
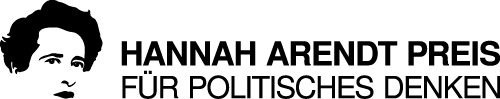

Serhiy Zhadan (born 1974) is a Ukrainian poet, writer, and singer in the rock band Zhadan i Sobaky. Raised in Donbas, the author studied literature in Kharkiv, where he now lives. His best-known works include the novels Mesopotamia, The Invention of Jazz in Donbass, and Internat, which have been translated into over twenty languages. Since the Russian invasion, he has been active as an activist, organizing aid supplies and performing with his band in shelters. His book Sky Over Kharkiv (2022) documents life during the war.

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Liebe Damen und Herren,
liebe UnterstützerInnen und FreundInnen des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«, liebe Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz, lieber Bastian Hermisson von der Heinrich-Böll-Stiftung, liebe Monika Tokarzewska, sehr geehrter Andrej Kurkow, verehrte europäische Mitbürgerinnen und Mitbürger der Ukraine, lieber und sehr geehrter Serhij Zhadan.
Ich darf Sie Im Namen des Vereins »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken« und im Namen des Vereinsvorstandes ganz herzlich zur diesjährigen Preisverleihung im Bremer Rathaussaal willkommen heißen. Wir danken der internationalen Jury dafür, dass sie sich in diesen finsteren und „dunklen Zeiten" übereinstimmend dazu entschieden hat, dem ukrainischen Dichter, Schriftsteller, Übersetzer, Aktivisten, Musiker und Sänger Serhij Zhadan den „Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken" zu überreichen. Die ermutigende, unbeugsame und widerständige Stimme des Preisträgers erklang bereits gestern Abend während eines im Rahmen der Preisverleihung hier in Bremen veranstalteten Konzerts mit seiner Band »Zhadan i Sobaky«, übersetzt: »Zhadan und die Hunde«. Von ZuschauerInnen oder KonzertbesucherInnen konnte kaum die Rede sein. Der Raum war vielmehr bis in alle Ecken gefüllt oder erfüllt von gemeinsam tanzenden, mit Serhij Zhadan mitsingenden, oder sich wechselseitig Solidarität spendender Menschen. Ein in jeglicher Hinsicht starkes und mitreißendes Konzert, für das wir uns bei der Band „Zhadan i Sobaky" an dieser Stelle ausdrücklich bedanken wollen. In Serhij Zhadans Buch Himmel über Charkiw findet sich der Satz: „Die Stimmen" waren „stark, selbstsicher … und [voller] Zorn."
Der diesjährige Preisträger ist im Donbas aufgewachsen und lebt in der ukrainischen Stadt Charkiw, die, wie so viele andere ukrainische Städte und Ortschaften, von den flächendeckenden und brutalen russischen Bombardements und Raketenbeschüssen, welche der ukrainischen Zivilbevölkerung gelten, heimgesucht wurde. Er hat in Charkiw in den 1990er-Jahren Literaturwissenschaft, Germanistik und Ukrainistik studiert und zum ukrainischen Futurismus promoviert. Die dortigen Universitäten, Bibliotheken und Theater sind ebenfalls einer andauernden Zerstörung ausgesetzt oder dieser bereits anheimgefallen. Sein vielseitiges literarisches Werk, seine preisgekrönten Romane, Erzählungen und Gedichtbände wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt. Serhij Zhadan ist mehrfach geehrt worden, unter anderem mit dem diesjährigen »Friedenspreis des Deutschen Buchhandels« sowie dem »Freiheitspreis der Frank-Schirrmacher-Stiftung«. Wir gratulieren Ihnen und freuen uns sehr darüber; nicht nur, weil es bedeutet, dass Ihre Stimme öffentlich gehört wird, sondern auch, weil die öffentlichen Ehrungen zugleich ermöglichen, dass wir für den ukrainischen Freiheits- und Widerstandskampf solidarisch und hellhörig bleiben. In dem jüngst erschienenen Buch Himmel über Charkiw. Nachrichten vom Überleben im Krieg, lesen, nein, erfahren wir von dem unermüdlichen und mutigen Engagement Serhij Zhadans, der innerhalb eines solidarischen Netzwerks Hilfsgüter organisiert und verteilt, oder benötigte Materialien wie schusssichere Westen, Wärmebildkameras etc. pp. an die Front bringt. Mit seiner Band „Zhadan i Sobaky" tritt er außerdem in Krankenhäusern und Metrostationen in Charkiw auf, in welchen die Menschen Schutz vor den russischen Angriffen suchen. Zudem richtet er nicht nur in Charkiw kulturelle Veranstaltungen aus. Die Liste ließe sich fortsetzen. Wir freuen uns sehr darüber, dass Ihre Stimme, lieber Serhij Zhadan, heute Abend öffentlich aufleuchtet. Nochmals herzlich willkommen!
Bei Hannah Arendt heißt es, dass »die Stimme der Dichter uns alle« angehe. Vielleicht stimmt es. Besonders stimmig aber klingen diese Worte mit Blick auf den heutigen Preisträger, der uns mit seinen Erzählungen, Gedichten, Texten und Reden nicht etwa dergestalt in die fürchterlichen Gräuel, den Terror und den Horror des Krieges hineinzwingt, dass wir angesichts des fürchterlichen Ausmaßes der Gewalt gleichsam verstummen, sondern der uns an den konkreten und unmittelbaren Wirklichkeitserfahrungen des Krieges, den Verletzungen, der Verzweiflung, dem Schmerz, den gebrochenen Wahrnehmungen und Realitätsverschiebungen, aber auch an dem mutigen, unbeugsamen und gelebten Zusammenhalt der ukrainischen BürgerInnen, teilhaben lässt. Und zwar so, dass die Kriegsrealität selbst erfahrbar, verständlich und aussprechbar wird, in unsere Alltagserfahrung einzudringen vermag, sich mit ihr verbindet. Vielleicht ja solcherart, »wie die Kunst« laut Zhadan »die Realität ergänzt, mit ihr verschmilzt, an sie heranwächst«. In diesem Sinne, der ein politischer ist, erscheinen die »Konturen der [geteilten] Wirklichkeit« als »Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten« oder wie die Namensgeberin des Preises es formuliert: »Das einzige, woran wir die Realität der Welt erkennen und messen können, ist, daß sie uns allen gemeinsam ist (…).« Wir bekommen eine Ahnung davon, wie sich die Denk-, Erfahrungs- und Sprachwege Serhij Zhadans und Hannah Arendts kreuzen beziehungsweise ineinander verwoben sind. In Serhij Zhadans Nachwort zu Himmel über Charkiw stehen die Worte: »[E]s geht um die Wirklichkeit selbst.«
Ich wünsche Ihnen und uns allen, liebe Anwesende, dass wir »an den Klippen der Wirklichkeit« nicht scheitern, sondern die seitens Serhij Zhadan sprachlich erbaute Brücke betreten, die ja immer auch eine Metapher für Verständigung ist und zur Wirklichkeit hinführen möchte. Vielleicht wird uns hierdurch klarer und deutlicher, dass der russische Angriffskrieg uns alle betrifft, unsere gemeinsam geteilte Welt und Freiheit.
Nach dieser Einstimmung, darf ich Sie nun mit dem weiteren Verlauf der heutigen Festveranstaltung und den weiteren Stimmen, die an diesem Abend zu hören sein werden, vertraut machen. Zunächst werden auch in diesem Jahr die VertreterInnen der beiden preisstiftenden Institutionen zu Wort kommen. Für den Senat der Freien Hansestadt Bremen wird stellvertretend zunächst die Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz sprechen, für die Heinrich-Böll-Stiftung Bastian Hermisson. Wir möchten den genannten Geldgebern, namentlich dem Bremer Senat sowie der Heinrich-Böll-Stiftung (Bund) und der Heinrich- Böll-Stiftung Bremen, die den »Hannah-Arendt-Preis« seit so vielen Jahren finanziell und ideell unterstützen, und auch das gestrige Ska-Punk-Konzert mitermöglichten, bei dieser Gelegenheit nochmals und ausdrücklich für ihre Unterstützung danken.
Im Anschluss an die Ansprachen der StifterInnen des Preises wird Monika Tokarzewska als Jurymitglied die Begründung der Preisvergabe vortragen. Es folgt dann die Laudatio auf Serhij Zhadan, die Andrej Kurkow halten wird. Wir sind froh, mit dem vielfach ausgezeichneten und bedeutenden ukrainischen Schriftsteller und, unter anderem, Drehbuchautoren Andrej Kurkow eine weitere wichtige Stimme aus der Ukraine hier in Bremen begrüßen zu dürfen. Zahlreiche seiner in wirklich vielen Sprachen übersetzten Bücher haben auch hierzulande Berühmtheit erlangt. Am vergangenen Montag wurde Andrej Kurkow in München mit dem »Geschwister-Scholl-Preis« für sein Buch Tagebuch einer Invasion ausgezeichnet. Seine diesbezüglich gehaltene, ich zitiere, »bewegende Rede«, ist auf eine breite öffentliche Resonanz gestoßen. Schön, dass Sie hier sind! Anschließend an Andrej Kurkows Laudatio hören wir die Festrede Serhij Zhadans. Danach klingt der Abend mit der öffentlichen Preisübergabe hier und einem gemeinsamen Sektempfang im Nachbarsaal aus. Damit überreiche ich nun das Wort an Carmen Emigholz. Danach spricht, wie gesagt, Bastian Hermisson im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung. Anschließend erfolgt die Jurybegründung von Monika Tokarzewska, schließlich die Laudatio Andrej Kurkows sowie die Festrede Serhij Zhadans.
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Zhadan, liebe Mitglieder der Jury, lieber Herr Kurkow, verehrte Gäste, ich leite die Europa-Arbeit bei der Heinrich-Böll-Stiftung und gratuliere herzlich dem diesjährigen Preisträger des Hannah-Arendt-Preises, Serhij Zhadan.
Diese Entscheidung der Jury ist ein großer Glücksfall. Die Lyrik, die Erzählungen von Herrn Zhadan sind auf mindestens drei Ebenen bedeutsam. Sie haben eine gewaltige poetische Kraft. Sie vermitteln uns einen Eindruck vom Leben in der Ukraine, von der postsowjetischen Transitionszeit bis zum Leben inmitten des russischen Angriffskrieges, der seit 2014 (und eben nicht erst seit diesem Jahr) das Land und das Leben der Menschen prägt. Und sie transportieren tiefgehende menschliche Erfahrungen, von Schmerz, von Mut und von Hoffnung.
Das Werk von Herrn Zhadan ist daher auch von großer politischer Kraft und Relevanz, und es ist nicht von ungefähr, dass er politisches Engagement und Kunst in seinem Wirken vereint. Das ist umso bedeutender in dieser historischen Situation, für die Ukraine, und für Europa.
Die Europäische Union fußt auf drei zentralen Versprechen. Europa soll ein Raum des Friedens, des Wohlstands und der Freiheit sein. Der russische Angriffskrieg, dieser brutale Krieg gegen die ukrainische Zivilbevölkerung, ist auch ein Angriff auf diese Grundfesten Europas. Der Krieg stellt die europäische Friedensordnung fundamental infrage. Russland versucht, Europa wirtschaftlich zu schwächen und zu spalten. Und es greift die Freiheit selbst an, die liberale Demokratie als politisches System, um das Recht des Stärkeren durchzusetzen anstatt der Stärke des Rechts.
Die Leidtragenden dieses Krieges aber sind nicht wir in der Europäischen Union, sondern die Menschen in der Ukraine, die im wahrsten Sinne des Wortes um ihre Existenz kämpfen und sich dem russischen Vernichtungskrieg mit unglaublich viel Mut, Kraft und Gemeinsinn entgegenstellen.
Wir haben als Deutsche eine besondere Verantwortung für die Ukraine aufgrund der grausamen Verbrechen, die wir im Zweiten Weltkrieg dort verübt haben. Und wir haben eine besondere Verantwortung aufgrund unserer gescheiterten Ostpolitik der letzten Jahrzehnte, welche die zentralen Interessen unserer östlichen Nachbarn sträflich negierte.
Es geht jetzt darum, die Ukraine zu stützen und zu stärken. Das Ziel ist nicht nur ein militärischer Erfolg der Ukraine, sondern auch, das Versprechen Europas für Frieden, Wohlstand und Freiheit, in der Ukraine einzulösen. Denn es gibt in dieser Zeit keinen europäischeren Ort als die Ukraine.
Serhij Zhadan hat auch hierzu wichtige Worte gefunden. Und auch dies macht ihn zu einem würdigen und wichtigen Preisträger des Hannah-Arendt-Preises.
Ich will schließen mit einem Zitat von Hannah Arendt aus einem Briefwechsel mit dem Philosophen Gershom Sholem: »Ich bin in der Tat heute der Meinung, dass das Böse immer nur extrem ist, aber niemals radikal, es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. Tief aber, und radikal ist immer nur das Gute.«
Vielen Dank.
Bastian Hermisson leitet seit August 2022 das Referat EU/NA der Heinrich-Böll-Stiftung. Von 2015 bis 2022 leitete er das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington
»Abends ist Charkiw ganz still und leer. Der Sommer, wenn auch eher kalt als warm, hat sich in den Straßen ausgebreitet. Der Himmel über der Stadt ist groß und geheimnisvoll.« –Diese drei Sätze stammen aus Serhij Zhadans jüngstem auf Deutsch erschienenen Buch Himmel über Charkiw, einer Art Tagebuch: verfasst als eine Reihe von kurzen Einträgen, kaum einer davon länger als eine halbe Seite; manchmal besteht ein Eintrag aus nur einem Satz. Die Kürze erklärt sich durch die Entstehungsumstände: es handelt sich hier – wie man auf dem Buchumschlag liest– um eine Art provisorische Charkiwer Chronik zwischen Februar und Juni 2022, um tägliche Nachrichtenaufzeichnungen mitten aus dem Krieg, gesehen mit den Augen eines Zivilisten, der seine Heimatstadt in steter Bedrohung durch russische Raketen und in einem Zustand, in dem Zerstörung zum Alltag wird, erlebt. Die Einträge wurden ursprünglich in den sozialen Medien gepostet. Sie fühlen sich als Buch eigentlich ihrem natürlichen Element entzogen, denn sie sind auf Konkretes, auf täglich eintretende Nöte und Aktivitäten bezogen. Und sie sind schlicht. Zitat: „Am Nachmittag war es im Stadtzentrum still und ruhig. Der totale Kontrast zu den Nachrichten über den Beschuss der Postfiliale und des Einkaufszentrums." Ist das noch Literatur oder ist das bloß eine Nachricht? Es ist diesen Einträgen zu entnehmen, dass sie nicht als stilles Selbstgespräch und nicht als einschneidende Wirklichkeitsanalyse entstanden sind, sondern, um Zeugnis vom Mut der Charkiwer abzulegen, wie auch um Mut und Hoffnung einzuflößen:
Wir haben in der Jury dieses jüngste Buch noch nicht kennen können, als wir im Frühling dieses Jahres über die Wahl eines Preisträgers bzw. einer Preisträgerin diskutierten. Die Wahl war schwierig, weil einige hervorragende Kandidatinnen und Kandidaten in Frage kamen. Dass wir nach dem 24. Februar 2022 die Ukraine in den Blick nehmen werden, war uns allen sofort klar – sonst wäre das kein Preis im Sinne von Hannah Arendt gewesen, die das ‚Sich-einschalten' als unabdingbare politische Haltung ansah. Serhij Zhadans Prosa in den Büchern Mesopotamien, Die Erfindung des Jazz in Donbass oder Internat haben uns durch ihre lebensnahe und zugleich sehr kunstvolle Sprache überzeugt. Diese Sprache hat eine tiefe Verbundenheit mit dem Gebiet, aus dem Zhadan stammt. Sie sucht die Menschen der Ukraine und ihr Leben unter harten Umständen und an den Scheidewegen der gewaltreichen Geschichte zwischen postsowjetischer Ära und der vielfältigen Identität des seit 30 Jahren unabhängigen Staates, zu beschreiben. Die Gewalt, die laut Hannah Arendt stumm ist, wird hier in den kleinsten, alltäglichen Dimensionen greifbar. Sie wird aber stets durch die Durchhaltekraft, den Einfallsreichtum oder einfach blindes Glück gebrochen. Die Helden dieser Prosa sind einfache, durchschnittliche Menschen in ihrer Undurchschnittlichkeit. Sie alle haben sehr konkrete Gesichter. Sie kämpfen sich manchmal mit einer bewundernswerten quasi-kriminellen Energie durch. Es hat uns angesprochen, wie die Sprache Zhadans sich diesen in ihrem Existenzkampf und in aller Verzweiflung trotzenden Lebenslust begriffenen Menschen nähert, ohne sentimental zu sein. Zugleich hat diese Sprache etwas Poetisches: hie und da eine originelle Metapher, eine Sprache, in der Prosa oft fließend in Gedichte übergeht. Es sind Geschichten von unten erzählt, sie zeigen auf greifbare Weise die Wirklichkeit eines Landes, das sich einem Krieg ausgesetzt sieht, der aber zumeist im Hintergrund bleibt. „Politik tötet" – erklärt jemand in Zhadans Buch Geschichte und Prosa aus dem Krieg aus dem Jahre 2015. Die Menschen in seinen Erzählungen sind aber keine hin und her geworfenen hilflosen Opfer der Umstände. Sie nehmen Stellung zu dem, was auf sie zukommt – so gut oder so schlecht, wie sie nur imstande sind. Manchmal werden diese Menschen zu wahren Helden, wie der Boxer Marat, der mitten in der Nacht in Charkiw Zigaretten kaufen ging und erschossen wurde, weil er sich spontan mit nackten Fäusten für eine unbekannte, überfallene Frau zur Wehr setzte. Hannah Arendt betonte die Bedeutung des Geschichtenerzählens für die Möglichkeit jeder Politik, indem sie den Taten und Worten der handelnden Menschen auch die Notwendigkeit des Erzählers zugesellte. Denn ohne einen solchen wären weder Taten noch Worte von Dauer. So gab es zum Glück jemanden, der die Geschichte des Boxers Marat erzählen konnte.
Die Jury hat Serhij Zhadan auch als jemand ehren wollen, der sich seit den ersten Tagen des Kriegs für die Menschen im Krieg engagiert. Dieses unermüdliche Engagement reicht von der Verteilung von Lebensmitteln und der Evakuierung der Bedrohten bis hin zu den Konzerten, die er mit seiner Band gibt.
Es ist trotzdem nicht selbstverständlich, dass ein Schriftsteller, Dichter und Rocksänger ausgerechnet einen Preis für politisches Denken erhält. Literatur und Politik – das ist keine einfache Beziehung. Es wäre naiv, an Unschuld der Literatur und Kultur der Macht gegenüber zu glauben – nur, weil Kunst von Zeit zu Zeit subversiv und zum Ausdruck von Widerstand wird. Die ästhetische Kraft ist ein zweischneidiges Schwert. Der polnische Dichter Zbigniew Herbert verfasste einmal ein Gedicht über Belzebub und die Künstler. »Belzebub liebt die Kunst und prahlt, dass seine Chöre, seine Dichter und seine Maler in Kürze die himmlischen übertreffen werden. Wer die bessere Kunst hat, hat die bessere Regierung, das ist klar.« Deshalb sichert in Herberts Parabel Belzebub seinen Künstlern »Ruhe, gute Verpflegung und gänzliche Abschottung vom höllischen Leben.«
Literatur und Krieg ist ein nicht minder schwieriges Paar. Ihre gegenseitige Beziehung hat zwar etwas zu tun mit den Anfängen der Erzählkunst überhaupt – Homers Muse sollte den Zorn Achills besingen. Zugleich besagt aber ein lateinisches Zitat, dass die Musen schweigen, wenn die Waffen sprechen.
Es sei hier zum Schluss noch einmal kurz auf das jüngste Buch Zhadans erinnert: auf die Tagesnachrichten aus dem existentiell bedrohtem Charkiw. Zwischen der kunstvollen Sprache in Mesopotamien und der Schlichtheit der Einträge hier spannt sich die Beziehung zwischen Krieg und Literatur in seiner ganzen Breite aus. Einer der Einträge besteht bloß aus einer Liste von Gegenständen, die zur Versorgung der Zivilisten und der Soldaten gekauft wurden: »Kettensägen, Drohnen, Taschenlampen, Unterhosen.« Ist das Literatur? An die Grenzen gelangt die Sprache hier allerdings nicht als Stottern, das heißt nicht als Ausdruck eines Traumas, so dass einem die Sprache verschlägt. Die Grenze der Sprache ist eben ihre Schlichtheit. Ein Gedicht vortragen gehört mitten unter tägliche Hilfsaktionen einfach dazu. „Wir haben Gedichte vorgetragen und ein Teleskop mitgebracht, damit die Kinder den Mond betrachten können."
Es ist nicht ungefährlich sich an der Grenze zu bewegen – es fühlt sich ein bisschen an wie auf einem hochaufgespannten Seil zu spazieren. Dieses Schreiben in einer Grenzsituation legt jedoch etwas ganz Elementares frei. Unaufdringlich wird hier an unerwarteten Stellen doch Literatur geboren: ganz ursprünglich als Rhythmus. Er entsteht aus dem Festhalten am Alltag, daraus, dass das Café nach dem Einschlag doch wieder öffnet und daraus, dass die Kinder, die in den Kellern der Metro hausieren, mal wieder spielen können.
Die Jury hatte bei ihrer Entscheidung, Serhij Zhadan mit dem Hannah Arendt Preis für Politisches Denken zu ehren, die Tatsache vor Augen gehabt, dass sich die Ukraine in einem Vernichtungskrieg befindet. Es ist aber auch völlig im Sinne Serhij Zhadans, eine Bewunderung für die Lebens- und Überlebenskraft der Ukrainer auszusprechen, die sie jeden Tag beweisen, und für ihre Hoffnung.
Der Himmel über Charkiw ist meist sonnig und klar, er kann aber auch auf geheimnisvolle Weise poetisch sein: »Der Himmel ist still wie eine Klinik / aus der Patienten evakuiert wurden. / Jemand hat die Schichten der Luft geöffnet.« Blicke zum Himmel kehren bei Zhadan wie ein Leitmotiv wieder. Sie sind keine Blicke ins Jenseits. Sie sind Blicke zum Einfachen und Grundlegenden, das wie selbstverständlich sich immer wieder erneuert. Im Anschluss an den Himmel über Charkiw kann man vielleicht am besten jene Ballade von Bertolt Brecht zitieren, die Hannah Arendt für so wichtig hielt, dass sie diese Strophen ihrem grundlegenden Buch über die Bedingungen politischen Handelns: Vita activa - als Motto vorangestellt hatte:
Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal
War der Himmel schon so groß und still und fahl
Jung und nackt und ungeheuer wundersam
Wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam
Als im dunklen Erdgeschoße faulte Baal
War der Himmel noch so groß und still und fahl
Jung und nackt und ungeheuer wunderbar
Wie ihn Baal einst liebte, als Baal war.
Monika Tokarzewska ist Assistentin am Lehrstuhl für Germanistik an der Nikolaus Kopernikus-Universität Toruń/Polen und Mitglied der internationalen Jury des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken e.V.
Die Stimme von Serhij Zhadan kann heute nicht von der Stimme der Ukraine getrennt werden. Und das, obwohl er für sich selbst spricht und nicht für die Regierung oder das ganze Land. Er sagte und sagt immer, was er denkt. Er ist kein Politiker und es ist ihm egal, ob ihn die Leute mögen oder nicht. Ob sie bereit sind, seine Gedanken und Appelle anzunehmen oder nicht, das ist ihre Sache, es ist ihre Wahl, das ist schließlich ihr Recht. Aber die Ukrainer hören auf das, was Serhij Zhadan sagt. Hören seine Poesie und seine Lieder.
Und es ist nicht einmal so, dass er nicht in Slogans und Zitaten spricht. Er ist ein Dichter. Er spricht Zuhörer und Leser auf einer anderen Ebene an. Auf der Ebene, wo Worte zu Empfindungen und Bildern werden. Und auch wenn man sich an diese Worte nicht erinnert, bleiben sie mit einer besonderen Wärme, einem besonderen Klang in der Seele.
Er wird gehört. Er wird gesehen und gehört, weil er sich nirgendwo versteckt, nicht in seinem Büro sitzt. Er steht nicht am Ufer eines lärmenden Ozeans und sendet seine Botschaften entlang seiner Wellen in einer verkorkten Flasche, ohne zu wissen, wem und wann diese Botschaft in die Hände fallen wird. Er spricht direkt in die Augen, in die Ohren, in die Seelen seiner Mitbürger.
Serhij Zhadan ist die Stimme von Donbass, die Stimme von Charkiw und die Stimme der gesamten jungen Ukraine, der Ukraine von heute und der Ukraine der Zukunft.
Ich hatte das Glück, Serhij Zhadan seit zwanzig langen Jahren zu kennen und zu hören. In all den Jahren hat er sich nie verraten, seine Ansichten und Prinzipien nicht geändert. Seine Ansichten, wie seine Poesie, wie seine Prosa, veränderten sich, entwickelten sich weiter, kehrten sich aber nie um. Er wuchs allmählich wie ein langlebiger Baum. Er stieg auf und wurde immer sichtbarer, zuerst auf der ukrainischen und dann auf der Weltliteraturszene. Und so kam es, dass sein Heranwachsen als Dichter und als Bürger in die schwierigste Zeit der unabhängigen Ukraine fiel, zu einer Zeit, als die Existenz der Ukraine als unabhängiger Staat von Russland in Frage gestellt wurde.
Kann ein Dichter ein Land retten? Kann Literatur während des grausamsten Zerstörungskrieges überhaupt eine Rolle spielen, wenn Bibliotheken mit Büchern unter dem Beschuss russischer Artillerie brennen, Theater und Universitäten von Raketen zerstört werden, wenn Nichtmenschen in russischen Militäruniformen Dichter und Übersetzer erschießen, wie es bei dem Dichter Volodymyr Vakulenko bei Izyum oder mit einem Übersetzer aus dem Altgriechischen, Universitätsprofessor Oleksandr Kislyuk in Bucha bei Kiew passierte?
Die Geschichte des Landes, seine Biographie wird von den Stimmen der Dichter und Schriftsteller geschrieben. Es sind diese Stimmen, die die tragischsten Ereignisse beeinflussen können und sollten. Diese Stimmen werden zu Erinnerungen und Büchern. Diese Stimmen helfen den Menschen, die schwierigste Zeit zu überstehen, den Mut nicht zu verlieren, sich auch nach den schwersten Schlägen vom Boden zu erheben.
Die bürgerliche und menschliche Energie von Serhij Zhadans Poesie kann diejenigen, die sie hören, nur erfreuen, sie anregen. In dieser Zeit, in der die Hälfte der Ukraine ohne Licht und Wärme lebt, strahlen die Worte und Gedanken von Serhiy Zhadan sowohl Licht als auch Wärme aus und geben Hoffnung.
In dieser Zeit, in der die Ukraine jeden Tag ihre von Russland getöteten Bürger beerdigt, tröstet die Stimme von Serhij Zhadan die Trauernden und gibt ihnen Kraft. In dieser Zeit, in der die Ukrainer in den besetzten Gebieten deprimiert sind und den Glauben an die Zukunft verlieren, stellen Serhiy Zhadans Gedichte und sein bürgerschaftliches Engagement ihren Glauben wieder her und verleihen ihnen Geduld, um auf die Befreiung ihrer Heimatstädte und -dörfer zu warten.
Auch Serhij Zhadans Heimatstadt Starobilsk in der Region Luhansk ist besetzt. Dort verbrachte Serhij seine Kindheit und Jugend, bevor er nach Charkiw zum Studium ging. Dort begann Serhij Zhadan, Gedichte zu schreiben, begann, das Leben mit den Augen eines Schriftstellers zu betrachten.
Seit dieser Zeit hat Serhij Zhadan zwei kleine Heimatländer: Starobilsk und Charkiw, eines erobert, das andere Widerstand leistend und frei.
Es war 2014 in Charkiw, als Serhij Zhadan auf den Svoboda-Platz im Stadtzentrum zog, um die Freiheit der Ukraine zu verteidigen. Dann kamen Dutzende von Bussen mit Militanten aus Russland in die Stadt, um einen antiukrainischen Putsch durchzuführen, um Charkiw zu einem Teil Russlands zu erklären. Und zwei Dutzend Kharkov-Aktivisten, Dichter und Intellektuelle traten gegen Hunderte russische Militante auf. Einschließlich Serhij Zhadan. Sie wurden geschlagen, aber sie knieten nicht. Sie hielten furchtlos durch und gaben ihrer Heimatstadt ein Beispiel dafür, wie sie ihre Ansichten, ihre Straßen, ihre Häuser und ihre Familien verteidigen können.
Ich sehe einen direkten Zusammenhang zwischen dem, was 2014 in Charkiw passiert ist, und dem, was jetzt in Charkiw passiert, wo die russische Armee seit neun Monaten versucht, es einzunehmen. Sie versucht es, aber sie kann es nicht.
Deshalb versucht Russland seit neun Monaten, die Stadt mit Raketen und Artillerie zu zerstören, versucht, sie ohne Wärme, Wasser und Licht zu lassen, und versucht, alles, was darin lebt, zu töten. Aber Charkiv kniet nicht, genauso wie Sergei Zhadan nicht kniete. Ja, Charkiw begräbt jeden Tag seine Toten. Aber jeden Tag verteidigt sich die Stadt gegen den Feind und gibt nicht auf. Darüber hinaus hat die Stadt ein aktives kulturelles und literarisches Leben, ein wichtiger Teil davon ist Serhij Zhadan.
Seit Kriegsbeginn hat sich dieses Leben in Luftschutzbunker und auf die Bahnsteige von U-Bahn-Stationen verlagert. Aber gleichzeitig wurde es kein "Underground". Im Gegenteil, das kulturelle Leben der Stadt wird immer mehr zur Masse, wird aber gleichzeitig nicht zum „Mainstream". Literatur, Musik, die ukrainische Kultur im Allgemeinen wurde zu einer Waffe des Widerstands. Poesie ist zu Sauerstoff geworden. Die Ukrainer hören eifrig Serhiy Zhadans Poesie zu, gefüllt mit warmen, hellen, schmerzhaft vertrauten Bildern, aber geschrieben mit scharfen und durchdringenden Worten wie eine Kugel.
Gleichzeitig ist das Schreiben von Gedichten und Prosa seit vielen Jahren nicht mehr die Hauptbeschäftigung von Serhij Zhadan. Er ist ohne Zweifel einer der aktivsten Freiwilligen, der jede Stunde seines Lebens der Ukraine und dem zukünftigen Sieg der Ukraine über den russischen Aggressor widmet. Er beteiligt sich erfolgreich an der Beschaffung von Spenden für die Verwundeten und die Familien der Toten, er hilft der ukrainischen Armee und der vom Krieg betroffenen ukrainischen Zivilbevölkerung. Und er nutzt jede freie Minute, um die Ukrainer mit seiner Poesie, seiner Musik, seiner kraftvollen Stimme zu unterstützen. Seine öffentlichen Poesieabende finden im In- und Ausland statt. Er verwendet das gesamte Geld, das er aus dem Ticketverkauf erhält, für seine ehrenamtlichen Aktivitäten, für das ukrainische Volk. Er selbst ist für viele, insbesondere für junge Ukrainer, bereits zum Symbol der Unabhängigkeit und Freiheit geworden. Politisch unabhängig hat er immer gesagt, was er über ukrainische Politiker denkt. Politische Ambitionen hatte und hat er nicht, obwohl ihn jede Partei gerne auf ihre Kandidatenliste für das Parlament setzen würde. Sein einziges Ziel ist es, ein würdiger Bürger seines Landes zu sein. Und dieses Ziel hat er erreicht, auch wenn er es sich nicht gesetzt hat.
Serhij Zhadan ist ein würdiger Bürger der Ukraine, ein würdiger Dichter der Ukraine und der Welt. Die Wahrheit spricht heute in seiner Stimme. Das Gewissen spricht heute mit seiner Stimme. Seine Stimme, seine Poesie erinnern jeden von uns an den Wert des menschlichen Lebens, Liebe, Hoffnung, dass jeder von uns auch eine Stimme hat und wir kein Recht haben zu schweigen, wenn wir Böses, Ungerechtigkeit, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sehen!
Ich freue mich über diese Gelegenheit, Serhij Zhadan und Ihnen allen zu sagen, dass ich dank der Kraft von Serhijs Stimme an den Sieg des Guten über das Böse glaube, ich glaube an den Sieg der Ukraine über Putins Russland, ich glaube an den Sieg der europäischen Werte und der Demokratie über die dunklen Mächte des Mittelalters, die versuchen, uns allen die Idee ihrer Unbesiegbarkeit aufzuzwingen.
Liebe Freunde,
ich möchte, dass wir heute im Namen all jener Menschen sprechen, die derzeit mit einem außergewöhnlich schmerzhaften zeitlichen Bruch konfrontiert sind. Ich möchte heute über Zeit sprechen als ein Segment unserer Existenz, als die Folie, auf der sich unsere Überzeugungen und Ansichten – vor allem die politischen – herausbilden, formen und wandeln. Wir alle befinden uns in einem Zeitstrom, mitten in einem System von Zeichen und Begriffen. In vielerlei Hinsicht sind wir von der Zeit abhängig. Wir sind von ihr abhängig, aber nicht in ihr gefangen. Zumindest nicht, solange wir die Kraft aufbringen, die Zeit zu bezeugen.
Was meine ich damit? Wir alle entfernen uns immer weiter von dem Schatten, den das 20. Jahrhundert geworfen hat. Der persönliche Bezug zu diesem Jahrhundert der furchtbaren Völkermorde und Weltkriege scheint uns immer mehr verloren zu gehen. Es gibt nur noch wenige Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges und auch des Kalten Krieges. Die Erfahrung der persönlichen Angst beim Lesen der morgendlichen Nachrichten wird allmählich ersetzt durch eine Erfahrung der Reflexion, des Abstandes und des erworbenen Wissens. Der tiefe Schmerz unserer Großeltern, die das Gemetzel des Zweiten Weltkrieges miterlebt haben und diese Erfahrung – widerwillig – ihren Kindern und Enkeln weitergaben, vermittelt sich nun unseren Kindern in Form von tragischen, grausamen, schmerzhaften, aber eben doch: Geschichten.
Wer Geschichte nicht persönlich erlebt hat, zieht daraus nur selten Lehren. Wenn die Lehren übergangen werden, verliert die Geschichte ihr Potenzial für Entwicklung und Fortschritt.
Ich wurde 1974 geboren. Mein Vater 1945 – er galt als »Kriegskind«. Meine Großmutter, die mich aufgezogen hat und mit der Sowjetarmee bis nach Berlin gekommen war, starb 1982. Ich kann mich nicht mehr an ihre Erzählungen erinnern. Meine Eltern hatten nichts vom Krieg zu berichten, weil sie noch zu jung waren. Ich hatte also keinen direkten Bezug zum Krieg – was auch so bleiben sollte. Denn ich wurde genau in dem Zeitfenster geboren, in dem der Krieg beschloss, eine Generation auszulassen.
Langsam, aber kontinuierlich bauten wir unsere eigene Welt auf. Zwischenzeitlich schien es, als meine es die Zeit gut mit uns. Als schenke sie uns den – aus Sicht unserer Eltern und Großeltern – unfassbaren Luxus, von Kriegen verschont zu bleiben.
All das änderte sich 2014. Plötzlich tauchten auf unserem Territorium bewaffnete russländische Kräfte auf. Sie kamen zuerst auf die Krim und drangen dann in den Osten des Landes ein. Der Krieg begann – ein Krieg, den die Welt lange Zeit nicht wahrhaben wollte. Am 24. Februar dieses Jahres startete Russland eine Großoffensive, die man nicht länger ignorieren konnte. Was blieb, war das Eingeständnis, dass die bisher gültige Ordnung des europäischen Lebens in Trümmern liegt. Europa hat eine neue Kriegsgeneration.
Wir müssen feststellen, dass das Niederreißen eines jeden eisernen Vorhangs ein kontinuierlicher Prozess ist. Mauern haben die Fähigkeit, wieder neu zu wachsen. Totalitarismus entfaltet sich dort, wo er ignoriert wird. Revanchismus ist eine Krankheit, an der immer noch ganze Gesellschaften leiden. Wir Ukrainer bekommen heute die alten Traumata der Politik des 20. Jahrhunderts zu spüren. Während wir versuchten, unser eigenes Wirklichkeitsgerüst zu errichten, fällt das Imperium, von dem wir uns zu lösen suchten, zurück in die Vergangenheit.
Russland klammert sich an eine Vergangenheit, die für es selbst zur Falle geworden ist. Zwanzig Jahre Propaganda, Indoktrination und sowjetischer Nostalgie haben einen neuen Krieg vorbereitet. Der Kreis der Geschichte schließt sich – und wieder missachtet Russland fremde Grenzen.
Allerdings sind dieses Mal wir, die Ukrainer, das Ziel. Während für uns die Entwicklung vorhersehbar war, fragt sich der Rest der Welt nun: Wie konnte es dazu kommen? Warum hat niemand den Aggressor aufgehalten?
Offensichtlich ist weder der Triumph der Gerechtigkeit noch die Niederlage des Bösen etwas Endgültiges. Wir unterschätzen die Fähigkeit des Bösen zur Selbstregeneration. Das Böse, so wie Hannah Arendt schrieb, ist banal – konstant, strukturell, unabhängig vom technischen oder sozialen Fortschritt.
Die russländische Gesellschaft unterstützt mehrheitlich die Rhetorik und das Verhalten ihres Staates. Ohne diese Loyalität gäbe es keinen Totalitarismus. Und das ist eine Lehre des 20. Jahrhunderts, die wir nicht ausreichend beachtet haben.
Warum hat die Welt acht Jahre gebraucht, um die Dinge beim Namen zu nennen? Warum sind Ethik und Moral in Politik, Wirtschaft und Medien so vage und verhandelbar? Und vor allem – sind das alles nur rhetorische Fragen, oder sind wir bereit, sie wirklich zu stellen?
Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Er eskaliert. Die Besatzer zerstören Städte, Infrastruktur und Wohnviertel. Die Ukraine verteidigt sich – und braucht Hilfe. Aber auch die Welt braucht Schutz. Denn ihr Sicherheitssystem und ihr Wertesystem haben sich als fragil erwiesen. Die Krise wird nicht mit der Niederlage Russlands verschwinden.
Das 21. Jahrhundert hat bereits gezeigt, wie schnell das Böse zurückkehrt, wenn man es ignoriert.
Ich danke Ihnen für diese Möglichkeit – die Möglichkeit, schmerzhafte Fragen zu formulieren und darauf zu hoffen, dass sie gehört werden. Wenn wir heute um unsere Zukunft kämpfen, dann nur im Bewusstsein der Vergangenheit. Wir alle sind miteinander verbunden – in dieser Zeit, in diesem Raum. Und wir füllen die Luft mit unseren Stimmen. Jede Stimme ist wichtig. Jeder Atemzug ist wichtig. Wenn wir verstummen, fühlt sich das Böse sicherer. Das ist ein weiterer Grund zu reden – und zuzuhören.
Aus dem Ukrainischen von Claudia Dathe.
Serhiy Zhadan (born 1974) is a Ukrainian poet, writer, and singer in the rock band Zhadan i Sobaky. Raised in Donbas, the author studied literature in Kharkiv, where he now lives. His best-known works include the novels Mesopotamia, The Invention of Jazz in Donbass, and Internat, which have been translated into over twenty languages. Since the Russian invasion, he has been active as an activist, organizing aid supplies and performing with his band in shelters. His book Sky Over Kharkiv (2022) documents life during the war.

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Liebe Damen und Herren,
liebe UnterstützerInnen und FreundInnen des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«, liebe Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz, lieber Bastian Hermisson von der Heinrich-Böll-Stiftung, liebe Monika Tokarzewska, sehr geehrter Andrej Kurkow, verehrte europäische Mitbürgerinnen und Mitbürger der Ukraine, lieber und sehr geehrter Serhij Zhadan.
Ich darf Sie Im Namen des Vereins »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken« und im Namen des Vereinsvorstandes ganz herzlich zur diesjährigen Preisverleihung im Bremer Rathaussaal willkommen heißen. Wir danken der internationalen Jury dafür, dass sie sich in diesen finsteren und „dunklen Zeiten" übereinstimmend dazu entschieden hat, dem ukrainischen Dichter, Schriftsteller, Übersetzer, Aktivisten, Musiker und Sänger Serhij Zhadan den „Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken" zu überreichen. Die ermutigende, unbeugsame und widerständige Stimme des Preisträgers erklang bereits gestern Abend während eines im Rahmen der Preisverleihung hier in Bremen veranstalteten Konzerts mit seiner Band »Zhadan i Sobaky«, übersetzt: »Zhadan und die Hunde«. Von ZuschauerInnen oder KonzertbesucherInnen konnte kaum die Rede sein. Der Raum war vielmehr bis in alle Ecken gefüllt oder erfüllt von gemeinsam tanzenden, mit Serhij Zhadan mitsingenden, oder sich wechselseitig Solidarität spendender Menschen. Ein in jeglicher Hinsicht starkes und mitreißendes Konzert, für das wir uns bei der Band „Zhadan i Sobaky" an dieser Stelle ausdrücklich bedanken wollen. In Serhij Zhadans Buch Himmel über Charkiw findet sich der Satz: „Die Stimmen" waren „stark, selbstsicher … und [voller] Zorn."
Der diesjährige Preisträger ist im Donbas aufgewachsen und lebt in der ukrainischen Stadt Charkiw, die, wie so viele andere ukrainische Städte und Ortschaften, von den flächendeckenden und brutalen russischen Bombardements und Raketenbeschüssen, welche der ukrainischen Zivilbevölkerung gelten, heimgesucht wurde. Er hat in Charkiw in den 1990er-Jahren Literaturwissenschaft, Germanistik und Ukrainistik studiert und zum ukrainischen Futurismus promoviert. Die dortigen Universitäten, Bibliotheken und Theater sind ebenfalls einer andauernden Zerstörung ausgesetzt oder dieser bereits anheimgefallen. Sein vielseitiges literarisches Werk, seine preisgekrönten Romane, Erzählungen und Gedichtbände wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt. Serhij Zhadan ist mehrfach geehrt worden, unter anderem mit dem diesjährigen »Friedenspreis des Deutschen Buchhandels« sowie dem »Freiheitspreis der Frank-Schirrmacher-Stiftung«. Wir gratulieren Ihnen und freuen uns sehr darüber; nicht nur, weil es bedeutet, dass Ihre Stimme öffentlich gehört wird, sondern auch, weil die öffentlichen Ehrungen zugleich ermöglichen, dass wir für den ukrainischen Freiheits- und Widerstandskampf solidarisch und hellhörig bleiben. In dem jüngst erschienenen Buch Himmel über Charkiw. Nachrichten vom Überleben im Krieg, lesen, nein, erfahren wir von dem unermüdlichen und mutigen Engagement Serhij Zhadans, der innerhalb eines solidarischen Netzwerks Hilfsgüter organisiert und verteilt, oder benötigte Materialien wie schusssichere Westen, Wärmebildkameras etc. pp. an die Front bringt. Mit seiner Band „Zhadan i Sobaky" tritt er außerdem in Krankenhäusern und Metrostationen in Charkiw auf, in welchen die Menschen Schutz vor den russischen Angriffen suchen. Zudem richtet er nicht nur in Charkiw kulturelle Veranstaltungen aus. Die Liste ließe sich fortsetzen. Wir freuen uns sehr darüber, dass Ihre Stimme, lieber Serhij Zhadan, heute Abend öffentlich aufleuchtet. Nochmals herzlich willkommen!
Bei Hannah Arendt heißt es, dass »die Stimme der Dichter uns alle« angehe. Vielleicht stimmt es. Besonders stimmig aber klingen diese Worte mit Blick auf den heutigen Preisträger, der uns mit seinen Erzählungen, Gedichten, Texten und Reden nicht etwa dergestalt in die fürchterlichen Gräuel, den Terror und den Horror des Krieges hineinzwingt, dass wir angesichts des fürchterlichen Ausmaßes der Gewalt gleichsam verstummen, sondern der uns an den konkreten und unmittelbaren Wirklichkeitserfahrungen des Krieges, den Verletzungen, der Verzweiflung, dem Schmerz, den gebrochenen Wahrnehmungen und Realitätsverschiebungen, aber auch an dem mutigen, unbeugsamen und gelebten Zusammenhalt der ukrainischen BürgerInnen, teilhaben lässt. Und zwar so, dass die Kriegsrealität selbst erfahrbar, verständlich und aussprechbar wird, in unsere Alltagserfahrung einzudringen vermag, sich mit ihr verbindet. Vielleicht ja solcherart, »wie die Kunst« laut Zhadan »die Realität ergänzt, mit ihr verschmilzt, an sie heranwächst«. In diesem Sinne, der ein politischer ist, erscheinen die »Konturen der [geteilten] Wirklichkeit« als »Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten« oder wie die Namensgeberin des Preises es formuliert: »Das einzige, woran wir die Realität der Welt erkennen und messen können, ist, daß sie uns allen gemeinsam ist (…).« Wir bekommen eine Ahnung davon, wie sich die Denk-, Erfahrungs- und Sprachwege Serhij Zhadans und Hannah Arendts kreuzen beziehungsweise ineinander verwoben sind. In Serhij Zhadans Nachwort zu Himmel über Charkiw stehen die Worte: »[E]s geht um die Wirklichkeit selbst.«
Ich wünsche Ihnen und uns allen, liebe Anwesende, dass wir »an den Klippen der Wirklichkeit« nicht scheitern, sondern die seitens Serhij Zhadan sprachlich erbaute Brücke betreten, die ja immer auch eine Metapher für Verständigung ist und zur Wirklichkeit hinführen möchte. Vielleicht wird uns hierdurch klarer und deutlicher, dass der russische Angriffskrieg uns alle betrifft, unsere gemeinsam geteilte Welt und Freiheit.
Nach dieser Einstimmung, darf ich Sie nun mit dem weiteren Verlauf der heutigen Festveranstaltung und den weiteren Stimmen, die an diesem Abend zu hören sein werden, vertraut machen. Zunächst werden auch in diesem Jahr die VertreterInnen der beiden preisstiftenden Institutionen zu Wort kommen. Für den Senat der Freien Hansestadt Bremen wird stellvertretend zunächst die Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz sprechen, für die Heinrich-Böll-Stiftung Bastian Hermisson. Wir möchten den genannten Geldgebern, namentlich dem Bremer Senat sowie der Heinrich-Böll-Stiftung (Bund) und der Heinrich- Böll-Stiftung Bremen, die den »Hannah-Arendt-Preis« seit so vielen Jahren finanziell und ideell unterstützen, und auch das gestrige Ska-Punk-Konzert mitermöglichten, bei dieser Gelegenheit nochmals und ausdrücklich für ihre Unterstützung danken.
Im Anschluss an die Ansprachen der StifterInnen des Preises wird Monika Tokarzewska als Jurymitglied die Begründung der Preisvergabe vortragen. Es folgt dann die Laudatio auf Serhij Zhadan, die Andrej Kurkow halten wird. Wir sind froh, mit dem vielfach ausgezeichneten und bedeutenden ukrainischen Schriftsteller und, unter anderem, Drehbuchautoren Andrej Kurkow eine weitere wichtige Stimme aus der Ukraine hier in Bremen begrüßen zu dürfen. Zahlreiche seiner in wirklich vielen Sprachen übersetzten Bücher haben auch hierzulande Berühmtheit erlangt. Am vergangenen Montag wurde Andrej Kurkow in München mit dem »Geschwister-Scholl-Preis« für sein Buch Tagebuch einer Invasion ausgezeichnet. Seine diesbezüglich gehaltene, ich zitiere, »bewegende Rede«, ist auf eine breite öffentliche Resonanz gestoßen. Schön, dass Sie hier sind! Anschließend an Andrej Kurkows Laudatio hören wir die Festrede Serhij Zhadans. Danach klingt der Abend mit der öffentlichen Preisübergabe hier und einem gemeinsamen Sektempfang im Nachbarsaal aus. Damit überreiche ich nun das Wort an Carmen Emigholz. Danach spricht, wie gesagt, Bastian Hermisson im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung. Anschließend erfolgt die Jurybegründung von Monika Tokarzewska, schließlich die Laudatio Andrej Kurkows sowie die Festrede Serhij Zhadans.
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Zhadan, liebe Mitglieder der Jury, lieber Herr Kurkow, verehrte Gäste, ich leite die Europa-Arbeit bei der Heinrich-Böll-Stiftung und gratuliere herzlich dem diesjährigen Preisträger des Hannah-Arendt-Preises, Serhij Zhadan.
Diese Entscheidung der Jury ist ein großer Glücksfall. Die Lyrik, die Erzählungen von Herrn Zhadan sind auf mindestens drei Ebenen bedeutsam. Sie haben eine gewaltige poetische Kraft. Sie vermitteln uns einen Eindruck vom Leben in der Ukraine, von der postsowjetischen Transitionszeit bis zum Leben inmitten des russischen Angriffskrieges, der seit 2014 (und eben nicht erst seit diesem Jahr) das Land und das Leben der Menschen prägt. Und sie transportieren tiefgehende menschliche Erfahrungen, von Schmerz, von Mut und von Hoffnung.
Das Werk von Herrn Zhadan ist daher auch von großer politischer Kraft und Relevanz, und es ist nicht von ungefähr, dass er politisches Engagement und Kunst in seinem Wirken vereint. Das ist umso bedeutender in dieser historischen Situation, für die Ukraine, und für Europa.
Die Europäische Union fußt auf drei zentralen Versprechen. Europa soll ein Raum des Friedens, des Wohlstands und der Freiheit sein. Der russische Angriffskrieg, dieser brutale Krieg gegen die ukrainische Zivilbevölkerung, ist auch ein Angriff auf diese Grundfesten Europas. Der Krieg stellt die europäische Friedensordnung fundamental infrage. Russland versucht, Europa wirtschaftlich zu schwächen und zu spalten. Und es greift die Freiheit selbst an, die liberale Demokratie als politisches System, um das Recht des Stärkeren durchzusetzen anstatt der Stärke des Rechts.
Die Leidtragenden dieses Krieges aber sind nicht wir in der Europäischen Union, sondern die Menschen in der Ukraine, die im wahrsten Sinne des Wortes um ihre Existenz kämpfen und sich dem russischen Vernichtungskrieg mit unglaublich viel Mut, Kraft und Gemeinsinn entgegenstellen.
Wir haben als Deutsche eine besondere Verantwortung für die Ukraine aufgrund der grausamen Verbrechen, die wir im Zweiten Weltkrieg dort verübt haben. Und wir haben eine besondere Verantwortung aufgrund unserer gescheiterten Ostpolitik der letzten Jahrzehnte, welche die zentralen Interessen unserer östlichen Nachbarn sträflich negierte.
Es geht jetzt darum, die Ukraine zu stützen und zu stärken. Das Ziel ist nicht nur ein militärischer Erfolg der Ukraine, sondern auch, das Versprechen Europas für Frieden, Wohlstand und Freiheit, in der Ukraine einzulösen. Denn es gibt in dieser Zeit keinen europäischeren Ort als die Ukraine.
Serhij Zhadan hat auch hierzu wichtige Worte gefunden. Und auch dies macht ihn zu einem würdigen und wichtigen Preisträger des Hannah-Arendt-Preises.
Ich will schließen mit einem Zitat von Hannah Arendt aus einem Briefwechsel mit dem Philosophen Gershom Sholem: »Ich bin in der Tat heute der Meinung, dass das Böse immer nur extrem ist, aber niemals radikal, es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. Tief aber, und radikal ist immer nur das Gute.«
Vielen Dank.
Bastian Hermisson leitet seit August 2022 das Referat EU/NA der Heinrich-Böll-Stiftung. Von 2015 bis 2022 leitete er das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington
»Abends ist Charkiw ganz still und leer. Der Sommer, wenn auch eher kalt als warm, hat sich in den Straßen ausgebreitet. Der Himmel über der Stadt ist groß und geheimnisvoll.« –Diese drei Sätze stammen aus Serhij Zhadans jüngstem auf Deutsch erschienenen Buch Himmel über Charkiw, einer Art Tagebuch: verfasst als eine Reihe von kurzen Einträgen, kaum einer davon länger als eine halbe Seite; manchmal besteht ein Eintrag aus nur einem Satz. Die Kürze erklärt sich durch die Entstehungsumstände: es handelt sich hier – wie man auf dem Buchumschlag liest– um eine Art provisorische Charkiwer Chronik zwischen Februar und Juni 2022, um tägliche Nachrichtenaufzeichnungen mitten aus dem Krieg, gesehen mit den Augen eines Zivilisten, der seine Heimatstadt in steter Bedrohung durch russische Raketen und in einem Zustand, in dem Zerstörung zum Alltag wird, erlebt. Die Einträge wurden ursprünglich in den sozialen Medien gepostet. Sie fühlen sich als Buch eigentlich ihrem natürlichen Element entzogen, denn sie sind auf Konkretes, auf täglich eintretende Nöte und Aktivitäten bezogen. Und sie sind schlicht. Zitat: „Am Nachmittag war es im Stadtzentrum still und ruhig. Der totale Kontrast zu den Nachrichten über den Beschuss der Postfiliale und des Einkaufszentrums." Ist das noch Literatur oder ist das bloß eine Nachricht? Es ist diesen Einträgen zu entnehmen, dass sie nicht als stilles Selbstgespräch und nicht als einschneidende Wirklichkeitsanalyse entstanden sind, sondern, um Zeugnis vom Mut der Charkiwer abzulegen, wie auch um Mut und Hoffnung einzuflößen:
Wir haben in der Jury dieses jüngste Buch noch nicht kennen können, als wir im Frühling dieses Jahres über die Wahl eines Preisträgers bzw. einer Preisträgerin diskutierten. Die Wahl war schwierig, weil einige hervorragende Kandidatinnen und Kandidaten in Frage kamen. Dass wir nach dem 24. Februar 2022 die Ukraine in den Blick nehmen werden, war uns allen sofort klar – sonst wäre das kein Preis im Sinne von Hannah Arendt gewesen, die das ‚Sich-einschalten' als unabdingbare politische Haltung ansah. Serhij Zhadans Prosa in den Büchern Mesopotamien, Die Erfindung des Jazz in Donbass oder Internat haben uns durch ihre lebensnahe und zugleich sehr kunstvolle Sprache überzeugt. Diese Sprache hat eine tiefe Verbundenheit mit dem Gebiet, aus dem Zhadan stammt. Sie sucht die Menschen der Ukraine und ihr Leben unter harten Umständen und an den Scheidewegen der gewaltreichen Geschichte zwischen postsowjetischer Ära und der vielfältigen Identität des seit 30 Jahren unabhängigen Staates, zu beschreiben. Die Gewalt, die laut Hannah Arendt stumm ist, wird hier in den kleinsten, alltäglichen Dimensionen greifbar. Sie wird aber stets durch die Durchhaltekraft, den Einfallsreichtum oder einfach blindes Glück gebrochen. Die Helden dieser Prosa sind einfache, durchschnittliche Menschen in ihrer Undurchschnittlichkeit. Sie alle haben sehr konkrete Gesichter. Sie kämpfen sich manchmal mit einer bewundernswerten quasi-kriminellen Energie durch. Es hat uns angesprochen, wie die Sprache Zhadans sich diesen in ihrem Existenzkampf und in aller Verzweiflung trotzenden Lebenslust begriffenen Menschen nähert, ohne sentimental zu sein. Zugleich hat diese Sprache etwas Poetisches: hie und da eine originelle Metapher, eine Sprache, in der Prosa oft fließend in Gedichte übergeht. Es sind Geschichten von unten erzählt, sie zeigen auf greifbare Weise die Wirklichkeit eines Landes, das sich einem Krieg ausgesetzt sieht, der aber zumeist im Hintergrund bleibt. „Politik tötet" – erklärt jemand in Zhadans Buch Geschichte und Prosa aus dem Krieg aus dem Jahre 2015. Die Menschen in seinen Erzählungen sind aber keine hin und her geworfenen hilflosen Opfer der Umstände. Sie nehmen Stellung zu dem, was auf sie zukommt – so gut oder so schlecht, wie sie nur imstande sind. Manchmal werden diese Menschen zu wahren Helden, wie der Boxer Marat, der mitten in der Nacht in Charkiw Zigaretten kaufen ging und erschossen wurde, weil er sich spontan mit nackten Fäusten für eine unbekannte, überfallene Frau zur Wehr setzte. Hannah Arendt betonte die Bedeutung des Geschichtenerzählens für die Möglichkeit jeder Politik, indem sie den Taten und Worten der handelnden Menschen auch die Notwendigkeit des Erzählers zugesellte. Denn ohne einen solchen wären weder Taten noch Worte von Dauer. So gab es zum Glück jemanden, der die Geschichte des Boxers Marat erzählen konnte.
Die Jury hat Serhij Zhadan auch als jemand ehren wollen, der sich seit den ersten Tagen des Kriegs für die Menschen im Krieg engagiert. Dieses unermüdliche Engagement reicht von der Verteilung von Lebensmitteln und der Evakuierung der Bedrohten bis hin zu den Konzerten, die er mit seiner Band gibt.
Es ist trotzdem nicht selbstverständlich, dass ein Schriftsteller, Dichter und Rocksänger ausgerechnet einen Preis für politisches Denken erhält. Literatur und Politik – das ist keine einfache Beziehung. Es wäre naiv, an Unschuld der Literatur und Kultur der Macht gegenüber zu glauben – nur, weil Kunst von Zeit zu Zeit subversiv und zum Ausdruck von Widerstand wird. Die ästhetische Kraft ist ein zweischneidiges Schwert. Der polnische Dichter Zbigniew Herbert verfasste einmal ein Gedicht über Belzebub und die Künstler. »Belzebub liebt die Kunst und prahlt, dass seine Chöre, seine Dichter und seine Maler in Kürze die himmlischen übertreffen werden. Wer die bessere Kunst hat, hat die bessere Regierung, das ist klar.« Deshalb sichert in Herberts Parabel Belzebub seinen Künstlern »Ruhe, gute Verpflegung und gänzliche Abschottung vom höllischen Leben.«
Literatur und Krieg ist ein nicht minder schwieriges Paar. Ihre gegenseitige Beziehung hat zwar etwas zu tun mit den Anfängen der Erzählkunst überhaupt – Homers Muse sollte den Zorn Achills besingen. Zugleich besagt aber ein lateinisches Zitat, dass die Musen schweigen, wenn die Waffen sprechen.
Es sei hier zum Schluss noch einmal kurz auf das jüngste Buch Zhadans erinnert: auf die Tagesnachrichten aus dem existentiell bedrohtem Charkiw. Zwischen der kunstvollen Sprache in Mesopotamien und der Schlichtheit der Einträge hier spannt sich die Beziehung zwischen Krieg und Literatur in seiner ganzen Breite aus. Einer der Einträge besteht bloß aus einer Liste von Gegenständen, die zur Versorgung der Zivilisten und der Soldaten gekauft wurden: »Kettensägen, Drohnen, Taschenlampen, Unterhosen.« Ist das Literatur? An die Grenzen gelangt die Sprache hier allerdings nicht als Stottern, das heißt nicht als Ausdruck eines Traumas, so dass einem die Sprache verschlägt. Die Grenze der Sprache ist eben ihre Schlichtheit. Ein Gedicht vortragen gehört mitten unter tägliche Hilfsaktionen einfach dazu. „Wir haben Gedichte vorgetragen und ein Teleskop mitgebracht, damit die Kinder den Mond betrachten können."
Es ist nicht ungefährlich sich an der Grenze zu bewegen – es fühlt sich ein bisschen an wie auf einem hochaufgespannten Seil zu spazieren. Dieses Schreiben in einer Grenzsituation legt jedoch etwas ganz Elementares frei. Unaufdringlich wird hier an unerwarteten Stellen doch Literatur geboren: ganz ursprünglich als Rhythmus. Er entsteht aus dem Festhalten am Alltag, daraus, dass das Café nach dem Einschlag doch wieder öffnet und daraus, dass die Kinder, die in den Kellern der Metro hausieren, mal wieder spielen können.
Die Jury hatte bei ihrer Entscheidung, Serhij Zhadan mit dem Hannah Arendt Preis für Politisches Denken zu ehren, die Tatsache vor Augen gehabt, dass sich die Ukraine in einem Vernichtungskrieg befindet. Es ist aber auch völlig im Sinne Serhij Zhadans, eine Bewunderung für die Lebens- und Überlebenskraft der Ukrainer auszusprechen, die sie jeden Tag beweisen, und für ihre Hoffnung.
Der Himmel über Charkiw ist meist sonnig und klar, er kann aber auch auf geheimnisvolle Weise poetisch sein: »Der Himmel ist still wie eine Klinik / aus der Patienten evakuiert wurden. / Jemand hat die Schichten der Luft geöffnet.« Blicke zum Himmel kehren bei Zhadan wie ein Leitmotiv wieder. Sie sind keine Blicke ins Jenseits. Sie sind Blicke zum Einfachen und Grundlegenden, das wie selbstverständlich sich immer wieder erneuert. Im Anschluss an den Himmel über Charkiw kann man vielleicht am besten jene Ballade von Bertolt Brecht zitieren, die Hannah Arendt für so wichtig hielt, dass sie diese Strophen ihrem grundlegenden Buch über die Bedingungen politischen Handelns: Vita activa - als Motto vorangestellt hatte:
Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal
War der Himmel schon so groß und still und fahl
Jung und nackt und ungeheuer wundersam
Wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam
Als im dunklen Erdgeschoße faulte Baal
War der Himmel noch so groß und still und fahl
Jung und nackt und ungeheuer wunderbar
Wie ihn Baal einst liebte, als Baal war.
Monika Tokarzewska ist Assistentin am Lehrstuhl für Germanistik an der Nikolaus Kopernikus-Universität Toruń/Polen und Mitglied der internationalen Jury des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken e.V.
Die Stimme von Serhij Zhadan kann heute nicht von der Stimme der Ukraine getrennt werden. Und das, obwohl er für sich selbst spricht und nicht für die Regierung oder das ganze Land. Er sagte und sagt immer, was er denkt. Er ist kein Politiker und es ist ihm egal, ob ihn die Leute mögen oder nicht. Ob sie bereit sind, seine Gedanken und Appelle anzunehmen oder nicht, das ist ihre Sache, es ist ihre Wahl, das ist schließlich ihr Recht. Aber die Ukrainer hören auf das, was Serhij Zhadan sagt. Hören seine Poesie und seine Lieder.
Und es ist nicht einmal so, dass er nicht in Slogans und Zitaten spricht. Er ist ein Dichter. Er spricht Zuhörer und Leser auf einer anderen Ebene an. Auf der Ebene, wo Worte zu Empfindungen und Bildern werden. Und auch wenn man sich an diese Worte nicht erinnert, bleiben sie mit einer besonderen Wärme, einem besonderen Klang in der Seele.
Er wird gehört. Er wird gesehen und gehört, weil er sich nirgendwo versteckt, nicht in seinem Büro sitzt. Er steht nicht am Ufer eines lärmenden Ozeans und sendet seine Botschaften entlang seiner Wellen in einer verkorkten Flasche, ohne zu wissen, wem und wann diese Botschaft in die Hände fallen wird. Er spricht direkt in die Augen, in die Ohren, in die Seelen seiner Mitbürger.
Serhij Zhadan ist die Stimme von Donbass, die Stimme von Charkiw und die Stimme der gesamten jungen Ukraine, der Ukraine von heute und der Ukraine der Zukunft.
Ich hatte das Glück, Serhij Zhadan seit zwanzig langen Jahren zu kennen und zu hören. In all den Jahren hat er sich nie verraten, seine Ansichten und Prinzipien nicht geändert. Seine Ansichten, wie seine Poesie, wie seine Prosa, veränderten sich, entwickelten sich weiter, kehrten sich aber nie um. Er wuchs allmählich wie ein langlebiger Baum. Er stieg auf und wurde immer sichtbarer, zuerst auf der ukrainischen und dann auf der Weltliteraturszene. Und so kam es, dass sein Heranwachsen als Dichter und als Bürger in die schwierigste Zeit der unabhängigen Ukraine fiel, zu einer Zeit, als die Existenz der Ukraine als unabhängiger Staat von Russland in Frage gestellt wurde.
Kann ein Dichter ein Land retten? Kann Literatur während des grausamsten Zerstörungskrieges überhaupt eine Rolle spielen, wenn Bibliotheken mit Büchern unter dem Beschuss russischer Artillerie brennen, Theater und Universitäten von Raketen zerstört werden, wenn Nichtmenschen in russischen Militäruniformen Dichter und Übersetzer erschießen, wie es bei dem Dichter Volodymyr Vakulenko bei Izyum oder mit einem Übersetzer aus dem Altgriechischen, Universitätsprofessor Oleksandr Kislyuk in Bucha bei Kiew passierte?
Die Geschichte des Landes, seine Biographie wird von den Stimmen der Dichter und Schriftsteller geschrieben. Es sind diese Stimmen, die die tragischsten Ereignisse beeinflussen können und sollten. Diese Stimmen werden zu Erinnerungen und Büchern. Diese Stimmen helfen den Menschen, die schwierigste Zeit zu überstehen, den Mut nicht zu verlieren, sich auch nach den schwersten Schlägen vom Boden zu erheben.
Die bürgerliche und menschliche Energie von Serhij Zhadans Poesie kann diejenigen, die sie hören, nur erfreuen, sie anregen. In dieser Zeit, in der die Hälfte der Ukraine ohne Licht und Wärme lebt, strahlen die Worte und Gedanken von Serhiy Zhadan sowohl Licht als auch Wärme aus und geben Hoffnung.
In dieser Zeit, in der die Ukraine jeden Tag ihre von Russland getöteten Bürger beerdigt, tröstet die Stimme von Serhij Zhadan die Trauernden und gibt ihnen Kraft. In dieser Zeit, in der die Ukrainer in den besetzten Gebieten deprimiert sind und den Glauben an die Zukunft verlieren, stellen Serhiy Zhadans Gedichte und sein bürgerschaftliches Engagement ihren Glauben wieder her und verleihen ihnen Geduld, um auf die Befreiung ihrer Heimatstädte und -dörfer zu warten.
Auch Serhij Zhadans Heimatstadt Starobilsk in der Region Luhansk ist besetzt. Dort verbrachte Serhij seine Kindheit und Jugend, bevor er nach Charkiw zum Studium ging. Dort begann Serhij Zhadan, Gedichte zu schreiben, begann, das Leben mit den Augen eines Schriftstellers zu betrachten.
Seit dieser Zeit hat Serhij Zhadan zwei kleine Heimatländer: Starobilsk und Charkiw, eines erobert, das andere Widerstand leistend und frei.
Es war 2014 in Charkiw, als Serhij Zhadan auf den Svoboda-Platz im Stadtzentrum zog, um die Freiheit der Ukraine zu verteidigen. Dann kamen Dutzende von Bussen mit Militanten aus Russland in die Stadt, um einen antiukrainischen Putsch durchzuführen, um Charkiw zu einem Teil Russlands zu erklären. Und zwei Dutzend Kharkov-Aktivisten, Dichter und Intellektuelle traten gegen Hunderte russische Militante auf. Einschließlich Serhij Zhadan. Sie wurden geschlagen, aber sie knieten nicht. Sie hielten furchtlos durch und gaben ihrer Heimatstadt ein Beispiel dafür, wie sie ihre Ansichten, ihre Straßen, ihre Häuser und ihre Familien verteidigen können.
Ich sehe einen direkten Zusammenhang zwischen dem, was 2014 in Charkiw passiert ist, und dem, was jetzt in Charkiw passiert, wo die russische Armee seit neun Monaten versucht, es einzunehmen. Sie versucht es, aber sie kann es nicht.
Deshalb versucht Russland seit neun Monaten, die Stadt mit Raketen und Artillerie zu zerstören, versucht, sie ohne Wärme, Wasser und Licht zu lassen, und versucht, alles, was darin lebt, zu töten. Aber Charkiv kniet nicht, genauso wie Sergei Zhadan nicht kniete. Ja, Charkiw begräbt jeden Tag seine Toten. Aber jeden Tag verteidigt sich die Stadt gegen den Feind und gibt nicht auf. Darüber hinaus hat die Stadt ein aktives kulturelles und literarisches Leben, ein wichtiger Teil davon ist Serhij Zhadan.
Seit Kriegsbeginn hat sich dieses Leben in Luftschutzbunker und auf die Bahnsteige von U-Bahn-Stationen verlagert. Aber gleichzeitig wurde es kein "Underground". Im Gegenteil, das kulturelle Leben der Stadt wird immer mehr zur Masse, wird aber gleichzeitig nicht zum „Mainstream". Literatur, Musik, die ukrainische Kultur im Allgemeinen wurde zu einer Waffe des Widerstands. Poesie ist zu Sauerstoff geworden. Die Ukrainer hören eifrig Serhiy Zhadans Poesie zu, gefüllt mit warmen, hellen, schmerzhaft vertrauten Bildern, aber geschrieben mit scharfen und durchdringenden Worten wie eine Kugel.
Gleichzeitig ist das Schreiben von Gedichten und Prosa seit vielen Jahren nicht mehr die Hauptbeschäftigung von Serhij Zhadan. Er ist ohne Zweifel einer der aktivsten Freiwilligen, der jede Stunde seines Lebens der Ukraine und dem zukünftigen Sieg der Ukraine über den russischen Aggressor widmet. Er beteiligt sich erfolgreich an der Beschaffung von Spenden für die Verwundeten und die Familien der Toten, er hilft der ukrainischen Armee und der vom Krieg betroffenen ukrainischen Zivilbevölkerung. Und er nutzt jede freie Minute, um die Ukrainer mit seiner Poesie, seiner Musik, seiner kraftvollen Stimme zu unterstützen. Seine öffentlichen Poesieabende finden im In- und Ausland statt. Er verwendet das gesamte Geld, das er aus dem Ticketverkauf erhält, für seine ehrenamtlichen Aktivitäten, für das ukrainische Volk. Er selbst ist für viele, insbesondere für junge Ukrainer, bereits zum Symbol der Unabhängigkeit und Freiheit geworden. Politisch unabhängig hat er immer gesagt, was er über ukrainische Politiker denkt. Politische Ambitionen hatte und hat er nicht, obwohl ihn jede Partei gerne auf ihre Kandidatenliste für das Parlament setzen würde. Sein einziges Ziel ist es, ein würdiger Bürger seines Landes zu sein. Und dieses Ziel hat er erreicht, auch wenn er es sich nicht gesetzt hat.
Serhij Zhadan ist ein würdiger Bürger der Ukraine, ein würdiger Dichter der Ukraine und der Welt. Die Wahrheit spricht heute in seiner Stimme. Das Gewissen spricht heute mit seiner Stimme. Seine Stimme, seine Poesie erinnern jeden von uns an den Wert des menschlichen Lebens, Liebe, Hoffnung, dass jeder von uns auch eine Stimme hat und wir kein Recht haben zu schweigen, wenn wir Böses, Ungerechtigkeit, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sehen!
Ich freue mich über diese Gelegenheit, Serhij Zhadan und Ihnen allen zu sagen, dass ich dank der Kraft von Serhijs Stimme an den Sieg des Guten über das Böse glaube, ich glaube an den Sieg der Ukraine über Putins Russland, ich glaube an den Sieg der europäischen Werte und der Demokratie über die dunklen Mächte des Mittelalters, die versuchen, uns allen die Idee ihrer Unbesiegbarkeit aufzuzwingen.
Liebe Freunde,
ich möchte, dass wir heute im Namen all jener Menschen sprechen, die derzeit mit einem außergewöhnlich schmerzhaften zeitlichen Bruch konfrontiert sind. Ich möchte heute über Zeit sprechen als ein Segment unserer Existenz, als die Folie, auf der sich unsere Überzeugungen und Ansichten – vor allem die politischen – herausbilden, formen und wandeln. Wir alle befinden uns in einem Zeitstrom, mitten in einem System von Zeichen und Begriffen. In vielerlei Hinsicht sind wir von der Zeit abhängig. Wir sind von ihr abhängig, aber nicht in ihr gefangen. Zumindest nicht, solange wir die Kraft aufbringen, die Zeit zu bezeugen.
Was meine ich damit? Wir alle entfernen uns immer weiter von dem Schatten, den das 20. Jahrhundert geworfen hat. Der persönliche Bezug zu diesem Jahrhundert der furchtbaren Völkermorde und Weltkriege scheint uns immer mehr verloren zu gehen. Es gibt nur noch wenige Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges und auch des Kalten Krieges. Die Erfahrung der persönlichen Angst beim Lesen der morgendlichen Nachrichten wird allmählich ersetzt durch eine Erfahrung der Reflexion, des Abstandes und des erworbenen Wissens. Der tiefe Schmerz unserer Großeltern, die das Gemetzel des Zweiten Weltkrieges miterlebt haben und diese Erfahrung – widerwillig – ihren Kindern und Enkeln weitergaben, vermittelt sich nun unseren Kindern in Form von tragischen, grausamen, schmerzhaften, aber eben doch: Geschichten.
Wer Geschichte nicht persönlich erlebt hat, zieht daraus nur selten Lehren. Wenn die Lehren übergangen werden, verliert die Geschichte ihr Potenzial für Entwicklung und Fortschritt.
Ich wurde 1974 geboren. Mein Vater 1945 – er galt als »Kriegskind«. Meine Großmutter, die mich aufgezogen hat und mit der Sowjetarmee bis nach Berlin gekommen war, starb 1982. Ich kann mich nicht mehr an ihre Erzählungen erinnern. Meine Eltern hatten nichts vom Krieg zu berichten, weil sie noch zu jung waren. Ich hatte also keinen direkten Bezug zum Krieg – was auch so bleiben sollte. Denn ich wurde genau in dem Zeitfenster geboren, in dem der Krieg beschloss, eine Generation auszulassen.
Langsam, aber kontinuierlich bauten wir unsere eigene Welt auf. Zwischenzeitlich schien es, als meine es die Zeit gut mit uns. Als schenke sie uns den – aus Sicht unserer Eltern und Großeltern – unfassbaren Luxus, von Kriegen verschont zu bleiben.
All das änderte sich 2014. Plötzlich tauchten auf unserem Territorium bewaffnete russländische Kräfte auf. Sie kamen zuerst auf die Krim und drangen dann in den Osten des Landes ein. Der Krieg begann – ein Krieg, den die Welt lange Zeit nicht wahrhaben wollte. Am 24. Februar dieses Jahres startete Russland eine Großoffensive, die man nicht länger ignorieren konnte. Was blieb, war das Eingeständnis, dass die bisher gültige Ordnung des europäischen Lebens in Trümmern liegt. Europa hat eine neue Kriegsgeneration.
Wir müssen feststellen, dass das Niederreißen eines jeden eisernen Vorhangs ein kontinuierlicher Prozess ist. Mauern haben die Fähigkeit, wieder neu zu wachsen. Totalitarismus entfaltet sich dort, wo er ignoriert wird. Revanchismus ist eine Krankheit, an der immer noch ganze Gesellschaften leiden. Wir Ukrainer bekommen heute die alten Traumata der Politik des 20. Jahrhunderts zu spüren. Während wir versuchten, unser eigenes Wirklichkeitsgerüst zu errichten, fällt das Imperium, von dem wir uns zu lösen suchten, zurück in die Vergangenheit.
Russland klammert sich an eine Vergangenheit, die für es selbst zur Falle geworden ist. Zwanzig Jahre Propaganda, Indoktrination und sowjetischer Nostalgie haben einen neuen Krieg vorbereitet. Der Kreis der Geschichte schließt sich – und wieder missachtet Russland fremde Grenzen.
Allerdings sind dieses Mal wir, die Ukrainer, das Ziel. Während für uns die Entwicklung vorhersehbar war, fragt sich der Rest der Welt nun: Wie konnte es dazu kommen? Warum hat niemand den Aggressor aufgehalten?
Offensichtlich ist weder der Triumph der Gerechtigkeit noch die Niederlage des Bösen etwas Endgültiges. Wir unterschätzen die Fähigkeit des Bösen zur Selbstregeneration. Das Böse, so wie Hannah Arendt schrieb, ist banal – konstant, strukturell, unabhängig vom technischen oder sozialen Fortschritt.
Die russländische Gesellschaft unterstützt mehrheitlich die Rhetorik und das Verhalten ihres Staates. Ohne diese Loyalität gäbe es keinen Totalitarismus. Und das ist eine Lehre des 20. Jahrhunderts, die wir nicht ausreichend beachtet haben.
Warum hat die Welt acht Jahre gebraucht, um die Dinge beim Namen zu nennen? Warum sind Ethik und Moral in Politik, Wirtschaft und Medien so vage und verhandelbar? Und vor allem – sind das alles nur rhetorische Fragen, oder sind wir bereit, sie wirklich zu stellen?
Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Er eskaliert. Die Besatzer zerstören Städte, Infrastruktur und Wohnviertel. Die Ukraine verteidigt sich – und braucht Hilfe. Aber auch die Welt braucht Schutz. Denn ihr Sicherheitssystem und ihr Wertesystem haben sich als fragil erwiesen. Die Krise wird nicht mit der Niederlage Russlands verschwinden.
Das 21. Jahrhundert hat bereits gezeigt, wie schnell das Böse zurückkehrt, wenn man es ignoriert.
Ich danke Ihnen für diese Möglichkeit – die Möglichkeit, schmerzhafte Fragen zu formulieren und darauf zu hoffen, dass sie gehört werden. Wenn wir heute um unsere Zukunft kämpfen, dann nur im Bewusstsein der Vergangenheit. Wir alle sind miteinander verbunden – in dieser Zeit, in diesem Raum. Und wir füllen die Luft mit unseren Stimmen. Jede Stimme ist wichtig. Jeder Atemzug ist wichtig. Wenn wir verstummen, fühlt sich das Böse sicherer. Das ist ein weiterer Grund zu reden – und zuzuhören.
Aus dem Ukrainischen von Claudia Dathe.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz