
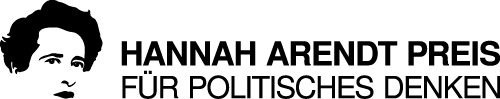


© DHM / Middletown, Conneticut, Wesleyan University Library, Special Collections & Archives
Hannah Arendt, geboren 1906 in Hannover, zählt zu den einflussreichsten politischen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts – eine jüdische Intellektuelle, geprägt von den Umwälzungen und Verfolgungen ihrer Zeit. Ihr Denken formte sich aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts – Nationalsozialismus, Antisemitismus, Krieg und Exil. Nicht ewige Wahrheiten waren ihr Ziel, sondern ein Denken, das sich den Herausforderungen der Gegenwart stellt.
Arendts Denken war untrennbar mit politischer Erfahrung verbunden. Ihre Überlegungen entsprangen der Perspektive der Flüchtenden, der Staatenlosen, der jüdischen Außenseiterin, der politisch Handelnden und der Zeitzeugin menschlicher Größe ebenso wie menschlicher Abgründe. Sie bestand darauf, politische Ereignisse weder bloß moralisch zu bewerten noch ausschließlich historisch zu erklären, sondern sie in ihrer Komplexität, Kontingenz und Widersprüchlichkeit zu durchdenken. Der Vorstellung einer einzigen, absoluten Wahrheit setzte sie ein Denken entgegen, das Wahrheit als an Zeit, Perspektive und Erfahrung gebunden verstand. Ein Lieblingszitat Arendts von Franz Kafka bringt dies auf den Punkt:
»Es ist schwer, die Wahrheit zu sagen, denn es gibt zwar nur eine, aber sie ist lebendig und hat daher ein lebendig wechselndes Gesicht.« (Kafka, Franz: Briefe an Milena, Frankfurt am Main 1986, Brief vom 23. Juni 1920)
Nach dem Studium der Philosophie, Theologie und Klassische Philologie bei Martin Heidegger, Nicolai Hartmann, Rudolf Bultmann in Marburg und bei Edmund Husserl in Freiburg, promovierte sie bei Karl Jaspers in Heidelberg. Arendt floh in den 1930er-Jahren vor den Nationalsozialisten, lebte zunächst in Frankreich und emigrierte 1941 in die USA. Dort wurde sie zu einer zentralen Stimme unter den deutsch-jüdischen Emigranten und später zu einer international anerkannten öffentlichen Intellektuellen. In ihrer kritischen Reflexion europäischer politischer Philosophie und Theorie verknüpfte sie diese mit den amerikanischen Traditionen politischer Freiheit, republikanischem Denken und gesellschaftlicher Pluralität – eine Verknüpfung, die ihren Schriften eine besondere transatlantische Perspektive verlieh. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1951/1955), Vita activa oder Vom tätigen Leben (1958/1961), Fragwürdige Traditionsbestände im politischen Denken der Gegenwart. Vier Essays (Frankfurt/Main 1957/1961), Eichmann in Jerusalem – Ein Bericht von der Banalität des Bösen (1963/1964) sowie Über die Revolution (1963/1965).
Ihr wirklichkeitsnahes Denken, getragen von einer philosophisch orientierten Analyse sozialer und politischer Verhältnisse, wies ihr den Weg zu den Themen, die kritischer Reflexion bedürfen: die Zerbrechlichkeit der Freiheit, die Voraussetzungen politischen Handelns sowie die Gefahren, die von Ideologien und moralischer Gleichgültigkeit ausgehen. Schon früh schrieb sie engagiert, kritisch und unabhängig über Antisemitismus, jüdische Identität und Zionismus.
Obwohl sie an renommierten Institutionen wie Princeton, der University of Chicago und New School for Social Research in New York lehrte, verfolgte Arendt nie eine klassische akademische Laufbahn. Sie blieb zeitlebens unabhängig – geleitet von der Überzeugung, dass Denken ein politischer Akt und Urteilen den Bezug auf andere voraussetzt. 1975 starb sie und wurde am Bard College in New York neben ihrem Ehemann Heinrich Blücher beigesetzt.

Hannah Arendt, geboren 1906 in Hannover, zählt zu den einflussreichsten politischen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts – eine jüdische Intellektuelle, geprägt von den Umwälzungen und Verfolgungen ihrer Zeit. Ihr Denken formte sich aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts – Nationalsozialismus, Antisemitismus, Krieg und Exil. Nicht ewige Wahrheiten waren ihr Ziel, sondern ein Denken, das sich den Herausforderungen der Gegenwart stellt.
Arendts Denken war untrennbar mit politischer Erfahrung verbunden. Ihre Überlegungen entsprangen der Perspektive der Flüchtenden, der Staatenlosen, der jüdischen Außenseiterin, der politisch Handelnden und der Zeitzeugin menschlicher Größe ebenso wie menschlicher Abgründe. Sie bestand darauf, politische Ereignisse weder bloß moralisch zu bewerten noch ausschließlich historisch zu erklären, sondern sie in ihrer Komplexität, Kontingenz und Widersprüchlichkeit zu durchdenken. Der Vorstellung einer einzigen, absoluten Wahrheit setzte sie ein Denken entgegen, das Wahrheit als an Zeit, Perspektive und Erfahrung gebunden verstand. Ein Lieblingszitat Arendts von Franz Kafka bringt dies auf den Punkt:
»Es ist schwer, die Wahrheit zu sagen, denn es gibt zwar nur eine, aber sie ist lebendig und hat daher ein lebendig wechselndes Gesicht.« (Kafka, Franz: Briefe an Milena, Frankfurt am Main 1986, Brief vom 23. Juni 1920)
Nach dem Studium der Philosophie, Theologie und Klassische Philologie bei Martin Heidegger, Nicolai Hartmann, Rudolf Bultmann in Marburg und bei Edmund Husserl in Freiburg, promovierte sie bei Karl Jaspers in Heidelberg. Arendt floh in den 1930er-Jahren vor den Nationalsozialisten, lebte zunächst in Frankreich und emigrierte 1941 in die USA. Dort wurde sie zu einer zentralen Stimme unter den deutsch-jüdischen Emigranten und später zu einer international anerkannten öffentlichen Intellektuellen. In ihrer kritischen Reflexion europäischer politischer Philosophie und Theorie verknüpfte sie diese mit den amerikanischen Traditionen politischer Freiheit, republikanischem Denken und gesellschaftlicher Pluralität – eine Verknüpfung, die ihren Schriften eine besondere transatlantische Perspektive verlieh. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1951/1955), Vita activa oder Vom tätigen Leben (1958/1961), Fragwürdige Traditionsbestände im politischen Denken der Gegenwart. Vier Essays (Frankfurt/Main 1957/1961), Eichmann in Jerusalem – Ein Bericht von der Banalität des Bösen (1963/1964) sowie Über die Revolution (1963/1965).
Ihr wirklichkeitsnahes Denken, getragen von einer philosophisch orientierten Analyse sozialer und politischer Verhältnisse, wies ihr den Weg zu den Themen, die kritischer Reflexion bedürfen: die Zerbrechlichkeit der Freiheit, die Voraussetzungen politischen Handelns sowie die Gefahren, die von Ideologien und moralischer Gleichgültigkeit ausgehen. Schon früh schrieb sie engagiert, kritisch und unabhängig über Antisemitismus, jüdische Identität und Zionismus.
Obwohl sie an renommierten Institutionen wie Princeton, der University of Chicago und New School for Social Research in New York lehrte, verfolgte Arendt nie eine klassische akademische Laufbahn. Sie blieb zeitlebens unabhängig – geleitet von der Überzeugung, dass Denken ein politischer Akt und Urteilen den Bezug auf andere voraussetzt. 1975 starb sie und wurde am Bard College in New York neben ihrem Ehemann Heinrich Blücher beigesetzt.