
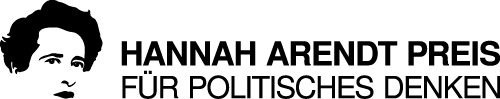

Tony Judt (†), britischer Historiker und Autor, lebte in New York

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Interventionen der Sorge
Sehr geehrter Preisträger, lieber Tony Judt, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Karoline Linnert, lieber Peter Rüdel von der Heinrich-Böll-Stiftung, liebe Gäste aus nah und fern – und aus Oldenburg, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur diesjährigen Verleihung des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«. Unser jährliches Treffen zur Preisverleihung hat inzwischen Tradition. Wir blicken auf eine ansehnliche Reihe von Preisträgerinnen und Preisträgern zurück, von denen ich Ihnen nur einige ins Gedächtnis rufe: Ágnes Heller (1995), François Furet (1996), Jelena Bonner (2000), Ernst-Wolfgang Böckenförde (2004) Julia Kristeva (2006). Der Preis wird von einer internationalen Jury vergeben. Er ist ein Preis für mutige politische Interventionen; er wird nicht in erster Linie für akademische oder Lebensleistungen verliehen. In Fortsetzung einer Tradition der deutschen und europäischen Intelligenz, für die Hannah Arendt als streitbare öffentliche Intellektuelle steht, sucht die Jury nach Preisträgerinnen und Preisträgern, die mit dem, wofür sie stehen, jenes Überraschungsmoment wachrufen, von dem die öffentliche politische Debatte zehrt – jenes Neue, Unerwartete, das innehalten lässt, das Staunen hervorruft und natürlich auch Widerspruch. Die Jury hat mit Tony Judt eine Persönlichkeit gewählt, die sich in der öffentlichen Debatte um Europa und den Westen auf vielfältige Weise zeigt: als Historiker, der sich bewusst ist, dass historische Ereignisse nicht ohne ihre kontrapunktischen historischen Linien und Verflechtungen verstanden werden können, als politischer Denker, der seine Sicht auf die Zeitereignisse in die kontroverse öffentliche Debatte einbringt, als streitbarer Zeuge der Zeit, über die er nachdenkt, die ihn beschäftigt, an der er sich reibt. Tony Judts Blick ist auf die großen Linien der europäischen Geschichte gerichtet, und doch beginnt er und kehrt immer wieder zu den Geschichten der einzelnen Völker in ihrer dissonanten Eigenart und in ihren Leidensgeschichten zurück. Er fragt mit skeptischem Blick nach der politischen Handlungsfähigkeit eines Europa der Vielfalt, sich dabei absetzend von jener Maxime, nach der die Länder Europas zu einer auf Identität beruhenden Einheit zusammenkommen sollen. Aus Judts beiden Büchern über Europa spricht einerseits die Sorge eines Europäers, das europäische Projekt könne sich als große Plattwalze für die verschiedenen Kulturen und Eigenarten der Länder, der Regionen betätigen. Dann würden nicht mehr nur die Dächer und die Gurken einander angeglichen in Europa, es verschwände jene Pluralität der Kulturen, die die vormalige lettische Staatspräsidentin und HannahArendt-Preisträgerin Vaira Vike-Freiberga vor einigen Jahren als den Reichtum Europas bezeichnet hat. Gleichwohl verbietet sich, über der wunderbaren Idee der Pluralität, deren Verständnis im angelsächsischen Raum so viel reicher ausgestattet ist als im deutschen, jeder blauäugige Paneuropäismus. Das Einheitsstreben der zentralen Behörden und die Pluralität der Nationen reiben sich in der Realität des politischen Prozesses mitunter kakophonisch aneinander. Judts immer wieder formulierte unbequeme Frage lautet, wie es einem pluralen Europa gelingen könne, in der internationalen Konfliktkonstellation handlungsfähig zu werden und dabei die kritische Auseinandersetzung mit den anderen beteiligten handelnden Mächten nicht zu scheuen.
Die Idee der Pluralität ist Europa seit seinen Anfängen mit auf den Weg gegeben. Als die vertriebenen europäischen Juden in den Vierzigerjahren des 20. Jahrhunderts im Exil darüber debattierten, wie es nach dem Ende des Krieges in einem zerstörten Europa weitergehen könne oder vielmehr wie ein politisches Leben in Europa überhaupt neu beginnen könne, haben sie diese Idee der Pluralität – anstelle der nationalen Konkurrenz – hervorgehoben. Es berührt die Leserin beim Wiederlesen einiger Texte Hannah Arendts eigenartig, wie diese Idee eines Europa der kommunizierenden Nationen mitten im Zweiten Weltkrieg wie ein Funke unter der Asche der Trümmer glimmt. So kann man kann mit Fug und Recht sagen, dass das Bestreben der Namensgeberin dieses Preises auf die Stiftung eines neuen Europa gerichtet war. Mit Blick auf Europa schreibt sie ein Buch über die amerikanische Revolution (Über die Revolution), mit Blick auf Europa diskutiert sie Alternativen zum Nationalstaat des 19. Jahrhunderts, mit dessen Erbe die europäischen Gesellschaften und Staaten so schwer zu kämpfen haben. Mit Blick auf Europa beginnt sie ihr öffentliches Selbstgespräch über die Zerstörung des öffentlichen Raums in der Moderne und die Bedingungen seiner Stiftung (Vita activa). Und insofern mag es nicht verwundern, dass die Jury in ihrer Wahl der Preisträgerinnen und Preisträger immer wieder auch zu dieser Streitfrage nach einem politisch handlungsfähigen Europa zurückkehrt. Mit ihrer Wahl hat die Jury auch gewürdigt, dass Tony Judt mit seinen Büchern und Beiträgen für ein besseres Verstehen Europas im amerikanischen Raum wirbt, ein Verständnis, das nicht von Gegensätzen, nicht von illusorischer Harmonie, sondern von einer streitbaren Auseinandersetzung über eine vielfältig dissonante, doch aufeinander bezogene Gegenwart und Zukunft ausgeht.
Die Jury hat Tony Judt in Ansehung seiner Interventionen in die politische Debatte gewürdigt. Nun steht der Preisträger seit Jahren immer wieder in der öffentlichen Kontroverse. Seine kritischen Beiträge zum dilemmatischen Verhältnis zwischen dem israelischen Staat und den palästinensischen Organisationen, zum zionistischen Selbstverständnis des israelischen Staates, zur ambivalenten Rolle der Vereinigten Staaten in dieser Konstellation, zur Rolle Europas, sorgen immer wieder für erbitterten öffentlichen Streit. Im Argumentationsgestus einiger seiner Gegner taucht dabei ein Moment auf, das aus der Lebensgeschichte der Hannah Arendt wohl bekannt ist: Es wird nicht zwischen der Person und der Sache unterschieden. Aus der Verwerfung des sachlichen Arguments folgt dann konsequenterweise die persönliche Diskreditierung, ja der Verratsvorwurf an den Autor. Der französische Philosoph Etienne Balibar hat unlängst bemerkt, ein solcher Argumentationsduktus reduziere alle politischen Fragen, jeden Konflikt mit dem Nachbarn, jeden Umgang mit Kritikern auf die Frage von Leben und Tod. Hannah Arendt hat gegenüber dieser Einstellung, die ihr mehrfach persönlich begegnete, darauf beharrt, dass die Trennung zwischen Person und Position erst die Voraussetzungen dafür schafft, dass eine politische Atmosphäre entstehen kann, in der man sich um eine gemeinsame Sache streitet. Es ist ihr oft nicht geglückt, ihre Gegner von dieser Unterscheidung zu überzeugen, aber ihre Gegner haben sie auch nicht davon abhalten können, darauf zu beharren. Nur so konnten Freundschaften gerettet werden, zum Beispiel die zu dem zionistischen Politiker Kurt Blumenfeld. Es spielt aber noch etwas anderes hinein: Wer Tony Judt als Feind deklariert, kann nicht mehr wahrnehmen, dass Judts Interventionen von einer Grundströmung der Sorge getragen werden: Sorge über eine Lage, die seit vielen Jahren als ausweglos erscheint, Sorge über eine kriegsträchtige, scheinbar nicht in politische Dimensionen zu transformierende Konstellation, die nach Lösungen schreit, deren Beteiligte aber seit Jahrzehnten nicht über den Kampf auf Leben und Tod hinauskommen. Eben dieses Hinauskommen über eine als festgefügt, wie zementiert erscheinende Lage aber ist gefragt. So weit die Begründung der Jury. Wie immer wieder an dieser Stelle möchten wir den Geldgebern herzlich danken: der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bremer Senat, die die Preisvergabe seit nunmehr 13 Jahren tragen und Abende wie diesen auch in Zeiten ermöglichen, in denen das Geld knapp ist. Großer Dank gilt natürlich jedes Jahr der Jury und dem Kreis der Kollegen und Kolleginnen aus Vorstand und Mitgliederversammlung, die den Preis mit neuen Ideen füttern und verhindern, dass dieser seine Sperrigkeit verliert.
Transzendenz und Transgression
Meine Damen und Herren, ich bin sehr stolz, dass ich hier die Gelegenheit habe, eine Laudatio auf den diesjährigen Preisträger Tony Judt zu halten. Dabei will ich natürlich nicht verschweigen, dass ich aus Ungarn komme. In diesem Zusammenhang drei kurze Geschichten: Die erste Geschichte: Die gegenwärtige ungarische Regierung plant Maßnahmen, die denen von Hartz I bis IV in Deutschland sehr ähneln, die Sie gut kennen. Aus diesem Anlass gab es riesige Demonstrationen in Budapest, auf denen wurde jedoch nicht gerufen: »Wir wollen soziale Gerechtigkeit«, sondern es wurde von Zehntausenden Leuten geschrieen: »Juden in die Donau!« Ich bin politisch aktiv und aus dem Fernsehen bekannt, ich wohne im Stadtzentrum, ich spaziere immer auf diesen Straßen, auf denen man das brüllt. Ich höre in meiner Schreibstube die Leute auf der Straße brüllen: »Schwule in die Donau! Die Juden hinterher«. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte: Vor einiger Zeit fand eine kleine antifaschistische Veranstaltung am Ufer der Donau statt. Dort gibt es eine seltsame Skulptur aus Schuhen, bronzenen Schuhen, die an die dort ermordeten Juden erinnern sollen. Die Juden waren 1944 von den »Pfeilkreuzlern«, den ungarischen Nazis, in die Donau getrieben worden. Vorher wurden sie gezwungen, ihre Schuhe auszuziehen. Die wollten die Pfeilkreuzler natürlich noch weiter verwenden. In Erinnerung an dieses Begebnis ist später ein sehr schönes, einfaches Denkmal – die bronzenen Schuhe – errichtet worden. An diesem Ort gab es also eine antifaschistische Kundgebung, aber dorthin kamen auch Gegendemonstranten und riefen in Sprechchören: »Juden, zieht eure Schuhe aus!« Und das an diesem Ort! Und die dritte kleine Geschichte: Es gibt bei uns eine kleine rechtsextreme Partei, und diese Partei hat den Stadträten überall in Ungarn vorgeschlagen, die so genannte Árpád-Streifenflagge anstelle der ungarischen Flagge auf den öffentlichen Gebäuden zu hissen. Diese Flagge war seinerzeit auch von den Pfeilkreuzlern benutzt worden. 123 Gemeinderäte haben diesen Vorschlag inzwischen aufgegriffen und in die Tat umgesetzt. Die alte Pfeilkreuzler-Flagge ersetzt gegenwärtig in immer mehr Gemeinden die ungarische National-Trikolore. Die »neuen« Fahnen sieht man jetzt überall. Die reformierte Kirche neben meinem Wohnhaus zum Beispiel hisst nicht mehr die ungarische Fahne, sondern die Árpád-Streifenfahne. Vorige Woche habe ich mit einem jungen jüdischen Freund über diese angespannte Lage gesprochen. Er hat mir einiges über seine Gefühle erzählt, und ich habe mich erinnert, dass ich ähnliche Worte schon einmal gehört oder gelesen hatte. Und schließlich habe ich sie wiedergefunden. Sie stammen von einem wenig bekannten deutschen Schriftsteller, aus einem Buch, das 1921 in Berlin unter dem Titel Mein Weg als Deutscher und Jude veröffentlicht worden war. Sein Autor hieß Jakob Wassermann. Wassermann schreibt dort: »Es ist vergeblich, in das tobsüchtige Geschrei Worte der Vernunft zu werfen. Sie sagen: Was, er wagt es aufzumucken? Stopft ihm das Maul. Es ist vergeblich, beispielschaffend zu wirken. Sie sagen: Wir wissen nichts, wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gehört. Es ist vergeblich, die Verborgenheit zu suchen. Sie sagen: Der Feigling, er verkriecht sich, sein schlechtes Gewissen treibt ihn dazu. Es ist vergeblich, unter sie zu gehen und ihnen die Hand zu bieten. Sie sagen: Was nimmt er sich heraus mit seiner jüdischen Aufdringlichkeit? Es ist vergeblich, ihnen Treue zu halten, sei es als Mitkämpfer, sei es als Mitbürger. Sie sagen: Er ist der Proteus, er kann eben alles. Es ist vergeblich, ihnen zu helfen, Sklavenketten von den Gliedern zu streifen. Sie sagen: Er wird seinen Profit schon dabei gemacht haben. Es ist vergeblich, das Gift zu entgiften. Sie brauen frisches. Es ist vergeblich, für sie zu leben und für sie zu sterben. Sie sagen: Er ist ein Jude.« Der junge Mann, mein Bekannter, der ähnlich dachte wie Wassermann seinerzeit, wird eine Universität in Amerika besuchen, und ich bin sicher, dass er nicht zurückkehren wird.
Und dennoch sage ich: Wenn man von Europa und seiner Geschichte als einer Geschichte des Bösen spricht – wie es Tony Judt im Titel seines Vortrags anklingen lässt –, sollte man von einer Geschichte der Transzendenz und Transgression reden. Was verknüpft ideengeschichtlich und philosophisch die beiden Begriffe Transzendenz und Transgression? Wir können uns dieser Frage von zwei verschiedenen Richtungen her annähern. Die Revolutionäre des 18. Jahrhunderts haben die Frage so beantwortet, dass die Transzendenz zurückgewiesen gehört und die Immanenz als naturgegeben akzeptiert wird. Nach den glorreichen Tagen des Bürgertums wies die Revolution die Natur zurück, also die Transzendierung der sozialen Welt. Marx, zwischen beiden Seiten stehend, spricht bekanntlich von der Transzendenz als Jenseits, als Opium für das Volk, aber auch als fantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens. Marx war kein Aufklärer. Für ihn war das Transzendierende zugleich der Gegenstand des Transzendierens in der Religion und keineswegs nichtig, weil sie eine schon verkehrte Welt verkehre. Beide Dimensionen sind Fantasmen für Marx, das Diesseits ist kaum besser als das Jenseits. In der bürgerlichen Gesellschaft wird das Soziale zur menschlichen Wirklichkeit und wird zur Natur. Ich komme zu unserem Problem. Jenseits dieser Natur gibt es kein Seiendes, kein Starkes, kein Lebendiges. Diese zweite Natur wird regiert von einem Kalkül der Triebkräfte, wir sind abhängig von individuellen Wertungen, notwendigen oder wünschenswerten Tätigkeiten. So ist die herrschende Disziplin des gegenwärtigen Zeitalters, die neoklassische Wirtschaftswissenschaft, konstruiert. In dieser Theorie wird das äußere Leben des modernen Menschen betrachtet als eine unendliche Reihe von Wahlentscheidungen, Begierden und so weiter. Das zeitliche Chaos von momentanen und meinungslosen Entscheidungen spricht die menschliche Natur als Rohstoff für die Nachfrage und für die davon determinierten Entscheidungen der Herren der Produktion an. Es ist diese Natur, gegen die sich das 20. Jahrhundert erhob. Das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert des Kampfes gegen den Kapitalismus. Die Marxisten wollten diese Welt zerstören und haben zu zeigen versucht, dass das, was von der menschlichen Natur bleibt, in der Geschichte aufgeht. Faschisten und Nationalsozialisten waren ebensolche Antimoralisten wie die Marxisten, aber sie haben den bürgerlichen Ideen über die Natur nicht die Geschichte, sondern das Leben entgegengesetzt. Orientierungspunkte in einer solchen Allgemeinheit waren schwer zu finden, da man Geschichte mit Tradition gleichsetzte. Die Unterscheidung zwischen wertvollem und »unwertem« Leben hat eine Art Moralität, aber eine funktionalisierte Moralität der Art: Wo etwas stark und zäh sei, sollte es von vornherein als gut gelten. Das Ziel der Marxisten war die Überwindung des Kapitalismus. Das Ziel der Nationalsozialisten lag woanders. Sie wollten den Sieg über das Bürgertum und die bürgerliche Kultur. Und wir haben gelernt, dass die beiden nicht identisch sind. Wir sehen es heute, dass ein Kapitalismus ohne Bürgertum und ohne Proletariat möglich ist. Die alte Bourgeoisie existiert nicht mehr. Das alte Proletariat existiert nicht mehr. Die Gegenkultur des Kapitalismus, des alten Kapitalismus, die revolutionäre Arbeiterbewegung, existiert nicht mehr. Dennoch existieren die strukturellen Bedingungen des Kapitalismus – von der Warenproduktion und Lohnarbeit über die reelle Subsumption und das Kapital bis hin zum Zins-, Kredit-, Geldwesen und so weiter – weiter. Die Revolutionen und Konterrevolutionen des 20. Jahrhunderts haben Bürgertum, bürgerliche Kultur, bürgerliche Tradition, Aufklärung, bürgerlichen Humanismus, Liberalismus und die damit zusammenhängenden Kulturen vernichtet. Die Kommunisten in der Sowjetunion haben es nicht geschafft, den Kapitalismus zu vernichten. Der Staatskapitalismus ohne Bourgeoisie und der globale Marktkapitalismus ohne Bourgeoisie sind in dieser Hinsicht, obwohl in vielem verschieden, identisch, und die Grundstruktur des Kapitalismus sorgt nicht für dieselbe Kultur und dieselbe Geschichte. Die Revolutionen und die Konterrevolutionen des 20. Jahrhunderts sind gescheitert. Der Kapitalismus ist gleichwohl nicht vernichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die bürgerliche Demokratie in Europa auf verschiedene Weise wiedergeboren. Aber dass hier dennoch etwas nicht stimmt, obwohl alle Totalitarismen niedergeschlagen wurden und wir Demokraten gesiegt haben – dass trotzdem etwas nicht stimmt, das spüren wir, obwohl es keine totalitäre Gefahr mehr gibt. Ich glaube nicht, dass der Faschismus wiedergeboren wird – trotz der Sehnsucht nach Transgression, nach neuen Abenteuern, die das bürgerliche Zeitalter transzendieren. Aber es gibt eine weit verbreitete Skepsis gegenüber demokratischen und liberalen Republikanern, gegenüber republikanischen Institutionen. Man sucht in den ehemaligen Ostblockländern und in der Dritten Welt nach anderen »Lösungen« für die Probleme der Modernität, nach »Alternativen« zur Demokratie. Dies zeigt uns, dass jene Probleme und Ängste, die im Lebenswerk von Hannah Arendt exemplarisch und evokativ beschrieben sind, und die Unruhe, von der man im Werk des heute preisgekrönten Historikers lesen kann, nicht vergehen werden. Wir leben in einer Welt, in der die Immanenz der bürgerlichen Gesellschaft nicht stabil ist, auch nie stabil sein wird; wir werden mit diesen Gefahren, mit diesen Versuchungen und mit diesen Ängsten vor dem Bösen, vor Krieg und Tod weiter leben müssen. Es gibt keine endliche Lösung für die Probleme der Modernität. Wir haben gesehen, der Festvortrag des Preisträgers hat es uns sehr gut gezeigt, dass man mit der bürgerlichen, demokratischen und liberalen Friedfertigkeit und mit Nächstenliebe den Bewohnern der Pariser Banlieues und den anderen Leidenden in der gegenwärtigen Welt nicht kommen kann. Die werden nicht zuhören, die wollen das nicht mehr hören. Und wir, glaube ich, sollten auf eine neue Art, mit einer neuen Methode die Probleme und Ängste der neuen heimlosen Generationen verstehen und damit politisch umgehen
Das »Problem des Bösen« im Nachkriegs-Europa
Es ist mir eine große Ehre, heute hier in Bremen zu sein. Angesichts der berühmten früheren Empfänger des Hannah-ArendtPreises – unter ihnen Agnes Heller, François Furet, Claude Lefort und Yelena Bonner – bin ich sehr stolz, zu ihnen zu gehören. Außerdem ist es mir eine besondere Freude, einen Preis zu bekommen, der nach Hannah Arendt benannt ist. Wie so vielen scheint es auch mir, als hätte ich Arendt schon immer gekannt. In meinem Fall ist vielleicht die Reihenfolge erhellend, in der ich zu Arendts Schriften gekommen bin. Im Gegensatz zu den meisten Menschen meiner Generation war Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft nicht das erste Werk, das ich von Hannah Arendt gelesen habe. Es war auch nicht Vita activa oder Vom tätigen Leben, Über die Revolution oder gar Menschen in finsteren Zeiten. Mein erstes Arendt-Buch, das ich im Alter von fünfzehn Jahren gelesen habe, war Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen. Dieses Buch bleibt für mich die bezeichnende Arendt-Schrift. Es ist nicht ihr philosophischstes Buch. Es ist sicherlich nicht in allen Punkten richtig; und es ist ohne Zweifel nicht ihr populärstes Werk. Ich mochte das Buch nicht einmal, als ich es zum ersten Mal las – ich war damals noch sehr jung, ein begeisterter sozialistischer Zionist, und Arendts Schlussfolgerungen verstörten mich zutiefst. Doch mit den Jahren habe ich begriffen, dass Eichmann in Jerusalem Hannah Arendt in Höchstform zeigt: ein schmerzliches Thema frontal in Angriff nehmen; mutig von der herrschenden Meinung abweichen; nicht nur die Feinde, sondern gerade auch die Freunde zur Debatte herausfordern; und vor allem den bequemen Frieden der landläufigen Meinung stören. So werde ich Ihnen heute in Erinnerung an Hannah Arendt, die »Unruhestifterin«, einige Gedanken zu dem Thema anbieten, das sie mehr als jedes andere in ihren politischen Schriften beschäftigte.
1945, in einer ihrer ersten Abhandlungen nach dem Kriegsende in Europa, schrieb Hannah Arendt: »Das Problem des Bösen wird die fundamentale Frage des geistigen Lebens nach dem Krieg in Europa sein – so wie der Schrecken des Todes die fundamentale Frage nach dem letzten Krieg wurde.« Einerseits lag sie damit natürlich vollkommen richtig. Nach dem Ersten Weltkrieg waren die Europäer durch die Erinnerung an den Tod traumatisiert: vor allem durch den Tod auf dem Schlachtfeld, in einem bislang unvorstellbaren Ausmaß. Die Dichtung, die Literatur und das Kino im Zwischenkriegs-Europa waren besessen von Bildern der Gewalt und des Todes: im Allgemeinen auf kritische, aber manchmal auch auf eine nostalgische Weise (wie in den Schriften von Ernst Jünger oder Pierre Drieu la Rochelle). Und natürlich schwemmte die bewaffnete Gewalt des Ersten Weltkriegs auf vielfältige Weise in die Friedenszeit hinein: paramilitärische Gruppen, politische Morde, Staatsstreiche, Bürgerkriege und Revolutionen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand die Verherrlichung der Gewalt weitgehend aus dem europäischen Leben. Während dieses Krieges richtete sich die Gewalt nicht nur gegen die Soldaten, sondern vor allem gegen Zivilisten (denken Sie daran, dass die meisten Menschen während des Zweiten Weltkriegs nicht in der Schlacht starben, sondern im Zuge von Besetzung, ethnischer Säuberung und Völkermord). Die völlige Erschöpfung aller europäischen Nationen – der Gewinner ebenso wie der Verlierer – hinterließ wenig Illusionen über den Ruhm des Kampfes oder die Ehre des Todes. Was allerdings zurückblieb, war eine weit verbreitete Vertrautheit mit Brutalität und Verbrechen in einem nie zuvor gekannten Ausmaß. Die Frage, wie menschliche Wesen das einander antun konnten – und mehr als alles andere die Frage, wie und warum ein europäisches Volk – die Deutschen – sich aufmachte, um ein anderes – die Juden – zu vernichten, würde, das war für eine aufmerksame Beobachterin wie Arendt selbstverständlich die obsessive Frage, mit der sich der Kontinent konfrontiert sah. Das ist es, was sie mit dem »Problem des Bösen« meinte. Einerseits hatte Arendt, wie ich bereits sagte, natürlich Recht. Doch wie so oft in Arendts Fall, brauchten andere einige Zeit, um ihren Standpunkt zu begreifen. Es stimmt, dass Juristen und Gesetzgeber nach Hitlers Niederlage und den Nürnberger Prozessen den »Verbrechen gegen die Menschheit« und der Definition jenes neuartigen Verbrechens – des »Genozids« –, das bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal einen Namen hatte, sehr viel Aufmerksamkeit widmeten. Doch während die Gerichtshöfe die ungeheuerlichen Verbrechen zu definieren suchten, die gerade in Europa begangen worden waren, suchten die meisten Europäer zu vergessen. So gesehen hatte Arendt – wenigstens für einige Zeit – Unrecht. Weit entfernt davon, in den Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs über das Problem des Bösen zu reflektieren, wandten sich die meisten Europäer entschlossen davon ab. Heute fällt es uns schwer, das zu verstehen, doch Fakt ist, dass die Shoah – der versuchte Völkermord an den Juden Europas – zunächst nicht die zentrale Frage der Intellektuellen im Nachkriegs-Europa war. Die meisten Menschen – Intellektuelle und andere – ignorierten sie sogar, so gut sie konnten. Warum? In Osteuropa gab es dafür vier Gründe. Erstens wurde ein großer Teil der schlimmsten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs im Osten begangen; und obwohl die Verbrechen von den Deutschen getragen wurden, gab es unter Polen, Ukrainern, Letten, Kroaten und anderen keinen Mangel an willigen Kollaborateuren. Folglich war der Anreiz vielerorts groß, zu vergessen, was geschehen war und einen Mantel des Schweigens über das Grauen zu legen. Zweitens waren auch viele nicht-jüdische Osteuropäer Opfer einiger der schlimmsten Gräueltaten (begangen von Deutschen, Russen und anderen), und wenn sie sich an den Krieg erinnerten, dann dachten sie normalerweise nicht an das Leiden ihrer jüdischen Nachbarn, sondern an das eigene Leid und an die eigenen Verluste. Drittens geriet bis 1948 der größte Teil Zentral- und Osteuropas unter sowjetische Herrschaft. In der offiziellen sowjetischen Darstellung war der Zweite Weltkrieg ein antifaschistischer Krieg – oder, innerhalb der Sowjetunion, der Große Vaterländische Krieg. Für Moskau war Hitler vor allem ein Faschist und Nationalist. Sein Rassismus war weit weniger wichtig und vielleicht sogar verwirrend. Die Millionen toter Juden aus den sowjetischen Gebieten zählte man wie selbstverständlich unter die sowjetischen Verluste, ihre Zugehörigkeit zum Judentum wurde in den Geschichtsbüchern und bei öffentlichen Gedenkfeiern heruntergespielt oder gar verleugnet. Nach einigen Jahren hatte die Erinnerung an die kommunistische Unterdrückung die Erinnerung an die deutsche Besatzung ersetzt. Die Vernichtung der Juden wurde in den Hintergrund gedrängt.
In Westeuropa gab es ein ähnliches Vergessen, obwohl die Umstände ganz andere waren. Die Besatzung während des Krieges – in Frankreich, Belgien, Holland, Norwegen und, nach 1943, Italien – war eine demütigende Erfahrung. Sowohl die NachkriegsRegierungen als auch die Intellektuellen zogen es vor, die Kollaborationen und andere Erniedrigungen zu vergessen und stattdessen die heldenhaften Widerstandsbewegungen, Volksaufstände, Befreiungen und Märtyrer herauszustellen. Noch viele Jahre nach 1945 trugen sogar die, die es besser wussten – wie Charles de Gaulle –, bewusst zu einer nationalen Mythologie heroischen Leidens und mutigen Massenwiderstands bei, obwohl ihnen klar war, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Sogar in NachkriegsWestdeutschland war die anfängliche Stimmung eine des Selbstmitleids mit Deutschlands eigenem Leiden. Niemand – weder die Deutschen noch die Österreicher, die Franzosen, Holländer, Belgier oder Italiener – wollte sich an das Leid der Juden erinnern oder an das besondere Böse, welches es hervorgerufen hatte. Deshalb, um nur ein prominentes Beispiel zu nennen, lehnte der bedeutende italienische Verleger Einaudi 1946 die Veröffentlichung von Primo Levis Se questo è un uomo (sein autobiografischer Auschwitz-Bericht, hierzulande unter dem Titel Ist das ein Mensch? bekannt) kurzerhand ab. Damals und auch noch in den folgenden Jahren standen Bergen-Belsen und Dachau, nicht Auschwitz, für die Schrecken des Nazismus; die Hervorhebung der politischen statt der aus rassischen Gründen Deportierten passte besser zu den beschwichtigenden Nachkriegsberichten über den nationalen Widerstand während des Krieges. Levis Buch wurde schließlich doch noch veröffentlicht, allerdings nur in einer Auflage von 2 500 Exemplaren bei einem kleinen lokalen Verlag. Kaum jemand kaufte es; viele Exemplare landeten in einer Lagerhalle in Florenz und wurden dort in der großen Flut 1966 zerstört. Das mangelnde Interesse an der Shoah in jenen Jahren kann ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen – als jemand, der in England aufgewachsen ist, in einem Land also, das den Krieg gewonnen hat, niemals besetzt war und von daher keine Komplexe bezüglich Kriegsverbrechen haben sollte. Doch selbst in England wurde das Thema nie viel diskutiert – ob zu Hause, in der Schule oder in den Medien. Noch 1966, als ich mein Studium der modernen Geschichte an der Cambridge University begann, lernte ich in französischer Geschichte zwar einiges über Vichy-Frankreich, jedoch so gut wie nichts über die Juden oder den Antisemitismus. Niemand schrieb über das Thema. Ja, wir beschäftigten uns mit der Besetzung Frankreichs durch die Nazis, mit den Vichy-Kollaborateuren und den französischen Faschisten. Doch nichts von dem, was wir lasen, auf Englisch oder Französisch, beschäftigte sich mit dem Problem der Rolle Frankreichs bei der Endlösung. Und obwohl ich jüdisch bin und Mitglieder meiner eigenen Familie in den Todeslagern umgebracht wurden, erschien es mir damals nicht seltsam, dass das Thema nicht erwähnt wurde. Das Schweigen schien normal. Wie kann man rückblickend diese Bereitschaft erklären, das Inakzeptable zu akzeptieren? Wie kann das Anormale so normal erscheinen, dass wir es nicht einmal bemerken? Wahrscheinlich aus dem deprimierend einfachen Grund, den Tolstoi in Anna Karenina nennt: »Ein Mensch kann sich an alle Lebensumstände gewöhnen, wenn er muss, vor allem wenn alle um ihn herum diese akzeptieren.« Wie Sie wissen, begann sich nach den Sechzigerjahren alles zu ändern, aus vielerlei Gründen: unter anderem wegen der verstrichenen Zeit und der Neugier einer neuen Generation. In den 1980er-Jahren hatte die Geschichte der Vernichtung von Europas Juden eine zunehmende Bekanntheit in Büchern, im Kino und im Fernsehen erlangt. Seit den 1990er-Jahren sind offizielle Entschuldigungen, nationale Gedenkstätten, Denkmäler und Museen gang und gäbe; und sogar im postkommunistischen Osteuropa hat das Leid der Juden begonnen, seinen Platz im öffentlichen Gedenken einzunehmen. Heute ist die Shoah eine universelle Referenz. Kurse zur Geschichte der Endlösung oder des Zweiten Weltkriegs sind mitunter die einzigen in den Lehrplänen der Sekundarschulen vorgeschriebenen Geschichtskurse – insbesondere in Amerika und Großbritannien. Es gibt nunmehr buchstäblich Tausende von Studien über die Vernichtung der europäischen Juden während des Zweiten Weltkriegs: lokalhistorische wie philosophische Abhandlungen, soziologische wie psychologische Untersuchungen, Memoiren, Erzählungen, Spielfilme, Archive voll Interviews und vieles mehr. Es scheint, als ob Hannah Arendts Prophezeiung wahrgeworden ist: Die Geschichte des Problems des Bösen ist nun ein grundlegendes Thema des europäischen Geisteslebens.
I st jetzt also alles in Ordnung? Jetzt, wo wir in die dunkle Vergangenheit geblickt haben, sie beim Namen genannt und geschworen haben, dass sie sich niemals wiederholen darf? Ich bin mir da nicht so sicher. Lassen Sie mich fünf paradoxe Schwierigkeiten benennen, die sich aus unserer heutigen Beschäftigung mit der Shoah ergeben, mit dem, was jedes Schulkind heute als den »Holocaust« bezeichnet. Die erste Schwierigkeit betrifft das Dilemma unvereinbarer Erinnerungen. In Westeuropa ist die Erinnerung an die Endlösung heute universell (wenn auch in Spanien und Portugal weniger ausgeprägt). Doch die östlichen Staaten, die »Europa« seit 1989 beigetreten sind, haben aus den Gründen, die ich bereits erläutert habe, noch immer eine ganz andere Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und seine Lektionen. In der Tat hat es durch das Verschwinden der Sowjetunion und der damit einhergehenden Freiheit, die Verbrechen und Misserfolge des Kommunismus zu untersuchen und zu diskutieren, eine größere Aufmerksamkeit für die Qual von Europas östlicher Hälfte, verursacht durch Deutsche wie durch Sowjets, gegeben. In diesem Kontext ruft die westeuropäische und amerikanische Betonung von Auschwitz und den jüdischen Opfern einige Irritationen hervor. Wenn ich zum Beispiel in Polen und Rumänien oder in Kroatien darüber gesprochen habe, bin ich – von gebildeten, weltoffenen Zuhörern – gefragt worden, warum westliche Intellektuelle wie ich dem Massenmord an den Juden so viel Bedeutung beimessen? Was denn mit den Hunderttausenden, Millionen nicht-jüdischer Opfer des Nazismus und Stalinismus sei? Warum die Shoah das Verbrechen sei? Es gibt eine Antwort auf diese Frage, doch sie ist nicht selbstverständlich für alle östlich der Oder-Neiße- Grenze. Das mag uns nicht gefallen, doch wir sollten uns daran erinnern. In dieser Hinsicht ist Europa weit entfernt davon, vereinigt zu sein. Das zweite Paradox betrifft die historische Genauigkeit und die Risiken der Überkompensierung. Viele Jahre lang zogen es die Westeuropäer vor, nicht über die Leiden der Juden während des Krieges nachzudenken. Nun werden wir dazu ermutigt, ständig über dieses Leid nachzudenken. In den ersten Jahrzehnten nach 1945 kamen die Gaskammern nur am Rande unseres Verständnisses von Hitlers Krieg vor. Heute stehen sie im Zentrum. In moralischer Hinsicht ist es, wie es sein sollte: Das zentrale ethische Thema des Zweiten Weltkriegs ist »Auschwitz«. Doch für Historiker ist das sehr irreführend. Denn die traurige Wahrheit ist, dass die meisten Leute während des Zweiten Weltkriegs nicht über das Schicksal der Juden Bescheid wussten, und wenn sie es wussten, so kümmerte es sie nicht besonders. Es gab nur zwei Gruppierungen, für die der Zweite Weltkrieg vor allem ein Vorhaben war, um die Juden zu vernichten: die Nazis und die Juden selbst. Für alle anderen hatte der Krieg ganz andere Bedeutungen: Sie hatten ihre eigenen Sorgen. Wenn wir also darauf beharren, so wie wir es heute tun, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs vor allem – und manchmal ausschließlich – durch das Prisma des Holocaust zu lehren, so lehren wir vielleicht gute Moralvorstellungen, aber keine gute Geschichte. Und wenn man die Vergangenheit benutzt, um moralische Grundsätze zu lehren – selbst wenn es sich um die allerwichtigsten moralischen Grundsätze handelt – bezahlt man immer einen Preis dafür. Es fällt uns schwer zu akzeptieren, dass der Holocaust in unserem eigenen Leben eine wichtigere Rolle innehat als im Erleben der besetzten Länder zu Kriegszeiten. Doch wenn wir die wirkliche Bedeutung des Bösen – das, was Hannah Arendt meinte, als sie es »banal« nannte – begreifen wollen, dann müssen wir uns daran erinnern, was wirklich entsetzlich an der Vernichtung der Juden ist: nicht dass sie so viel, sondern dass sie so wenig bedeutete.
Mein drittes Paradox betrifft das Konzept des »Bösen« selbst. Die moderne säkulare Gesellschaft hat sich mit der Idee des »Bösen« lange unwohl gefühlt. Wir bevorzugen rationalere und gesetzliche Definitionen von gut und schlecht, richtig und falsch, Verbrechen und Strafe. Doch in den letzten Jahren hat sich das Wort langsam wieder in moralische und sogar politische Diskurse eingeschlichen. Doch nun, wo das Konzept des »Bösen« wieder in unsere öffentliche Sprache eingezogen ist, wissen wir nicht, was wir damit anfangen sollen. Im Westen wird das Wort heute üblicherweise verwendet, um das »einzigartige« Böse Hitlers und der Nazis zu bezeichnen. Doch hier geraten wir in Verwirrung. Der Völkermord an den Juden – der »Holocaust« – wird zuweilen als ein einzigartiges Verbrechen dargestellt, als ein Böses, das es nie zuvor und auch seither nicht mehr gegeben hat, als ein Beispiel und eine Warnung: »Nie wieder!« Andererseits berufen wir uns mitunter aus den verschiedensten und ganz und gar nicht einzigartigen Gründen auf eben dieses (einzigartige) Böse. In den letzten Jahren haben Politiker, Historiker und Journalisten den Begriff des »Bösen« verwendet, um beabsichtigte Völkermorde überall auf der Welt und ihre Folgen zu beschreiben: von Kambodscha bis Ruanda, von der Türkei bis zum Sudan. Sie alle kennen zweifellos die »Achse des Bösen« von Präsident George Bush. Sogar Hitler selbst wird nun zu vielen Gelegenheiten heraufbeschworen, um die »böse« Natur und die Absichten moderner Diktatoren zu bezeichnen: Es wird uns erzählt, dass es überall »Hitlers« gibt, von Nordkorea über den Irak bis hin zum Iran. Wenn aber Auschwitz und der Völkermord an den Juden für das einzigartige Böse stehen, warum werden wir dann laufend gewarnt, es könne überall passieren oder stünde erneut unmittelbar bevor? Wann immer jemand die Mauer einer Synagoge in Frankreich mit antisemitischen Graffitis beschmiert oder ein russischer Politiker nostalgische Gefühle für Stalin bekundet, werden wir gewarnt, dass »das einzigartige Böse« wieder um uns ist, dass alles wieder wie 1938 ist. Wir verlieren die Fähigkeit zu unterscheiden: zu unterscheiden zwischen den normalen Sünden und Verrücktheiten der Menschheit – Dummheit, Vorurteil, Demagogie und Fanatismus – und dem echten (genuin) Bösen. Wir haben aus den Augen verloren, was an den politischen Religionen der extremen Linken und extremen Rechten des 20. Jahrhunderts so verführerisch war, so gewöhnlich, so modern und dadurch wahrhaft diabolisch. Wenn wir das Böse doch überall sehen, wie können wir dann das Echte erkennen? Vor sechzig Jahren befürchtete Hannah Arendt, dass wir nicht wüssten, wie wir über das Böse sprechen sollen und dass wir deshalb seine Bedeutung niemals begreifen würden. Heute sprechen wir ständig von dem »Bösen« – mit dem Ergebnis, dass wir seine wahre Bedeutung vergessen haben.
Mein viertes Paradox betrifft das Risiko, das wir eingehen, wenn wir alle unsere emotionalen und moralischen Energien in nur ein Problem investieren, wie groß es auch sein mag. Die Gefahr unserer gegenwärtigen Beschäftigung mit dem Völkermord an den Juden ist, dass wir uns an ein großes Böses erinnern, jedoch auf Kosten des Vergessens der vielen kleineren, mit denen wir uns auch befassen sollten. Der Preis für diese Art von Tunnelblick kommt heute bei Washingtons »Krieg gegen den Terror« schmerzlich zum Ausdruck. Die Frage ist nicht, ob es Terrorismus gibt – natürlich gibt es ihn –, noch ob Terrorismus und Terroristen bekämpft werden sollten – natürlich sollten sie bekämpft werden. Die Frage ist, welches andere Böse wir vernachlässigen – oder erzeugen –, indem wir uns auf ausschließlich einen Feind konzentrieren und ihn dazu benutzen, Hunderte unserer eigenen, geringeren Verbrechen zu rechtfertigen. Das Gleiche gilt für unsere gegenwärtige Faszination für das Problem des Antisemitismus und unser Beharren auf seine einzigartige Bedeutung. Antisemitismus ist genau wie Terrorismus ein altes Problem. Und wie beim Terrorismus, so beim Antisemitismus: Schon ein kleiner Ausbruch erinnert uns daran, welche Folgen es in der Vergangenheit hatte, dass wir ihn nicht ernst genug genommen haben. Aber: Antisemitismus ist ebenso wie Terrorismus nicht das einzige Böse in der Welt und darf keine Entschuldigung dafür sein, andere Verbrechen und andere Leiden zu ignorieren. Die Gefahr dabei, »Terrorismus« oder Antisemitismus von ihren jeweiligen Kontexten zu abstrahieren – sie als größte Gefahr für die westliche Zivilisation oder die Demokratie oder »unsere Lebensart« auf ein Podest zu setzen und ihren Vertretern mit einem unbegrenzten Krieg zu drohen – bedeutet, die vielen anderen Herausforderungen unserer Zeit zu vernachlässigen. Auch hierzu hat Hannah Arendt etwas gesagt. Als Autorin des einflussreichsten Buches über den Totalitarismus war sie sich vollkommen im Klaren über die Bedrohung, die er für offene Gesellschaften darstellte. Doch in der Ära des Kalten Krieges lief der »Totalitarismus«, wie heute der Terrorismus oder Antisemitismus, Gefahr, unter Ausschluss alles anderen zu einer zwanghaften Beschäftigung der Denker und Politiker im Westen zu werden. Dagegen sprach Arendt eine Warnung aus, die auch heute noch relevant ist: »Die größte Gefahr darin, im Totalitarismus den Fluch dieses Jahrhunderts zu sehen, bestünde in einer Besessenheit von ihm, die uns blind werden ließe für die unzähligen kleinen und weniger kleinen Übel, mit denen der Weg zur Hölle gepflastert ist.«
Mein letztes Paradox werden Sie vielleicht etwas provokant finden. Es betrifft die Beziehung zwischen der Erinnerung an den europäischen Holocaust und dem heutigen Staat Israel. Seit seiner Geburt 1948 hatte der Staat Israel ein komplexes Verhältnis zur Shoah. Einerseits lieferte die Beinahevernichtung von Europas Juden die Grundlage für den Zionismus: Die Überzeugung, dass es für Juden unmöglich wäre, in nicht-jüdischen Ländern zu überleben und sich zu entwickeln, dass ihre Integration und Assimilation an europäische Nationen und Kulturen ein tragischer Irrglaube war und dass sie einen eigenen Staat brauchten. Andererseits bedeutete die weit verbreitete israelische Sicht, dass die europäischen Juden zu ihrem eigenen Untergang beitrugen, sie, wie es hieß, »wie Lämmer zur Schlachtbank« gingen, dass Israels ursprüngliche Identität sich auf das Zurückweisen der jüdischen Vergangenheit gründete sowie auf die Behandlung der jüdischen Katastrophe als ein Zeichen der Schwäche: Eine Schwäche, die zu überwinden Israels Aufgabe war, indem es eine neue Art von Juden hervorbrachte. In den letzten Jahren hat sich das Verhältnis zwischen Israel und dem Holocaust jedoch verändert. Wenn sich Israel heute internationaler Kritik ausgesetzt sieht – wegen seines falschen Umgangs mit den Palästinensern und wegen der Besiedlung der Gebiete, die es 1967 erobert hatte –, verweisen die Verteidiger der israelischen Politik vielfach auf die Erinnerung an den Holocaust. Wer Israel zu scharf kritisiere, so warnen sie, wecke nur den Antisemitismus; Sie behaupten sogar, dass eine offensive Kritik an Israel – also ein Antizionismus, wenn Sie so wollen – nicht nur Antisemitismus weckt. Nein: Es ist Antisemitismus. Und mit dem Antisemitismus ist der Weg nach vorn – oder zurück – frei: zum Jahr 1938, zur Kristallnacht und von dort nach Treblinka und Auschwitz. Wenn Sie wissen wollen, so sagen sie, wohin Antizionismus führt, müssen Sie nur Yad Vashem in Jerusalem besuchen, das Holocaust-Museum in Washington oder unzählige Gedenkstätten und Museen in ganz Europa. Ich verstehe die Emotionen hinter diesen Behauptungen. Doch meiner Ansicht nach sind die Behauptungen selbst außerordentlich gefährlich. Wenn mir gesagt wird, dass ich meine Kritik an Israel besser nicht zu laut äußern sollte, aus Angst, die Geister des Antisemitismus heraufzubeschwören, dann antworte ich, dass es genau andersherum ist. Lassen Sie mich das erklären. Viele Jahre lang habe ich Gymnasien insbesondere in den USA, Großbritannien und Frankreich besucht und dort über die Nachkriegsgeschichte Europas und die Erinnerung an die Shoah referiert. Ich unterrichte diese Themen auch an meiner Universität. Und ich kann über meine Entdeckungen berichten. Die heutigen Studenten müssen nicht an das Problem des Bösen erinnert werden, an die historischen Folgen des Antisemitismus oder den Völkermord an den Juden. Sie wissen alles darüber – ganz im Unterschied zu ihren Eltern. Und so soll es auch sein. Doch es hat mich getroffen, wie oft Studenten mich in den letzten Jahren gefragt haben: »Warum lernen wir nur etwas über den Holocaust?« oder »Warum ist dieser Fall so besonders?« oder »Wird die Bedrohung durch Antisemitismus nicht übertrieben?« oder – und immer öfter – »Dient der Holocaust für Israel nicht als Entschuldigung, sich zu verhalten, wie es ihm beliebt?« In den 1980er-Jahren habe ich diese Fragen nicht gehört, und in den 1990er-Jahren habe ich sie nur in bestimmten Teilen Osteuropas gehört. Heute höre ich sie immer öfter, überall. Meine Befürchtung ist, dass zweierlei passiert ist. Durch die Betonung der historischen Einzigartigkeit des Holocaust und die gleichzeitige Bezugnahme auf ihn, wenn es um heutige Vorkommnisse geht, haben wir die jungen Menschen verwirrt. Und wenn wir jedes Mal, wenn jemand Israel angreift oder die Palästinenser verteidigt, »Antisemitismus« schreien, so ziehen wir Zyniker heran. Denn die Wahrheit ist, dass Israel heute nicht in existenzieller Gefahr ist. Heute sind die Juden hier im Westen keinen Bedrohungen oder Vorurteilen ausgesetzt, die im Entferntesten mit den damaligen vergleichbar wären – oder vergleichbar mit den Vorurteilen gegen andere Minderheiten. Fragen Sie sich selbst: Würden Sie sich heute sicherer, akzeptierter, willkommener fühlen als Muslim in den USA? Als Pakistani in England? Als Marokkaner in Holland? Als »beur« in Frankreich? Als Schwarzer in der Schweiz? Als »illegaler Einwanderer« in Dänemark? Als Rumäne in Italien? Als Türke in Deutschland? Als Zigeuner irgendwo in Europa? Oder würden Sie sich sicherer, integrierter, akzeptierter fühlen als Jude in all diesen Orten? Ich denke, Sie kennen die Antwort. Ich weiß, ich kenne sie.
Wenn es eine Bedrohung für die Juden – und jeden anderen – gibt, so kommt sie aus einer anderen Richtung. Wir haben die Erinnerung an den Holocaust so fest mit der Verteidigung Israels verbunden, dass wir Gefahr laufen, die moralische Bedeutung dieser Erinnerung zu schmälern und sie zu provinzialisieren. Das Problem des Bösen im letzten Jahrhundert, um Hannah Arendt noch einmal zu bemühen, mag sich in der Form eines Versuchs der Deutschen gezeigt haben, die Juden zu vernichten. Aber es betrifft nicht nur die Deutschen, und es betrifft nicht nur die Juden. Es betrifft sogar nicht nur Europa, obwohl es hier geschehen ist. Das Problem des Bösen – des totalitären Bösen oder genozidalen Bösen – ist ein universelles Problem. Doch wenn es ständig für eigennützige oder regionale Zwecke verwendet wird – um Israel zu verteidigen oder Antisemitismus zu geißeln oder Kritiker der amerikanischen Außenpolitik zum Schweigen zu bringen – dann wird die Erinnerung an das Böse bald seine Universalität einbüßen. Was dann passieren wird (und schon passiert) ist, dass diejenigen, die einen gewissen Abstand zur Erinnerung an das europäische Verbrechen haben – weil sie keine Europäer sind oder weil sie zu jung sind, um sich daran zu erinnern, warum es wichtig ist –, nicht verstehen werden, was diese Erinnerung mit ihnen zu tun hat, und sie werden uns nicht länger zuhören, wenn wir ihnen erzählen, warum das wichtig ist und was es bedeutet. Wenn Sie mir nicht glauben, stellen Sie die Frage einem heutigen europäischen Oberstufenschüler. Oder gehen Sie nach China oder Sambia oder Peru und fragen, welche Lektionen Auschwitz uns erteilt. Ich glaube, Sie werden die Antworten sehr beunruhigend finden. Es gibt keine einfache Antwort auf dieses Problem, ebenso wenig wie es eine einfache Antwort auf die anderen Paradoxe gibt, die ich angesprochen habe. Was heute für Westeuropäer offensichtlich erscheint, ist für viele Osteuropäer unklar, so wie es auch vor vierzig Jahren für Westeuropäer unklar war. Die moralischen Lektionen von Auschwitz, die sich überdimensional auf der Erinnerungsleinwand der Europäer abzeichnen, sind für Asiaten oder Afrikaner weitgehend unsichtbar. Und, vielleicht zuallererst, was für die Menschen meiner Generation offensichtlich scheint, wird für unsere Kinder und Enkelkinder sehr wenig Sinn ergeben. Also: Wie können wir eine europäische Vergangenheit bewahren, die nun von Erinnerung zu Geschichte verblasst? Ich bin mir nicht sicher, dass wir es können. Vielleicht sind wir dazu verdammt, die Vergangenheit zu verlieren. Vielleicht sind alle unsere heutigen Museen und Gedenkstätten und obligatorischen Schulausflüge kein Zeichen dafür, dass wir bereit sind, uns zu erinnern, sondern vielmehr ein Hinweis darauf, dass wir meinen, unsere Buße getan zu haben und nun beginnen können, loszulassen und zu vergessen, den Steinen an unserer Stelle das Erinnern zu überlassen. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass die Geschichte, wenn sie ihren Auftrag erfüllen soll, den Nachweis vergangener Verbrechen und von allem anderen für immer zu bewahren, dann muss sie in Ruhe gelassen werden. Wenn wir die Vergangenheit für heutige Ziele instrumentalisieren – die Stücke herausfiltern, die unseren Zwecken dienen können, oder die Geschichte heranziehen, um einfache moralische oder politische Lektionen zu erteilen –, werden dabei schlechte moralische Grundsätze und eine schlechte Geschichtsschreibung herauskommen. Einstweilen sollten wir alle vielleicht etwas mehr aufpassen, wenn wir vom Problem des Bösen sprechen. Denn es gibt mehr als eine Art von Banalität. Es gibt die berühmte Banalität, von der Arendt gesprochen hat – das beunruhigende, normale, nachbarliche, alltägliche Böse in den Menschen. Aber es gibt noch eine andere Banalität: die Banalität der Überbeanspruchung – der verflachende, desensibilisierende Effekt, der eintritt, wenn wir dieselbe Sache zu oft sehen oder sagen oder denken, bis wir schließlich unser Publikum betäubt und immun gemacht haben gegen das Böse, das wir beschreiben. Und das ist die Banalität – oder »Banalisierung« –, vor der wir heute stehen.
Die Generation unserer Eltern hat nach 1945 das Problem des Bösen beiseite geschoben, weil es – für sie – zu viel Bedeutung enthielt. Die Generation nach uns läuft Gefahr, das Problem beiseite zu schieben, weil es nunmehr zu wenig Bedeutung enthält. Wie können wir das verhindern? In anderen Worten, wie können wir sicherstellen, dass das Problem des Bösen die fundamentale Frage für Europas Intellektuelle bleibt? Ic1h kenne die Antwort nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es die richtige Frage ist. Es ist die Frage, die Hannah Arendt vor sechzig Jahren gestellt hat, und ich glaube, sie würde sie auch heute noch stellen. Übersetzung aus dem Englischen von Ute Szczepanski
Lieber Tony Judt, lieber Christian Weber als Präsident der Bremischen Bürgerschaft, liebe Karo und Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Seit 13 Jahren gibt es den HannahArendt-Preis für politisches Denken, der im Sommer 1994 gegründet wurde, und zum 13. Mal vergeben wir unseren Preis. Auf keiner Ebene gibt es finanzielle Selbstverständlichkeiten mehr. Bremen büßt jetzt für die Ausgaben der vergangenen Jahre. Jeder Cent wird einmal umgedreht, bevor er ausgegeben wird, und da ist es keineswegs selbstverständlich, dass dieser Preis immer noch seinen Anteil bekommt. Was geschehen ist. Vielen Dank dafür an die Stadt. Wenn der Hannah-Arendt-Preis eine Kontinuität hat und ihn etwas auszeichnet, dann ist es der Mut der Preisträger, gegen Widerstände, welcher Art auch immer, sich das politische Denken nicht verbieten zu lassen: Sie sehen hier die Namen und bei Agnes Heller, Jelena Bonner, Dany Cohn-Bendit und den anderen fallen fast jedem von uns Ereignisse und Geschichten dazu ein. Sie stehen damit in guter Tradition mit Hannah Arendt, die gerade da, wo es ihr am wichtigsten war, am leidenschaftlichsten gekämpft hat. Einen Konflikt teilte sie mit unserem heutigen Preisträger: die Frage, wie und wo Juden nach dem Holocaust weiterleben können. In den Dreißigerjahren hatte Hannah Arendt dabei geholfen, jüdische Kinder nach Palästina zu retten und war selbst dort gewesen. Später, Anfang der Vierzigerjahre, als sie schon in New York für den Aufbau schrieb, kämpfte sie für eine jüdische Armee. Sie kennen die Aussage: »Wenn du als Jude angegriffen wirst, musst du dich als Jude wehren.« Sie begleitete aber die Entstehung des Nationalstaates Israel mit großer Skepsis. Am 16. März 1945 schrieb sie im Aufbruch: »Ein jüdisches Nationalheim, das von dem Nachbarvolk nicht anerkannt und nicht respektiert wird, ist kein Heim, sondern eine Illusion – bis es zu einem Schlachtfeld wird.« Natürlich machte sie sich damit keine Freunde unter den Menschen, die ihr wichtig waren. Und spätestens nach ihrem Eichmann-Buch, Anfang der Sechzigerjahre, war sie für viele eine Persona non grata geworden. Sie lasse es an Liebe zum jüdischen Volk fehlen, hielten ihr der bis dahin gute Freund Gershom Scholem und später auch Arno Lustiger vor. Heute, glaube ich, würde Hannah Arendt kaum jemand mehr mangelnde Empathie für das jüdische Volk vorwerfen. David Grossmann, neben Amos Oz einer der bekanntesten israelischen Schriftsteller, erzählte im April dieses Jahres in New York auf dem PEN-Festival »World voices« davon, dass sein Sohn im Libanonkrieg gefallen ist. »Ja, es fällt schwer, von sich selbst zu sprechen. Deshalb möchte ich ein paar Worte darüber sagen, wie sich ein Schicksalsschlag oder eine traumatische Situation auf ein ganzes Volk auswirkt. Dabei kommt mir sofort die Maus in Kafkas Kurzgeschichte ›Kleine Fabel‹ in den Sinn: ›Eingekeilt zwischen der Falle vor und der lauernden Katze hinter sich, sagt die Maus: Ach die Welt wird enger mit jedem Tag.‹ Nach den vielen Jahren, die ich in Israel, also in der extremen Realität eines politischen, militärischen und religiösen Dauerkonflikts verbracht habe, muss ich Ihnen bestätigen, dass Kafkas Maus Recht hatte: Die Welt wird tatsächlich mit jedem Tag enger und bedrängender.« Für Grossmann ist es das Schreiben, für andere das Denken, was den Raum wieder größer werden lässt. Es braucht solche Leute wie Hannah Arendt und heute auch Tony Judt, der in der jüdischen Öffentlichkeit unter polemischem Beschuss steht, und da geht es nicht um die Bewertung von Vorschlägen, sondern um die Kraft, die Denken, Streit und Weiterdenken entfalten können. Kurz ein anderes Beispiel, Dieter Senghaas hat mich darauf aufmerksam gemacht. In der neuesten Ausgabe des New York Review of Books bespricht Tony Judt ein Buch von Robert B. Reich: Superkapitalismus: Wie die Wirtschaft unsere Demokratie untergräbt. Superkapitalismus steht bei Reich für Globalisierung. In seiner Besprechung des Buches kritisiert Judt den Preis des Superkapitalismus, wie Reich ihn entwirft. Für ihn bedeutet es die Durchökonomisierung aller Lebensbereiche. Reich setzt auf ein »integriertes System des globalen Kapitalismus«, das Wirtschaftswachstum und Produktivität gegen Klassenkämpfe, Revolutionen und Fortschritt setzt und kommt mit Margret Thatcher zu dem Ergebnis »There is no alternative.« Ich erzähle das nur der Denkfigur wegen, weil ich mich hier nicht ernsthaft auf die Argumente einlassen kann. Politik, politische Öffentlichkeit und Demokratie brauchen die Freiheit, Alternativen denken zu können und zu dürfen, ohne von Ausgrenzung bedroht zu werden: Das gilt für die scheinbar unausweichlichen Mechanismen der Globalisierung genauso wie für die Fragen nach der Zukunft Israels. Antonia Grunenberg hat in ihrer Jurybegründung andere Felder mit dringendem Diskussionsbedarf benannt. Abschließend möchte ich noch die Jury zu ihrer Wahl beglückwünschen und mich bei ihr für ihre Arbeit bedanken und freue mich jetzt auf den Festvortrag von Tony Judt, in dem er Ihnen zeigen wird, dass er den Preis zu Recht erhalten hat.
Vielen Dank!
SICH DER DISKUSSION STELLEN
Sehr geehrte Frau Grunenberg, sehr geehrter Herr Judt, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie hier in der Oberen Rathaushalle im Namen des Senats zur 13. Verleihung des Hannah-ArendtPreises für politisches Denken begrüßen. Hannah Arendt war zeit ihres Lebens eine mutige Denkerin, die auch die harten persönlichen Auswirkungen ihrer Meinungen nicht fürchtete. Sie hat nichts davon gehalten, durch ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Gruppe ihre kritische Haltung zu allem zu vergessen. Immer wieder stellte sie sich mit ihren Äußerungen abseits der herrschenden Meinung und scheute auch nicht Konflikte mit ihren Freunden. Nie verstand sie sich als Sozialistin oder Kommunistin, aber sie begriff sich auch nicht durchgehend als Zionistin. Ihr persönlicher Mut und ihre Zivilcourage zeigen sich in ihrem gesamten Lebensweg. Sei es bei der Unterstützung jüdischer Organisationen zur Zeit des Nationalsozialismus, aber auch bei ihren Reisen ins Nachkriegsdeutschland und bei ihrer Berichterstattung über den Eichmann-Prozess in Israel. Ihre öffentlichen und persönlichen Stellungnahmen zu politischen Ereignissen waren häufig unter Gegnern, aber auch unter Freunden umstritten. Freiheit und Gerechtigkeit waren für Hannah Arendt zentrale Begriffe. Sie hielt nichts davon, dem Denken Tabus aufzuerlegen. Arendt besaß eine tief sitzende Abneigung gegenüber umfassenden Weltanschauungen und Lehren vom Ganzen. In den USA, wo sie seit ihrer Emigration aus dem nationalsozialistischen Deutschland lebte, setzte sie sich mit der Diskriminierung der Schwarzen und dem Vietnam-Krieg auseinander. Sie befasste sich aber auch mit der Studentenrebellion von 1968. In diesem Zusammenhang stellte sie fest, dass die guten Episoden in der Geschichte gewöhnlich von kurzer Dauer sind. Für Hannah Arendt war das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, das Recht, Rechte zu haben, ein hohes Gut. Es handele sich beim Rechtsstaat um die Herrschaft der Gesetze und nicht um diejenige der Menschen. Hannah Arendt hatte sich stets gegen die Vorstellung einer Kollektivschuld gewandt. Für sie ist der Mensch ein frei handelndes, für seine Taten verantwortliches Wesen. Die Schuld haben konkrete Personen auf sich geladen. Sie äußerte in diesem Zusammenhang, »wo alle schuldig sind, da ist es niemand ...« Arendt wies stets darauf hin, dass eventuell auch sie unter bestimmten Bedingungen die hohen Anforderungen der persönlichen Verantwortung nicht erfüllt hätte: »Wer hat je behauptet, dass ich, indem ich ein Unrecht beurteile, unterstelle, selbst unfähig zu sein, es zu begehen?« Als Hannah Arendts Buch über den Eichmann-Prozess im Jahre 2000 in Tel Aviv als erstes ihrer Werke in einer hebräischen Ausgabe erschien, sorgte das Buch wieder für eine Diskussion. Arendt wurde ein grundsätzlicher Antizionismus vorgeworfen und ihre kritische Auffassung über die Rolle der Judenräte und der Begriff der »Banalität des Bösen« im Zusammenhang mit dem Eichmann-Prozess stieß auf Ablehnung. Hannah Arendt äußerte in einer Rede zur Verleihung des Lessing-Preises 1959, Ziel sei das freie Denken »ohne das Gebäude der Tradition« mit Intelligenz, Tiefsinn und Mut. Eine absolute Wahrheit existiere nicht, da sie sich im Austausch mit anderen sofort in eine »Meinung unter Meinungen« verwandle und Teil des unendlichen Gesprächs der Menschen sei, in einem Raum, wo es viele Stimmen gibt. Jede einseitige Wahrheit, die nur auf einer Meinung beruht, sei »unmenschlich«. Nun will ich einige Worte zu dem Preis sagen, der heute verliehen wird. Dieser Preis wird seit 1995 durch den Verein »Hannah-Arendt-Preis für kritisches Denken« verliehen. Die Mitgliederversammlung des Vereins bestimmt eine internationale Jury, die über die Preisträgerin oder den Preisträger berät und entscheidet. Das Grundprinzip dabei ist Unabhängigkeit und Eigenverantwortung. Die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bremer Senat stiften zwar gemeinsam das Preisgeld, nehmen aber keinen Einfluss auf die Regularien des Vereins und die Entscheidungen der Jury. Ziel der Preisvergabe ist es, die öffentliche Diskussion über strittige politische Fragen zu stimulieren. Die diesjährige Entscheidung hat bereits im Vorfeld zu Kontroversen geführt. Die jüdische Gemeinde in Bremen hat sich in einem offenen Brief gegenüber der Hannah-Arendt-Jury, der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Senat geäußert und die Haltung des diesjährigen Preisträgers Tony Judt zu Israel kritisiert. Ich muss nun die Verbindung der Preisverleihung durch den Verein Hannah-Arendt-Preis mit einer etwa dadurch zum Ausdruck gebrachten antiisraelischen Haltung des Bremer Senats deutlich zurückweisen. Wie sicherlich vielen der hier Anwesenden bekannt ist, unterhält Bremen seit vielen Jahren gute und enge Beziehungen zu Haifa. Diese Städtepartnerschaft umfasst seit 1978 zahlreiche Bereiche, die im regen Austausch miteinander stehen. Die tragende Institution ist die Stiftung Kulturfonds Haifa. Seit 1988 gibt es eine Rahmenvereinbarung, in der Ziele der Zusammenarbeit auf dem Gebiet von kommunaler Wirtschaft, des Tourismus, der Kultur und des Umweltschutzes formuliert werden. Gegenseitige Besuchsdelegationen von Schulen, Universitäten, Bürgerinnen und Bürgern, Abgeordneten finden regelmäßig statt. Nicht so offiziell, aber trotzdem von Bedeutung, seien hier aber auch noch die Kontakte zu Haifas arabischer Nachbargemeinde Tamra erwähnt. Im nächsten Jahr werden zahlreiche Aktivitäten in Bremen anlässlich des 60. Jahrestages der Gründung Israels stattfinden, an denen der Senat, die Deutsch-Israelische Gesellschaft, der Verein Bremer Freunde Israels, die Universität, die Bremische Bürgerschaft, die Landeszentrale für politische Bildung, die Volkshochschule, die Jüdische Gemeinde und viele andere beteiligt sind. Nun, es ist der diesjährigen Preisverleihung, der Entscheidung der Jury für den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken an den Historiker Tony Judt, zweifellos gelungen, eine öffentliche Diskussion anzustoßen. Herr Judt, ich gratuliere Ihnen herzlich zu diesem Preis! – Sie haben diesen Preis auch erhalten, weil Sie mutig, unerschrocken und vielleicht unbequem ihre Vorstellungen vertreten. Auf diese Weise hat man natürlich nicht immer Recht. Allerdings ist es sehr wichtig, zu seinen Meinungen – ohne Starrsinn – zu stehen. Aber genauso wichtig ist es auch, dass man bereit ist, sich der Diskussion zu stellen und in der Auseinandersetzung dazuzulernen. Auf diese Weise kann ein Dialog zu fruchtbaren Ergebnissen führen. Ich bin mir sicher, Hannah Arendt hätte diese Diskussion zugelassen und engagiert geführt.
I t’s a great honour, because Hannah Arendt is one of the most influential writers in my own intellectual life and because she stands for a certain kind of political honesty in public debate, which I admire greatly.« Mit diesem O-Ton wird Tony Judt am 29.11.07, einen Tag vor der Preisverleihung, im Hörfunk von WDR 3 Tageszeichen und von NDR Kultur Journal vorgestellt. Autor Wolfgang Stenke präsentiert den jüdischen Historiker nicht nur als einen Verfechter des Meinungsstreites, indem er einige Beispiele von Konflikten um Judts pointierte Meinungen oder Maßnahmen der Druckausübung jüdischer Interessenverbände in den USA aufzeigt. Denn es gab auch von einem akuten Streit um den Preisträger zu berichten: »Doch der Gelehrte ist zugleich ein scharfer Kritiker der israelischen Regierungspolitik. In dieser Eigenschaft erschien der Historiker dem Präsidium der Jüdischen Gemeinde Bremen durchaus nicht als preiswürdig. In einem offenen Brief an die Jury, den Bremer Senat und die Heinrich-Böll-Stiftung, die die Auszeichnung vergeben, schreiben die Repräsentanten der Gemeinde ...« Der Weserkurier vom 1.12.07 führt die Namen zweier Vorstandsmitglieder an, nämlich Elvira Noa und Grigori Pantijelew. Das Radiofeature führt Passagen dieses Briefes an: »Wenn einer – jahrein, jahraus – sagt: Israel sei ›umstritten‹, ... ›ein Besatzer und Kolonialist‹, ›eine strategische Belastung‹, ›ein politischer Anachronismus« etc., stellt sich die Frage, was das soll? Wir würden sagen, das ist keine Kritik an einer Regierung, sondern eine antiisraelische Haltung.« Im Feature wird Judt im O-Ton dagegengestellt: »Offensichtlich haben sie nur einen meiner Artikel gelesen und sind, wie es scheint, deshalb kaum in der Lage zu urteilen. Ich habe vor Jahren in Israel gelebt. Vielleicht weiß ich ein wenig mehr über den Mittleren Osten als einige Leute von der Jüdischen Gemeinde in Bremen. Es ist schade, dass sie sich in der Frage, wer über Israel sprechen darf, zu Autoritäten aufschwingen.« Stein des Anstoßes ist für den Autor vor allem Tony Judts Essay »Israel: die Alternative«, des Historikers Plädoyer für einen binationalen Staat für Juden und Palästinenser. O-Ton: »Die Tragödie ist, dass ein rein jüdischer Staat zunehmend unmöglich wird, da die Araber in dem von Israel beherrschten Territorium bald die Mehrheit haben werden. Nach meiner Ansicht wäre eine Zweistaatenlösung immer noch die beste, aber die wird sich kaum auf eine für beide Seiten akzeptable Weise finden lassen. Und das ist eine Wahrheit, die vielen meiner Kritiker sehr unangenehm ist.« Robert Best im Weserkurier bemerkt, »eine vergleichbare Empörung gab es in der 13-jährigen Geschichte des HannahArendt-Preises noch nie«. Unter der Schlagzeile »Eine umstrittene Ehrung« zitiert auch er aus dem offenen Brief, ist jedoch bemüht um eine differenzierte Berichterstattung, indem er die Sachprobleme ins Zentrum rückt, die auch im Radio-Feature behandelt werden. »Israel sei jedoch nicht geholfen, wenn man über seine ›aggressive Politik‹ schweige. Vielmehr sei es das Schweigen selbst – auch das über die Vernichtung der Juden in Europa –, das Vorurteile erzeuge«, fasst er ein Wort Judts zusammen. Das ist auch die zentrale Passage eines Artikels von Verena Luecken in der FAZ am 3.12.07: »Judt ... lehnte diesen Angriff in Bremen als Anmaßung ab. Er besteht darauf, dass zwischen Kritik und Antisemitismus unterschieden werden müsse. Die Kritiker könnten ›nicht anderen Juden sagen, was sie tun oder lassen sollen‹. Es sei für Israel nicht hilfreich, wenn man über dessen ›aggressive Politik‹ schweige ... Judt bestätigte mit seinen Äußerungen seinen Ruf als politisch provokanter Vordenker.« Sie leitet den Schluss ihres Artikels mit dem Charakter des Preises und der Begründung der Jury ein, »dass er (Judt) sich wie frühere Preisträger durch Widerstände nicht das politische Denken verbieten lasse«. Dagegen scheint Klaus Wolschner von der taz Nord (27.11.07) das kritische Augenmaß bei der Jury zu vermissen: »In der Begründung der Jury für die Wahl des Preisträgers wird auf dessen kritische Position zu dem Staat Israel nicht eingegangen.« Auf Positionen lässt sich sein Artikel allerdings nicht ein, sondern hängt sich an eine Formulierung des offenen Briefes an: »›Sein Programm des binationalen Staates ist, nach treffenden Worten Leon Wieseltiers, keine Alternative für Israel, sondern die Alternative zu Israel‹, schreibt Elvira Noa.« Er folgt auch der Kritik, Judt »sei als Historiker bei weitem nicht so anerkannt und gepriesen wie als Israel-Kritiker. In der Tat ist Judt in den USA vor allem durch die Auseinandersetzung mit der Israel-Lobby in den Medien bekannt geworden.« Einen scheinbar unparteiischen Kommentar, »Lob und Tadel«, entbietet Frank König in der Jüdischen Zeitung (Dez. 2007). Zunächst stellt er den Preis und den Preisträger dar, man möchte sagen, angenehm distanziert. Vielleicht eine Spur zu objektiv, denn zu Hannah Arendt fällt ihm nur ein knappes Zitat von Rita Süssmuth ein. Aber auch das Präsidium der Jüdischen Gemeinde ist nur das »besagte Präsidium«, Distanz also allerorten. Alle haben bestimmte Meinungen und Kritiken und kommen zu Wort, den LeserInnen wird eine kleine Demokratielektion geboten. Interessant ist, dass Tony Judt in der Sache nicht zu Wort kommt, dafür sein Kritiker Micha Brumlik ein bisschen mehr als alle anderen. »Brumlik verurteilt Judt ›keineswegs unisono‹«, schreibt König, nachdem er ihn mit einer Kritik zitiert hat, die den binationalen Staat als Gedankenspiel linksliberaler Zionisten ins Jahr 1948 zurückkatapultiert hat. Natürlich ist das Kritik nach Strich und Faden. Wenn er dann noch nachlegt: »Judt verwende allerdings in einigen seiner jüngsten Aufsätze ›wirklich eine mehrfach unglückselige Metaphorik‹ – bezogen auf Judts Nahost-Auffassungen«, dann weiß man auch, wo der objektive Herr König steht, nämlich am objektiven Rockzipfel von Micha Brumlik. Und ganz objektiv legt er dann an dieser Stelle noch eine kritische Anmerkung von Ralf Fücks nach, wohl wissend, dass die hier gar nichts verloren hat.
Tony Judt (†), britischer Historiker und Autor, lebte in New York

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Interventionen der Sorge
Sehr geehrter Preisträger, lieber Tony Judt, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Karoline Linnert, lieber Peter Rüdel von der Heinrich-Böll-Stiftung, liebe Gäste aus nah und fern – und aus Oldenburg, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur diesjährigen Verleihung des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«. Unser jährliches Treffen zur Preisverleihung hat inzwischen Tradition. Wir blicken auf eine ansehnliche Reihe von Preisträgerinnen und Preisträgern zurück, von denen ich Ihnen nur einige ins Gedächtnis rufe: Ágnes Heller (1995), François Furet (1996), Jelena Bonner (2000), Ernst-Wolfgang Böckenförde (2004) Julia Kristeva (2006). Der Preis wird von einer internationalen Jury vergeben. Er ist ein Preis für mutige politische Interventionen; er wird nicht in erster Linie für akademische oder Lebensleistungen verliehen. In Fortsetzung einer Tradition der deutschen und europäischen Intelligenz, für die Hannah Arendt als streitbare öffentliche Intellektuelle steht, sucht die Jury nach Preisträgerinnen und Preisträgern, die mit dem, wofür sie stehen, jenes Überraschungsmoment wachrufen, von dem die öffentliche politische Debatte zehrt – jenes Neue, Unerwartete, das innehalten lässt, das Staunen hervorruft und natürlich auch Widerspruch. Die Jury hat mit Tony Judt eine Persönlichkeit gewählt, die sich in der öffentlichen Debatte um Europa und den Westen auf vielfältige Weise zeigt: als Historiker, der sich bewusst ist, dass historische Ereignisse nicht ohne ihre kontrapunktischen historischen Linien und Verflechtungen verstanden werden können, als politischer Denker, der seine Sicht auf die Zeitereignisse in die kontroverse öffentliche Debatte einbringt, als streitbarer Zeuge der Zeit, über die er nachdenkt, die ihn beschäftigt, an der er sich reibt. Tony Judts Blick ist auf die großen Linien der europäischen Geschichte gerichtet, und doch beginnt er und kehrt immer wieder zu den Geschichten der einzelnen Völker in ihrer dissonanten Eigenart und in ihren Leidensgeschichten zurück. Er fragt mit skeptischem Blick nach der politischen Handlungsfähigkeit eines Europa der Vielfalt, sich dabei absetzend von jener Maxime, nach der die Länder Europas zu einer auf Identität beruhenden Einheit zusammenkommen sollen. Aus Judts beiden Büchern über Europa spricht einerseits die Sorge eines Europäers, das europäische Projekt könne sich als große Plattwalze für die verschiedenen Kulturen und Eigenarten der Länder, der Regionen betätigen. Dann würden nicht mehr nur die Dächer und die Gurken einander angeglichen in Europa, es verschwände jene Pluralität der Kulturen, die die vormalige lettische Staatspräsidentin und HannahArendt-Preisträgerin Vaira Vike-Freiberga vor einigen Jahren als den Reichtum Europas bezeichnet hat. Gleichwohl verbietet sich, über der wunderbaren Idee der Pluralität, deren Verständnis im angelsächsischen Raum so viel reicher ausgestattet ist als im deutschen, jeder blauäugige Paneuropäismus. Das Einheitsstreben der zentralen Behörden und die Pluralität der Nationen reiben sich in der Realität des politischen Prozesses mitunter kakophonisch aneinander. Judts immer wieder formulierte unbequeme Frage lautet, wie es einem pluralen Europa gelingen könne, in der internationalen Konfliktkonstellation handlungsfähig zu werden und dabei die kritische Auseinandersetzung mit den anderen beteiligten handelnden Mächten nicht zu scheuen.
Die Idee der Pluralität ist Europa seit seinen Anfängen mit auf den Weg gegeben. Als die vertriebenen europäischen Juden in den Vierzigerjahren des 20. Jahrhunderts im Exil darüber debattierten, wie es nach dem Ende des Krieges in einem zerstörten Europa weitergehen könne oder vielmehr wie ein politisches Leben in Europa überhaupt neu beginnen könne, haben sie diese Idee der Pluralität – anstelle der nationalen Konkurrenz – hervorgehoben. Es berührt die Leserin beim Wiederlesen einiger Texte Hannah Arendts eigenartig, wie diese Idee eines Europa der kommunizierenden Nationen mitten im Zweiten Weltkrieg wie ein Funke unter der Asche der Trümmer glimmt. So kann man kann mit Fug und Recht sagen, dass das Bestreben der Namensgeberin dieses Preises auf die Stiftung eines neuen Europa gerichtet war. Mit Blick auf Europa schreibt sie ein Buch über die amerikanische Revolution (Über die Revolution), mit Blick auf Europa diskutiert sie Alternativen zum Nationalstaat des 19. Jahrhunderts, mit dessen Erbe die europäischen Gesellschaften und Staaten so schwer zu kämpfen haben. Mit Blick auf Europa beginnt sie ihr öffentliches Selbstgespräch über die Zerstörung des öffentlichen Raums in der Moderne und die Bedingungen seiner Stiftung (Vita activa). Und insofern mag es nicht verwundern, dass die Jury in ihrer Wahl der Preisträgerinnen und Preisträger immer wieder auch zu dieser Streitfrage nach einem politisch handlungsfähigen Europa zurückkehrt. Mit ihrer Wahl hat die Jury auch gewürdigt, dass Tony Judt mit seinen Büchern und Beiträgen für ein besseres Verstehen Europas im amerikanischen Raum wirbt, ein Verständnis, das nicht von Gegensätzen, nicht von illusorischer Harmonie, sondern von einer streitbaren Auseinandersetzung über eine vielfältig dissonante, doch aufeinander bezogene Gegenwart und Zukunft ausgeht.
Die Jury hat Tony Judt in Ansehung seiner Interventionen in die politische Debatte gewürdigt. Nun steht der Preisträger seit Jahren immer wieder in der öffentlichen Kontroverse. Seine kritischen Beiträge zum dilemmatischen Verhältnis zwischen dem israelischen Staat und den palästinensischen Organisationen, zum zionistischen Selbstverständnis des israelischen Staates, zur ambivalenten Rolle der Vereinigten Staaten in dieser Konstellation, zur Rolle Europas, sorgen immer wieder für erbitterten öffentlichen Streit. Im Argumentationsgestus einiger seiner Gegner taucht dabei ein Moment auf, das aus der Lebensgeschichte der Hannah Arendt wohl bekannt ist: Es wird nicht zwischen der Person und der Sache unterschieden. Aus der Verwerfung des sachlichen Arguments folgt dann konsequenterweise die persönliche Diskreditierung, ja der Verratsvorwurf an den Autor. Der französische Philosoph Etienne Balibar hat unlängst bemerkt, ein solcher Argumentationsduktus reduziere alle politischen Fragen, jeden Konflikt mit dem Nachbarn, jeden Umgang mit Kritikern auf die Frage von Leben und Tod. Hannah Arendt hat gegenüber dieser Einstellung, die ihr mehrfach persönlich begegnete, darauf beharrt, dass die Trennung zwischen Person und Position erst die Voraussetzungen dafür schafft, dass eine politische Atmosphäre entstehen kann, in der man sich um eine gemeinsame Sache streitet. Es ist ihr oft nicht geglückt, ihre Gegner von dieser Unterscheidung zu überzeugen, aber ihre Gegner haben sie auch nicht davon abhalten können, darauf zu beharren. Nur so konnten Freundschaften gerettet werden, zum Beispiel die zu dem zionistischen Politiker Kurt Blumenfeld. Es spielt aber noch etwas anderes hinein: Wer Tony Judt als Feind deklariert, kann nicht mehr wahrnehmen, dass Judts Interventionen von einer Grundströmung der Sorge getragen werden: Sorge über eine Lage, die seit vielen Jahren als ausweglos erscheint, Sorge über eine kriegsträchtige, scheinbar nicht in politische Dimensionen zu transformierende Konstellation, die nach Lösungen schreit, deren Beteiligte aber seit Jahrzehnten nicht über den Kampf auf Leben und Tod hinauskommen. Eben dieses Hinauskommen über eine als festgefügt, wie zementiert erscheinende Lage aber ist gefragt. So weit die Begründung der Jury. Wie immer wieder an dieser Stelle möchten wir den Geldgebern herzlich danken: der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bremer Senat, die die Preisvergabe seit nunmehr 13 Jahren tragen und Abende wie diesen auch in Zeiten ermöglichen, in denen das Geld knapp ist. Großer Dank gilt natürlich jedes Jahr der Jury und dem Kreis der Kollegen und Kolleginnen aus Vorstand und Mitgliederversammlung, die den Preis mit neuen Ideen füttern und verhindern, dass dieser seine Sperrigkeit verliert.
Transzendenz und Transgression
Meine Damen und Herren, ich bin sehr stolz, dass ich hier die Gelegenheit habe, eine Laudatio auf den diesjährigen Preisträger Tony Judt zu halten. Dabei will ich natürlich nicht verschweigen, dass ich aus Ungarn komme. In diesem Zusammenhang drei kurze Geschichten: Die erste Geschichte: Die gegenwärtige ungarische Regierung plant Maßnahmen, die denen von Hartz I bis IV in Deutschland sehr ähneln, die Sie gut kennen. Aus diesem Anlass gab es riesige Demonstrationen in Budapest, auf denen wurde jedoch nicht gerufen: »Wir wollen soziale Gerechtigkeit«, sondern es wurde von Zehntausenden Leuten geschrieen: »Juden in die Donau!« Ich bin politisch aktiv und aus dem Fernsehen bekannt, ich wohne im Stadtzentrum, ich spaziere immer auf diesen Straßen, auf denen man das brüllt. Ich höre in meiner Schreibstube die Leute auf der Straße brüllen: »Schwule in die Donau! Die Juden hinterher«. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte: Vor einiger Zeit fand eine kleine antifaschistische Veranstaltung am Ufer der Donau statt. Dort gibt es eine seltsame Skulptur aus Schuhen, bronzenen Schuhen, die an die dort ermordeten Juden erinnern sollen. Die Juden waren 1944 von den »Pfeilkreuzlern«, den ungarischen Nazis, in die Donau getrieben worden. Vorher wurden sie gezwungen, ihre Schuhe auszuziehen. Die wollten die Pfeilkreuzler natürlich noch weiter verwenden. In Erinnerung an dieses Begebnis ist später ein sehr schönes, einfaches Denkmal – die bronzenen Schuhe – errichtet worden. An diesem Ort gab es also eine antifaschistische Kundgebung, aber dorthin kamen auch Gegendemonstranten und riefen in Sprechchören: »Juden, zieht eure Schuhe aus!« Und das an diesem Ort! Und die dritte kleine Geschichte: Es gibt bei uns eine kleine rechtsextreme Partei, und diese Partei hat den Stadträten überall in Ungarn vorgeschlagen, die so genannte Árpád-Streifenflagge anstelle der ungarischen Flagge auf den öffentlichen Gebäuden zu hissen. Diese Flagge war seinerzeit auch von den Pfeilkreuzlern benutzt worden. 123 Gemeinderäte haben diesen Vorschlag inzwischen aufgegriffen und in die Tat umgesetzt. Die alte Pfeilkreuzler-Flagge ersetzt gegenwärtig in immer mehr Gemeinden die ungarische National-Trikolore. Die »neuen« Fahnen sieht man jetzt überall. Die reformierte Kirche neben meinem Wohnhaus zum Beispiel hisst nicht mehr die ungarische Fahne, sondern die Árpád-Streifenfahne. Vorige Woche habe ich mit einem jungen jüdischen Freund über diese angespannte Lage gesprochen. Er hat mir einiges über seine Gefühle erzählt, und ich habe mich erinnert, dass ich ähnliche Worte schon einmal gehört oder gelesen hatte. Und schließlich habe ich sie wiedergefunden. Sie stammen von einem wenig bekannten deutschen Schriftsteller, aus einem Buch, das 1921 in Berlin unter dem Titel Mein Weg als Deutscher und Jude veröffentlicht worden war. Sein Autor hieß Jakob Wassermann. Wassermann schreibt dort: »Es ist vergeblich, in das tobsüchtige Geschrei Worte der Vernunft zu werfen. Sie sagen: Was, er wagt es aufzumucken? Stopft ihm das Maul. Es ist vergeblich, beispielschaffend zu wirken. Sie sagen: Wir wissen nichts, wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gehört. Es ist vergeblich, die Verborgenheit zu suchen. Sie sagen: Der Feigling, er verkriecht sich, sein schlechtes Gewissen treibt ihn dazu. Es ist vergeblich, unter sie zu gehen und ihnen die Hand zu bieten. Sie sagen: Was nimmt er sich heraus mit seiner jüdischen Aufdringlichkeit? Es ist vergeblich, ihnen Treue zu halten, sei es als Mitkämpfer, sei es als Mitbürger. Sie sagen: Er ist der Proteus, er kann eben alles. Es ist vergeblich, ihnen zu helfen, Sklavenketten von den Gliedern zu streifen. Sie sagen: Er wird seinen Profit schon dabei gemacht haben. Es ist vergeblich, das Gift zu entgiften. Sie brauen frisches. Es ist vergeblich, für sie zu leben und für sie zu sterben. Sie sagen: Er ist ein Jude.« Der junge Mann, mein Bekannter, der ähnlich dachte wie Wassermann seinerzeit, wird eine Universität in Amerika besuchen, und ich bin sicher, dass er nicht zurückkehren wird.
Und dennoch sage ich: Wenn man von Europa und seiner Geschichte als einer Geschichte des Bösen spricht – wie es Tony Judt im Titel seines Vortrags anklingen lässt –, sollte man von einer Geschichte der Transzendenz und Transgression reden. Was verknüpft ideengeschichtlich und philosophisch die beiden Begriffe Transzendenz und Transgression? Wir können uns dieser Frage von zwei verschiedenen Richtungen her annähern. Die Revolutionäre des 18. Jahrhunderts haben die Frage so beantwortet, dass die Transzendenz zurückgewiesen gehört und die Immanenz als naturgegeben akzeptiert wird. Nach den glorreichen Tagen des Bürgertums wies die Revolution die Natur zurück, also die Transzendierung der sozialen Welt. Marx, zwischen beiden Seiten stehend, spricht bekanntlich von der Transzendenz als Jenseits, als Opium für das Volk, aber auch als fantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens. Marx war kein Aufklärer. Für ihn war das Transzendierende zugleich der Gegenstand des Transzendierens in der Religion und keineswegs nichtig, weil sie eine schon verkehrte Welt verkehre. Beide Dimensionen sind Fantasmen für Marx, das Diesseits ist kaum besser als das Jenseits. In der bürgerlichen Gesellschaft wird das Soziale zur menschlichen Wirklichkeit und wird zur Natur. Ich komme zu unserem Problem. Jenseits dieser Natur gibt es kein Seiendes, kein Starkes, kein Lebendiges. Diese zweite Natur wird regiert von einem Kalkül der Triebkräfte, wir sind abhängig von individuellen Wertungen, notwendigen oder wünschenswerten Tätigkeiten. So ist die herrschende Disziplin des gegenwärtigen Zeitalters, die neoklassische Wirtschaftswissenschaft, konstruiert. In dieser Theorie wird das äußere Leben des modernen Menschen betrachtet als eine unendliche Reihe von Wahlentscheidungen, Begierden und so weiter. Das zeitliche Chaos von momentanen und meinungslosen Entscheidungen spricht die menschliche Natur als Rohstoff für die Nachfrage und für die davon determinierten Entscheidungen der Herren der Produktion an. Es ist diese Natur, gegen die sich das 20. Jahrhundert erhob. Das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert des Kampfes gegen den Kapitalismus. Die Marxisten wollten diese Welt zerstören und haben zu zeigen versucht, dass das, was von der menschlichen Natur bleibt, in der Geschichte aufgeht. Faschisten und Nationalsozialisten waren ebensolche Antimoralisten wie die Marxisten, aber sie haben den bürgerlichen Ideen über die Natur nicht die Geschichte, sondern das Leben entgegengesetzt. Orientierungspunkte in einer solchen Allgemeinheit waren schwer zu finden, da man Geschichte mit Tradition gleichsetzte. Die Unterscheidung zwischen wertvollem und »unwertem« Leben hat eine Art Moralität, aber eine funktionalisierte Moralität der Art: Wo etwas stark und zäh sei, sollte es von vornherein als gut gelten. Das Ziel der Marxisten war die Überwindung des Kapitalismus. Das Ziel der Nationalsozialisten lag woanders. Sie wollten den Sieg über das Bürgertum und die bürgerliche Kultur. Und wir haben gelernt, dass die beiden nicht identisch sind. Wir sehen es heute, dass ein Kapitalismus ohne Bürgertum und ohne Proletariat möglich ist. Die alte Bourgeoisie existiert nicht mehr. Das alte Proletariat existiert nicht mehr. Die Gegenkultur des Kapitalismus, des alten Kapitalismus, die revolutionäre Arbeiterbewegung, existiert nicht mehr. Dennoch existieren die strukturellen Bedingungen des Kapitalismus – von der Warenproduktion und Lohnarbeit über die reelle Subsumption und das Kapital bis hin zum Zins-, Kredit-, Geldwesen und so weiter – weiter. Die Revolutionen und Konterrevolutionen des 20. Jahrhunderts haben Bürgertum, bürgerliche Kultur, bürgerliche Tradition, Aufklärung, bürgerlichen Humanismus, Liberalismus und die damit zusammenhängenden Kulturen vernichtet. Die Kommunisten in der Sowjetunion haben es nicht geschafft, den Kapitalismus zu vernichten. Der Staatskapitalismus ohne Bourgeoisie und der globale Marktkapitalismus ohne Bourgeoisie sind in dieser Hinsicht, obwohl in vielem verschieden, identisch, und die Grundstruktur des Kapitalismus sorgt nicht für dieselbe Kultur und dieselbe Geschichte. Die Revolutionen und die Konterrevolutionen des 20. Jahrhunderts sind gescheitert. Der Kapitalismus ist gleichwohl nicht vernichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die bürgerliche Demokratie in Europa auf verschiedene Weise wiedergeboren. Aber dass hier dennoch etwas nicht stimmt, obwohl alle Totalitarismen niedergeschlagen wurden und wir Demokraten gesiegt haben – dass trotzdem etwas nicht stimmt, das spüren wir, obwohl es keine totalitäre Gefahr mehr gibt. Ich glaube nicht, dass der Faschismus wiedergeboren wird – trotz der Sehnsucht nach Transgression, nach neuen Abenteuern, die das bürgerliche Zeitalter transzendieren. Aber es gibt eine weit verbreitete Skepsis gegenüber demokratischen und liberalen Republikanern, gegenüber republikanischen Institutionen. Man sucht in den ehemaligen Ostblockländern und in der Dritten Welt nach anderen »Lösungen« für die Probleme der Modernität, nach »Alternativen« zur Demokratie. Dies zeigt uns, dass jene Probleme und Ängste, die im Lebenswerk von Hannah Arendt exemplarisch und evokativ beschrieben sind, und die Unruhe, von der man im Werk des heute preisgekrönten Historikers lesen kann, nicht vergehen werden. Wir leben in einer Welt, in der die Immanenz der bürgerlichen Gesellschaft nicht stabil ist, auch nie stabil sein wird; wir werden mit diesen Gefahren, mit diesen Versuchungen und mit diesen Ängsten vor dem Bösen, vor Krieg und Tod weiter leben müssen. Es gibt keine endliche Lösung für die Probleme der Modernität. Wir haben gesehen, der Festvortrag des Preisträgers hat es uns sehr gut gezeigt, dass man mit der bürgerlichen, demokratischen und liberalen Friedfertigkeit und mit Nächstenliebe den Bewohnern der Pariser Banlieues und den anderen Leidenden in der gegenwärtigen Welt nicht kommen kann. Die werden nicht zuhören, die wollen das nicht mehr hören. Und wir, glaube ich, sollten auf eine neue Art, mit einer neuen Methode die Probleme und Ängste der neuen heimlosen Generationen verstehen und damit politisch umgehen
Das »Problem des Bösen« im Nachkriegs-Europa
Es ist mir eine große Ehre, heute hier in Bremen zu sein. Angesichts der berühmten früheren Empfänger des Hannah-ArendtPreises – unter ihnen Agnes Heller, François Furet, Claude Lefort und Yelena Bonner – bin ich sehr stolz, zu ihnen zu gehören. Außerdem ist es mir eine besondere Freude, einen Preis zu bekommen, der nach Hannah Arendt benannt ist. Wie so vielen scheint es auch mir, als hätte ich Arendt schon immer gekannt. In meinem Fall ist vielleicht die Reihenfolge erhellend, in der ich zu Arendts Schriften gekommen bin. Im Gegensatz zu den meisten Menschen meiner Generation war Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft nicht das erste Werk, das ich von Hannah Arendt gelesen habe. Es war auch nicht Vita activa oder Vom tätigen Leben, Über die Revolution oder gar Menschen in finsteren Zeiten. Mein erstes Arendt-Buch, das ich im Alter von fünfzehn Jahren gelesen habe, war Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen. Dieses Buch bleibt für mich die bezeichnende Arendt-Schrift. Es ist nicht ihr philosophischstes Buch. Es ist sicherlich nicht in allen Punkten richtig; und es ist ohne Zweifel nicht ihr populärstes Werk. Ich mochte das Buch nicht einmal, als ich es zum ersten Mal las – ich war damals noch sehr jung, ein begeisterter sozialistischer Zionist, und Arendts Schlussfolgerungen verstörten mich zutiefst. Doch mit den Jahren habe ich begriffen, dass Eichmann in Jerusalem Hannah Arendt in Höchstform zeigt: ein schmerzliches Thema frontal in Angriff nehmen; mutig von der herrschenden Meinung abweichen; nicht nur die Feinde, sondern gerade auch die Freunde zur Debatte herausfordern; und vor allem den bequemen Frieden der landläufigen Meinung stören. So werde ich Ihnen heute in Erinnerung an Hannah Arendt, die »Unruhestifterin«, einige Gedanken zu dem Thema anbieten, das sie mehr als jedes andere in ihren politischen Schriften beschäftigte.
1945, in einer ihrer ersten Abhandlungen nach dem Kriegsende in Europa, schrieb Hannah Arendt: »Das Problem des Bösen wird die fundamentale Frage des geistigen Lebens nach dem Krieg in Europa sein – so wie der Schrecken des Todes die fundamentale Frage nach dem letzten Krieg wurde.« Einerseits lag sie damit natürlich vollkommen richtig. Nach dem Ersten Weltkrieg waren die Europäer durch die Erinnerung an den Tod traumatisiert: vor allem durch den Tod auf dem Schlachtfeld, in einem bislang unvorstellbaren Ausmaß. Die Dichtung, die Literatur und das Kino im Zwischenkriegs-Europa waren besessen von Bildern der Gewalt und des Todes: im Allgemeinen auf kritische, aber manchmal auch auf eine nostalgische Weise (wie in den Schriften von Ernst Jünger oder Pierre Drieu la Rochelle). Und natürlich schwemmte die bewaffnete Gewalt des Ersten Weltkriegs auf vielfältige Weise in die Friedenszeit hinein: paramilitärische Gruppen, politische Morde, Staatsstreiche, Bürgerkriege und Revolutionen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand die Verherrlichung der Gewalt weitgehend aus dem europäischen Leben. Während dieses Krieges richtete sich die Gewalt nicht nur gegen die Soldaten, sondern vor allem gegen Zivilisten (denken Sie daran, dass die meisten Menschen während des Zweiten Weltkriegs nicht in der Schlacht starben, sondern im Zuge von Besetzung, ethnischer Säuberung und Völkermord). Die völlige Erschöpfung aller europäischen Nationen – der Gewinner ebenso wie der Verlierer – hinterließ wenig Illusionen über den Ruhm des Kampfes oder die Ehre des Todes. Was allerdings zurückblieb, war eine weit verbreitete Vertrautheit mit Brutalität und Verbrechen in einem nie zuvor gekannten Ausmaß. Die Frage, wie menschliche Wesen das einander antun konnten – und mehr als alles andere die Frage, wie und warum ein europäisches Volk – die Deutschen – sich aufmachte, um ein anderes – die Juden – zu vernichten, würde, das war für eine aufmerksame Beobachterin wie Arendt selbstverständlich die obsessive Frage, mit der sich der Kontinent konfrontiert sah. Das ist es, was sie mit dem »Problem des Bösen« meinte. Einerseits hatte Arendt, wie ich bereits sagte, natürlich Recht. Doch wie so oft in Arendts Fall, brauchten andere einige Zeit, um ihren Standpunkt zu begreifen. Es stimmt, dass Juristen und Gesetzgeber nach Hitlers Niederlage und den Nürnberger Prozessen den »Verbrechen gegen die Menschheit« und der Definition jenes neuartigen Verbrechens – des »Genozids« –, das bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal einen Namen hatte, sehr viel Aufmerksamkeit widmeten. Doch während die Gerichtshöfe die ungeheuerlichen Verbrechen zu definieren suchten, die gerade in Europa begangen worden waren, suchten die meisten Europäer zu vergessen. So gesehen hatte Arendt – wenigstens für einige Zeit – Unrecht. Weit entfernt davon, in den Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs über das Problem des Bösen zu reflektieren, wandten sich die meisten Europäer entschlossen davon ab. Heute fällt es uns schwer, das zu verstehen, doch Fakt ist, dass die Shoah – der versuchte Völkermord an den Juden Europas – zunächst nicht die zentrale Frage der Intellektuellen im Nachkriegs-Europa war. Die meisten Menschen – Intellektuelle und andere – ignorierten sie sogar, so gut sie konnten. Warum? In Osteuropa gab es dafür vier Gründe. Erstens wurde ein großer Teil der schlimmsten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs im Osten begangen; und obwohl die Verbrechen von den Deutschen getragen wurden, gab es unter Polen, Ukrainern, Letten, Kroaten und anderen keinen Mangel an willigen Kollaborateuren. Folglich war der Anreiz vielerorts groß, zu vergessen, was geschehen war und einen Mantel des Schweigens über das Grauen zu legen. Zweitens waren auch viele nicht-jüdische Osteuropäer Opfer einiger der schlimmsten Gräueltaten (begangen von Deutschen, Russen und anderen), und wenn sie sich an den Krieg erinnerten, dann dachten sie normalerweise nicht an das Leiden ihrer jüdischen Nachbarn, sondern an das eigene Leid und an die eigenen Verluste. Drittens geriet bis 1948 der größte Teil Zentral- und Osteuropas unter sowjetische Herrschaft. In der offiziellen sowjetischen Darstellung war der Zweite Weltkrieg ein antifaschistischer Krieg – oder, innerhalb der Sowjetunion, der Große Vaterländische Krieg. Für Moskau war Hitler vor allem ein Faschist und Nationalist. Sein Rassismus war weit weniger wichtig und vielleicht sogar verwirrend. Die Millionen toter Juden aus den sowjetischen Gebieten zählte man wie selbstverständlich unter die sowjetischen Verluste, ihre Zugehörigkeit zum Judentum wurde in den Geschichtsbüchern und bei öffentlichen Gedenkfeiern heruntergespielt oder gar verleugnet. Nach einigen Jahren hatte die Erinnerung an die kommunistische Unterdrückung die Erinnerung an die deutsche Besatzung ersetzt. Die Vernichtung der Juden wurde in den Hintergrund gedrängt.
In Westeuropa gab es ein ähnliches Vergessen, obwohl die Umstände ganz andere waren. Die Besatzung während des Krieges – in Frankreich, Belgien, Holland, Norwegen und, nach 1943, Italien – war eine demütigende Erfahrung. Sowohl die NachkriegsRegierungen als auch die Intellektuellen zogen es vor, die Kollaborationen und andere Erniedrigungen zu vergessen und stattdessen die heldenhaften Widerstandsbewegungen, Volksaufstände, Befreiungen und Märtyrer herauszustellen. Noch viele Jahre nach 1945 trugen sogar die, die es besser wussten – wie Charles de Gaulle –, bewusst zu einer nationalen Mythologie heroischen Leidens und mutigen Massenwiderstands bei, obwohl ihnen klar war, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Sogar in NachkriegsWestdeutschland war die anfängliche Stimmung eine des Selbstmitleids mit Deutschlands eigenem Leiden. Niemand – weder die Deutschen noch die Österreicher, die Franzosen, Holländer, Belgier oder Italiener – wollte sich an das Leid der Juden erinnern oder an das besondere Böse, welches es hervorgerufen hatte. Deshalb, um nur ein prominentes Beispiel zu nennen, lehnte der bedeutende italienische Verleger Einaudi 1946 die Veröffentlichung von Primo Levis Se questo è un uomo (sein autobiografischer Auschwitz-Bericht, hierzulande unter dem Titel Ist das ein Mensch? bekannt) kurzerhand ab. Damals und auch noch in den folgenden Jahren standen Bergen-Belsen und Dachau, nicht Auschwitz, für die Schrecken des Nazismus; die Hervorhebung der politischen statt der aus rassischen Gründen Deportierten passte besser zu den beschwichtigenden Nachkriegsberichten über den nationalen Widerstand während des Krieges. Levis Buch wurde schließlich doch noch veröffentlicht, allerdings nur in einer Auflage von 2 500 Exemplaren bei einem kleinen lokalen Verlag. Kaum jemand kaufte es; viele Exemplare landeten in einer Lagerhalle in Florenz und wurden dort in der großen Flut 1966 zerstört. Das mangelnde Interesse an der Shoah in jenen Jahren kann ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen – als jemand, der in England aufgewachsen ist, in einem Land also, das den Krieg gewonnen hat, niemals besetzt war und von daher keine Komplexe bezüglich Kriegsverbrechen haben sollte. Doch selbst in England wurde das Thema nie viel diskutiert – ob zu Hause, in der Schule oder in den Medien. Noch 1966, als ich mein Studium der modernen Geschichte an der Cambridge University begann, lernte ich in französischer Geschichte zwar einiges über Vichy-Frankreich, jedoch so gut wie nichts über die Juden oder den Antisemitismus. Niemand schrieb über das Thema. Ja, wir beschäftigten uns mit der Besetzung Frankreichs durch die Nazis, mit den Vichy-Kollaborateuren und den französischen Faschisten. Doch nichts von dem, was wir lasen, auf Englisch oder Französisch, beschäftigte sich mit dem Problem der Rolle Frankreichs bei der Endlösung. Und obwohl ich jüdisch bin und Mitglieder meiner eigenen Familie in den Todeslagern umgebracht wurden, erschien es mir damals nicht seltsam, dass das Thema nicht erwähnt wurde. Das Schweigen schien normal. Wie kann man rückblickend diese Bereitschaft erklären, das Inakzeptable zu akzeptieren? Wie kann das Anormale so normal erscheinen, dass wir es nicht einmal bemerken? Wahrscheinlich aus dem deprimierend einfachen Grund, den Tolstoi in Anna Karenina nennt: »Ein Mensch kann sich an alle Lebensumstände gewöhnen, wenn er muss, vor allem wenn alle um ihn herum diese akzeptieren.« Wie Sie wissen, begann sich nach den Sechzigerjahren alles zu ändern, aus vielerlei Gründen: unter anderem wegen der verstrichenen Zeit und der Neugier einer neuen Generation. In den 1980er-Jahren hatte die Geschichte der Vernichtung von Europas Juden eine zunehmende Bekanntheit in Büchern, im Kino und im Fernsehen erlangt. Seit den 1990er-Jahren sind offizielle Entschuldigungen, nationale Gedenkstätten, Denkmäler und Museen gang und gäbe; und sogar im postkommunistischen Osteuropa hat das Leid der Juden begonnen, seinen Platz im öffentlichen Gedenken einzunehmen. Heute ist die Shoah eine universelle Referenz. Kurse zur Geschichte der Endlösung oder des Zweiten Weltkriegs sind mitunter die einzigen in den Lehrplänen der Sekundarschulen vorgeschriebenen Geschichtskurse – insbesondere in Amerika und Großbritannien. Es gibt nunmehr buchstäblich Tausende von Studien über die Vernichtung der europäischen Juden während des Zweiten Weltkriegs: lokalhistorische wie philosophische Abhandlungen, soziologische wie psychologische Untersuchungen, Memoiren, Erzählungen, Spielfilme, Archive voll Interviews und vieles mehr. Es scheint, als ob Hannah Arendts Prophezeiung wahrgeworden ist: Die Geschichte des Problems des Bösen ist nun ein grundlegendes Thema des europäischen Geisteslebens.
I st jetzt also alles in Ordnung? Jetzt, wo wir in die dunkle Vergangenheit geblickt haben, sie beim Namen genannt und geschworen haben, dass sie sich niemals wiederholen darf? Ich bin mir da nicht so sicher. Lassen Sie mich fünf paradoxe Schwierigkeiten benennen, die sich aus unserer heutigen Beschäftigung mit der Shoah ergeben, mit dem, was jedes Schulkind heute als den »Holocaust« bezeichnet. Die erste Schwierigkeit betrifft das Dilemma unvereinbarer Erinnerungen. In Westeuropa ist die Erinnerung an die Endlösung heute universell (wenn auch in Spanien und Portugal weniger ausgeprägt). Doch die östlichen Staaten, die »Europa« seit 1989 beigetreten sind, haben aus den Gründen, die ich bereits erläutert habe, noch immer eine ganz andere Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und seine Lektionen. In der Tat hat es durch das Verschwinden der Sowjetunion und der damit einhergehenden Freiheit, die Verbrechen und Misserfolge des Kommunismus zu untersuchen und zu diskutieren, eine größere Aufmerksamkeit für die Qual von Europas östlicher Hälfte, verursacht durch Deutsche wie durch Sowjets, gegeben. In diesem Kontext ruft die westeuropäische und amerikanische Betonung von Auschwitz und den jüdischen Opfern einige Irritationen hervor. Wenn ich zum Beispiel in Polen und Rumänien oder in Kroatien darüber gesprochen habe, bin ich – von gebildeten, weltoffenen Zuhörern – gefragt worden, warum westliche Intellektuelle wie ich dem Massenmord an den Juden so viel Bedeutung beimessen? Was denn mit den Hunderttausenden, Millionen nicht-jüdischer Opfer des Nazismus und Stalinismus sei? Warum die Shoah das Verbrechen sei? Es gibt eine Antwort auf diese Frage, doch sie ist nicht selbstverständlich für alle östlich der Oder-Neiße- Grenze. Das mag uns nicht gefallen, doch wir sollten uns daran erinnern. In dieser Hinsicht ist Europa weit entfernt davon, vereinigt zu sein. Das zweite Paradox betrifft die historische Genauigkeit und die Risiken der Überkompensierung. Viele Jahre lang zogen es die Westeuropäer vor, nicht über die Leiden der Juden während des Krieges nachzudenken. Nun werden wir dazu ermutigt, ständig über dieses Leid nachzudenken. In den ersten Jahrzehnten nach 1945 kamen die Gaskammern nur am Rande unseres Verständnisses von Hitlers Krieg vor. Heute stehen sie im Zentrum. In moralischer Hinsicht ist es, wie es sein sollte: Das zentrale ethische Thema des Zweiten Weltkriegs ist »Auschwitz«. Doch für Historiker ist das sehr irreführend. Denn die traurige Wahrheit ist, dass die meisten Leute während des Zweiten Weltkriegs nicht über das Schicksal der Juden Bescheid wussten, und wenn sie es wussten, so kümmerte es sie nicht besonders. Es gab nur zwei Gruppierungen, für die der Zweite Weltkrieg vor allem ein Vorhaben war, um die Juden zu vernichten: die Nazis und die Juden selbst. Für alle anderen hatte der Krieg ganz andere Bedeutungen: Sie hatten ihre eigenen Sorgen. Wenn wir also darauf beharren, so wie wir es heute tun, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs vor allem – und manchmal ausschließlich – durch das Prisma des Holocaust zu lehren, so lehren wir vielleicht gute Moralvorstellungen, aber keine gute Geschichte. Und wenn man die Vergangenheit benutzt, um moralische Grundsätze zu lehren – selbst wenn es sich um die allerwichtigsten moralischen Grundsätze handelt – bezahlt man immer einen Preis dafür. Es fällt uns schwer zu akzeptieren, dass der Holocaust in unserem eigenen Leben eine wichtigere Rolle innehat als im Erleben der besetzten Länder zu Kriegszeiten. Doch wenn wir die wirkliche Bedeutung des Bösen – das, was Hannah Arendt meinte, als sie es »banal« nannte – begreifen wollen, dann müssen wir uns daran erinnern, was wirklich entsetzlich an der Vernichtung der Juden ist: nicht dass sie so viel, sondern dass sie so wenig bedeutete.
Mein drittes Paradox betrifft das Konzept des »Bösen« selbst. Die moderne säkulare Gesellschaft hat sich mit der Idee des »Bösen« lange unwohl gefühlt. Wir bevorzugen rationalere und gesetzliche Definitionen von gut und schlecht, richtig und falsch, Verbrechen und Strafe. Doch in den letzten Jahren hat sich das Wort langsam wieder in moralische und sogar politische Diskurse eingeschlichen. Doch nun, wo das Konzept des »Bösen« wieder in unsere öffentliche Sprache eingezogen ist, wissen wir nicht, was wir damit anfangen sollen. Im Westen wird das Wort heute üblicherweise verwendet, um das »einzigartige« Böse Hitlers und der Nazis zu bezeichnen. Doch hier geraten wir in Verwirrung. Der Völkermord an den Juden – der »Holocaust« – wird zuweilen als ein einzigartiges Verbrechen dargestellt, als ein Böses, das es nie zuvor und auch seither nicht mehr gegeben hat, als ein Beispiel und eine Warnung: »Nie wieder!« Andererseits berufen wir uns mitunter aus den verschiedensten und ganz und gar nicht einzigartigen Gründen auf eben dieses (einzigartige) Böse. In den letzten Jahren haben Politiker, Historiker und Journalisten den Begriff des »Bösen« verwendet, um beabsichtigte Völkermorde überall auf der Welt und ihre Folgen zu beschreiben: von Kambodscha bis Ruanda, von der Türkei bis zum Sudan. Sie alle kennen zweifellos die »Achse des Bösen« von Präsident George Bush. Sogar Hitler selbst wird nun zu vielen Gelegenheiten heraufbeschworen, um die »böse« Natur und die Absichten moderner Diktatoren zu bezeichnen: Es wird uns erzählt, dass es überall »Hitlers« gibt, von Nordkorea über den Irak bis hin zum Iran. Wenn aber Auschwitz und der Völkermord an den Juden für das einzigartige Böse stehen, warum werden wir dann laufend gewarnt, es könne überall passieren oder stünde erneut unmittelbar bevor? Wann immer jemand die Mauer einer Synagoge in Frankreich mit antisemitischen Graffitis beschmiert oder ein russischer Politiker nostalgische Gefühle für Stalin bekundet, werden wir gewarnt, dass »das einzigartige Böse« wieder um uns ist, dass alles wieder wie 1938 ist. Wir verlieren die Fähigkeit zu unterscheiden: zu unterscheiden zwischen den normalen Sünden und Verrücktheiten der Menschheit – Dummheit, Vorurteil, Demagogie und Fanatismus – und dem echten (genuin) Bösen. Wir haben aus den Augen verloren, was an den politischen Religionen der extremen Linken und extremen Rechten des 20. Jahrhunderts so verführerisch war, so gewöhnlich, so modern und dadurch wahrhaft diabolisch. Wenn wir das Böse doch überall sehen, wie können wir dann das Echte erkennen? Vor sechzig Jahren befürchtete Hannah Arendt, dass wir nicht wüssten, wie wir über das Böse sprechen sollen und dass wir deshalb seine Bedeutung niemals begreifen würden. Heute sprechen wir ständig von dem »Bösen« – mit dem Ergebnis, dass wir seine wahre Bedeutung vergessen haben.
Mein viertes Paradox betrifft das Risiko, das wir eingehen, wenn wir alle unsere emotionalen und moralischen Energien in nur ein Problem investieren, wie groß es auch sein mag. Die Gefahr unserer gegenwärtigen Beschäftigung mit dem Völkermord an den Juden ist, dass wir uns an ein großes Böses erinnern, jedoch auf Kosten des Vergessens der vielen kleineren, mit denen wir uns auch befassen sollten. Der Preis für diese Art von Tunnelblick kommt heute bei Washingtons »Krieg gegen den Terror« schmerzlich zum Ausdruck. Die Frage ist nicht, ob es Terrorismus gibt – natürlich gibt es ihn –, noch ob Terrorismus und Terroristen bekämpft werden sollten – natürlich sollten sie bekämpft werden. Die Frage ist, welches andere Böse wir vernachlässigen – oder erzeugen –, indem wir uns auf ausschließlich einen Feind konzentrieren und ihn dazu benutzen, Hunderte unserer eigenen, geringeren Verbrechen zu rechtfertigen. Das Gleiche gilt für unsere gegenwärtige Faszination für das Problem des Antisemitismus und unser Beharren auf seine einzigartige Bedeutung. Antisemitismus ist genau wie Terrorismus ein altes Problem. Und wie beim Terrorismus, so beim Antisemitismus: Schon ein kleiner Ausbruch erinnert uns daran, welche Folgen es in der Vergangenheit hatte, dass wir ihn nicht ernst genug genommen haben. Aber: Antisemitismus ist ebenso wie Terrorismus nicht das einzige Böse in der Welt und darf keine Entschuldigung dafür sein, andere Verbrechen und andere Leiden zu ignorieren. Die Gefahr dabei, »Terrorismus« oder Antisemitismus von ihren jeweiligen Kontexten zu abstrahieren – sie als größte Gefahr für die westliche Zivilisation oder die Demokratie oder »unsere Lebensart« auf ein Podest zu setzen und ihren Vertretern mit einem unbegrenzten Krieg zu drohen – bedeutet, die vielen anderen Herausforderungen unserer Zeit zu vernachlässigen. Auch hierzu hat Hannah Arendt etwas gesagt. Als Autorin des einflussreichsten Buches über den Totalitarismus war sie sich vollkommen im Klaren über die Bedrohung, die er für offene Gesellschaften darstellte. Doch in der Ära des Kalten Krieges lief der »Totalitarismus«, wie heute der Terrorismus oder Antisemitismus, Gefahr, unter Ausschluss alles anderen zu einer zwanghaften Beschäftigung der Denker und Politiker im Westen zu werden. Dagegen sprach Arendt eine Warnung aus, die auch heute noch relevant ist: »Die größte Gefahr darin, im Totalitarismus den Fluch dieses Jahrhunderts zu sehen, bestünde in einer Besessenheit von ihm, die uns blind werden ließe für die unzähligen kleinen und weniger kleinen Übel, mit denen der Weg zur Hölle gepflastert ist.«
Mein letztes Paradox werden Sie vielleicht etwas provokant finden. Es betrifft die Beziehung zwischen der Erinnerung an den europäischen Holocaust und dem heutigen Staat Israel. Seit seiner Geburt 1948 hatte der Staat Israel ein komplexes Verhältnis zur Shoah. Einerseits lieferte die Beinahevernichtung von Europas Juden die Grundlage für den Zionismus: Die Überzeugung, dass es für Juden unmöglich wäre, in nicht-jüdischen Ländern zu überleben und sich zu entwickeln, dass ihre Integration und Assimilation an europäische Nationen und Kulturen ein tragischer Irrglaube war und dass sie einen eigenen Staat brauchten. Andererseits bedeutete die weit verbreitete israelische Sicht, dass die europäischen Juden zu ihrem eigenen Untergang beitrugen, sie, wie es hieß, »wie Lämmer zur Schlachtbank« gingen, dass Israels ursprüngliche Identität sich auf das Zurückweisen der jüdischen Vergangenheit gründete sowie auf die Behandlung der jüdischen Katastrophe als ein Zeichen der Schwäche: Eine Schwäche, die zu überwinden Israels Aufgabe war, indem es eine neue Art von Juden hervorbrachte. In den letzten Jahren hat sich das Verhältnis zwischen Israel und dem Holocaust jedoch verändert. Wenn sich Israel heute internationaler Kritik ausgesetzt sieht – wegen seines falschen Umgangs mit den Palästinensern und wegen der Besiedlung der Gebiete, die es 1967 erobert hatte –, verweisen die Verteidiger der israelischen Politik vielfach auf die Erinnerung an den Holocaust. Wer Israel zu scharf kritisiere, so warnen sie, wecke nur den Antisemitismus; Sie behaupten sogar, dass eine offensive Kritik an Israel – also ein Antizionismus, wenn Sie so wollen – nicht nur Antisemitismus weckt. Nein: Es ist Antisemitismus. Und mit dem Antisemitismus ist der Weg nach vorn – oder zurück – frei: zum Jahr 1938, zur Kristallnacht und von dort nach Treblinka und Auschwitz. Wenn Sie wissen wollen, so sagen sie, wohin Antizionismus führt, müssen Sie nur Yad Vashem in Jerusalem besuchen, das Holocaust-Museum in Washington oder unzählige Gedenkstätten und Museen in ganz Europa. Ich verstehe die Emotionen hinter diesen Behauptungen. Doch meiner Ansicht nach sind die Behauptungen selbst außerordentlich gefährlich. Wenn mir gesagt wird, dass ich meine Kritik an Israel besser nicht zu laut äußern sollte, aus Angst, die Geister des Antisemitismus heraufzubeschwören, dann antworte ich, dass es genau andersherum ist. Lassen Sie mich das erklären. Viele Jahre lang habe ich Gymnasien insbesondere in den USA, Großbritannien und Frankreich besucht und dort über die Nachkriegsgeschichte Europas und die Erinnerung an die Shoah referiert. Ich unterrichte diese Themen auch an meiner Universität. Und ich kann über meine Entdeckungen berichten. Die heutigen Studenten müssen nicht an das Problem des Bösen erinnert werden, an die historischen Folgen des Antisemitismus oder den Völkermord an den Juden. Sie wissen alles darüber – ganz im Unterschied zu ihren Eltern. Und so soll es auch sein. Doch es hat mich getroffen, wie oft Studenten mich in den letzten Jahren gefragt haben: »Warum lernen wir nur etwas über den Holocaust?« oder »Warum ist dieser Fall so besonders?« oder »Wird die Bedrohung durch Antisemitismus nicht übertrieben?« oder – und immer öfter – »Dient der Holocaust für Israel nicht als Entschuldigung, sich zu verhalten, wie es ihm beliebt?« In den 1980er-Jahren habe ich diese Fragen nicht gehört, und in den 1990er-Jahren habe ich sie nur in bestimmten Teilen Osteuropas gehört. Heute höre ich sie immer öfter, überall. Meine Befürchtung ist, dass zweierlei passiert ist. Durch die Betonung der historischen Einzigartigkeit des Holocaust und die gleichzeitige Bezugnahme auf ihn, wenn es um heutige Vorkommnisse geht, haben wir die jungen Menschen verwirrt. Und wenn wir jedes Mal, wenn jemand Israel angreift oder die Palästinenser verteidigt, »Antisemitismus« schreien, so ziehen wir Zyniker heran. Denn die Wahrheit ist, dass Israel heute nicht in existenzieller Gefahr ist. Heute sind die Juden hier im Westen keinen Bedrohungen oder Vorurteilen ausgesetzt, die im Entferntesten mit den damaligen vergleichbar wären – oder vergleichbar mit den Vorurteilen gegen andere Minderheiten. Fragen Sie sich selbst: Würden Sie sich heute sicherer, akzeptierter, willkommener fühlen als Muslim in den USA? Als Pakistani in England? Als Marokkaner in Holland? Als »beur« in Frankreich? Als Schwarzer in der Schweiz? Als »illegaler Einwanderer« in Dänemark? Als Rumäne in Italien? Als Türke in Deutschland? Als Zigeuner irgendwo in Europa? Oder würden Sie sich sicherer, integrierter, akzeptierter fühlen als Jude in all diesen Orten? Ich denke, Sie kennen die Antwort. Ich weiß, ich kenne sie.
Wenn es eine Bedrohung für die Juden – und jeden anderen – gibt, so kommt sie aus einer anderen Richtung. Wir haben die Erinnerung an den Holocaust so fest mit der Verteidigung Israels verbunden, dass wir Gefahr laufen, die moralische Bedeutung dieser Erinnerung zu schmälern und sie zu provinzialisieren. Das Problem des Bösen im letzten Jahrhundert, um Hannah Arendt noch einmal zu bemühen, mag sich in der Form eines Versuchs der Deutschen gezeigt haben, die Juden zu vernichten. Aber es betrifft nicht nur die Deutschen, und es betrifft nicht nur die Juden. Es betrifft sogar nicht nur Europa, obwohl es hier geschehen ist. Das Problem des Bösen – des totalitären Bösen oder genozidalen Bösen – ist ein universelles Problem. Doch wenn es ständig für eigennützige oder regionale Zwecke verwendet wird – um Israel zu verteidigen oder Antisemitismus zu geißeln oder Kritiker der amerikanischen Außenpolitik zum Schweigen zu bringen – dann wird die Erinnerung an das Böse bald seine Universalität einbüßen. Was dann passieren wird (und schon passiert) ist, dass diejenigen, die einen gewissen Abstand zur Erinnerung an das europäische Verbrechen haben – weil sie keine Europäer sind oder weil sie zu jung sind, um sich daran zu erinnern, warum es wichtig ist –, nicht verstehen werden, was diese Erinnerung mit ihnen zu tun hat, und sie werden uns nicht länger zuhören, wenn wir ihnen erzählen, warum das wichtig ist und was es bedeutet. Wenn Sie mir nicht glauben, stellen Sie die Frage einem heutigen europäischen Oberstufenschüler. Oder gehen Sie nach China oder Sambia oder Peru und fragen, welche Lektionen Auschwitz uns erteilt. Ich glaube, Sie werden die Antworten sehr beunruhigend finden. Es gibt keine einfache Antwort auf dieses Problem, ebenso wenig wie es eine einfache Antwort auf die anderen Paradoxe gibt, die ich angesprochen habe. Was heute für Westeuropäer offensichtlich erscheint, ist für viele Osteuropäer unklar, so wie es auch vor vierzig Jahren für Westeuropäer unklar war. Die moralischen Lektionen von Auschwitz, die sich überdimensional auf der Erinnerungsleinwand der Europäer abzeichnen, sind für Asiaten oder Afrikaner weitgehend unsichtbar. Und, vielleicht zuallererst, was für die Menschen meiner Generation offensichtlich scheint, wird für unsere Kinder und Enkelkinder sehr wenig Sinn ergeben. Also: Wie können wir eine europäische Vergangenheit bewahren, die nun von Erinnerung zu Geschichte verblasst? Ich bin mir nicht sicher, dass wir es können. Vielleicht sind wir dazu verdammt, die Vergangenheit zu verlieren. Vielleicht sind alle unsere heutigen Museen und Gedenkstätten und obligatorischen Schulausflüge kein Zeichen dafür, dass wir bereit sind, uns zu erinnern, sondern vielmehr ein Hinweis darauf, dass wir meinen, unsere Buße getan zu haben und nun beginnen können, loszulassen und zu vergessen, den Steinen an unserer Stelle das Erinnern zu überlassen. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass die Geschichte, wenn sie ihren Auftrag erfüllen soll, den Nachweis vergangener Verbrechen und von allem anderen für immer zu bewahren, dann muss sie in Ruhe gelassen werden. Wenn wir die Vergangenheit für heutige Ziele instrumentalisieren – die Stücke herausfiltern, die unseren Zwecken dienen können, oder die Geschichte heranziehen, um einfache moralische oder politische Lektionen zu erteilen –, werden dabei schlechte moralische Grundsätze und eine schlechte Geschichtsschreibung herauskommen. Einstweilen sollten wir alle vielleicht etwas mehr aufpassen, wenn wir vom Problem des Bösen sprechen. Denn es gibt mehr als eine Art von Banalität. Es gibt die berühmte Banalität, von der Arendt gesprochen hat – das beunruhigende, normale, nachbarliche, alltägliche Böse in den Menschen. Aber es gibt noch eine andere Banalität: die Banalität der Überbeanspruchung – der verflachende, desensibilisierende Effekt, der eintritt, wenn wir dieselbe Sache zu oft sehen oder sagen oder denken, bis wir schließlich unser Publikum betäubt und immun gemacht haben gegen das Böse, das wir beschreiben. Und das ist die Banalität – oder »Banalisierung« –, vor der wir heute stehen.
Die Generation unserer Eltern hat nach 1945 das Problem des Bösen beiseite geschoben, weil es – für sie – zu viel Bedeutung enthielt. Die Generation nach uns läuft Gefahr, das Problem beiseite zu schieben, weil es nunmehr zu wenig Bedeutung enthält. Wie können wir das verhindern? In anderen Worten, wie können wir sicherstellen, dass das Problem des Bösen die fundamentale Frage für Europas Intellektuelle bleibt? Ic1h kenne die Antwort nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es die richtige Frage ist. Es ist die Frage, die Hannah Arendt vor sechzig Jahren gestellt hat, und ich glaube, sie würde sie auch heute noch stellen. Übersetzung aus dem Englischen von Ute Szczepanski
Lieber Tony Judt, lieber Christian Weber als Präsident der Bremischen Bürgerschaft, liebe Karo und Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Seit 13 Jahren gibt es den HannahArendt-Preis für politisches Denken, der im Sommer 1994 gegründet wurde, und zum 13. Mal vergeben wir unseren Preis. Auf keiner Ebene gibt es finanzielle Selbstverständlichkeiten mehr. Bremen büßt jetzt für die Ausgaben der vergangenen Jahre. Jeder Cent wird einmal umgedreht, bevor er ausgegeben wird, und da ist es keineswegs selbstverständlich, dass dieser Preis immer noch seinen Anteil bekommt. Was geschehen ist. Vielen Dank dafür an die Stadt. Wenn der Hannah-Arendt-Preis eine Kontinuität hat und ihn etwas auszeichnet, dann ist es der Mut der Preisträger, gegen Widerstände, welcher Art auch immer, sich das politische Denken nicht verbieten zu lassen: Sie sehen hier die Namen und bei Agnes Heller, Jelena Bonner, Dany Cohn-Bendit und den anderen fallen fast jedem von uns Ereignisse und Geschichten dazu ein. Sie stehen damit in guter Tradition mit Hannah Arendt, die gerade da, wo es ihr am wichtigsten war, am leidenschaftlichsten gekämpft hat. Einen Konflikt teilte sie mit unserem heutigen Preisträger: die Frage, wie und wo Juden nach dem Holocaust weiterleben können. In den Dreißigerjahren hatte Hannah Arendt dabei geholfen, jüdische Kinder nach Palästina zu retten und war selbst dort gewesen. Später, Anfang der Vierzigerjahre, als sie schon in New York für den Aufbau schrieb, kämpfte sie für eine jüdische Armee. Sie kennen die Aussage: »Wenn du als Jude angegriffen wirst, musst du dich als Jude wehren.« Sie begleitete aber die Entstehung des Nationalstaates Israel mit großer Skepsis. Am 16. März 1945 schrieb sie im Aufbruch: »Ein jüdisches Nationalheim, das von dem Nachbarvolk nicht anerkannt und nicht respektiert wird, ist kein Heim, sondern eine Illusion – bis es zu einem Schlachtfeld wird.« Natürlich machte sie sich damit keine Freunde unter den Menschen, die ihr wichtig waren. Und spätestens nach ihrem Eichmann-Buch, Anfang der Sechzigerjahre, war sie für viele eine Persona non grata geworden. Sie lasse es an Liebe zum jüdischen Volk fehlen, hielten ihr der bis dahin gute Freund Gershom Scholem und später auch Arno Lustiger vor. Heute, glaube ich, würde Hannah Arendt kaum jemand mehr mangelnde Empathie für das jüdische Volk vorwerfen. David Grossmann, neben Amos Oz einer der bekanntesten israelischen Schriftsteller, erzählte im April dieses Jahres in New York auf dem PEN-Festival »World voices« davon, dass sein Sohn im Libanonkrieg gefallen ist. »Ja, es fällt schwer, von sich selbst zu sprechen. Deshalb möchte ich ein paar Worte darüber sagen, wie sich ein Schicksalsschlag oder eine traumatische Situation auf ein ganzes Volk auswirkt. Dabei kommt mir sofort die Maus in Kafkas Kurzgeschichte ›Kleine Fabel‹ in den Sinn: ›Eingekeilt zwischen der Falle vor und der lauernden Katze hinter sich, sagt die Maus: Ach die Welt wird enger mit jedem Tag.‹ Nach den vielen Jahren, die ich in Israel, also in der extremen Realität eines politischen, militärischen und religiösen Dauerkonflikts verbracht habe, muss ich Ihnen bestätigen, dass Kafkas Maus Recht hatte: Die Welt wird tatsächlich mit jedem Tag enger und bedrängender.« Für Grossmann ist es das Schreiben, für andere das Denken, was den Raum wieder größer werden lässt. Es braucht solche Leute wie Hannah Arendt und heute auch Tony Judt, der in der jüdischen Öffentlichkeit unter polemischem Beschuss steht, und da geht es nicht um die Bewertung von Vorschlägen, sondern um die Kraft, die Denken, Streit und Weiterdenken entfalten können. Kurz ein anderes Beispiel, Dieter Senghaas hat mich darauf aufmerksam gemacht. In der neuesten Ausgabe des New York Review of Books bespricht Tony Judt ein Buch von Robert B. Reich: Superkapitalismus: Wie die Wirtschaft unsere Demokratie untergräbt. Superkapitalismus steht bei Reich für Globalisierung. In seiner Besprechung des Buches kritisiert Judt den Preis des Superkapitalismus, wie Reich ihn entwirft. Für ihn bedeutet es die Durchökonomisierung aller Lebensbereiche. Reich setzt auf ein »integriertes System des globalen Kapitalismus«, das Wirtschaftswachstum und Produktivität gegen Klassenkämpfe, Revolutionen und Fortschritt setzt und kommt mit Margret Thatcher zu dem Ergebnis »There is no alternative.« Ich erzähle das nur der Denkfigur wegen, weil ich mich hier nicht ernsthaft auf die Argumente einlassen kann. Politik, politische Öffentlichkeit und Demokratie brauchen die Freiheit, Alternativen denken zu können und zu dürfen, ohne von Ausgrenzung bedroht zu werden: Das gilt für die scheinbar unausweichlichen Mechanismen der Globalisierung genauso wie für die Fragen nach der Zukunft Israels. Antonia Grunenberg hat in ihrer Jurybegründung andere Felder mit dringendem Diskussionsbedarf benannt. Abschließend möchte ich noch die Jury zu ihrer Wahl beglückwünschen und mich bei ihr für ihre Arbeit bedanken und freue mich jetzt auf den Festvortrag von Tony Judt, in dem er Ihnen zeigen wird, dass er den Preis zu Recht erhalten hat.
Vielen Dank!
SICH DER DISKUSSION STELLEN
Sehr geehrte Frau Grunenberg, sehr geehrter Herr Judt, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie hier in der Oberen Rathaushalle im Namen des Senats zur 13. Verleihung des Hannah-ArendtPreises für politisches Denken begrüßen. Hannah Arendt war zeit ihres Lebens eine mutige Denkerin, die auch die harten persönlichen Auswirkungen ihrer Meinungen nicht fürchtete. Sie hat nichts davon gehalten, durch ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Gruppe ihre kritische Haltung zu allem zu vergessen. Immer wieder stellte sie sich mit ihren Äußerungen abseits der herrschenden Meinung und scheute auch nicht Konflikte mit ihren Freunden. Nie verstand sie sich als Sozialistin oder Kommunistin, aber sie begriff sich auch nicht durchgehend als Zionistin. Ihr persönlicher Mut und ihre Zivilcourage zeigen sich in ihrem gesamten Lebensweg. Sei es bei der Unterstützung jüdischer Organisationen zur Zeit des Nationalsozialismus, aber auch bei ihren Reisen ins Nachkriegsdeutschland und bei ihrer Berichterstattung über den Eichmann-Prozess in Israel. Ihre öffentlichen und persönlichen Stellungnahmen zu politischen Ereignissen waren häufig unter Gegnern, aber auch unter Freunden umstritten. Freiheit und Gerechtigkeit waren für Hannah Arendt zentrale Begriffe. Sie hielt nichts davon, dem Denken Tabus aufzuerlegen. Arendt besaß eine tief sitzende Abneigung gegenüber umfassenden Weltanschauungen und Lehren vom Ganzen. In den USA, wo sie seit ihrer Emigration aus dem nationalsozialistischen Deutschland lebte, setzte sie sich mit der Diskriminierung der Schwarzen und dem Vietnam-Krieg auseinander. Sie befasste sich aber auch mit der Studentenrebellion von 1968. In diesem Zusammenhang stellte sie fest, dass die guten Episoden in der Geschichte gewöhnlich von kurzer Dauer sind. Für Hannah Arendt war das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, das Recht, Rechte zu haben, ein hohes Gut. Es handele sich beim Rechtsstaat um die Herrschaft der Gesetze und nicht um diejenige der Menschen. Hannah Arendt hatte sich stets gegen die Vorstellung einer Kollektivschuld gewandt. Für sie ist der Mensch ein frei handelndes, für seine Taten verantwortliches Wesen. Die Schuld haben konkrete Personen auf sich geladen. Sie äußerte in diesem Zusammenhang, »wo alle schuldig sind, da ist es niemand ...« Arendt wies stets darauf hin, dass eventuell auch sie unter bestimmten Bedingungen die hohen Anforderungen der persönlichen Verantwortung nicht erfüllt hätte: »Wer hat je behauptet, dass ich, indem ich ein Unrecht beurteile, unterstelle, selbst unfähig zu sein, es zu begehen?« Als Hannah Arendts Buch über den Eichmann-Prozess im Jahre 2000 in Tel Aviv als erstes ihrer Werke in einer hebräischen Ausgabe erschien, sorgte das Buch wieder für eine Diskussion. Arendt wurde ein grundsätzlicher Antizionismus vorgeworfen und ihre kritische Auffassung über die Rolle der Judenräte und der Begriff der »Banalität des Bösen« im Zusammenhang mit dem Eichmann-Prozess stieß auf Ablehnung. Hannah Arendt äußerte in einer Rede zur Verleihung des Lessing-Preises 1959, Ziel sei das freie Denken »ohne das Gebäude der Tradition« mit Intelligenz, Tiefsinn und Mut. Eine absolute Wahrheit existiere nicht, da sie sich im Austausch mit anderen sofort in eine »Meinung unter Meinungen« verwandle und Teil des unendlichen Gesprächs der Menschen sei, in einem Raum, wo es viele Stimmen gibt. Jede einseitige Wahrheit, die nur auf einer Meinung beruht, sei »unmenschlich«. Nun will ich einige Worte zu dem Preis sagen, der heute verliehen wird. Dieser Preis wird seit 1995 durch den Verein »Hannah-Arendt-Preis für kritisches Denken« verliehen. Die Mitgliederversammlung des Vereins bestimmt eine internationale Jury, die über die Preisträgerin oder den Preisträger berät und entscheidet. Das Grundprinzip dabei ist Unabhängigkeit und Eigenverantwortung. Die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bremer Senat stiften zwar gemeinsam das Preisgeld, nehmen aber keinen Einfluss auf die Regularien des Vereins und die Entscheidungen der Jury. Ziel der Preisvergabe ist es, die öffentliche Diskussion über strittige politische Fragen zu stimulieren. Die diesjährige Entscheidung hat bereits im Vorfeld zu Kontroversen geführt. Die jüdische Gemeinde in Bremen hat sich in einem offenen Brief gegenüber der Hannah-Arendt-Jury, der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Senat geäußert und die Haltung des diesjährigen Preisträgers Tony Judt zu Israel kritisiert. Ich muss nun die Verbindung der Preisverleihung durch den Verein Hannah-Arendt-Preis mit einer etwa dadurch zum Ausdruck gebrachten antiisraelischen Haltung des Bremer Senats deutlich zurückweisen. Wie sicherlich vielen der hier Anwesenden bekannt ist, unterhält Bremen seit vielen Jahren gute und enge Beziehungen zu Haifa. Diese Städtepartnerschaft umfasst seit 1978 zahlreiche Bereiche, die im regen Austausch miteinander stehen. Die tragende Institution ist die Stiftung Kulturfonds Haifa. Seit 1988 gibt es eine Rahmenvereinbarung, in der Ziele der Zusammenarbeit auf dem Gebiet von kommunaler Wirtschaft, des Tourismus, der Kultur und des Umweltschutzes formuliert werden. Gegenseitige Besuchsdelegationen von Schulen, Universitäten, Bürgerinnen und Bürgern, Abgeordneten finden regelmäßig statt. Nicht so offiziell, aber trotzdem von Bedeutung, seien hier aber auch noch die Kontakte zu Haifas arabischer Nachbargemeinde Tamra erwähnt. Im nächsten Jahr werden zahlreiche Aktivitäten in Bremen anlässlich des 60. Jahrestages der Gründung Israels stattfinden, an denen der Senat, die Deutsch-Israelische Gesellschaft, der Verein Bremer Freunde Israels, die Universität, die Bremische Bürgerschaft, die Landeszentrale für politische Bildung, die Volkshochschule, die Jüdische Gemeinde und viele andere beteiligt sind. Nun, es ist der diesjährigen Preisverleihung, der Entscheidung der Jury für den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken an den Historiker Tony Judt, zweifellos gelungen, eine öffentliche Diskussion anzustoßen. Herr Judt, ich gratuliere Ihnen herzlich zu diesem Preis! – Sie haben diesen Preis auch erhalten, weil Sie mutig, unerschrocken und vielleicht unbequem ihre Vorstellungen vertreten. Auf diese Weise hat man natürlich nicht immer Recht. Allerdings ist es sehr wichtig, zu seinen Meinungen – ohne Starrsinn – zu stehen. Aber genauso wichtig ist es auch, dass man bereit ist, sich der Diskussion zu stellen und in der Auseinandersetzung dazuzulernen. Auf diese Weise kann ein Dialog zu fruchtbaren Ergebnissen führen. Ich bin mir sicher, Hannah Arendt hätte diese Diskussion zugelassen und engagiert geführt.
I t’s a great honour, because Hannah Arendt is one of the most influential writers in my own intellectual life and because she stands for a certain kind of political honesty in public debate, which I admire greatly.« Mit diesem O-Ton wird Tony Judt am 29.11.07, einen Tag vor der Preisverleihung, im Hörfunk von WDR 3 Tageszeichen und von NDR Kultur Journal vorgestellt. Autor Wolfgang Stenke präsentiert den jüdischen Historiker nicht nur als einen Verfechter des Meinungsstreites, indem er einige Beispiele von Konflikten um Judts pointierte Meinungen oder Maßnahmen der Druckausübung jüdischer Interessenverbände in den USA aufzeigt. Denn es gab auch von einem akuten Streit um den Preisträger zu berichten: »Doch der Gelehrte ist zugleich ein scharfer Kritiker der israelischen Regierungspolitik. In dieser Eigenschaft erschien der Historiker dem Präsidium der Jüdischen Gemeinde Bremen durchaus nicht als preiswürdig. In einem offenen Brief an die Jury, den Bremer Senat und die Heinrich-Böll-Stiftung, die die Auszeichnung vergeben, schreiben die Repräsentanten der Gemeinde ...« Der Weserkurier vom 1.12.07 führt die Namen zweier Vorstandsmitglieder an, nämlich Elvira Noa und Grigori Pantijelew. Das Radiofeature führt Passagen dieses Briefes an: »Wenn einer – jahrein, jahraus – sagt: Israel sei ›umstritten‹, ... ›ein Besatzer und Kolonialist‹, ›eine strategische Belastung‹, ›ein politischer Anachronismus« etc., stellt sich die Frage, was das soll? Wir würden sagen, das ist keine Kritik an einer Regierung, sondern eine antiisraelische Haltung.« Im Feature wird Judt im O-Ton dagegengestellt: »Offensichtlich haben sie nur einen meiner Artikel gelesen und sind, wie es scheint, deshalb kaum in der Lage zu urteilen. Ich habe vor Jahren in Israel gelebt. Vielleicht weiß ich ein wenig mehr über den Mittleren Osten als einige Leute von der Jüdischen Gemeinde in Bremen. Es ist schade, dass sie sich in der Frage, wer über Israel sprechen darf, zu Autoritäten aufschwingen.« Stein des Anstoßes ist für den Autor vor allem Tony Judts Essay »Israel: die Alternative«, des Historikers Plädoyer für einen binationalen Staat für Juden und Palästinenser. O-Ton: »Die Tragödie ist, dass ein rein jüdischer Staat zunehmend unmöglich wird, da die Araber in dem von Israel beherrschten Territorium bald die Mehrheit haben werden. Nach meiner Ansicht wäre eine Zweistaatenlösung immer noch die beste, aber die wird sich kaum auf eine für beide Seiten akzeptable Weise finden lassen. Und das ist eine Wahrheit, die vielen meiner Kritiker sehr unangenehm ist.« Robert Best im Weserkurier bemerkt, »eine vergleichbare Empörung gab es in der 13-jährigen Geschichte des HannahArendt-Preises noch nie«. Unter der Schlagzeile »Eine umstrittene Ehrung« zitiert auch er aus dem offenen Brief, ist jedoch bemüht um eine differenzierte Berichterstattung, indem er die Sachprobleme ins Zentrum rückt, die auch im Radio-Feature behandelt werden. »Israel sei jedoch nicht geholfen, wenn man über seine ›aggressive Politik‹ schweige. Vielmehr sei es das Schweigen selbst – auch das über die Vernichtung der Juden in Europa –, das Vorurteile erzeuge«, fasst er ein Wort Judts zusammen. Das ist auch die zentrale Passage eines Artikels von Verena Luecken in der FAZ am 3.12.07: »Judt ... lehnte diesen Angriff in Bremen als Anmaßung ab. Er besteht darauf, dass zwischen Kritik und Antisemitismus unterschieden werden müsse. Die Kritiker könnten ›nicht anderen Juden sagen, was sie tun oder lassen sollen‹. Es sei für Israel nicht hilfreich, wenn man über dessen ›aggressive Politik‹ schweige ... Judt bestätigte mit seinen Äußerungen seinen Ruf als politisch provokanter Vordenker.« Sie leitet den Schluss ihres Artikels mit dem Charakter des Preises und der Begründung der Jury ein, »dass er (Judt) sich wie frühere Preisträger durch Widerstände nicht das politische Denken verbieten lasse«. Dagegen scheint Klaus Wolschner von der taz Nord (27.11.07) das kritische Augenmaß bei der Jury zu vermissen: »In der Begründung der Jury für die Wahl des Preisträgers wird auf dessen kritische Position zu dem Staat Israel nicht eingegangen.« Auf Positionen lässt sich sein Artikel allerdings nicht ein, sondern hängt sich an eine Formulierung des offenen Briefes an: »›Sein Programm des binationalen Staates ist, nach treffenden Worten Leon Wieseltiers, keine Alternative für Israel, sondern die Alternative zu Israel‹, schreibt Elvira Noa.« Er folgt auch der Kritik, Judt »sei als Historiker bei weitem nicht so anerkannt und gepriesen wie als Israel-Kritiker. In der Tat ist Judt in den USA vor allem durch die Auseinandersetzung mit der Israel-Lobby in den Medien bekannt geworden.« Einen scheinbar unparteiischen Kommentar, »Lob und Tadel«, entbietet Frank König in der Jüdischen Zeitung (Dez. 2007). Zunächst stellt er den Preis und den Preisträger dar, man möchte sagen, angenehm distanziert. Vielleicht eine Spur zu objektiv, denn zu Hannah Arendt fällt ihm nur ein knappes Zitat von Rita Süssmuth ein. Aber auch das Präsidium der Jüdischen Gemeinde ist nur das »besagte Präsidium«, Distanz also allerorten. Alle haben bestimmte Meinungen und Kritiken und kommen zu Wort, den LeserInnen wird eine kleine Demokratielektion geboten. Interessant ist, dass Tony Judt in der Sache nicht zu Wort kommt, dafür sein Kritiker Micha Brumlik ein bisschen mehr als alle anderen. »Brumlik verurteilt Judt ›keineswegs unisono‹«, schreibt König, nachdem er ihn mit einer Kritik zitiert hat, die den binationalen Staat als Gedankenspiel linksliberaler Zionisten ins Jahr 1948 zurückkatapultiert hat. Natürlich ist das Kritik nach Strich und Faden. Wenn er dann noch nachlegt: »Judt verwende allerdings in einigen seiner jüngsten Aufsätze ›wirklich eine mehrfach unglückselige Metaphorik‹ – bezogen auf Judts Nahost-Auffassungen«, dann weiß man auch, wo der objektive Herr König steht, nämlich am objektiven Rockzipfel von Micha Brumlik. Und ganz objektiv legt er dann an dieser Stelle noch eine kritische Anmerkung von Ralf Fücks nach, wohl wissend, dass die hier gar nichts verloren hat.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz