
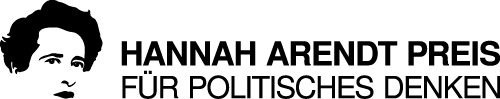

Juri Andruchowytsch, ukrainischer Lyriker, Essayist, Romanautor, Übersetzer und Theatermacher, und Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina, Aktionskünstlerinnen aus Russland.

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Die Jury hat den Preis zu gleichen Teilen an die Bürgerrechtsaktivistinnen Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina einerseits und an den ukrainischen Schriftsteller Juri Andruchowytsch andererseits vergeben. Wir bedauern es sehr, dass die beiden russischen Preisträgerinnen verhindert sind, den Preis persönlich in Empfang zu nehmen. In seiner Laudatio wird Joscha Schmierer noch auf ihre Geschichte eingehen.
Der Verlauf des Abends gestaltet sich folgendermaßen: Es folgt die Begründung der Jury zusammen mit der Laudatio auf unsere Preisträgerinnen und den Preisträger durch Joscha Schmierer. Es sprechen dann Bürgermeisterin Karoline Linnert für die Freie Hansestadt Bremen und Ralf Fücks für die Heinrich Böll Stiftung als den Institutionen, die den Preis finanziell unterstützen. Es folgt ein musikalisches Zwischenspiel der ukrainischen Künstlerin Ulyana Horbatschewska und ihres Kollegen Mark Tokar. Daran schließt sich der Festvortrag von Juri Andruchowytsch an. Dieser Teil des Abends endet mit der Preisübergabe und – wie in den letzten Jahren auch – mit einem Sektempfang im Nebenraum. Neu an unserem Abendprogramm ist, dass wir die Anwesenden im Anschluss zu einem festlichen Empfang mit Buffet im Institut Français an der Contrescarpe einladen. Dies ist das Programm für den heutigen Abend.
Morgen um 11 Uhr findet in der Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112, eine politisch-literarisch-musikalische Veranstaltung zu und mit den Preisträgern statt. Im ersten Teil verlesen zwei Sprecherinnen die Plädoyers von Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina aus ihrem Prozess in Moskau, in dem sie am 17. August 2012 wegen »Rowdytums aus religiösem Hass« zu je zwei Jahren Arbeitslager verurteilt wurden. Es folgt eine literarisch-musikalische Performance von und mit Juri Andruchowytsch, Ulyana Horbatschewska und Mark Tokar. Bitte entnehmen Sie diese Angaben auch dem Programm.
Meine Damen und Herren, der Hannah-Arendt-Preis ist ein europäischer Preis mit transatlantischen Bezügen. Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich erwähne, dass sich die Idee des Preises auf das politische Denken seiner Namensgeberin bezieht. Hannah Arendt arbeitete nach ihrer Flucht aus Europa und ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten unter anderem an der Frage: Wie kann ein politischer Neubeginn für Europa aussehen? Welche politischen Konsequenzen sind aus der Katastrophe zu ziehen? Die Antwort schien ihr so deutlich wie sie offenbar unrealistisch war: Ein Neuanfang sollte beginnen mit dem Abschied vom Nationalstaat des 19. Jahrhunderts. In Arendts Erfahrung gehörten die europäischen Nationalstaaten mit ihrer gleichsam angeborenen Ausgrenzungspolitik gegenüber Minderheiten und Flüchtlingen zu den Mitverursachern der beiden Weltkriege und des Genozids an den europäischen Juden.
In der Realpolitik ist ihre Erkenntnis damals nicht angekommen. Es hat keinen Abschied vom Nationalstaat gegeben, wohl aber die Begründung eines neuen Europa und die wirtschaftliche Vernetzung der europäischen Nationalstaaten. Diesen fällt es bis heute schwer, an die Stelle der traditionellen Ausgrenzungspolitik gegenüber Minderheiten und Flüchtlingen eine Aufnahmepolitik mit Augenmaß zu setzen.
Etwas Neues kam hinzu: Das neue Europa war aufgrund der Teilung des Kontinents amputiert. Die westlichen europäischen Staaten deklarierten sich in der Folge als neues Gesamteuropa, das Zentrum und der Osten verschwanden im Schatten der Katastrophe. Bemerkenswert ist nun, dass nicht nur der Osten, dessen Staaten zu Satelliten des sowjetischen Imperiums geworden waren, unter der Teilung gelitten hat, sondern dass die Teilung auch im Westen tiefe Spuren hinterlassen hat. Die zeigen sich bis heute in der täglich praktizierten Überzeugung, dass das wahre, das wirkliche, das effektive, das zukunftsträchtige Europa im Westen liegt. Die zentraleuropäischen und ost- sowie südosteuropäischen Staaten sind zwar zum großen Teil Mitglieder der EU oder werden es in naher Zukunft sein, doch ihre Stellung, ihre Anerkennung leidet darunter, dass ihre Wachstumsraten zu wünschen übrig lassen. In der öffentlichen Meinung gehören diese Länder, die doch einst das Zentrum Europas bildeten, noch kaum zum neuen Europa. Das Gesamtbild Europas ist von der wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte der westlichen Staaten geprägt.
Dies gilt erst recht für die Ukraine. Seit dem Beginn der Freiheitsbewegung auf dem Kiewer Maidan, die zum Sturz der korrupten Regierung führte, denken Westeuropäer darüber nach, wie man das Geschehen in der Ukraine zu beurteilen und zu behandeln hat. In der Öffentlichkeit streiten sich die, die befinden, dass die Ukraine zu den Außenbezirken des russischen Machtbereichs gehört, mit denen, die die jahrelange Freiheitsbewegung in der Ukraine und den erklärten Willen der Mehrheit ihrer Bevölkerung als besten Beweis ihrer Zugehörigkeit zu einem neuen Europa sehen.
Als Russland die Krim besetzte und Krieg in der Ukraine anzettelte, definierte ihn die westeuropäische Politik einerseits als Bruch des Völkerrechts und andererseits als inneren Konflikt zwischen zwei zusammengehörigen Nachbarstaaten. Als russische Freischärler und reguläre Militärs die Ost-Ukraine besetzten und ein unerklärter Krieg begann, wurde das als besorgniserregender Konflikt definiert und die Kontrahenten zu diplomatischen Gesprächen aufgerufen. Einzig Polen und die baltischen Staaten verstanden sich zu eindeutigen Solidaritätsbekundungen für die Ukraine.
Ein Gespenst geht um in Europa: das Gespenst eines erzürnten Putin, der kriegerische Gesten vollführt – und damit ganz Europa einschüchtert. Die Ukraine soll in dieser Situation, so wollen uns viele Gutmeinende einreden, um des europäischen Friedens willen das Notopfer sein. Ist das nicht auch damals, zwischen 1939 und 1945 die »tragische Rolle« der Ukraine gewesen, Opfer der beiden Großmächte Deutsches Reich und Sowjetunion zu sein? Und haben sich westdeutsche Politiker nicht schon einmal geirrt, als sie in den Achtzigerjahren die polnische Freiheitsbewegung Solidarnosc als eine Bedrohung für den Frieden kritisierten?
Es ist richtig, der Freiheitswille von Völkern stellt überkommene politische Ordnungen in Frage. Aber kann dieser Umstand begründen, dass das freie Europa gegen den Freiheitswillen eines Volkes, das sich ihm anschließen will, agiert?
Wir befinden uns nicht im Jahre 1939 – die Geschichte wiederholt sich nicht.
Es geht mir auch nicht darum, westliche diplomatische Strategien zu kritisieren, unsere Kritik richtet sich auf die europäische und vor allem die deutsche Öffentlichkeit. Man darf die Art und Weise, wie hier mancherorts die Diskussion geführt wird, ruhigen Gewissens geschichtsvergessen und anti-politisch nennen.
Westeuropa und Deutschland müssen aufhören die Teilung Europas zu zementieren, indem ihre Wortführer die Ukraine als den russischen Sicherheitsinteressen untergeordnet behandeln und den Freiheitswillen seiner Bevölkerung für eine diplomatische Lappalie halten. Eine solche Einstellung ist eines Europas der Freiheit nicht würdig.
Vom politischen Denken zum Handeln
Ich freue mich, dass wir – die Heinrich Böll Stiftung Bremen und der Bremer Senat – heute gemeinsam den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken verleihen. Wir verleihen diese Auszeichnung an den Schriftsteller, Übersetzer und Journalisten Juri Andruchowytsch aus der Ukraine. Schön, dass Sie heute hier sein und den Preis persönlich in Empfang nehmen können. Und wir verleihen den Preis gleichermaßen an Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina, die wohl den meisten von uns zuerst als Mitglieder der Gruppe Pussy Riot bekannt geworden sind. Sie stammen aus Russland und leben dort. Auf beide müssen wir heute leider verzichten.
Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken wurde 1994 ins Leben gerufen, um in den kontroversen Diskussionen über politische Gegenwartsfragen an Hannah Arendts Ausspruch zu erinnern, dass »der Sinn von Politik Freiheit (ist)«. Und dem folgen diese drei Persönlichkeiten – jeweils auf ihre Weise.
Gemeinsam ist den Preisträgerinnen und dem Preisträger, dass sie mit ihrer Kunst – mit knallbunter, lauter Aktionskunst oder mit ruhigerer, literarischer Kunst – hochpolitisch und sehr aktuell sind und sich deutlich positionieren. Und gemeinsam ist ihnen auch, dass sie jeweils auf ihre Weise dem expansiven Machtgebaren Wladimir Putins Einhalt gebieten wollen – in territorialer wie in geistiger Hinsicht. Weder ist die Ausdehnung russischer Grenzen auf das Staatsgebiet der Ukraine hinnehmbar noch die Besetzung der Köpfe mit einer einzigen, bestimmten, patriarchalen und autoritären Vorstellung davon, wie die russische Bevölkerung zu glauben und zu leben hat. Die drei, die wir heute ehren und auszeichnen wollen, sehen sehr genau hin. Und darauf beruht ihr Protest.
Kunst als Mittel des politischen Protests ist in Deutschland heutzutage nicht (mehr?) ein so verbreitetes Mittel, zumal die Möglichkeiten, damit Aufregung zu erreichen, geringer sind. Das mag an unserer gefestigten Demokratie liegen und an gesicherten Vorstellungen von der Freiheit der Kunst und der Freiheit des gesprochenen und geschriebenen Wortes.
Bremen hat traditionell Partnerstädte in Osteuropa, Danzig und Riga. Ich habe sie mehrfach besucht und habe anfangs geglaubt, dass die Menschen dort mit mir als Deutsche über die Vergangenheit und den Nationalsozialismus sprechen wollen. Mir ist aber viel häufiger begegnet, dass sich die Menschen in Danzig und Riga viel intensiver mit der aktuellen Situation beschäftigten und sich darüber austauschen wollten, wie sehr sie die Haltung Russlands ihnen gegenüber als aggressiv und bedrohlich wahrnehmen.
Juri Andruchowytsch, die Zeit Ihrer Aktionskunst beziehungsweise der Performancegruppe »Bu-Ba-Bu« liegt schon ein paar Jahre zurück: 1985 waren Sie da sehr aktiv. Da waren Ihre Mit-Preisträgerinnen noch nicht einmal geboren. Entsprechend unterschiedlich sind Sie aufgewachsen: Während Sie, Juri Andruchowytsch, Ihre Militärzeit bei der Sowjetischen Armee ableisten mussten, löste sich eben diese Sowjetunion gerade auf, als Marija Aljochina 1988 und Nadeshda Tolokonnikowa 1989 auf die Welt kamen.
Sie haben im Jahr 2004 die »Orangene Revolution« auf dem Maidan erlebt, die Euphorie damals, und Sie haben dem Euromaidan vor etwa einem Jahr ein ziviles Gesicht gegeben, das diejenigen Lügen straft, die behaupteten, diese Bewegung bestehe vor allem aus Rechtsextremisten. Und das tun Sie mit ihrer Sprache, die eben nicht einfach nur nachrichtliche Berichterstattung ist, sondern die Sprache eines Literaten, eines Künstlers ist – mit sehr klarem Bezug zum Alltag, zur Realität. Ihre gedankliche Auseinandersetzung mit Russland ist schon älter. Ich möchte an dieser Stelle eine Passage aus Ihrem Essay »Mit sonderbarer Liebe« aus dem Jahr 2003 zitieren. Es ist in dem Band Engel und Dämonen der Peripherie im Jahr 2007 in Deutschland erschienen.
»Was will ich von Russland?
(…)
Daß es aufhört, Druck auf die Ukraine (und alle möglichen anderen Schweden) auszuüben: wen sie, die Ukraine, wählen oder nicht wählen soll, mit wem sie sich zusammentun soll und mit wem unter keinen Umständen.
Daß es die Idee aufgibt, uns alle am Gängelband zu führen.
Daß es sich, wieder im Geiste Dynkos, endlich von der Perspektive einer extensiven Entwicklung verabschiedet, von der Expansion nach Westen, und sich auf sich selbst konzentriert, tief und wunderbar, wie es ist. Daß es meine Romane im Original liest.
Daß es aufhört, mein Land ausschließlich als Heimat der Speckfresser wahrzunehmen.
Daß es nie wieder seine besten Schriftsteller hinter Gitter bringt.
Daß es liberal-individualistisch wird, daß das russische Individuelle (das Positive) für immer die Oberhand gewinnt über das russische Gesellschaftliche (das Negative).
Anders gesagt: daß in dieser hochexplosiven Mischung aus Despotie und Anarchie namens Russland die russische Anarchie über die russische Despotie siegt.
Meine Forderungen sind absurd und unerfüllbar, meine Liebe zu Russland ist sonderbar.«
Heute sind Sie eine der wichtigsten Stimmen der Ukraine, ein weitsichtiger und wichtiger Wortführer einer politisch aufgeklärten, kritischen Schicht, die Freiheit und eine demokratische Ausrichtung anstrebt und auf Posen vom »starken Mann« gerne verzichtet. Man liest viele Interviews mit Ihnen auch in deutschen Zeitungen, und Sie haben deutliche, aber sehr differenzierte Kritik auch an der hiesigen Berichterstattung und an Europa. Wir erleben derzeit keine »Ukraine-Krise«, sondern einen »Krieg«. Das sagen Sie ganz klar. Und dieser Krieg betrifft nicht nur die Ukraine, sondern auch andere Nachbarländer Russlands.
Über diese Situation mache ich mir derzeit große Sorgen. Es kann wohl niemand ernsthaft eine militärische Reaktion für die richtige halten. Man kann aber auch nicht hinnehmen, dass der amtierende russische Präsident Teile der Ukraine annektieren lässt und man ihm das unwidersprochen durchgehen lässt. Ich muss zugeben, diese Situation macht hilflos, man fühlt sich ohnmächtig und das Darüber-Nachdenken bereitet Pein. Denn was ist die Lösung?
Auf die Frage, welcher Gesprächspartner Wladimir Putin auf Augenhöhe begegnen könne, haben Sie kürzlich bei einem Gespräch im Bremer EuropaPunkt gesagt: »Die Realität!«
Denn in der Realität sterben russische Soldaten, kostet dieser russische Militäreinsatz viel Geld, das anderswo beispielsweise für Krankenhäuser fehlt, und zeigen auch die Sanktionen der EU Wirkung, die russische Bevölkerung spürt sie. Ich will gerne mit Ihnen darauf hoffen, dass die Realität hilft, eine Grenzen missachtende Politik in die Schranken zu weisen. Und ich will gerne mit Ihnen darauf hoffen, dass kritische Russinnen und Russen in Moskau oder St. Petersburg das Wagnis eingehen, gegen eine solche Politik zu protestieren.
Mutige Russinnen sind Marija Aljochina, Nadeshda Tolokonnikowa und Jekaterina Samuzewitsch. Diese drei waren es, die im Februar 2012 mit ihrer Aktionskunst weltweit bekannt geworden sind: Sie waren damals die drei Pussy Riots, die das »Punk-Gebet« in der ChristErlöser-Kathedrale Moskau vorgetragen haben.
Es mag sein, dass sie damit auch religiöse Gefühle verletzt haben – das ist ein schmaler Grat, auf dem man da wandelt. Aber ihre Kunst basiert auf fundiertem politischem Denken. Pussy Riot haben sich mit ihrer Aktionskunst für die Freiheit eingesetzt. Die drei sehr mutigen, jungen Frauen haben sich sehr genau überlegt, was sie da tun. Sie sind sehenden Auges ein sehr großes persönliches Risiko eingegangen. Ihnen war klar, welche Justiz-Maschinerie und Bestrafung da auf sie zurollen würde, da bin ich mir sicher.
Marija Aljochina machte in ihrem Schlussplädoyer am Ende des Prozesses deutlich, wofür sie sich eingesetzt haben: die Freiheit. Dabei spielte sie eine sprachliche Demütigung an das Gericht zurück. Sie sagte: »Mich ärgert sehr, wenn die Anklage von ›sogenannter‹ moderner Kunst spricht. … Für mich trifft das Wort ›sogenannt‹ nur auf diesen Prozess zu. Und ich habe keine Angst vor Ihnen. Ich fürchte mich nicht vor den Lügen und Erdichtungen, dem schlecht kaschierten Betrug im Urteil des sogenannten Gerichts. Denn Sie können mich zwar der sogenannten Freiheit berauben, die es in Russland gibt (und nur eine solche gibt es in der Russischen Föderation), aber meine innere Freiheit kann mir niemand mehr nehmen. Sie lebt im Wort; sie wird dank der Öffentlichkeit leben, wenn Tausende von Menschen es lesen und hören werden.«
Die Künstlerinnen haben mit ihrer damaligen Verhaftung ihre Freiheit eingebüßt. Sie haben die Folgen ihres Protests erlitten, die Verurteilung zu jahrelanger Haft in Straflagern.
ung zu jahrelanger Haft in Straflagern. Mich beeindruckt, dass es dem System jedoch nicht gelungen ist, diese offensichtlich starken Frauen zu brechen. Stattdessen arbeiten nun Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina dafür, die Haftbedingungen all der Frauen, die gerade jetzt auch inhaftiert sind, so weit zu »verbessern«, dass geltendes Recht eingehalten wird: etwa dass die tägliche Arbeitszeit tatsächlich nur acht Stunden beträgt und nicht 14 oder 16 Stunden, wovon Nadeshda Tolokonnikowa berichtet hat. Sie haben die Nichtregierungsorganisation »Zone des Rechts« gegründet, um unmenschliche Bedingungen und Willkür im russischen Strafvollzug, die sie selbst erlebt haben, zu bekämpfen.
Gemeinsam haben Juri Andruchowytsch, Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina, dass sie ihre Aufgabe darin sehen, über die herrschenden Zustände zu berichten, dagegen zu protestieren und über die Hintergründe zu informieren, vor allem im westlichen Europa und in den USA. Sie alle drei sind derzeit viel auf Reisen, knüpfen Kontakte, geben Interviews und halten Vorträge. Damit kämpfen sie für die Freiheit in ihrem Land.
Aber nicht nur das: Sie erlauben es uns in den westlichen Demokratien nicht länger, uns auf ein vorgeschütztes, diffuses Halbwissen zurück zu ziehen, so zu tun, als wären das »interne Angelegenheiten« und uns nicht mit der Realität auseinander zu setzen. So wird aus politischem Denken politisches Reden und politisches Handeln. Und dafür ehren wir sie heute.
Im Namen des Senats danke ich der Heinrich Böll Stiftung und der Jury, die uns immer wieder solche beeindruckenden Preisträgerinnen und Preisträger präsentiert und uns damit auch immer wieder eine Nuss zu knacken gibt. Ich gratuliere Ihnen herzlich und freue mich auf die Festrede von Juri Andruchowytsch.
Über Wahrheit und Lüge in der Politik
Der Hannah-Arendt-Preis war schon immer ein politischer Preis. Sonst würde er seiner Namensgeberin nicht gerecht. In diesem Jahr ist das vielleicht noch mehr als sonst der Fall. Die PreisträgerInnen konfrontieren uns mit den dramatischen Entwicklungen im Osten unseres Kontinents: mit der autoritären Wendung der russischen Machtelite nach innen und ihrer expansiven Wendung nach außen und dem schon fast verzweifelten Kampf der Ukraine um ihre territoriale Einheit und politische Souveränität. Zugleich verweist die Auswahl der Jury darauf, dass noch nicht aller Tage Abend ist.
Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina stehen für den ungezähmten, freiheitlichen Geist, der in der russischen Kulturszene, in der Menschenrechtsbewegung und in feministischen Zirkeln weht, allen Repressalien zum Trotz. Und Juri Andruchowytsch steht für den erneuten demokratischen Aufbruch in der Ukraine – dem dritten seit 1990/91, als sich die große Mehrheit für die Loslösung von der Sowjetunion entschied. Im Kern geht es darum noch immer: um die doppelte Selbstbefreiung der Ukraine von russischer Dominanz wie von den postsowjetischen politischen und gesellschaftlichen Strukturen – organisierte Verantwortungslosigkeit, kriminelle Bereicherung, staatliche Willkür, eine unselige Verschränkung politischer und wirtschaftlicher Macht, soziale Gleichgültigkeit.
Andruchowytsch ist ein politischer Intellektueller, der öffentlich Partei ergreift. Als Schriftsteller ist er zugleich ein Dolmetscher, der uns die Welt Mitteleuropas erklärt: eine Welt, die uns historisch und geographisch so nah ist und doch von vielen als »nicht zugehörig« empfunden wird. Und er ist ein wahrer Europäer, der die Idee des freien und einigen Europa verteidigt. Bis vor kurzem hätte ich gesagt: der nicht müde wird, uns zu erklären, dass in der Ukraine um die Zukunft Europas gekämpft wird. Wenn ich nicht irre, ist sein Ton in der letzten Zeit ungeduldiger geworden und mit Bitterkeit gemischt über all den Unverstand, die Ignoranz und die Vorurteile, mit denen die Ukraine im Westen zu kämpfen hat. Umso wichtiger ist dieser Preis – als Signal, dass wir diese Auseinandersetzung als unsere eigene verstehen.
Es führt eine direkte Linie vom Preisträger des letzten Jahres, Timothy Snyder, zu den heutigen Preisträgern. Im Internet kursiert der Videomitschnitt eines Vortrags von Snyder, in dem er den Propagandakrieg des Kremls seziert. Er erwähnt Hannah Arendt nicht explizit, aber sein Vortrag erinnert lebhaft an einen Essay, den sie 1963 unter dem Titel Wahrheit und Politik veröffentlichte. Man findet darin fast alles, was zum Verständnis der heutigen Desinformationspolitik des Kremls erforderlich ist. Im Anschluss an Leibniz unterscheidet Arendt mathematische, wissenschaftliche und philosophische Wahrheiten, die sie im Begriff der Vernunftwahrheit zusammenfasst, von Tatsachenwahrheiten als Grundlage demokratischer Meinungsbildung. Ich zitiere: »Wenn politische Macht sich an Vernunftwahrheiten vergreift, so übertritt sie gleichsam das ihr zugehörige Gebiet, während jeder Angriff auf Tatsachenwahrheiten innerhalb des politischen Bereichs selbst stattfindet. ... Innerhalb des Bereichs menschlicher Angelegenheiten (legt) jeder Anspruch auf absolute Wahrheit, die von den Meinungen der Menschen unabhängig zu sein vorgibt, die Axt an die Wurzeln aller Politik und der Legitimität aller Staatsformen.«
Man kann das als Absage an jede Form des Fundamentalismus lesen, bei dem die Politik als Vollstrecker absoluter Wahrheiten auftritt, seien sie religiöser, wissenschaftlicher oder weltanschaulicher Provenienz. Das bedeutet keineswegs, dass der Unterschied von Wahrheit und Lüge im Bereich des Politischen irrelevant wäre. In der politischen Auseinandersetzung geht es um begründete Meinungen. Sie beruhen auf der unterschiedlichen Bewertung tatsächlicher Ereignisse und Sachverhalte, also von »Tatsachenwahrheiten«. Den Unterschied zwischen Tatsachen und Meinungen zu verwischen hält Arendt für »nicht weniger schockierend als die Resistenz der Menschen gegen die Wahrheit überhaupt«, soweit sie ihnen nicht in den Kram passt.
Genau diese Verwischung betreibt die Kreml-Propaganda mit List und Tücke. Ein Beispiel: Als die malaysische Passagiermaschine über dem Gebiet der »Volksrepublik Donbass« abgeschossen wurde und 298 Menschen ihr Leben verloren, wurden prompt verschiedene Theorien in die Welt gesetzt, die alle durch das russischen Fernsehen geisterten und im Internet breite Resonanz fanden:
die Maschine wurde durch ukrainische Artillerie abgeschossen;
es waren ukrainische Jagdflieger (eine entsprechende Fotomontage wurde im russischen Staatsfernsehen gezeigt);
es waren US-Kampfflugzeuge im Spiel; das Ganze war ein gezieltes Komplott, um einen Kriegsvorwand gegen Russland zu fingieren;
den Vogel schoss die Behauptung ab, das Flugzeug sei schon als fliegender Sarg gestartet, vollgepackt mit Leichen, die gezielt über dem Territorium der Separatisten zum Absturz gebracht wurden.
Dass sich diese Versionen widersprechen, spielt keine Rolle: Es geht nicht um Aufklärung, sondern um systematische Verwirrung. Am Ende ist jede Version beliebig, jedes Untersuchungsergebnis steht unter dem Verdacht der Manipulation; jeder Indizienbeweis, der auf die prorussischen Separatisten hindeutet, wird in das Zwielicht einer interessengeleiteten Meinungsäußerung gezogen. Damit das funktioniert, mussten am Boden alle Spuren verwischt werden, so gut es ging, und genau das ist passiert.
Man kann unterschiedliche Schlüsse aus sozialen Sachverhalten ziehen. Wer aber die empirischen Tatsachen manipuliert und sie zum bloßen Material im politischen Meinungskampf macht, entzieht damit auch der Meinungsfreiheit den Boden. Hannah Arendt: »Meinungsfreiheit ist eine Farce, wenn die Information über die Tatsachen nicht garantiert ist.« Sie zitiert ein Bonmot des französischen Staatsmanns Clemenceau, der Ende der 1920er-Jahre gefragt wurde, was künftige Historiker wohl über die damals (wie heute) strittige Kriegsschuldfrage denken werden. »Das weiß ich nicht«, soll Clemenceau geantwortet haben, »aber eine Sache ist sicher, sie werden nicht sagen: Belgien fiel in Deutschland ein.« Es wäre schon ein Fortschritt, wenn wir uns in der aktuellen Debatte darauf verständigen könnten, dass nicht die Ukraine Russland attackierte, sondern umgekehrt.
In der Wissenschaft ist der Gegensatz zur Wahrheit der Irrtum, in der Politik ist es die Lüge, also ein bewusster Akt der Unwahrheit. Wie sonst soll man es bezeichnen, wenn der Kreml zu Beginn der militärischen Intervention in der Krim leugnete, dass es sich um russische Truppen handelte? Das hinderte Putin natürlich nicht, anschließend Orden an die beteiligten Spezialeinheiten zu verteilen. Es geht nicht um Konsistenz des jeweiligen Narrativs, sondern um politische Zweckmäßigkeit. Die Tatsachen sind bloßes Material der politischen Propaganda.
Das gleiche Spiel wiederholt sich jetzt bei der Intervention in der Ostukraine. Auch hier wird die militärische Aggression hinter der löchrigen Fassade eines bewaffneten Aufstands der »russischen Landsleute« getarnt. Bis heute leugnen die Vertreter der Macht, dass Russland im Donbass mit Waffen und Kämpfern agiert. Die Liste organisierter Verdrehungen, Halbwahrheiten und ganzer Lügen wird täglich länger. Dazu gehört die gebetsmühlenhafte Behauptung, in Kiew habe ein »faschistischer Putsch« stattgefunden, die Rede vom »Bürgerkrieg« in der Ukraine, die Beschwörung der antisemitischen Gefahr, die Bezeichnung der ukrainischen Regierung als »faschistische Junta« et cetera.
Außenminister Lawrow ist ein Großmeister in der Verdrehung der Tatsachen. Wenn er behauptet, dass Russland nicht Kriegspartei sei, weiß jeder, dass er lügt, und er weiß, dass es jeder weiß, aber das kümmert ihn nicht. Er setzt darauf, dass es niemand wagen wird, ihn einen Lügner zu nennen – das wäre ja die Sprache des Kalten Krieges. Stattdessen kumpelt unser Außenminister auf offener Bühne mit seinem »lieben Freund Sergey«. Und wenn die Bundeskanzlerin nach einem langen nächtlichen Gespräch mit Präsident Putin Klartext redet, fehlt es nicht an Stimmen, die vor »rhetorischer Eskalation« warnen.
Was passiert mit uns, wenn wir nicht mehr wagen, die Dinge beim Namen zu nennen? Die Lüge hinzunehmen ist der Beginn der Selbstaufgabe der liberalen Demokratien. Wir rutschen damit auf die schiefe Ebene einer Relativierung der Tatsachen, an deren Ende die Relativierung aller Werte steht. Manchmal ist es schon eine politische Handlung, wenn man ausspricht, was der Fall ist. Noch einmal Hannah Arendt: »Wahrhaftigkeit ist nie zu den politischen Tugenden gerechnet worden, weil sie in der Tat wenig zu dem eigentlich politischen Geschäft, der Veränderung der Welt und der Umstände, unter denen wir leben, beizutragen hat. Dies wird erst anders, wenn ein Gemeinwesen im Prinzip sich der Lüge als einer politischen Waffe bedient, wie es etwa im Falle der totalen Herrschaft der Fall ist; dann allerdings kann Wahrhaftigkeit als solche … zu einem politischen Faktor ersten Ranges werden.
Wo prinzipiell und nicht nur gelegentlich gelogen wird, hat derjenige, der einfach sagt, was ist, bereits zu handeln angefangen, auch wenn er dies gar nicht beabsichtigte. In einer Welt, in der man mit Tatsachen nach Belieben umspringt, ist die einfachste Tatsachenfeststellung bereits eine Gefährdung der Machthaber.«
Genau das war das Credo der Dissidenten in der alten Sowjetunion, und an diesem Punkt sind wir heute wieder gegenüber dem autoritären Regime, das Putin in Russland etabliert hat.
Man kann bei Arendt lernen, dass demokratische Gesellschaften einer doppelten Gefahr ausgesetzt sind: Die eine ist die systematische Verwischung des Unterschieds von Wahrheit und Lüge, die andere liegt in der Versuchung Augen und Ohren vor unbequemen Wahrheiten zu schließen. Beides trifft für den Konflikt um die Ukraine zu. Wir wollen nicht wahrhaben, dass Putin längst die Grenze zum Krieg überschritten hat, die wir aus guten Gründen keinesfalls überschreiten wollen. Wir wollen den Zusammenhang zwischen Autoritarismus nach innen und Expansion nach außen nicht sehen, weil er die Illusion auf eine baldige Rückkehr zu guter Nachbarschaft stört. Wir zögern, den nationalreligiösen Ton ernst zu nehmen, den Putin in seiner jüngsten Rede an die Nation angeschlagen hat, als er die Heimholung der Krim zu einer heiligen Sache erklärte. (Genau diese Symbiose von russischer Orthodoxie und politischer Macht wollte Pussy Riot mit ihrer Aktion in der Moskauer Christ-Erlöser-Kirche offenlegen.)
Wir wollen nicht wahr haben, dass sich unsere Nachbarn in Polen und im Baltikum wieder von Russland bedroht fühlen, weil wir die NATO gern für eine historisch überholte Veranstaltung halten und mit militärischer Abschreckung nichts mehr zu tun haben wollen.
Ich fürchte nur, dass es nichts hilft, den Kopf in den Sand zu stecken. Jede realistische Politik beginnt mit der Anerkennung der »Tatsachenwahrheiten«, um noch einmal mit Hannah Arendt zu sprechen. Über die politischen Schlussfolgerungen kann und muss diskutiert werden.
Im Osten geht es um die Zukunft Europas
Es ist mir eine große Freude heute unsere Preisvergabe begründen und unsere Preisträgerinnen und unseren Preisträger würdigen zu können. Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken ist ein politischer Preis, und die Entscheidung der Jury für die Preisvergabe ist unvermeidlich auch eine politische Stellungnahme, mal eher implizit, mal eher explizit wie in diesem Jahr. Politisches Denken ist öffentliches Denken und begründet politisches Handeln. Politisches Handeln ist öffentliches Handeln, und wo die Öffentlichkeit durch politische Unterdrückung beschränkt bleibt, zielt politisches Handeln auf Herstellung von Öffentlichkeit, um gemeinsame Meinungs- und Willensbildung zu ermöglichen und den gemeinsamen Willen öffentlich geltend zu machen. Unter Umständen wirkt dieses Handeln revolutionär, zumindest aber provozierend, also anregend für die einen, aufregend für die anderen. Hannah Arendt spricht nicht umsonst vom »Wagnis der Öffentlichkeit«, das politisches Denken eingehen muss. Die Jury hat sich entschieden, den Hannah-Arendt-Preis in diesem Jahr gemeinsam, einerseits an zwei Frauen von Pussy Riot, nämlich an Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina, und andererseits an Juri Andruchowytsch, zu verleihen. Dabei vergeben wir nach unserer Ansicht nicht zwei Preise mit halber Ausschüttung, sondern einen gemeinsamen Preis in zwei Teilen. Leider auch finanziell zweigeteilt. Ich werde also zuerst erläutern, inwiefern wir einen gemeinsamen Preis verleihen, um dann die beiden Preisträgerinnen und den Preisträger jeweils für sich zu würdigen.
Sowohl der Euromaidan, für den uns Juri Andruchowytsch steht, als auch die Protestaktion von Pussy Riot sind eine Antwort auf konkrete Akte der gewaltsamen politischen Unterdrückung.
Bevor in Kiew der Maidan besetzt wurde, war eine Demonstration von Studenten, die gegen die Nichtunterzeichnung des Abkommens zwischen der Ukraine und der EU protestierten, von den Sicherheitskräften brutal zusammengeschlagen worden. Der zunächst minoritäre Protest gegen ein bestimmtes repressives Regierungshandeln wandelte sich schließlich zu einem Aufstand gegen die Regierung. Man mag diesen Aufstand als prowestlich oder proeuropäisch bezeichnen, und viele der Protagonistinnen und Protagonisten verstehen ihn sicherlich auch so, aber in erster Linie war er der Aufstand gegen eine Regierung, bei der die Leute die Unabhängigkeit der Ukraine und ihre eigene Freiheit gefährdet und verraten sahen. Es ist eine ziemliche Unsitte, jede Bewegung gegen Unterdrückung sofort zu einer prowestlichen und damit implizit zu einer antirussischen zu erklären.
Wenn ich sage, in erster Linie handelt es sich um einen Aufstand gegen Unterdrückung, dann meine ich, es ist noch nicht ausgemacht, wie sich die Ukraine, wenn es ihr gelingen sollte, die annektierte Krim wieder in das ukrainische Staatsterritorium aufzunehmen und die umkämpften Gebiete im Osten zurückzugewinnen, sich letztlich verorten wird. Hinter dem Sieg des Aufstandes steht immer noch die Frage, wie die territoriale Einheit und die Souveränität der Ukraine wieder hergestellt werden können. Mit der Entscheidung zwischen Himmelsrichtungen wird sie sich vielleicht nicht lösen lassen. Und damit stecken wir mitten in den Dilemmata der postsowjetischen Konstellation, dem Kampfboden, auf dem sich unser ukrainischer Preisträger wie unsere Moskauer Preisträgerinnen bewegen.
Der Auftritt von Pussy Riot, der mit Lager bestrafte Muschi-Aufstand in der Erlöserkirche also, war die Antwort auf die offensichtlichen Manipulationen zugunsten der erneuten Wahl von Putin zum Präsidenten, nachdem er schon zwei Amtszeiten und die Zwischenzeit bis zur erneuten Wahl zum Präsidenten als Ministerpräsident hinter sich gebracht hatte. Öffentliche Demonstrationen gegen Putins Wiederwahl wurden schikaniert und gewaltsam unterbunden, die Medien trommelten fast unisono für Putins Wiederwahl, Patriarch Kirill bezeichnete die Wahl Putins gar als Christenpflicht.
In dieser Situation richtete sich die Aktion von Pussy Riot gegen eine entscheidende Nahtstelle der Machtbasis des Putin-Regimes, gegen die Verknüpfung der führenden Kräfte der orthodoxen Kirche mit dem Kremlherrscher. Das Motiv war durch und durch politisch, und die Aktion wollte als öffentlicher Protest wahrgenommen werden. Natürlich konnte diese Aktion nicht öffentlich angekündigt werden, wenn sie nicht schon im Vorfeld unterbunden werden wollte. Sie konnte auch nicht im hellen Licht der Öffentlichkeit, sondern nur im Dämmerlicht der Christ-Erlöser-Kirche durchgeführt werden. Pussy Riot musste außerdem selber dafür sorgen, dass die Aktion öffentlich bekannt wurde. Das taten sie mit Hilfe von Video und Internet.
Gemeinsam ist dem Maidan und der Aktion von Pussy Riot der öffentliche Protest. Zugleich zeigt sich der große Unterschied zwischen den Bedingungen des Protests. In Kiew konnte der zentrale Platz zum Zentrum des öffentlichen Protests werden und monatelang besetzt gehalten werden. Pussy Riot musste klandestin vorgehen, um dann erst im Internet seinen öffentlichen Platz zu erobern. Der Maidan wurde zum Ort einer mehr oder weniger ununterbrochenen assenveranstaltung, bei der der gemeinsame Protest ganz leibhaftig als Kampfgemeinschaft gelebt werden konnte. Davon konnte bei der Aktion von Pussy Riot keine Rede sein. Sie landeten bis zum Prozess im Gefängnis.
Umso höher ist ihr Mut einzuschätzen, und umso erstaunlicher ist die öffentliche Wirkung, die sie erzielten. Dazu musste es ihnen gelingen, nach monatelanger Haft den Gerichtsaal als Bühne zu nutzen. Diese Bühne stand unter Zwangsverfassung. Dennoch gelang es ihnen, ihre Aktion zu begründen und zu verteidigen und in ihren Schlussworten ihr politisches Denken darzulegen. Marija Aljochina meinte, der Prozess spreche Bände und bezeichnete ihn als »eine heimtückische und groteske Maskerade« und klagte die Nichtexistenz eines Rechtsstaates an. Sie sagte: »Nachdem ich fast ein halbes Jahr hinter Gittern verbracht habe, weiß ich, dass das Gefängnis einfach Russland im Miniaturmaßstab ist. … Da ist keinerlei horizontale Verteilung von Aufgaben, die das Leben jedes Einzelnen spürbar erleichtern könnten. Und da ist das Fehlen jeder Eigeninitiative. Denunziation geht einher mit gegenseitigen Verdächtigungen. Im Gefängnis ist – wie in unserem ganzen Land – alles darauf ausgerichtet, den Menschen seiner Persönlichkeit zu entkleiden und ihn einzig mit seiner Funktion zu identifizieren, egal ob er nun Arbeiter oder Gefangener ist.« Die Frauen von Pussy Riot nahmen so unter immensem Druck den Gerichtssaal als letzten Ort einer bis auf das Äußerste reduzierten Öffentlichkeit wahr. Das verlangte viel Mut, aber auch einen klaren politischen Verstand.
Es geht derzeit beim Schreiben über die Vorgeschichten und die Nachwirkungen des Maidan ebenso wie bei Pussy Riot, ihrer damaligen Aktion, ihrer Verteidigung im Gerichtssaal und ihrer ungebrochenen Haltung im Lager und dem Einsatz für die Mitgefangenen nach ihrer Freilassung, wenn nicht direkt um ein gemeinsames politisches Ziel, so doch um das gleiche immense Problem: um Russland als Machtregime im postsowjetischen Raum. Und dieses russische Machtregime hat – freundlich ausgedrückt – derzeit das Zeug zum gesamteuropäischen und globalen Problem.
In dem von Juri Andruchowytsch in der »edition suhrkamp« herausgegebenen Band mit dem Titel Euromaidan findet sich ganz am Ende ein Aufsatz des polnischen Schriftstellers Andrzej Stasiuk: »Ein Staat ›unterwegs‹«. Der Aufsatz ist voller Sorge gegenüber Russland, aber es fehlt auch nicht an Empathie. Stasiuk schreibt: »Mich reizt die Idee Russlands als eines uneindeutigen Staates. Eines Staates, der zu Europa ebenso gehört wie zu Asien. Eines Staates mit definierten Grenzen, der zugleich beweglich ist, eines Staates ›unterwegs‹. Mir fällt immer der alte Witz aus sowjetischer Zeit ein: An wen grenzt die Sowjetunion? An wen sie will! In diesem Witz steckt eine tiefere Wahrheit, denn die Geschichte Russlands ist eine Geschichte, die mehr im Raum als in der Zeit spielte, es ist eine Geschichte, die im Grunde Geographie ist.«
Als frühe Illustration des Staates unterwegs mag ein Zitat aus Puschkins Die Reise nach Arzrum während des Feldzugs im Jahre 1829 dienen. Puschkin schreibt: »Noch nie hatte ich ein fremdes Land gesehen. Die Grenze hatte für mich etwas Geheimnisvolles; von Kind an waren Reisen mein Lieblingstraum. Lange habe ich ein Nomadenleben geführt, mal im Norden, mal im Süden umherstreifend, doch noch nie war ich über die Grenzen des unermesslichen Russland hinausgekommen. Heiter ritt ich hinein in den gelobten Fluss, und mein braves Ross trug mich ans türkische Ufer. Doch dieses Ufer war bereits erobert: ich befand mich noch immer in Russland.«
Der gelobte Fluss ist keine Grenze, sondern nur ein Hindernis, das der Staat unterwegs in ein neues Russland zu überwinden hat. Stasiuks Folgerung aus seinen Überlegungen zu Russland als »Staat unterwegs« lesen sich so: »Wir waren davon ausgegangen, dass Russland ein Staat wie unsere Staaten sei, mehr oder weniger, nur größer, tollpatschiger, rückständig und ein bisschen exotisch. Man müsse nur geduldig auf Russland einwirken, ihm gut zureden und es erziehen, damit es diesen Rückstand aufholt. Dem ist wohl nicht so. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir nicht an unsere eigene Fortsetzung grenzen. Wir grenzen an etwas anderes.«
Gleichzeitig meint Stasiuk: »Europa wird nie einen anderen Nachbarn haben. Umziehen kann es nicht. Mich als Polen freut es sogar, es nimmt meiner Heimat einen Teil der Last ab. Wir sind heute nicht mehr (hoffe ich doch) alleingelassen mit dem russischen Nachbarn. Da es nicht wegziehen kann, wird Europa lernen müssen, im russischen Schatten zu leben.«
Um aber in diesem Schatten leben zu können, ist es notwendig zu verhindern, dass er sich nach außen immer weiter ausdehnt und nach innen immer dunkler wird. Und deshalb ist es folgerichtig, Pussy Riot, die sich mit ihrer Aktion gegen das Schutz-und-Trutz-Bündnis von Kirche und Staat in der Unterdrückung von liberalem Recht und Freiheit gewandt haben, und Juri Andruchowytsch als Verteidiger und Exponenten der ukrainischen Unabhängigkeit gleichermaßen zu preisen.
Ein bisschen harsch äußerte sich Juri Andruchowytsch 2006 in der polnischen Gazeta Wyborcza über die EU – er ist eben kein bequemer Preisträger und wird es wohl auch nicht werden –, sie sei »eine Ansammlung postimperialer Loser, die es nicht im Alleingang geschafft haben, Supermacht zu werden« (zit. nach Perlentaucher). Zum Glück möchte man sagen: Die westeuropäischen Kolonialmächte wurden durch die antikoloniale Befreiung auf die Mutterländer zurückgeschnitten, das heißt auf begrenzte Staaten, die ihre Grenzen an anderen begrenzten Staaten finden, nachdem zuvor schon das potenziell ohne innere Schranken und ohne akzeptierte Grenzen im Osten sich ausbreitende deutsche Kontinentalreich in zwei Weltkriegen in den Grenzen Westdeutschlands und Österreichs zum »postimperialen Loser« geworden war, das heißt zu zwei dauerhaft begrenzten Staaten. Mit der Anerkennung der Grenze zu Polen bleibt auch das vereinigte Deutschland ein glücklicher postimperialer Loser, der als Gleicher unter Gleichen immer noch gut in die EU passt.
In der postsowjetischen Konstellation war und ist zwar völkerrechtlich alles klar. Schon die Republiken der UdSSR waren formell unabhängige Staaten in eindeutigen Grenzen. Das erleichterte ihre Unabhängigkeitserklärungen. Die Unabhängigkeit mündete nicht sofort in Grenzkriegen. Aber auch heute sind sie sich trotz OSZE und UN ihrer Unabhängigkeit nicht sicher.
Russland macht sich wieder auf den Weg und kann dabei die Widersprüche innerhalb der früheren Sowjetrepubliken nutzen. Die postsowjetische Konstellation ist keine postimperiale. Selbst abgesehen von seinen Expansionsbestrebungen bleibt Russland auch in seinen eigenen Grenzen ein multinationales Imperium unter russischer Vorherrschaft. Schließlich wurde Putins erster Krieg, der Tschetschenienkrieg, innerhalb der russischen Staatsgrenzen geführt. Für Russland mag seine Expansion durchaus als Fortsetzung des Gleichen erscheinen. Durch Eroberung ändert sich seine Politik. Sie wird aggressiv. Aber seinen Charakter ändert Russland damit nicht. Von innen aus gesehen ist es wieder unterwegs wie es immer schon unterwegs war. Von außen gesehen erscheint es als der Aggressor, der es ist.
Putin hielt neulich bei der Enthüllung eines Denkmals für Alexander I. eine Rede. Er pries ihn als Wegweiser. Alexander I. sei als Mann, der Napoleon besiegte, in die Geschichte eingegangen. Als vorausschauender Politiker und Diplomat, als politischer Führer sei er sich seiner Verantwortung für die sichere Entwicklung Europas und der Welt voll bewusst gewesen. In dieses Gewand eines Retters Europas und Schöpfers eines neuen Gleichgewichts in der Welt möchte Putin gern hineinwachsen. Seine Ambition ist ein bisschen lächerlich, aber auch ziemlich gefährlich. Schon Alexander I. war eine Geißel für Europas Freiheit, vor allem für die Freiheit der Polen.
Die Wiederbelebung des imperialen Furors in und durch Russland ist das gemeinsame Problem der unabhängigen Ukraine und der unabhängigen russischen Zivilgesellschaft. Wie der Maidan bewies, ist dabei die ukrainische Unabhängigkeitsbewegung in der besseren politischen Situation als die russische Zivilgesellschaft. Das zeigt sich unter anderem am Beispiel von Pussy Riot und ihrer schwierigen Geschichte. Natürlich ist eine so freche Opposition junger Frauen in einer autoritären Gesellschaft von Isolation bedroht.
In der postsowjetischen Konstellation bleiben die Kämpfe um die äußere Begrenzung des Kremlregimes und die inneren Grenzen seiner Macht direkt miteinander verbunden, wie zuletzt die Annexion der Krim zeigte. Die Zustimmungsraten zu Putins Herrschaft in Russland verließen ihren vorübergehenden Tiefstand und erreichten Rekordhöhen. Da ist es den Frauen von Pussy Riot hoch anzurechnen, dass sie sich weiterhin eindeutig gegen Putins Regime aussprachen und sich mit der Ukraine solidarisierten. Sie sind Teil der Kräfte, die sich in einer öffentlichen Demonstration in Moskau gegen die Annexion aussprachen und damit den chauvinistischen Konsens durchbrachen. Die beiden Frauen von Pussy Riot wurden durch die Lagerhaft nicht gebrochen. Sie bleiben klarsichtig und entschieden, im Übrigen auch bescheiden. Jeder könne zu Pussy Riot werden. Man müsse sich nur eine Pudelmütze überziehen.
Soweit zum politischen Zusammenhang der Verleihung des HannahArendt-Preises für politisches Denken gemeinsam an die Frauen von Pussy Riot und Juri Andruchowytsch. Obwohl sich die Frauen von Pussy Riot anders als die Frauen von Femen bei ihren Aktionen nicht entblößen, sondern verhüllen, werden sie schnell zum Opfer sexistischer Angriffe. So beschimpfte sie der tschechische Präsident neulich in Anlehnung an eine etwas einseitige Übersetzung von Pussy als »Huren«. Mit einem Aufstand der Pussys hat er seine Schwierigkeiten. Riot versuchte er also gar nicht erst zu übersetzen. Manche prangern die angebliche Unsensibilität gegenüber dem Christentum an. Dabei war es unüberhörbar, dass die Frauen in ihrem Song die Mutter Maria anriefen, sie möge Putin vertreiben. Und Putin ist kein Heiliger. Da war der Ort für ihr Punkgebet mit der Kathedrale doch gar nicht schlecht gewählt. Es ging um die Vertreibung eines Lästerers aus dem Tempel, und gegen die Pharisäer als Tempelhüter. Der Protest galt dem ganz weltlichen Handel zwischen Kirill und Putin. Der Protest von Pussy Riot ist provokativ, aber nicht brutal. Er nimmt Kunstform an und bedient sich der globalen Sprache des Pop in Musik und Gestik. Zu Recht stellten die Frauen vor Gericht ihre Verfolgung in die traditionelle, lang anhaltende und erneut verschärfte Unterdrückung der künstlerischen Avantgarde in Russland.
Juri Andruchowytsch ist ein langjähriger Vordenker, in diesem Fall kann man das sagen, der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung, die in der orangenen Revolution und im Euromaidan ihre öffentliche Plattform fand. Er hat sehr kluge und feinsinnige Essays über die ukrainische Topographie, die natürliche und die politische, geschrieben. Man kann diese Essays in ihrer Ironie, Beharrlichkeit, in ihrer intellektuellen Mixtur aus Metaphysik und politischem Klartext, aus Mythos und Utopie vielleicht romantische Texte nennen. Es sind Texte, an denen man sich reiben kann. Und es sind Texte, die uns die Geschichte, die Lebens- und Leidenswelt und die denkerische Gemengelage in der Ukraine – die Menschen und Mythen, ihre Hoffnungen und Ängste – in den letzten Jahrzehnten immer wieder nahegebracht, ja, das Schicksal der Region in unserem Bewusstsein präsent gehalten haben. Sie weichen Ambivalenzen nicht aus. So stellte Andruchowytsch einmal die These auf, die Erweiterung der EU am 1. Mai 2004 habe sein »Ostmitteleuropa, zwischen verschiedenen Zentren zerrissen und geteilt«. Ostmitteleuropas »Ambiguität, das ›Dasein dazwischen‹«, verschwinde »auf allen Ebenen – von der Unifizierung der Landschaft zur Pragmatisierung der Mentalitäten«. Ich glaube mit dem »Dasein dazwischen« spricht Andruchowytsch das existenzielle Problem seines Ostmitteleuropas an, in dem jede einseitige Erweiterungspolitik von einem der Zentren aus, sei es Brüssel, das nie ein Zentrum war, oder Moskau, das »praktisch kein Zentrum mehr ist, aber um jeden Preis diesen Anschein erwecken will«, scheitern und zur Spaltung führen wird. Das Problem steckt in geografischen und politischen Tatsachen und ist keine Sache des bloßen Meinens.
Auch wenn sich die Verleihung eines Preises für politisches Denken vor allem auf die Essays von Juri Andruchowytsch stützt, die in drei Bänden der »edition suhrkamp« nachzulesen sind, gilt der Preis auch seinem Werk als Romancier. Denn, so lautet eine unvergängliche Hoffnung, die Arendt gerne zitierte, Erzählungen könnten vielleicht die gleiche Wirkung haben wie die Taten, von denen sie handeln. Außerdem hat Literatur, das ist eine eminent politische Funktion, die Fähigkeit, auch solche Ideen und Hoffnungen in uns wach zu halten, die in der Gegenwart ausgestorben scheinen.
Im Zusammenhang mit einem Preis für politisches Denken ist vielleicht als erstes Andruchowytsch’s Roman Moscoviada zu nennen, der den multinationalen Charakter der Sowjetunion und ihre Vereinheitlichung im trübsinnig geistreichen Suff spüren lässt. Hier wird am Beispiel von Insassen, so muss man es wohl nennen, eines Moskauer Studentenheimes gezeigt, wie die Verkommenheit des Imperiums die Individuen beschädigt, auch wenn sie nichts mit dem Imperium am Hut haben. Der Roman spielt vor der Auflösung der UdSSR und er wurde geschrieben in der Zeit ihrer Auflösung. In der Moskauer Bierhalle geht das Plädoyer für die »völlige und endgültige Loslösung der Ukraine von Russland« dem Protagonisten ganz leicht von den Lippen: »Hoch lebe die unverbrüchliche Freundschaft zwischen dem ukrainischen und dem russischen Volk! Glaubt mir – zwischen diesen beiden Aussagen besteht keinerlei Widerspruch.« Nach kurzer, angespannter Stille bricht »unglaublicher, bodenloser, grenzenloser Applaus« unter den Gästen und dem Personal der Bierhalle aus. Alles wird gut. Es wurde aber nicht alles gut. In einem Postskriptum zur deutschen Ausgabe aus dem Jahr 2006 schreibt Andruchowytsch, er habe seinerzeit geglaubt, sobald er den Roman fertiggestellt hätte, »wären die imperialen Gespenster vertrieben und nur noch hölzerne Schaufensterpuppen übrig, aus denen Sägespäne rieseln«. Aber es handle sich gar nicht um Gespenster, merke er nun vierzehn Jahre nach der Niederschrift des Romans. Man konnte die imperialen Gespenster beschreiben, aber nicht wegschreiben.
Juri Andruchowytsch hat neulich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erneut nach Westen ausgeschlagen und den ukrainischen Heroismus dem in der EU und im Westen vielleicht vorherrschenden, wohlstandsgesättigten Postheroismus gegenüber gestellt. Ich sagte ja, der Preisträger kann klotzen:
»Es gibt kaum Berührungspunkte zwischen uns, der Ukraine und Europa. Europa hat in seiner absolut erfolgreichen Entwicklung das Endziel erreicht, es ist vor allem zu einer Zone des Wohlstands, Komforts und der Sicherheit geworden, oversecured, overprotected, overregulated, ein Territorium aufgeblähter und irgendwie beigelegter Konflikte, politisch korrekt und steril. In der Ukraine aber wird Blut vergossen, und das ist noch milde ausgedrückt, denn wenn ich anfinge, hier zur Veranschaulichung zu beschreiben, auf welche Art Blut vergossen werden muss, dann würden Sie erschrecken«, sagte er zur Eröffnung der Internationalen Buchmesse in Wien. Er habe einen »bösen Verdacht«: Die EU fürchte die Ukraine letztlich, so meint er, weil sie mit ihren existenziellen Problemen die EU aufschrecke und verstöre. Die Ukraine sei zum Gewissensbiss der EU-Bürgerinnen und -Bürger geworden. Dazu passte die Überschrift, die die FAZ der Rede verpasste: »Wir reden über Werte, ihr redet über Preise«. So ohne Ironie habe ich Juri Andruchowytsch noch nie lesen müssen.
Vielleicht darf ich zum Schluss für die Jury gegenüber unseren Preisträgerinnen in Moskau unsere Bewunderung für ihren Mut in Auseinandersetzung mit einem autoritären und brutalen Regime und gegenüber unserem Preisträger aus der Ukraine unsere Hoffnung auf einen Erfolg bei der Verteidigung von Demokratie und Unabhängigkeit gegen die äußere Aggressionspolitik des Kremlregimes zum Ausdruck bringen. Die reale Distanz zwischen der Situation hier und der postsowjetischen Konstellation als Kampfboden unserer Preisträgerinnen in Moskau und unseres Preisträgers aus der Ukraine lässt sich nicht durch Worte und auch nicht durch einen Preis für politisches Denken überbrücken. Ich denke, wir wären alle froh, wenn wir überall ohne Heroismus auskommen könnten. Freilich kann man sich nicht einmal sicher sein, dass wir uns das in der EU auf die Dauer leisten können. Der HannahArendt-Preis geht in den Osten, im Bewusstsein, dass es derzeit gerade dort um die Zukunft Europas geht.
»Hagel«, »Tornado«, »Hurrikan«.
Der chimärische Krieg
Ich möchte diesen zweifellos festlichen und für mich freudigen Anlass nutzen, um Ihnen etwas mehr über gewisse Aspekte jenes Konfliktes zu erzählen, der hier meistens »Krise in der Ukraine« genannt wird. Mir scheint, dass es sowohl im Umfeld dieses Konfliktes als auch in seinem Inneren furchtbar viele Dinge gibt, von denen Sie kaum etwas wissen, weil Medien und Politiker Sie nach ein und denselben Schemata und Schablonen informieren: Geopolitik; Einfluss- und Interessenszonen; russisch-amerikanisches Tauziehen; die Ukraine als hoffnungslos geteiltes, unzurechnungsfähiges Land; wirtschaftliche Gründe für das »PutinVerstehen«; sichere Gasversorgung.
Aber die Ukraine ist mehr als ein Territorium für den Gastransit zwischen Russland und Europa. Sie ist ein Land mit einer eigenen, extrem schwierigen und tragischen Geschichte und einer neu gefundenen Identität. Sie ist also viel komplizierter, als es scheint, und sie verdient Ihre Aufmerksamkeit. In der Ukraine wird heute ein Re-Make des historischen Dramas aufgeführt, in dem Zentraleuropa als Territorium fungiert, wo die autokratischen Werte zum wiederholten Male einen Angriff gegen die liberalen starten. Außerdem vollzieht sich in der Ukraine vor unseren Augen das Werden einer neuen europäischen Gesellschaft.
Diesem Werden wird harter, grausamer Widerstand entgegengesetzt – sowohl von außen, als auch im Innern des Landes. Aber letztlich sind sowohl die im Innern als auch die von außen Elemente ein und derselben zerstörerischen Spezialoperation.
Darum ist es ein schmerzhaftes Werden. Um es zu stoppen, schreckt unser Nachbarstaat nicht einmal vor militärischer Einmischung zurück. Sein Präsident hat sich in diesem Konflikt, den er selbst mehr als zehn Jahre lang vorbereitet und geschürt hat, die Rolle des strengen, aber gerechten Schiedsrichters auf den Leib geschrieben. Aber diese Rolle gelingt ihm nicht oder nur äußerst schlecht – so schlecht, dass ihm offenbar nur noch die Herren Schröder, Berlusconi, Gorbatschow und andere, heute schon legendäre Helden der Realpolitik glauben können.
Ein Interview des russischen Präsidenten, das dieser vor kurzem erst, Mitte November 2014, einem deutschen Fernsehsender gegeben hat, ist das perfekte Beispiel für seine ebenso scham- wie hilflose Verdrehung der Tatsachen. Putin benimmt sich vor dem deutschen Fernsehpublikum genauso wie vor dem heimischen russischen, das ja bekanntlich sogar zu glauben bereit ist, das die malaysische Boeing 777 schon vor dem Abflug nicht mit lebendigen Passagieren, sondern mit menschlichen Leichen beladen war. Aber zurück zum Interview für das deutsche Fernsehpublikum, in dem der russische Präsident unter anderem folgendes sagte: »Im Osten der Ukraine finden Kämpfe statt. Die ukrainische Zentralmacht hat die Armee dorthin entsandt, sogar ballistische Raketen kommen zum Einsatz. Und wird darüber etwas gesprochen?« – Er macht eine Pause und setzt theatralisch den Punkt.
»Kein Wort.«
In Wirklichkeit wurde schon im Sommer von den ballistischen Raketen gesprochen, zum Beispiel auf CNN. Die Information wurde von der ukrainischen Regierung sofort dementiert, die erklärte, dass »die letzte Rakete, die gemäß internationaler Klassifizierung als ballistisch gelten kann und eine Reichweite zwischen 500 und 1000 Kilometer hat, in der Ukraine am 1. Juli 1996 zerstört wurde, und zwar im Rahmen eines von den USA finanzierten Abrüstungsprogramms. In der Ukraine gibt es solche ballistischen Raketen nicht.«
In Wirklichkeit – und dieser Ausdruck muss sehr häufig gebraucht werden, wenn man den russischen Präsidenten kommentiert – kämpfen in der Ukraine seine, Putins, regulären Militäreinheiten – und sie kämpfen nicht nur mit Raketenwerfersystemen mit so sprechenden Namen wie »Hagel«, »Tornado« und »Hurrikan«, sondern auch mit nagelneuen T-90-Panzern. Aber davon kommt dem russischen Präsidenten wirklich »kein Wort« über die Lippen.
Warum reagiert Putin so aggressiv auf die Ukraine? Warum konzentriert Russland heute seine gesamte Außenpolitik auf den Krieg gegen uns und darauf, den Rest der Welt in großem Stile bezüglich dieses Krieges hinters Licht zu führen?
Es gibt Lügen. Es gibt große Lügen. Es gibt schamlose und schamlos große Lügen. Und es gibt die Lüge in Reinform – die russische Propagandamaschine.
Da haben Sie, grob gesagt, die gesamte Außenpolitik.
In Wirklichkeit (wieder dieser Ausdruck!) geht es Putin vor allem um etwas, das er mehr als alles fürchtet. Ich zitiere aus den Nachrichten: »Der russische Präsident bezeichnet die ›Farbrevolutionen‹, die in einer Reihe von Ländern stattgefunden haben, als Lehre und Warnung für Russland und verspricht, alles Notwendige zu tun, damit in Russland nichts dergleichen passiert.« (Hervorhebungen von mir, J. A.) So tut er zum Beispiel im Osten der Ukraine »alles Notwendige«. Unter anderem mit Hilfe von Mehrfachraketenwerfern »Hagel«, »Tornado« und »Hurrikan«.
Die zitierte Erklärung über »Lehre und Warnschuss« für Russland hat Putin nicht irgendwo abgegeben, sondern auf einer Sitzung des russischen Sicherheitsrats. Weiter sprach er davon, dass der Extremismus in der heutigen Welt als »Instrument der Geopolitik und der Verschiebung von Einflusszonen« benutzt wird. Natürlich – was sonst sollte einen gewissenhaften Schüler des geopolitischen Genius aller Zeiten und Völker, Professor Alexander Dugin, beschäftigen! Geopolitik und Einflusszonen – das ist es, was dem russischen Präsidenten keine Ruhe lässt.
»Wir sehen«, fährt er fort, »zu welchen tragischen Folgen die Welle sogenannter Farbrevolutionen geführt hat, welche Erschütterungen die Völker jener Länder durchlebten und weiter durchleben, ausgelöst von verantwortungslosen Experimenten, von versteckter, manchmal auch brutaler, tumber Einmischung in ihr Leben.«
Alles ist haargenau umgekehrt. In mein persönliches Leben, wie auch in das Leben vieler Millionen anderer Menschen, hat er, Wladimir Wladimirowitsch Putin, sich tumb und brutal eingemischt, er, dessen Reagieren auf unsere »Farbrevolution« mehr als krankhaft ausfiel. Eine äußerst präzise Bewertung hat kürzlich Herta Müller in einem Interview für die dänische Zeitung Dagens Nyheter vorgenommen:
»Putins Sozialisation im KGB ist in den letzten Jahren immer mehr zum einzigen Maßstab seines politischen Handelns geworden. Er sieht überall im In- und Ausland Feinde, weil er die Welt nicht anders begreifen kann. Und er braucht Feinde, die man anlügen und austricksen muss, um die sogenannten russischen Interessen durchzusetzen. Und damit inszeniert er sich als Retter der slawischen Werte, die von der dekadenten westlichen Kultur – also von uns – bedroht werden.« Und etwas weiter unten im Interview: »Putins einziger und größter Gegner ist die westliche pluralistische Gesellschaft, die Freiheit des Individuums und die Unabhängigkeit der Justiz – also die Demokratie, in der wir gerne leben. Und in der auch die Menschen in der Ukraine gerne leben würden. Transparenz und Geheimdienst – einen größeren Widerspruch kann es kaum geben.«
Als absoluter Geheimdienstler handelt Putin im Regime von Spezialoperationen. Darum trägt sein Krieg gegen die Ukraine einen so chimärischen Charakter. Hybride Kriegsführung, wie man jetzt zu sagen pflegt.
Aber bei aller Geheimhaltung dieses Spezialkrieges – die Soldaten und Panzer, die er in den Osten der Ukraine schickt, lassen sich nicht verbergen. Sogar der OSZE-Mission fallen sie inzwischen auf. Und die britische Botschaft in Kiew hat eine Instruktion veröffentlicht, die, so die Diplomaten, »dem Kreml helfen soll, seine Panzer in der Ukraine zu finden«. David Liddington, britischer Europaminister, erklärt Folgendes: »Der Kreml hat Hunderte Soldaten in die Ukraine geschickt, Tausende an ihren Grenzen versammelt und versorgt seine Marionetten im Osten mit Waffen und Panzern in unbegrenzter Zahl. Das ist keine Annahme, sondern eine Tatsache. Wir verfügen über Satellitenaufnahmen, Fotografien von Menschen vor Ort, Berichte der OSZE-Mission und Berichte von Augenzeugen. Die russischen Versuche, dies zu leugnen, sind unglaubhaft.«
Panzer sind Panzer, sie lassen sich nicht verbergen. Aber die Soldaten, die Gefallenen, müssen doch begraben werden. Unabhängige Quellen russischer Menschenrechtsverteidiger sprechen schon von an die tausend Gefallenen unter den russischen Soldaten des »Donbass-Feldzugs«. Also offiziell kämpft Russland bei uns nicht, die russische Armee ist nicht da, aber die Leichen russischer Soldaten sind es. Wohin mit ihnen? Am besten sie in Stollen stapeln, in anonymen Gräbern verscharren. Ein Soldat – verschwunden. Vielleicht hat es ihn nie gegeben. Den Verwandten kann man, unter absoluter Geheimhaltung, mitteilen, dass ihr Sohn, Mann, Bruder einen Herzschlag erlitten hat oder überhaupt im Urlaub an der Hitze gestorben ist. Wie sagte einst der legendäre russische Marschall Schukow, als er weitere Kompanien, Bataillone und Heere der Roten Armee in den sicheren Tod schickte: »Russland ist groß, die Weiber werden neue Soldaten gebären.« Wenn der russische Präsident nicht nur grundlegende Rechte, sondern sogar das Leben seiner eigenen Bürger so missachtet, was ist dann von ihm zu erwarten, wenn es um ukrainische Bürger geht?
Nach neuesten Erkenntnissen sind derzeit nicht weniger als 700 dieser ukrainischen Bürger Geiseln oder Gefangene der Terroristen. Sie werden gefoltert und erniedrigt. Die Erzählungen derjenigen, die befreit werden konnten, hinterlassen den furchtbaren Eindruck eines zügellosen Re-Makes des entsetzlichsten Mittelalters. Im Sommer füllte man mit ihnen die erstickenden Keller der Verwaltungsgebäude, wo sie sich Wochen und Monate quälten, geschlagen und gebrochen, ohne Licht und Luft, oft ohne Wasser und Essen und meist ohne jede medizinische Versorgung. Jetzt naht der Winter, und es ist noch schrecklicher, sich all das vorzustellen. Unter ihnen sind Frauen und Minderjährige. Es wird berichtet, dass Frauen mit Maschinengewehren vergewaltigt wurden. Das ist keine Metapher.
Um die Atmosphäre der Angst in den besetzten Gebieten aufrecht zu erhalten haben die Separatisten die Todesstrafe eingeführt. Das geschieht auf dem Territorium eines Landes, das Mitglied des Europarats ist und dessen Verfassung die Todesstrafe verbietet. Wie die Führer der Separatisten vor einigen Tagen in ihren Fernsehsendern verkündeten, werden die Entscheidungen über Todesurteile von nun an von »besonderen Trios« (Stalin lässt grüßen) aus – Obacht! – »Feld-Militär-Richtern« gefällt. Niemand kann sagen, wie viele Todesurteile schon vollstreckt wurden. Aber es kommt genug Material für einen langen und an entsetzlichen Fakten überreichen Prozess in Den Haag zusammen.
Im siebten Bericht des UN-Hochkommissars für Menschenrechte heißt es, die »bewaffneten Gruppierungen fahren fort, Menschen unrechtmäßig gefangen zu halten, Hinrichtungen ohne Urteil zu vollstrecken, zu Zwangsarbeit zu zwingen, sexuelle Gewalt anzuwenden und persönlichen Besitz zu vernichten oder zu konfiszieren. Tausende Menschen gelten als vermisst, dauernd werden neue, anonyme Gräber gefunden, aus denen die Leichen zur Identifizierung exhumiert werden.«
Ein weiterer Aspekt dieses Hybridkrieges besteht darin, dass nicht weniger als zwei Dutzend ukrainische Bürger, die auf dem Gebiet ihres Landes gefangen genommen oder entführt wurden, inzwischen rechtswidrig in russischen Gefängnissen festgehalten werden. Es versteht sich, dass sie genauso rechtswidrig dorthin verbracht wurden – meist aus den von den Separatisten kontrollierten Gebieten. Die russischen Anwälte dieser Gefangenen berichten, dass einige von ihnen gefoltert werden – vor allem, um sie zu zwingen, von »Verbrechen des ukrainischen Militärs gegen die Zivilbevölkerung des Donbass« zu erzählen. Am längsten wird der stellvertretende Vorsitzende der Partei UNAUNSO, Mykola Karpjuk, in Russland festgehalten. Ihn hat man schon im März im weit vom Donbass entfernten Tschernigower Oblast entführt. Im April wurden auf der Krim vier weitere Ukrainer rechtswidrig festgenommen: der Filmregisseur Oleg Senzow, der Geschichtslehrer Oleksij Tschyrnij, der Fotograf Gennadij Afanasjew und der Aktivist Oleksandr Koltschenko. Notieren Sie diese Namen, merken Sie sie sich – nicht ausgeschlossen, dass gerade jetzt, in dieser Minute, einer von ihnen in einem Moskauer Untersuchungsgefängnis unaussprechliche Folterqualen erleiden muss. Die bekannteste Gefangene ist eine Frau, die Militärpilotin Nadija Sawtschenko, die seit dem 18. Juni in Gefangenschaft ist. Die Separatisten haben sie im Gebiet Luhansk entführt und den russischen Geheimdiensten übergeben. Organisiert und persönlich geleitet wurde die Operation vom derzeitigen »Oberhaupt der Luhansker Volksrepublik«.
Braucht es noch weitere Beweise, dass die Donbasser Separatisten direkt und absolut vom Kreml gesteuert werden? Was heißt hier »Volksrepubliken«, »Aufständische«, »Rebellen«? Es sind Verbrecher und banale Marionetten!
Ein weiterer Aspekt, den ich hier nennen muss, ist die Lage auf der Krim insgesamt und die ihres indigenen Volkes im Besonderen. Flüchtlinge von der Krim und Menschenrechtsaktivisten haben eine interaktive Karte angefertigt, auf der alle Fälle von Menschenrechtsverletzungen auf der Halbinsel eingetragen sind. Seit dem 24. Februar (dem Beginn der russischen Intervention) bis heute wurden 103 Verletzungen von bürgerlichen und politischen Rechten festgestellt, 70 Verletzungen der Rechte der indigenen Völker und nationalen Minderheiten, 65 Verletzungen kultureller und religiöser Rechte und 139 Verletzungen sozialökonomischer Rechte. Wenn im Frühling, zu Beginn der Okkupation der Krim, überwiegend pro-ukrainische Aktivisten verfolgt wurden, so verstärkt sich in letzter Zeit vor allem der Druck auf die Krimtataren. Sie wissen, dass dieses Volk schon einmal auf Befehl Stalins aus seiner Heimat deportiert wurde. Heute bemüht sich die Okkupationsmacht, für sie solche Lebensbedingungen zu schaffen, dass sie die Halbinsel auch ohne jede Deportation von oben freiwillig massenhaft verlassen. Seit Beginn der Okkupation wurden 21 Vertreter des Volkes der Krimtataren entführt, einige wurden später tot und mit Folterspuren aufgefunden. Die verbreitetste Art der – verzeihen Sie – Beute bei dieser Safari sind Kinder, Teenager und junge Männer krimtatarischer Nationalität.
Ich lese all diese offiziellen Erkenntnisse und versuche, nicht verrückt zu werden. Wo und mit wem geschieht all dies? Geschieht es wirklich bei uns, in meinem Land, in Mittelosteuropa? Oder hat der große geopolitische Schürer dieses Konfliktes genau das erreicht – uns für immer aus Europa zu drängen und in einen ganz anderen »Erdteil« zu treiben, irgendwo bei Afghanistan, Irak und Syrien? Im Bewusstsein vieler Europäer sind wir schon dort. Sie glauben, bei uns herrscht ewige Krise. »Die Krise in der Ukraine«.
Zurück zu den Entführungen mit darauf folgenden Folterungen und Morden. Diese sind charakteristische Elemente einer gewissen und klar erkennbaren Handschrift.
Und sind gleichzeitig eines der verbreitetsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das das Regime Janukowytsch so aktiv gegen uns auf dem Maidan anwendete, wobei es gewissenhaft die Instruktionen der Moskauer Führung befolgte. Die Menschen des Maidan verschwanden von Anfang an. Um den Maidan herum kreisten immer sogenannte Kerle sportlichen Typs und andere »Schleicher«. Unter meinen Freunden gab es niemanden, der nicht Anzeichen dafür bemerkte, dass er verfolgt und sein Telefon abgehört wurde. Es war äußerst gefährlich, sich in der Stadt einzeln oder in zu kleinen Gruppen zu bewegen – Leute mit Maidan-Symbolik konnten auf Schritt und Tritt angegriffen und von unbekannten »Hooligans« oder »Besoffenen« schwer zusammengeschlagen werden. Nur mitten auf dem Maidan konnte man sich mehr oder weniger sicher fühlen, hinter den Barrikaden, umgeben von Zehntausenden Gleichgesinnten. Manchmal aber musste man einfach nach draußen – heim, zu Verwandten und Freunden, Dinge erledigen. »Sie« beobachteten unsere Bewegungen genau. Auf diese Art wurde am 25. Dezember die bekannte Journalistin Tetjana Tschornowol angegriffen und auf brutale Art bewusstlos geprügelt (geplant war, sie zu Tode zu prügeln, aber sie hatte Glück). In der zweiten Januarhälfte geschahen einige der aufsehenerregendsten Entführungen. Das Regime und die ihm nahestehenden kriminellen Elemente machten ihre Beutezüge auch in Krankenhäusern, wo sich Maidan-Demonstranten wegen ihrer Verletzungen behandeln ließen, die sie sich bei den Auseinandersetzungen mit den Sondereinheiten der Polizei auf der Hruschewskyj-Straße zugezogen hatten. Aus dem Krankenhaus wurden der Aktivist Ihor Luzenko und der Lemberger Gelehrte und Reisende Juri Werbyckyj entführt. Mehrere Tage lang wurden sie in einem unbekannten Versteck im Wald bei Kiew gefoltert. Der von der Folter halb bewusstlose Luzenko wurde danach lebend aus einem Auto auf den Waldweg gestoßen und überlebte wie durch ein Wunder. Die entstellte Leiche Werbyckyjs wurde einige Tage später in eben jenem Wald aufgefunden.
Es wurde immer gefährlicher, in Kiew ein Krankenhaus aufzusuchen. Dort lauerten Polizei und Banditen auf solche wie uns. In jenen Tagen schrieb mir die hier schon einmal erwähnte Herta Müller: »Mich erinnert die Ermordung von Verletzten in den Kliniken an das Ende der Ceausescu-Diktatur. In Temeswar wurden auch viele Oppositionelle im Krankenhaus erschossen. Offensichtlich hat sich diese russisch-sowjetische Praxis auch in der Ukraine gehalten.« In meiner Antwort bemerkte ich, dass sich alles erhalten hat, und dass wir unseren Präsidenten schon seit geraumer Zeit nur noch »Januschescu« nennen.
Ja, es war eine entsetzliche repressive Maschinerie, deren Motor in Moskau saß. Es ist traurig und schrecklich, aber unmöglich zu verschweigen – 29 Teilnehmer des Euromaidan sind bis heute verschollen. Ohne Zweifel sind sie nicht mehr am Leben. Wo aber befinden sich ihre Leichen – verscharrt, verbrannt, irgendwie anders vernichtet? Was bleibt, ist der Glaube, dass alles Geheime einmal ans Licht kommt und keine Untat ungesühnt bleibt.
In Zusammenhang mit der soeben beschriebenen Atmosphäre konsequenter Einschüchterung, Verfolgung und praktisch pausenloser Eskalation durch die damalige Staatsmacht sticht ein weiterer Aspekt hervor – das Problem der Rechten. Es gibt sie tatsächlich. Während der revolutionären Ereignisse auf dem Maidan wurde der »Rechte Sektor« immer häufiger erwähnt. Er war Realität, kein Fake. Fake ist jedoch sein antisemitischer oder neofaschistischer Charakter. Als die Spezialkräfte der Polizei, denen die Straflosigkeit zu Kopf gestiegen war, im Januar des Jahres massenhaft zu foltern und zu erniedrigen begannen, als sie gezielt auf Frauen, Ärzte und Journalisten schossen, als die Auseinandersetzungen auf der Hruschewskyj-Straße wirklich bitter wurden vom Feuer und Rauch der brennenden Reifen, reichten die Kiewer Juden, wie alle anderen Kiewer, dem »Rechten Sektor« Molotow-Cocktails und Pflastersteine. Die Kiewer Rechten verteidigten die Kiewer Juden vor den Verbrechern in Polizeiuniform – was soll daran verwunderlich sein? Meiner Ansicht nach gar nichts, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass der Maidan so verschiedene gesellschaftliche Schichten, ethnische Gemeinschaften, sprachliche und weltanschauliche Gruppen vereinte, dass er die gesamte Ukraine abbildete in ihrer heutigen Kompliziertheit und Widersprüchlichkeit. Keine einzelnen Regionen, nicht etwa irgendwelche »Nationalisten«, sondern die ganze komplizierte und dramatisch zerschnittene soziale Struktur des Landes mit seinen Studenten, Bauern, Intellektuellen, Ultras, Anarchisten, mit seiner noch existierenden Arbeiterklasse, seinen Unternehmern, Afghanistan-Veteranen und Ex-Zachal-Offizieren, mit seinen fantastisch mutigen Frauen und allen anderen, den Ukrainisch- und den Russischsprachigen. Sogar die Krishna-Anhänger – diesen Anblick werde ich nie vergessen – kamen mit BaseballSchlägern zu uns auf den Maidan, um ihre Nächsten zu verteidigen, wie es Krishna Ardshuna gelehrt hatte.
Meine ausländischen Bekannten zweifeln. Zweifeln ist ein völlig positiver Charakterzug des echten Europäers. Als echte Europäer zweifeln also auch meine Bekannten. Sie fragen, ob es denn überhaupt möglich sei, dass das Gute nur auf einer Seite sei und das Böse auf der anderen. Ob nicht die Wahrheit irgendwo dazwischen liege?
Ich verstehe: Sie wollen nicht nur dem Kreml, sondern auch seinen Marionetten-»Separatisten« die Chance geben, nicht das absolut Böse zu sein. Das postmoderne Bewusstsein fordert den Konflikt auszublenden und negiert alles Schwarz-Weiße. »Militär-Feld-Richter«, Todesstrafe und Folter sind meinen Bekannten zu wenig. Sie suchen Schuldige auf beiden Seiten des Konflikts. Genau für solche Fälle existiert das wunderbare deutsche Wort »Ausgewogenheit«.
Putin kennt die Europäer, und er kennt diese Besonderheiten des europäischen ausgewogenen Denkens. Darum die schon erwähnte Schiedsrichter-Rolle. Ich erlaube mir noch einmal, aus seinem Interview fürs deutsche Fernsehen zu zitieren: »Ich sage Ihnen ganz offen, es ist kein Geheimnis, die Menschen, die gegen die ukrainische Armee kämpfen, sagen: ›Das sind unsere Dörfer, wir stammen von hier. Hier wohnen unsere Familien, unsere Freunde und Verwandten. Wenn wir abziehen, kommen die nationalistischen Bataillone und bringen alle um. Wir ziehen nicht ab, da müsstet schon ihr selbst uns umbringen.‹« Und weiter, wie es einem gerechten Schiedsrichter gebührt: »Natürlich versuchen wir, sie zu überzeugen, wir reden mit ihnen, aber wenn sie solche Dinge sagen, dann, verstehen Sie, gehen uns die Argumente aus.«
Aber was weiß Putin wirklich über diese Menschen und diese Dörfer? Mit wem spricht er eigentlich, und auf wen, außer Professor Dugin, hört er?
Das ist kein Bürgerkrieg, kein Krieg eines Teils der Ukrainer gegen einen anderen, noch weniger ist es ein Krieg des »russisch-sprachigen Ostens« gegen den »ukrainisch-sprachigen Westen«. Das Recht auf Muttersprache, wenn es gefährdet ist, verteidigt man mit dem Intellekt, nicht mit dem Gewehr. Sogar in der angeblichen »Hochburg der Separatisten«, Donezk, kamen noch im April zu proukrainischen Demonstrationen mehr Leute zusammen als zu »separatistischen«. Heute allerdings sind die meisten dieser Menschen nicht mehr in Donezk – sie wurden gezwungen wegzufahren, zu verschwinden, umzukommen. Einige von ihnen wurden unter den zu Tode Gefolterten identifiziert. Andere werden noch identifiziert werden.
Das ist kein Bürgerkrieg. Es ist der nicht erklärte Krieg des Staates Russland gegen seinen Nachbarn, die souveräne Ukraine. Und weil er noch nicht erklärt ist, wird er bisher mit begrenzten Kräften geführt.
Also bombardiert die russische Luftwaffe unsere Städte noch nicht, und von den »Mistral«, die Russland demnächst Frankreich abpressen und ins Schwarze Meer schicken wird, steigen noch keine Kampfhubschrauber auf. Es ist ein Krieg im Spezialoperations-Format, ein Krieg von Saboteuren und Sturmtruppen, paramilitärischen »Rekonstrukteuren« und Banditen, aber auch banalen Söldnern und einer wenig zahlreichen, aber gut bewaffneten fünften Kolonne. Es ist ihr Krieg gegen alles Demokratische, Liberale, Europäische, Westliche. Die postrevolutionäre Ukraine wurde zum ersten Opfer dieser Aggression, aber auch – unerwartet für den Aggressor – zum ersten ernsthaften Hindernis auf seinem Weg. Nicht nur, dass sie ihre Verteidigungslinie hält – sie wäre auch längst mit diesem »Bürgerkrieg« fertig geworden, wenn der Präsident des Nachbarlandes nur endlich aufhören wollte, die von ihm abhängigen »Aufständischen der Volksrepubliken« mit Panzern, »Tornados« und »Hurrikans« zu versorgen sowie mit regulären Armeeeinheiten.
Wie kann er gezwungen werden, damit aufzuhören?
Diese Frage, genauer: die gemeinsame Suche nach einer Antwort sollte heute Ukrainer und Europäer einen. Unterstützen Sie die Ukraine – nicht nur sie ist heute in Gefahr. Und nicht nur die baltischen Staaten, Polen oder Rumänien. Wir haben einen außergewöhnlich kleinen und, ehrlich gesagt, außergewöhnlich brüchigen und sensiblen Kontinent. Er glaubte, so wunderbar für seine Sicherheit gesorgt zu haben, in diesem Bereich so viel erreicht zu haben. Aber es genügt eine einzige Person im Kreml, und alles erzittert und erbebt.
In der Ukraine hat Europa gewonnen. Aber es wird vielleicht in Europa selbst verlieren – wenn Europa sich von sich selbst lossagt und sich durch eine Mauer von Unverständnis und Gleichgültigkeit von der Ukraine abschottet. Unser Land sollte vom Westen gerade jetzt als ein Teil Mitteleuropas betrachtet werden, als ein Vorposten des Westens, der heute nicht nur die eigene Freiheit und seine europäische Zukunft verteidigt, sondern auch die westlichen liberalen Werte überhaupt.
Meinen Dank dafür, Laureat eines so bedeutenden Preises zu sein, verbinde ich mit der Hoffnung, dass wir – trotz allem – Verbündete sind, dass wir uns mit der Zeit immer besser verstehen, uns annähern werden und auf diese Weise, um eines der Vorbilder meiner Jugend zu zitieren, dem Frieden eine Chance geben.
Neben Juri Andruchowytsch wurde der Hannah-Arendt-Preis 2014 auch an Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina von der russischen Punkband Pussy Riot verliehen. Beide konnten allerdings an der Preisverleihung nicht teilnehmen. Um ihnen und ihrem politischen Kampf um Freiheitsrechte dennoch eine Präsenz zu geben, verlasen im Rahmen einer szenischen Lesung zwei Schauspielerinnen die Schlusserklärungen der beiden Frauen, die sie zum Ende des Prozesses gegen sie im August 2012 abgegeben hatten. Wir dokumentieren hier die beiden Erklärungen, deren Übersetzung wir der Nautilus-Flugschrift Pussy Riot! Ein Punkgebet für die Freiheit entnommen haben. Wir danken dem Nautilus Verlag für die Erlaubnis zum Abdruck.
Schlusserklärung vor dem Gericht in Moskau
»Verzerren und verfälschen Sie unsere Worte nicht«
Im Großen und Ganzen sind es nicht die drei Mitglieder von Pussy Riot, um die es in diesem Prozess geht. Wäre es so, hätte der Fall nicht eine solche Bedeutung. Es geht darin vielmehr um das gesamte politische System der Russischen Föderation, das es, zu seinem großen Unglück, genießt, die Grausamkeit des Staates gegenüber dem Einzelnen und seine Gleichgültigkeit gegenüber menschlicher Ehre und Würde vorzuführen – es wiederholt damit die schlechtesten Momente der russischen Geschichte. Zu meinem tiefsten Bedauern kommt dieses armselige Gerichtsverfahren Stalins Troikas ziemlich nahe. Auch wir haben nur einen Vernehmungsbeamten, einen Richter und einen Ankläger. Darüber hinaus basiert dieses repressive Theater auf politischen Anweisungen von oben, die diesen drei Justizfiguren ihre Worte, Handlungen und Entscheidungen vorschreiben.
Was steckt hinter unserer Performance in der Christ-ErlöserKathedrale und dem nachfolgenden Prozess? Nichts anderes als das autokratische politische System. Man kann die Auftritte von Pussy Riot Dissidentenkunst nennen oder politische Aktionen, die Kunstformen einsetzen. So oder so, unsere Performances sind eine Form ziviler Aktivitäten inmitten der Repressionen eines korporativen politischen Systems, das seine Macht gezielt gegen grundlegende Menschenrechte und zivile und politische Freiheiten richtet. Junge Menschen, zermürbt von der systematischen, in den Nullerjahren betriebenen Ausrottung von Freiheiten, haben sich jetzt gegen den Staat erhoben. Wir waren auf der Suche nach wirklicher Ehrlichkeit und Einfachheit und haben diese Eigenschaften im jurodstwo [heilige Dummheit] des Punk gefunden.
Leidenschaft, totale Ehrlichkeit und Naivität sind Heuchelei, Verlogenheit und falscher Bescheidenheit überlegen. Die benutzt man dazu, Verbrechen zu verschleiern. Die sogenannten Führungspersönlichkeiten unseres Staates stehen mit rechtschaffenen Mienen in der Kathedrale, aufgrund ihrer Arglist aber ist ihre Sünde viel größer als unsere. Wir haben politische Punkauftritte als Reaktion auf eine Regierung veranstaltet, die voller Härte, Verschlossenheit und kastenartiger Hierarchiestrukturen ist. Sie werden derartig durchschaubar dafür eingesetzt, den eigenen korporativen Interessen zu dienen, dass uns schlecht wird, wenn wir russische Luft atmen. Wir lehnen Folgendes kategorisch ab, und das zwingt uns dazu, politisch aktiv zu werden und zu leben: den Einsatz von Zwangs- und Gewaltmaßnahmen zur Regulierung sozialer Prozesse, ein Umstand, in dem die meisten wichtigen politischen Einrichtungen die Disziplinierungsstrukturen des Staats sind; die Sicherheitsbehörden (Armee, Polizei und Geheimdienste) und ihre dazugehö- rigen Instrumente zur Gewährleistung politischer »Stabilität« (Gefängnisse. Präventivhaft sowie alle Mechanismen zur strikten Überwachung der Bürgerschaft); gewaltsam erzwungene zivile Passivität bei einem Großteil der Bevölkerung; die totale Dominanz der Exekutive über Legislative und Judikative.
Darüber hinaus sind wir zutiefst enttäuscht vom skandalösen Mangel an politischer Kultur, der eine Folge von Angst ist und durch bewusste Anstrengungen der Regierung und ihrer Knechte aufrechterhalten wird (Patriarch Kyrill: »Orthodoxe Christen nehmen nicht an Kundgebungen teil«), enttäuscht von der skandalösen Schwäche horizontaler Verbindungen in unserer Gesellschaft. Es gefällt uns nicht, dass der Staat so mühelos die öffentliche Meinung mit den Instrumenten seiner peniblen Kontrolle des Großteils der Medien manipulieren kann (ein besonders anschauliches Beispiel für diese Manipulationen ist die beispiellos unverfrorene und verzerrte Kampagne gegen Pussy Riot in praktisch jedem russischen Medium).
Obwohl wir uns in einer grundlegend autoritären Situation befinden und unter autoritärer Herrschaft leben, sehe ich dieses System angesichts von drei Mitgliedern von Pussy Riot bröckeln. Was das System erhoffte, ist nicht eingetreten. Russland verurteilt uns nicht, und mit jedem Tag, der vergeht, glauben mehr Menschen an uns und daran, dass wir frei sein sollten statt hinter Gittern. Ich erlebe das bei den Menschen, denen ich begegne. Menschen, die für das System und in seinen Institutionen arbeiten, aber auch inhaftierte Menschen. Jeden Tag begegne ich unseren Unterstützern, die uns Glück und vor allem Freiheit wünschen. Sie sagen, was wir gemacht hätten, sei gerechtfertigt. Mit jedem Tag, der vergeht, sagen uns immer mehr Menschen, dass nach anfänglichen Zweifeln, ob wir das Recht zu unserer Aktion gehabt hätten, die Zeit gezeigt habe, dass unsere politische Geste richtig gewesen sei – dass wir die Wunden dieses politischen Systems geöffnet und direkt ins Wespennest gestochen hätten, sodass man hinter uns her war, aber wir ...
Diese Menschen versuchen, so gut sie können, uns unser Leid zu erleichtern, und dafür sind wir ihnen dankbar. Wir sind auch jedem dankbar, der draußen zu unserer Unterstützung auftritt. Es gibt viele Unterstützer, und ich weiß es. Ich weiß, dass sich eine große Zahl orthodoxer Christen für uns ausspricht, insbesondere diejenigen, die sich in der Nähe des Gerichts versammeln. Sie beten für uns, die eingesperrten Mitglieder von Pussy Riot. Wir haben die kleinen Broschüren mit Gebeten für die Inhaftierten gesehen, die Orthodoxe verteilen. Allein das beweist schon, dass es nicht eine einheitliche geschlossene Gruppe von orthodoxen Gläubigen gibt, worauf der Staatsanwalt gerne beharrte. So eine geschlossene Gruppe existiert nicht. Heute verteidigen immer mehr Gläubige Pussy Riot. Sie glauben nicht, dass das, was wir getan haben, fünf Monate Untersuchungshaft rechtfertigt, ganz zu schweigen von drei Jahren Gefängnis, die der Staatsanwalt gefordert hat.
Jeden Tag begreifen mehr Menschen, dass, wenn das System drei junge Frauen, die vierzig Sekunden lang in der Christ-Erlöser-Kirche aufgetreten sind, mit derartiger Vehemenz angreift, dies nur bedeutet, dass dieses System die Wahrheit, Ehrlichkeit und Geradlinigkeit fürchtet, für die wir stehen. Wir haben in diesem Verfahren nie zu einer Täuschung gegriffen. Unsere Gegner dagegen allzu oft, und die Menschen spüren das. Allerdings besitzt die Wahrheit eine ontologische, existenzielle Überlegenheit gegenüber der Täuschung, das steht schon in der Bibel, vor allem im Alten Testament. Die Wege der Wahrheit triumphieren immer über die Wege der Täuschung, Arglist und Irreführung. Mit jedem Tag wird die Wahrheit siegreicher, auch wenn wir hinter Gittern bleiben – und das vermutlich für lange Zeit.
Gestern ist Madonna in Moskau mit dem Schriftzug Pussy Riot auf dem Rücken aufgetreten. Immer mehr Menschen erkennen, dass wir hier rechtswidrig und unter falschen Vorwänden festgehalten werden. Das erstaunt mich. Ich bin überrascht, dass Wahrheit tatsächlich über Täuschung triumphiert. Denn obwohl wir physisch hier sind, sind wir freier als alle, die uns hier neben der Staatsanwaltschaft gegenübersitzen. Wir können alles sagen, was wir wollen, und tun es auch. Die Staatsanwaltschaft kann nur sagen, was ihr von der politischen Zensur zu sagen erlaubt ist. Sie können nicht »Punk-Gebet« sagen oder »Jungfrau Maria, heilige Muttergottes, räum Putin aus dem Weg!«, sie können nicht eine einzige Zeile unseres Punk-Gebets in den Mund nehmen, das sich mit dem politischen System auseinandersetzt.
Vielleicht glauben sie, es wäre gut, uns ins Gefängnis zu stecken, weil wir den Mund gegen Putin und sein Regime aufmachen. Sie sagen es nicht, weil sie es nicht dürfen. Ihre Lippen sind zugenäht. Dummerweise sind sie hier bloß Attrappen. Ich hoffe aber, dass ihnen das klar wird und sie am Ende den Weg von Freiheit, Wahrheit und Ehrlichkeit einschlagen, weil dieser Weg dem Weg der totalen Stagnation, der falschen Bescheidenheit und Heuchelei überlegen ist. Stagnation und die Suche nach der Wahrheit stehen schon immer im Widerspruch zueinander, und in diesem Fall, im Verlauf dieses Prozesses, sehen wir auf der einen Seite Menschen, die versuchen, die Wahrheit zu erkennen, und auf der anderen Seite Menschen, die versuchen, dies zu verhindern.
Ein Mensch ist ein Wesen, das ständig irrt und niemals perfekt ist. Es sucht nach Weisheit und kann sie nicht besitzen; deshalb ist die Philosophie entstanden. Deshalb ist der Philosoph derjenige, der die Weisheit liebt und sich nach ihr sehnt, sie aber noch nicht besitzt. Und das fordert letztlich ein menschliches Wesen zum Handeln auf, zum Denken und zu einer bestimmten Lebenshaltung. Es war unsere Suche nach Wahrheit, die uns in die Christ-Erlöser-Kathedrale führte. Ich denke, dass der christliche Glaube, wie ich ihn bei meinem Studium des Alten und besonders des Neuen Testaments verstanden habe, die Suche nach Wahrheit und einer ständigen Überwindung seiner selbst unterstützt, die Überwindung dessen, was man zuvor gewesen ist. Nicht umsonst sagte Christus, als er bei den Prostituierten war, den Gestrauchelten müsse geholfen werden: »Ich vergebe ihnen«, sagte er. In unserem Prozess, der ja unter dem Banner des christlichen Glaubens steht, kann ich diesen Geist nicht erkennen. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass die Anklage die Religion mit Füßen tritt.
Die Anwälte der »moralisch geschädigten Parteien« haben diese sitzenlassen – so sehe ich es jedenfalls. Vor zwei Tagen hielt Alexej Taratukhin [einer der Anwälte der Nebenkläger] eine Rede, in der er darauf bestand, man dürfe unter keinen Umständen annehmen, dass er mit den von ihm vertretenen Parteien übereinstimme. Anders gesagt: Der Anwalt findet sich in einer moralisch unangenehmen Position wieder, er möchte nicht für die Menschen stehen, die Pussy Riot gerne eingesperrt sehen wollen. Ich weiß nicht, warum sie wollen, dass wir ins Gefängnis kommen. Vielleicht haben sie das Recht dazu, aber ich möchte betonen, dass ihr Anwalt sich offensichtlich schämt. Vielleicht haben ihn auch die »Schämt euch, ihr Henker!«-Rufe der Menschen getroffen. Ich möchte darauf hinweisen, dass Wahrheit und Güte immer über Täuschung und Groll triumphieren. Außerdem habe ich den Eindruck, dass die Staatsanwälte unter dem Einfluss irgendeiner höheren Macht stehen, weil sie sich immer wieder versprechen und versehentlich uns »die geschädigte Partei« nennen. Fast alle Staatsanwälte haben das schon einmal gesagt, und sogar die Anwältin der Nebenkläger, Larissa Pawlowa, die uns gegenüber sehr negativ eingestellt ist, scheint nichtsdestotrotz von einer höheren Macht getrieben zu werden, wenn sie sich auf uns als »die geschädigte Partei« bezieht. So nennt sie nicht diejenigen, die sie vertritt, sondern nur uns.
Ich möchte niemanden abstempeln. Es kommt mir so vor, als gebe es hier keine Gewinner, Verlierer, Opfer oder Angeklagte. Wir müssen nur aufeinander zugehen, eine Verbindung herstellen und miteinander ins Gespräch kommen, um gemeinsam die Wahrheit zu finden. Gemeinsam können wir Philosophen sein und nach Weisheit streben, statt andere zu stigmatisieren und in Schubladen zu stecken. Das ist das Letzte, was ein Mensch tun sollte. Jesus Christus hat das verurteilt. Mit diesem Prozess missbraucht uns das System. Wer hätte gedacht, dass ein Mann und der Staat, den er regiert, immer und immer wieder absolut unmotiviert Böses tun? Wer hätte gedacht, dass die Geschichte, insbesondere Stalins gar nicht so lange zurückliegender Großer Terror, uns nichts lehren konnte? Die mittelalterlichen Inquisitionsmethoden, die im Strafvollzug und im Justizwesen dieses Landes herrschen, sind zum Heulen. Aber seit unserer Verhaftung haben wir aufgehört zu heulen. Wir haben die Fähigkeit dazu verloren. In unseren Punkkonzerten haben wir verzweifelt geschrien. Aus Leibeskräften haben wir die Gesetzlosigkeit der Machthaber, der Führungsorgane angeprangert. Doch jetzt hat man uns unserer Stimmen beraubt. Man hat sie uns am 3. März 2012 genommen, als wir verhaftet wurden. Und tags darauf hat man uns und Millionen anderen bei den sogenannten Wahlen unsere Stimmen und unsere Wahlstimmen gestohlen.
Im Verlauf des gesamten Prozesses haben es einige Leute abgelehnt, uns anzuhören. Das hieße ja, offen zu sein für das, was wir zu sagen haben, aufmerksam, nach Weisheit zu streben, ein Philosoph zu sein. Ich glaube, jeder Mensch sollte das anstreben, und nicht nur diejenigen, die an irgendeinem Philosophischen Institut studiert haben. Eine formelle Ausbildung bedeutet gar nichts, auch wenn Nebenklagevertreterin Larissa Pawlowa ständig versucht, uns unsere mangelnde Bildung vorzuhalten. Wir sind der Überzeugung, das Wichtigste, wonach man streben sollte, ist Wissen und Verstehen. Denn beides kann ein Mensch auch unabhängig und außerhalb der Mauern einer Bildungseinrichtung erwerben. Ornat und höhere akademische Grade bedeuten nichts. Ein Mensch kann jede Menge wissen und trotzdem nicht wie ein menschliches Wesen handeln. Pythagoras sagte, viel Lernen lehre noch keine Weisheit. Leider befinden wir uns hier, um das zu bestätigen. Wir sind hier lediglich zur Dekoration, leblose Elemente, nur Körper, die im Gerichtssaal abgeliefert wurden. Unseren Anträgen wurde – nach tagelangem Nachfragen, Verhandeln und Kämpfen – keine Beachtung geschenkt, sie wurden prinzipiell abgewiesen. Bedauerlicherweise – für uns und unser Land – hörte das Gericht einen Staatsanwalt an, der unsere Worte und Aussagen fortwährend ungestraft verdreht und neutralisiert. Ungeniert und demonstrativ wird gegen das grundlegende Rechtsprinzip der Gleichheit und Waffengleichheit der gegensätzlichen Parteien verstoßen.
Am 30. Juli, dem ersten Prozesstag, haben wir unsere Antwort auf die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Damals hat uns das Gericht das Rederecht verweigert, und unsere Verteidigerin Violetta Wolkowa hat unsere Texte verlesen. Nach fünf Monaten Haft war dies unsere erste Gelegenheit, uns zu äußern. Bis dahin waren wir inhaftiert und eingeschränkt; von dort aus kann man nichts unternehmen, wir können keine Aufrufe oder Einsprüche verfassen, nicht filmen, was in unserer Umgebung passiert, wir haben kein Internet, und unsere Anwälte können uns nicht mal mit Papier versorgen, weil das verboten ist. Am 30. Juli haben wir zum ersten Mal öffentlich gesprochen; wir haben Kontaktaufnahme und Gesprächserleichterungen gefordert, nicht Streit und Konfrontation gesucht. Wir haben den Menschen, die uns aus irgendeinem Grund für ihre Feindinnen halten, offen die Hand gereicht, und sie haben hineingespuckt. »Ihr meint es nicht ehrlich«, hat man uns gesagt. Schade. Beurteilt uns nicht nach eurem eigenen Verhalten. Wir waren aufrichtig, wie wir es immer sind. Wir haben gesagt, was wir denken. Wir waren unglaublich kindlich, ja naiv in unserer Wahrheit, trotzdem bedauern wir unsere Worte nicht, auch nicht die Worte an jenem Tag. Und wenn man uns verleumdet hat, wollen wir als Antwort darauf andere nicht auch verleumden. Wir befinden uns in einer verzweifelten Situation, aber wir verzweifeln nicht. Wir sind angeklagt, aber nicht im Stich gelassen. Es ist einfach, Menschen zu entwürdigen und zu zerstö- ren, die so aufrichtig sind, aber »wenn ich schwach bin, bin ich stark«.
Hören Sie auf das, was wir sagen, und nicht, was der [Putin-freundliche Fernsehjournalist] Arkadi Mamontow über uns erzählt. Verzerren und verfälschen Sie unsere Worte nicht. Gestatten Sie uns, in einen Dialog, in Kontakt zu diesem Land zu treten, das auch das unsrige ist, und nicht nur das Putins und des Patriarchen. Genauso wie Alexander Solschenizyn glaube auch ich, dass zu guter Letzt das Wort den Beton sprengen wird. Er schrieb: »Deshalb ist das Wort wichtiger als der Beton. Deshalb ist das Wort kein geringes Nichts. Auf diese Weise beginnen edle Menschen zu wachsen, und ihr Werk wird Beton sprengen.«
Katja, Mascha und ich sitzen vielleicht im Gefängnis, aber ich halte uns nicht für besiegt. Wie die Dissidenten sind wir nicht besiegt. Auch wenn sie in Irrenhäusern und Gefängnissen verschwanden, brachten sie ihr Urteil über das Regime immer zum Ausdruck. Die Kunst, das Profil einer Epoche zu schaffen, kennt keine Gewinner oder Verlierer. So war es auch mit den Dichtern der Gruppe OBERIU, deren Mitglieder bis zum Schluss Künstler blieben, unerklärbar und unverständlich. Alexander Wwedenski, der 1932 einer Säuberungsaktion zum Opfer fiel, schrieb: »Das Unverständliche gefällt uns, das Unerklärbare ist unser Freund.« Laut der offiziellen Sterbeurkunde starb Alexander Wwedenski am 20. Dezember 1941. Niemand kennt die Todesursache. Es könnte die Ruhr gewesen sein, auf seinem Transport ins Lager; oder die Kugel eines Wachmanns. Jedenfalls passierte es irgendwo auf der Bahnstrecke zwischen Woronesch und Kazan.
Pussy Riot sind Wwedenskis Schülerinnen und Erbinnen. Sein Prinzip des schlechten Reims bedeutet uns viel. Er schrieb: »Ich denke mir hin und wieder zwei Reime aus, einen guten und einen schlechten, und ich entscheide mich immer für den schlechten, weil der immer der richtige ist.«
»Das Unerklärbare ist unser Freund«: Die anspruchsvollen und raffinierten Werke der Dichtergruppe OBERIU und ihre Suche nach einem Denken an den Rändern des Sinns fand ihre Verkörperung schließlich darin, dass sie für ihre Kunst mit dem Leben bezahlten – durch den sinnlosen und unerklärbaren Großen Terror. Mit diesem Tod bewiesen diese Dichter ungewollt, dass ihre Epoche im Kern aus Irrationalität und Sinnlosigkeit bestand. Das Künstlerische wurde dadurch zur historischen Tatsache. Der Preis, an der Schaffung von Geschichte teilzuhaben, ist für den Einzelnen unermesslich hoch. Und doch liegt das Eigentliche der menschlichen Existenz genau in dieser Beteiligung. Ein Bettler zu sein und andere doch zu bereichern. Nichts zu haben und doch alles zu besitzen. Man hält die OBERIU-Dissidenten für tot, aber sie sind immer noch lebendig. Sie wurden bestraft, aber sie sterben nicht.
Wissen Sie noch, warum der junge Dostojewski zum Tode verurteilt wurde? Seine ganze Schuld bestand darin, dass er von sozialistischen Theorien fasziniert war, und bei seinen Zusammenkünften mit Freidenkern und Freunden – man traf sich immer freitags in der Wohnung von [Michail] Petraschewski – diskutierte er über die Schriften von [Charles] Fourier und George Sand. An einem der letzten dieser Freitage las er den Brief von [Wissarion] Belinski an [Nikolaj] Gogol vor, der laut Gericht, das Dostojewskis Fall verhandelte – man höre! –, vor »schamlosen Bemerkungen über die orthodoxe Kirche und die Staatsregierung« nur so strotzte. Nachdem die Exekution schon vorbereitet war und nach »zehn qualvollen, unendlich entsetzlichen Minuten des Wartens auf den Tod« (Dostojewski), wurde bekanntgegeben, dass die Strafe in vier Jahre Zwangsarbeit in Sibirien und anschließenden Militärdienst umgewandelt worden war.
Sokrates war angeklagt, mit seinen philosophischen Diskussionen die Jugend zu verderben und sich zu weigern, die Götter Athens anzuerkennen. Dabei hatte er einen lebendigen Bezug zur göttlichen Stimme und war, worauf er viele Male bestand, in keinerlei Hinsicht ein Feind der Götter. Aber was für eine Rolle spielte das, wo er doch mit seinem kritischen, dialektischen und vorurteilsfreien Denken die einflussreichen Bürger seiner Stadt erzürnte? Sokrates wurde zum Tode verurteilt, und nachdem er sich geweigert hatte, aus Athen zu fliehen (wie seine Schüler ihm vorschlugen), leerte er mutig seinen Schierlingsbecher und starb. Haben Sie vergessen, unter welchen Umständen der Heilige Stephanus, der Jünger unter den Aposteln, sein Erdenleben beendete? »Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen: Dieser Mensch hört nicht auf, zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz.« [Apostelgeschichte 6, 11-13] Er wurde schuldig gesprochen und gesteinigt. Ich hoffe auch, dass Sie sich alle daran erinnern, was die Juden Christus geantwortet haben: »Um des guten Werks willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen.« [Johannes 10, 33] Und zum Schluss täten wir gut daran, nicht zu vergessen, wie Christus geschildert wurde: »Er hat einen bösen Geist und ist von Sinnen.« [Johannes 10, 20]
Wenn Behörden, Zaren, Präsidenten, Premierminister, das Volk und Richter wirklich verstünden, was »Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer« [Matthäus 9, 13] bedeutete, würden sie keine Unschuldigen vor Gericht stellen. Unsere Behörden jedoch fallen mit Verurteilungen über uns her und lassen niemals Gnade walten. An dieser Stelle möchte ich mich gerne bei Dmitri Anatoljewitsch Medwedew bedanken, der uns folgenden großartigen Aphorismus lieferte. Er fasste seine Amtszeit als Präsident mit den Worten zusammen: »Freiheit ist besser als Nichtfreiheit.« Dementsprechend ließe sich, in Übereinstimmung mit Medwedews trefflichen Worten, die dritte Amtszeit Putins sehr schön mit dem Aphorismus »Gefängnis ist besser als Steinigung« charakterisieren. Ich bitte Sie, Folgendes aus Montaignes Essays gewissenhaft in Betracht zu ziehen. Sie wurden im 16. Jahrhundert geschrieben und predigen Toleranz und die Ablehnung jeglicher Einseitigkeit und Doktrin: »Es misst den eigenen Mutmaßungen einen sehr hohen Wert bei, wenn man ihretwegen einen Menschen bei lebendigem Leib verbrannt hat.«
Ist es das wert, Menschen zu verurteilen und ins Gefängnis zu stecken, allein auf Grundlage von Mutmaßungen, die die Anklage nicht bewiesen hat? Da wir wirklich nie Hass oder Feindseligkeit hegten, sind unsere Ankläger auf falsche Zeugen angewiesen. Eine von ihnen, Matilda Iwaschenko, begann sich zu schämen und erschien nicht vor Gericht. Daneben gab es falsche Zeugenaussagen von Herrn Troitski, Herrn Ponkin sowie von Frau Abramenkowa. Es gibt keinen Beweis für Hass und Feindseligkeit bei uns, ausgenommen das sogenannte »Gutachten«. Dieses müsste das Gericht, wenn es ehrlich und fair ist, als Beweismittel eigentlich als inakzeptabel ablehnen, da es sich dabei nicht um einen schlüssigen und objektiven Text handelt, sondern um ein niederträchtiges und falsches Stück Papier, das an Inquisition erinnert. Einen anderen Beweis, der die Existenz eines solchen Motivs bestätigen würde, gibt es nicht. Die Anklage hat es abgelehnt, Auszüge aus Interviews von Pussy Riot vorzutragen, da diese nur ein weiterer Beweis für das Fehlen irgendeines Motivs gewesen wären. Warum wurde auch der folgende Text von uns – der im Übrigen Bestandteil unserer eidesstattlichen Versicherung ist – von der Staatsanwaltschaft nicht angeführt? »Wir respektieren Religion im Allgemeinen und den orthodoxen Glauben im Besonderen. Deshalb macht es uns besonders wütend, wenn der christliche Glaube, der voller Licht ist, auf eine derartig schmutzige Weise ausgenutzt wird. Uns wird schlecht mitanzusehen, wie diese großen Gedanken in die Knie gezwungen werden.« Dieses Zitat stammt aus einem Interview, das im Russian Reporter erschienen ist und am Tag nach unserer Performance mit Pussy Riot geführt wurde. Uns ist immer noch schlecht, und es tut uns wirklich weh, das alles zu sehen. Und schließ- lich wird das Fehlen von Hass oder Feindseligkeit gegenüber Religionen und dem Religiösen von den Aussagen sämtlicher Leumundszeugen bestätigt, die unsere Anwälte geladen haben.
Neben diesen Leumundszeugnissen bitte ich Sie, auch die Resultate der psychologischen und psychiatrischen Gutachten im Untersuchungsgefängnis Nummer 6 zu berücksichtigen, die auf Anordnung der Gefängnisbehörde erstellt wurden. Der Bericht stellt Folgendes fest: Die Werte, die ich mir zu eigen mache, sind Gerechtigkeit, gegenseitiger Respekt, Menschlichkeit, Gleichheit und Freiheit. Das schrieb ein Gerichtsgutachter, der mich nicht persönlich kennt, obwohl es sein könnte, dass Ranchenkow, der Ermittler, sich ein anderes Fazit gewünscht hätte. Doch anscheinend gibt es in dieser Welt doch mehr Menschen, die die Wahrheit lieben und schätzen, als andere, die es nicht tun. Darin hat die Bibel Recht. Zum Abschluss möchte ich aus einem Songtext von Pussy Riot zitieren, der sich, so merkwürdig es sein mag, als prophetisch herausgestellt hat. Wir haben vorhergesehen, dass »der Chef des KGB und der Oberheilige des Landes die Demonstranten unter Geleitschutz ins Gefängnis abführen lassen« wird. Dabei ging es um uns. Weder bei mir, noch bei Aljochina, noch bei Samuzewitsch wurden starke und dauerhafte Affekte oder andere psychologische Ausprägungen gefunden, die sich als Hass auf etwas oder jemanden interpretieren ließen.
Also:
Macht alle Türen auf, streift eure Epauletten ab Kommt, kostet die Freiheit mit uns
Pussy Riot
Das ist alles.
Schlusserklärung vor dem Gericht in Moskau
»… wir sind gegen das Putin-erzeugte Chaos …«
Dieser Prozess ist äußerst typisch und spricht Bände. Die derzeitige Regierung wird noch sehr lange Gelegenheit haben, sich für ihn zu schä- men. In jedem Stadium verkörperte er ein Zerrbild der Justiz. Wie sich herausstellte, wuchs sich unsere Performance, anfangs eine kleine und ein wenig absurde Shownummer, lawinenartig zu einer Riesenkatastrophe aus. In einer gesunden Gesellschaft würde so etwas ganz offensichtlich nicht passieren. Russland als Staat glich lange einem Organismus, der bis ins Mark krank ist. Und diese Erkrankung bricht aus, wenn man mit seinen entzündeten Abszessen in Berührung kommt. Am Anfang und für lange Zeit wird in der Öffentlichkeit über diese Krankheit geschwiegen, aber irgendwann wird sie durch Dialog doch immer überwunden. Und sehen Sie – dies ist die Art von Dialog, zu der unsere Regierung fähig ist. Dieser Prozess ist nicht nur ein bösartiges und groteskes Maskenspiel, sondern er offenbart das wahre Gesicht des Dialogs der Regierung mit dem Volk dieses Landes. Um auf gesellschaftlicher Ebene die Diskussion über ein Problem anzustoßen, braucht es oft die richtigen Voraussetzungen – einen Anstoß.
Es ist interessant, dass unsere Situation von Anfang an depersonalisiert wurde. Denn wenn wir über Putin sprechen, haben wir zunächst einmal nicht Wladimir Wladimirowitsch Putin im Sinn, sondern das System Putin, das er geschaffen hat – die vertikale Macht, in der die gesamte Kontrolle faktisch von einer einzigen Person ausgeübt wird. Und diese vertikale Macht interessiert sich nicht, und zwar kein bisschen, für die Meinung der Masse. Was mich dabei am meisten stört, ist, dass die Meinung der jüngeren Generationen außer Acht gelassen wird. Wir sind überzeugt, dass die Unfähigkeit dieser Regierung in praktisch jedem Bereich offenkundig ist.
Und genau hier, in dieser Schlusserklärung, möchte ich gerne meine eigenen Erfahrungen schildern, wie ich mit diesem System in Konflikt geraten bin. Unsere Schulausbildung, in der sich die Persönlichkeit in einem sozialen Kontext zu entwickeln beginnt, ignoriert quasi alle individuellen Eigenarten. Es gibt keinen individuellen Ansatz, man erwirbt keine Kenntnisse zu Kultur und Philosophie oder ein Grundwissen über die Zivilgesellschaft. Offiziell gibt es diese Themen zwar, sie werden aber immer noch nach dem Sowjetmodell unterrichtet. lm Ergebnis sehen wir eine Ausgrenzung der Gegenwartskunst, fehlende Anregung zu philosophischem Denken und eine klischeehafte Zuordnung der Geschlechterrollen. Die Vorstellung vom Menschen als Bürger wird in die hinterste Ecke gefegt.
Die heutigen Erziehungsinstitutionen bringen Menschen von klein auf bei, als Roboter zu leben und nicht die entscheidenden Fragen zu stellen, die ihrem Alter entsprechen. Sie impfen einem Grausamkeit und Intoleranz gegenüber jeder Abweichung ein. Schon in der Kindheit vergessen wir unsere Freiheit.
Ich habe persönliche Erfahrungen mit psychiatrischen Kliniken für Minderjährige gemacht. Und ich kann wirklich sagen, dass jeder Teenager, der auch nur irgendein Anzeichen aktiver Nonkonformität zeigt, dort landen kann. Ein gewisser Prozentsatz der Kinder darin stammt aus Waisenhäusern. In unserem Land wird es nämlich als völlig normal angesehen, ein Kind, das versucht hat, aus einem Waisenhaus auszurei- ßen, in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. Dort werden sie mit extrem starken sedierenden Medikamenten wie Chlorpromazin behandelt, das in den 1970ern auch bei Sowjet-Dissidenten eingesetzt wurde.
Angesichts der allgemeinen Tendenz zur Bestrafung in dieser Umgebung und dem Fehlen wirklicher psychologischer Hilfe ist diese Erfahrung besonders traumatisierend. Sämtliche Interaktionen basieren auf der Instrumentalisierung kindlicher Ängste und dem Zwang zu Unterordnung und Gehorsam. In der Folge potenziert sich diese Grausamkeit noch um ein Vielfaches. Viele dieser Kinder sind Analphabeten, aber niemand unternimmt etwas dagegen – im Gegenteil, jedes letzte Restchen Motivation zur persönlichen Entfaltung wird entmutigt. Der Einzelne schließt sich völlig ab und verliert seinen Glauben an die Welt.
Ich möchte anmerken, dass diese Art und Weise der Persönlichkeitsentwicklung die Herausbildung individueller und religiöser Freiheiten bedauerlicherweise eindeutig massenweise behindert. Die Folgeerscheinungen des Prozesses, den ich gerade beschrieben habe, sind ontologische Demut, existenzielle Demut und Verstaatlichung. Ich halte diese Transformation oder diesen Bruch insofern für bemerkenswert, als wir, vom Standpunkt der christlichen Kultur aus betrachtet, sehen können, dass Bedeutungen und Symbole von solchen verdrängt werden, die ihnen diametral entgegengesetzt sind. Dementsprechend wird einer der wichtigsten christlichen Begriffe, die Demut, inzwischen im Allgemeinen nicht mehr als ein Weg zu Erkenntnis, Festigung und endgültiger Freiheit verstanden, sondern im Gegenteil als ein Instrument der Versklavung. Den [russischen Philosophen] Nikolai Berdjajew zitierend, könnte man sagen: »Die Ontologie der Demut ist die Ontologie der Sklaven Gottes und nicht die seiner Söhne.«
Während ich am Aufbau der Ökologiebewegung mitarbeitete, gelangte ich zu der festen Überzeugung, dass innere Freiheit die wichtigste Grundlage für Handeln darstellt und Handeln als solches von ganz unmittelbarer Bedeutung ist.
Bis zum heutigen Tag finde ich es erstaunlich, dass wir in unserem Land die Unterstützung von mehreren tausend Menschen brauchen, um der Willkür einer Handvoll Bürokraten ein Ende zu setzen. Ich möchte hervorheben, dass unser Prozess die sehr beredte Bestätigung der Tatsache ist, dass wir die Unterstützung Tausender Menschen aus aller Welt brauchen, um das Offensichtliche zu beweisen: Wir drei sind unschuldig. Das sagt die ganze Welt. Sie sagt es bei Konzerten, im Internet, in den Medien, sogar im Parlament. Der englische Premierminister empfängt unseren Präsidenten nicht mit Worten zu den Olympischen Spielen, sondern mit der Frage: »Warum sitzen drei unschuldige Frauen im Gefängnis?« Es ist beschämend.
Noch erstaunlicher finde ich allerdings, dass Leute nicht daran glauben, Einfluss auf die Regierung nehmen zu können. Im Laufe der Streiks und Demonstrationen [im Winter und Frühjahr], als ich Unterschriften sammelte und Petitionen vorbereitete, haben mich viele Leute – mit ehrlicher Verwunderung – gefragt, warum sie sich um alles in der Welt für dieses kleine Fleckchen Wald in der Region Krasnodar interessieren sollten oder was sie das denn anginge – selbst wenn es möglicherweise einzigartig in Russland ist, vielleicht sogar urzeitlich? Was sollte es sie kümmern, dass die Frau von Ministerpräsident Dmitri Medwedew dort einen offiziellen Amtssitz bauen lassen will und damit das einzige Reservat für Kriechwacholder zerstört? Diese Leute ... sie sind nur eine weitere Bestätigung dafür, dass die Menschen in unserem Land das Bewusstsein verloren haben, dass dieses Land uns gehört, den Bürgern. Sie empfinden sich nicht mehr als Bürger, sie empfinden sich nur noch als die automatisierte Masse. Sie haben nicht das Gefühl, dass der Wald ihnen gehört, selbst wenn er direkt neben ihren Häusern liegt.
Ich bezweifle sogar, dass sie für diese Häuser so etwas wie Besitzerschaft empfinden. Wenn irgendwer mit einer Planierraupe vor ihrer Veranda vorführe und ihnen erzählte, sie müssten evakuiert werden – »Bitte entschuldigen Sie, aber wir müssen Ihr Haus plattmachen, um Platz für eine Bürokratenresidenz zu schaffen« –, würden diese Leute gehorsam ihre Habseligkeiten zusammenraffen, ihre Koffer holen und auf die Straße hinausgehen. Und dort würden sie exakt so lange stehen bleiben, bis die Regierung ihnen sagt, was sie als Nächstes tun sollen. Sie sind völlig gestaltlos, es ist unendlich traurig. Nach einem knappen halben Jahr in Haft bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass das Gefängnis nichts anderes als Russland im Kleinen ist.
Man könnte auch mit dem Regierungssystem beginnen. Es weist die gleiche vertikale Machtstruktur auf, in der jede Entscheidung einzig und allein durch direkten Eingriff des gerade Verantwortlichen getroffen wird. Es gibt darin keinerlei horizontale Delegierung von Aufgaben, was jedem das Leben spürbar erleichtern würde. Und es mangelt an persönlicher Initiative. Denunziation gedeiht neben gegenseitigem Misstrauen. lm Gefängnis, wie in unserem Land als Ganzem, ist alles darauf angelegt, den Menschen ihre Individualität zu nehmen und sie mit einer bloßen Funktion gleichzusetzen, sei es die Funktion eines Arbeiters oder die eines Häftlings. Der straffe Rahmen des Tagesplans im Gefängnis (an den man sich schnell gewöhnt) gleicht dem Gerüst des Alltags, in das alle hineingeboren werden.
In diesem Alltagsgerüst fangen Menschen an, großen Wert auf bedeutungslose Kleinigkeiten zu legen. Im Gefängnis sind solche Kleinigkeiten Dinge wie eine Tischdecke oder Plastikgeschirr, die man sich nur mit persönlicher Erlaubnis des Gefängnisdirektors beschaffen kann. Außerhalb des Gefängnisses verfügt man entsprechend über einen sozialen Status, auf den ebenfalls größter Wert gelegt wird. Das hat mich immer gewundert. Ein weiteres Element dieses Gerüsts besteht darin, sich bewusst zu werden, inwiefern diese Regierung wie eine Theaterinszenierung funktioniert, als Bühnenstück. Derweil verwandelt sie sich in der Realität in Chaos. Die Oberflächenstruktur des Regimes bröckelt und offenbart die Desorganisation und Ineffizienz des Großteils seiner Arbeit. Es liegt auf der Hand, dass das nicht zu irgendeiner Form tatsächlichen Regierens führt. Im Gegenteil, die Menschen empfinden ein immer stärker werdendes Gefühl des Verlorenseins – einschließlich des Verlorenseins in Raum und Zeit. lm Gefängnis und überall im Land wissen die Menschen nicht, wohin sie sich mit dieser oder jener Frage wenden können. Deshalb wenden sie sich an den Boss des Gefängnisses. Und außerhalb des Gefängnisses gehen die Menschen dementsprechend zu Putin, dem Oberboss.
In einem Text ein Gesamtbild des Systems zum Ausdruck zu bringen ... nun, generell könnte ich sagen, dass wir nicht gegen ... wir sind gegen das Putin-erzeugte Chaos, das nur oberflächlich betrachtet eine Regierung genannt werden kann. Ein Gesamtbild des Systems, in dem unserer Auffassung nach praktisch sämtliche Institutionen einer Art Mutation unterzogen werden, während sie dem Namen nach noch intakt erscheinen. Und in welchem die Zivilgesellschaft, an der uns so viel liegt, zerstört wird. Wir verwenden in unseren Texten keine direkten Bibelzitate; wir benutzen lediglich ihre Form als künstlerisches Stilmittel. Das Einzige, was gleich ist, ist unsere Motivation. Unsere Motivation entspricht tatsächlich der Motivation eines direkten Bibelzitates. Am besten bringen die Evangelien diese Motivation zum Ausdruck: »Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.« [Matthäus 7, 8] Ich – wir alle – glauben aufrichtig, dass uns die Tür geöffnet wird. Aber leider Gottes ist im Moment das Einzige, was passiert ist, dass wir ins Gefängnis gesperrt wurden. Es ist sehr seltsam, dass die Behörden in ihrer Reaktion auf unsere Aktionen die historische Praxis der abweichenden Meinung vollständig ignoriert haben. »Wie bedauernswert ist ein Land, in dem einfache Ehrlichkeit im besten Fall als Heldenmut verstanden wird und im schlimmsten als Geisteskrankheit«, schrieb in den 1970er-Jahren der Dissident [Wladimir] Bukowsky. Und obwohl es noch gar nicht so lange her ist, verhalten sich die Menschen heute so, als hätte es den Gro- ßen Terror nie gegeben und auch keine Versuche, ihm Widerstand zu leisten. Ich vermute, dass wir von Menschen ohne Gedächtnis angeklagt werden. Viele von ihnen haben gesagt: »Er ist von einem Dämon besessen und redet im Wahn. Warum hört ihr ihm zu?« Das waren die Worte der Juden, die Jesus der Gotteslästerung anklagten. »Wir steinigen dich ... wegen Gotteslästerung.« [Johannes 10, 33] Interessanterweise benutzt die Russisch-Orthodoxe Kirche genau diesen Vers, um ihre Auffassung von Gotteslästerung zum Ausdruck zu bringen.
Diese Auffassung ist schriftlich bestätigt, das Dokument liegt unserer Strafakte bei. Mit dieser Auffassung bezieht sich die Russisch-Orthodoxe Kirche auf die Evangelien als eine feststehende theologische Wahrheit. Sie werden nicht mehr als Offenbarung verstanden, was sie von Anfang an gewesen sind, sondern als ein monolithischer Klotz, der sich in einzelne Zitate zerlegen lässt, um diese wo immer nötig hinzuschieben – in jedes Schriftstück, für jeden erdenklichen Zweck. Die Russisch-Orthodoxe Kirche hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, den Zusammenhang nachzulesen, in dem »Gotteslästerung« hier erwähnt wird – dass der Begriff in diesem Fall auf Jesus selbst angewendet wird. Ich glaube, religiöse Wahrheit sollte nichts Statisches sein, und dass es unbedingt notwendig ist, die Umstände und Wege geistiger Entwicklung zu begreifen, die Schwierigkeiten des Menschen, seine Doppelzüngigkeit, seine Zersplittertheit. Dass es für das eigene Selbst lebenswichtig ist, diese Dinge wahrzunehmen und zu erleben, um sich zu entwickeln. Dass man diese Dinge wahrnehmen und erfahren muss, um eine Persönlichkeit herauszubilden. Dass religiöse Wahrheit ein Prozess und kein fertiges Produkt ist, das sich jederzeit und wohin man will verschieben lässt.
All diese Dinge, über die ich gesprochen habe, all diese Prozesse – sie erlangen Bedeutung in der Kunst und in der Philosophie, auch in der Gegenwartskunst. Ein künstlerischer Akt kann und, wie ich meine, muss einen eigenen inneren Konflikt beinhalten. Und was mich wirklich ärgert, ist, wie die Anklage das Wort »sogenannt« in Bezug auf Gegenwartskunst verwendet.
Ich möchte darauf hinweisen, dass während des Prozesses gegen den Dichter [Joseph] Brodsky sehr ähnliche Methoden zum Einsatz kamen. Seine Gedichte wurden als »sogenannte« Gedichte bezeichnet; die Zeugen der Anklage hatten sie in Wirklichkeit gar nicht gelesen – genau wie mehrere Zeugen in unserem Fall die Performance selbst gar nicht gesehen, sondern nur den Videoclip im Internet angeschaut haben. Auch unsere Entschuldigungen werden von der kollektiven Anklage anscheinend zu »sogenannten« Entschuldigungen erklärt. Das ist beleidigend. Und ich bin erschüttert von den moralischen Verletzungen und psychischen Traumata [, die wir offenbar verursacht haben]. Unsere Entschuldigungen waren aufrichtig. Es tut mir leid, dass so viel geredet wurde und Sie alle das immer noch nicht begriffen haben. Oder es ist absichtliche Hinterhältigkeit, wenn Sie behaupten, unsere Entschuldigungen seien unaufrichtig. Ich weiß nicht, was Sie noch von uns hören müssen. Aber für mich ist dieser Prozess ein »sogenannter« Prozess. Und ich habe keine Angst vor Ihnen. Auch keine Angst vor Falschheit und Unechtheit, vor schlampig getarnter Irreführung im Urteilsspruch des »sogenannten« Gerichts.
Denn alles, was Sie mir nehmen können, ist »sogenannte« Freiheit. Es ist die einzige in Russland existierende Form. Doch meine innere Freiheit kann mir niemand nehmen. Sie lebt im Wort und wird weiterleben dank der glasnost [Offenheit], wenn das hier von Tausenden Menschen gelesen und gehört wird. Diese Freiheit wird weiterleben mit allen, die nicht gleichgültig sind und uns in diesem Land hören. Mit allen, die in diesem Prozess Bruchstücke von sich selbst entdeckt haben, so wie andere sie in früheren Zeiten bei Franz Kafka und Guy Debord entdeckt haben. Ich glaube, dass ich aufrichtig und offen bin, ich dürste nach der Wahrheit; und diese Dinge werden uns alle nur noch ein wenig freier machen. Wir werden schon sehen.
»Die Moskauer Prozesse«
Zum Verhältnis von Kunst und gesellschaftlicher Realität in Russland
Russland erlebte seit den 1990er-Jahren eine Reihe von Gerichtsprozessen gegen zeitgenössische avantgardistische KünstlerInnen und AusstellungsmacherInnen. Sie wurden ausgelöst durch die Forderung bestimmter »Bürgergruppen« nach Kompensation für die erlittene Verletzung ihrer religiösen Gefühle beziehungsweise moralischen Prinzipien und nach Verbot solcherart gesellschaftlich engagierter Kunst, die offenbar »religiö- sen Hass provozieren« wolle (ein Straftatbestand). In manchen Fällen waren militante orthodoxe »Patrioten« gleich zur Selbstjustiz vorangeschritten, hatten Exponate beschädigt oder zerstört und Zugänge blockiert. Eine Reihe KünstlerInnen wurde auch persönlich bedroht und emigrierte aus dem Land.
Mit dem Film Die Moskauer Prozesse dokumentiert der Schweizer Theater- und Filmregisseur Milo Rau seine gleichnamige Theaterinszenierung vom März 2013 im Moskauer Sacharow-Zentrum für Frieden, Fortschritt und Menschenrechte. Diese rollte die Auseinandersetzung um zwei vieldiskutierte, abgebrochene und in Teilen zerstörte Ausstellungen in eben diesem Sacharow-Zentrum (Vorsicht, Religion, 2003, Verbotene Kunst, 2006) sowie um die hochpolitische Pussy-Riot-Aktion von 2010 in der Christ-Erlöser-Kathedrale neu auf, in der Form einer »offenen Gerichtsshow«.
Dieses offene Setting erwies sich als unerwartet produktiv: Kern der Inszenierung, für die der Regisseur lediglich die russische Gesetzgebung als verbindlichen Rahmen und keinerlei eigenen Text vorgegeben hatte, waren die Kreuzverhöre von geladenen Zeugen durch »Verteidigung« und »Staatsanwaltschaft«. Im Verlauf von drei Tagen entfaltete sich in zuweilen hochaggressiver Form und Lautstärke ein Panorama gegenwärtiger Auseinandersetzungen und Konflikte in der Gesellschaft. Der Film beleuchtet diese in später eingespielten Interviews mit verschiedenen Beteiligten.
Ein größerer Teil der AkteurInnen war in der einen oder anderen Form an den realen Prozessen beteiligt gewesen (etwa die Kunstexpertin Katja Djogot, ein nicht inhaftiertes Pussy-Riot-Mitglied, die Verteidigerin Anna Stawizkaja); mit einer Ausnahme vertraten alle Teilnehmenden ihre persönlichen Anschauungen. Eine besondere Rolle kam dem umstrittenen antiliberalen, kremltreuen und höchst eloquenten TVJournalisten Maxim Schewtschenko zu, hier als Vertreter der Staatsanwaltschaft. Sieben angeheuerte »szenefremde« SchöffInnen sollten eine Art Querschnitt durch wichtige Positionen und soziale Gruppen in der Gesellschaft repräsentieren. Außerdem gab es etwa 100 Personen geladenes Publikum. Am Ende unterschied sich das Votum des Gerichts, speziell der Schöffen, erheblich von den rechtskräftig gewordenen Urteilen der »echten« Prozesse.
Ich schließe nicht aus, dass hierzu auch ein, ironisch gesprochen, highlight des dritten Tages beigetragen hat: der überraschende Einbruch des Moskauer Politalltags in den Kunstkontext. Zuerst hielten Beamte der Einwanderungsbehörde den Prozess für zwei Stunden auf, weil sie die angeblich unvollständigen Visaunterlagen der anwesenden Ausländer überprüfen wollten – ein sattsam bekanntes bürokratisches Verfahren, das in heiklen Konfliktsituationen die eigentlichen Intentionen und juristische Haltlosigkeit verschleiern soll. Kurz darauf stürmte eine Patrouille der halboffiziellen Kosakenmilizen herein, die von Beleidigungen der orthodoxen Kirche gehört haben wollten. Eindrucksvoll deeskalierend gestaltete sich in den Tumulten das Zusammengehen von Verteidigung und Anklage zur Rettung des Projekts. Offenbar vertrat selbst Herr Schewtschenko in dieser Situation das Recht auf Meinungs-, Redeund Kunstfreiheit – der zentrale Streitpunkt all dieser einschlägigen Prozesse.
Juri Andruchowytsch, ukrainischer Lyriker, Essayist, Romanautor, Übersetzer und Theatermacher, und Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina, Aktionskünstlerinnen aus Russland.

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Die Jury hat den Preis zu gleichen Teilen an die Bürgerrechtsaktivistinnen Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina einerseits und an den ukrainischen Schriftsteller Juri Andruchowytsch andererseits vergeben. Wir bedauern es sehr, dass die beiden russischen Preisträgerinnen verhindert sind, den Preis persönlich in Empfang zu nehmen. In seiner Laudatio wird Joscha Schmierer noch auf ihre Geschichte eingehen.
Der Verlauf des Abends gestaltet sich folgendermaßen: Es folgt die Begründung der Jury zusammen mit der Laudatio auf unsere Preisträgerinnen und den Preisträger durch Joscha Schmierer. Es sprechen dann Bürgermeisterin Karoline Linnert für die Freie Hansestadt Bremen und Ralf Fücks für die Heinrich Böll Stiftung als den Institutionen, die den Preis finanziell unterstützen. Es folgt ein musikalisches Zwischenspiel der ukrainischen Künstlerin Ulyana Horbatschewska und ihres Kollegen Mark Tokar. Daran schließt sich der Festvortrag von Juri Andruchowytsch an. Dieser Teil des Abends endet mit der Preisübergabe und – wie in den letzten Jahren auch – mit einem Sektempfang im Nebenraum. Neu an unserem Abendprogramm ist, dass wir die Anwesenden im Anschluss zu einem festlichen Empfang mit Buffet im Institut Français an der Contrescarpe einladen. Dies ist das Programm für den heutigen Abend.
Morgen um 11 Uhr findet in der Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112, eine politisch-literarisch-musikalische Veranstaltung zu und mit den Preisträgern statt. Im ersten Teil verlesen zwei Sprecherinnen die Plädoyers von Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina aus ihrem Prozess in Moskau, in dem sie am 17. August 2012 wegen »Rowdytums aus religiösem Hass« zu je zwei Jahren Arbeitslager verurteilt wurden. Es folgt eine literarisch-musikalische Performance von und mit Juri Andruchowytsch, Ulyana Horbatschewska und Mark Tokar. Bitte entnehmen Sie diese Angaben auch dem Programm.
Meine Damen und Herren, der Hannah-Arendt-Preis ist ein europäischer Preis mit transatlantischen Bezügen. Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich erwähne, dass sich die Idee des Preises auf das politische Denken seiner Namensgeberin bezieht. Hannah Arendt arbeitete nach ihrer Flucht aus Europa und ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten unter anderem an der Frage: Wie kann ein politischer Neubeginn für Europa aussehen? Welche politischen Konsequenzen sind aus der Katastrophe zu ziehen? Die Antwort schien ihr so deutlich wie sie offenbar unrealistisch war: Ein Neuanfang sollte beginnen mit dem Abschied vom Nationalstaat des 19. Jahrhunderts. In Arendts Erfahrung gehörten die europäischen Nationalstaaten mit ihrer gleichsam angeborenen Ausgrenzungspolitik gegenüber Minderheiten und Flüchtlingen zu den Mitverursachern der beiden Weltkriege und des Genozids an den europäischen Juden.
In der Realpolitik ist ihre Erkenntnis damals nicht angekommen. Es hat keinen Abschied vom Nationalstaat gegeben, wohl aber die Begründung eines neuen Europa und die wirtschaftliche Vernetzung der europäischen Nationalstaaten. Diesen fällt es bis heute schwer, an die Stelle der traditionellen Ausgrenzungspolitik gegenüber Minderheiten und Flüchtlingen eine Aufnahmepolitik mit Augenmaß zu setzen.
Etwas Neues kam hinzu: Das neue Europa war aufgrund der Teilung des Kontinents amputiert. Die westlichen europäischen Staaten deklarierten sich in der Folge als neues Gesamteuropa, das Zentrum und der Osten verschwanden im Schatten der Katastrophe. Bemerkenswert ist nun, dass nicht nur der Osten, dessen Staaten zu Satelliten des sowjetischen Imperiums geworden waren, unter der Teilung gelitten hat, sondern dass die Teilung auch im Westen tiefe Spuren hinterlassen hat. Die zeigen sich bis heute in der täglich praktizierten Überzeugung, dass das wahre, das wirkliche, das effektive, das zukunftsträchtige Europa im Westen liegt. Die zentraleuropäischen und ost- sowie südosteuropäischen Staaten sind zwar zum großen Teil Mitglieder der EU oder werden es in naher Zukunft sein, doch ihre Stellung, ihre Anerkennung leidet darunter, dass ihre Wachstumsraten zu wünschen übrig lassen. In der öffentlichen Meinung gehören diese Länder, die doch einst das Zentrum Europas bildeten, noch kaum zum neuen Europa. Das Gesamtbild Europas ist von der wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte der westlichen Staaten geprägt.
Dies gilt erst recht für die Ukraine. Seit dem Beginn der Freiheitsbewegung auf dem Kiewer Maidan, die zum Sturz der korrupten Regierung führte, denken Westeuropäer darüber nach, wie man das Geschehen in der Ukraine zu beurteilen und zu behandeln hat. In der Öffentlichkeit streiten sich die, die befinden, dass die Ukraine zu den Außenbezirken des russischen Machtbereichs gehört, mit denen, die die jahrelange Freiheitsbewegung in der Ukraine und den erklärten Willen der Mehrheit ihrer Bevölkerung als besten Beweis ihrer Zugehörigkeit zu einem neuen Europa sehen.
Als Russland die Krim besetzte und Krieg in der Ukraine anzettelte, definierte ihn die westeuropäische Politik einerseits als Bruch des Völkerrechts und andererseits als inneren Konflikt zwischen zwei zusammengehörigen Nachbarstaaten. Als russische Freischärler und reguläre Militärs die Ost-Ukraine besetzten und ein unerklärter Krieg begann, wurde das als besorgniserregender Konflikt definiert und die Kontrahenten zu diplomatischen Gesprächen aufgerufen. Einzig Polen und die baltischen Staaten verstanden sich zu eindeutigen Solidaritätsbekundungen für die Ukraine.
Ein Gespenst geht um in Europa: das Gespenst eines erzürnten Putin, der kriegerische Gesten vollführt – und damit ganz Europa einschüchtert. Die Ukraine soll in dieser Situation, so wollen uns viele Gutmeinende einreden, um des europäischen Friedens willen das Notopfer sein. Ist das nicht auch damals, zwischen 1939 und 1945 die »tragische Rolle« der Ukraine gewesen, Opfer der beiden Großmächte Deutsches Reich und Sowjetunion zu sein? Und haben sich westdeutsche Politiker nicht schon einmal geirrt, als sie in den Achtzigerjahren die polnische Freiheitsbewegung Solidarnosc als eine Bedrohung für den Frieden kritisierten?
Es ist richtig, der Freiheitswille von Völkern stellt überkommene politische Ordnungen in Frage. Aber kann dieser Umstand begründen, dass das freie Europa gegen den Freiheitswillen eines Volkes, das sich ihm anschließen will, agiert?
Wir befinden uns nicht im Jahre 1939 – die Geschichte wiederholt sich nicht.
Es geht mir auch nicht darum, westliche diplomatische Strategien zu kritisieren, unsere Kritik richtet sich auf die europäische und vor allem die deutsche Öffentlichkeit. Man darf die Art und Weise, wie hier mancherorts die Diskussion geführt wird, ruhigen Gewissens geschichtsvergessen und anti-politisch nennen.
Westeuropa und Deutschland müssen aufhören die Teilung Europas zu zementieren, indem ihre Wortführer die Ukraine als den russischen Sicherheitsinteressen untergeordnet behandeln und den Freiheitswillen seiner Bevölkerung für eine diplomatische Lappalie halten. Eine solche Einstellung ist eines Europas der Freiheit nicht würdig.
Vom politischen Denken zum Handeln
Ich freue mich, dass wir – die Heinrich Böll Stiftung Bremen und der Bremer Senat – heute gemeinsam den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken verleihen. Wir verleihen diese Auszeichnung an den Schriftsteller, Übersetzer und Journalisten Juri Andruchowytsch aus der Ukraine. Schön, dass Sie heute hier sein und den Preis persönlich in Empfang nehmen können. Und wir verleihen den Preis gleichermaßen an Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina, die wohl den meisten von uns zuerst als Mitglieder der Gruppe Pussy Riot bekannt geworden sind. Sie stammen aus Russland und leben dort. Auf beide müssen wir heute leider verzichten.
Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken wurde 1994 ins Leben gerufen, um in den kontroversen Diskussionen über politische Gegenwartsfragen an Hannah Arendts Ausspruch zu erinnern, dass »der Sinn von Politik Freiheit (ist)«. Und dem folgen diese drei Persönlichkeiten – jeweils auf ihre Weise.
Gemeinsam ist den Preisträgerinnen und dem Preisträger, dass sie mit ihrer Kunst – mit knallbunter, lauter Aktionskunst oder mit ruhigerer, literarischer Kunst – hochpolitisch und sehr aktuell sind und sich deutlich positionieren. Und gemeinsam ist ihnen auch, dass sie jeweils auf ihre Weise dem expansiven Machtgebaren Wladimir Putins Einhalt gebieten wollen – in territorialer wie in geistiger Hinsicht. Weder ist die Ausdehnung russischer Grenzen auf das Staatsgebiet der Ukraine hinnehmbar noch die Besetzung der Köpfe mit einer einzigen, bestimmten, patriarchalen und autoritären Vorstellung davon, wie die russische Bevölkerung zu glauben und zu leben hat. Die drei, die wir heute ehren und auszeichnen wollen, sehen sehr genau hin. Und darauf beruht ihr Protest.
Kunst als Mittel des politischen Protests ist in Deutschland heutzutage nicht (mehr?) ein so verbreitetes Mittel, zumal die Möglichkeiten, damit Aufregung zu erreichen, geringer sind. Das mag an unserer gefestigten Demokratie liegen und an gesicherten Vorstellungen von der Freiheit der Kunst und der Freiheit des gesprochenen und geschriebenen Wortes.
Bremen hat traditionell Partnerstädte in Osteuropa, Danzig und Riga. Ich habe sie mehrfach besucht und habe anfangs geglaubt, dass die Menschen dort mit mir als Deutsche über die Vergangenheit und den Nationalsozialismus sprechen wollen. Mir ist aber viel häufiger begegnet, dass sich die Menschen in Danzig und Riga viel intensiver mit der aktuellen Situation beschäftigten und sich darüber austauschen wollten, wie sehr sie die Haltung Russlands ihnen gegenüber als aggressiv und bedrohlich wahrnehmen.
Juri Andruchowytsch, die Zeit Ihrer Aktionskunst beziehungsweise der Performancegruppe »Bu-Ba-Bu« liegt schon ein paar Jahre zurück: 1985 waren Sie da sehr aktiv. Da waren Ihre Mit-Preisträgerinnen noch nicht einmal geboren. Entsprechend unterschiedlich sind Sie aufgewachsen: Während Sie, Juri Andruchowytsch, Ihre Militärzeit bei der Sowjetischen Armee ableisten mussten, löste sich eben diese Sowjetunion gerade auf, als Marija Aljochina 1988 und Nadeshda Tolokonnikowa 1989 auf die Welt kamen.
Sie haben im Jahr 2004 die »Orangene Revolution« auf dem Maidan erlebt, die Euphorie damals, und Sie haben dem Euromaidan vor etwa einem Jahr ein ziviles Gesicht gegeben, das diejenigen Lügen straft, die behaupteten, diese Bewegung bestehe vor allem aus Rechtsextremisten. Und das tun Sie mit ihrer Sprache, die eben nicht einfach nur nachrichtliche Berichterstattung ist, sondern die Sprache eines Literaten, eines Künstlers ist – mit sehr klarem Bezug zum Alltag, zur Realität. Ihre gedankliche Auseinandersetzung mit Russland ist schon älter. Ich möchte an dieser Stelle eine Passage aus Ihrem Essay »Mit sonderbarer Liebe« aus dem Jahr 2003 zitieren. Es ist in dem Band Engel und Dämonen der Peripherie im Jahr 2007 in Deutschland erschienen.
»Was will ich von Russland?
(…)
Daß es aufhört, Druck auf die Ukraine (und alle möglichen anderen Schweden) auszuüben: wen sie, die Ukraine, wählen oder nicht wählen soll, mit wem sie sich zusammentun soll und mit wem unter keinen Umständen.
Daß es die Idee aufgibt, uns alle am Gängelband zu führen.
Daß es sich, wieder im Geiste Dynkos, endlich von der Perspektive einer extensiven Entwicklung verabschiedet, von der Expansion nach Westen, und sich auf sich selbst konzentriert, tief und wunderbar, wie es ist. Daß es meine Romane im Original liest.
Daß es aufhört, mein Land ausschließlich als Heimat der Speckfresser wahrzunehmen.
Daß es nie wieder seine besten Schriftsteller hinter Gitter bringt.
Daß es liberal-individualistisch wird, daß das russische Individuelle (das Positive) für immer die Oberhand gewinnt über das russische Gesellschaftliche (das Negative).
Anders gesagt: daß in dieser hochexplosiven Mischung aus Despotie und Anarchie namens Russland die russische Anarchie über die russische Despotie siegt.
Meine Forderungen sind absurd und unerfüllbar, meine Liebe zu Russland ist sonderbar.«
Heute sind Sie eine der wichtigsten Stimmen der Ukraine, ein weitsichtiger und wichtiger Wortführer einer politisch aufgeklärten, kritischen Schicht, die Freiheit und eine demokratische Ausrichtung anstrebt und auf Posen vom »starken Mann« gerne verzichtet. Man liest viele Interviews mit Ihnen auch in deutschen Zeitungen, und Sie haben deutliche, aber sehr differenzierte Kritik auch an der hiesigen Berichterstattung und an Europa. Wir erleben derzeit keine »Ukraine-Krise«, sondern einen »Krieg«. Das sagen Sie ganz klar. Und dieser Krieg betrifft nicht nur die Ukraine, sondern auch andere Nachbarländer Russlands.
Über diese Situation mache ich mir derzeit große Sorgen. Es kann wohl niemand ernsthaft eine militärische Reaktion für die richtige halten. Man kann aber auch nicht hinnehmen, dass der amtierende russische Präsident Teile der Ukraine annektieren lässt und man ihm das unwidersprochen durchgehen lässt. Ich muss zugeben, diese Situation macht hilflos, man fühlt sich ohnmächtig und das Darüber-Nachdenken bereitet Pein. Denn was ist die Lösung?
Auf die Frage, welcher Gesprächspartner Wladimir Putin auf Augenhöhe begegnen könne, haben Sie kürzlich bei einem Gespräch im Bremer EuropaPunkt gesagt: »Die Realität!«
Denn in der Realität sterben russische Soldaten, kostet dieser russische Militäreinsatz viel Geld, das anderswo beispielsweise für Krankenhäuser fehlt, und zeigen auch die Sanktionen der EU Wirkung, die russische Bevölkerung spürt sie. Ich will gerne mit Ihnen darauf hoffen, dass die Realität hilft, eine Grenzen missachtende Politik in die Schranken zu weisen. Und ich will gerne mit Ihnen darauf hoffen, dass kritische Russinnen und Russen in Moskau oder St. Petersburg das Wagnis eingehen, gegen eine solche Politik zu protestieren.
Mutige Russinnen sind Marija Aljochina, Nadeshda Tolokonnikowa und Jekaterina Samuzewitsch. Diese drei waren es, die im Februar 2012 mit ihrer Aktionskunst weltweit bekannt geworden sind: Sie waren damals die drei Pussy Riots, die das »Punk-Gebet« in der ChristErlöser-Kathedrale Moskau vorgetragen haben.
Es mag sein, dass sie damit auch religiöse Gefühle verletzt haben – das ist ein schmaler Grat, auf dem man da wandelt. Aber ihre Kunst basiert auf fundiertem politischem Denken. Pussy Riot haben sich mit ihrer Aktionskunst für die Freiheit eingesetzt. Die drei sehr mutigen, jungen Frauen haben sich sehr genau überlegt, was sie da tun. Sie sind sehenden Auges ein sehr großes persönliches Risiko eingegangen. Ihnen war klar, welche Justiz-Maschinerie und Bestrafung da auf sie zurollen würde, da bin ich mir sicher.
Marija Aljochina machte in ihrem Schlussplädoyer am Ende des Prozesses deutlich, wofür sie sich eingesetzt haben: die Freiheit. Dabei spielte sie eine sprachliche Demütigung an das Gericht zurück. Sie sagte: »Mich ärgert sehr, wenn die Anklage von ›sogenannter‹ moderner Kunst spricht. … Für mich trifft das Wort ›sogenannt‹ nur auf diesen Prozess zu. Und ich habe keine Angst vor Ihnen. Ich fürchte mich nicht vor den Lügen und Erdichtungen, dem schlecht kaschierten Betrug im Urteil des sogenannten Gerichts. Denn Sie können mich zwar der sogenannten Freiheit berauben, die es in Russland gibt (und nur eine solche gibt es in der Russischen Föderation), aber meine innere Freiheit kann mir niemand mehr nehmen. Sie lebt im Wort; sie wird dank der Öffentlichkeit leben, wenn Tausende von Menschen es lesen und hören werden.«
Die Künstlerinnen haben mit ihrer damaligen Verhaftung ihre Freiheit eingebüßt. Sie haben die Folgen ihres Protests erlitten, die Verurteilung zu jahrelanger Haft in Straflagern.
ung zu jahrelanger Haft in Straflagern. Mich beeindruckt, dass es dem System jedoch nicht gelungen ist, diese offensichtlich starken Frauen zu brechen. Stattdessen arbeiten nun Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina dafür, die Haftbedingungen all der Frauen, die gerade jetzt auch inhaftiert sind, so weit zu »verbessern«, dass geltendes Recht eingehalten wird: etwa dass die tägliche Arbeitszeit tatsächlich nur acht Stunden beträgt und nicht 14 oder 16 Stunden, wovon Nadeshda Tolokonnikowa berichtet hat. Sie haben die Nichtregierungsorganisation »Zone des Rechts« gegründet, um unmenschliche Bedingungen und Willkür im russischen Strafvollzug, die sie selbst erlebt haben, zu bekämpfen.
Gemeinsam haben Juri Andruchowytsch, Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina, dass sie ihre Aufgabe darin sehen, über die herrschenden Zustände zu berichten, dagegen zu protestieren und über die Hintergründe zu informieren, vor allem im westlichen Europa und in den USA. Sie alle drei sind derzeit viel auf Reisen, knüpfen Kontakte, geben Interviews und halten Vorträge. Damit kämpfen sie für die Freiheit in ihrem Land.
Aber nicht nur das: Sie erlauben es uns in den westlichen Demokratien nicht länger, uns auf ein vorgeschütztes, diffuses Halbwissen zurück zu ziehen, so zu tun, als wären das »interne Angelegenheiten« und uns nicht mit der Realität auseinander zu setzen. So wird aus politischem Denken politisches Reden und politisches Handeln. Und dafür ehren wir sie heute.
Im Namen des Senats danke ich der Heinrich Böll Stiftung und der Jury, die uns immer wieder solche beeindruckenden Preisträgerinnen und Preisträger präsentiert und uns damit auch immer wieder eine Nuss zu knacken gibt. Ich gratuliere Ihnen herzlich und freue mich auf die Festrede von Juri Andruchowytsch.
Über Wahrheit und Lüge in der Politik
Der Hannah-Arendt-Preis war schon immer ein politischer Preis. Sonst würde er seiner Namensgeberin nicht gerecht. In diesem Jahr ist das vielleicht noch mehr als sonst der Fall. Die PreisträgerInnen konfrontieren uns mit den dramatischen Entwicklungen im Osten unseres Kontinents: mit der autoritären Wendung der russischen Machtelite nach innen und ihrer expansiven Wendung nach außen und dem schon fast verzweifelten Kampf der Ukraine um ihre territoriale Einheit und politische Souveränität. Zugleich verweist die Auswahl der Jury darauf, dass noch nicht aller Tage Abend ist.
Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina stehen für den ungezähmten, freiheitlichen Geist, der in der russischen Kulturszene, in der Menschenrechtsbewegung und in feministischen Zirkeln weht, allen Repressalien zum Trotz. Und Juri Andruchowytsch steht für den erneuten demokratischen Aufbruch in der Ukraine – dem dritten seit 1990/91, als sich die große Mehrheit für die Loslösung von der Sowjetunion entschied. Im Kern geht es darum noch immer: um die doppelte Selbstbefreiung der Ukraine von russischer Dominanz wie von den postsowjetischen politischen und gesellschaftlichen Strukturen – organisierte Verantwortungslosigkeit, kriminelle Bereicherung, staatliche Willkür, eine unselige Verschränkung politischer und wirtschaftlicher Macht, soziale Gleichgültigkeit.
Andruchowytsch ist ein politischer Intellektueller, der öffentlich Partei ergreift. Als Schriftsteller ist er zugleich ein Dolmetscher, der uns die Welt Mitteleuropas erklärt: eine Welt, die uns historisch und geographisch so nah ist und doch von vielen als »nicht zugehörig« empfunden wird. Und er ist ein wahrer Europäer, der die Idee des freien und einigen Europa verteidigt. Bis vor kurzem hätte ich gesagt: der nicht müde wird, uns zu erklären, dass in der Ukraine um die Zukunft Europas gekämpft wird. Wenn ich nicht irre, ist sein Ton in der letzten Zeit ungeduldiger geworden und mit Bitterkeit gemischt über all den Unverstand, die Ignoranz und die Vorurteile, mit denen die Ukraine im Westen zu kämpfen hat. Umso wichtiger ist dieser Preis – als Signal, dass wir diese Auseinandersetzung als unsere eigene verstehen.
Es führt eine direkte Linie vom Preisträger des letzten Jahres, Timothy Snyder, zu den heutigen Preisträgern. Im Internet kursiert der Videomitschnitt eines Vortrags von Snyder, in dem er den Propagandakrieg des Kremls seziert. Er erwähnt Hannah Arendt nicht explizit, aber sein Vortrag erinnert lebhaft an einen Essay, den sie 1963 unter dem Titel Wahrheit und Politik veröffentlichte. Man findet darin fast alles, was zum Verständnis der heutigen Desinformationspolitik des Kremls erforderlich ist. Im Anschluss an Leibniz unterscheidet Arendt mathematische, wissenschaftliche und philosophische Wahrheiten, die sie im Begriff der Vernunftwahrheit zusammenfasst, von Tatsachenwahrheiten als Grundlage demokratischer Meinungsbildung. Ich zitiere: »Wenn politische Macht sich an Vernunftwahrheiten vergreift, so übertritt sie gleichsam das ihr zugehörige Gebiet, während jeder Angriff auf Tatsachenwahrheiten innerhalb des politischen Bereichs selbst stattfindet. ... Innerhalb des Bereichs menschlicher Angelegenheiten (legt) jeder Anspruch auf absolute Wahrheit, die von den Meinungen der Menschen unabhängig zu sein vorgibt, die Axt an die Wurzeln aller Politik und der Legitimität aller Staatsformen.«
Man kann das als Absage an jede Form des Fundamentalismus lesen, bei dem die Politik als Vollstrecker absoluter Wahrheiten auftritt, seien sie religiöser, wissenschaftlicher oder weltanschaulicher Provenienz. Das bedeutet keineswegs, dass der Unterschied von Wahrheit und Lüge im Bereich des Politischen irrelevant wäre. In der politischen Auseinandersetzung geht es um begründete Meinungen. Sie beruhen auf der unterschiedlichen Bewertung tatsächlicher Ereignisse und Sachverhalte, also von »Tatsachenwahrheiten«. Den Unterschied zwischen Tatsachen und Meinungen zu verwischen hält Arendt für »nicht weniger schockierend als die Resistenz der Menschen gegen die Wahrheit überhaupt«, soweit sie ihnen nicht in den Kram passt.
Genau diese Verwischung betreibt die Kreml-Propaganda mit List und Tücke. Ein Beispiel: Als die malaysische Passagiermaschine über dem Gebiet der »Volksrepublik Donbass« abgeschossen wurde und 298 Menschen ihr Leben verloren, wurden prompt verschiedene Theorien in die Welt gesetzt, die alle durch das russischen Fernsehen geisterten und im Internet breite Resonanz fanden:
die Maschine wurde durch ukrainische Artillerie abgeschossen;
es waren ukrainische Jagdflieger (eine entsprechende Fotomontage wurde im russischen Staatsfernsehen gezeigt);
es waren US-Kampfflugzeuge im Spiel; das Ganze war ein gezieltes Komplott, um einen Kriegsvorwand gegen Russland zu fingieren;
den Vogel schoss die Behauptung ab, das Flugzeug sei schon als fliegender Sarg gestartet, vollgepackt mit Leichen, die gezielt über dem Territorium der Separatisten zum Absturz gebracht wurden.
Dass sich diese Versionen widersprechen, spielt keine Rolle: Es geht nicht um Aufklärung, sondern um systematische Verwirrung. Am Ende ist jede Version beliebig, jedes Untersuchungsergebnis steht unter dem Verdacht der Manipulation; jeder Indizienbeweis, der auf die prorussischen Separatisten hindeutet, wird in das Zwielicht einer interessengeleiteten Meinungsäußerung gezogen. Damit das funktioniert, mussten am Boden alle Spuren verwischt werden, so gut es ging, und genau das ist passiert.
Man kann unterschiedliche Schlüsse aus sozialen Sachverhalten ziehen. Wer aber die empirischen Tatsachen manipuliert und sie zum bloßen Material im politischen Meinungskampf macht, entzieht damit auch der Meinungsfreiheit den Boden. Hannah Arendt: »Meinungsfreiheit ist eine Farce, wenn die Information über die Tatsachen nicht garantiert ist.« Sie zitiert ein Bonmot des französischen Staatsmanns Clemenceau, der Ende der 1920er-Jahre gefragt wurde, was künftige Historiker wohl über die damals (wie heute) strittige Kriegsschuldfrage denken werden. »Das weiß ich nicht«, soll Clemenceau geantwortet haben, »aber eine Sache ist sicher, sie werden nicht sagen: Belgien fiel in Deutschland ein.« Es wäre schon ein Fortschritt, wenn wir uns in der aktuellen Debatte darauf verständigen könnten, dass nicht die Ukraine Russland attackierte, sondern umgekehrt.
In der Wissenschaft ist der Gegensatz zur Wahrheit der Irrtum, in der Politik ist es die Lüge, also ein bewusster Akt der Unwahrheit. Wie sonst soll man es bezeichnen, wenn der Kreml zu Beginn der militärischen Intervention in der Krim leugnete, dass es sich um russische Truppen handelte? Das hinderte Putin natürlich nicht, anschließend Orden an die beteiligten Spezialeinheiten zu verteilen. Es geht nicht um Konsistenz des jeweiligen Narrativs, sondern um politische Zweckmäßigkeit. Die Tatsachen sind bloßes Material der politischen Propaganda.
Das gleiche Spiel wiederholt sich jetzt bei der Intervention in der Ostukraine. Auch hier wird die militärische Aggression hinter der löchrigen Fassade eines bewaffneten Aufstands der »russischen Landsleute« getarnt. Bis heute leugnen die Vertreter der Macht, dass Russland im Donbass mit Waffen und Kämpfern agiert. Die Liste organisierter Verdrehungen, Halbwahrheiten und ganzer Lügen wird täglich länger. Dazu gehört die gebetsmühlenhafte Behauptung, in Kiew habe ein »faschistischer Putsch« stattgefunden, die Rede vom »Bürgerkrieg« in der Ukraine, die Beschwörung der antisemitischen Gefahr, die Bezeichnung der ukrainischen Regierung als »faschistische Junta« et cetera.
Außenminister Lawrow ist ein Großmeister in der Verdrehung der Tatsachen. Wenn er behauptet, dass Russland nicht Kriegspartei sei, weiß jeder, dass er lügt, und er weiß, dass es jeder weiß, aber das kümmert ihn nicht. Er setzt darauf, dass es niemand wagen wird, ihn einen Lügner zu nennen – das wäre ja die Sprache des Kalten Krieges. Stattdessen kumpelt unser Außenminister auf offener Bühne mit seinem »lieben Freund Sergey«. Und wenn die Bundeskanzlerin nach einem langen nächtlichen Gespräch mit Präsident Putin Klartext redet, fehlt es nicht an Stimmen, die vor »rhetorischer Eskalation« warnen.
Was passiert mit uns, wenn wir nicht mehr wagen, die Dinge beim Namen zu nennen? Die Lüge hinzunehmen ist der Beginn der Selbstaufgabe der liberalen Demokratien. Wir rutschen damit auf die schiefe Ebene einer Relativierung der Tatsachen, an deren Ende die Relativierung aller Werte steht. Manchmal ist es schon eine politische Handlung, wenn man ausspricht, was der Fall ist. Noch einmal Hannah Arendt: »Wahrhaftigkeit ist nie zu den politischen Tugenden gerechnet worden, weil sie in der Tat wenig zu dem eigentlich politischen Geschäft, der Veränderung der Welt und der Umstände, unter denen wir leben, beizutragen hat. Dies wird erst anders, wenn ein Gemeinwesen im Prinzip sich der Lüge als einer politischen Waffe bedient, wie es etwa im Falle der totalen Herrschaft der Fall ist; dann allerdings kann Wahrhaftigkeit als solche … zu einem politischen Faktor ersten Ranges werden.
Wo prinzipiell und nicht nur gelegentlich gelogen wird, hat derjenige, der einfach sagt, was ist, bereits zu handeln angefangen, auch wenn er dies gar nicht beabsichtigte. In einer Welt, in der man mit Tatsachen nach Belieben umspringt, ist die einfachste Tatsachenfeststellung bereits eine Gefährdung der Machthaber.«
Genau das war das Credo der Dissidenten in der alten Sowjetunion, und an diesem Punkt sind wir heute wieder gegenüber dem autoritären Regime, das Putin in Russland etabliert hat.
Man kann bei Arendt lernen, dass demokratische Gesellschaften einer doppelten Gefahr ausgesetzt sind: Die eine ist die systematische Verwischung des Unterschieds von Wahrheit und Lüge, die andere liegt in der Versuchung Augen und Ohren vor unbequemen Wahrheiten zu schließen. Beides trifft für den Konflikt um die Ukraine zu. Wir wollen nicht wahrhaben, dass Putin längst die Grenze zum Krieg überschritten hat, die wir aus guten Gründen keinesfalls überschreiten wollen. Wir wollen den Zusammenhang zwischen Autoritarismus nach innen und Expansion nach außen nicht sehen, weil er die Illusion auf eine baldige Rückkehr zu guter Nachbarschaft stört. Wir zögern, den nationalreligiösen Ton ernst zu nehmen, den Putin in seiner jüngsten Rede an die Nation angeschlagen hat, als er die Heimholung der Krim zu einer heiligen Sache erklärte. (Genau diese Symbiose von russischer Orthodoxie und politischer Macht wollte Pussy Riot mit ihrer Aktion in der Moskauer Christ-Erlöser-Kirche offenlegen.)
Wir wollen nicht wahr haben, dass sich unsere Nachbarn in Polen und im Baltikum wieder von Russland bedroht fühlen, weil wir die NATO gern für eine historisch überholte Veranstaltung halten und mit militärischer Abschreckung nichts mehr zu tun haben wollen.
Ich fürchte nur, dass es nichts hilft, den Kopf in den Sand zu stecken. Jede realistische Politik beginnt mit der Anerkennung der »Tatsachenwahrheiten«, um noch einmal mit Hannah Arendt zu sprechen. Über die politischen Schlussfolgerungen kann und muss diskutiert werden.
Im Osten geht es um die Zukunft Europas
Es ist mir eine große Freude heute unsere Preisvergabe begründen und unsere Preisträgerinnen und unseren Preisträger würdigen zu können. Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken ist ein politischer Preis, und die Entscheidung der Jury für die Preisvergabe ist unvermeidlich auch eine politische Stellungnahme, mal eher implizit, mal eher explizit wie in diesem Jahr. Politisches Denken ist öffentliches Denken und begründet politisches Handeln. Politisches Handeln ist öffentliches Handeln, und wo die Öffentlichkeit durch politische Unterdrückung beschränkt bleibt, zielt politisches Handeln auf Herstellung von Öffentlichkeit, um gemeinsame Meinungs- und Willensbildung zu ermöglichen und den gemeinsamen Willen öffentlich geltend zu machen. Unter Umständen wirkt dieses Handeln revolutionär, zumindest aber provozierend, also anregend für die einen, aufregend für die anderen. Hannah Arendt spricht nicht umsonst vom »Wagnis der Öffentlichkeit«, das politisches Denken eingehen muss. Die Jury hat sich entschieden, den Hannah-Arendt-Preis in diesem Jahr gemeinsam, einerseits an zwei Frauen von Pussy Riot, nämlich an Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina, und andererseits an Juri Andruchowytsch, zu verleihen. Dabei vergeben wir nach unserer Ansicht nicht zwei Preise mit halber Ausschüttung, sondern einen gemeinsamen Preis in zwei Teilen. Leider auch finanziell zweigeteilt. Ich werde also zuerst erläutern, inwiefern wir einen gemeinsamen Preis verleihen, um dann die beiden Preisträgerinnen und den Preisträger jeweils für sich zu würdigen.
Sowohl der Euromaidan, für den uns Juri Andruchowytsch steht, als auch die Protestaktion von Pussy Riot sind eine Antwort auf konkrete Akte der gewaltsamen politischen Unterdrückung.
Bevor in Kiew der Maidan besetzt wurde, war eine Demonstration von Studenten, die gegen die Nichtunterzeichnung des Abkommens zwischen der Ukraine und der EU protestierten, von den Sicherheitskräften brutal zusammengeschlagen worden. Der zunächst minoritäre Protest gegen ein bestimmtes repressives Regierungshandeln wandelte sich schließlich zu einem Aufstand gegen die Regierung. Man mag diesen Aufstand als prowestlich oder proeuropäisch bezeichnen, und viele der Protagonistinnen und Protagonisten verstehen ihn sicherlich auch so, aber in erster Linie war er der Aufstand gegen eine Regierung, bei der die Leute die Unabhängigkeit der Ukraine und ihre eigene Freiheit gefährdet und verraten sahen. Es ist eine ziemliche Unsitte, jede Bewegung gegen Unterdrückung sofort zu einer prowestlichen und damit implizit zu einer antirussischen zu erklären.
Wenn ich sage, in erster Linie handelt es sich um einen Aufstand gegen Unterdrückung, dann meine ich, es ist noch nicht ausgemacht, wie sich die Ukraine, wenn es ihr gelingen sollte, die annektierte Krim wieder in das ukrainische Staatsterritorium aufzunehmen und die umkämpften Gebiete im Osten zurückzugewinnen, sich letztlich verorten wird. Hinter dem Sieg des Aufstandes steht immer noch die Frage, wie die territoriale Einheit und die Souveränität der Ukraine wieder hergestellt werden können. Mit der Entscheidung zwischen Himmelsrichtungen wird sie sich vielleicht nicht lösen lassen. Und damit stecken wir mitten in den Dilemmata der postsowjetischen Konstellation, dem Kampfboden, auf dem sich unser ukrainischer Preisträger wie unsere Moskauer Preisträgerinnen bewegen.
Der Auftritt von Pussy Riot, der mit Lager bestrafte Muschi-Aufstand in der Erlöserkirche also, war die Antwort auf die offensichtlichen Manipulationen zugunsten der erneuten Wahl von Putin zum Präsidenten, nachdem er schon zwei Amtszeiten und die Zwischenzeit bis zur erneuten Wahl zum Präsidenten als Ministerpräsident hinter sich gebracht hatte. Öffentliche Demonstrationen gegen Putins Wiederwahl wurden schikaniert und gewaltsam unterbunden, die Medien trommelten fast unisono für Putins Wiederwahl, Patriarch Kirill bezeichnete die Wahl Putins gar als Christenpflicht.
In dieser Situation richtete sich die Aktion von Pussy Riot gegen eine entscheidende Nahtstelle der Machtbasis des Putin-Regimes, gegen die Verknüpfung der führenden Kräfte der orthodoxen Kirche mit dem Kremlherrscher. Das Motiv war durch und durch politisch, und die Aktion wollte als öffentlicher Protest wahrgenommen werden. Natürlich konnte diese Aktion nicht öffentlich angekündigt werden, wenn sie nicht schon im Vorfeld unterbunden werden wollte. Sie konnte auch nicht im hellen Licht der Öffentlichkeit, sondern nur im Dämmerlicht der Christ-Erlöser-Kirche durchgeführt werden. Pussy Riot musste außerdem selber dafür sorgen, dass die Aktion öffentlich bekannt wurde. Das taten sie mit Hilfe von Video und Internet.
Gemeinsam ist dem Maidan und der Aktion von Pussy Riot der öffentliche Protest. Zugleich zeigt sich der große Unterschied zwischen den Bedingungen des Protests. In Kiew konnte der zentrale Platz zum Zentrum des öffentlichen Protests werden und monatelang besetzt gehalten werden. Pussy Riot musste klandestin vorgehen, um dann erst im Internet seinen öffentlichen Platz zu erobern. Der Maidan wurde zum Ort einer mehr oder weniger ununterbrochenen assenveranstaltung, bei der der gemeinsame Protest ganz leibhaftig als Kampfgemeinschaft gelebt werden konnte. Davon konnte bei der Aktion von Pussy Riot keine Rede sein. Sie landeten bis zum Prozess im Gefängnis.
Umso höher ist ihr Mut einzuschätzen, und umso erstaunlicher ist die öffentliche Wirkung, die sie erzielten. Dazu musste es ihnen gelingen, nach monatelanger Haft den Gerichtsaal als Bühne zu nutzen. Diese Bühne stand unter Zwangsverfassung. Dennoch gelang es ihnen, ihre Aktion zu begründen und zu verteidigen und in ihren Schlussworten ihr politisches Denken darzulegen. Marija Aljochina meinte, der Prozess spreche Bände und bezeichnete ihn als »eine heimtückische und groteske Maskerade« und klagte die Nichtexistenz eines Rechtsstaates an. Sie sagte: »Nachdem ich fast ein halbes Jahr hinter Gittern verbracht habe, weiß ich, dass das Gefängnis einfach Russland im Miniaturmaßstab ist. … Da ist keinerlei horizontale Verteilung von Aufgaben, die das Leben jedes Einzelnen spürbar erleichtern könnten. Und da ist das Fehlen jeder Eigeninitiative. Denunziation geht einher mit gegenseitigen Verdächtigungen. Im Gefängnis ist – wie in unserem ganzen Land – alles darauf ausgerichtet, den Menschen seiner Persönlichkeit zu entkleiden und ihn einzig mit seiner Funktion zu identifizieren, egal ob er nun Arbeiter oder Gefangener ist.« Die Frauen von Pussy Riot nahmen so unter immensem Druck den Gerichtssaal als letzten Ort einer bis auf das Äußerste reduzierten Öffentlichkeit wahr. Das verlangte viel Mut, aber auch einen klaren politischen Verstand.
Es geht derzeit beim Schreiben über die Vorgeschichten und die Nachwirkungen des Maidan ebenso wie bei Pussy Riot, ihrer damaligen Aktion, ihrer Verteidigung im Gerichtssaal und ihrer ungebrochenen Haltung im Lager und dem Einsatz für die Mitgefangenen nach ihrer Freilassung, wenn nicht direkt um ein gemeinsames politisches Ziel, so doch um das gleiche immense Problem: um Russland als Machtregime im postsowjetischen Raum. Und dieses russische Machtregime hat – freundlich ausgedrückt – derzeit das Zeug zum gesamteuropäischen und globalen Problem.
In dem von Juri Andruchowytsch in der »edition suhrkamp« herausgegebenen Band mit dem Titel Euromaidan findet sich ganz am Ende ein Aufsatz des polnischen Schriftstellers Andrzej Stasiuk: »Ein Staat ›unterwegs‹«. Der Aufsatz ist voller Sorge gegenüber Russland, aber es fehlt auch nicht an Empathie. Stasiuk schreibt: »Mich reizt die Idee Russlands als eines uneindeutigen Staates. Eines Staates, der zu Europa ebenso gehört wie zu Asien. Eines Staates mit definierten Grenzen, der zugleich beweglich ist, eines Staates ›unterwegs‹. Mir fällt immer der alte Witz aus sowjetischer Zeit ein: An wen grenzt die Sowjetunion? An wen sie will! In diesem Witz steckt eine tiefere Wahrheit, denn die Geschichte Russlands ist eine Geschichte, die mehr im Raum als in der Zeit spielte, es ist eine Geschichte, die im Grunde Geographie ist.«
Als frühe Illustration des Staates unterwegs mag ein Zitat aus Puschkins Die Reise nach Arzrum während des Feldzugs im Jahre 1829 dienen. Puschkin schreibt: »Noch nie hatte ich ein fremdes Land gesehen. Die Grenze hatte für mich etwas Geheimnisvolles; von Kind an waren Reisen mein Lieblingstraum. Lange habe ich ein Nomadenleben geführt, mal im Norden, mal im Süden umherstreifend, doch noch nie war ich über die Grenzen des unermesslichen Russland hinausgekommen. Heiter ritt ich hinein in den gelobten Fluss, und mein braves Ross trug mich ans türkische Ufer. Doch dieses Ufer war bereits erobert: ich befand mich noch immer in Russland.«
Der gelobte Fluss ist keine Grenze, sondern nur ein Hindernis, das der Staat unterwegs in ein neues Russland zu überwinden hat. Stasiuks Folgerung aus seinen Überlegungen zu Russland als »Staat unterwegs« lesen sich so: »Wir waren davon ausgegangen, dass Russland ein Staat wie unsere Staaten sei, mehr oder weniger, nur größer, tollpatschiger, rückständig und ein bisschen exotisch. Man müsse nur geduldig auf Russland einwirken, ihm gut zureden und es erziehen, damit es diesen Rückstand aufholt. Dem ist wohl nicht so. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir nicht an unsere eigene Fortsetzung grenzen. Wir grenzen an etwas anderes.«
Gleichzeitig meint Stasiuk: »Europa wird nie einen anderen Nachbarn haben. Umziehen kann es nicht. Mich als Polen freut es sogar, es nimmt meiner Heimat einen Teil der Last ab. Wir sind heute nicht mehr (hoffe ich doch) alleingelassen mit dem russischen Nachbarn. Da es nicht wegziehen kann, wird Europa lernen müssen, im russischen Schatten zu leben.«
Um aber in diesem Schatten leben zu können, ist es notwendig zu verhindern, dass er sich nach außen immer weiter ausdehnt und nach innen immer dunkler wird. Und deshalb ist es folgerichtig, Pussy Riot, die sich mit ihrer Aktion gegen das Schutz-und-Trutz-Bündnis von Kirche und Staat in der Unterdrückung von liberalem Recht und Freiheit gewandt haben, und Juri Andruchowytsch als Verteidiger und Exponenten der ukrainischen Unabhängigkeit gleichermaßen zu preisen.
Ein bisschen harsch äußerte sich Juri Andruchowytsch 2006 in der polnischen Gazeta Wyborcza über die EU – er ist eben kein bequemer Preisträger und wird es wohl auch nicht werden –, sie sei »eine Ansammlung postimperialer Loser, die es nicht im Alleingang geschafft haben, Supermacht zu werden« (zit. nach Perlentaucher). Zum Glück möchte man sagen: Die westeuropäischen Kolonialmächte wurden durch die antikoloniale Befreiung auf die Mutterländer zurückgeschnitten, das heißt auf begrenzte Staaten, die ihre Grenzen an anderen begrenzten Staaten finden, nachdem zuvor schon das potenziell ohne innere Schranken und ohne akzeptierte Grenzen im Osten sich ausbreitende deutsche Kontinentalreich in zwei Weltkriegen in den Grenzen Westdeutschlands und Österreichs zum »postimperialen Loser« geworden war, das heißt zu zwei dauerhaft begrenzten Staaten. Mit der Anerkennung der Grenze zu Polen bleibt auch das vereinigte Deutschland ein glücklicher postimperialer Loser, der als Gleicher unter Gleichen immer noch gut in die EU passt.
In der postsowjetischen Konstellation war und ist zwar völkerrechtlich alles klar. Schon die Republiken der UdSSR waren formell unabhängige Staaten in eindeutigen Grenzen. Das erleichterte ihre Unabhängigkeitserklärungen. Die Unabhängigkeit mündete nicht sofort in Grenzkriegen. Aber auch heute sind sie sich trotz OSZE und UN ihrer Unabhängigkeit nicht sicher.
Russland macht sich wieder auf den Weg und kann dabei die Widersprüche innerhalb der früheren Sowjetrepubliken nutzen. Die postsowjetische Konstellation ist keine postimperiale. Selbst abgesehen von seinen Expansionsbestrebungen bleibt Russland auch in seinen eigenen Grenzen ein multinationales Imperium unter russischer Vorherrschaft. Schließlich wurde Putins erster Krieg, der Tschetschenienkrieg, innerhalb der russischen Staatsgrenzen geführt. Für Russland mag seine Expansion durchaus als Fortsetzung des Gleichen erscheinen. Durch Eroberung ändert sich seine Politik. Sie wird aggressiv. Aber seinen Charakter ändert Russland damit nicht. Von innen aus gesehen ist es wieder unterwegs wie es immer schon unterwegs war. Von außen gesehen erscheint es als der Aggressor, der es ist.
Putin hielt neulich bei der Enthüllung eines Denkmals für Alexander I. eine Rede. Er pries ihn als Wegweiser. Alexander I. sei als Mann, der Napoleon besiegte, in die Geschichte eingegangen. Als vorausschauender Politiker und Diplomat, als politischer Führer sei er sich seiner Verantwortung für die sichere Entwicklung Europas und der Welt voll bewusst gewesen. In dieses Gewand eines Retters Europas und Schöpfers eines neuen Gleichgewichts in der Welt möchte Putin gern hineinwachsen. Seine Ambition ist ein bisschen lächerlich, aber auch ziemlich gefährlich. Schon Alexander I. war eine Geißel für Europas Freiheit, vor allem für die Freiheit der Polen.
Die Wiederbelebung des imperialen Furors in und durch Russland ist das gemeinsame Problem der unabhängigen Ukraine und der unabhängigen russischen Zivilgesellschaft. Wie der Maidan bewies, ist dabei die ukrainische Unabhängigkeitsbewegung in der besseren politischen Situation als die russische Zivilgesellschaft. Das zeigt sich unter anderem am Beispiel von Pussy Riot und ihrer schwierigen Geschichte. Natürlich ist eine so freche Opposition junger Frauen in einer autoritären Gesellschaft von Isolation bedroht.
In der postsowjetischen Konstellation bleiben die Kämpfe um die äußere Begrenzung des Kremlregimes und die inneren Grenzen seiner Macht direkt miteinander verbunden, wie zuletzt die Annexion der Krim zeigte. Die Zustimmungsraten zu Putins Herrschaft in Russland verließen ihren vorübergehenden Tiefstand und erreichten Rekordhöhen. Da ist es den Frauen von Pussy Riot hoch anzurechnen, dass sie sich weiterhin eindeutig gegen Putins Regime aussprachen und sich mit der Ukraine solidarisierten. Sie sind Teil der Kräfte, die sich in einer öffentlichen Demonstration in Moskau gegen die Annexion aussprachen und damit den chauvinistischen Konsens durchbrachen. Die beiden Frauen von Pussy Riot wurden durch die Lagerhaft nicht gebrochen. Sie bleiben klarsichtig und entschieden, im Übrigen auch bescheiden. Jeder könne zu Pussy Riot werden. Man müsse sich nur eine Pudelmütze überziehen.
Soweit zum politischen Zusammenhang der Verleihung des HannahArendt-Preises für politisches Denken gemeinsam an die Frauen von Pussy Riot und Juri Andruchowytsch. Obwohl sich die Frauen von Pussy Riot anders als die Frauen von Femen bei ihren Aktionen nicht entblößen, sondern verhüllen, werden sie schnell zum Opfer sexistischer Angriffe. So beschimpfte sie der tschechische Präsident neulich in Anlehnung an eine etwas einseitige Übersetzung von Pussy als »Huren«. Mit einem Aufstand der Pussys hat er seine Schwierigkeiten. Riot versuchte er also gar nicht erst zu übersetzen. Manche prangern die angebliche Unsensibilität gegenüber dem Christentum an. Dabei war es unüberhörbar, dass die Frauen in ihrem Song die Mutter Maria anriefen, sie möge Putin vertreiben. Und Putin ist kein Heiliger. Da war der Ort für ihr Punkgebet mit der Kathedrale doch gar nicht schlecht gewählt. Es ging um die Vertreibung eines Lästerers aus dem Tempel, und gegen die Pharisäer als Tempelhüter. Der Protest galt dem ganz weltlichen Handel zwischen Kirill und Putin. Der Protest von Pussy Riot ist provokativ, aber nicht brutal. Er nimmt Kunstform an und bedient sich der globalen Sprache des Pop in Musik und Gestik. Zu Recht stellten die Frauen vor Gericht ihre Verfolgung in die traditionelle, lang anhaltende und erneut verschärfte Unterdrückung der künstlerischen Avantgarde in Russland.
Juri Andruchowytsch ist ein langjähriger Vordenker, in diesem Fall kann man das sagen, der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung, die in der orangenen Revolution und im Euromaidan ihre öffentliche Plattform fand. Er hat sehr kluge und feinsinnige Essays über die ukrainische Topographie, die natürliche und die politische, geschrieben. Man kann diese Essays in ihrer Ironie, Beharrlichkeit, in ihrer intellektuellen Mixtur aus Metaphysik und politischem Klartext, aus Mythos und Utopie vielleicht romantische Texte nennen. Es sind Texte, an denen man sich reiben kann. Und es sind Texte, die uns die Geschichte, die Lebens- und Leidenswelt und die denkerische Gemengelage in der Ukraine – die Menschen und Mythen, ihre Hoffnungen und Ängste – in den letzten Jahrzehnten immer wieder nahegebracht, ja, das Schicksal der Region in unserem Bewusstsein präsent gehalten haben. Sie weichen Ambivalenzen nicht aus. So stellte Andruchowytsch einmal die These auf, die Erweiterung der EU am 1. Mai 2004 habe sein »Ostmitteleuropa, zwischen verschiedenen Zentren zerrissen und geteilt«. Ostmitteleuropas »Ambiguität, das ›Dasein dazwischen‹«, verschwinde »auf allen Ebenen – von der Unifizierung der Landschaft zur Pragmatisierung der Mentalitäten«. Ich glaube mit dem »Dasein dazwischen« spricht Andruchowytsch das existenzielle Problem seines Ostmitteleuropas an, in dem jede einseitige Erweiterungspolitik von einem der Zentren aus, sei es Brüssel, das nie ein Zentrum war, oder Moskau, das »praktisch kein Zentrum mehr ist, aber um jeden Preis diesen Anschein erwecken will«, scheitern und zur Spaltung führen wird. Das Problem steckt in geografischen und politischen Tatsachen und ist keine Sache des bloßen Meinens.
Auch wenn sich die Verleihung eines Preises für politisches Denken vor allem auf die Essays von Juri Andruchowytsch stützt, die in drei Bänden der »edition suhrkamp« nachzulesen sind, gilt der Preis auch seinem Werk als Romancier. Denn, so lautet eine unvergängliche Hoffnung, die Arendt gerne zitierte, Erzählungen könnten vielleicht die gleiche Wirkung haben wie die Taten, von denen sie handeln. Außerdem hat Literatur, das ist eine eminent politische Funktion, die Fähigkeit, auch solche Ideen und Hoffnungen in uns wach zu halten, die in der Gegenwart ausgestorben scheinen.
Im Zusammenhang mit einem Preis für politisches Denken ist vielleicht als erstes Andruchowytsch’s Roman Moscoviada zu nennen, der den multinationalen Charakter der Sowjetunion und ihre Vereinheitlichung im trübsinnig geistreichen Suff spüren lässt. Hier wird am Beispiel von Insassen, so muss man es wohl nennen, eines Moskauer Studentenheimes gezeigt, wie die Verkommenheit des Imperiums die Individuen beschädigt, auch wenn sie nichts mit dem Imperium am Hut haben. Der Roman spielt vor der Auflösung der UdSSR und er wurde geschrieben in der Zeit ihrer Auflösung. In der Moskauer Bierhalle geht das Plädoyer für die »völlige und endgültige Loslösung der Ukraine von Russland« dem Protagonisten ganz leicht von den Lippen: »Hoch lebe die unverbrüchliche Freundschaft zwischen dem ukrainischen und dem russischen Volk! Glaubt mir – zwischen diesen beiden Aussagen besteht keinerlei Widerspruch.« Nach kurzer, angespannter Stille bricht »unglaublicher, bodenloser, grenzenloser Applaus« unter den Gästen und dem Personal der Bierhalle aus. Alles wird gut. Es wurde aber nicht alles gut. In einem Postskriptum zur deutschen Ausgabe aus dem Jahr 2006 schreibt Andruchowytsch, er habe seinerzeit geglaubt, sobald er den Roman fertiggestellt hätte, »wären die imperialen Gespenster vertrieben und nur noch hölzerne Schaufensterpuppen übrig, aus denen Sägespäne rieseln«. Aber es handle sich gar nicht um Gespenster, merke er nun vierzehn Jahre nach der Niederschrift des Romans. Man konnte die imperialen Gespenster beschreiben, aber nicht wegschreiben.
Juri Andruchowytsch hat neulich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erneut nach Westen ausgeschlagen und den ukrainischen Heroismus dem in der EU und im Westen vielleicht vorherrschenden, wohlstandsgesättigten Postheroismus gegenüber gestellt. Ich sagte ja, der Preisträger kann klotzen:
»Es gibt kaum Berührungspunkte zwischen uns, der Ukraine und Europa. Europa hat in seiner absolut erfolgreichen Entwicklung das Endziel erreicht, es ist vor allem zu einer Zone des Wohlstands, Komforts und der Sicherheit geworden, oversecured, overprotected, overregulated, ein Territorium aufgeblähter und irgendwie beigelegter Konflikte, politisch korrekt und steril. In der Ukraine aber wird Blut vergossen, und das ist noch milde ausgedrückt, denn wenn ich anfinge, hier zur Veranschaulichung zu beschreiben, auf welche Art Blut vergossen werden muss, dann würden Sie erschrecken«, sagte er zur Eröffnung der Internationalen Buchmesse in Wien. Er habe einen »bösen Verdacht«: Die EU fürchte die Ukraine letztlich, so meint er, weil sie mit ihren existenziellen Problemen die EU aufschrecke und verstöre. Die Ukraine sei zum Gewissensbiss der EU-Bürgerinnen und -Bürger geworden. Dazu passte die Überschrift, die die FAZ der Rede verpasste: »Wir reden über Werte, ihr redet über Preise«. So ohne Ironie habe ich Juri Andruchowytsch noch nie lesen müssen.
Vielleicht darf ich zum Schluss für die Jury gegenüber unseren Preisträgerinnen in Moskau unsere Bewunderung für ihren Mut in Auseinandersetzung mit einem autoritären und brutalen Regime und gegenüber unserem Preisträger aus der Ukraine unsere Hoffnung auf einen Erfolg bei der Verteidigung von Demokratie und Unabhängigkeit gegen die äußere Aggressionspolitik des Kremlregimes zum Ausdruck bringen. Die reale Distanz zwischen der Situation hier und der postsowjetischen Konstellation als Kampfboden unserer Preisträgerinnen in Moskau und unseres Preisträgers aus der Ukraine lässt sich nicht durch Worte und auch nicht durch einen Preis für politisches Denken überbrücken. Ich denke, wir wären alle froh, wenn wir überall ohne Heroismus auskommen könnten. Freilich kann man sich nicht einmal sicher sein, dass wir uns das in der EU auf die Dauer leisten können. Der HannahArendt-Preis geht in den Osten, im Bewusstsein, dass es derzeit gerade dort um die Zukunft Europas geht.
»Hagel«, »Tornado«, »Hurrikan«.
Der chimärische Krieg
Ich möchte diesen zweifellos festlichen und für mich freudigen Anlass nutzen, um Ihnen etwas mehr über gewisse Aspekte jenes Konfliktes zu erzählen, der hier meistens »Krise in der Ukraine« genannt wird. Mir scheint, dass es sowohl im Umfeld dieses Konfliktes als auch in seinem Inneren furchtbar viele Dinge gibt, von denen Sie kaum etwas wissen, weil Medien und Politiker Sie nach ein und denselben Schemata und Schablonen informieren: Geopolitik; Einfluss- und Interessenszonen; russisch-amerikanisches Tauziehen; die Ukraine als hoffnungslos geteiltes, unzurechnungsfähiges Land; wirtschaftliche Gründe für das »PutinVerstehen«; sichere Gasversorgung.
Aber die Ukraine ist mehr als ein Territorium für den Gastransit zwischen Russland und Europa. Sie ist ein Land mit einer eigenen, extrem schwierigen und tragischen Geschichte und einer neu gefundenen Identität. Sie ist also viel komplizierter, als es scheint, und sie verdient Ihre Aufmerksamkeit. In der Ukraine wird heute ein Re-Make des historischen Dramas aufgeführt, in dem Zentraleuropa als Territorium fungiert, wo die autokratischen Werte zum wiederholten Male einen Angriff gegen die liberalen starten. Außerdem vollzieht sich in der Ukraine vor unseren Augen das Werden einer neuen europäischen Gesellschaft.
Diesem Werden wird harter, grausamer Widerstand entgegengesetzt – sowohl von außen, als auch im Innern des Landes. Aber letztlich sind sowohl die im Innern als auch die von außen Elemente ein und derselben zerstörerischen Spezialoperation.
Darum ist es ein schmerzhaftes Werden. Um es zu stoppen, schreckt unser Nachbarstaat nicht einmal vor militärischer Einmischung zurück. Sein Präsident hat sich in diesem Konflikt, den er selbst mehr als zehn Jahre lang vorbereitet und geschürt hat, die Rolle des strengen, aber gerechten Schiedsrichters auf den Leib geschrieben. Aber diese Rolle gelingt ihm nicht oder nur äußerst schlecht – so schlecht, dass ihm offenbar nur noch die Herren Schröder, Berlusconi, Gorbatschow und andere, heute schon legendäre Helden der Realpolitik glauben können.
Ein Interview des russischen Präsidenten, das dieser vor kurzem erst, Mitte November 2014, einem deutschen Fernsehsender gegeben hat, ist das perfekte Beispiel für seine ebenso scham- wie hilflose Verdrehung der Tatsachen. Putin benimmt sich vor dem deutschen Fernsehpublikum genauso wie vor dem heimischen russischen, das ja bekanntlich sogar zu glauben bereit ist, das die malaysische Boeing 777 schon vor dem Abflug nicht mit lebendigen Passagieren, sondern mit menschlichen Leichen beladen war. Aber zurück zum Interview für das deutsche Fernsehpublikum, in dem der russische Präsident unter anderem folgendes sagte: »Im Osten der Ukraine finden Kämpfe statt. Die ukrainische Zentralmacht hat die Armee dorthin entsandt, sogar ballistische Raketen kommen zum Einsatz. Und wird darüber etwas gesprochen?« – Er macht eine Pause und setzt theatralisch den Punkt.
»Kein Wort.«
In Wirklichkeit wurde schon im Sommer von den ballistischen Raketen gesprochen, zum Beispiel auf CNN. Die Information wurde von der ukrainischen Regierung sofort dementiert, die erklärte, dass »die letzte Rakete, die gemäß internationaler Klassifizierung als ballistisch gelten kann und eine Reichweite zwischen 500 und 1000 Kilometer hat, in der Ukraine am 1. Juli 1996 zerstört wurde, und zwar im Rahmen eines von den USA finanzierten Abrüstungsprogramms. In der Ukraine gibt es solche ballistischen Raketen nicht.«
In Wirklichkeit – und dieser Ausdruck muss sehr häufig gebraucht werden, wenn man den russischen Präsidenten kommentiert – kämpfen in der Ukraine seine, Putins, regulären Militäreinheiten – und sie kämpfen nicht nur mit Raketenwerfersystemen mit so sprechenden Namen wie »Hagel«, »Tornado« und »Hurrikan«, sondern auch mit nagelneuen T-90-Panzern. Aber davon kommt dem russischen Präsidenten wirklich »kein Wort« über die Lippen.
Warum reagiert Putin so aggressiv auf die Ukraine? Warum konzentriert Russland heute seine gesamte Außenpolitik auf den Krieg gegen uns und darauf, den Rest der Welt in großem Stile bezüglich dieses Krieges hinters Licht zu führen?
Es gibt Lügen. Es gibt große Lügen. Es gibt schamlose und schamlos große Lügen. Und es gibt die Lüge in Reinform – die russische Propagandamaschine.
Da haben Sie, grob gesagt, die gesamte Außenpolitik.
In Wirklichkeit (wieder dieser Ausdruck!) geht es Putin vor allem um etwas, das er mehr als alles fürchtet. Ich zitiere aus den Nachrichten: »Der russische Präsident bezeichnet die ›Farbrevolutionen‹, die in einer Reihe von Ländern stattgefunden haben, als Lehre und Warnung für Russland und verspricht, alles Notwendige zu tun, damit in Russland nichts dergleichen passiert.« (Hervorhebungen von mir, J. A.) So tut er zum Beispiel im Osten der Ukraine »alles Notwendige«. Unter anderem mit Hilfe von Mehrfachraketenwerfern »Hagel«, »Tornado« und »Hurrikan«.
Die zitierte Erklärung über »Lehre und Warnschuss« für Russland hat Putin nicht irgendwo abgegeben, sondern auf einer Sitzung des russischen Sicherheitsrats. Weiter sprach er davon, dass der Extremismus in der heutigen Welt als »Instrument der Geopolitik und der Verschiebung von Einflusszonen« benutzt wird. Natürlich – was sonst sollte einen gewissenhaften Schüler des geopolitischen Genius aller Zeiten und Völker, Professor Alexander Dugin, beschäftigen! Geopolitik und Einflusszonen – das ist es, was dem russischen Präsidenten keine Ruhe lässt.
»Wir sehen«, fährt er fort, »zu welchen tragischen Folgen die Welle sogenannter Farbrevolutionen geführt hat, welche Erschütterungen die Völker jener Länder durchlebten und weiter durchleben, ausgelöst von verantwortungslosen Experimenten, von versteckter, manchmal auch brutaler, tumber Einmischung in ihr Leben.«
Alles ist haargenau umgekehrt. In mein persönliches Leben, wie auch in das Leben vieler Millionen anderer Menschen, hat er, Wladimir Wladimirowitsch Putin, sich tumb und brutal eingemischt, er, dessen Reagieren auf unsere »Farbrevolution« mehr als krankhaft ausfiel. Eine äußerst präzise Bewertung hat kürzlich Herta Müller in einem Interview für die dänische Zeitung Dagens Nyheter vorgenommen:
»Putins Sozialisation im KGB ist in den letzten Jahren immer mehr zum einzigen Maßstab seines politischen Handelns geworden. Er sieht überall im In- und Ausland Feinde, weil er die Welt nicht anders begreifen kann. Und er braucht Feinde, die man anlügen und austricksen muss, um die sogenannten russischen Interessen durchzusetzen. Und damit inszeniert er sich als Retter der slawischen Werte, die von der dekadenten westlichen Kultur – also von uns – bedroht werden.« Und etwas weiter unten im Interview: »Putins einziger und größter Gegner ist die westliche pluralistische Gesellschaft, die Freiheit des Individuums und die Unabhängigkeit der Justiz – also die Demokratie, in der wir gerne leben. Und in der auch die Menschen in der Ukraine gerne leben würden. Transparenz und Geheimdienst – einen größeren Widerspruch kann es kaum geben.«
Als absoluter Geheimdienstler handelt Putin im Regime von Spezialoperationen. Darum trägt sein Krieg gegen die Ukraine einen so chimärischen Charakter. Hybride Kriegsführung, wie man jetzt zu sagen pflegt.
Aber bei aller Geheimhaltung dieses Spezialkrieges – die Soldaten und Panzer, die er in den Osten der Ukraine schickt, lassen sich nicht verbergen. Sogar der OSZE-Mission fallen sie inzwischen auf. Und die britische Botschaft in Kiew hat eine Instruktion veröffentlicht, die, so die Diplomaten, »dem Kreml helfen soll, seine Panzer in der Ukraine zu finden«. David Liddington, britischer Europaminister, erklärt Folgendes: »Der Kreml hat Hunderte Soldaten in die Ukraine geschickt, Tausende an ihren Grenzen versammelt und versorgt seine Marionetten im Osten mit Waffen und Panzern in unbegrenzter Zahl. Das ist keine Annahme, sondern eine Tatsache. Wir verfügen über Satellitenaufnahmen, Fotografien von Menschen vor Ort, Berichte der OSZE-Mission und Berichte von Augenzeugen. Die russischen Versuche, dies zu leugnen, sind unglaubhaft.«
Panzer sind Panzer, sie lassen sich nicht verbergen. Aber die Soldaten, die Gefallenen, müssen doch begraben werden. Unabhängige Quellen russischer Menschenrechtsverteidiger sprechen schon von an die tausend Gefallenen unter den russischen Soldaten des »Donbass-Feldzugs«. Also offiziell kämpft Russland bei uns nicht, die russische Armee ist nicht da, aber die Leichen russischer Soldaten sind es. Wohin mit ihnen? Am besten sie in Stollen stapeln, in anonymen Gräbern verscharren. Ein Soldat – verschwunden. Vielleicht hat es ihn nie gegeben. Den Verwandten kann man, unter absoluter Geheimhaltung, mitteilen, dass ihr Sohn, Mann, Bruder einen Herzschlag erlitten hat oder überhaupt im Urlaub an der Hitze gestorben ist. Wie sagte einst der legendäre russische Marschall Schukow, als er weitere Kompanien, Bataillone und Heere der Roten Armee in den sicheren Tod schickte: »Russland ist groß, die Weiber werden neue Soldaten gebären.« Wenn der russische Präsident nicht nur grundlegende Rechte, sondern sogar das Leben seiner eigenen Bürger so missachtet, was ist dann von ihm zu erwarten, wenn es um ukrainische Bürger geht?
Nach neuesten Erkenntnissen sind derzeit nicht weniger als 700 dieser ukrainischen Bürger Geiseln oder Gefangene der Terroristen. Sie werden gefoltert und erniedrigt. Die Erzählungen derjenigen, die befreit werden konnten, hinterlassen den furchtbaren Eindruck eines zügellosen Re-Makes des entsetzlichsten Mittelalters. Im Sommer füllte man mit ihnen die erstickenden Keller der Verwaltungsgebäude, wo sie sich Wochen und Monate quälten, geschlagen und gebrochen, ohne Licht und Luft, oft ohne Wasser und Essen und meist ohne jede medizinische Versorgung. Jetzt naht der Winter, und es ist noch schrecklicher, sich all das vorzustellen. Unter ihnen sind Frauen und Minderjährige. Es wird berichtet, dass Frauen mit Maschinengewehren vergewaltigt wurden. Das ist keine Metapher.
Um die Atmosphäre der Angst in den besetzten Gebieten aufrecht zu erhalten haben die Separatisten die Todesstrafe eingeführt. Das geschieht auf dem Territorium eines Landes, das Mitglied des Europarats ist und dessen Verfassung die Todesstrafe verbietet. Wie die Führer der Separatisten vor einigen Tagen in ihren Fernsehsendern verkündeten, werden die Entscheidungen über Todesurteile von nun an von »besonderen Trios« (Stalin lässt grüßen) aus – Obacht! – »Feld-Militär-Richtern« gefällt. Niemand kann sagen, wie viele Todesurteile schon vollstreckt wurden. Aber es kommt genug Material für einen langen und an entsetzlichen Fakten überreichen Prozess in Den Haag zusammen.
Im siebten Bericht des UN-Hochkommissars für Menschenrechte heißt es, die »bewaffneten Gruppierungen fahren fort, Menschen unrechtmäßig gefangen zu halten, Hinrichtungen ohne Urteil zu vollstrecken, zu Zwangsarbeit zu zwingen, sexuelle Gewalt anzuwenden und persönlichen Besitz zu vernichten oder zu konfiszieren. Tausende Menschen gelten als vermisst, dauernd werden neue, anonyme Gräber gefunden, aus denen die Leichen zur Identifizierung exhumiert werden.«
Ein weiterer Aspekt dieses Hybridkrieges besteht darin, dass nicht weniger als zwei Dutzend ukrainische Bürger, die auf dem Gebiet ihres Landes gefangen genommen oder entführt wurden, inzwischen rechtswidrig in russischen Gefängnissen festgehalten werden. Es versteht sich, dass sie genauso rechtswidrig dorthin verbracht wurden – meist aus den von den Separatisten kontrollierten Gebieten. Die russischen Anwälte dieser Gefangenen berichten, dass einige von ihnen gefoltert werden – vor allem, um sie zu zwingen, von »Verbrechen des ukrainischen Militärs gegen die Zivilbevölkerung des Donbass« zu erzählen. Am längsten wird der stellvertretende Vorsitzende der Partei UNAUNSO, Mykola Karpjuk, in Russland festgehalten. Ihn hat man schon im März im weit vom Donbass entfernten Tschernigower Oblast entführt. Im April wurden auf der Krim vier weitere Ukrainer rechtswidrig festgenommen: der Filmregisseur Oleg Senzow, der Geschichtslehrer Oleksij Tschyrnij, der Fotograf Gennadij Afanasjew und der Aktivist Oleksandr Koltschenko. Notieren Sie diese Namen, merken Sie sie sich – nicht ausgeschlossen, dass gerade jetzt, in dieser Minute, einer von ihnen in einem Moskauer Untersuchungsgefängnis unaussprechliche Folterqualen erleiden muss. Die bekannteste Gefangene ist eine Frau, die Militärpilotin Nadija Sawtschenko, die seit dem 18. Juni in Gefangenschaft ist. Die Separatisten haben sie im Gebiet Luhansk entführt und den russischen Geheimdiensten übergeben. Organisiert und persönlich geleitet wurde die Operation vom derzeitigen »Oberhaupt der Luhansker Volksrepublik«.
Braucht es noch weitere Beweise, dass die Donbasser Separatisten direkt und absolut vom Kreml gesteuert werden? Was heißt hier »Volksrepubliken«, »Aufständische«, »Rebellen«? Es sind Verbrecher und banale Marionetten!
Ein weiterer Aspekt, den ich hier nennen muss, ist die Lage auf der Krim insgesamt und die ihres indigenen Volkes im Besonderen. Flüchtlinge von der Krim und Menschenrechtsaktivisten haben eine interaktive Karte angefertigt, auf der alle Fälle von Menschenrechtsverletzungen auf der Halbinsel eingetragen sind. Seit dem 24. Februar (dem Beginn der russischen Intervention) bis heute wurden 103 Verletzungen von bürgerlichen und politischen Rechten festgestellt, 70 Verletzungen der Rechte der indigenen Völker und nationalen Minderheiten, 65 Verletzungen kultureller und religiöser Rechte und 139 Verletzungen sozialökonomischer Rechte. Wenn im Frühling, zu Beginn der Okkupation der Krim, überwiegend pro-ukrainische Aktivisten verfolgt wurden, so verstärkt sich in letzter Zeit vor allem der Druck auf die Krimtataren. Sie wissen, dass dieses Volk schon einmal auf Befehl Stalins aus seiner Heimat deportiert wurde. Heute bemüht sich die Okkupationsmacht, für sie solche Lebensbedingungen zu schaffen, dass sie die Halbinsel auch ohne jede Deportation von oben freiwillig massenhaft verlassen. Seit Beginn der Okkupation wurden 21 Vertreter des Volkes der Krimtataren entführt, einige wurden später tot und mit Folterspuren aufgefunden. Die verbreitetste Art der – verzeihen Sie – Beute bei dieser Safari sind Kinder, Teenager und junge Männer krimtatarischer Nationalität.
Ich lese all diese offiziellen Erkenntnisse und versuche, nicht verrückt zu werden. Wo und mit wem geschieht all dies? Geschieht es wirklich bei uns, in meinem Land, in Mittelosteuropa? Oder hat der große geopolitische Schürer dieses Konfliktes genau das erreicht – uns für immer aus Europa zu drängen und in einen ganz anderen »Erdteil« zu treiben, irgendwo bei Afghanistan, Irak und Syrien? Im Bewusstsein vieler Europäer sind wir schon dort. Sie glauben, bei uns herrscht ewige Krise. »Die Krise in der Ukraine«.
Zurück zu den Entführungen mit darauf folgenden Folterungen und Morden. Diese sind charakteristische Elemente einer gewissen und klar erkennbaren Handschrift.
Und sind gleichzeitig eines der verbreitetsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das das Regime Janukowytsch so aktiv gegen uns auf dem Maidan anwendete, wobei es gewissenhaft die Instruktionen der Moskauer Führung befolgte. Die Menschen des Maidan verschwanden von Anfang an. Um den Maidan herum kreisten immer sogenannte Kerle sportlichen Typs und andere »Schleicher«. Unter meinen Freunden gab es niemanden, der nicht Anzeichen dafür bemerkte, dass er verfolgt und sein Telefon abgehört wurde. Es war äußerst gefährlich, sich in der Stadt einzeln oder in zu kleinen Gruppen zu bewegen – Leute mit Maidan-Symbolik konnten auf Schritt und Tritt angegriffen und von unbekannten »Hooligans« oder »Besoffenen« schwer zusammengeschlagen werden. Nur mitten auf dem Maidan konnte man sich mehr oder weniger sicher fühlen, hinter den Barrikaden, umgeben von Zehntausenden Gleichgesinnten. Manchmal aber musste man einfach nach draußen – heim, zu Verwandten und Freunden, Dinge erledigen. »Sie« beobachteten unsere Bewegungen genau. Auf diese Art wurde am 25. Dezember die bekannte Journalistin Tetjana Tschornowol angegriffen und auf brutale Art bewusstlos geprügelt (geplant war, sie zu Tode zu prügeln, aber sie hatte Glück). In der zweiten Januarhälfte geschahen einige der aufsehenerregendsten Entführungen. Das Regime und die ihm nahestehenden kriminellen Elemente machten ihre Beutezüge auch in Krankenhäusern, wo sich Maidan-Demonstranten wegen ihrer Verletzungen behandeln ließen, die sie sich bei den Auseinandersetzungen mit den Sondereinheiten der Polizei auf der Hruschewskyj-Straße zugezogen hatten. Aus dem Krankenhaus wurden der Aktivist Ihor Luzenko und der Lemberger Gelehrte und Reisende Juri Werbyckyj entführt. Mehrere Tage lang wurden sie in einem unbekannten Versteck im Wald bei Kiew gefoltert. Der von der Folter halb bewusstlose Luzenko wurde danach lebend aus einem Auto auf den Waldweg gestoßen und überlebte wie durch ein Wunder. Die entstellte Leiche Werbyckyjs wurde einige Tage später in eben jenem Wald aufgefunden.
Es wurde immer gefährlicher, in Kiew ein Krankenhaus aufzusuchen. Dort lauerten Polizei und Banditen auf solche wie uns. In jenen Tagen schrieb mir die hier schon einmal erwähnte Herta Müller: »Mich erinnert die Ermordung von Verletzten in den Kliniken an das Ende der Ceausescu-Diktatur. In Temeswar wurden auch viele Oppositionelle im Krankenhaus erschossen. Offensichtlich hat sich diese russisch-sowjetische Praxis auch in der Ukraine gehalten.« In meiner Antwort bemerkte ich, dass sich alles erhalten hat, und dass wir unseren Präsidenten schon seit geraumer Zeit nur noch »Januschescu« nennen.
Ja, es war eine entsetzliche repressive Maschinerie, deren Motor in Moskau saß. Es ist traurig und schrecklich, aber unmöglich zu verschweigen – 29 Teilnehmer des Euromaidan sind bis heute verschollen. Ohne Zweifel sind sie nicht mehr am Leben. Wo aber befinden sich ihre Leichen – verscharrt, verbrannt, irgendwie anders vernichtet? Was bleibt, ist der Glaube, dass alles Geheime einmal ans Licht kommt und keine Untat ungesühnt bleibt.
In Zusammenhang mit der soeben beschriebenen Atmosphäre konsequenter Einschüchterung, Verfolgung und praktisch pausenloser Eskalation durch die damalige Staatsmacht sticht ein weiterer Aspekt hervor – das Problem der Rechten. Es gibt sie tatsächlich. Während der revolutionären Ereignisse auf dem Maidan wurde der »Rechte Sektor« immer häufiger erwähnt. Er war Realität, kein Fake. Fake ist jedoch sein antisemitischer oder neofaschistischer Charakter. Als die Spezialkräfte der Polizei, denen die Straflosigkeit zu Kopf gestiegen war, im Januar des Jahres massenhaft zu foltern und zu erniedrigen begannen, als sie gezielt auf Frauen, Ärzte und Journalisten schossen, als die Auseinandersetzungen auf der Hruschewskyj-Straße wirklich bitter wurden vom Feuer und Rauch der brennenden Reifen, reichten die Kiewer Juden, wie alle anderen Kiewer, dem »Rechten Sektor« Molotow-Cocktails und Pflastersteine. Die Kiewer Rechten verteidigten die Kiewer Juden vor den Verbrechern in Polizeiuniform – was soll daran verwunderlich sein? Meiner Ansicht nach gar nichts, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass der Maidan so verschiedene gesellschaftliche Schichten, ethnische Gemeinschaften, sprachliche und weltanschauliche Gruppen vereinte, dass er die gesamte Ukraine abbildete in ihrer heutigen Kompliziertheit und Widersprüchlichkeit. Keine einzelnen Regionen, nicht etwa irgendwelche »Nationalisten«, sondern die ganze komplizierte und dramatisch zerschnittene soziale Struktur des Landes mit seinen Studenten, Bauern, Intellektuellen, Ultras, Anarchisten, mit seiner noch existierenden Arbeiterklasse, seinen Unternehmern, Afghanistan-Veteranen und Ex-Zachal-Offizieren, mit seinen fantastisch mutigen Frauen und allen anderen, den Ukrainisch- und den Russischsprachigen. Sogar die Krishna-Anhänger – diesen Anblick werde ich nie vergessen – kamen mit BaseballSchlägern zu uns auf den Maidan, um ihre Nächsten zu verteidigen, wie es Krishna Ardshuna gelehrt hatte.
Meine ausländischen Bekannten zweifeln. Zweifeln ist ein völlig positiver Charakterzug des echten Europäers. Als echte Europäer zweifeln also auch meine Bekannten. Sie fragen, ob es denn überhaupt möglich sei, dass das Gute nur auf einer Seite sei und das Böse auf der anderen. Ob nicht die Wahrheit irgendwo dazwischen liege?
Ich verstehe: Sie wollen nicht nur dem Kreml, sondern auch seinen Marionetten-»Separatisten« die Chance geben, nicht das absolut Böse zu sein. Das postmoderne Bewusstsein fordert den Konflikt auszublenden und negiert alles Schwarz-Weiße. »Militär-Feld-Richter«, Todesstrafe und Folter sind meinen Bekannten zu wenig. Sie suchen Schuldige auf beiden Seiten des Konflikts. Genau für solche Fälle existiert das wunderbare deutsche Wort »Ausgewogenheit«.
Putin kennt die Europäer, und er kennt diese Besonderheiten des europäischen ausgewogenen Denkens. Darum die schon erwähnte Schiedsrichter-Rolle. Ich erlaube mir noch einmal, aus seinem Interview fürs deutsche Fernsehen zu zitieren: »Ich sage Ihnen ganz offen, es ist kein Geheimnis, die Menschen, die gegen die ukrainische Armee kämpfen, sagen: ›Das sind unsere Dörfer, wir stammen von hier. Hier wohnen unsere Familien, unsere Freunde und Verwandten. Wenn wir abziehen, kommen die nationalistischen Bataillone und bringen alle um. Wir ziehen nicht ab, da müsstet schon ihr selbst uns umbringen.‹« Und weiter, wie es einem gerechten Schiedsrichter gebührt: »Natürlich versuchen wir, sie zu überzeugen, wir reden mit ihnen, aber wenn sie solche Dinge sagen, dann, verstehen Sie, gehen uns die Argumente aus.«
Aber was weiß Putin wirklich über diese Menschen und diese Dörfer? Mit wem spricht er eigentlich, und auf wen, außer Professor Dugin, hört er?
Das ist kein Bürgerkrieg, kein Krieg eines Teils der Ukrainer gegen einen anderen, noch weniger ist es ein Krieg des »russisch-sprachigen Ostens« gegen den »ukrainisch-sprachigen Westen«. Das Recht auf Muttersprache, wenn es gefährdet ist, verteidigt man mit dem Intellekt, nicht mit dem Gewehr. Sogar in der angeblichen »Hochburg der Separatisten«, Donezk, kamen noch im April zu proukrainischen Demonstrationen mehr Leute zusammen als zu »separatistischen«. Heute allerdings sind die meisten dieser Menschen nicht mehr in Donezk – sie wurden gezwungen wegzufahren, zu verschwinden, umzukommen. Einige von ihnen wurden unter den zu Tode Gefolterten identifiziert. Andere werden noch identifiziert werden.
Das ist kein Bürgerkrieg. Es ist der nicht erklärte Krieg des Staates Russland gegen seinen Nachbarn, die souveräne Ukraine. Und weil er noch nicht erklärt ist, wird er bisher mit begrenzten Kräften geführt.
Also bombardiert die russische Luftwaffe unsere Städte noch nicht, und von den »Mistral«, die Russland demnächst Frankreich abpressen und ins Schwarze Meer schicken wird, steigen noch keine Kampfhubschrauber auf. Es ist ein Krieg im Spezialoperations-Format, ein Krieg von Saboteuren und Sturmtruppen, paramilitärischen »Rekonstrukteuren« und Banditen, aber auch banalen Söldnern und einer wenig zahlreichen, aber gut bewaffneten fünften Kolonne. Es ist ihr Krieg gegen alles Demokratische, Liberale, Europäische, Westliche. Die postrevolutionäre Ukraine wurde zum ersten Opfer dieser Aggression, aber auch – unerwartet für den Aggressor – zum ersten ernsthaften Hindernis auf seinem Weg. Nicht nur, dass sie ihre Verteidigungslinie hält – sie wäre auch längst mit diesem »Bürgerkrieg« fertig geworden, wenn der Präsident des Nachbarlandes nur endlich aufhören wollte, die von ihm abhängigen »Aufständischen der Volksrepubliken« mit Panzern, »Tornados« und »Hurrikans« zu versorgen sowie mit regulären Armeeeinheiten.
Wie kann er gezwungen werden, damit aufzuhören?
Diese Frage, genauer: die gemeinsame Suche nach einer Antwort sollte heute Ukrainer und Europäer einen. Unterstützen Sie die Ukraine – nicht nur sie ist heute in Gefahr. Und nicht nur die baltischen Staaten, Polen oder Rumänien. Wir haben einen außergewöhnlich kleinen und, ehrlich gesagt, außergewöhnlich brüchigen und sensiblen Kontinent. Er glaubte, so wunderbar für seine Sicherheit gesorgt zu haben, in diesem Bereich so viel erreicht zu haben. Aber es genügt eine einzige Person im Kreml, und alles erzittert und erbebt.
In der Ukraine hat Europa gewonnen. Aber es wird vielleicht in Europa selbst verlieren – wenn Europa sich von sich selbst lossagt und sich durch eine Mauer von Unverständnis und Gleichgültigkeit von der Ukraine abschottet. Unser Land sollte vom Westen gerade jetzt als ein Teil Mitteleuropas betrachtet werden, als ein Vorposten des Westens, der heute nicht nur die eigene Freiheit und seine europäische Zukunft verteidigt, sondern auch die westlichen liberalen Werte überhaupt.
Meinen Dank dafür, Laureat eines so bedeutenden Preises zu sein, verbinde ich mit der Hoffnung, dass wir – trotz allem – Verbündete sind, dass wir uns mit der Zeit immer besser verstehen, uns annähern werden und auf diese Weise, um eines der Vorbilder meiner Jugend zu zitieren, dem Frieden eine Chance geben.
Neben Juri Andruchowytsch wurde der Hannah-Arendt-Preis 2014 auch an Nadeshda Tolokonnikowa und Marija Aljochina von der russischen Punkband Pussy Riot verliehen. Beide konnten allerdings an der Preisverleihung nicht teilnehmen. Um ihnen und ihrem politischen Kampf um Freiheitsrechte dennoch eine Präsenz zu geben, verlasen im Rahmen einer szenischen Lesung zwei Schauspielerinnen die Schlusserklärungen der beiden Frauen, die sie zum Ende des Prozesses gegen sie im August 2012 abgegeben hatten. Wir dokumentieren hier die beiden Erklärungen, deren Übersetzung wir der Nautilus-Flugschrift Pussy Riot! Ein Punkgebet für die Freiheit entnommen haben. Wir danken dem Nautilus Verlag für die Erlaubnis zum Abdruck.
Schlusserklärung vor dem Gericht in Moskau
»Verzerren und verfälschen Sie unsere Worte nicht«
Im Großen und Ganzen sind es nicht die drei Mitglieder von Pussy Riot, um die es in diesem Prozess geht. Wäre es so, hätte der Fall nicht eine solche Bedeutung. Es geht darin vielmehr um das gesamte politische System der Russischen Föderation, das es, zu seinem großen Unglück, genießt, die Grausamkeit des Staates gegenüber dem Einzelnen und seine Gleichgültigkeit gegenüber menschlicher Ehre und Würde vorzuführen – es wiederholt damit die schlechtesten Momente der russischen Geschichte. Zu meinem tiefsten Bedauern kommt dieses armselige Gerichtsverfahren Stalins Troikas ziemlich nahe. Auch wir haben nur einen Vernehmungsbeamten, einen Richter und einen Ankläger. Darüber hinaus basiert dieses repressive Theater auf politischen Anweisungen von oben, die diesen drei Justizfiguren ihre Worte, Handlungen und Entscheidungen vorschreiben.
Was steckt hinter unserer Performance in der Christ-ErlöserKathedrale und dem nachfolgenden Prozess? Nichts anderes als das autokratische politische System. Man kann die Auftritte von Pussy Riot Dissidentenkunst nennen oder politische Aktionen, die Kunstformen einsetzen. So oder so, unsere Performances sind eine Form ziviler Aktivitäten inmitten der Repressionen eines korporativen politischen Systems, das seine Macht gezielt gegen grundlegende Menschenrechte und zivile und politische Freiheiten richtet. Junge Menschen, zermürbt von der systematischen, in den Nullerjahren betriebenen Ausrottung von Freiheiten, haben sich jetzt gegen den Staat erhoben. Wir waren auf der Suche nach wirklicher Ehrlichkeit und Einfachheit und haben diese Eigenschaften im jurodstwo [heilige Dummheit] des Punk gefunden.
Leidenschaft, totale Ehrlichkeit und Naivität sind Heuchelei, Verlogenheit und falscher Bescheidenheit überlegen. Die benutzt man dazu, Verbrechen zu verschleiern. Die sogenannten Führungspersönlichkeiten unseres Staates stehen mit rechtschaffenen Mienen in der Kathedrale, aufgrund ihrer Arglist aber ist ihre Sünde viel größer als unsere. Wir haben politische Punkauftritte als Reaktion auf eine Regierung veranstaltet, die voller Härte, Verschlossenheit und kastenartiger Hierarchiestrukturen ist. Sie werden derartig durchschaubar dafür eingesetzt, den eigenen korporativen Interessen zu dienen, dass uns schlecht wird, wenn wir russische Luft atmen. Wir lehnen Folgendes kategorisch ab, und das zwingt uns dazu, politisch aktiv zu werden und zu leben: den Einsatz von Zwangs- und Gewaltmaßnahmen zur Regulierung sozialer Prozesse, ein Umstand, in dem die meisten wichtigen politischen Einrichtungen die Disziplinierungsstrukturen des Staats sind; die Sicherheitsbehörden (Armee, Polizei und Geheimdienste) und ihre dazugehö- rigen Instrumente zur Gewährleistung politischer »Stabilität« (Gefängnisse. Präventivhaft sowie alle Mechanismen zur strikten Überwachung der Bürgerschaft); gewaltsam erzwungene zivile Passivität bei einem Großteil der Bevölkerung; die totale Dominanz der Exekutive über Legislative und Judikative.
Darüber hinaus sind wir zutiefst enttäuscht vom skandalösen Mangel an politischer Kultur, der eine Folge von Angst ist und durch bewusste Anstrengungen der Regierung und ihrer Knechte aufrechterhalten wird (Patriarch Kyrill: »Orthodoxe Christen nehmen nicht an Kundgebungen teil«), enttäuscht von der skandalösen Schwäche horizontaler Verbindungen in unserer Gesellschaft. Es gefällt uns nicht, dass der Staat so mühelos die öffentliche Meinung mit den Instrumenten seiner peniblen Kontrolle des Großteils der Medien manipulieren kann (ein besonders anschauliches Beispiel für diese Manipulationen ist die beispiellos unverfrorene und verzerrte Kampagne gegen Pussy Riot in praktisch jedem russischen Medium).
Obwohl wir uns in einer grundlegend autoritären Situation befinden und unter autoritärer Herrschaft leben, sehe ich dieses System angesichts von drei Mitgliedern von Pussy Riot bröckeln. Was das System erhoffte, ist nicht eingetreten. Russland verurteilt uns nicht, und mit jedem Tag, der vergeht, glauben mehr Menschen an uns und daran, dass wir frei sein sollten statt hinter Gittern. Ich erlebe das bei den Menschen, denen ich begegne. Menschen, die für das System und in seinen Institutionen arbeiten, aber auch inhaftierte Menschen. Jeden Tag begegne ich unseren Unterstützern, die uns Glück und vor allem Freiheit wünschen. Sie sagen, was wir gemacht hätten, sei gerechtfertigt. Mit jedem Tag, der vergeht, sagen uns immer mehr Menschen, dass nach anfänglichen Zweifeln, ob wir das Recht zu unserer Aktion gehabt hätten, die Zeit gezeigt habe, dass unsere politische Geste richtig gewesen sei – dass wir die Wunden dieses politischen Systems geöffnet und direkt ins Wespennest gestochen hätten, sodass man hinter uns her war, aber wir ...
Diese Menschen versuchen, so gut sie können, uns unser Leid zu erleichtern, und dafür sind wir ihnen dankbar. Wir sind auch jedem dankbar, der draußen zu unserer Unterstützung auftritt. Es gibt viele Unterstützer, und ich weiß es. Ich weiß, dass sich eine große Zahl orthodoxer Christen für uns ausspricht, insbesondere diejenigen, die sich in der Nähe des Gerichts versammeln. Sie beten für uns, die eingesperrten Mitglieder von Pussy Riot. Wir haben die kleinen Broschüren mit Gebeten für die Inhaftierten gesehen, die Orthodoxe verteilen. Allein das beweist schon, dass es nicht eine einheitliche geschlossene Gruppe von orthodoxen Gläubigen gibt, worauf der Staatsanwalt gerne beharrte. So eine geschlossene Gruppe existiert nicht. Heute verteidigen immer mehr Gläubige Pussy Riot. Sie glauben nicht, dass das, was wir getan haben, fünf Monate Untersuchungshaft rechtfertigt, ganz zu schweigen von drei Jahren Gefängnis, die der Staatsanwalt gefordert hat.
Jeden Tag begreifen mehr Menschen, dass, wenn das System drei junge Frauen, die vierzig Sekunden lang in der Christ-Erlöser-Kirche aufgetreten sind, mit derartiger Vehemenz angreift, dies nur bedeutet, dass dieses System die Wahrheit, Ehrlichkeit und Geradlinigkeit fürchtet, für die wir stehen. Wir haben in diesem Verfahren nie zu einer Täuschung gegriffen. Unsere Gegner dagegen allzu oft, und die Menschen spüren das. Allerdings besitzt die Wahrheit eine ontologische, existenzielle Überlegenheit gegenüber der Täuschung, das steht schon in der Bibel, vor allem im Alten Testament. Die Wege der Wahrheit triumphieren immer über die Wege der Täuschung, Arglist und Irreführung. Mit jedem Tag wird die Wahrheit siegreicher, auch wenn wir hinter Gittern bleiben – und das vermutlich für lange Zeit.
Gestern ist Madonna in Moskau mit dem Schriftzug Pussy Riot auf dem Rücken aufgetreten. Immer mehr Menschen erkennen, dass wir hier rechtswidrig und unter falschen Vorwänden festgehalten werden. Das erstaunt mich. Ich bin überrascht, dass Wahrheit tatsächlich über Täuschung triumphiert. Denn obwohl wir physisch hier sind, sind wir freier als alle, die uns hier neben der Staatsanwaltschaft gegenübersitzen. Wir können alles sagen, was wir wollen, und tun es auch. Die Staatsanwaltschaft kann nur sagen, was ihr von der politischen Zensur zu sagen erlaubt ist. Sie können nicht »Punk-Gebet« sagen oder »Jungfrau Maria, heilige Muttergottes, räum Putin aus dem Weg!«, sie können nicht eine einzige Zeile unseres Punk-Gebets in den Mund nehmen, das sich mit dem politischen System auseinandersetzt.
Vielleicht glauben sie, es wäre gut, uns ins Gefängnis zu stecken, weil wir den Mund gegen Putin und sein Regime aufmachen. Sie sagen es nicht, weil sie es nicht dürfen. Ihre Lippen sind zugenäht. Dummerweise sind sie hier bloß Attrappen. Ich hoffe aber, dass ihnen das klar wird und sie am Ende den Weg von Freiheit, Wahrheit und Ehrlichkeit einschlagen, weil dieser Weg dem Weg der totalen Stagnation, der falschen Bescheidenheit und Heuchelei überlegen ist. Stagnation und die Suche nach der Wahrheit stehen schon immer im Widerspruch zueinander, und in diesem Fall, im Verlauf dieses Prozesses, sehen wir auf der einen Seite Menschen, die versuchen, die Wahrheit zu erkennen, und auf der anderen Seite Menschen, die versuchen, dies zu verhindern.
Ein Mensch ist ein Wesen, das ständig irrt und niemals perfekt ist. Es sucht nach Weisheit und kann sie nicht besitzen; deshalb ist die Philosophie entstanden. Deshalb ist der Philosoph derjenige, der die Weisheit liebt und sich nach ihr sehnt, sie aber noch nicht besitzt. Und das fordert letztlich ein menschliches Wesen zum Handeln auf, zum Denken und zu einer bestimmten Lebenshaltung. Es war unsere Suche nach Wahrheit, die uns in die Christ-Erlöser-Kathedrale führte. Ich denke, dass der christliche Glaube, wie ich ihn bei meinem Studium des Alten und besonders des Neuen Testaments verstanden habe, die Suche nach Wahrheit und einer ständigen Überwindung seiner selbst unterstützt, die Überwindung dessen, was man zuvor gewesen ist. Nicht umsonst sagte Christus, als er bei den Prostituierten war, den Gestrauchelten müsse geholfen werden: »Ich vergebe ihnen«, sagte er. In unserem Prozess, der ja unter dem Banner des christlichen Glaubens steht, kann ich diesen Geist nicht erkennen. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass die Anklage die Religion mit Füßen tritt.
Die Anwälte der »moralisch geschädigten Parteien« haben diese sitzenlassen – so sehe ich es jedenfalls. Vor zwei Tagen hielt Alexej Taratukhin [einer der Anwälte der Nebenkläger] eine Rede, in der er darauf bestand, man dürfe unter keinen Umständen annehmen, dass er mit den von ihm vertretenen Parteien übereinstimme. Anders gesagt: Der Anwalt findet sich in einer moralisch unangenehmen Position wieder, er möchte nicht für die Menschen stehen, die Pussy Riot gerne eingesperrt sehen wollen. Ich weiß nicht, warum sie wollen, dass wir ins Gefängnis kommen. Vielleicht haben sie das Recht dazu, aber ich möchte betonen, dass ihr Anwalt sich offensichtlich schämt. Vielleicht haben ihn auch die »Schämt euch, ihr Henker!«-Rufe der Menschen getroffen. Ich möchte darauf hinweisen, dass Wahrheit und Güte immer über Täuschung und Groll triumphieren. Außerdem habe ich den Eindruck, dass die Staatsanwälte unter dem Einfluss irgendeiner höheren Macht stehen, weil sie sich immer wieder versprechen und versehentlich uns »die geschädigte Partei« nennen. Fast alle Staatsanwälte haben das schon einmal gesagt, und sogar die Anwältin der Nebenkläger, Larissa Pawlowa, die uns gegenüber sehr negativ eingestellt ist, scheint nichtsdestotrotz von einer höheren Macht getrieben zu werden, wenn sie sich auf uns als »die geschädigte Partei« bezieht. So nennt sie nicht diejenigen, die sie vertritt, sondern nur uns.
Ich möchte niemanden abstempeln. Es kommt mir so vor, als gebe es hier keine Gewinner, Verlierer, Opfer oder Angeklagte. Wir müssen nur aufeinander zugehen, eine Verbindung herstellen und miteinander ins Gespräch kommen, um gemeinsam die Wahrheit zu finden. Gemeinsam können wir Philosophen sein und nach Weisheit streben, statt andere zu stigmatisieren und in Schubladen zu stecken. Das ist das Letzte, was ein Mensch tun sollte. Jesus Christus hat das verurteilt. Mit diesem Prozess missbraucht uns das System. Wer hätte gedacht, dass ein Mann und der Staat, den er regiert, immer und immer wieder absolut unmotiviert Böses tun? Wer hätte gedacht, dass die Geschichte, insbesondere Stalins gar nicht so lange zurückliegender Großer Terror, uns nichts lehren konnte? Die mittelalterlichen Inquisitionsmethoden, die im Strafvollzug und im Justizwesen dieses Landes herrschen, sind zum Heulen. Aber seit unserer Verhaftung haben wir aufgehört zu heulen. Wir haben die Fähigkeit dazu verloren. In unseren Punkkonzerten haben wir verzweifelt geschrien. Aus Leibeskräften haben wir die Gesetzlosigkeit der Machthaber, der Führungsorgane angeprangert. Doch jetzt hat man uns unserer Stimmen beraubt. Man hat sie uns am 3. März 2012 genommen, als wir verhaftet wurden. Und tags darauf hat man uns und Millionen anderen bei den sogenannten Wahlen unsere Stimmen und unsere Wahlstimmen gestohlen.
Im Verlauf des gesamten Prozesses haben es einige Leute abgelehnt, uns anzuhören. Das hieße ja, offen zu sein für das, was wir zu sagen haben, aufmerksam, nach Weisheit zu streben, ein Philosoph zu sein. Ich glaube, jeder Mensch sollte das anstreben, und nicht nur diejenigen, die an irgendeinem Philosophischen Institut studiert haben. Eine formelle Ausbildung bedeutet gar nichts, auch wenn Nebenklagevertreterin Larissa Pawlowa ständig versucht, uns unsere mangelnde Bildung vorzuhalten. Wir sind der Überzeugung, das Wichtigste, wonach man streben sollte, ist Wissen und Verstehen. Denn beides kann ein Mensch auch unabhängig und außerhalb der Mauern einer Bildungseinrichtung erwerben. Ornat und höhere akademische Grade bedeuten nichts. Ein Mensch kann jede Menge wissen und trotzdem nicht wie ein menschliches Wesen handeln. Pythagoras sagte, viel Lernen lehre noch keine Weisheit. Leider befinden wir uns hier, um das zu bestätigen. Wir sind hier lediglich zur Dekoration, leblose Elemente, nur Körper, die im Gerichtssaal abgeliefert wurden. Unseren Anträgen wurde – nach tagelangem Nachfragen, Verhandeln und Kämpfen – keine Beachtung geschenkt, sie wurden prinzipiell abgewiesen. Bedauerlicherweise – für uns und unser Land – hörte das Gericht einen Staatsanwalt an, der unsere Worte und Aussagen fortwährend ungestraft verdreht und neutralisiert. Ungeniert und demonstrativ wird gegen das grundlegende Rechtsprinzip der Gleichheit und Waffengleichheit der gegensätzlichen Parteien verstoßen.
Am 30. Juli, dem ersten Prozesstag, haben wir unsere Antwort auf die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Damals hat uns das Gericht das Rederecht verweigert, und unsere Verteidigerin Violetta Wolkowa hat unsere Texte verlesen. Nach fünf Monaten Haft war dies unsere erste Gelegenheit, uns zu äußern. Bis dahin waren wir inhaftiert und eingeschränkt; von dort aus kann man nichts unternehmen, wir können keine Aufrufe oder Einsprüche verfassen, nicht filmen, was in unserer Umgebung passiert, wir haben kein Internet, und unsere Anwälte können uns nicht mal mit Papier versorgen, weil das verboten ist. Am 30. Juli haben wir zum ersten Mal öffentlich gesprochen; wir haben Kontaktaufnahme und Gesprächserleichterungen gefordert, nicht Streit und Konfrontation gesucht. Wir haben den Menschen, die uns aus irgendeinem Grund für ihre Feindinnen halten, offen die Hand gereicht, und sie haben hineingespuckt. »Ihr meint es nicht ehrlich«, hat man uns gesagt. Schade. Beurteilt uns nicht nach eurem eigenen Verhalten. Wir waren aufrichtig, wie wir es immer sind. Wir haben gesagt, was wir denken. Wir waren unglaublich kindlich, ja naiv in unserer Wahrheit, trotzdem bedauern wir unsere Worte nicht, auch nicht die Worte an jenem Tag. Und wenn man uns verleumdet hat, wollen wir als Antwort darauf andere nicht auch verleumden. Wir befinden uns in einer verzweifelten Situation, aber wir verzweifeln nicht. Wir sind angeklagt, aber nicht im Stich gelassen. Es ist einfach, Menschen zu entwürdigen und zu zerstö- ren, die so aufrichtig sind, aber »wenn ich schwach bin, bin ich stark«.
Hören Sie auf das, was wir sagen, und nicht, was der [Putin-freundliche Fernsehjournalist] Arkadi Mamontow über uns erzählt. Verzerren und verfälschen Sie unsere Worte nicht. Gestatten Sie uns, in einen Dialog, in Kontakt zu diesem Land zu treten, das auch das unsrige ist, und nicht nur das Putins und des Patriarchen. Genauso wie Alexander Solschenizyn glaube auch ich, dass zu guter Letzt das Wort den Beton sprengen wird. Er schrieb: »Deshalb ist das Wort wichtiger als der Beton. Deshalb ist das Wort kein geringes Nichts. Auf diese Weise beginnen edle Menschen zu wachsen, und ihr Werk wird Beton sprengen.«
Katja, Mascha und ich sitzen vielleicht im Gefängnis, aber ich halte uns nicht für besiegt. Wie die Dissidenten sind wir nicht besiegt. Auch wenn sie in Irrenhäusern und Gefängnissen verschwanden, brachten sie ihr Urteil über das Regime immer zum Ausdruck. Die Kunst, das Profil einer Epoche zu schaffen, kennt keine Gewinner oder Verlierer. So war es auch mit den Dichtern der Gruppe OBERIU, deren Mitglieder bis zum Schluss Künstler blieben, unerklärbar und unverständlich. Alexander Wwedenski, der 1932 einer Säuberungsaktion zum Opfer fiel, schrieb: »Das Unverständliche gefällt uns, das Unerklärbare ist unser Freund.« Laut der offiziellen Sterbeurkunde starb Alexander Wwedenski am 20. Dezember 1941. Niemand kennt die Todesursache. Es könnte die Ruhr gewesen sein, auf seinem Transport ins Lager; oder die Kugel eines Wachmanns. Jedenfalls passierte es irgendwo auf der Bahnstrecke zwischen Woronesch und Kazan.
Pussy Riot sind Wwedenskis Schülerinnen und Erbinnen. Sein Prinzip des schlechten Reims bedeutet uns viel. Er schrieb: »Ich denke mir hin und wieder zwei Reime aus, einen guten und einen schlechten, und ich entscheide mich immer für den schlechten, weil der immer der richtige ist.«
»Das Unerklärbare ist unser Freund«: Die anspruchsvollen und raffinierten Werke der Dichtergruppe OBERIU und ihre Suche nach einem Denken an den Rändern des Sinns fand ihre Verkörperung schließlich darin, dass sie für ihre Kunst mit dem Leben bezahlten – durch den sinnlosen und unerklärbaren Großen Terror. Mit diesem Tod bewiesen diese Dichter ungewollt, dass ihre Epoche im Kern aus Irrationalität und Sinnlosigkeit bestand. Das Künstlerische wurde dadurch zur historischen Tatsache. Der Preis, an der Schaffung von Geschichte teilzuhaben, ist für den Einzelnen unermesslich hoch. Und doch liegt das Eigentliche der menschlichen Existenz genau in dieser Beteiligung. Ein Bettler zu sein und andere doch zu bereichern. Nichts zu haben und doch alles zu besitzen. Man hält die OBERIU-Dissidenten für tot, aber sie sind immer noch lebendig. Sie wurden bestraft, aber sie sterben nicht.
Wissen Sie noch, warum der junge Dostojewski zum Tode verurteilt wurde? Seine ganze Schuld bestand darin, dass er von sozialistischen Theorien fasziniert war, und bei seinen Zusammenkünften mit Freidenkern und Freunden – man traf sich immer freitags in der Wohnung von [Michail] Petraschewski – diskutierte er über die Schriften von [Charles] Fourier und George Sand. An einem der letzten dieser Freitage las er den Brief von [Wissarion] Belinski an [Nikolaj] Gogol vor, der laut Gericht, das Dostojewskis Fall verhandelte – man höre! –, vor »schamlosen Bemerkungen über die orthodoxe Kirche und die Staatsregierung« nur so strotzte. Nachdem die Exekution schon vorbereitet war und nach »zehn qualvollen, unendlich entsetzlichen Minuten des Wartens auf den Tod« (Dostojewski), wurde bekanntgegeben, dass die Strafe in vier Jahre Zwangsarbeit in Sibirien und anschließenden Militärdienst umgewandelt worden war.
Sokrates war angeklagt, mit seinen philosophischen Diskussionen die Jugend zu verderben und sich zu weigern, die Götter Athens anzuerkennen. Dabei hatte er einen lebendigen Bezug zur göttlichen Stimme und war, worauf er viele Male bestand, in keinerlei Hinsicht ein Feind der Götter. Aber was für eine Rolle spielte das, wo er doch mit seinem kritischen, dialektischen und vorurteilsfreien Denken die einflussreichen Bürger seiner Stadt erzürnte? Sokrates wurde zum Tode verurteilt, und nachdem er sich geweigert hatte, aus Athen zu fliehen (wie seine Schüler ihm vorschlugen), leerte er mutig seinen Schierlingsbecher und starb. Haben Sie vergessen, unter welchen Umständen der Heilige Stephanus, der Jünger unter den Aposteln, sein Erdenleben beendete? »Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen: Dieser Mensch hört nicht auf, zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz.« [Apostelgeschichte 6, 11-13] Er wurde schuldig gesprochen und gesteinigt. Ich hoffe auch, dass Sie sich alle daran erinnern, was die Juden Christus geantwortet haben: »Um des guten Werks willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen.« [Johannes 10, 33] Und zum Schluss täten wir gut daran, nicht zu vergessen, wie Christus geschildert wurde: »Er hat einen bösen Geist und ist von Sinnen.« [Johannes 10, 20]
Wenn Behörden, Zaren, Präsidenten, Premierminister, das Volk und Richter wirklich verstünden, was »Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer« [Matthäus 9, 13] bedeutete, würden sie keine Unschuldigen vor Gericht stellen. Unsere Behörden jedoch fallen mit Verurteilungen über uns her und lassen niemals Gnade walten. An dieser Stelle möchte ich mich gerne bei Dmitri Anatoljewitsch Medwedew bedanken, der uns folgenden großartigen Aphorismus lieferte. Er fasste seine Amtszeit als Präsident mit den Worten zusammen: »Freiheit ist besser als Nichtfreiheit.« Dementsprechend ließe sich, in Übereinstimmung mit Medwedews trefflichen Worten, die dritte Amtszeit Putins sehr schön mit dem Aphorismus »Gefängnis ist besser als Steinigung« charakterisieren. Ich bitte Sie, Folgendes aus Montaignes Essays gewissenhaft in Betracht zu ziehen. Sie wurden im 16. Jahrhundert geschrieben und predigen Toleranz und die Ablehnung jeglicher Einseitigkeit und Doktrin: »Es misst den eigenen Mutmaßungen einen sehr hohen Wert bei, wenn man ihretwegen einen Menschen bei lebendigem Leib verbrannt hat.«
Ist es das wert, Menschen zu verurteilen und ins Gefängnis zu stecken, allein auf Grundlage von Mutmaßungen, die die Anklage nicht bewiesen hat? Da wir wirklich nie Hass oder Feindseligkeit hegten, sind unsere Ankläger auf falsche Zeugen angewiesen. Eine von ihnen, Matilda Iwaschenko, begann sich zu schämen und erschien nicht vor Gericht. Daneben gab es falsche Zeugenaussagen von Herrn Troitski, Herrn Ponkin sowie von Frau Abramenkowa. Es gibt keinen Beweis für Hass und Feindseligkeit bei uns, ausgenommen das sogenannte »Gutachten«. Dieses müsste das Gericht, wenn es ehrlich und fair ist, als Beweismittel eigentlich als inakzeptabel ablehnen, da es sich dabei nicht um einen schlüssigen und objektiven Text handelt, sondern um ein niederträchtiges und falsches Stück Papier, das an Inquisition erinnert. Einen anderen Beweis, der die Existenz eines solchen Motivs bestätigen würde, gibt es nicht. Die Anklage hat es abgelehnt, Auszüge aus Interviews von Pussy Riot vorzutragen, da diese nur ein weiterer Beweis für das Fehlen irgendeines Motivs gewesen wären. Warum wurde auch der folgende Text von uns – der im Übrigen Bestandteil unserer eidesstattlichen Versicherung ist – von der Staatsanwaltschaft nicht angeführt? »Wir respektieren Religion im Allgemeinen und den orthodoxen Glauben im Besonderen. Deshalb macht es uns besonders wütend, wenn der christliche Glaube, der voller Licht ist, auf eine derartig schmutzige Weise ausgenutzt wird. Uns wird schlecht mitanzusehen, wie diese großen Gedanken in die Knie gezwungen werden.« Dieses Zitat stammt aus einem Interview, das im Russian Reporter erschienen ist und am Tag nach unserer Performance mit Pussy Riot geführt wurde. Uns ist immer noch schlecht, und es tut uns wirklich weh, das alles zu sehen. Und schließ- lich wird das Fehlen von Hass oder Feindseligkeit gegenüber Religionen und dem Religiösen von den Aussagen sämtlicher Leumundszeugen bestätigt, die unsere Anwälte geladen haben.
Neben diesen Leumundszeugnissen bitte ich Sie, auch die Resultate der psychologischen und psychiatrischen Gutachten im Untersuchungsgefängnis Nummer 6 zu berücksichtigen, die auf Anordnung der Gefängnisbehörde erstellt wurden. Der Bericht stellt Folgendes fest: Die Werte, die ich mir zu eigen mache, sind Gerechtigkeit, gegenseitiger Respekt, Menschlichkeit, Gleichheit und Freiheit. Das schrieb ein Gerichtsgutachter, der mich nicht persönlich kennt, obwohl es sein könnte, dass Ranchenkow, der Ermittler, sich ein anderes Fazit gewünscht hätte. Doch anscheinend gibt es in dieser Welt doch mehr Menschen, die die Wahrheit lieben und schätzen, als andere, die es nicht tun. Darin hat die Bibel Recht. Zum Abschluss möchte ich aus einem Songtext von Pussy Riot zitieren, der sich, so merkwürdig es sein mag, als prophetisch herausgestellt hat. Wir haben vorhergesehen, dass »der Chef des KGB und der Oberheilige des Landes die Demonstranten unter Geleitschutz ins Gefängnis abführen lassen« wird. Dabei ging es um uns. Weder bei mir, noch bei Aljochina, noch bei Samuzewitsch wurden starke und dauerhafte Affekte oder andere psychologische Ausprägungen gefunden, die sich als Hass auf etwas oder jemanden interpretieren ließen.
Also:
Macht alle Türen auf, streift eure Epauletten ab Kommt, kostet die Freiheit mit uns
Pussy Riot
Das ist alles.
Schlusserklärung vor dem Gericht in Moskau
»… wir sind gegen das Putin-erzeugte Chaos …«
Dieser Prozess ist äußerst typisch und spricht Bände. Die derzeitige Regierung wird noch sehr lange Gelegenheit haben, sich für ihn zu schä- men. In jedem Stadium verkörperte er ein Zerrbild der Justiz. Wie sich herausstellte, wuchs sich unsere Performance, anfangs eine kleine und ein wenig absurde Shownummer, lawinenartig zu einer Riesenkatastrophe aus. In einer gesunden Gesellschaft würde so etwas ganz offensichtlich nicht passieren. Russland als Staat glich lange einem Organismus, der bis ins Mark krank ist. Und diese Erkrankung bricht aus, wenn man mit seinen entzündeten Abszessen in Berührung kommt. Am Anfang und für lange Zeit wird in der Öffentlichkeit über diese Krankheit geschwiegen, aber irgendwann wird sie durch Dialog doch immer überwunden. Und sehen Sie – dies ist die Art von Dialog, zu der unsere Regierung fähig ist. Dieser Prozess ist nicht nur ein bösartiges und groteskes Maskenspiel, sondern er offenbart das wahre Gesicht des Dialogs der Regierung mit dem Volk dieses Landes. Um auf gesellschaftlicher Ebene die Diskussion über ein Problem anzustoßen, braucht es oft die richtigen Voraussetzungen – einen Anstoß.
Es ist interessant, dass unsere Situation von Anfang an depersonalisiert wurde. Denn wenn wir über Putin sprechen, haben wir zunächst einmal nicht Wladimir Wladimirowitsch Putin im Sinn, sondern das System Putin, das er geschaffen hat – die vertikale Macht, in der die gesamte Kontrolle faktisch von einer einzigen Person ausgeübt wird. Und diese vertikale Macht interessiert sich nicht, und zwar kein bisschen, für die Meinung der Masse. Was mich dabei am meisten stört, ist, dass die Meinung der jüngeren Generationen außer Acht gelassen wird. Wir sind überzeugt, dass die Unfähigkeit dieser Regierung in praktisch jedem Bereich offenkundig ist.
Und genau hier, in dieser Schlusserklärung, möchte ich gerne meine eigenen Erfahrungen schildern, wie ich mit diesem System in Konflikt geraten bin. Unsere Schulausbildung, in der sich die Persönlichkeit in einem sozialen Kontext zu entwickeln beginnt, ignoriert quasi alle individuellen Eigenarten. Es gibt keinen individuellen Ansatz, man erwirbt keine Kenntnisse zu Kultur und Philosophie oder ein Grundwissen über die Zivilgesellschaft. Offiziell gibt es diese Themen zwar, sie werden aber immer noch nach dem Sowjetmodell unterrichtet. lm Ergebnis sehen wir eine Ausgrenzung der Gegenwartskunst, fehlende Anregung zu philosophischem Denken und eine klischeehafte Zuordnung der Geschlechterrollen. Die Vorstellung vom Menschen als Bürger wird in die hinterste Ecke gefegt.
Die heutigen Erziehungsinstitutionen bringen Menschen von klein auf bei, als Roboter zu leben und nicht die entscheidenden Fragen zu stellen, die ihrem Alter entsprechen. Sie impfen einem Grausamkeit und Intoleranz gegenüber jeder Abweichung ein. Schon in der Kindheit vergessen wir unsere Freiheit.
Ich habe persönliche Erfahrungen mit psychiatrischen Kliniken für Minderjährige gemacht. Und ich kann wirklich sagen, dass jeder Teenager, der auch nur irgendein Anzeichen aktiver Nonkonformität zeigt, dort landen kann. Ein gewisser Prozentsatz der Kinder darin stammt aus Waisenhäusern. In unserem Land wird es nämlich als völlig normal angesehen, ein Kind, das versucht hat, aus einem Waisenhaus auszurei- ßen, in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. Dort werden sie mit extrem starken sedierenden Medikamenten wie Chlorpromazin behandelt, das in den 1970ern auch bei Sowjet-Dissidenten eingesetzt wurde.
Angesichts der allgemeinen Tendenz zur Bestrafung in dieser Umgebung und dem Fehlen wirklicher psychologischer Hilfe ist diese Erfahrung besonders traumatisierend. Sämtliche Interaktionen basieren auf der Instrumentalisierung kindlicher Ängste und dem Zwang zu Unterordnung und Gehorsam. In der Folge potenziert sich diese Grausamkeit noch um ein Vielfaches. Viele dieser Kinder sind Analphabeten, aber niemand unternimmt etwas dagegen – im Gegenteil, jedes letzte Restchen Motivation zur persönlichen Entfaltung wird entmutigt. Der Einzelne schließt sich völlig ab und verliert seinen Glauben an die Welt.
Ich möchte anmerken, dass diese Art und Weise der Persönlichkeitsentwicklung die Herausbildung individueller und religiöser Freiheiten bedauerlicherweise eindeutig massenweise behindert. Die Folgeerscheinungen des Prozesses, den ich gerade beschrieben habe, sind ontologische Demut, existenzielle Demut und Verstaatlichung. Ich halte diese Transformation oder diesen Bruch insofern für bemerkenswert, als wir, vom Standpunkt der christlichen Kultur aus betrachtet, sehen können, dass Bedeutungen und Symbole von solchen verdrängt werden, die ihnen diametral entgegengesetzt sind. Dementsprechend wird einer der wichtigsten christlichen Begriffe, die Demut, inzwischen im Allgemeinen nicht mehr als ein Weg zu Erkenntnis, Festigung und endgültiger Freiheit verstanden, sondern im Gegenteil als ein Instrument der Versklavung. Den [russischen Philosophen] Nikolai Berdjajew zitierend, könnte man sagen: »Die Ontologie der Demut ist die Ontologie der Sklaven Gottes und nicht die seiner Söhne.«
Während ich am Aufbau der Ökologiebewegung mitarbeitete, gelangte ich zu der festen Überzeugung, dass innere Freiheit die wichtigste Grundlage für Handeln darstellt und Handeln als solches von ganz unmittelbarer Bedeutung ist.
Bis zum heutigen Tag finde ich es erstaunlich, dass wir in unserem Land die Unterstützung von mehreren tausend Menschen brauchen, um der Willkür einer Handvoll Bürokraten ein Ende zu setzen. Ich möchte hervorheben, dass unser Prozess die sehr beredte Bestätigung der Tatsache ist, dass wir die Unterstützung Tausender Menschen aus aller Welt brauchen, um das Offensichtliche zu beweisen: Wir drei sind unschuldig. Das sagt die ganze Welt. Sie sagt es bei Konzerten, im Internet, in den Medien, sogar im Parlament. Der englische Premierminister empfängt unseren Präsidenten nicht mit Worten zu den Olympischen Spielen, sondern mit der Frage: »Warum sitzen drei unschuldige Frauen im Gefängnis?« Es ist beschämend.
Noch erstaunlicher finde ich allerdings, dass Leute nicht daran glauben, Einfluss auf die Regierung nehmen zu können. Im Laufe der Streiks und Demonstrationen [im Winter und Frühjahr], als ich Unterschriften sammelte und Petitionen vorbereitete, haben mich viele Leute – mit ehrlicher Verwunderung – gefragt, warum sie sich um alles in der Welt für dieses kleine Fleckchen Wald in der Region Krasnodar interessieren sollten oder was sie das denn anginge – selbst wenn es möglicherweise einzigartig in Russland ist, vielleicht sogar urzeitlich? Was sollte es sie kümmern, dass die Frau von Ministerpräsident Dmitri Medwedew dort einen offiziellen Amtssitz bauen lassen will und damit das einzige Reservat für Kriechwacholder zerstört? Diese Leute ... sie sind nur eine weitere Bestätigung dafür, dass die Menschen in unserem Land das Bewusstsein verloren haben, dass dieses Land uns gehört, den Bürgern. Sie empfinden sich nicht mehr als Bürger, sie empfinden sich nur noch als die automatisierte Masse. Sie haben nicht das Gefühl, dass der Wald ihnen gehört, selbst wenn er direkt neben ihren Häusern liegt.
Ich bezweifle sogar, dass sie für diese Häuser so etwas wie Besitzerschaft empfinden. Wenn irgendwer mit einer Planierraupe vor ihrer Veranda vorführe und ihnen erzählte, sie müssten evakuiert werden – »Bitte entschuldigen Sie, aber wir müssen Ihr Haus plattmachen, um Platz für eine Bürokratenresidenz zu schaffen« –, würden diese Leute gehorsam ihre Habseligkeiten zusammenraffen, ihre Koffer holen und auf die Straße hinausgehen. Und dort würden sie exakt so lange stehen bleiben, bis die Regierung ihnen sagt, was sie als Nächstes tun sollen. Sie sind völlig gestaltlos, es ist unendlich traurig. Nach einem knappen halben Jahr in Haft bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass das Gefängnis nichts anderes als Russland im Kleinen ist.
Man könnte auch mit dem Regierungssystem beginnen. Es weist die gleiche vertikale Machtstruktur auf, in der jede Entscheidung einzig und allein durch direkten Eingriff des gerade Verantwortlichen getroffen wird. Es gibt darin keinerlei horizontale Delegierung von Aufgaben, was jedem das Leben spürbar erleichtern würde. Und es mangelt an persönlicher Initiative. Denunziation gedeiht neben gegenseitigem Misstrauen. lm Gefängnis, wie in unserem Land als Ganzem, ist alles darauf angelegt, den Menschen ihre Individualität zu nehmen und sie mit einer bloßen Funktion gleichzusetzen, sei es die Funktion eines Arbeiters oder die eines Häftlings. Der straffe Rahmen des Tagesplans im Gefängnis (an den man sich schnell gewöhnt) gleicht dem Gerüst des Alltags, in das alle hineingeboren werden.
In diesem Alltagsgerüst fangen Menschen an, großen Wert auf bedeutungslose Kleinigkeiten zu legen. Im Gefängnis sind solche Kleinigkeiten Dinge wie eine Tischdecke oder Plastikgeschirr, die man sich nur mit persönlicher Erlaubnis des Gefängnisdirektors beschaffen kann. Außerhalb des Gefängnisses verfügt man entsprechend über einen sozialen Status, auf den ebenfalls größter Wert gelegt wird. Das hat mich immer gewundert. Ein weiteres Element dieses Gerüsts besteht darin, sich bewusst zu werden, inwiefern diese Regierung wie eine Theaterinszenierung funktioniert, als Bühnenstück. Derweil verwandelt sie sich in der Realität in Chaos. Die Oberflächenstruktur des Regimes bröckelt und offenbart die Desorganisation und Ineffizienz des Großteils seiner Arbeit. Es liegt auf der Hand, dass das nicht zu irgendeiner Form tatsächlichen Regierens führt. Im Gegenteil, die Menschen empfinden ein immer stärker werdendes Gefühl des Verlorenseins – einschließlich des Verlorenseins in Raum und Zeit. lm Gefängnis und überall im Land wissen die Menschen nicht, wohin sie sich mit dieser oder jener Frage wenden können. Deshalb wenden sie sich an den Boss des Gefängnisses. Und außerhalb des Gefängnisses gehen die Menschen dementsprechend zu Putin, dem Oberboss.
In einem Text ein Gesamtbild des Systems zum Ausdruck zu bringen ... nun, generell könnte ich sagen, dass wir nicht gegen ... wir sind gegen das Putin-erzeugte Chaos, das nur oberflächlich betrachtet eine Regierung genannt werden kann. Ein Gesamtbild des Systems, in dem unserer Auffassung nach praktisch sämtliche Institutionen einer Art Mutation unterzogen werden, während sie dem Namen nach noch intakt erscheinen. Und in welchem die Zivilgesellschaft, an der uns so viel liegt, zerstört wird. Wir verwenden in unseren Texten keine direkten Bibelzitate; wir benutzen lediglich ihre Form als künstlerisches Stilmittel. Das Einzige, was gleich ist, ist unsere Motivation. Unsere Motivation entspricht tatsächlich der Motivation eines direkten Bibelzitates. Am besten bringen die Evangelien diese Motivation zum Ausdruck: »Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.« [Matthäus 7, 8] Ich – wir alle – glauben aufrichtig, dass uns die Tür geöffnet wird. Aber leider Gottes ist im Moment das Einzige, was passiert ist, dass wir ins Gefängnis gesperrt wurden. Es ist sehr seltsam, dass die Behörden in ihrer Reaktion auf unsere Aktionen die historische Praxis der abweichenden Meinung vollständig ignoriert haben. »Wie bedauernswert ist ein Land, in dem einfache Ehrlichkeit im besten Fall als Heldenmut verstanden wird und im schlimmsten als Geisteskrankheit«, schrieb in den 1970er-Jahren der Dissident [Wladimir] Bukowsky. Und obwohl es noch gar nicht so lange her ist, verhalten sich die Menschen heute so, als hätte es den Gro- ßen Terror nie gegeben und auch keine Versuche, ihm Widerstand zu leisten. Ich vermute, dass wir von Menschen ohne Gedächtnis angeklagt werden. Viele von ihnen haben gesagt: »Er ist von einem Dämon besessen und redet im Wahn. Warum hört ihr ihm zu?« Das waren die Worte der Juden, die Jesus der Gotteslästerung anklagten. »Wir steinigen dich ... wegen Gotteslästerung.« [Johannes 10, 33] Interessanterweise benutzt die Russisch-Orthodoxe Kirche genau diesen Vers, um ihre Auffassung von Gotteslästerung zum Ausdruck zu bringen.
Diese Auffassung ist schriftlich bestätigt, das Dokument liegt unserer Strafakte bei. Mit dieser Auffassung bezieht sich die Russisch-Orthodoxe Kirche auf die Evangelien als eine feststehende theologische Wahrheit. Sie werden nicht mehr als Offenbarung verstanden, was sie von Anfang an gewesen sind, sondern als ein monolithischer Klotz, der sich in einzelne Zitate zerlegen lässt, um diese wo immer nötig hinzuschieben – in jedes Schriftstück, für jeden erdenklichen Zweck. Die Russisch-Orthodoxe Kirche hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, den Zusammenhang nachzulesen, in dem »Gotteslästerung« hier erwähnt wird – dass der Begriff in diesem Fall auf Jesus selbst angewendet wird. Ich glaube, religiöse Wahrheit sollte nichts Statisches sein, und dass es unbedingt notwendig ist, die Umstände und Wege geistiger Entwicklung zu begreifen, die Schwierigkeiten des Menschen, seine Doppelzüngigkeit, seine Zersplittertheit. Dass es für das eigene Selbst lebenswichtig ist, diese Dinge wahrzunehmen und zu erleben, um sich zu entwickeln. Dass man diese Dinge wahrnehmen und erfahren muss, um eine Persönlichkeit herauszubilden. Dass religiöse Wahrheit ein Prozess und kein fertiges Produkt ist, das sich jederzeit und wohin man will verschieben lässt.
All diese Dinge, über die ich gesprochen habe, all diese Prozesse – sie erlangen Bedeutung in der Kunst und in der Philosophie, auch in der Gegenwartskunst. Ein künstlerischer Akt kann und, wie ich meine, muss einen eigenen inneren Konflikt beinhalten. Und was mich wirklich ärgert, ist, wie die Anklage das Wort »sogenannt« in Bezug auf Gegenwartskunst verwendet.
Ich möchte darauf hinweisen, dass während des Prozesses gegen den Dichter [Joseph] Brodsky sehr ähnliche Methoden zum Einsatz kamen. Seine Gedichte wurden als »sogenannte« Gedichte bezeichnet; die Zeugen der Anklage hatten sie in Wirklichkeit gar nicht gelesen – genau wie mehrere Zeugen in unserem Fall die Performance selbst gar nicht gesehen, sondern nur den Videoclip im Internet angeschaut haben. Auch unsere Entschuldigungen werden von der kollektiven Anklage anscheinend zu »sogenannten« Entschuldigungen erklärt. Das ist beleidigend. Und ich bin erschüttert von den moralischen Verletzungen und psychischen Traumata [, die wir offenbar verursacht haben]. Unsere Entschuldigungen waren aufrichtig. Es tut mir leid, dass so viel geredet wurde und Sie alle das immer noch nicht begriffen haben. Oder es ist absichtliche Hinterhältigkeit, wenn Sie behaupten, unsere Entschuldigungen seien unaufrichtig. Ich weiß nicht, was Sie noch von uns hören müssen. Aber für mich ist dieser Prozess ein »sogenannter« Prozess. Und ich habe keine Angst vor Ihnen. Auch keine Angst vor Falschheit und Unechtheit, vor schlampig getarnter Irreführung im Urteilsspruch des »sogenannten« Gerichts.
Denn alles, was Sie mir nehmen können, ist »sogenannte« Freiheit. Es ist die einzige in Russland existierende Form. Doch meine innere Freiheit kann mir niemand nehmen. Sie lebt im Wort und wird weiterleben dank der glasnost [Offenheit], wenn das hier von Tausenden Menschen gelesen und gehört wird. Diese Freiheit wird weiterleben mit allen, die nicht gleichgültig sind und uns in diesem Land hören. Mit allen, die in diesem Prozess Bruchstücke von sich selbst entdeckt haben, so wie andere sie in früheren Zeiten bei Franz Kafka und Guy Debord entdeckt haben. Ich glaube, dass ich aufrichtig und offen bin, ich dürste nach der Wahrheit; und diese Dinge werden uns alle nur noch ein wenig freier machen. Wir werden schon sehen.
»Die Moskauer Prozesse«
Zum Verhältnis von Kunst und gesellschaftlicher Realität in Russland
Russland erlebte seit den 1990er-Jahren eine Reihe von Gerichtsprozessen gegen zeitgenössische avantgardistische KünstlerInnen und AusstellungsmacherInnen. Sie wurden ausgelöst durch die Forderung bestimmter »Bürgergruppen« nach Kompensation für die erlittene Verletzung ihrer religiösen Gefühle beziehungsweise moralischen Prinzipien und nach Verbot solcherart gesellschaftlich engagierter Kunst, die offenbar »religiö- sen Hass provozieren« wolle (ein Straftatbestand). In manchen Fällen waren militante orthodoxe »Patrioten« gleich zur Selbstjustiz vorangeschritten, hatten Exponate beschädigt oder zerstört und Zugänge blockiert. Eine Reihe KünstlerInnen wurde auch persönlich bedroht und emigrierte aus dem Land.
Mit dem Film Die Moskauer Prozesse dokumentiert der Schweizer Theater- und Filmregisseur Milo Rau seine gleichnamige Theaterinszenierung vom März 2013 im Moskauer Sacharow-Zentrum für Frieden, Fortschritt und Menschenrechte. Diese rollte die Auseinandersetzung um zwei vieldiskutierte, abgebrochene und in Teilen zerstörte Ausstellungen in eben diesem Sacharow-Zentrum (Vorsicht, Religion, 2003, Verbotene Kunst, 2006) sowie um die hochpolitische Pussy-Riot-Aktion von 2010 in der Christ-Erlöser-Kathedrale neu auf, in der Form einer »offenen Gerichtsshow«.
Dieses offene Setting erwies sich als unerwartet produktiv: Kern der Inszenierung, für die der Regisseur lediglich die russische Gesetzgebung als verbindlichen Rahmen und keinerlei eigenen Text vorgegeben hatte, waren die Kreuzverhöre von geladenen Zeugen durch »Verteidigung« und »Staatsanwaltschaft«. Im Verlauf von drei Tagen entfaltete sich in zuweilen hochaggressiver Form und Lautstärke ein Panorama gegenwärtiger Auseinandersetzungen und Konflikte in der Gesellschaft. Der Film beleuchtet diese in später eingespielten Interviews mit verschiedenen Beteiligten.
Ein größerer Teil der AkteurInnen war in der einen oder anderen Form an den realen Prozessen beteiligt gewesen (etwa die Kunstexpertin Katja Djogot, ein nicht inhaftiertes Pussy-Riot-Mitglied, die Verteidigerin Anna Stawizkaja); mit einer Ausnahme vertraten alle Teilnehmenden ihre persönlichen Anschauungen. Eine besondere Rolle kam dem umstrittenen antiliberalen, kremltreuen und höchst eloquenten TVJournalisten Maxim Schewtschenko zu, hier als Vertreter der Staatsanwaltschaft. Sieben angeheuerte »szenefremde« SchöffInnen sollten eine Art Querschnitt durch wichtige Positionen und soziale Gruppen in der Gesellschaft repräsentieren. Außerdem gab es etwa 100 Personen geladenes Publikum. Am Ende unterschied sich das Votum des Gerichts, speziell der Schöffen, erheblich von den rechtskräftig gewordenen Urteilen der »echten« Prozesse.
Ich schließe nicht aus, dass hierzu auch ein, ironisch gesprochen, highlight des dritten Tages beigetragen hat: der überraschende Einbruch des Moskauer Politalltags in den Kunstkontext. Zuerst hielten Beamte der Einwanderungsbehörde den Prozess für zwei Stunden auf, weil sie die angeblich unvollständigen Visaunterlagen der anwesenden Ausländer überprüfen wollten – ein sattsam bekanntes bürokratisches Verfahren, das in heiklen Konfliktsituationen die eigentlichen Intentionen und juristische Haltlosigkeit verschleiern soll. Kurz darauf stürmte eine Patrouille der halboffiziellen Kosakenmilizen herein, die von Beleidigungen der orthodoxen Kirche gehört haben wollten. Eindrucksvoll deeskalierend gestaltete sich in den Tumulten das Zusammengehen von Verteidigung und Anklage zur Rettung des Projekts. Offenbar vertrat selbst Herr Schewtschenko in dieser Situation das Recht auf Meinungs-, Redeund Kunstfreiheit – der zentrale Streitpunkt all dieser einschlägigen Prozesse.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz