
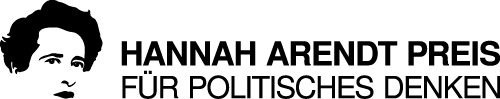

Jill Lepore (* 1966) ist Professorin für amerikanische Geschichte an der Harvard University und seit 2024 auch Professorin an der Harvard Law School sowie Autorin für The New Yorker. Sie ist Autorin zahlreicher preisgekrönter Bücher, darunter der internationale Bestseller These Truths: A History of the United States (2018), und wurde mit bedeutenden Auszeichnungen wie dem Bancroft-Preis und dem PEN Diamonstein-Spielvogel Award for the Art of the Essay geehrt.

© Stephanie Mitchell/Harvard Staff Photographer
Begrüßung Eva Senghaas-Knobloch
Guten Abend meine Damen und Herren!
Dear Prof. Lepore, a warm welcome, what a pity that this meeting with you is only possible by video!
Sehr geehrte Mitglieder von Bürgerschaft und Senat!
Im Namen des Vorstands und der Mitglieder des Vereins „Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken" möchte ich Sie sehr herzlich zur Preisverleihung in diesen besonderen Räumen des altehrwürdigen Rathauses der Freien Hansestadt Bremen begrüßen, unter sehr eingeschränkten Bedingungen, die schon nicht mehr außergewöhnlich sind. Um so mehr freuen wir uns, dass Sie heute hier sind. Ich darf Sie am heutigen Abend durch das Programm führen.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei unserer unabhängigen, internationalen Jury, die sich in schwierigen Zeiten zusammen gefunden hat. Und wir danken ganz besonders unseren Preisstiftern, dem Senat der Freien Hansestadt Bremen und der Heinrich Böll Stiftung, für ihre finanzielle Unterstützung und das markante Zeichen, das sie mit ihrer langjährigen Förderung setzen. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Schäfer, sehr geehrte Frau Dr. Überschär, vielen Dank, dass Sie gleich mit Ihren Grußworten zu uns sprechen werden.
Auch allen, hier im Hause und meinen KollegInnen, die an der Vorbereitung dieses Abends unter schwierigen Umständen mitgewirkt haben, möchte ich danken, – besonders Peter Rüdel für seine umsichtige und immer verlässliche Organisation und Koordination, die dies Jahr ganz besondere Herausforderungen zu meistern hatte; Dank gilt ebenso Michael Ackermann, Ole Schultz und weiteren hilfreichen Personen, die ich hier nicht alle nennen kann.
Der politische Preis, der heute zum 25. Mal verliehen wird, würdigt Menschen, die durch ihr öffentliches Handeln in Schrift und Tat ganz im Sinne von Hannah Arendt zur freiheitlichen Meinungs- und Urteilsbildung beitragen, die eine liberale Demokratie auszeichnen. Das geschieht unter anderem, wenn Kontroversen markiert werden und auf Gedächtnislücken verwiesen wird, wenn Doppelstandards benannt und gegensätzliche geistige Strömungen nachgezeichnet werden, wenn unterdrückten Stimmen das Wort gegeben wird und wenn das, was neu ist in der Erfahrungswelt der Menschen hervorgehoben wird.
Unsere heutige Preisträgerin Jill Lepore macht all dies. Sie ist Professorin für amerikanische Geschichte an der Harvard Universität, Essayistin, die in diversen Zeitschriften publiziert und gefragte Gesprächspartnerin; sie hat die Online-Zeitschrift Commonplace gegründet, einen historischen Roman und zahlreiche wissenschaftliche Bücher geschrieben. Darunter ist das Buch, das auf deutsch den Titel trägt: Diese Wahrheiten (These truths), in Anspielung auf die Worte am Anfang der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776. Neben der Verlagsauflage wurde ihr Buch in Deutschland auch von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgebracht. Es ist eines ihrer Werke, das an konkreten Personen und Begebenheiten die Vielschichtigkeit der amerikanischen Geschichte und ihres Freiheitsgedankens beleuchtet bis in die Gegenwart hinein, in der die Wählerschaft, wie Lepore schreibt, »auf dem Ozean des Internets hin und her schwankt.«
In welch besonderer Weise unsere Preisträgerin, die Historikerin Jill Lepore, aus Sicht der internationalen Jury den Geist von Hannah Arendt weiterträgt, wird nach den Grußworten der Preisgeber in diesem Jahr von Antonia Grunenberg begründet werden. Antonia Grunenberg ist Professorin für politische Wissenschaft und langjährige Leiterin des Hannah-Arendt-Zentrums an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und viel beachtete Autorin.
Jill Lepore selbst wird nach der Jurybegründung mit ihrer Preisrede im Video zu Wort kommen. Auf Ihren Plätzen haben Sie diese Rede auch in deutscher Übersetzung liegen.
Wir sind glücklich und dankbar, dass wir im Anschluss daran für die Laudatio Prof. Roger Berkowitz gewinnen konnten. Vielen Dank, dass Sie den weiten Weg trotz aller Widrigkeiten auf sich genommen haben. Roger Berkowitz ist als Rechts- und Politikwissenschaftler akademischer Direktor des Hannah-Arendt-Center am Bard College in New York tätig. Und er war zusammen mit Jerome Kohn 2019 selbst Preisträger. Jerome Kohn ist im Juni 90 Jahre alt geworden, wir übermitteln ihm von hier aus unsere herzlichen Glückwünsche für das neue Lebensjahr.
Nach der Laudatio wird die Übergabe des Preises folgen, auch dies unter den obwaltenden Umständen in ungewohnter Weise. Und anders als traditionell darf der Abend heute nicht im Nachbarsaal mit Getränken und weiterführenden Gesprächen ausklingen.
Auch unsere traditionelle Gesprächsrunde am morgigen Vormittag im Institut Francais muss pandemiebedingt leider ausfallen. Es sollte um das »Versprechen der Freiheit« gehen. Aber wir haben fest geplant, dass wir diese Runde am 28. Mai nächsten Jahres im Rahmen eines Kolloquiums nachholen werden.
Damit übergebe ich jetzt das Wort an Frau Bürgermeisterin Schäfer.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Mrs. Lepore,
ich freue mich sehr, Sie im Namen des Senats zur Verleihung des diesjährigen Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken im Bremer Rathaus begrüßen zu dürfen.
1994 wurde dieser Preis ins Leben gerufen, um der deutsch-amerikanischen Denkerin einen angemessenen Platz in der öffentlichen Wahrnehmung zu verschaffen.
Die Initiatorinnen und Initiatoren hatten damals sicher nicht erwartet, dass knapp 30 Jahre später Hannah Arendts Gedanken in den sozialen Netzwerken in Form von sogenannten Memes zahlreich benutzt und verbreitet werden, um aktuelle Geschehnisse zu kommentieren.
Es ist fast schon erschreckend, wie gut sie passen: Äußerungen aus dem Kontext gerissen muten an wie Beschreibung heutiger Phänomene und Ereignisse. Zum Beispiel folgendes Zitat, das zuletzt vielfach geteilt auf Twitter kursierte:
»Der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt […] in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen.«
Hannah Arendt beschreibt wie aktiv die Wirkmechanismen der totalitären Propaganda noch in den Köpfen der Menschen im Nachkriegsdeutschland verankert sind. Das Leugnen des Werts von Tatsachen, der Glaube, dass das Verneinen von Tatsachen demokratisches Handeln sei, der Einsatz und das Hinnehmen von sogenannten »Wahr-Lügen«.
Diesen Verlust des Urteilsvermögens und die Bereitschaft zur Akzeptanz der Lüge finden wir heute wieder im Umgang vieler Menschen mit der Komplexität und den Problemen unserer Zeit. Verstärkt durch globale Unsicherheiten, politische Polarisierung und durch die Algorithmen der digitalen Welt, die die Meinungsbildung durch Zuweisung zu einer »Filterblasen« steuern oder zumindest erschweren. Und wir sehen wie Populisten und Rechte das für sich nutzen.
2016 / 2017 haben wir noch halb entsetzt, halb belustigt auf die USA geblickt, in denen ein Populist zum Präsidenten gewählt wurde, der von „alternativen Fakten" spricht und die Lüge im politischen Diskurs salonfähig macht. Und die Liberalen mit ihrer Faktizität und dem Ringen um das bessere Argument sprachlos zurücklässt. Zu gleich mahnt uns Hannah Arendt nicht mit Zynismus zu reagieren. Roger Berkowitz, der Leiter des New Yorker »Hannah Arendt Center for Politics and Humanity« warnt hier vor einem Kreislauf der Lügen.
Mit dem Erstarken rechter Kräfte in Europa, dem Umgang mit der Klimakrise und spätestens mit Beginn der globalen Pandemie müssen wir uns eingestehen, dass wir in Deutschland und Europa nicht davor gefeit sind. Der Umgang mit der Pandemie führt uns aktuell vor Augen, welches Unvermögen oder gar welcher Unwille in Teilen der Gesellschaft herrscht, zwischen Tatsachen und Meinung zu unterscheiden. Und wie dies von Populisten und Rechten instrumentalisiert wird.
Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit erleben wir postfaktische Angriffe auf die Demokratie. Wir sehen absolute Gleichgültigkeit gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen und Zynismus gegenüber dem öffentlichen Diskurs. »Freiheit« wird zum Totschlagargument gegen Fakten und Selbstdarsteller schwingen sich zu Helden auf, nur, weil sie ihre Meinung sagen auch wenn diese jedweder Vernunft entbehrt.
Freiheitsrechte werden zur Begründung der Ablehnung allem, was dem Individuum als unbequem erscheint hinzugezogen: Sei es das Tragen einer Maske, sich impfen zu lassen, rassistische Wörter zu verbannen oder ein Tempolimit auf der Autobahn.
Der Umgang und die Diskussion mit einer Pandemie ist kein leichter. Wir haben den Spagat zwischen persönlicher Freiheit auf der einen Seite und Schutzmaßnahmen vor Infektion auf der anderen Seite, zu meistern. Die Frage einer Impfpflicht um die Pandemie einzudämmen und auf der anderen Seite das Recht auf Selbstbestimmung. Was richtig und was falsch ist, lässt sich schwer sagen, denn wir alle haben eine Pandemie in dem Ausmaß noch nie erlebt und können nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Wir müssen situativ jede Woche neu entscheiden und klar macht man vielleicht auch mal Fehler. Aber das Misstrauen der Querdenkerbewegung, das über social media völlig hemmungslos verbreitet wird, gegenüber der Politik, der Ärzte, der Impfkommissionen und gegenüber den Statistiken kann ich so nicht nachvollziehen. Es gibt aber ein Argument, das ich überhaupt nicht akzeptieren kann, das ist wenn Querdenker die Corona-Maßnahmen mit dem Dritten Reich vergleichen. Die Schreckensherrschaft und Diktatur im Dritten Reich, KZs, Folter, Krieg, keine Meinungs- und Pressefreiheit – ein Staat in dem es tödlich sein konnte eine andere Meinung zu äußern – das hat aber auch so gar nichts mit der jetzigen Situation zu tun und dieses Agieren und Argumentieren und Dritte-Reich-Vergleiche verbieten sich! Was wir brauchen sind Debatten die verbinden und nicht trennen – nur so können wir die Pandemie bewältigen.
Der heute verliehene Preis fördert »öffentliche Interventionen, in denen Arendtsche Fragen an die Gegenwart herangetragen, neue Verständnisweisen für politische Geschehnisse erprobt werden und die schließlich dazu beitragen, die politische Handlungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.« Er ist ein Beitrag dazu, das – wie Hannah Arendt sagt – »Denken ohne Geländer« zu fördern, das Einnehmen unterschiedlicher Perspektiven.
Mit Jill Lepore würdigt die Jury eine »herausragende Wissenschaftlerin, die es vermag, die amerikanische Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven zu erzählen und zu beleuchten.« Damit erinnert sie ihre Leserschaft daran, dass es die Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger ist, sich zu informieren und eigene Urteile zu bilden, um politisch Handeln zu können. Frau Lepore setzt sich in ihrer Arbeit auseinander mit zentralen Begriffen wie Freiheit, Nation und Nationalismus und versucht diese zu retten.
Liebe Frau Lepore, ich gratuliere Ihnen herzlich zu diesem Preis.
Und ich danke der Jury und dem Verein.
Vielen Dank!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum,
ich freue mich sehr, zur heutigen Preisverleihung des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken einige eröffnende Worte zu sprechen.
Die Jury des Hannah-Arendt-Preises hatte in diesem Jahr eine besonders glückliche Hand. Jill Lepore erfüllt geradezu idealtypisch das Kriterium, ein Denken und Arbeiten, das Nachdenken über die US-amerikanische Gesellschaft im Sinne Hannah Arendts, fortzuführen. Die US-amerikanische Republik hat auch Hannah Arendt über Jahrzehnte beschäftigt.
Zum anderen rückt die Vergabe an die renommierte US-amerikanische Historikerin Jill Lepore in die Aufmerksamkeit, wie sehr dies ein Preis ist, der im Namen einer deutsch-amerikanischen Intellektuellen vergeben wird.
Denn trotz oder gerade weil die Wahl von Joe Biden und Kamala Harris einen lang erhofften Neustart der transatlantischen Beziehungen zu Deutschland und der Europäischen Union ins Rollen gebracht hat: Das Verständnis der Geschichte und der diversen Gesellschaft der Vereinigten Staaten für die deutschsprachige Öffentlichkeit ist und bleibt eine wichtige Aufgabe und Herausforderung für das gemeinsame Gestalten und Wirken.
Jill Lepore ist eine renommierte, mehrfach ausgezeichnete Historikerin. Sie ist Professorin an der Harvard University und seit vielen Jahren einer Fach-Community nicht nur in den USA selbstverständlich bekannt. Einem breiteren deutschsprachigen Lesepublikum wurde sie, auch über Fachkreise hinaus, u. a. durch die Übersetzungen ihrer Geschichte Diese Wahrheiten. Die Geschichte der Vereinigten Staaten bekannt. Die Geschichte schärft den Blick für die USA und deren verfassungsmäßige Versprechen nach gleichen Rechten für alle, die in der US-amerikanischen Geschichte entlang politischer Polarisierungen und Ausschlüsse durch Bewegungen wie das Civil-Rights-Movements erst zu einer politischen Verwirklichung kommen konnten.
Ihr Essay Dieses Amerika. Manifest für eine bessere Nation! (2020) macht dies deutlich und wurde ebenso von einem deutschsprachigen Publikum aufgenommen, das gerade hinsichtlich der Debatte über Nation und politische Zugehörigkeit immer wieder auf die USA schaut. Lepore hat sich zu diesen und weiteren Themen regelmäßig mit Interventionen über die Fachöffentlichkeit hinaus geäußert und publizistisch engagiert, etwa im Magazin New Yorker.
Jill Lepore's Denken lässt sich insoweit noch einmal auf Hannah Arendt beziehen, als sie dem »Geist« der amerikanischen Revolution, von dem auch Arendt gesprochen hat, aus einer historischen Perspektive nachspürt. Die US-amerikanische Verfassung und ihre Überprüfung hinsichtlich der gesellschaftlichen Realität ermöglichen in den Institutionen immer wieder eine Erweiterung von Rechten, die es ermöglichen, das Versprechen einer inklusiven Republik zu realisieren.
Eben dieses Nachdenken über die US-amerikanische Republik hielt nicht nur Arendt für entscheidend, sondern sie empfahl es auch gelegentlich ihren Kolleg:innen jenseits des großen Teiches. Die Arbeiten und das Wirken von Jill Lepore sind ein hervorragender Ausgangspunkt, um diese Fährte in Zukunft weiter zu verfolgen.
In diesem Sinne gratuliere ich Jill Lepore ganz herzlich vonseiten der Heinrich Böll Stiftung als Preisträgerin des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken 2021.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
Liebe Freundinnen und Freunde des Hannah-Arendt-Preises,
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Lassen Sie mich kurz die Begründung der Jury für unsere leider abwesende Preisträgerin vortragen. Die Laudatio werden Sie ja später noch hören. Und es wird Ihnen womöglich auffallen, dass die Perspektive der deutschen Jury und die Würdigung des amerikanischen Laudators unterschiedliche Blickwinkel auf die Preisträgerin öffnen. Genau das ist beabsichtigt bei einem transatlantischen Preis mit einer Namensgeberin, die den Dialog zwischen Europa und Amerika vor über einem halben Jahrhundert so bereicherte, dass wir noch immer davon zehren.
Wir vergeben den Preis in einer Zeit, in der allüberall in der Welt Demokratien attackiert und manipuliert werden – und dies nicht nur von aussen, sondern auch von innen.
Das spektakulärste Beispiel in jüngster Zeit war die Präsidentschaft Donald Trumps. Dieser Präsident hat Teile des amerikanischen Volkes gegen die demokratischen Institutionen seines Landes aufgebracht und einen Grundkonflikt sichtbar gemacht, der dieses Land seit seiner Gründung begleitet: der Streit um das politische und gesellschaftliche Selbstbild der USA nach innen und nach außen.
Die Preisträgerin Jill Lepore hat diesen Grundkonflikt auf eine herausragende Weise verstehbar gemacht, indem sie verdeutlicht, dass die amerikanische Demokratiegeschichte einigen Aufschluss über die Probleme der heutigen Demokratien bereit hält.
Es gibt ja bei der Suche nach einer neuen Preisträgerin, einem neuen Preisträger immer ein Moment, in dem sich in der Jury die Meinung bildet, ja diese oder jenen sollten wir nehmen. Bei der Historikerin Jill Lepore ist es das Zusammentreffen eines Wissensbedürfnisses unsererseits, zu verstehen, wie um aller Welt eine solche Selbstdemontage der amerikanischen Demokratie zu verstehen ist – und eines Buches mit einer reichhaltigen Erzählung über die Vorgeschichte dieses Dilemmas und seine Nachwirkungen bis heute. Es hat die Jury überzeugt, wie Lepore am Beispiel der amerikanischen Demokratie ihre Leser an die Unwägbarkeiten, an die Schwächen und die Stärken der Demokratien generell heranführt.
Sie lässt ihre Leser in die unberechenbaren Dynamiken, in die Antagonismen, die Ideen, die Interessenkonflikte einer der ältesten Demokratien der Welt gleichsam hineinschauen. Sie beschreibt die Geburt der amerikanischen Demokratie als eine Geschichte von Konflikten zwischen konkurrierenden Interessengruppen und Persönlichkeiten: den kolonialen Supermächten England und Frankreich, den Sklaven, den verschiedenen ethnischen Gruppen, den Wirtschaftsinteressen, der politischen Elite, den Frauen … Sie zeigt luzide auf, wie wirtschaftliche Interessen und politische Bestrebungen mit demokratischen Grundideen, zum Beispiel der der Freiheit, kollidieren – und schließlich zum Bürgerkrieg führen – und wie diese Konflikte quasi subkutan die amerikanische Geschichte bis heute begleiten. Und sie veranschaulicht, wie die Grundfrage der amerikanischen Gründung, die Frage, wer als Mensch und somit als freiheitsfähig anzusehen ist, die Gesellschaft bis auf den heutigen Tag spaltet. Damit führt sie uns ein in die Kunst, die Gegenwart der westlichen Demokratien zu verstehen. Es sind sehr oft ähnliche Grundkonflikte, die die Demokratien weltweit von innen her bedrohen: Diktatorische Bestrebungen der Mehrheit; Machtgelüste einer korrupten Minderheit (Washingtoner Elite, politische Klasse, die Reichen, die Ideologen), die sich anmaßt, die Mehrheit zu manipulieren; gesellschaftliche Gruppen, die gegeneinander aufgehetzt werden; der Machtanspruch wirtschaftlicher Interessengruppen; die Ausbeutung der Schwachen; der Kampf um die kulturelle Hoheit; der Versuch, die Gestaltung der Freiheit zu einer Funktion der digitalen Welt zu machen, ich könnte weiter fortfahren.
In der politischen Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika kann sich die demokratische Welt wiedererkennen. Die Bürgerinnen und Bürger von heute können darin sowohl die Schwächen und selbstzerstörerischen Tendenzen wie auch die Stärken der Demokratie erkennen, nämlich die Fähigkeit ihrer Bürgerinnen und Bürger, Machtgelüste zu bremsen, Fehlentscheidungen rückgängig zu machen, sich des Vertrauens des Volkes zu versichern, sich selbst zu einem Neubeginn zu befähigen. Und das ist einzigartig an dieser Form des politischen Zusammenlebens, deren Stabilität so sehr von dieser Fähigkeit abhängt.
Diese Freiheitsfähigkeit gilt es immer wieder wachzurufen und zu regenerieren. Denn sie ist die Basis demokratischen Zusammenlebens. Und das gilt für Europa ebenso wie für die Vereinigten Staaten – und für all jene, die diesen Weg des politischen Zusammenlebens einschlagen wollen.
»Die Geschichte ist für [die Flüchtlinge] kein Buch mit sieben Siegeln«
»History is no longer a closed book to them«
»Die Geschichte ist für [die Flüchtlinge] kein Buch mit sieben Siegeln«, Hannah Arendt, We Refugees
Es ist mir eine Ehre, Sie, Jill Lepore, hier und heute zu würdigen.
Jill Lepore den Hannah-Arendt-Preis zu verleihen, bedeutet, eine gelehrte Denkerin zu ehren, die für die Öffentlichkeit auf eine Weise schreibt, die herausfordert, provoziert und aufklärt. Wie Hannah Arendt verbindet Jill Lepore fundiertes Wissen mit Engagement und Einsicht, um vor einem breiten und gebildeten Publikum zu sprechen.
Lepore ist David Woods Kemper '41 Professor of American History an der Harvard University und Autorin von elf Büchern, darunter These Truths: A History of the United States (2018) und If/Then: How the Simulatics Corporation Invented the Future (2020). Ihr Buch The Secret History of Wonder Woman hat das American History Book Prize gewonnen. Sie ist ehemalige Präsidentin der Society of American Historians und wurde 2014 zur American Historian Laureate ernannt. Außerdem ist sie angestellte Autorin beim The New Yorker Magazine, wo Lepore, mit Essays über amerikanische Geschichte, Politik, und Recht eine nationale sogar internationale Anhängerschaft gefunden hat.
In Ihrem Buch These Truths, macht Lepore die Paradoxe sichtbar, eingefaltet in die vielseitigen Mäntel Amerikanischer Geschichte. In den Hauptflügel dieser Geschichte klingen die Worte von Thomas Jefferson laut. „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness." Es gibt aber andere Wahrheiten, die die amerikanische Geschichte ebenso stark prägten. Der Transport, die Folter und die rassische Versklavung von Millionen Afrikanern und später afrikanische Amerikanerinnen, die Enteignung, Ermordung und Erniedrigung indigener Völker und das Erbe von Rassismus und Imperialismus – all These Truths – Diese Wahrheiten – sind in der amerikanischen Geschichte enthalten.
Der Ehrgeiz von Lepores Geschichte besteht darin, den liberalen Universalismus des amerikanischen Glaubensbekenntnis – life, liberty, and the pursuit of happiness – zu feiern; gleichzeitig bestehet sie darauf zu manifestieren und sinnvoll zu erklären, die unzähligen Wege, in denen der amerikanische Nationalstaat weit hinter seinen Idealen zurückbleibt. Sie stellt Sklaverei neben Freiheit auf die fruchtbaren Grundlagen der amerikanischen Geschichte und nimmt die Wahrheit an, dass das Land »eine Nation ist, die im Widerspruch geboren wurde, Freiheit in einem Land der Sklaverei, Souveränität in einem Land der Eroberung« (786). »Die Wahrheiten, auf denen die Nation gegründet wurde – Gleichheit, Souveränität und Zustimmung« – wurden nie verwirklicht. Das Erzählen von Geschichte, schreibt Lepore, ist ein Kampf darüber, welche Wahrheiten und welche Geschichten wir über uns selbst erzählen werden und erzählen sollen. Es ist der „Kampf, um das Versprechen die Gründungswahrheiten der Nation einzulösen". (787)
In Lepores Wende zum Geschichtenerzählen eröffnet Sie ein wesentliches modernes Problem über das Wesen der Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht mehr, wie in früherer Vergangenheit, ein Mysterium, das nur den Göttern bekannt und in Mythen verpackt ist. Außerdem ist die Wahrheit nicht mehr das, was sie während des langen wissenschaftlichen Zeitalters war, eine Tatsache. Wenn die Wissenschaft behauptet, nur die objektive Wahrheit zu kennen, führt die Forderung nach Wahrheit schnell zu der Erkenntnis, dass alle Wahrheit politisch ist. Wenn die Gerichtsjury ihr Urteil verkündet, ist es von Bedeutung, wer auf der Geschworenenbank sitzt.
In ihrem Podcast The Last Archive geht Lepore der grundsätzlichen Frage nach: »Who Killed Truth?« Nach dem Verlust der einfachen Tatsachen erkennt Lepore, dass wir an der Schwelle zu einer weiteren Transformation des Wahrheitsgedankens stehen. Die Wahrheit ist zunehmend, was wird erkannt durch die Analyse von Daten durch Algorithmen und künstlicher Intelligenz. In ihrem neuesten Buch If/Then: How the Simulatics Corporation Invented the Future thematisiert Lepore die politische Gefahr der Destabilisierung der Wahrheit durch nicht-menschliche Intelligenzen. Wir treten in ein Zeitalter ein, Lepore zeigt es uns, in dem algorithmische Wahrheiten gegen menschliche Wahrheiten ausspielen werden, in denen der Wahrheitsstreit nicht durch menschliche Intelligenz beigelegt werden kann.
Um diese Transformation von der Wahrheit zu verstehen und zu entgegnen, erzählt Lepore Geschichten. Lepore ist eine meisterhafte Erzählerin und hat das Geschichtenerzählen als ein politisches Projekt der nationalen Identifikation bezeichnet. Sie schreibt: „Ob Nationen liberal bleiben können, hängt tatsächlich von der Wiedererholung der vielen Weise der Verstehen ab, was bedeutet, zu einer Nation zu gehören." In einer Welt, in der Nationen existieren und für Millionen ihrer Bürger unwiderstehlich bleiben, »gibt es keinen mächtigeren Weg, die Kräfte von Vorurteilen, Intoleranz und Ungerechtigkeit zu bekämpfen, als durch ein Engagement für Gleichheit, Staatsbürgerschaft und gleiche Rechte, wie sie durch eine Nation mit Gesetzen garantiert werden.« Die liberalen Geschichte der amerikanischen Nation, die Lepore stärken will, verbindet ein Bekenntnis zum amerikanischen Glauben mit einer „klaren Abrechnung mit der amerikanischen Geschichte, ihren Sorgen nicht weniger als ihrem Ruhm". In einer Zeit, in der mächtige politische Kräfte mit rosa Brillen auf die Größe vergangene Zeiten zurückblicken wollen, plädiert Lepore für eine bunte nationale Geschichte, die die viel-strahlende Wahrheit sagt.
Lepores Entschlossenheit, die Wahrheit zu sagen, erinnert an, Hannah Arendts immer wiederkehrendes Bemühen, »zu sagen was ist.« In On Revolution versuchte Arendt, eine Geschichte über die Vereinigten Staaten und ihre Bedeutung als konstitutionelle und föderalistische Republik mit demokratischen Elementen zu erzählen. Arendt argumentiert, dass die Originalität der amerikanischen Revolution darin besteht, dass sie die Erfahrung der Freiheit unnachgiebig umarmt. Unter Freiheit versteht Arendt die Befugnis, im öffentlichen Raum sichtbar zu agieren und sich an der Tätigkeit des Selbstregieren zu beteiligen. Aufbauend auf dieser Erfahrung politischer Freiheit, versuchten die Amerikanische Revolution und ihre verfassungsmäßige Tradition, diese Erfahrung der republikanischen Freiheit zu verallgemeinern.
Aber Arendt bot auch ihre eigene »klare Abrechnung« mit den dunklen Seiten der amerikanischen Geschichte an. Die zielstrebige Freiheitsorientierung der Amerikaner sei nur möglich gewesen, schreibt Arendt, weil sie sich völlig verweigerten, die Erfahrungen derer zu berücksichtigen, die nicht frei seien: Frauen, amerikanische Indianer und vor allem diejenigen, die in rassistischer Versklavung festgehalten werden. Die Tatsache der Sklaverei – die Arendt das „Urverbrechen" der amerikanischen Republik nennt – wurde für sie durch die nahezu absolute Unsichtbarkeit des Elends der Sklaven ausgeglichen. In dieser Blindheit weißer Amerikaner gegenüber der Not der schwarzen Amerikaner (und auch gegenüber Frauen und indigenen Amerikanern) verortet Arendt eines der beunruhigendsten Paradoxe der amerikanischen Nationalgeschichte: dass Amerika sich so voll und ganz dem Streben nach politischer Freiheit widmen könnte zum großen Teil wegen des Urverbrechens der Sklaverei und der Unsichtbarkeit der Sklaven.
Was machen wir mit diesem grundlegenden amerikanischen Paradoxon? Lepore antwortet, dass wir unsere Geschichte neu erzählen müssen, um „Diese Wahrheiten", die wir in Amerika anstreben und die wir bewohnen, zu erweitern. Arendts Antwort lautet, dass wir erkennen müssen, wie außergewöhnlich und zerbrechlich die amerikanische Wahrheit ist, ein Gemeinwesen, das nicht als einheitliche und souveräne Nation, sondern als pluralistische, föderale und freie Republik gebildet wurde. Ein Großteil von Arendts Buch ist ein Bericht über das fehlschlagen der Revolution um Freiheit zu konstituieren. Arendt führt das Versagen der amerikanischen revolutionären Tradition zum großen Teil auf das Versagen der amerikanische Gründerväter zurück, Institutionen der Volksbeteiligung in die Verfassungsstruktur der Vereinigten Staaten einzubeziehen. Sie befürchtet auch, dass das amerikanische Streben nach Freiheit als öffentliches Glück Gefahr läuft, durch ein ebenso amerikanisches Streben nach materiellem Wohlstand korrumpiert zu werden. Und Arendt kämpft mit diesem »Urverbrechen«, das nicht nur die Sklaverei war, sondern auch der vollständige Ausschluss von Sklaven und ihren Nachkommen aus der amerikanischen Erfahrung der öffentlichen Freiheit. Arendt argumentiert, dass der Bürgerkrieg und die 13., 14. und 15. Änderungsanträge nichts ausreichten, um schwarze Amerikaner in die amerikanische Nationalgeschichte einzubeziehen. Es war und bleibt notwendig, schreibt Arendt, die US-Verfassung zu ändern, um ausdrücklich die volle Mitgliedschaft und den Ausschluss ehemaliger Sklaven und schwarzer Amerikaner in der Nation der Vereinigten Staaten zu bekräftigen – etwas, das bis heute nicht geschehen ist.
Arendt und Lepore, beide stellen uns die Frage, wie können wir das Buch der Nationalgeschichte offen halten für ausgegrenzte Gruppen. Vielleicht greift Arendt nirgendwo so direkt ein wie in ihrem Essay „Wir Flüchtlinge". Arendt, ein staatenloser Flüchtling, beginnt: „Vor allem mögen wir es nicht, wenn man uns ‚Flüchtlinge' nennt. Das Wort „Flüchtling" ist ein abstumpfendes Wort. Es zeichnet eine Person von Verlust und Verletzlichkeit. Stattdessen will der Flüchtling als „Neuankömmlinge" oder „Einwanderer" gesehen werden." Aber es ist ein Paradox des gegenwärtigen Systems der internationalen Menschenrechte, dass Flüchtlinge als Flüchtlinge bezeichnet werden müssen, um sich für Hilfe zu qualifizieren. Wir in der internationalen Gemeinschaft bestehen darauf, dass sich Flüchtlinge als Flüchtlinge bezeichnen, dass sie ihre Identität als elend annehmen. Wir bestehen auf ihrer Verachtung als Preis für die Erlösung.
Ein Großteil von Arendts Essay Wir Flüchtlinge ist eine Meditation über Assimilation und Selbstmord als die beiden Fluchtwege, die der Flüchtling vor der Last der Ablehnung hat. Aber Arendt beendet ihren Aufsatz mit dem Hinweis, dass es möglicherweise eine andere Möglichkeit für den Flüchtling gibt. Sie beteuert, dass es einige Flüchtlinge gebe, „die darauf bestehen, die Wahrheit zu sagen, bis hin zur ‚Unanständigkeit'". Wenn die Flüchtlinge „Diese Wahrheit" sprechen, schreibt Arendt auf English: „history is no longer a closed book to them." Auf Deutsch, Arendt schreibt das Gleiche aber dichterischer. Wenn die Flüchtlinge ihre Wahrheit aussprechen, »Die Geschichte ist für sie kein Buch mit sieben Siegeln.«
Indem die Flüchtlinge ihre Wahrheit – die Wahrheit – in einer nationalen und damit in einer menschlichen Welt hineinsprechen, stellen diese Flüchtlinge das nationale Narrativ auf den Kopf und können eine Quelle großen Unbehagens sein. Aber im Austausch für ihre Unbeliebtheit erhalten diese wahrheitssagenden Flüchtlinge einen unschätzbaren Vorteil: Sie treten in das Buch der Geschichte ein. Sie fügen sich in die Geschichte ein und Politik ist für sie nicht mehr das Privileg der Staatsbürger. Um die Wahrheit zu sagen, dass man ein staatenloser, obdachloser und entwurzelter Flüchtling ist, muss man darauf bestehen, dass die umgebende nationale Gesellschaft den Aufstieg einer neuen und immer häufiger werdenden Art von Menschen ernst nimmt. Auf diese Weise kann der die Wahrheit sagende Flüchtling zu einer Avantgarde werden, der Vorbild für einen weltoffenen und postnationalen Bürger ist. Indem er seinen Außenseiterstatus als Flüchtling akzeptiert – was Arendt als »bewussten Paria« bezeichnet – besteht der ehrliche Flüchtling darauf, als politisch bedeutsamer und mächtiger Akteur gesehen und gehört zu werden.
Arendts beharren darauf, dass Flüchtlinge die Tür der Geschichte aufbrechen und in die öffentliche Welt eindringen, ist eine Möglichkeit, das Buch der Geschichte für das Projekt der Neukonstitution zu öffnen. Lepores Forderung, dass wir unsere nationale Geschichte neu erzählen, indem wir die Geschichten derjenigen aufnehmen, die ignoriert, ausgeschlossen und unterdrückt wurden, ist eine weitere Möglichkeit, diese Wahrheiten und Geschichten unserer Vergangenheit und unserer Gegenwart neu zu denken.
Jill Lepore schreibt im Geist Arendts um Geschichte zu erzählen, Geschichte die endlich und irgendwann „Diese Wahrheiten" sagen und jene plurale Öffentlichkeit verwirklichen, die den Idealen der liberalen Universalismus gerecht werden. Jill Lepore den Hannah-Arendt-Preis zu übergeben klingt wie eine dieser Wahrheiten.
(Übersetzung ohne Literaturhinweise)
Hannah Arendt schrieb On Revolution (deutsch: Über die Revolution) 1963 in den Vereinigten Staaten – verfolgt vom Holocaust, Totalitarismus und der Atombombe, zu einer Zeit, die unserem Zeitalter der Pandemien, Überschwemmungen und Brände nicht unähnlich ist, zu einer Zeit, in der es sehr wahrscheinlich schien, dass der Mensch sich selbst und sogar alles Leben auf der Erde zerstören würde.
Das Buch ist eine Hommage an die amerikanische Revolution, die für Arendt den Beginn der Moderne markierte, weil sie aus zwei Teilen bestand, die wie ein Türscharnier zusammenhingen: eine politische Revolution und eine gänzlich neue Verfassung. Der revolutionäre Geist der letzten Jahrhunderte, das heißt der Eifer zur Befreiung und zum Bau eines neuen Hauses, in dem die Freiheit wohnen kann, ist beispiellos in der gesamten bisherigen Geschichte, schrieb sie. Die Befreiung ist die Revolution, das neue Haus ist die Verfassung. Eine Revolution erfordert für Arendt sowohl das Umstürzen – das Vergessen der Vergangenheit – als auch das neu Beginnen. Die Revolution ist das Vergessen, die Verfassung ist der Neubeginn.
Die Herausforderungen des einundzwanzigsten Jahrhunderts erfordern wiederum einen weiteren Neubeginn, einen neuen Konstitutionalismus, der in der Lage ist, die Krisen der biologischen Diversität und des Klimawandels zu bewältigen. Heute Abend möchte ich Arendts Studie Über die Revolution wieder aufgreifen, um für einen solchen neuen Konstitutionalismus zu argumentieren.
Arendt ist vor allem durch ihr Buch The Origins of Totalitarianism (deutsch: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft) bekannt, das sie nach einem Völkermord, dem sie nur knapp entkommen war, geschrieben hatte und das 1951 veröffentlicht wurde. In Origins beklagte Arendt das Entstehen staatenlos gewordener Menschen in der Zwischenkriegszeit – per definitionem vogelfrei und rechtlich keine Rechts-Personen; es war dies der Status der Juden und anderer Minderheiten in Europa, die innerhalb eines Nationalstaates leben, der ihnen aber den Status eines Staatsbürgers verweigerte und die außerhalb der Gerichtsbarkeit des Staates standen, jenseits der Grenzen seiner Gesetze – es gibt kein Gesetz für sie –, eine Position außerhalb des politischen Bereichs, nur noch auf Soziales beschränkt.
Die Bedingungen, unter denen sie lebten, die Verträge, die sie vor der Verletzlichkeit aufgrund ihrer Staatenlosigkeit »schützen« sollten, die Art und Weise, in der sie sich selbst im Verhältnis zu der Gemeinschaft der Staatsbürger beschrieben, reduzierten sie auf Tiere. Dieses Thema griff Arendt auch in ihrem Buch The Human Condition (1958) (deutsch: Vita Activa) auf.
In On Revolution wandte sich Arendt dem achtzehnten Jahrhundert zu. Der größte Teil des Buches befasst sich mit dem Vergleich der Amerikanischen mit der Französischen Revolution; Arendt zog die Amerikanische vor, weil es dieser besser gelang, vom Machen einer Revolution zum Machen einer Verfassung zu kommen, – aber auch, weil die Amerikanische Revolution sich – ihrer Meinung nach – nie von dem ablenken ließ, was sie als lediglich soziale Fragen, wie Armut, bezeichnete. Nach Arendts Verständnis rebellieren die Armen (Revolutionäre), weil sie elend sind, und die Guten (Revolutionäre) revoltieren, weil sie frei sein wollen; und obwohl die Guten vielleicht die Hilfe der Armen brauchen, sollten sie diese nicht ausufern lassen, weil deren Bedürftigkeit die Revolution zum Scheitern bringt und eine Schreckensherrschaft einleitet. Gleichwohl, so Arendt, geschieht genau dies sehr oft. Für Arendt war die Amerikanische Revolution eine gute Revolution, die Französische Revolution eine schlechte, und alle späteren Revolutionen waren Französisch, bis zur Ungarischen Revolution von 1956, die der amerikanischen glich.
Die Amerikanische Revolution begann mit dem Trennen, dem Vergessen menschlicher Beziehungsweisen (bisheriger Ausprägung) in der Unabhängigkeitserklärung von Jahr 1776, und sie endete 1787 mit der Einführung einer neuen Verfassung. Arendt nahm die Grausamkeit der Sklaverei zur Kenntnis, unter der zur Zeit der Amerikanischen Revolution fünfhunderttausend Menschen in einem Ungleichheitsstatus lebten, der weit niedriger war als der Status der Armut. Sie bedauerte deren Lebensbedingungen als „vollständige Not und des Elend". Aber sie überzeugte sich selbst, dass die Verwerflichkeit der Sklaverei so wenig relevant war für die Amerikanische Revolution und so weit entfernt vom Raum des Politischen, dass sie nicht einmal als soziale Frage zählte. Im Gegensatz zu den halb verhungerten französischen Massen revoltierten damals die Amerikaner gegen Tyrannei und Unterdrückung, nicht gegen Ausbeutung und Armut.
Arendts Verständnis der Amerikanischen Revolution spiegelte perfekt die führende Geschichtswissenschaft ihrer Zeit. Doch nach dem Erscheinen von On Revolution nahm die Erforschung der Amerikanischen Revolution neue Fahrt auf. Marxistische HistorikerInnen zeigten auf, dass der Impetus zur Revolution vielfach von Seiten der Armen gekommen war. HistorikerInnen der Frauengeschichte, der indigenen Völker und der Afroamerikaner stellten die Revolution in den Kontext der umfassenderen Kämpfe um Emanzipation, Souveränität und Unabhängigkeit, einschließlich der Indianerkriege, Frauenproteste und Sklavenaufstände – einschließlich der Haitianischen Revolution.
Die Haitianische Revolution begann 1791, als versklavte Menschen auf Saint-Domingue für sich die versprochenen Rechte in der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 einforderten, deren erster Artikel lautete: Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. Im Jahr 1794 schaffte Frankreich die Sklaverei ab und gewährte den Schwarzen in Saint-Domingue die französische Staatsbürgerschaft, obwohl es eine französische Kolonie blieb.
Im Jahr 1801 verabschiedete Haiti eine Verfassung, in der es hieß: Auf diesem Territorium darf es keine Sklaven geben und Alle Menschen werden geboren, leben und sterben als freie Franzosen. Nachdem Napoleon jedoch versucht hatte, die Sklaverei in Saint-Domingue wieder einzuführen, führte der Revolutionär Jean-Jacques Dessalines eine Bewegung für die Unabhängigkeit an. Im Jahr 1804 erklärte Haiti seine Unabhängigkeit und war damit erst das zweite Land in Amerika, das eine neue Freiheit gründete.
WissenschaftlerInnen, die sich in letzter Zeit mit Arendts Auslassung der Haitianischen Revolution befasst haben, haben jeweils unterschiedlich geschrieben, dass sie an rassistischen Vorurteilen gelitten habe, an einer analytischen Blindheit aufgrund ihres philosophischen Idee, dass Ungleichheit lediglich ein soziales Problem sei oder – epistemisch gesehen – an „weißer Ignoranz", einer Unfähigkeit, die Struktur der rassischen Ungleichheit zu begreifen. Doch diese Kritiken ignorieren vieles, was Arendt über Rasse und auch über die Sklaverei geschrieben hat, was vielfach aus ihrer Analyse der Staatenlosigkeit in dem Buch Ursprünge des Totalitarismus folgte, in dem sie schrieb: Wenn ein Neger in einer weißen Gemeinschaft als Neger und als nichts anderes betrachtet wird, verliert er mit seinem Recht auf Gleichheit auch die Freiheit zu handeln, die spezifisch menschlich ist; alle seine Taten werden nun als ‚notwendige' Folge der Neger-Eigenschaften erklärt; er ist zu einem Exemplar einer Tierart geworden, die man Mensch nennt. Wie die Juden im Deutschland der Zwischenkriegszeit standen auch die Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten unter Jim Crow ((>ein Slangbegriff für die Zeit der Rassischen Segregation≤ , d. Ü.)) außerhalb der Grenzen des Rechts, waren Menschen, die auf den Status der Staatenlosigkeit reduziert waren, wie Tiere.
Aber wie steht es dann um den Schutz der Verfassungen? Eine Verfassung ist eine Norm, ein Pfeiler und ein Band der Zusammengehörigkeit, wenn sie verstanden, gebilligt und geliebt wird, schrieb John Adams. Aber ohne diese Intelligenz und Anhänglichkeit könnte sie genauso gut ein Drachen oder Ballon sein, der in die Luft fliegt, so Arendt. Frankreich baute nur Verfassungsdrachen. Arendt führt an, dass die Autorität der ersten 1791 in Frankreich geschriebenen Verfassung durch die rasche Folge einer neuen Verfassung nach der anderen in einer Lawine von Sukzessionen verloren ging, so dass selbst der Begriff der Verfassung begraben wurde. Auch Haitis Unabhängigkeitserklärung von 1804 litt unter einer Lawine von Verfassungen, sieben in fünfzehn Jahren.
Für Arendt bedeutet eine Verfassung einen Neuanfang, der die Ungerechtigkeiten der Geschichte auslöscht und die Welt neu beginnen lässt. Aber die haitianische Unabhängigkeitserklärung von 1804, die eine Revolution verfassungsmäßig festschrieb, hatte einen politischen Körper durch den Akt des Erinnerns geschaffen. Dort heißt es: Der französische Name verfolgt noch immer unser Land. Alles weckt die Erinnerung an die Grausamkeiten dieses barbarischen Volkes. Bürger einer Republik zu sein, deren Ursprünge in der menschlichen Sklaverei liegen, so die Philosophin Jennifer Gaffney, bedeutet Verantwortung für die Erinnerung an deren Grausamkeiten zu tragen. Arendt sieht die Beziehung zwischen Revolution und Verfassung als Befreiung und als Bau eines neuen Hauses, in dem die Freiheit wohnen kann; Gaffney legt nahe, dass es in diesem Haus spukt.
Eine Verfassung macht mehr als nur eine Regierung zu etablieren. Sie schafft Bürger und garantiert ihre Rechte. Aber was ist mit den Wesen, die durch eine Verfassung auf den Status der Staatslosigkeit reduziert werden? Die U.S. Verfassung von 1787 enthielt keine Bestimmungen für Tiere oder für Prärien oder Flüsse oder Berge oder Seen. Sie enthielt auch keine Bestimmungen für Frauen oder Kinder, und die einzige Bestimmung, die sie für die Ureinwohner hatte und für die Afrikaner und ihre Nachkommen, die in Sklaverei oder Knechtschaft gehalten wurden, war mathematisch: Die politische Vertretung der Gebietskörperschaften im Kongress wurde so berechnet, dass die „freien Personen" zusammengezählt wurden, unter Abzug der nicht besteuerten Indianer, aber mit Hinzufügung der in Knechtschaft/Sklaverei gehaltenen Menschen als drei Fünftel aller anderen Personen, denn auch sie waren nach dem Gesetz der Sklaverei keine Personen, sondern Eigentum: also Dinge, menschliche Nicht-Personen. Als im Kongress die Frage aufgeworfen wurde, ob in diesem Fall domestizierte Tiere wie Rinder für die Repräsentation zählen sollten, stellte Benjamin Franklin eine Faustregel dafür auf, wie man den Unterschied zwischen Personen und Dingen erkennen kann: Schafe werden nie einen Aufstände machen.
In den Vereinigten Staaten brauchte es einen Bürgerkrieg, um unter Klausel der equal protection des vierzehnten Verfassungszusatzes festzusetzen, dass alle Menschen Personen sind. Im Jahr 1866 endete die entsprechende Beratung des Kongresses, führte aber zu einer irritierenden Frage aus dem Plenum: weibliche ebenso wie männliche? Die Klärung dieser Frage dauerte ein weiteres Jahrhundert.
Arendts politischer Raum schloss Armut und Sklaverei als rein soziale Fragen aus. Aber eine Einbeziehung des Sozialen in eine neue Konzeption des Politischen geht bei weitem noch nicht weit genug. Jede neue verfassungsrechtliche Regelung muss das Natürliche mit einbeziehen indem sie den wachsenden Umfang rechtswissenschaftlichen Denkens nicht über natürliche Rechte, sondern über die Rechte der Natur aufnimmt. Arendts Buch Über die Revolution erschien 1963, nur wenige Monate nach der Veröffentlichung von Silent Spring, (dem Buch,) in dem Rachel Carson den politischen Körper als untrennbar von der natürlichen Welt dachte. Es löste eine Bewegung aus, sowohl das Menschliche als auch das Nicht-Menschliche – Tiere, Pflanzen, Gewässer, Lebensräume, Wildnis – als verfassungsrelevant zu behandeln
In den USA und in vielen anderen Teilen der Welt wurden Gesetze zum Schutz der Umwelt erlassen, die Umweltverschmutzung zu regulieren; gefährdete Arten und den Lebensraum von Wildtieren zu erhalten und den Klimawandel zu stoppen, wurden bereits in den frühen 1970er Jahren erlassen, so der Clean Water Act, der Environmental Policy Act und die Einrichtung der Environmental Protection Agency. Der erste Vorschlag, die Verschlechterung der Umwelt durch eine Verfassungsänderung zu behandeln, kam 1970, als der Senator von Wisconsin, Gaylord Nelson, der auch den Erdtag ins Leben rief, eine Änderung vorschlug, die lauten sollte: Jeder Mensch hat das unveräußerliche Recht auf eine menschenwürdige Umwelt. Die Vereinigten Staaten und jeder Staat sollen dieses Recht garantieren. Aber zu diesem Zeitpunkt war die US-Verfassung bereits praktisch unabänderlich geworden. Immer wieder wurden Vorschläge zum Schutz der Umwelt folgenlos eingebracht: Das Recht eines jeden Menschen auf saubere und gesunde Luft und gesundes Wasser und auf den Schutz der anderen natürlichen Ressourcen der Nation darf von niemandem verletzt werden. Niemand darf das Recht auf saubere Luft und gesundes Wasser und auf den Schutz anderer natürlicher Ressourcen der Nation verletzen, hieß es in einem Antrag, der von Gesetzgebern aus siebenunddreißig Bundesstaaten unterstützt wurde. Sie wurden nicht aufgenommen. Da in der US-Verfassung kein Wort über die Umwelt zu finden ist, sind legislative und gesetzliche Maßnahmen außerordentlich verletzbar: Zwischen 2017 und 2021 hat die Trump-Administration mehr als einhundert Umweltbestimmungen zurückgenommen. Die Regierung Biden hat die Wiederherstellung dieser Bestimmungen und die Aufnahme weiterer zu einer oberste Priorität gemacht, aber alle diese Maßnahmen können rückgängig gemacht werden.
Andere Länder haben ihre Verfassungen geändert. Von den 148 Verfassungen der Welt enthalten einige auch solche Bestimmungen, die als Umweltkonstitutionalismus bezeichnet werden. Der Konstitutionalismus für Tiere hat seine Spuren hinterlassen. 1976 verabschiedete Indien, unter dem Einfluss des Hinduismus eine Verfassungsänderung, die es zur Pflicht eines jeden Bürgers machte, die natürliche Umwelt zu schützen und zu verbessern, einschließlich der Wälder, Seen, Flüsse und die Wildnis zu schützen und zu verbessern und Mitgefühl für Lebewesen zu haben. Dies wurde nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs 2014 als die Magna Charta der Tierrechte bezeichnet, in einer Entscheidung, bei welcher der Gerichtshof Mitgefühl als Sorge um Leidende definierte. Im Jahr 2002 änderte Deutschland auf Drängen der Grünen Partei die Bestimmungen des Grundgesetzes ((in Artikel 20a)) über die „Verantwortung des Staates gegenüber künftigen Generationen" – mit Blick auf Verpflichtungen des Staates gegenüber der Natur – um drei Worte: »und den Tieren«.
Ein Großteil der amerikanischen Geschichte ist die Geschichte von Menschen, Rechten und Pflichten, die aus der verfassungsmäßigen Ordnung ausgeklammert waren und ihren Weg in diese Ordnung hinein fanden, insbesondere durch Verfassungsänderungen. Der Zweck von Verfassungsänderungen, wie sie die frühen Amerikaner verstanden, war es, die Fehler zu korrigieren, die sich im Laufe der Zeit oder durch veränderte Umstände eingeschlichen haben. Ohne Änderungen, so glaubten sie, gäbe es keine Möglichkeit, einen grundlegenden Wandel herbeizuführen, außer durch eine Revolution: einen immerwährenden Aufstand. Aber so wie die friedliche Machtübergabe ist auch die Befugnis zur Revision der Verfassung nicht mehr verlässlich. Sinnvolle Änderungen sind seit den 1970er Jahren so gut wie unmöglich geworden, gerade als die Umwelt- und Tierrechtsbewegungen an Stärke gewannen.
Die US-Verfassung ist so gut wie unveränderbar geworden; nur die natürliche Welt ändert sich. Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Philadelphia betrug 1787 zweiundfünfzig Grad Fahrenheit. 2017 waren es neunundfünfzig. Letztes Jahr berichtete die World Wildlife Foundation, dass die Wildtierpopulationen rund um den Globus im letzten halben Jahrhundert um zwei Drittel zurückgegangen sind. Wir ruinieren unsere Welt, sagte der Leiter der Stiftung. Die meisten der jüngsten Fälle von Aussterben sind nicht auf den Klimawandel zurückzuführen, sondern auf den Verlust von Lebensräumen. Inzwischen schlagen die Gewalt menschlicher Eroberung von Tier-Territorien und die Grausamkeiten der Massentierhaltung zurück, Krankheiten werden vom Tier auf den Menschen und wieder zurück übertragen. Nahezu fünf Millionen Menschen sind bisher an dem Coronavirus gestorben, das nicht die letzte zoonotische Krankheit sein wird. Nachdem der Mensch den Lebensraum vieler anderer Arten auf der Welt zerstört hat, zerstört er nun auch seinen eigenen. Neue internationale und bundesstaatliche Gesetze könnten helfen, aber die meisten Umweltvereinbarungen sind unverbindlich, die Vereinigten Staaten haben sich weitgehend aus der Welt zurückgezogen und der Kongress funktioniert kaum noch.
Da so viele Wege versperrt waren, begannen Umweltschützer und Tierschützer für die Rechte der Natur zu streiten. Im Jahr 1972 veröffentlichte der Juraprofessor Christopher Stone in der Law-Review Artikel mit dem Titel Should Trees Have Standing? Stone argumentierte, dass die Geschichte des Rechts ein moralischen Fortschritt ist, bei dem die Vorstellung, eine rechtstragende Person zu sein, auf eine immer größer werdende Klasse von Akteuren ausgedehnt wurde: von nur bestimmten Männern auf mehr Männer, dann auf einige Frauen und schließlich auf alle Erwachsenen und dann auf Kinder und sogar auf Unternehmen und Schiffe. Warum nicht auch Bäume und Flüsse und Bäche? Rechtsmittel für Umweltschäden könnten dann nicht nur von den Menschen eingelegt werden, die von diesen Schäden betroffen sind, sondern auch im Namen der Umwelt selbst. Stone erklärte vor einem halben Jahrhundert, dass er diese Lösung als das bestmögliche Mittel gegen eine drohende Katastrophe ansehe, um einer drohenden Katastrophe zu begegnen. Wissenschaftler haben vor den Krisen gewarnt, die der Erde und allen Menschen auf der Erde drohen, wenn wir unser Verhalten nicht radikal ändern, schrieb Stone. Die Atmosphäre der Erde selbst ist mit beängstigend Möglichkeiten bedroht: Die Absorption von Unlicht, von dem der gesamte Lebenszyklus abhängt, könnte verringert werden; die Ozeane könnten sich erwärmen (was den Treibhauseffekt der Atmosphäre erhöht), was das Abschmelzen der Polkappen und die Zerstörung unserer großen Küstenstädte zur Folge haben wird.
Ein neuerer wegweisender Gerichtsfall erweitert Stones Arbeit und argumentiert für die Persönlichkeit eines Elefanten. Das Nonhuman Rights Projekt führt dieses Jahr im Namen eines asiatischen Elefanten namens Happy eine sog. Habeas-Corpus-Klage gegen den Bronx Zoo in New York. Das Projekt ist inspiriert von den Abolitionisten, die argumentierten, dass Menschen, die in Sklaverei/Knechtschaft gehalten werden, kein Eigentum, sondern Personen sind.
Das Nonhuman Rights Projekt begann seine Rechtsprozesse in New York im Jahr 2013 mit einer Habeas-Corpus-Petition für einen Schimpansen namens Kiko. Das Gericht wies die Petition mit der Begründung ab: Der Petent führt keinen Präzedenzfall an, und es scheint auch keinen zu geben – weder nach staatlichem Recht, noch nach englischen Gewohnheitsrecht – , dass ein Tier als ‚Person' im Sinne des Common Law Habeas Corpus angesehen werden könnte. Tatsächlich wurde Habeas-Corpus-Hilfe noch nie für ein nicht-menschliches Wesen gewährt.
Im Jahr 2016, nachdem das Nonhuman Rights Project eine zweite Habeas-Corpus-Petition für Kiko eingereicht hatte, reichte Laurence Tribe von der Harvard Law School ein Amicus Brief ((eine dem deutschen Recht fremde Rechtspraxis in USA, d. Ü.)) ein. Es bestritt die Aussage des Gerichts, dass Kiko mit der Begründung, dass Personen sowohl Rechte und Pflichten haben, keine Person sein könne: Diese Definition, die auf den ersten Blick Föten im dritten Trimester sowie Kinder und komatöse Erwachsene ausschließen würde (neben anderen Personen, deren Rechte als Personen das Gesetz schützt), missversteht die Beziehung zwischen Rechten, Pflichten und Personsein in erheblichem Maße. Im Jahr 2018 hat das New Yorker Berufungsgericht einen Antrag auf Zulassung der Berufung abgelehnt, aber ein Richter räumte ein, dass die Frage irgendwann geklärt werden muss und merkte an, dass die Streitfrage, ob ein nichtmenschliches Tier ein Grundrecht auf Freiheit hat, das durch das Habeas-Corpus-Gesetz geschützt ist, grundlegend und weitreichend ist. Es spricht für unsere Beziehung zu allem Leben um uns herum und wir werden es nicht ignorieren können. Es kann zwar argumentiert werden, dass ein Schimpanse keine »Person« ist. Es besteht aber kein Zweifel, dass es nicht nur ein Ding ist.
Dass Schimpansen eine Person sind, wurde – zumindest theoretisch – bereits an anderer Stelle festgestellt. Im Jahr 2016 hatte ein Gericht in Argentinien eine Habeas-Corpus-Petition abgewiesen, die von einer Tierrechtsorganisation im Namen eines Schimpansen namens Cecilia mit der Begründung, dass die Organisation keine Klagebefugnis habe. Aber es bestand darauf, dass Cecilia selbst eine Klagebefugnis hat, entschied, dass ein Schimpanse keine Sache ist, und erklärte, dass Menschenaffen juristische Personen mit Rechtsfähigkeit sind, jedoch nicht in der Lage, als solche zu handeln. Dies wird in diesem Fall durch die Evidenz bestärkt, dass Schimpansen die geistigen Fähigkeiten eines eines 4-jährigen Kindes haben. Ihre Rechte sind zwar nicht mit den Menschenrechten gleichzusetzen, aber das Gericht erklärte, dass sie das grundlegende Recht, in einer artgerechten Umgebung geboren zu werden, zu leben, zu wachsen und zu sterben haben. In einer Entscheidung aus dem Jahr 2019 in Indien, bei der es um eine Kuh ging, schrieb der Richter: Das gesamte Tierreich, einschließlich der Vogel- und Wasserwelt, werden zu Rechtssubjekten erklärt, die eine eigene Persönlichkeit mit mit den entsprechenden Rechten, Pflichten und Verbindlichkeiten einer lebenden Person und erklärte, dass alle Bürger in loco parentis als das menschliche Gesicht für das Wohlergehen und den Schutz der Tiere eintreten.
Im Jahr 2019 versuchte das Nonhuman Rights Project einen Habeas-Corpus-Rechtsschutz für drei Elefanten in Connecticut. In der mündlichen Verhandlung befragten die Richter den Vertreter des Projekts, Steven Wise, zu den Implikationen der Tierpersönlichkeit:
Der Richter: Gilt Ihr Argument auch für andere Tiere in freier Wildbahn?
Wise: Unsere Argumentation erstreckt sich auf Elefanten.
Der Richter: Ich frage Sie, weil es eine logische Frage ist, wie weit diese Behauptung geht. Sie bitten ein Gericht, nicht den Gesetzgeber, eine radikale Änderung des Gesetzes vorzunehmen, und ich möchte Sie bitten, eine Prognose darüber abzugeben, wohin das führt.
Wise hat diese Frage nie beantwortet. Es wird erwartet, dass der Fall Happy das New Yorker Berufungsgericht im Jahr 2022 beschäftigen wird.
Kein Fall wie der von Happy hat jemals ein so hohes Gericht erreicht, nirgendwo in der englischsprachigen Welt. In einer Zeit des Massensterbens und der Klimakatastrophe werden hier Fragen, aufgeworfen über die Beziehung zwischen Menschen, Tieren und der natürlichen Welt, die die Zukunft des Lebens auf der Erde betreffen, Fragen, für deren Beantwortung das geltende Recht katastrophal schlecht gerüstet ist. Unterdessen steigen die Gewässer. Menschen, vor allem die Armen leiden und sterben, Krankheiten breiten sich aus, Häuser werden weggespült, Wälder sterben, Vermögen gehen verloren, Lebensräume verschwinden, Arten sterben aus. Das Haus, in dem die Freiheit wohnt, wird von den Gespenstern der Grausamkeiten, Massakern und Gräuelaten heimgesucht. In ihm haben sich die Menschen selbst zu einer gefangenen Spezies gemacht, die auf eine neue Revolution warten.
Anmerkung d. Ü.: Bei Kursivschreibung liegt im amerikanischen Redemanuskript ein Zitat aus einem anderen Originaltext vor.
Jill Lepore (* 1966) ist Professorin für amerikanische Geschichte an der Harvard University und seit 2024 auch Professorin an der Harvard Law School sowie Autorin für The New Yorker. Sie ist Autorin zahlreicher preisgekrönter Bücher, darunter der internationale Bestseller These Truths: A History of the United States (2018), und wurde mit bedeutenden Auszeichnungen wie dem Bancroft-Preis und dem PEN Diamonstein-Spielvogel Award for the Art of the Essay geehrt.

© Stephanie Mitchell/Harvard Staff Photographer
Begrüßung Eva Senghaas-Knobloch
Guten Abend meine Damen und Herren!
Dear Prof. Lepore, a warm welcome, what a pity that this meeting with you is only possible by video!
Sehr geehrte Mitglieder von Bürgerschaft und Senat!
Im Namen des Vorstands und der Mitglieder des Vereins „Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken" möchte ich Sie sehr herzlich zur Preisverleihung in diesen besonderen Räumen des altehrwürdigen Rathauses der Freien Hansestadt Bremen begrüßen, unter sehr eingeschränkten Bedingungen, die schon nicht mehr außergewöhnlich sind. Um so mehr freuen wir uns, dass Sie heute hier sind. Ich darf Sie am heutigen Abend durch das Programm führen.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei unserer unabhängigen, internationalen Jury, die sich in schwierigen Zeiten zusammen gefunden hat. Und wir danken ganz besonders unseren Preisstiftern, dem Senat der Freien Hansestadt Bremen und der Heinrich Böll Stiftung, für ihre finanzielle Unterstützung und das markante Zeichen, das sie mit ihrer langjährigen Förderung setzen. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Schäfer, sehr geehrte Frau Dr. Überschär, vielen Dank, dass Sie gleich mit Ihren Grußworten zu uns sprechen werden.
Auch allen, hier im Hause und meinen KollegInnen, die an der Vorbereitung dieses Abends unter schwierigen Umständen mitgewirkt haben, möchte ich danken, – besonders Peter Rüdel für seine umsichtige und immer verlässliche Organisation und Koordination, die dies Jahr ganz besondere Herausforderungen zu meistern hatte; Dank gilt ebenso Michael Ackermann, Ole Schultz und weiteren hilfreichen Personen, die ich hier nicht alle nennen kann.
Der politische Preis, der heute zum 25. Mal verliehen wird, würdigt Menschen, die durch ihr öffentliches Handeln in Schrift und Tat ganz im Sinne von Hannah Arendt zur freiheitlichen Meinungs- und Urteilsbildung beitragen, die eine liberale Demokratie auszeichnen. Das geschieht unter anderem, wenn Kontroversen markiert werden und auf Gedächtnislücken verwiesen wird, wenn Doppelstandards benannt und gegensätzliche geistige Strömungen nachgezeichnet werden, wenn unterdrückten Stimmen das Wort gegeben wird und wenn das, was neu ist in der Erfahrungswelt der Menschen hervorgehoben wird.
Unsere heutige Preisträgerin Jill Lepore macht all dies. Sie ist Professorin für amerikanische Geschichte an der Harvard Universität, Essayistin, die in diversen Zeitschriften publiziert und gefragte Gesprächspartnerin; sie hat die Online-Zeitschrift Commonplace gegründet, einen historischen Roman und zahlreiche wissenschaftliche Bücher geschrieben. Darunter ist das Buch, das auf deutsch den Titel trägt: Diese Wahrheiten (These truths), in Anspielung auf die Worte am Anfang der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776. Neben der Verlagsauflage wurde ihr Buch in Deutschland auch von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgebracht. Es ist eines ihrer Werke, das an konkreten Personen und Begebenheiten die Vielschichtigkeit der amerikanischen Geschichte und ihres Freiheitsgedankens beleuchtet bis in die Gegenwart hinein, in der die Wählerschaft, wie Lepore schreibt, »auf dem Ozean des Internets hin und her schwankt.«
In welch besonderer Weise unsere Preisträgerin, die Historikerin Jill Lepore, aus Sicht der internationalen Jury den Geist von Hannah Arendt weiterträgt, wird nach den Grußworten der Preisgeber in diesem Jahr von Antonia Grunenberg begründet werden. Antonia Grunenberg ist Professorin für politische Wissenschaft und langjährige Leiterin des Hannah-Arendt-Zentrums an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und viel beachtete Autorin.
Jill Lepore selbst wird nach der Jurybegründung mit ihrer Preisrede im Video zu Wort kommen. Auf Ihren Plätzen haben Sie diese Rede auch in deutscher Übersetzung liegen.
Wir sind glücklich und dankbar, dass wir im Anschluss daran für die Laudatio Prof. Roger Berkowitz gewinnen konnten. Vielen Dank, dass Sie den weiten Weg trotz aller Widrigkeiten auf sich genommen haben. Roger Berkowitz ist als Rechts- und Politikwissenschaftler akademischer Direktor des Hannah-Arendt-Center am Bard College in New York tätig. Und er war zusammen mit Jerome Kohn 2019 selbst Preisträger. Jerome Kohn ist im Juni 90 Jahre alt geworden, wir übermitteln ihm von hier aus unsere herzlichen Glückwünsche für das neue Lebensjahr.
Nach der Laudatio wird die Übergabe des Preises folgen, auch dies unter den obwaltenden Umständen in ungewohnter Weise. Und anders als traditionell darf der Abend heute nicht im Nachbarsaal mit Getränken und weiterführenden Gesprächen ausklingen.
Auch unsere traditionelle Gesprächsrunde am morgigen Vormittag im Institut Francais muss pandemiebedingt leider ausfallen. Es sollte um das »Versprechen der Freiheit« gehen. Aber wir haben fest geplant, dass wir diese Runde am 28. Mai nächsten Jahres im Rahmen eines Kolloquiums nachholen werden.
Damit übergebe ich jetzt das Wort an Frau Bürgermeisterin Schäfer.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Mrs. Lepore,
ich freue mich sehr, Sie im Namen des Senats zur Verleihung des diesjährigen Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken im Bremer Rathaus begrüßen zu dürfen.
1994 wurde dieser Preis ins Leben gerufen, um der deutsch-amerikanischen Denkerin einen angemessenen Platz in der öffentlichen Wahrnehmung zu verschaffen.
Die Initiatorinnen und Initiatoren hatten damals sicher nicht erwartet, dass knapp 30 Jahre später Hannah Arendts Gedanken in den sozialen Netzwerken in Form von sogenannten Memes zahlreich benutzt und verbreitet werden, um aktuelle Geschehnisse zu kommentieren.
Es ist fast schon erschreckend, wie gut sie passen: Äußerungen aus dem Kontext gerissen muten an wie Beschreibung heutiger Phänomene und Ereignisse. Zum Beispiel folgendes Zitat, das zuletzt vielfach geteilt auf Twitter kursierte:
»Der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt […] in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen.«
Hannah Arendt beschreibt wie aktiv die Wirkmechanismen der totalitären Propaganda noch in den Köpfen der Menschen im Nachkriegsdeutschland verankert sind. Das Leugnen des Werts von Tatsachen, der Glaube, dass das Verneinen von Tatsachen demokratisches Handeln sei, der Einsatz und das Hinnehmen von sogenannten »Wahr-Lügen«.
Diesen Verlust des Urteilsvermögens und die Bereitschaft zur Akzeptanz der Lüge finden wir heute wieder im Umgang vieler Menschen mit der Komplexität und den Problemen unserer Zeit. Verstärkt durch globale Unsicherheiten, politische Polarisierung und durch die Algorithmen der digitalen Welt, die die Meinungsbildung durch Zuweisung zu einer »Filterblasen« steuern oder zumindest erschweren. Und wir sehen wie Populisten und Rechte das für sich nutzen.
2016 / 2017 haben wir noch halb entsetzt, halb belustigt auf die USA geblickt, in denen ein Populist zum Präsidenten gewählt wurde, der von „alternativen Fakten" spricht und die Lüge im politischen Diskurs salonfähig macht. Und die Liberalen mit ihrer Faktizität und dem Ringen um das bessere Argument sprachlos zurücklässt. Zu gleich mahnt uns Hannah Arendt nicht mit Zynismus zu reagieren. Roger Berkowitz, der Leiter des New Yorker »Hannah Arendt Center for Politics and Humanity« warnt hier vor einem Kreislauf der Lügen.
Mit dem Erstarken rechter Kräfte in Europa, dem Umgang mit der Klimakrise und spätestens mit Beginn der globalen Pandemie müssen wir uns eingestehen, dass wir in Deutschland und Europa nicht davor gefeit sind. Der Umgang mit der Pandemie führt uns aktuell vor Augen, welches Unvermögen oder gar welcher Unwille in Teilen der Gesellschaft herrscht, zwischen Tatsachen und Meinung zu unterscheiden. Und wie dies von Populisten und Rechten instrumentalisiert wird.
Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit erleben wir postfaktische Angriffe auf die Demokratie. Wir sehen absolute Gleichgültigkeit gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen und Zynismus gegenüber dem öffentlichen Diskurs. »Freiheit« wird zum Totschlagargument gegen Fakten und Selbstdarsteller schwingen sich zu Helden auf, nur, weil sie ihre Meinung sagen auch wenn diese jedweder Vernunft entbehrt.
Freiheitsrechte werden zur Begründung der Ablehnung allem, was dem Individuum als unbequem erscheint hinzugezogen: Sei es das Tragen einer Maske, sich impfen zu lassen, rassistische Wörter zu verbannen oder ein Tempolimit auf der Autobahn.
Der Umgang und die Diskussion mit einer Pandemie ist kein leichter. Wir haben den Spagat zwischen persönlicher Freiheit auf der einen Seite und Schutzmaßnahmen vor Infektion auf der anderen Seite, zu meistern. Die Frage einer Impfpflicht um die Pandemie einzudämmen und auf der anderen Seite das Recht auf Selbstbestimmung. Was richtig und was falsch ist, lässt sich schwer sagen, denn wir alle haben eine Pandemie in dem Ausmaß noch nie erlebt und können nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Wir müssen situativ jede Woche neu entscheiden und klar macht man vielleicht auch mal Fehler. Aber das Misstrauen der Querdenkerbewegung, das über social media völlig hemmungslos verbreitet wird, gegenüber der Politik, der Ärzte, der Impfkommissionen und gegenüber den Statistiken kann ich so nicht nachvollziehen. Es gibt aber ein Argument, das ich überhaupt nicht akzeptieren kann, das ist wenn Querdenker die Corona-Maßnahmen mit dem Dritten Reich vergleichen. Die Schreckensherrschaft und Diktatur im Dritten Reich, KZs, Folter, Krieg, keine Meinungs- und Pressefreiheit – ein Staat in dem es tödlich sein konnte eine andere Meinung zu äußern – das hat aber auch so gar nichts mit der jetzigen Situation zu tun und dieses Agieren und Argumentieren und Dritte-Reich-Vergleiche verbieten sich! Was wir brauchen sind Debatten die verbinden und nicht trennen – nur so können wir die Pandemie bewältigen.
Der heute verliehene Preis fördert »öffentliche Interventionen, in denen Arendtsche Fragen an die Gegenwart herangetragen, neue Verständnisweisen für politische Geschehnisse erprobt werden und die schließlich dazu beitragen, die politische Handlungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.« Er ist ein Beitrag dazu, das – wie Hannah Arendt sagt – »Denken ohne Geländer« zu fördern, das Einnehmen unterschiedlicher Perspektiven.
Mit Jill Lepore würdigt die Jury eine »herausragende Wissenschaftlerin, die es vermag, die amerikanische Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven zu erzählen und zu beleuchten.« Damit erinnert sie ihre Leserschaft daran, dass es die Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger ist, sich zu informieren und eigene Urteile zu bilden, um politisch Handeln zu können. Frau Lepore setzt sich in ihrer Arbeit auseinander mit zentralen Begriffen wie Freiheit, Nation und Nationalismus und versucht diese zu retten.
Liebe Frau Lepore, ich gratuliere Ihnen herzlich zu diesem Preis.
Und ich danke der Jury und dem Verein.
Vielen Dank!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum,
ich freue mich sehr, zur heutigen Preisverleihung des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken einige eröffnende Worte zu sprechen.
Die Jury des Hannah-Arendt-Preises hatte in diesem Jahr eine besonders glückliche Hand. Jill Lepore erfüllt geradezu idealtypisch das Kriterium, ein Denken und Arbeiten, das Nachdenken über die US-amerikanische Gesellschaft im Sinne Hannah Arendts, fortzuführen. Die US-amerikanische Republik hat auch Hannah Arendt über Jahrzehnte beschäftigt.
Zum anderen rückt die Vergabe an die renommierte US-amerikanische Historikerin Jill Lepore in die Aufmerksamkeit, wie sehr dies ein Preis ist, der im Namen einer deutsch-amerikanischen Intellektuellen vergeben wird.
Denn trotz oder gerade weil die Wahl von Joe Biden und Kamala Harris einen lang erhofften Neustart der transatlantischen Beziehungen zu Deutschland und der Europäischen Union ins Rollen gebracht hat: Das Verständnis der Geschichte und der diversen Gesellschaft der Vereinigten Staaten für die deutschsprachige Öffentlichkeit ist und bleibt eine wichtige Aufgabe und Herausforderung für das gemeinsame Gestalten und Wirken.
Jill Lepore ist eine renommierte, mehrfach ausgezeichnete Historikerin. Sie ist Professorin an der Harvard University und seit vielen Jahren einer Fach-Community nicht nur in den USA selbstverständlich bekannt. Einem breiteren deutschsprachigen Lesepublikum wurde sie, auch über Fachkreise hinaus, u. a. durch die Übersetzungen ihrer Geschichte Diese Wahrheiten. Die Geschichte der Vereinigten Staaten bekannt. Die Geschichte schärft den Blick für die USA und deren verfassungsmäßige Versprechen nach gleichen Rechten für alle, die in der US-amerikanischen Geschichte entlang politischer Polarisierungen und Ausschlüsse durch Bewegungen wie das Civil-Rights-Movements erst zu einer politischen Verwirklichung kommen konnten.
Ihr Essay Dieses Amerika. Manifest für eine bessere Nation! (2020) macht dies deutlich und wurde ebenso von einem deutschsprachigen Publikum aufgenommen, das gerade hinsichtlich der Debatte über Nation und politische Zugehörigkeit immer wieder auf die USA schaut. Lepore hat sich zu diesen und weiteren Themen regelmäßig mit Interventionen über die Fachöffentlichkeit hinaus geäußert und publizistisch engagiert, etwa im Magazin New Yorker.
Jill Lepore's Denken lässt sich insoweit noch einmal auf Hannah Arendt beziehen, als sie dem »Geist« der amerikanischen Revolution, von dem auch Arendt gesprochen hat, aus einer historischen Perspektive nachspürt. Die US-amerikanische Verfassung und ihre Überprüfung hinsichtlich der gesellschaftlichen Realität ermöglichen in den Institutionen immer wieder eine Erweiterung von Rechten, die es ermöglichen, das Versprechen einer inklusiven Republik zu realisieren.
Eben dieses Nachdenken über die US-amerikanische Republik hielt nicht nur Arendt für entscheidend, sondern sie empfahl es auch gelegentlich ihren Kolleg:innen jenseits des großen Teiches. Die Arbeiten und das Wirken von Jill Lepore sind ein hervorragender Ausgangspunkt, um diese Fährte in Zukunft weiter zu verfolgen.
In diesem Sinne gratuliere ich Jill Lepore ganz herzlich vonseiten der Heinrich Böll Stiftung als Preisträgerin des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken 2021.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
Liebe Freundinnen und Freunde des Hannah-Arendt-Preises,
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Lassen Sie mich kurz die Begründung der Jury für unsere leider abwesende Preisträgerin vortragen. Die Laudatio werden Sie ja später noch hören. Und es wird Ihnen womöglich auffallen, dass die Perspektive der deutschen Jury und die Würdigung des amerikanischen Laudators unterschiedliche Blickwinkel auf die Preisträgerin öffnen. Genau das ist beabsichtigt bei einem transatlantischen Preis mit einer Namensgeberin, die den Dialog zwischen Europa und Amerika vor über einem halben Jahrhundert so bereicherte, dass wir noch immer davon zehren.
Wir vergeben den Preis in einer Zeit, in der allüberall in der Welt Demokratien attackiert und manipuliert werden – und dies nicht nur von aussen, sondern auch von innen.
Das spektakulärste Beispiel in jüngster Zeit war die Präsidentschaft Donald Trumps. Dieser Präsident hat Teile des amerikanischen Volkes gegen die demokratischen Institutionen seines Landes aufgebracht und einen Grundkonflikt sichtbar gemacht, der dieses Land seit seiner Gründung begleitet: der Streit um das politische und gesellschaftliche Selbstbild der USA nach innen und nach außen.
Die Preisträgerin Jill Lepore hat diesen Grundkonflikt auf eine herausragende Weise verstehbar gemacht, indem sie verdeutlicht, dass die amerikanische Demokratiegeschichte einigen Aufschluss über die Probleme der heutigen Demokratien bereit hält.
Es gibt ja bei der Suche nach einer neuen Preisträgerin, einem neuen Preisträger immer ein Moment, in dem sich in der Jury die Meinung bildet, ja diese oder jenen sollten wir nehmen. Bei der Historikerin Jill Lepore ist es das Zusammentreffen eines Wissensbedürfnisses unsererseits, zu verstehen, wie um aller Welt eine solche Selbstdemontage der amerikanischen Demokratie zu verstehen ist – und eines Buches mit einer reichhaltigen Erzählung über die Vorgeschichte dieses Dilemmas und seine Nachwirkungen bis heute. Es hat die Jury überzeugt, wie Lepore am Beispiel der amerikanischen Demokratie ihre Leser an die Unwägbarkeiten, an die Schwächen und die Stärken der Demokratien generell heranführt.
Sie lässt ihre Leser in die unberechenbaren Dynamiken, in die Antagonismen, die Ideen, die Interessenkonflikte einer der ältesten Demokratien der Welt gleichsam hineinschauen. Sie beschreibt die Geburt der amerikanischen Demokratie als eine Geschichte von Konflikten zwischen konkurrierenden Interessengruppen und Persönlichkeiten: den kolonialen Supermächten England und Frankreich, den Sklaven, den verschiedenen ethnischen Gruppen, den Wirtschaftsinteressen, der politischen Elite, den Frauen … Sie zeigt luzide auf, wie wirtschaftliche Interessen und politische Bestrebungen mit demokratischen Grundideen, zum Beispiel der der Freiheit, kollidieren – und schließlich zum Bürgerkrieg führen – und wie diese Konflikte quasi subkutan die amerikanische Geschichte bis heute begleiten. Und sie veranschaulicht, wie die Grundfrage der amerikanischen Gründung, die Frage, wer als Mensch und somit als freiheitsfähig anzusehen ist, die Gesellschaft bis auf den heutigen Tag spaltet. Damit führt sie uns ein in die Kunst, die Gegenwart der westlichen Demokratien zu verstehen. Es sind sehr oft ähnliche Grundkonflikte, die die Demokratien weltweit von innen her bedrohen: Diktatorische Bestrebungen der Mehrheit; Machtgelüste einer korrupten Minderheit (Washingtoner Elite, politische Klasse, die Reichen, die Ideologen), die sich anmaßt, die Mehrheit zu manipulieren; gesellschaftliche Gruppen, die gegeneinander aufgehetzt werden; der Machtanspruch wirtschaftlicher Interessengruppen; die Ausbeutung der Schwachen; der Kampf um die kulturelle Hoheit; der Versuch, die Gestaltung der Freiheit zu einer Funktion der digitalen Welt zu machen, ich könnte weiter fortfahren.
In der politischen Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika kann sich die demokratische Welt wiedererkennen. Die Bürgerinnen und Bürger von heute können darin sowohl die Schwächen und selbstzerstörerischen Tendenzen wie auch die Stärken der Demokratie erkennen, nämlich die Fähigkeit ihrer Bürgerinnen und Bürger, Machtgelüste zu bremsen, Fehlentscheidungen rückgängig zu machen, sich des Vertrauens des Volkes zu versichern, sich selbst zu einem Neubeginn zu befähigen. Und das ist einzigartig an dieser Form des politischen Zusammenlebens, deren Stabilität so sehr von dieser Fähigkeit abhängt.
Diese Freiheitsfähigkeit gilt es immer wieder wachzurufen und zu regenerieren. Denn sie ist die Basis demokratischen Zusammenlebens. Und das gilt für Europa ebenso wie für die Vereinigten Staaten – und für all jene, die diesen Weg des politischen Zusammenlebens einschlagen wollen.
»Die Geschichte ist für [die Flüchtlinge] kein Buch mit sieben Siegeln«
»History is no longer a closed book to them«
»Die Geschichte ist für [die Flüchtlinge] kein Buch mit sieben Siegeln«, Hannah Arendt, We Refugees
Es ist mir eine Ehre, Sie, Jill Lepore, hier und heute zu würdigen.
Jill Lepore den Hannah-Arendt-Preis zu verleihen, bedeutet, eine gelehrte Denkerin zu ehren, die für die Öffentlichkeit auf eine Weise schreibt, die herausfordert, provoziert und aufklärt. Wie Hannah Arendt verbindet Jill Lepore fundiertes Wissen mit Engagement und Einsicht, um vor einem breiten und gebildeten Publikum zu sprechen.
Lepore ist David Woods Kemper '41 Professor of American History an der Harvard University und Autorin von elf Büchern, darunter These Truths: A History of the United States (2018) und If/Then: How the Simulatics Corporation Invented the Future (2020). Ihr Buch The Secret History of Wonder Woman hat das American History Book Prize gewonnen. Sie ist ehemalige Präsidentin der Society of American Historians und wurde 2014 zur American Historian Laureate ernannt. Außerdem ist sie angestellte Autorin beim The New Yorker Magazine, wo Lepore, mit Essays über amerikanische Geschichte, Politik, und Recht eine nationale sogar internationale Anhängerschaft gefunden hat.
In Ihrem Buch These Truths, macht Lepore die Paradoxe sichtbar, eingefaltet in die vielseitigen Mäntel Amerikanischer Geschichte. In den Hauptflügel dieser Geschichte klingen die Worte von Thomas Jefferson laut. „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness." Es gibt aber andere Wahrheiten, die die amerikanische Geschichte ebenso stark prägten. Der Transport, die Folter und die rassische Versklavung von Millionen Afrikanern und später afrikanische Amerikanerinnen, die Enteignung, Ermordung und Erniedrigung indigener Völker und das Erbe von Rassismus und Imperialismus – all These Truths – Diese Wahrheiten – sind in der amerikanischen Geschichte enthalten.
Der Ehrgeiz von Lepores Geschichte besteht darin, den liberalen Universalismus des amerikanischen Glaubensbekenntnis – life, liberty, and the pursuit of happiness – zu feiern; gleichzeitig bestehet sie darauf zu manifestieren und sinnvoll zu erklären, die unzähligen Wege, in denen der amerikanische Nationalstaat weit hinter seinen Idealen zurückbleibt. Sie stellt Sklaverei neben Freiheit auf die fruchtbaren Grundlagen der amerikanischen Geschichte und nimmt die Wahrheit an, dass das Land »eine Nation ist, die im Widerspruch geboren wurde, Freiheit in einem Land der Sklaverei, Souveränität in einem Land der Eroberung« (786). »Die Wahrheiten, auf denen die Nation gegründet wurde – Gleichheit, Souveränität und Zustimmung« – wurden nie verwirklicht. Das Erzählen von Geschichte, schreibt Lepore, ist ein Kampf darüber, welche Wahrheiten und welche Geschichten wir über uns selbst erzählen werden und erzählen sollen. Es ist der „Kampf, um das Versprechen die Gründungswahrheiten der Nation einzulösen". (787)
In Lepores Wende zum Geschichtenerzählen eröffnet Sie ein wesentliches modernes Problem über das Wesen der Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht mehr, wie in früherer Vergangenheit, ein Mysterium, das nur den Göttern bekannt und in Mythen verpackt ist. Außerdem ist die Wahrheit nicht mehr das, was sie während des langen wissenschaftlichen Zeitalters war, eine Tatsache. Wenn die Wissenschaft behauptet, nur die objektive Wahrheit zu kennen, führt die Forderung nach Wahrheit schnell zu der Erkenntnis, dass alle Wahrheit politisch ist. Wenn die Gerichtsjury ihr Urteil verkündet, ist es von Bedeutung, wer auf der Geschworenenbank sitzt.
In ihrem Podcast The Last Archive geht Lepore der grundsätzlichen Frage nach: »Who Killed Truth?« Nach dem Verlust der einfachen Tatsachen erkennt Lepore, dass wir an der Schwelle zu einer weiteren Transformation des Wahrheitsgedankens stehen. Die Wahrheit ist zunehmend, was wird erkannt durch die Analyse von Daten durch Algorithmen und künstlicher Intelligenz. In ihrem neuesten Buch If/Then: How the Simulatics Corporation Invented the Future thematisiert Lepore die politische Gefahr der Destabilisierung der Wahrheit durch nicht-menschliche Intelligenzen. Wir treten in ein Zeitalter ein, Lepore zeigt es uns, in dem algorithmische Wahrheiten gegen menschliche Wahrheiten ausspielen werden, in denen der Wahrheitsstreit nicht durch menschliche Intelligenz beigelegt werden kann.
Um diese Transformation von der Wahrheit zu verstehen und zu entgegnen, erzählt Lepore Geschichten. Lepore ist eine meisterhafte Erzählerin und hat das Geschichtenerzählen als ein politisches Projekt der nationalen Identifikation bezeichnet. Sie schreibt: „Ob Nationen liberal bleiben können, hängt tatsächlich von der Wiedererholung der vielen Weise der Verstehen ab, was bedeutet, zu einer Nation zu gehören." In einer Welt, in der Nationen existieren und für Millionen ihrer Bürger unwiderstehlich bleiben, »gibt es keinen mächtigeren Weg, die Kräfte von Vorurteilen, Intoleranz und Ungerechtigkeit zu bekämpfen, als durch ein Engagement für Gleichheit, Staatsbürgerschaft und gleiche Rechte, wie sie durch eine Nation mit Gesetzen garantiert werden.« Die liberalen Geschichte der amerikanischen Nation, die Lepore stärken will, verbindet ein Bekenntnis zum amerikanischen Glauben mit einer „klaren Abrechnung mit der amerikanischen Geschichte, ihren Sorgen nicht weniger als ihrem Ruhm". In einer Zeit, in der mächtige politische Kräfte mit rosa Brillen auf die Größe vergangene Zeiten zurückblicken wollen, plädiert Lepore für eine bunte nationale Geschichte, die die viel-strahlende Wahrheit sagt.
Lepores Entschlossenheit, die Wahrheit zu sagen, erinnert an, Hannah Arendts immer wiederkehrendes Bemühen, »zu sagen was ist.« In On Revolution versuchte Arendt, eine Geschichte über die Vereinigten Staaten und ihre Bedeutung als konstitutionelle und föderalistische Republik mit demokratischen Elementen zu erzählen. Arendt argumentiert, dass die Originalität der amerikanischen Revolution darin besteht, dass sie die Erfahrung der Freiheit unnachgiebig umarmt. Unter Freiheit versteht Arendt die Befugnis, im öffentlichen Raum sichtbar zu agieren und sich an der Tätigkeit des Selbstregieren zu beteiligen. Aufbauend auf dieser Erfahrung politischer Freiheit, versuchten die Amerikanische Revolution und ihre verfassungsmäßige Tradition, diese Erfahrung der republikanischen Freiheit zu verallgemeinern.
Aber Arendt bot auch ihre eigene »klare Abrechnung« mit den dunklen Seiten der amerikanischen Geschichte an. Die zielstrebige Freiheitsorientierung der Amerikaner sei nur möglich gewesen, schreibt Arendt, weil sie sich völlig verweigerten, die Erfahrungen derer zu berücksichtigen, die nicht frei seien: Frauen, amerikanische Indianer und vor allem diejenigen, die in rassistischer Versklavung festgehalten werden. Die Tatsache der Sklaverei – die Arendt das „Urverbrechen" der amerikanischen Republik nennt – wurde für sie durch die nahezu absolute Unsichtbarkeit des Elends der Sklaven ausgeglichen. In dieser Blindheit weißer Amerikaner gegenüber der Not der schwarzen Amerikaner (und auch gegenüber Frauen und indigenen Amerikanern) verortet Arendt eines der beunruhigendsten Paradoxe der amerikanischen Nationalgeschichte: dass Amerika sich so voll und ganz dem Streben nach politischer Freiheit widmen könnte zum großen Teil wegen des Urverbrechens der Sklaverei und der Unsichtbarkeit der Sklaven.
Was machen wir mit diesem grundlegenden amerikanischen Paradoxon? Lepore antwortet, dass wir unsere Geschichte neu erzählen müssen, um „Diese Wahrheiten", die wir in Amerika anstreben und die wir bewohnen, zu erweitern. Arendts Antwort lautet, dass wir erkennen müssen, wie außergewöhnlich und zerbrechlich die amerikanische Wahrheit ist, ein Gemeinwesen, das nicht als einheitliche und souveräne Nation, sondern als pluralistische, föderale und freie Republik gebildet wurde. Ein Großteil von Arendts Buch ist ein Bericht über das fehlschlagen der Revolution um Freiheit zu konstituieren. Arendt führt das Versagen der amerikanischen revolutionären Tradition zum großen Teil auf das Versagen der amerikanische Gründerväter zurück, Institutionen der Volksbeteiligung in die Verfassungsstruktur der Vereinigten Staaten einzubeziehen. Sie befürchtet auch, dass das amerikanische Streben nach Freiheit als öffentliches Glück Gefahr läuft, durch ein ebenso amerikanisches Streben nach materiellem Wohlstand korrumpiert zu werden. Und Arendt kämpft mit diesem »Urverbrechen«, das nicht nur die Sklaverei war, sondern auch der vollständige Ausschluss von Sklaven und ihren Nachkommen aus der amerikanischen Erfahrung der öffentlichen Freiheit. Arendt argumentiert, dass der Bürgerkrieg und die 13., 14. und 15. Änderungsanträge nichts ausreichten, um schwarze Amerikaner in die amerikanische Nationalgeschichte einzubeziehen. Es war und bleibt notwendig, schreibt Arendt, die US-Verfassung zu ändern, um ausdrücklich die volle Mitgliedschaft und den Ausschluss ehemaliger Sklaven und schwarzer Amerikaner in der Nation der Vereinigten Staaten zu bekräftigen – etwas, das bis heute nicht geschehen ist.
Arendt und Lepore, beide stellen uns die Frage, wie können wir das Buch der Nationalgeschichte offen halten für ausgegrenzte Gruppen. Vielleicht greift Arendt nirgendwo so direkt ein wie in ihrem Essay „Wir Flüchtlinge". Arendt, ein staatenloser Flüchtling, beginnt: „Vor allem mögen wir es nicht, wenn man uns ‚Flüchtlinge' nennt. Das Wort „Flüchtling" ist ein abstumpfendes Wort. Es zeichnet eine Person von Verlust und Verletzlichkeit. Stattdessen will der Flüchtling als „Neuankömmlinge" oder „Einwanderer" gesehen werden." Aber es ist ein Paradox des gegenwärtigen Systems der internationalen Menschenrechte, dass Flüchtlinge als Flüchtlinge bezeichnet werden müssen, um sich für Hilfe zu qualifizieren. Wir in der internationalen Gemeinschaft bestehen darauf, dass sich Flüchtlinge als Flüchtlinge bezeichnen, dass sie ihre Identität als elend annehmen. Wir bestehen auf ihrer Verachtung als Preis für die Erlösung.
Ein Großteil von Arendts Essay Wir Flüchtlinge ist eine Meditation über Assimilation und Selbstmord als die beiden Fluchtwege, die der Flüchtling vor der Last der Ablehnung hat. Aber Arendt beendet ihren Aufsatz mit dem Hinweis, dass es möglicherweise eine andere Möglichkeit für den Flüchtling gibt. Sie beteuert, dass es einige Flüchtlinge gebe, „die darauf bestehen, die Wahrheit zu sagen, bis hin zur ‚Unanständigkeit'". Wenn die Flüchtlinge „Diese Wahrheit" sprechen, schreibt Arendt auf English: „history is no longer a closed book to them." Auf Deutsch, Arendt schreibt das Gleiche aber dichterischer. Wenn die Flüchtlinge ihre Wahrheit aussprechen, »Die Geschichte ist für sie kein Buch mit sieben Siegeln.«
Indem die Flüchtlinge ihre Wahrheit – die Wahrheit – in einer nationalen und damit in einer menschlichen Welt hineinsprechen, stellen diese Flüchtlinge das nationale Narrativ auf den Kopf und können eine Quelle großen Unbehagens sein. Aber im Austausch für ihre Unbeliebtheit erhalten diese wahrheitssagenden Flüchtlinge einen unschätzbaren Vorteil: Sie treten in das Buch der Geschichte ein. Sie fügen sich in die Geschichte ein und Politik ist für sie nicht mehr das Privileg der Staatsbürger. Um die Wahrheit zu sagen, dass man ein staatenloser, obdachloser und entwurzelter Flüchtling ist, muss man darauf bestehen, dass die umgebende nationale Gesellschaft den Aufstieg einer neuen und immer häufiger werdenden Art von Menschen ernst nimmt. Auf diese Weise kann der die Wahrheit sagende Flüchtling zu einer Avantgarde werden, der Vorbild für einen weltoffenen und postnationalen Bürger ist. Indem er seinen Außenseiterstatus als Flüchtling akzeptiert – was Arendt als »bewussten Paria« bezeichnet – besteht der ehrliche Flüchtling darauf, als politisch bedeutsamer und mächtiger Akteur gesehen und gehört zu werden.
Arendts beharren darauf, dass Flüchtlinge die Tür der Geschichte aufbrechen und in die öffentliche Welt eindringen, ist eine Möglichkeit, das Buch der Geschichte für das Projekt der Neukonstitution zu öffnen. Lepores Forderung, dass wir unsere nationale Geschichte neu erzählen, indem wir die Geschichten derjenigen aufnehmen, die ignoriert, ausgeschlossen und unterdrückt wurden, ist eine weitere Möglichkeit, diese Wahrheiten und Geschichten unserer Vergangenheit und unserer Gegenwart neu zu denken.
Jill Lepore schreibt im Geist Arendts um Geschichte zu erzählen, Geschichte die endlich und irgendwann „Diese Wahrheiten" sagen und jene plurale Öffentlichkeit verwirklichen, die den Idealen der liberalen Universalismus gerecht werden. Jill Lepore den Hannah-Arendt-Preis zu übergeben klingt wie eine dieser Wahrheiten.
(Übersetzung ohne Literaturhinweise)
Hannah Arendt schrieb On Revolution (deutsch: Über die Revolution) 1963 in den Vereinigten Staaten – verfolgt vom Holocaust, Totalitarismus und der Atombombe, zu einer Zeit, die unserem Zeitalter der Pandemien, Überschwemmungen und Brände nicht unähnlich ist, zu einer Zeit, in der es sehr wahrscheinlich schien, dass der Mensch sich selbst und sogar alles Leben auf der Erde zerstören würde.
Das Buch ist eine Hommage an die amerikanische Revolution, die für Arendt den Beginn der Moderne markierte, weil sie aus zwei Teilen bestand, die wie ein Türscharnier zusammenhingen: eine politische Revolution und eine gänzlich neue Verfassung. Der revolutionäre Geist der letzten Jahrhunderte, das heißt der Eifer zur Befreiung und zum Bau eines neuen Hauses, in dem die Freiheit wohnen kann, ist beispiellos in der gesamten bisherigen Geschichte, schrieb sie. Die Befreiung ist die Revolution, das neue Haus ist die Verfassung. Eine Revolution erfordert für Arendt sowohl das Umstürzen – das Vergessen der Vergangenheit – als auch das neu Beginnen. Die Revolution ist das Vergessen, die Verfassung ist der Neubeginn.
Die Herausforderungen des einundzwanzigsten Jahrhunderts erfordern wiederum einen weiteren Neubeginn, einen neuen Konstitutionalismus, der in der Lage ist, die Krisen der biologischen Diversität und des Klimawandels zu bewältigen. Heute Abend möchte ich Arendts Studie Über die Revolution wieder aufgreifen, um für einen solchen neuen Konstitutionalismus zu argumentieren.
Arendt ist vor allem durch ihr Buch The Origins of Totalitarianism (deutsch: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft) bekannt, das sie nach einem Völkermord, dem sie nur knapp entkommen war, geschrieben hatte und das 1951 veröffentlicht wurde. In Origins beklagte Arendt das Entstehen staatenlos gewordener Menschen in der Zwischenkriegszeit – per definitionem vogelfrei und rechtlich keine Rechts-Personen; es war dies der Status der Juden und anderer Minderheiten in Europa, die innerhalb eines Nationalstaates leben, der ihnen aber den Status eines Staatsbürgers verweigerte und die außerhalb der Gerichtsbarkeit des Staates standen, jenseits der Grenzen seiner Gesetze – es gibt kein Gesetz für sie –, eine Position außerhalb des politischen Bereichs, nur noch auf Soziales beschränkt.
Die Bedingungen, unter denen sie lebten, die Verträge, die sie vor der Verletzlichkeit aufgrund ihrer Staatenlosigkeit »schützen« sollten, die Art und Weise, in der sie sich selbst im Verhältnis zu der Gemeinschaft der Staatsbürger beschrieben, reduzierten sie auf Tiere. Dieses Thema griff Arendt auch in ihrem Buch The Human Condition (1958) (deutsch: Vita Activa) auf.
In On Revolution wandte sich Arendt dem achtzehnten Jahrhundert zu. Der größte Teil des Buches befasst sich mit dem Vergleich der Amerikanischen mit der Französischen Revolution; Arendt zog die Amerikanische vor, weil es dieser besser gelang, vom Machen einer Revolution zum Machen einer Verfassung zu kommen, – aber auch, weil die Amerikanische Revolution sich – ihrer Meinung nach – nie von dem ablenken ließ, was sie als lediglich soziale Fragen, wie Armut, bezeichnete. Nach Arendts Verständnis rebellieren die Armen (Revolutionäre), weil sie elend sind, und die Guten (Revolutionäre) revoltieren, weil sie frei sein wollen; und obwohl die Guten vielleicht die Hilfe der Armen brauchen, sollten sie diese nicht ausufern lassen, weil deren Bedürftigkeit die Revolution zum Scheitern bringt und eine Schreckensherrschaft einleitet. Gleichwohl, so Arendt, geschieht genau dies sehr oft. Für Arendt war die Amerikanische Revolution eine gute Revolution, die Französische Revolution eine schlechte, und alle späteren Revolutionen waren Französisch, bis zur Ungarischen Revolution von 1956, die der amerikanischen glich.
Die Amerikanische Revolution begann mit dem Trennen, dem Vergessen menschlicher Beziehungsweisen (bisheriger Ausprägung) in der Unabhängigkeitserklärung von Jahr 1776, und sie endete 1787 mit der Einführung einer neuen Verfassung. Arendt nahm die Grausamkeit der Sklaverei zur Kenntnis, unter der zur Zeit der Amerikanischen Revolution fünfhunderttausend Menschen in einem Ungleichheitsstatus lebten, der weit niedriger war als der Status der Armut. Sie bedauerte deren Lebensbedingungen als „vollständige Not und des Elend". Aber sie überzeugte sich selbst, dass die Verwerflichkeit der Sklaverei so wenig relevant war für die Amerikanische Revolution und so weit entfernt vom Raum des Politischen, dass sie nicht einmal als soziale Frage zählte. Im Gegensatz zu den halb verhungerten französischen Massen revoltierten damals die Amerikaner gegen Tyrannei und Unterdrückung, nicht gegen Ausbeutung und Armut.
Arendts Verständnis der Amerikanischen Revolution spiegelte perfekt die führende Geschichtswissenschaft ihrer Zeit. Doch nach dem Erscheinen von On Revolution nahm die Erforschung der Amerikanischen Revolution neue Fahrt auf. Marxistische HistorikerInnen zeigten auf, dass der Impetus zur Revolution vielfach von Seiten der Armen gekommen war. HistorikerInnen der Frauengeschichte, der indigenen Völker und der Afroamerikaner stellten die Revolution in den Kontext der umfassenderen Kämpfe um Emanzipation, Souveränität und Unabhängigkeit, einschließlich der Indianerkriege, Frauenproteste und Sklavenaufstände – einschließlich der Haitianischen Revolution.
Die Haitianische Revolution begann 1791, als versklavte Menschen auf Saint-Domingue für sich die versprochenen Rechte in der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 einforderten, deren erster Artikel lautete: Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. Im Jahr 1794 schaffte Frankreich die Sklaverei ab und gewährte den Schwarzen in Saint-Domingue die französische Staatsbürgerschaft, obwohl es eine französische Kolonie blieb.
Im Jahr 1801 verabschiedete Haiti eine Verfassung, in der es hieß: Auf diesem Territorium darf es keine Sklaven geben und Alle Menschen werden geboren, leben und sterben als freie Franzosen. Nachdem Napoleon jedoch versucht hatte, die Sklaverei in Saint-Domingue wieder einzuführen, führte der Revolutionär Jean-Jacques Dessalines eine Bewegung für die Unabhängigkeit an. Im Jahr 1804 erklärte Haiti seine Unabhängigkeit und war damit erst das zweite Land in Amerika, das eine neue Freiheit gründete.
WissenschaftlerInnen, die sich in letzter Zeit mit Arendts Auslassung der Haitianischen Revolution befasst haben, haben jeweils unterschiedlich geschrieben, dass sie an rassistischen Vorurteilen gelitten habe, an einer analytischen Blindheit aufgrund ihres philosophischen Idee, dass Ungleichheit lediglich ein soziales Problem sei oder – epistemisch gesehen – an „weißer Ignoranz", einer Unfähigkeit, die Struktur der rassischen Ungleichheit zu begreifen. Doch diese Kritiken ignorieren vieles, was Arendt über Rasse und auch über die Sklaverei geschrieben hat, was vielfach aus ihrer Analyse der Staatenlosigkeit in dem Buch Ursprünge des Totalitarismus folgte, in dem sie schrieb: Wenn ein Neger in einer weißen Gemeinschaft als Neger und als nichts anderes betrachtet wird, verliert er mit seinem Recht auf Gleichheit auch die Freiheit zu handeln, die spezifisch menschlich ist; alle seine Taten werden nun als ‚notwendige' Folge der Neger-Eigenschaften erklärt; er ist zu einem Exemplar einer Tierart geworden, die man Mensch nennt. Wie die Juden im Deutschland der Zwischenkriegszeit standen auch die Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten unter Jim Crow ((>ein Slangbegriff für die Zeit der Rassischen Segregation≤ , d. Ü.)) außerhalb der Grenzen des Rechts, waren Menschen, die auf den Status der Staatenlosigkeit reduziert waren, wie Tiere.
Aber wie steht es dann um den Schutz der Verfassungen? Eine Verfassung ist eine Norm, ein Pfeiler und ein Band der Zusammengehörigkeit, wenn sie verstanden, gebilligt und geliebt wird, schrieb John Adams. Aber ohne diese Intelligenz und Anhänglichkeit könnte sie genauso gut ein Drachen oder Ballon sein, der in die Luft fliegt, so Arendt. Frankreich baute nur Verfassungsdrachen. Arendt führt an, dass die Autorität der ersten 1791 in Frankreich geschriebenen Verfassung durch die rasche Folge einer neuen Verfassung nach der anderen in einer Lawine von Sukzessionen verloren ging, so dass selbst der Begriff der Verfassung begraben wurde. Auch Haitis Unabhängigkeitserklärung von 1804 litt unter einer Lawine von Verfassungen, sieben in fünfzehn Jahren.
Für Arendt bedeutet eine Verfassung einen Neuanfang, der die Ungerechtigkeiten der Geschichte auslöscht und die Welt neu beginnen lässt. Aber die haitianische Unabhängigkeitserklärung von 1804, die eine Revolution verfassungsmäßig festschrieb, hatte einen politischen Körper durch den Akt des Erinnerns geschaffen. Dort heißt es: Der französische Name verfolgt noch immer unser Land. Alles weckt die Erinnerung an die Grausamkeiten dieses barbarischen Volkes. Bürger einer Republik zu sein, deren Ursprünge in der menschlichen Sklaverei liegen, so die Philosophin Jennifer Gaffney, bedeutet Verantwortung für die Erinnerung an deren Grausamkeiten zu tragen. Arendt sieht die Beziehung zwischen Revolution und Verfassung als Befreiung und als Bau eines neuen Hauses, in dem die Freiheit wohnen kann; Gaffney legt nahe, dass es in diesem Haus spukt.
Eine Verfassung macht mehr als nur eine Regierung zu etablieren. Sie schafft Bürger und garantiert ihre Rechte. Aber was ist mit den Wesen, die durch eine Verfassung auf den Status der Staatslosigkeit reduziert werden? Die U.S. Verfassung von 1787 enthielt keine Bestimmungen für Tiere oder für Prärien oder Flüsse oder Berge oder Seen. Sie enthielt auch keine Bestimmungen für Frauen oder Kinder, und die einzige Bestimmung, die sie für die Ureinwohner hatte und für die Afrikaner und ihre Nachkommen, die in Sklaverei oder Knechtschaft gehalten wurden, war mathematisch: Die politische Vertretung der Gebietskörperschaften im Kongress wurde so berechnet, dass die „freien Personen" zusammengezählt wurden, unter Abzug der nicht besteuerten Indianer, aber mit Hinzufügung der in Knechtschaft/Sklaverei gehaltenen Menschen als drei Fünftel aller anderen Personen, denn auch sie waren nach dem Gesetz der Sklaverei keine Personen, sondern Eigentum: also Dinge, menschliche Nicht-Personen. Als im Kongress die Frage aufgeworfen wurde, ob in diesem Fall domestizierte Tiere wie Rinder für die Repräsentation zählen sollten, stellte Benjamin Franklin eine Faustregel dafür auf, wie man den Unterschied zwischen Personen und Dingen erkennen kann: Schafe werden nie einen Aufstände machen.
In den Vereinigten Staaten brauchte es einen Bürgerkrieg, um unter Klausel der equal protection des vierzehnten Verfassungszusatzes festzusetzen, dass alle Menschen Personen sind. Im Jahr 1866 endete die entsprechende Beratung des Kongresses, führte aber zu einer irritierenden Frage aus dem Plenum: weibliche ebenso wie männliche? Die Klärung dieser Frage dauerte ein weiteres Jahrhundert.
Arendts politischer Raum schloss Armut und Sklaverei als rein soziale Fragen aus. Aber eine Einbeziehung des Sozialen in eine neue Konzeption des Politischen geht bei weitem noch nicht weit genug. Jede neue verfassungsrechtliche Regelung muss das Natürliche mit einbeziehen indem sie den wachsenden Umfang rechtswissenschaftlichen Denkens nicht über natürliche Rechte, sondern über die Rechte der Natur aufnimmt. Arendts Buch Über die Revolution erschien 1963, nur wenige Monate nach der Veröffentlichung von Silent Spring, (dem Buch,) in dem Rachel Carson den politischen Körper als untrennbar von der natürlichen Welt dachte. Es löste eine Bewegung aus, sowohl das Menschliche als auch das Nicht-Menschliche – Tiere, Pflanzen, Gewässer, Lebensräume, Wildnis – als verfassungsrelevant zu behandeln
In den USA und in vielen anderen Teilen der Welt wurden Gesetze zum Schutz der Umwelt erlassen, die Umweltverschmutzung zu regulieren; gefährdete Arten und den Lebensraum von Wildtieren zu erhalten und den Klimawandel zu stoppen, wurden bereits in den frühen 1970er Jahren erlassen, so der Clean Water Act, der Environmental Policy Act und die Einrichtung der Environmental Protection Agency. Der erste Vorschlag, die Verschlechterung der Umwelt durch eine Verfassungsänderung zu behandeln, kam 1970, als der Senator von Wisconsin, Gaylord Nelson, der auch den Erdtag ins Leben rief, eine Änderung vorschlug, die lauten sollte: Jeder Mensch hat das unveräußerliche Recht auf eine menschenwürdige Umwelt. Die Vereinigten Staaten und jeder Staat sollen dieses Recht garantieren. Aber zu diesem Zeitpunkt war die US-Verfassung bereits praktisch unabänderlich geworden. Immer wieder wurden Vorschläge zum Schutz der Umwelt folgenlos eingebracht: Das Recht eines jeden Menschen auf saubere und gesunde Luft und gesundes Wasser und auf den Schutz der anderen natürlichen Ressourcen der Nation darf von niemandem verletzt werden. Niemand darf das Recht auf saubere Luft und gesundes Wasser und auf den Schutz anderer natürlicher Ressourcen der Nation verletzen, hieß es in einem Antrag, der von Gesetzgebern aus siebenunddreißig Bundesstaaten unterstützt wurde. Sie wurden nicht aufgenommen. Da in der US-Verfassung kein Wort über die Umwelt zu finden ist, sind legislative und gesetzliche Maßnahmen außerordentlich verletzbar: Zwischen 2017 und 2021 hat die Trump-Administration mehr als einhundert Umweltbestimmungen zurückgenommen. Die Regierung Biden hat die Wiederherstellung dieser Bestimmungen und die Aufnahme weiterer zu einer oberste Priorität gemacht, aber alle diese Maßnahmen können rückgängig gemacht werden.
Andere Länder haben ihre Verfassungen geändert. Von den 148 Verfassungen der Welt enthalten einige auch solche Bestimmungen, die als Umweltkonstitutionalismus bezeichnet werden. Der Konstitutionalismus für Tiere hat seine Spuren hinterlassen. 1976 verabschiedete Indien, unter dem Einfluss des Hinduismus eine Verfassungsänderung, die es zur Pflicht eines jeden Bürgers machte, die natürliche Umwelt zu schützen und zu verbessern, einschließlich der Wälder, Seen, Flüsse und die Wildnis zu schützen und zu verbessern und Mitgefühl für Lebewesen zu haben. Dies wurde nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs 2014 als die Magna Charta der Tierrechte bezeichnet, in einer Entscheidung, bei welcher der Gerichtshof Mitgefühl als Sorge um Leidende definierte. Im Jahr 2002 änderte Deutschland auf Drängen der Grünen Partei die Bestimmungen des Grundgesetzes ((in Artikel 20a)) über die „Verantwortung des Staates gegenüber künftigen Generationen" – mit Blick auf Verpflichtungen des Staates gegenüber der Natur – um drei Worte: »und den Tieren«.
Ein Großteil der amerikanischen Geschichte ist die Geschichte von Menschen, Rechten und Pflichten, die aus der verfassungsmäßigen Ordnung ausgeklammert waren und ihren Weg in diese Ordnung hinein fanden, insbesondere durch Verfassungsänderungen. Der Zweck von Verfassungsänderungen, wie sie die frühen Amerikaner verstanden, war es, die Fehler zu korrigieren, die sich im Laufe der Zeit oder durch veränderte Umstände eingeschlichen haben. Ohne Änderungen, so glaubten sie, gäbe es keine Möglichkeit, einen grundlegenden Wandel herbeizuführen, außer durch eine Revolution: einen immerwährenden Aufstand. Aber so wie die friedliche Machtübergabe ist auch die Befugnis zur Revision der Verfassung nicht mehr verlässlich. Sinnvolle Änderungen sind seit den 1970er Jahren so gut wie unmöglich geworden, gerade als die Umwelt- und Tierrechtsbewegungen an Stärke gewannen.
Die US-Verfassung ist so gut wie unveränderbar geworden; nur die natürliche Welt ändert sich. Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Philadelphia betrug 1787 zweiundfünfzig Grad Fahrenheit. 2017 waren es neunundfünfzig. Letztes Jahr berichtete die World Wildlife Foundation, dass die Wildtierpopulationen rund um den Globus im letzten halben Jahrhundert um zwei Drittel zurückgegangen sind. Wir ruinieren unsere Welt, sagte der Leiter der Stiftung. Die meisten der jüngsten Fälle von Aussterben sind nicht auf den Klimawandel zurückzuführen, sondern auf den Verlust von Lebensräumen. Inzwischen schlagen die Gewalt menschlicher Eroberung von Tier-Territorien und die Grausamkeiten der Massentierhaltung zurück, Krankheiten werden vom Tier auf den Menschen und wieder zurück übertragen. Nahezu fünf Millionen Menschen sind bisher an dem Coronavirus gestorben, das nicht die letzte zoonotische Krankheit sein wird. Nachdem der Mensch den Lebensraum vieler anderer Arten auf der Welt zerstört hat, zerstört er nun auch seinen eigenen. Neue internationale und bundesstaatliche Gesetze könnten helfen, aber die meisten Umweltvereinbarungen sind unverbindlich, die Vereinigten Staaten haben sich weitgehend aus der Welt zurückgezogen und der Kongress funktioniert kaum noch.
Da so viele Wege versperrt waren, begannen Umweltschützer und Tierschützer für die Rechte der Natur zu streiten. Im Jahr 1972 veröffentlichte der Juraprofessor Christopher Stone in der Law-Review Artikel mit dem Titel Should Trees Have Standing? Stone argumentierte, dass die Geschichte des Rechts ein moralischen Fortschritt ist, bei dem die Vorstellung, eine rechtstragende Person zu sein, auf eine immer größer werdende Klasse von Akteuren ausgedehnt wurde: von nur bestimmten Männern auf mehr Männer, dann auf einige Frauen und schließlich auf alle Erwachsenen und dann auf Kinder und sogar auf Unternehmen und Schiffe. Warum nicht auch Bäume und Flüsse und Bäche? Rechtsmittel für Umweltschäden könnten dann nicht nur von den Menschen eingelegt werden, die von diesen Schäden betroffen sind, sondern auch im Namen der Umwelt selbst. Stone erklärte vor einem halben Jahrhundert, dass er diese Lösung als das bestmögliche Mittel gegen eine drohende Katastrophe ansehe, um einer drohenden Katastrophe zu begegnen. Wissenschaftler haben vor den Krisen gewarnt, die der Erde und allen Menschen auf der Erde drohen, wenn wir unser Verhalten nicht radikal ändern, schrieb Stone. Die Atmosphäre der Erde selbst ist mit beängstigend Möglichkeiten bedroht: Die Absorption von Unlicht, von dem der gesamte Lebenszyklus abhängt, könnte verringert werden; die Ozeane könnten sich erwärmen (was den Treibhauseffekt der Atmosphäre erhöht), was das Abschmelzen der Polkappen und die Zerstörung unserer großen Küstenstädte zur Folge haben wird.
Ein neuerer wegweisender Gerichtsfall erweitert Stones Arbeit und argumentiert für die Persönlichkeit eines Elefanten. Das Nonhuman Rights Projekt führt dieses Jahr im Namen eines asiatischen Elefanten namens Happy eine sog. Habeas-Corpus-Klage gegen den Bronx Zoo in New York. Das Projekt ist inspiriert von den Abolitionisten, die argumentierten, dass Menschen, die in Sklaverei/Knechtschaft gehalten werden, kein Eigentum, sondern Personen sind.
Das Nonhuman Rights Projekt begann seine Rechtsprozesse in New York im Jahr 2013 mit einer Habeas-Corpus-Petition für einen Schimpansen namens Kiko. Das Gericht wies die Petition mit der Begründung ab: Der Petent führt keinen Präzedenzfall an, und es scheint auch keinen zu geben – weder nach staatlichem Recht, noch nach englischen Gewohnheitsrecht – , dass ein Tier als ‚Person' im Sinne des Common Law Habeas Corpus angesehen werden könnte. Tatsächlich wurde Habeas-Corpus-Hilfe noch nie für ein nicht-menschliches Wesen gewährt.
Im Jahr 2016, nachdem das Nonhuman Rights Project eine zweite Habeas-Corpus-Petition für Kiko eingereicht hatte, reichte Laurence Tribe von der Harvard Law School ein Amicus Brief ((eine dem deutschen Recht fremde Rechtspraxis in USA, d. Ü.)) ein. Es bestritt die Aussage des Gerichts, dass Kiko mit der Begründung, dass Personen sowohl Rechte und Pflichten haben, keine Person sein könne: Diese Definition, die auf den ersten Blick Föten im dritten Trimester sowie Kinder und komatöse Erwachsene ausschließen würde (neben anderen Personen, deren Rechte als Personen das Gesetz schützt), missversteht die Beziehung zwischen Rechten, Pflichten und Personsein in erheblichem Maße. Im Jahr 2018 hat das New Yorker Berufungsgericht einen Antrag auf Zulassung der Berufung abgelehnt, aber ein Richter räumte ein, dass die Frage irgendwann geklärt werden muss und merkte an, dass die Streitfrage, ob ein nichtmenschliches Tier ein Grundrecht auf Freiheit hat, das durch das Habeas-Corpus-Gesetz geschützt ist, grundlegend und weitreichend ist. Es spricht für unsere Beziehung zu allem Leben um uns herum und wir werden es nicht ignorieren können. Es kann zwar argumentiert werden, dass ein Schimpanse keine »Person« ist. Es besteht aber kein Zweifel, dass es nicht nur ein Ding ist.
Dass Schimpansen eine Person sind, wurde – zumindest theoretisch – bereits an anderer Stelle festgestellt. Im Jahr 2016 hatte ein Gericht in Argentinien eine Habeas-Corpus-Petition abgewiesen, die von einer Tierrechtsorganisation im Namen eines Schimpansen namens Cecilia mit der Begründung, dass die Organisation keine Klagebefugnis habe. Aber es bestand darauf, dass Cecilia selbst eine Klagebefugnis hat, entschied, dass ein Schimpanse keine Sache ist, und erklärte, dass Menschenaffen juristische Personen mit Rechtsfähigkeit sind, jedoch nicht in der Lage, als solche zu handeln. Dies wird in diesem Fall durch die Evidenz bestärkt, dass Schimpansen die geistigen Fähigkeiten eines eines 4-jährigen Kindes haben. Ihre Rechte sind zwar nicht mit den Menschenrechten gleichzusetzen, aber das Gericht erklärte, dass sie das grundlegende Recht, in einer artgerechten Umgebung geboren zu werden, zu leben, zu wachsen und zu sterben haben. In einer Entscheidung aus dem Jahr 2019 in Indien, bei der es um eine Kuh ging, schrieb der Richter: Das gesamte Tierreich, einschließlich der Vogel- und Wasserwelt, werden zu Rechtssubjekten erklärt, die eine eigene Persönlichkeit mit mit den entsprechenden Rechten, Pflichten und Verbindlichkeiten einer lebenden Person und erklärte, dass alle Bürger in loco parentis als das menschliche Gesicht für das Wohlergehen und den Schutz der Tiere eintreten.
Im Jahr 2019 versuchte das Nonhuman Rights Project einen Habeas-Corpus-Rechtsschutz für drei Elefanten in Connecticut. In der mündlichen Verhandlung befragten die Richter den Vertreter des Projekts, Steven Wise, zu den Implikationen der Tierpersönlichkeit:
Der Richter: Gilt Ihr Argument auch für andere Tiere in freier Wildbahn?
Wise: Unsere Argumentation erstreckt sich auf Elefanten.
Der Richter: Ich frage Sie, weil es eine logische Frage ist, wie weit diese Behauptung geht. Sie bitten ein Gericht, nicht den Gesetzgeber, eine radikale Änderung des Gesetzes vorzunehmen, und ich möchte Sie bitten, eine Prognose darüber abzugeben, wohin das führt.
Wise hat diese Frage nie beantwortet. Es wird erwartet, dass der Fall Happy das New Yorker Berufungsgericht im Jahr 2022 beschäftigen wird.
Kein Fall wie der von Happy hat jemals ein so hohes Gericht erreicht, nirgendwo in der englischsprachigen Welt. In einer Zeit des Massensterbens und der Klimakatastrophe werden hier Fragen, aufgeworfen über die Beziehung zwischen Menschen, Tieren und der natürlichen Welt, die die Zukunft des Lebens auf der Erde betreffen, Fragen, für deren Beantwortung das geltende Recht katastrophal schlecht gerüstet ist. Unterdessen steigen die Gewässer. Menschen, vor allem die Armen leiden und sterben, Krankheiten breiten sich aus, Häuser werden weggespült, Wälder sterben, Vermögen gehen verloren, Lebensräume verschwinden, Arten sterben aus. Das Haus, in dem die Freiheit wohnt, wird von den Gespenstern der Grausamkeiten, Massakern und Gräuelaten heimgesucht. In ihm haben sich die Menschen selbst zu einer gefangenen Spezies gemacht, die auf eine neue Revolution warten.
Anmerkung d. Ü.: Bei Kursivschreibung liegt im amerikanischen Redemanuskript ein Zitat aus einem anderen Originaltext vor.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz