
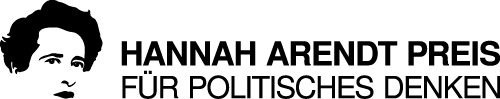

Ernst Wolfgang Böckenförde (†), Rechtsphilosoph; lebte im Breisgau
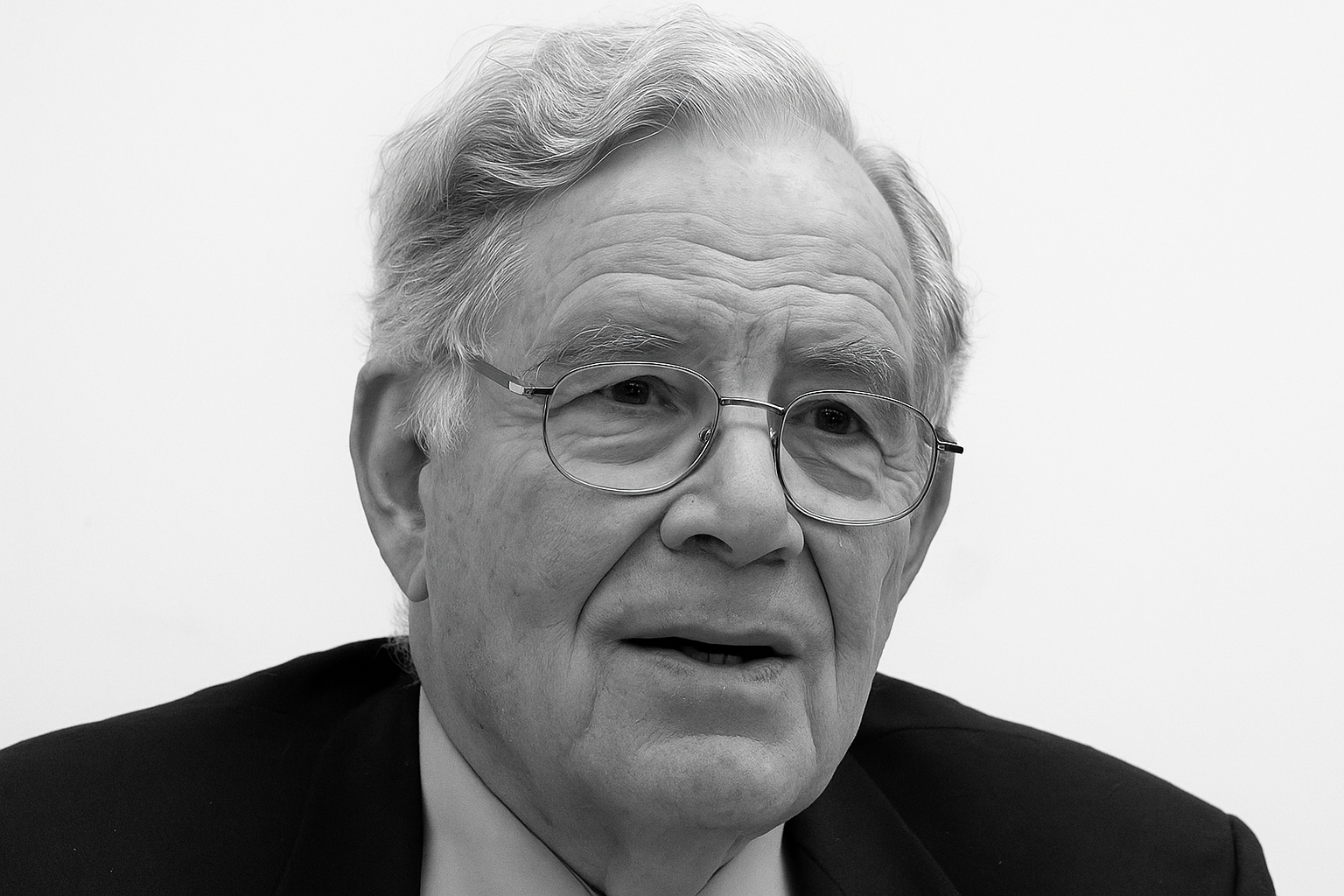
© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Ein erneuernder Konservativer?
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur diesjährigen Verleihung des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«. Ganz besonders heiße ich den Preisträger, Ernst-Wolfgang Böckenförde und seine Frau sowie die Gäste, die zu seiner Ehrung nach Bremen gekommen sind, willkommen. Unser jährliches Treffen zur Preisverleihung hat ja inzwischen Tradition. Wir blicken zurück auf eine ansehnliche Reihe von Preisträgerinnen und Preisträgern. Ágnes Heller (1995), François Furet (1996), Freimut Duve und Joachim Gauck (1997), Antje Vollmer und Claude Lefort (1998), Massimo Cacciari (1999), Jelena Bonner (2000), Ernst Vollrath und Daniel CohnBendit (2001), Gianni Vattimo (2002), Michael Ignatieff (2003). Lassen Sie mich ein kurzes Wort des Gedenkens an den in diesem Jahr verstorbenen Preisträger Ernst Vollrath einbringen. Er gehörte zu denen, die seit den Siebzigerjahren das Denken Arendts im Westen Deutschlands kenntlich gemacht haben, gegen viele Widerstände in den wissenschaftlichen Zünften. Seine Skepsis gegenüber säkularen Erlösungssehnsüchten hat ihm in den Siebzigerjahren den Ruf eingetragen, ein konservativer, das heißt bloß bewahrender Denker zu sein. Doch war er einer der wenigen, deren Denken immer um die Erneuerung der politischen Sphäre kreiste.
Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, sucht eine internationale Jury die jeweiligen Preisträger aus. Im Laufe der Jahre hat es sehr unterschiedliche Jury-Sitzungen gegeben, leichte und eindeutige, schwierige und kontroverse. Immer aber waren die Preisträger mit Themen verbunden. Manchmal hat ein Thema sich einen Preisträger gesucht, mitunter war es umgekehrt, dass erst über den Preisträger eine Idee erkennbar wurde. Doch selten haben ein Thema und ein Preisträger so selbstverständlich zueinander gefunden. Das Thema ist bei den Preisverleihungen der vergangenen Jahre immer wieder angespielt worden, ohne dass es so klar wie dieses Mal in Erscheinung getreten wäre: die Idee und die Geschichte einer immer wieder neu zu beginnenden Suche nach politischen, religiösen, moralischen, individuellen und kollektiven Sinnstiftungsmöglichkeiten im menschlichen Zusammenleben. Jedes Mal, wenn in der Vergangenheit verkündet wurde, der endgültige Sinn sei gefunden, erwies sich diese Verkündung als eine große Selbst-Täuschung, die zum Auseinanderbrechen der politisch verfassten Gesellschaften führte. Aus der Distanz können wir erkennen, dass Täuschungen zum Prozess der Suche hinzugehören und dass die Suche ein risikoreicher Weg ist. Vor dem Sturz in den Abgrund kann sich nur bewahren, wer fähig ist, die Täuschungen zu erkennen. Doch aus diesen Täuschungen zu schließen, dass die Suche beendet sei, wäre selbst eine Täuschung. Hannah Arendt hat aus dem Bruch der Tradition in der Mitte des 20. Jahrhunderts den Schluss gezogen, dass das Nachdenken über die Sinnhaftigkeit der Welt nicht festzuschreiben ist, dass es aber auch nicht grundlos ist. Seine Fundierung sah sie in den menschlichen Beziehungen, die durch Handeln und Sprechen, durch Denken und Urteilen gestiftet werden. Dieser Zusammenhang zwischen der aktuellen Debatte über »Europa und die Suche nach sich selbst« und dem uralten Thema der Stiftung von Sinnhaftigkeit im menschlichen Zusammenleben war es, der die Jury am Ende so sicher machte, in Ernst-Wolfgang Böckenförde den richtigen Träger des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken 2004« gefunden zu haben. Ernst-Wolfgang Böckenförde geht den Ideen nach, die in politischen Gemeinwesen wie in religiösen Gemeinschaften präsent sind, die zu Täuschungen werden können, aber auch unabdingbare Produktivkraft in politischen Sinnstiftungsprozessen sind. Herr Böckenförde ist Rechtsphilosoph und Rechtshistoriker. Nach seiner Promotion und Habilitation hat er von 1964 bis 1969 Rechtsphilosophie sowie Verfassungs- und Rechtsgeschichte an der Universität Heidelberg gelehrt. Er wurde später auf eine Professur für öffentliches Recht nach Bielefeld berufen und nahm schließlich 1977 den Ruf an die Juristische Fakultät in Freiburg im Breisgau an, wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1995 lehrte. Seit 1970 ist er Mitglied der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, von 1971 bis 1976 war er Mitglied der Enquetekommission Verfassungsreform des Deutschen Bundestages. 1983 wurde er in den Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts berufen und nahm diese Aufgabe bis 1996 wahr. Von seinen Werken nenne ich nur die jüngsten: die viel beachtete »Geschichte der Rechtsund Staatsphilosophie in der Antike und im Mittelalter« von 2002, die sich hervorragend auch für die Politikwissenschaft eignet, und die 2004 erschienene Aufsatzsammlung »Kirche und christlicher Glaube in den Herausforderungen der Zeit«, deren Themen bei dem Round Table-Gespräch heute Nachmittag eine Rolle gespielt haben. Etlichen von Ihnen ist Ernst-Wolfgang Böckenförde durch seine aktuellen Interventionen zu Fragen der Zeit bekannt, etwa zur Stellung des Individuums in unserem Rechtsverständnis oder zur religiösen Pluralität in säkularen Gesellschaften. Ihm geht der Ruf voraus, ein konservativer Denker zu sein. Diese Zuordnung scheint mir eigenartig quer zu stehen zu dem, was ErnstWolfgang Böckenförde antreibt, nämlich das Offenhalten und Erneuern der uralten Frage: Was bewirkt eigentlich, dass wir uns plural und sinnstiftend aufeinander beziehen können? Diese Frage wird seit Aristoteles immer wieder gestellt und es ist fast ein Wunder und auch wieder kein Zufall, dass sie in Zeiten der scheinbar vollständigen Säkularisierung und der Reduzierung des politischen Gemeinwesens auf die so unbefriedigende Dualität von Staat und Sozialverband immer wieder durchdringt. Von daher scheint mir Herr Böckenförde eher zu den Erneuerern als zu den Bewahrern zu gehören, aber wir wissen ja – und dies nicht erst seit Martin Heideggers Kritik an der geisteswissenschaftlichen Begrifflichkeit –, dass sich Begriffe von ihrem Gehalt lösen können. Vor diesem Hintergrund wäre denn Herr Böckenförde vielleicht als erneuernder Konservativer zu bezeichnen.
Wie immer wieder an dieser Stelle möchte ich den Geldgebern herzlich danken: der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bremer Senat, die Abende wie diesen ermöglichen. Großer Dank gilt natürlich auch der Jury und dem Kreis der Freunde und Mitstreiter – Lothar Probst, Peter Rüdel und Zoltán Szankay –, die den Preis mit neuen Ideen füttern und verhindern, dass dieser seine Sperrigkeit verliert: Die Jury hat entschieden, dass der Preisträger aus unterschiedlichen Perspektiven gewürdigt werden soll. Es gibt daher zwei Laudationes, eine von Tine Stein, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin, und die andere von Joachim Gauck, ehemals Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR und – zusammen mit Freimut Duve – Träger des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken« des Jahres 1997.
Ich bin nun der Fünfte, der sich in Reihenfolge an diesem Riesenaufriss von Ernst-Wolfgang Böckenförde abarbeiten will. Ich will es deshalb mal so machen: Erstens freue ich mich, dass es gelungen ist, in dieser Kombination so einen Preisträger auszugucken. Das war eine richtige Überraschung und das finde ich für beide Seiten erstaunlich und schön. Ich freue mich mit darüber. Als Zweites kann ich jeden Satz, den Ralf Fücks gesagt hat, unterstreichen. Das ist offenbar auch das Verdienst des Denkanstoßes unseres Preisträgers, dass so sehr unterschiedliche Leute wie der »Grüne« Ralf Fücks und der »brave Sozialdemokrat« Henning Scherf in einer großen Koalition gemeinsame Antworten finden. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich Sie so hörte – besonders Joachim Gauck, als er uns seine Biografie vorgetragen hat –, warum es mir anders als Ihnen geht. Also, mir geht es mit dem, was ich bei Ernst-Wolfgang Böckenförde höre, nicht so, dass ich auf meine Biografie zurückfalle, sondern mich fasziniert die Argumentationskraft des Juristen. Viele von Ihnen sind ja keine Juristen und halten Juristen eigentlich für eine anstrengende Spezies, die zwar nicht übersehen werden kann, aber die man eigentlich möglichst links oder rechts liegen lassen sollte oder, wenn überhaupt, als eine Art Techniker oder als Machttechniker ertragen muss. Sie lernen, finde ich und das habe ich eben auch bei diesem Vortrag gesehen, sie lernen, wie wir Juristen versuchen zu argumentieren. Das ist eine eigene Sorte von Umgang mit Ratio, Umgang mit Vernunft. Das ist ein Stück Säkularisierung, das ist auch ein Stück kultureller und zivilisatorischer Fortschritt. Diesen Vortrag eben – auf den ich genauso reagiert habe wie Ralf Fücks – habe ich erlebt wie ein Gutachten, früher, als ich noch Römisches Recht machen und argumentieren musste. Auf solch eine Art hat er das aufgebaut. Er sortiert seine Argumente und er sortiert auch die Argumente, die dagegen sprechen und kommt nicht gleich auf irgendeine machtpolitische Schlussfolgerung, bei der alles machtpolitisch plausibel oder nützlich wird. Das ist nicht nur intellektuell faszinierend, das ist auch grundlegend für Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft verlangt diese Form der Rationalisierung und diese Form des rationellen Umgangs mit Argumenten, auch mit anderen Argumenten. Wenn das aufgegeben wird oder würde und eigentlich nur noch polemisiert und Partei ergriffen wird und alle niedergemacht werden, die eine andere Meinung haben, dann geht Zivilgesellschaft kaputt, und dann geht auch die säkularisierte Gesellschaft und auch Vernunft kaputt. Wenn man sorgfältige Argumentation, die Betrachtung der anderen Seite eben nicht nur bei dem Verfassungsrechtler, sondern auch bei dem politischen Wissenschaftler findet – Ernst-Wolfgang Böckenförde ist ja ein großer Jurist, ein großer Verfassungsrechtler, ein großer Verfassungshistoriker und auf eben besondere Weise auch Politikwissenschaftler, aber immer mit dieser Sorgfalt der Argumentation –, dann ist das sehr befreiend. Wir haben uns nämlich alle darauf eingerichtet, eigentlich immer nur Machtfragen zu analysieren und diese immer nur auf ökonomische Interessenlagen zu reduzieren. Welches Interesse steckt hinter irgendeiner Entscheidung? Wenn man das weiß und das identifiziert hat, dann ist schon klar, woher die Entscheidung kommt. Das ist bei Ernst-Wolfgang Böckenförde ganz sorgfältig anders, und das ist entscheidend und wichtig. Das ist ein Stück unserer zivilisatorischen Entwicklung. Das ist ein Ergebnis der Aufklärung, das ist ein Ergebnis der Emanzipation. Und nun kommt er wieder und sagt zu uns, dass das auch das ist, was die Kirche betrieben hat, obwohl wir ja wissen, wie die Kirche darunter auch gelitten hat, als der Aufklärer den Theologen das Heft aus der Hand genommen hat. Die Säkularisierung ist das Ergebnis von theologischer Anstrengung, Reflexion und einem ernsthaften »Sich-Kümmern«. Das kann ich genau so sagen, da fühle ich mich aufgehoben und bin glücklich darüber, dass so eine Stimme so zentral in der Republik ist und so zentral von allen Seiten – auch wenn sie anstrengend ist und widersprüchlich sein mag – wahrgenommen wird. Ganz ausdrücklich bedanken möchte ich mich noch für diese ungewöhnliche Intervention in der »Kopftuchfrage«. Marie-Luise Beck und ich kämpfen da mit dem Rücken an der Wand. Wir haben – das können wir hier ruhig mal sagen – in unseren Parteien und überall inzwischen nur noch Abwehr gegen diese Lösung. Ich habe selber hier in Bremen grandios auf meinem SPD-Landesparteitag die erste fette Niederlage erlebt. Alle wollen mich hier halten in der Regierung, aber in dieser Frage bin ich so richtig niedergemacht und niedergestimmt worden und knabbere daran herum, aber ich will nicht aufgeben. Ich will nicht sagen: »Das ist jetzt erledigt«, sondern ich will mit dieser Argumentationshilfe überzeugen. Die müssen wir richtig nutzen. Wir müssen mit Ihnen »die Hans-Jochen Vogels« und »die Schilys« richtig in Verlegenheit bringen. Otto Schily kann man mit Ihnen richtig in Verlegenheit bringen. Das weiß ich, weil der Otto Schily ist ein kluger Jurist, und den kann man auch mit klugen juristischen verfassungsrechtlichen Argumentationen zur Nachdenklichkeit bringen. Ich finde, das ist ungewöhnlich und dafür danke ich Ihnen sehr, denn das wünsche ich mir auch, dass Religionsfreiheit natürlich für jeden gilt, und dass das nicht in einer Beliebigkeit endet – dass wir womöglich Angst haben vor Leuten, die zeigen, was sie glauben –, sondern dass das vielleicht eine Aufforderung wird, endlich rauszukommen aus der Beliebigkeit und dieser feigen »Wegduckerei«, die wir in den Kirchen übrigens ständig erleben. Das wissen Sie ja genauso wie ich auch. Überall wird so »weggeduckt«, weil sie Angst haben, dass sie in einer Minderheitsposition wahrgenommen werden und dann womöglich öffentlich lächerlich gemacht werden, deshalb sagen sie lieber gar nichts mehr. Grässlich, furchtbar, eine schreckliche Perspektive! Wenn wir wirklich alle zu Feiglingen werden und dann denen, die sich noch trauen, mit Polizeigewalt das noch verbieten. Also – Glückwunsch zu diesem ungewöhnlichen Preis. Diese Verleihung ist völlig anders als die des Guardini-Preises. Ich habe mir überlegt, wie das da in München war, als sich um Ernst-Wolfgang Böckenförde herum die CSU versammelt hatte und mit dem Kardinal zusammen darauf stolz war, dass nun ein so kluger Mann den Guardini-Preis kriegte. Das hier ist fast genau das Gegenteil davon, und das ist wunderbar. Es ist wunderbar, die Erfahrung zu machen, dass es Gestalten gibt – wie Ernst-Wolfgang Böckenförde –, die das in beiden unterschiedlichen Gesellschaften sagen können, frei und unverwechselbar sagen können. Das macht mich glücklich und ich bedanke mich besonders bei der Jury, dass sie auf diese grandiose Idee gekommen ist. – Ich hätte euch das nicht zugetraut.
Nach vielen klugen Worten möchte ich nur noch einige bescheidene Anmerkungen von meiner Seite und für die Heinrich-Böll-Stiftung machen. Die Jury hat auch in diesem Jahr die – immer mal wieder leise aufkommende – Befürchtung, dem Hannah-Arendt-Preis könnten die überzeugenden Preisträger ausgehen, auf eine eindrucksvolle Weise widerlegt. Ernst-Wolfgang Böckenförde ist zweifellos einer der markantesten politischen Denker unserer Republik, kein leichtfüßiger Meinungshändler im Talkshow-Format, sondern ein ebenso scharfsinniger wie unbequemer Kopf, der seinen Hörern und Lesern den Gebrauch des eigenen Verstandes abverlangt. – Ganz in der Tradition von Hannah Arendt. Ich erinnere an vier öffentliche Interventionen aus Ihrer Zeit, nachdem Sie aus dem Verfassungsgericht ausgeschieden waren. Es ist schon mehrfach auf Ihre Verteidigung der Religionsfreiheit und der aus ihr abgeleiteten Gleichberechtigung der religiösen Bekenntnisse hingewiesen worden. Ein Plädoyer gerade aus der Position des bekennenden Christenmenschen. Also nicht aus einer Haltung der Selbstabdankung der christlichen Kultur und Tradition, sondern gerade umgekehrt: als ein Zeichen Ihres Selbstbewusstseins, Ihrer Stärke und der Bedeutung, die die Menschenwürde – gerade in dieser christlichen Konzeption – hat und die sich eben auch beweist in dem Respekt und in der Anerkennung des Andersgläubigen. Man würde den deutschen Christdemokraten ein bisschen mehr von dieser Kombination von Liberalität und wertkonservativer Haltung, die Sie verkörpern, wünschen. Gerade wenn man an die aktuelle, fast hysterische Debatte über das angebliche Ende der multikulturellen und damit auch der multireligiösen Gesellschaft denkt. Ich erinnere als ein Zweites an Ihre Verteidigung der Geisteswissenschaften gegen eine kurzschlüssige Wissenschafts- und Hochschulpolitik, die die Geisteswissenschaften über den utilitaristischen Leisten schlägt und nur noch unter dem Kriterium ihrer ökonomischen Verwertbarkeit beurteilt – auch ein sehr aktuelles Thema. Ich erinnere an Ihren ebenso präzisen, wie donnernden Alarmruf gegen die relativierende Interpretation des Artikels 1 des Grundgesetzes, der unter dem Titel »Die Würde des Menschen war unantastbar« erschien. Auch dies ist keine akademische Frage, sondern eine höchst aktuelle in Zeiten der verwertenden Embryonenforschung oder des Überschreitens des Folterverbotes unter den Vorzeichen des Kampfes gegen den Terrorismus. Schließlich erinnere ich an Ihre mehrfachen Interventionen zu Fragen der Verfasstheit der Europäischen Union und der Zukunft der europäischen Demokratie, mit dem Ziel einer föderalen, europäisch-demokratischen Ordnung, die den Nationalstaat einerseits transzendiert und gleichzeitig sie zurückbindet an den Nationalstaat als eine Basis des politischen Lebens der Nationen in Europa. Das bringt mich natürlich unvermeidlich zu Ihrem Vortrag. Gestatten Sie mir als Referenz an diese Herausforderung ein paar kleine Bemerkungen. Es ist wohl wahr – und ich teile diese Analyse –, dass zwischen einer forcierten Erweiterungspolitik der Europäischen Union und dem proklamierten Ziel ihrer politischen Vertiefungen kein Harmonieverhältnis besteht, sondern ein Spannungsverhältnis und ab einem bestimmten Punkt sogar ein Konfliktverhältnis. Ich bin aber überzeugt, dass diese Frage sich zwar besonders scharf am Bespiel der Türkei stellt – genau aus den Gründen, die Sie genannt haben –, aber nicht exklusiv an der Türkei. Wenn man die Erweiterungsdynamik der Europäischen Union auf jetzt 25 Mitglieder vor Augen hat – mit Rumänien und Bulgarien an der Schwelle des Beitrittes und den Staaten des südlichen Balkan und Kroatien als nächstem Staat –, dann haben wir unschwer bald eine Europäische Union der 32 oder auch 33 Mitglieder vor Augen – auch ohne die Türkei. Mit welchem politisch-moralischen und historischen Recht wollten wir einer demokratischen Ukraine den Beitritt in die Europäische Union verweigern, nachdem wir zumindest sehr ernsthaft die Frage des Bei trittes der Türkei zur Europäischen Union aufgeworfen haben? Gerade erleben wir nämlich einen dieser seltenen historischen Momente, in dem die Kontinuität der Machtverhältnisse durchbrochen wird und die Bürgergesellschaft als politisches Subjekt auf den Plan tritt. Es geht ja um viel mehr als um einen Machtkampf zwischen zwei Kandidaten, die beide aus – sagen wir mal – der kommunistischen Tradition und ihren Parteien kommen, sondern es geht tatsächlich um den Konflikt zwischen einer erwachten selbstbewussten Zivilgesellschaft und dem krypto-sowjetischen Machtsystem. Es geht um die Fortsetzung dieser langen Welle der Demokratisierungen, die 1989 in der DDR, in Polen, in Tschechien und in Ungarn erfolgreich war und sich dann mit dem Sturz von Milosevic und vor fast genau vor einem Jahr in Georgien fortgesetzt hat. Diese Entwicklung braucht unsere ganze Sympathie und sie ist auch ein Prüfstein dafür, wie ernst es die Europäische Union mit ihren eigenen demokratischen Prinzipien nimmt, und dass sie nicht bereit ist, ihre demokratischen Grundsätze auf dem Altar der strategischen Partnerschaft mit Russlands Putin oder Putins Russland zu opfern. Also – das Problem, auf das Sie hingewiesen haben, dass eine forcierte Expansion der Europäischen Union möglicherweise ihre Fähigkeit, zu politischer Integration und die dafür notwendige (nicht nur formale) Kohäsion, sondern auch einen Zusammenhalt, der auf gemeinsamen Werten und gemeinsamen Orientierungen beruht, untergräbt, das ist wohl gegeben. Es war mir aber ein Schuss zu viel und ein bisschen zuviel Fatalismus in dieser Analyse. Ich setze doch stärker auf das Zutrauen auf die Reformfähigkeit der Europäischen Union und auf ihre Fähigkeit sich auf immer neue Herausforderungen immer neu einzustellen und sich immer neu selbst zu erfinden, und ich setze auf die Anziehungskraft der europäischen Demokratie und des europäischen Gesellschaftsmodells einer freiheitlich-sozialen Lebensform. Ich glaube Sie haben Recht, es wird am Ende zu einer Art engeren und weiteren Union kommen – mit oder ohne Beitritt der Türkei. Es wird zu einer stärkeren inneren Differenzierung kommen, aber nicht zu einer scharfen Abgrenzung dieser inneren und äußeren Union, sondern zu ganz differenzierten Niveaus von Zusammenarbeit und Integration; hoffentlich nicht in Form eines fest abgegrenzten Kerneuropas, dem ein Randeuropa gegenübersteht, sondern als ein offenes und flexibles System der Zusammenarbeit. Das – ganz am Ende – geopolitische Argument, dem Sie zu Recht einen zentralen Stellenwert gegeben haben, das ist, glaube ich, am Ende ein sehr schwerwiegendes Pro-Argument. Die Vorstellung der Europäischen Union als einer politischen Ordnungsmacht, die eine pro-aktive Stabilitätspolitik gegenüber ihren krisenhaften Nachbarregionen im Kaukasus, in Zentralasien und im Vorderen und Mittleren Orient betreibt, das ist sicher eine sehr andere Europäische Union als die der letzten zwanzig, dreißig Jahre. Ich halte aber die politische Herausforderung für ganz entscheidend, vor allem mit Blick auf die Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit der islamischen Welt. Ich setzte zudem darauf, dass die Europäische Union diese stabilisierende Funktion weniger durch die Macht ihrer Waffen als durch die Anziehungskraft ihrer demokratisch-politischen Kultur und auch durch die Magnetkraft ihres Binnenmarktes wird wahrnehmen können. Man kann, glaube ich, mit guten Gründen für den Beitritt der Türkei in die Europäische Union sein, aber man muss wissen, welche Probleme und welche Herausforderungen man sich damit an Bord holt und, dass man dafür einen Preis wird bezahlen müssen (nicht nur einen ökonomischen). In diesem Sinne fand ich Ihren Vortrag eine wunderbare Herausforderung. Herzlichen Dank. Ich verbinde den Glückwunsch an den Preisträger mit dem Glückwunsch an die Jury und einem Dankeschön für das – im besten Sinne – ehrenamtliche Engagement, mit dem sie diesen Preis nicht nur aus der Taufe gehoben, sondern groß gemacht hat.
Religions- und Gewissensfreiheit als zwingendes Recht
In Ernst-Wolfgang Böckenförde ehren wir mit dem HannahArendt-Preis für politisches Denken 2004 einen Gelehrten, einen politisch wirkmächtigen Intellektuellen und einen Bürger, der eines der höchsten republikanischen Ämter innehatte. Sein Amtsverständnis war von einem besonderen Ethos getragen. Böckenförde versteht es, in einer dialektischen Überlegung einerseits weltliche Rechtsordnung und göttliche Ordnung klar zu unterscheiden, andererseits den inhärenten Zusammenhang von Politik und Religion aufzuweisen. Darin liegt das große intellektuelle und vor allem auch politische Verdienst Ernst-Wolfgang Böckenfördes. Denn dies enthält eine Antwort auf die immer drängende und gegenwärtig besonders virulente Frage, wie das friedliche Zusammenleben in einer Gesellschaft gelingen kann, in der religiöse und säkulare Wahrheitsansprüche, ja, selbst die Negation eines Wahrheitsanspruchs, miteinander konkurrieren. Ernst-Wolfgang Böckenförde beschreibt in dem Aufsatz »Als Christ im Amt des Verfassungsrichters«, warum er bei der Vereidigung zum Bundesverfassungsrichter den Eid mit der religiösen Beteuerung abgeleistet hat – im Unterschied zu vorangegangenen Gelegenheiten. Während für den Normalfall des bürgerlichen Lebens die allzu häufige öffentliche Bezugnahme auf Gott ihm wohl weder als Christ noch als Bürger geboten erschien, so wollte er doch für die Amtsführung des Richters die innersten Bindungskräfte, die das Anrufen des göttlichen Beistands zu mobilisieren vermag, erbitten – wofür? Dafür, dass er sich als Richter allein auf die positive Rechtsordnung stützen möge und dem Prinzip der weltanschaulich-religiösen Neutralität gemäß die Rechtsprechung in höchstem Maße professionell auszuüben in der Lage sein werde – und das heißt: in Absehung persönlicher politischer und religiöser Überzeugungen. Die Bindungen und Verpflichtungen, denen der Verfassungsrichter sich zu fügen hat, sind die dieses spezifischen Amtes, nicht aber solche, denen die Person, welche das Richteramt bekleidet, in anderen Bezügen unterliegt, seien es jene, die aus einer Parteizugehörigkeit oder jene, die aus einer Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft resultieren. Es ist dieses Amtsverständnis, für das Böckenförde den Amtseid mit religiöser Bekräftigung geleistet hat, damit das Vertrauen, welches in der Verfassungsordnung dem Verfassungsrichteramt entgegenzubringen ist, nicht ge- und enttäuscht wird. Die Tatsache, dass die Richter in vielen genuin politischen Konflikten das letzte Wort haben, erfordert eine besondere Skrupulösität in der Interpretation der Verfassung, die in ihren Begründungen sich frei von religiös-metaphysischen Erwägungen halten muss. Das stellt an einen Richter, der als Person an die Wahrheit der geschichtlichen Gottesoffenbarung glaubt und der als Gelehrter ein sensibler Kenner der christlichen Rechtstheologie, insbesondere des thomistischen Naturrechts, ist – so möchte man in Böckenfördes Fall hinzufügen – eine besondere Anforderung. Das Dialektische ist nun, dass Ernst-Wolfgang Böckenförde zu diesem deutlichen – und wohl mitunter manche der konfessionellen Glaubensgeschwister wie politischen Freunde etwas enttäuscht habenden – Rollenverständnis nicht allein aus der eingehenden historischen Analyse der »Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation« gelangt; nicht allein aus der für den Juristen typischen Wertschätzung des positiven Rechts, das in der Lage ist, gerade weil es neutral gegenüber der Religion ist, Frieden und Sicherheit zu schaffen. Nein, Böckenförde kommt auch aus einer religiös motivierten Perspektive zu diesem Rollenverständnis. Denn nur wenn im Staat die Trennlinie zwischen der religiösen Sphäre und dem Regelungsbereich des Staates eingehalten wird, kann sich die Religions- und Gewissensfreiheit entfalten. Diese Freiheit ist eben nicht eine bloße Duldung gegenüber einer Abweichung, nicht eine Haltung der Toleranz der Mehrheit gegenüber der Minderheit oder gegenüber einem vom irrenden Gewissen fehlgeleiteten Glauben, wie es in den päpstlichen Stellungnahmen bis in die Fünfzigerjahre hinein zu lesen war. Sondern die Religions- und Gewissensfreiheit ist zwingendes Recht der Person, unabhängig vom jeweiligen Glaubensinhalt. Dies folgt für Böckenförde aus der theologisch begründeten Erkenntnis, dass der Glaube nur in Freiheit angenommen werden kann. Böckenförde hat mit sehr deutlichen Worten kritisiert, dass die Katholische Kirche eine unfassbar lange Zeit gebraucht hat, bis zum Zweiten Vatikanum nämlich, um zu dieser Wahrheit des Evangeliums durchzustoßen: dass die Wahrheit der Offenbarung verlangt, der Mensch möge sich in Freiheit zu ihr bekennen. Das umschließt notwendig die Möglichkeit, zu Gott nein sagen zu können. In den Schriften des Alten und Neuen Testaments wird der Mensch als mit einem Gewissen begabte sittliche Person vorgestellt. Das ist für die moderne Geschichte der Freiheit von ausschlaggebender Bedeutung. »Civis simul et christianus« – als Bürger und als Christ gelangt Böckenförde zu der Überzeugung, dass im religiös-weltanschaulich neutralen Staat es die Religionsfreiheit gebietet, ein Amt so auszuüben, wie es der säkularen Verfassungsordnung entspricht, und auf dieses Amtsverständnis hat er den Eid mit religiöser Beteuerung geleistet. Für Ernst-Wolfgang Böckenförde ist also die Trennung von politisch gesetzter Rechtsordnung und geoffenbarter Wahrheit als Quelle religiöser und ethischer Normen grundlegend. Die Rechtsordnung des freiheitlichen Verfassungsstaates verlangt Rechtstreue, aber nicht ein Bekenntnis innerer Loyalität, wie es das Bundesverfassungsgericht im Fall der Zeugen Jehovas unterstrichen hat. Das Gericht lässt es sich übrigens in diesem Zusammenhang der Frage von Staat und Religionsgemeinschaft auch nicht nehmen, an den berühmten Satz Böckenfördes zu erinnern, indem es festhält: »Dass sie (die Religionsgemeinschaften) ihre Tätigkeit frei von staatlicher Bevormundung und Einflussnahme entfalten können, schafft die Voraussetzung und den Rahmen, in dem die Religionsgemeinschaften das Ihre zu den Grundlagen von Staat und Gesellschaft beitragen können.« (BVerfGE 102, 370 ff [394] – als Literatur wird auf den Aufsatz zur Entstehung des Staates verwiesen.) Vor der Erwartung einer loyalen Gesinnung schützt die in Artikel 4 des Grundgesetzes verbürgte Religions- und Gewissensfreiheit. Kein Fürst dieser Welt kann für sich die metaphysische Legitimation in Anspruch nehmen, hier auf Erden letzte Gerechtigkeit zu versprechen – ob er sich nun als Repräsentant Gottes oder einer höheren Wahrheit versteht oder diese gar selbst zu verkörpern meint. Wohin solches Ansinnen führt, darüber unterrichtet die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Ost und West zur Genüge. (Und es bleibt deprimierend, dass ausgerechnet Carl Schmitt als einer der Klassiker des politischen und rechtlichen Denkens des vergangenen Jahrhunderts, der – obwohl er vom Menschen als einem »geistlich-weltlichen, spiritual-temporalen Doppelwesen« gesprochen hat – für die irdische Existenz der Menschen diese zu einer identitären politischen Einheit im Staat bringen wollte.)
Wenn also demgegenüber im religiös-weltanschaulich neutralen Staat der Verfügungsanspruch über die Bürger prinzipiell auf deren äußere Handlungen beschränkt ist, so ist zugleich darüber zu sprechen, woraus denn die Bürger die innerlichen Antriebsund Bindungskräfte beziehen, die zu jenem Minimum an ethischer Tugendhaftigkeit und wechselseitiger Solidarität führen, ohne die der Verfassungsstaat, der eben kein »Leviathan«, sondern freiheitlicher Staat ist, nicht funktionieren kann. Dass es allein die nackte Anerkennung und Ausübung der verfassungsmäßig garantierten Rechte eines jeden und die dort verankerten demokratischen Verfahrensweisen sind, die aus einer Gesellschaft von Fremden die zumutungsreiche Rechtsgemeinschaft machen, eine Gemeinschaft also, in der die Rechtsgenossen nicht nur um ihr eigenes Wohl, sondern auch um das der anderen und der Gesamtheit besorgt sind, das ist eine aus liberaler Sicht vielleicht für manche sympathische Hoffnung, aber letztlich eine weder theoretisch besonders plausible noch historisch gut belegte Vermutung. Auch die »Anrufung« einer dem Grundgesetz vermeintlich inhärenten Wertordnung kann dem positiven Recht nicht einen Mehrwert an Überzeugungskraft und Verbindlichkeit erbringen, wie Ernst-Wolfgang Böckenförde in seiner luziden Kritik der Wertordnungslehre klargestellt hat. Interessant ist nun gerade, dass Böckenförde die Frage nach dem »einigenden Band«, das der Gewährleistung der Freiheit des Einzelnen vorausliegt, nicht mit den gemeinsamen Wertüberzeugungen der Glaubensanhänger des Christentums zu einer Antwort kurzschließt. So einfach ist es nicht, wie manche Vertreter der politischen Klasse in diesen Tagen zu meinen scheinen, dass es bei der Integration des Staates bloß darauf ankomme, wahlweise a) die Liebe zum Vaterland in den Stundenplan der Öffentlichkeit neu aufzunehmen oder b) eine immerhin nominell noch zählbare christliche Mehrheit durch einen leitkulturellen Artenschutz zu privilegieren und womöglich zu fordern, dass im Lichte dieser Leitkultur dann auch die Rechte Anders- und Nichtgläubiger auszulegen seien. Die Position Böckenfördes im Kopftuchstreit ist diesbezüglich im Übrigen eindeutig: Aus dem Prinzip der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates folgt auch das Gebot der Gleichbehandlung. Entweder die symbolischen Zeichen des individuellen Glaubens sind für alle Religionsgemeinschaften gleichermaßen zulässig oder aber für alle gleichermaßen verboten, gleichviel ob Kopftuch, Kreuz oder Kippa. Das Bundesland Berlin hat sich für Letzteres entschieden und den französischen Weg eingeschlagen. Gewiss: Exklusiv-Rechte kann es für die Mehrheitsreligion nicht geben. Aber sichtbar sein in ihrer Religiosität – das sollen die Bürger, die es wollen, auch sein können, ob nun Anhänger des mehrheitlich vorherrschenden Glaubens oder der Minderheit. Im Unterschied zum französischen Modell des Laizismus, das dieser Tage durch den Präsidentschaftsbewerber Sarkozy kritisch hinterfragt wird, ist der deutsche Weg der offenen Neutralität ein anderer, worauf Böckenförde mit großer Geduld bei zahllosen Gelegenheiten immer wieder aufmerksam gemacht hat: Der Öffentlichkeitsanspruch, der für Religionen wie das Christentum und den Islam typisch ist, wird nicht aus der politisch-öffentlichen Sphäre in das Reich des Privaten verbannt.
Hat Böckenförde nun aber eine andere ungleiche Bewertung eingebracht, nämlich eine hinsichtlich religiöser und nicht-religiöser Bürger? Hat er gesagt, dass nur der ein guter Bürger für den demokratischen Verfassungsstaat sein kann, für den das Ereignis der geschichtlichen Gottesoffenbarung eine Glaubensgewissheit ist, noch kürzer gesagt: dass nur derjenige über Moral, Sittlichkeit und Ethos verfügt, der diese aus transzendenten Quellen speist? Eine solche Exklusivitätsbehauptung ist nicht zu finden, ja, sie wird auch nicht insinuiert. Das würde die Stoßrichtung der Argumentation verkennen: Es geht Ernst-Wolfgang Böckenförde nicht darum, die gläubigen Bürger besonders zu adeln, sondern sie aufzufordern, sich zu fragen, was sie über die Rechtstreue hinaus einbringen können. Das ist keine Forderung, die von staatlichen Organen an die Bürger ergehen kann, aber umso
wichtiger ist es, auf Grund der »Freigabe des Ethos« der Einzelnen diese in dem Dauerdiskurs der Öffentlichkeit auch an ihre Verantwortung für das Gelingen der freiheitlichen Ordnung zu erinnern. Im Kontext vor annähernd vierzig Jahren, als der berühmte Satz, nach welchem der freiheitliche säkularisierte Verfassungsstaat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann, das erste Mal, authentisch vom Autor selbst, in der Öffentlichkeit ausgesprochen wurde, ging es darum, die Christen aufzufordern, den säkularen Staat nicht als Feindesland zu begreifen. Heute sind die Probleme andere. Der Aufruf zur Einmischung, als der einzigen Möglichkeit realistisch zu bleiben, wie man mit Heinrich Böll ergänzen möchte, wäre heute anderen Charakters. Es geht darum, die in den religiösen Wahrheiten aufgehobenen Erkenntnisse in einer Weise in das politische Räsonnement einzubringen, die auch für den religiös Unmusikalischen eine Bereicherung darstellen kann. Jürgen Habermas hat in seiner Rede »Glauben und Wissen« hierfür den Begriff des Übersetzens vorgeschlagen. Und das hat Ernst-Wolfgang Böckenförde wahrlich ein ganzes reiches Gelehrtenleben lang getan. Seine Beiträge zur politisch-theologischen Verfassungsgeschichte, die nun in dem Band Kirche und christlicher Glaube in den Herausforderungen der Zeit versammelt sind, geben davon ein beredtes Zeugnis ab. Insbesondere hat er immer wieder eindringlich den Elementarbegriff der Menschenwürde herausgestellt. So wie die Souveränität des Volkes sich historisch nicht ohne die Vorstellung von Gottes Allmacht ausgebildet hat, so ist die Entwicklung der Unbedingtheit der Menschenwürde nicht ohne die in den biblischen Erzählungen bewahrte und theologisch begründete Idee der Gottebenbildlichkeit denkbar. Gewiss, die Menschenwürde lässt sich begründen ohne theologische Metaphysik, und einer im System des positiven Rechts verbleibende Verfassungsinterpretation des Artikels 1 Grundgesetz durch das Bundesverfassungsgericht muss
dies auch gelingen. Aber wie arm wäre unsere geistige Auseinandersetzung über die normativen Grundlagen unserer Rechtsordnung, wenn nicht auch die religiös inspirierten Begründungen in den wissenschaftlichen und öffentlichen Foren diskutiert würden. Warum auch sollte sich eine Gesellschaft von diesem Teil ihrer Herkunftsbedingungen gewissermaßen abschneiden, die doch ansonsten ganz auf die Pluralität der Sichtweisen im öffentlichen Ringen um das Gemeinwohl setzt? Mit der Menschenwürdegarantie ist ein meta-positives Prinzip positiviert worden, mit dem, wie es Böckenförde gesagt hat, ein »Anker« ausgeworfen, ein »Pfeiler im Strom des fließenden Verfassungsdiskurses« gesetzt wird. Gilt dies aber auch dann noch, wenn die Mehrheit der juristischen Kommentare diese Interpretation nicht mehr teilen sollte – weder die Auffassung, dass es sich um ein meta-positives Prinzip handelt, noch die der Unbedingtheit der Menschenwürde? Es mag dann noch auf dem Papier des Grundgesetzes der Satz stehen: »Die Würde des Menschen ist unantastbar«, es mag noch die Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 Grundgesetz suggerieren, eine Änderung habe nicht stattgefunden. Aber es würde sich dann doch wahrscheinlich bald um eine andere rechtliche Grundordnung handeln, in der die Idee der Gottebenbildlichkeit nicht länger eine gelungene säkulare Übersetzung in das Prinzip der unbedingten Menschenwürde findet. Ernst-Wolfgang Böckenförde hat uns das begriffliche und argumentative Instrumentarium an die Hand gegeben, diesen Wandel in aller Schärfe zu erkennen und ihn zu kritisieren.
Welche Art von Neutralität wollen wir?
Wie war das mit dem berühmten Böckenförde-Satz, der im Zentrum meiner Annäherung steht, die ich – ein Nicht-Jurist und Nicht-Politikwissenschaftler – als Bürger versuchen werde zu betrachten? Ich will ihn noch einmal zitieren: »Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert.« Was habe ich gesagt? Eine Annäherung soll es sein, die Anreise eines Bürgers auf diesen Boden, der mit einem solchen Wort beschrieben ist. Es ist eine Annäherung an eine Person, die mich als Christ und Bürger fasziniert. Es ist auch eine Annäherung an einen Gelehrten, aber in jedem Fall an eine Person, die ganz Ja sagen kann zum säkularen Staat, obwohl sie sich erkennbar letztlich aus ganz anderen Quellen geformt hat. Einst, als ich im dunklen Osten lebte, wollte ich nicht sein wie die, die den Raum beherrschten. Noch im Krieg geboren, war ich zu klein, um von den damaligen Diktatoren verführt zu werden. Größer geworden, trat neues Unrecht so dicht an mich – den Heranwachsenden – heran, dass, wenn man sich nicht aufgeben und mit den »Wölfen heulen« wollte, ein Fluchtpunkt gefunden werden musste, der dem örtlich Bleibenden eine geistige Heimat anderswo anbot.
Ich glaube nicht, dass mich die spärlichen protestantischen Traditionen meines Elternhauses, meiner Familie zu einem Glaubenden hätten machen können, aber die Nähe des Unrechts und der Ungerechtigkeit sehr wohl. Es war das öffentliche Unrecht, dass sich in der Binnenwelt des Jungen ein freiheitshungriges und gerechtigkeitssüchtiges Ich erschuf, das mit dem Unwesen nun zu ringen begann. In solchen Situationen entdeckt man gleich gesinnte Suchende und wappnet sich mit einer Rüstung, die einem niemand nehmen kann, nämlich mit der besseren Moral des Unterdrückten.
Über die nach innen wirkende Bedrohlichkeit dieser Rüstung wird man sich erst später klar werden. Zunächst einmal ist sie nur rettend. Der mächtige Außenfeind vermag sie vorerst nicht zu überwinden. Selbst viele faktisch Unterworfene führen eine eiserne Ration der besseren Moral mit sich. Sie geben den Tyrannen nur portionenweise Loyalität. Sie wissen, gäben sie dem Tyrannen alles, verlören sie sich selber. Ihnen eignet zwar nicht mehr die Würde eines Bürgers, da sie nur Staatsinsassen sind, aber in dem Maße, in dem sie selbst und andere um sie herum entwürdigt und entrechtet werden, kompensieren sie den Verlust durch das Anlegen eines inneren Kapitals. Sie jedenfalls wissen um ihre Würde, sie jedenfalls glauben an die Gerechtigkeit. Diese Haltung ist für die meisten Staatsbürger nicht von Dauer. Die Erwachsenen unterliegen Zwängen, die das Leben schafft. Man will verdienen, man will seinen Platz im Leben finden. In dieser Phase tauschen dann viele ihre moralische Sicherheit gegen eine Lebens- und Alltagssicherheit. Die Unterdrücker haben bei ihrem Tun, der Menschenüberwältigung, ja einen mächtigen Verbündeten, aber einen anderen, als wir vermuten. Es ist die Ratio. Die Staatsinsassen lernen: Eigentlich ist es unvernünftig, sich auf eine innere Reserve und auf Gegenwelten zu verlassen, die Teilhabe ausschließen. Heilige, Widerständler, Rebellen und Märtyrer werden mit ihrer Moral selig. Die Massen aber nehmen widerwillig oder gehorsam die Betriebsmoral der Organisatoren des sozialen Umfeldes an, und erlangen sie Partizipation auch nur um den Preis der Unterwerfung, so werden sie doch – und das ist der Gewinn – ein Teil der Mehrheitskultur, die sich ja auch längst darüber verständigt hat, dass man der normativen Kraft des Faktischen nicht entgehen kann.
Je durchherrschter nun und je langlebiger eine derartige Situation ist, desto mehr existieren intellektuelle und ideologische Verbrämungssysteme. Sie beruhigen, indem sie das Ungereimte reimen – so jedenfalls würde Wolf Biermann die Tätigkeit nennen. Mochte man einst ja an eine zur Person gehörende Fähigkeit der Unterscheidung von Gut und Böse geglaubt haben, so war man aber in Vereinzelung und Hilflosigkeit und Einflusslosigkeit angekommen. War es demnach nicht klüger, darauf zu setzen, dass das Gemeinwesen aus sich heraus die Normen setzen, die Moral erschaffen solle? – Geschieht dies aber, so werden nicht nur Facetten einer Betriebsmoral gestaltet, sondern die ganze Rechtsordnung, die Philosophie, alles wird vom Geist der Zeit in Besitz genommen. Nun durften wir erleben, dass diese Politikwelten endlich waren. Die zahllosen so genannten Philosophen und sonstige Ideologen – auch die elenden Panegyriker –, die es in Massen gab, konnten dem totalitären Herrschaftssystem nicht das ewige Leben verschaffen. Václav Havel und die anderen behaupteten, man müsse nicht mit der Lüge leben, weil er auch lehrte, dass die Macht der Mächtigen von der Ohnmacht der Ohnmächtigen käme. Ich übergehe die so irdische wie wunderbare Revolutionszeit und lenke nur unseren Blick auf das erstaunliche Phänomen, dass nach einer unendlich langen Gewöhnung an den Status eines Staatsinsassen nunmehr der Bürger auf der politischen Ebene erscheint: Was wird er tun? Wie wird er sich definieren?
Ich lasse diejenigen aus, die nach dem Zusammenbruch der Diktatur deren – quasi gereinigte – Ideologie als Grundlage für neues Recht und eine neuere Moral ausgaben. Ebenfalls lasse ich die aus, die ihren inneren Besitz – etwa an religiösen Wertorientierungen – jetzt zum allgemeinen Gesetz machen wollten. Einer höheren Gerechtigkeit hatten sie all die Jahre die Treue gehalten, nun sollte nichts weniger als eben die Gerechtigkeit politisch ins Leben gerufen werden. Als Norm von Ewigkeiten her und mit – quasi göttlicher oder ausgesprochen göttlicher – Autorität ausgestattet. Auch davon – von diesem Ansatz – will ich hier nicht reden. Aber wie nun würde der politische Raum in der politischen Moderne zu gestalten sein? So etwa musste sich, der – damals noch Pfarrer – Joachim Gauck fragen, als er auf die Ebene des Politischen eintrat.
Wenn nichts ewig Gültiges zur Verfügung stand, was war dann die Richtschnur der Gestaltung? Gott sei Dank gab es das Modell des säkularen Verfassungsstaates. Eine Verfassung mit Grundrechten und eine behauptete und verfassungsbefestigte »Würde des Menschen«. Der Freund der Moderne lernte, dass er auf eine letzte Autorität verzichten könne, ja, müsse, um sein Gemeinwesen zu gründen, zu definieren und zu gestalten. Bärbel Bohley zwar maulte, dass man die Gerechtigkeit gewollt habe, aber nur den Rechtsstaat bekommen habe, aber sie konnte mit diesem Unbehagen eben nicht in der Öffentlichkeit gestaltend Politik machen. Die Diskurse – so lernten wir –, sie würden uns den Weg weisen. Das klingt ja schon ein wenig eigenartig, aber doch, es weht auch ein großer Atem, wo Befreite – ohne Rückgriff auf letzte Autoritäten – ihre Rechtsordnung, ihre Politikinhalte und sich selbst im Gemeinwesen bestimmen. Ermächtigte wollen das! Sie erlangen ja eine, nie zuvor gekannte, jetzt besondere und neue Würde, nämlich: Sie haben eine Wahl. Sie entscheiden! Sie haben eine gestaltende Rolle. Es ist wirklich eine schöne, neue Welt – im ursprünglichen, nicht im ironischen Wortsinne.
Wenn nicht die Mühen der Ebene, nicht zunehmend die Mühen mit den Apparaten, den Strukturen der Ebene wären. Der individuelle Diskursteilnehmer weiß eben oft nicht mehr, ob er den Diskurs führt oder der Apparat, in dem er integriert ist. Auch gelten seine Werte, sein Glauben nicht mehr, sondern eine scheinbar offenkundige Logik der Entwicklung. Auch können alle möglichen Wolken des Zeitgeistes eine Rationalität erlangen, die kaum Widerspruch zulässt. Noch will der Freund der Moderne ja dem optimistischen Trotz von Soziologen folgen: In der Freiheit pendle sich schon aus, was wir zu tun und zu lassen hätten. Die Moderne könne sich ihrer Freiheit nicht begeben und wieder Letztgültigkeiten installieren. Die Demokratie habe nicht umsonst hinlängliche Regelungstechniken entwickelt und demokratische Verhaltensnormen geschaffen und – ja – der herrschaftsfreie Diskurs erschaffe selbst alle erforderlichen Elemente für eine gute, gemeinsame Zukunft aller.
Aber wenn der Freund der Moderne gleichzeitig ein gebranntes Kind des vergangenen blutigen Jahrhunderts ist und wenn er den Massenmord als das andere Gesicht der Moderne gesehen hat, befällt ihn nicht da eine gesunde Skepsis? Vielleicht war es ein Gebot der politischen Aufklärung, die Welt zu entzaubern und damals Gott für tot zu erklären. Ich zitiere: »Sie schuf einen verhängnisvollen leeren Raum, den des obersten Herrn und Richters, des Planers und Richters der Weltordnung. Dieser Raum konnte auf Dauer nicht unbesetzt bleiben, denn Gott war zwar vom Thron gestoßen, doch der Thron war noch unbeschädigt und wirkte in der gesamten moderneren Epoche auf Abenteurer und Visionäre wie eine Einladung, eine unwiderstehliche Versuchung. Die Sterblichen schickten sich nun an, den Traum allumfassender Ordnung und Harmonie und somit ihre Überlegenheit unter Beweis zu stellen. Der Mensch verstand die Welt als Garten, der vor dem Sturz ins Chaos zu bewahren war, wähnte sich verantwortlich dafür, dass die Klarheit der gesetzlichen Ordnung nicht durch Fremde, nicht durch Aufsässige, Klassen oder Rassen gefährdet würde. Es galt die verlorene – einst in Gott garantierte – Transparenz der Welt und des menschlichen Standorts wieder herzustellen; nun aber ausschließlich gestützt auf menschliche Erfindungsgabe und Verantwortung (oder wie sich herausstellte, menschliche Verantwortungslosigkeit). Schließlich erlangte menschliche Grausamkeit ihren spezifisch modernen Charakter und ermöglichte Auschwitz, den Gulag, Hiroshima und machte diese vielleicht sogar unvermeidlich.« Das Zitat ist nicht von Ernst-Wolfgang Böckenförde. Es ist auch nicht von einem Moralprediger, es ist nicht einmal von einem Theologen. Es stammt von einem Fachmann der Moderne, es stammt von einem Soziologen. Sein Name ist Zygmund Bauman.
Ein jüdisch-polnischer Soziologe, von dem wir eine Menge über die Moderne lernen können. Bauman, der sich ausdrücklich auf Hannah Arendts Skepsis gegenüber dem Konzept der »sozialen Fundierung der Moral« beruft, betont mit ihr eine ursprüngliche, menschliche Fähigkeit, Gut und Böse unterscheiden zu können. »Man muss für diese Fähigkeit eine andere Quelle annehmen als das kollektive gesellschaftliche Bewusstsein. Diese Fähigkeit gehört vielmehr zur Ausstattung des Menschen, wie seine biologische Konstitution«, und »der Sozialisierungsprozess dient der Manipulation der moralischen Fähigkeit, nicht ihrer Erzeugung«.
Wenn ich das alles lese, fällt mir ein, was ich gelebt habe und was Millionen Unschuldige mit ihrem Leben bezahlen mussten. Ich wollte Ihnen, verehrter Preisträger, lieber Ernst-Wolfgang Böckenförde, nicht erzählen, was ich von Ihnen in Vorbereitung dieses Tages gelesen habe oder was ich alles nicht weiß – das noch weniger –, aber Leben und Lesen haben mich in eine dankbare Nähe zu Ihnen gebracht, zu einem Menschen, der den drohenden Verlust der Dimension des Religiösen im öffentlichen Raum nicht klag- und argumentationslos hinnehmen will. Dabei ist er sich sicher, dass das Nebeneinander von Religion und Politik nicht unproblematisch sein kann. Bei aller Neutralität – etwa des modernen Staates – ist deutlich zu unterscheiden, welche Art von Neutralität wir wollen. Ob es eine distanzierende ist, die sich der Staat einfach nehmen muss, wenn es um sein hoheitliches Handeln und um die Rechtspflege geht, oder ob es eine offene – wir könnten auch sagen eine einladende und gewährende – Neutralität ist, für die Böckenförde immer wieder wirbt und für die er genügend Beispiele aus dem Leben anführt.
Das Modell des laizistischen Frankreich sieht er gerade nicht als ein Beispiel. Das hat mich berührt, wie er in einer Abhandlung über politische Theorie und politische Theologie diese als Moment politischer Theorie ausweist und die Unaufgebbarkeit des politischen Inhalts, politischer Theologie beschreibt. Er endet in diesem Aufsatz beim Papst, bei Johannes Paul II. – das wird vielen hier im protestantischen Bremen nicht gefallen –, dessen politische Theologie ihn ganz enorm einnimmt, und er sagt auch, warum: Sie sei ganz unpolitisch und sei allein auf die Verkündigung der christlichen Heilsbotschaft gerichtet: »Die Wahrheit Christi sei auch die Wahrheit für den Menschen«, so sagt es der Papst. Sie sei für die Menschen und vom Menschen und von der Würde, dem Recht, der Freiheit und der letzten Bestimmung des Menschen. Eine gemeinhin christliche Botschaft – eine ganz genuin christliche Botschaft –, die gleichzeitig im Stande ist, außerordentlich konkret in eine immanent politische Welt hineinzuwirken. Ich wünschte mir – in dem Land, in dem ich leben möchte, und in einer Zukunft, die ich sehen möchte – mehr Menschen, die bei dem Versuch, das Bild des Menschen zu bewahren, darum wissen, dass die Moderne aus jenen jüdisch-christlichen Wurzeln erwuchs, die das Besondere des Menschen in seiner »Gottebenbildlichkeit« sah. Das mag vielen merkwürdig klingen, aber verlören wir den Raum für dieses Zeugnis, wandelte sich wohl das Bild vom Menschen, das wir uns wünschen und gestalten wollen noch schneller, als wir es ahnten, zu einem Zerrbild. Davor bewahre uns Gott und Menschen wie dieser.
I
Die gegenwärtige öffentliche Diskussion über die Frage eines Beitritts der Türkei zur Europäischen Union kann nicht befriedigen. In ihr stehen Positionsnahmen einander gegenüber, die sich wechselseitig versteifen, auch polemisch gegeneinander richten, sich aber auf die Probleme in der Sache nur bedingt oder gar nicht einlassen. Das trifft ebenso die These, es gebe zu einem Beitritt der Türkei als Ziel und dem Beginn von Beitrittsverhandlungen auf Grund der bisherigen Entwicklung keine Alternative, wie die Gegenthese, ein Beitritt der Türkei und Verhandlungen daraufhin bedeuteten das Ende der Europäischen Union als politischer Union. Beide Positionen machen geltend, die Entscheidung über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die nun unmittelbar ansteht, sei mehr als eine unverbindliche prozedurale Zwischenentscheidung, sie habe vielmehr weichenstellende und ein Stück weit irreversible Bedeutung. Es mag sein, dass das so ist. Gerade dann aber erscheint eine intensiv auf die Sache selbst bezogene Diskussion, die jenseits populistischer Versuchbarkeit Argumente vorträgt, prüft und wägt, unerlässlich. Gefordert ist an Stelle schneller und vereinfachender Parolen ein nüchternes und klares politisches Denken, das das Handeln leitet, ein politisches Denken im Sinne Hannah Arendts, die ja in gewisser Weise die Schirmherrin dieser Veranstaltung ist. Denken muss man mit Haut und Haaren oder es bleiben lassen, lässt Joachim Fest Hannah Arendt demgegenüber sagen, und sie hat dies in ihren Werken wie in ihrem Leben immer wieder realisiert: ein Denken, gerichtet auf das, was wirklich ist und was als das Richtige erscheint, darin unnachgiebig und konsequent, ein Denken ohne (rückversicherndes) Geländer, um wiederum Hannah Arendt zu zitieren. Bemüht man sich um solches politisches Denken im Hinblick auf unser Thema, kann die Beitrittsfrage von vornherein nicht allein oder primär unter dem Gesichtspunkt der Bedürfnisse und der Eignung der Türkei für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union behandelt werden, welcher Gesichtspunkt indes im Augenblick vorherrschend geworden ist. Mindestens ebenso wichtig, ja noch wichtiger ist eine Erörterung im Blick auf die Eignung der Europäischen Union für eine Mitgliedschaft der Türkei und ihr politisches, kulturelles und ökonomisches Interesse daran. Was bedeutet der Beitritt der Türkei für die EU, welche Herausforderungen, Vorteile und Chancen, welche Risiken, Verluste und Gefahren bringt er mit sich? Wie weit sind die Voraussetzungen für einen solchen Beitritt nicht nur von Seiten der Türkei, sondern auch von Seiten der EU gegeben? Um eben diese Fragen soll es im Folgenden gehen.
II
Sucht man die Diskussion in diesem Sinn von Grund auf zu führen, kann zunächst die Frage nach der Finalität der europäischen Einigung, ihrem Wozu und Um-willen, nicht ausgeklammert werden. Was ist das eigentliche Ziel, auf das hin die EU konzipiert ist und sich entwickeln soll? Diese Diskussion ist seit dem Scheitern der EVG im Jahre 1954 ausdrücklich nie geführt worden. Vielmehr lagen und liegen unterschiedliche Vorstellungen in- und nebeneinander, sind zum Teil auch gegeneinander gerichtet: Europa als Friedensordnung, seine Integration als endgültige Besiegelung nationalistischer Kämpfe der europäischen Staaten und Völker gegeneinander; Europa als liberale Marktordnung mit freigesetztem Wettbewerb als Quelle des Wohlstandes, der funktionierende Binnenmarkt mit Offenheit zum Welthandel als sich selbst genügendes Ziel; Europa als Wirtschafts- und Sozialraum, der sich auf Angleichung der Lebensverhältnisse hin entfaltet, eine wirtschaftlich-entwicklungspolitische Union mit entsprechender Förderungs- und Ausgleichsfunktion; Europa als leistungsfähiger Konkurrent im globalen Wettbewerb um technologisch-ökonomische Führung mit gezielter Industriepolitik; Europa als auch politische Union und politischer Akteur auf Grund seiner vereinten Wirtschaftsmacht und einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
Die ausbleibende Diskussion wurde von den politischen Akteuren in Europa lange Zeit durch einen situationsgebundenen Pragmatismus ersetzt. Mal stand und steht die eine, mal mehr eine andere Zielvorstellung im Vordergrund, aber ohne gemeinsames, von allen Mitgliedsstaaten getragenes Konzept. Die Frage des Beitritts der Türkei lässt sich jedoch nicht mehr im Wege eines solchen Pragmatismus behandeln und voranbringen. Die Türkei ist nach geographischer Ausdehnung, Bevölkerungszahl, nationaler und kultureller Identität, ökonomischer und politischer Struktur von einer Bedeutung und Eigenart, die im Hinblick auf ihren Beitritt die Frage nach dem Konzept, der Finalité der europäischen Einigung, unausweichlich macht. Schiebt man diese Frage auch jetzt weiter vor sich her, wird sie angesichts der gegebenen Konstellation nicht wiederum vertagt, sondern indirekt, via facti, in bestimmter Weise beantwortet und entschieden. Denn die Frage der Eignung der EU für eine Aufnahme der Türkei und der Türkei für eine Mitgliedschaft in der EU ist anders gelagert und hat eine andere Dimension, wenn das Konzept und Ziel der europäischen Integration eine politische Union mit auch politischer Handlungsfähigkeit und darauf bezogener Konsistenz und demokratischer Struktur ist, wenn es sich lediglich auf eine Freihandelszone mit funktionsfähigem Binnenmarkt samt dazu erforderlicher ökonomischer Entwicklung und Angleichung richtet, oder wenn es primär auf eine sicherheitsstrategische Vormacht in der Bekämpfung des internationalen Terrorismus zielt, gewissermaßen als Seitenstück und Juniorpartner der Weltpolitik der USA.
Betrachten wir die Entwicklung der letzten zehn bis fünfzehn Jahre, so hat die europäische Integration freilich durch politische Aktivitäten, Beschlüsse und vertragliche Übereinkommen tatsächlich eine Richtung erhalten, die auf eine politische Union zielt, über eine Wirtschaftsgemeinschaft und einen europäischen Binnenmarkt hinaus. Das begann mit der Errichtung der Währungsunion im Vertrag von Maastricht; diese wurde von vielen der beteiligten Akteure gerade auch wegen eines aus deren eigener Logik damit verbundenen politischen Integrationszwangs gewollt und ins Werk gesetzt. Es setzte sich im Amsterdamer Vertrag und in den Beitrittsverhandlungen um die Erweiterung der EU vor allem nach Ostmitteleuropa hin fort, schließlich kam der jetzt unterzeichnete europäische Verfassungsvertrag hinzu. Eben dieser Verfassungsvertrag zielt in Umrissen ebenso auf eine institutionell und kompetenziell politisch handlungsfähige Union, nicht zuletzt im Bereich der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wie auf einen gewissen Ausbau der demokratischen Legitimation in der Union. Soll dieser Weg weitergegangen und nicht etwa abgebrochen oder zurückgenommen werden, kommt es auf die Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen an, die sich von den Grunderfordernissen und der Eigenart der Europäischen Union als politischer Union her für eine Mitgliedschaft der Türkei ergeben. Eine politische Union bedarf anderer Grundlagen und Gemeinsamkeiten, einer anderen Art von Zusammengehörigkeit und Solidarität als eine Freihandels- und Wirtschaftsgemeinschaft oder eine sicherheitsstrategische Aktionsgemeinschaft. Unter diesem Gesichtspunkt sind mehrere Faktoren in Betracht zu ziehen: geographisch-geopolitische, geschichtlich-kulturelle, politisch-integrative und im Zusammenhang damit demographische und ökonomische. Auch dürfen die Verpflichtungen und Zusagen, die gegenüber der Türkei eingegangen worden sind, und das was daraus folgt, nicht unberücksichtigt bleiben.
III
a) Beginnen wir mit dem geographisch-geopolitischen Faktor. Geographisch bedeutet eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU deren Ausdehnung nach Asien, und zwar in erheblichem Umfang. Nur ein kleiner Teil der Türkei, die westliche Landzunge diesseits des Bosporus, die nicht mehr als drei Prozent des Staatsgebietes der Türkei umfasst, gehört geographisch zu Europa. Die Türkei erstreckt sich über 1500 Kilometer auf asiatisches Gebiet, was in der Länge mehr bedeutet als die Entfernung von Warschau nach London. Sie wäre mithin weit mehr als nur ein Anhängsel zum europäischen Teil der EU. Geographisch wird mit dem Beitritt der Türkei aus der Europäischen Union eine europäisch-kleinasiatische Union. Einer meiner staatsrechtlichen Kollegen geht der Frage nach, ob diese Art der Ausdehnung über das geographische Europa hinaus noch vom Begriff des »vereinten Europa« in Artikel 23 und der Präambel des Grundgesetzes gedeckt sei, ob dieser Begriff nicht auch einen geographischen Gehalt habe und insofern beliebiger Ausdehnung Grenzen setze. Doch möchte ich das hier beiseite lassen. Wichtiger erscheint die geopolitische und geostrategische Komponente, die mit solcher geographischer Ausdehnung verbunden ist. Eine um die Türkei erweiterte EU hat direkte Grenzen mit Armenien, Georgien, Iran, Irak und Syrien. Die Außengrenzen der EU reichen dann bis nach Kaukasien und zum vorderen und mittleren Orient, mit allen Problemen, die damit verbunden sind. Eine so erstreckte EU wird von den Interessenkonstellationen, Konflikten und Unruheherden, die sich dort ergeben, unmittelbar mitbetroffen. Sie unterliegt möglichen Reaktionszwängen, denen sie – Grenzland und Anlieger – nicht ausweichen kann. Was bedeutet das für die politische Handlungsfähigkeit und innere Konsolidierung der EU? Jede politische Gemeinschaft, die über Warenaustausch, Dienstleistungsverkehr und Geldtransfer hinaus politisch aktionsfähig sein will, bedarf einer gebietsmäßigen Begrenzung, die strategisch, aber auch binnenstrukturell Kohärenz vermittelt und eine Problemüberlastung fern hält. Ungehemmte Ausdehnung bewirkt eher eine Schwächung als eine Stärkung politischer Handlungsfähigkeit, indem sie ein Übermaß an Problemdruck und Involviertheit hervorruft – die Schwächung durch Überdehnung. Besteht aber nicht – gerade auch geostrategisch und geopolitisch – eine notwendige Brückenfunktion der Türkei zwischen Europa und der islamischen Welt? In der Tat ist die Türkei der Staat der islamischen Welt, der sich Europa am meisten angenähert hat. Nicht nur blickt die Türkei historisch seit langem nach Europa – denken wir an die Jahrhunderte langen konfliktbeladenen Beziehungen des Osmanischen Reiches zu Europa und seinen Besitzstand in Europa – auch die Modernisierung der Türkei, seit Kemal Atatürk betrieben, ist in der weit gehenden Adaption europäischen Rechts und der Veränderung der Gesellschaftsstruktur stark an Europa ausgerichtet; nicht zuletzt belegen das die Reformbestrebungen der jüngsten Zeit. Die Türkei ist also zu einer Brücken- und Vermittlungsfunktion zwischen Europa und der islamischen Welt durchaus berufen und, sofern sie ihren Charakter als islamisches Land nicht negiert, auch in der Lage. Aber ist die Ausübung dieser Funktion nicht gerade an die Selbstständigkeit der Türkei, ihre politische Selbstständigkeit und Eigenständigkeit, gebunden? Wird die Türkei über eine volle Mitgliedschaft integrierter Teil der EU, kann das durchaus die Wirkung haben, dass sie von der islamischen Welt, insbesondere der islamisch-arabischen Welt, als islamisches Land abgeschrieben wird, eben weil sie ins westliche Lager, ein dem Islam feindliches Lager, übergetreten und damit dem Islam untreu geworden ist. Blickt man auf die gegenwärtige Verfasstheit der islamischen Welt, ist diese Reaktion eher wahrscheinlich – klares politisches Denken darf mentale Gegebenheiten nicht außer Acht lassen. Kann und soll die Türkei helfen, Aggressionen der islamischen Welt gegen den Westen, die westliche Welt, vermittelnd abzubauen, und selbst demonstrieren, dass westlich-europäische Lebensform und Islam keine unvereinbaren Gegensätze sind, so spricht viel dafür, dass dies gerade die Selbstständigkeit und Eigenständigkeit, auch die volle Souveränität einer Türkei – mag sie auch wirtschaftlich und eventuell monetär mit der EU eng verbunden sein – voraussetzt. Wie ja auch eine Brücke mehr und anderes ist als ein bloßer Brückenkopf; die Brücke verbindet eigenständig aus sich heraus verschiedene, vielleicht auch gegensätzliche Ufer oder Länder, und sie vermag das nicht als bloßer Vorposten der einen oder anderen Seite.
b) Geschichtlich-kulturell sind Europa und die Türkei nicht nur am Rande, sondern grundlegend unterschieden. Darüber dürfen die zum Teil hektischen Reformgesetze der jüngsten Zeit, so anerkennenswert sie als Anpassung an europäische Standards sein mögen, nicht hinwegtäuschen. Dieser Unterschied greift erheblich weiter als alle kulturellen Unterschiede innerhalb der bisherigen Europäischen Union, die Osterweiterung des Jahres 2004 eingeschlossen. Was ist der Grund dafür? Zumeist wird die Prägung durch die christliche Religion und durch den Islam angeführt, die Europa und die Türkei voneinander scheide. Das Problem liegt jedoch weniger in der Religion als solcher. Es liegt in der einerseits von der christlichen Religion, andererseits vom Islam geprägten Kultur und Mentalität in Europa und der Türkei. Hier und dort haben sich unterschiedliche Grundeinstellungen, Denkmuster, Traditionen und Lebensformen herausgebildet. Sie haben – zusammen mit anderen Kräften und Wirkungsfaktoren – eine je eigene kulturelle Identität geformt, die sich auch in den Charakteren der Völker niederschlägt. Dieses kulturelle Erbe hat die Menschen über Jahrhunderte geprägt und geformt, mit entsprechenden Auswirkungen auf ihr Denken und Empfinden. In dieser Vermittlung gehört die christliche Religion zum kulturellen Boden Europas, der Islam zum kulturellen Boden der Türkei. Was besagt dies für die Beitrittsfrage? Kann nicht, so lässt sich fragen, im Zeichen von Religionsfreiheit und Toleranz aus der Anerkennung des jeweils anderen eine gemeinsame Grundlage für ein produktives Zusammenwirken entstehen? Versteht sich das Europa der EU nicht selbst als säkulare, ja säkularisierte Ordnung, offen für verschiedene Religionen, ebenso wie für A-Religiosität? Gewiss hat das heutige Europa säkularen Charakter und existiert, von Malta und teilweise Griechenland vielleicht abgesehen, in der Form säkularisierter Gesellschaften. Aber dieser Charakter ist erwachsen nicht durch Beiseitestellen, sondern in lebendiger Auseinandersetzung mit dem fortwirkenden Christentum und in der Umsetzung gerade auch christlicher Gedanken. Die Kultur Europas – genauer und politisch unkorrekt, aber zutreffend: des lateinischen Europas – ist geprägt durch epochale Vorgänge, wie zunächst den Investiturstreit, den ersten Freiheitskampf zwischen Kirche und politischer Ordnung, sodann die Reformation, den europäischen Rationalismus und die Aufklärung, schließlich die Menschenrechtsbewegung. Diese Vorgänge haben tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis und der Mentalität der Völker des lateinischen Europas hinterlassen. Sie haben deren Identität in der Weise geprägt, dass praktizierte Religion und säkularisierter Staat, christlicher Glaube und freiheitliche Ordnung neben- und miteinander bestehen, sich sogar wechselseitig ergänzen können. An einer in dieser oder einer vergleichbaren Weise geprägten geistig-kulturellen Identität fehlt es in der Türkei. Sie lässt sich auch nicht durch die viel berufene Laizität der Türkei ersetzen oder kompensieren. Die türkische Laizität ist, was oft übersehen wird, keineswegs gleichbedeutend mit der laicité in Frankreich. Diese hat die völlige Freigabe der Religion bei ihrer Beschränkung auf den privat-persönlichen Bereich zum Inhalt, die türkische Laizität demgegenüber die Gestaltung der Religion des Islam – ohne Freiheit für andere Religionen – durch den Staat, um sie einerseits zu entpolitisieren und andererseits in das kemalistische nationale Modernisierungsprogramm zu integrieren; deshalb auch die neutralisierenden Züge. So sind Glaubensfragen und der religiöse Kult dem Direktorium für Religionsangelegenheiten (Diyanet), einer staatlichen Behörde, unterstellt; sie hat nach der letzten, 2003 beschlossenen Vergrößerung etwa 100 000 Angestellte, darunter Vorbeter, Prediger, Gebetsrufer und so fort, und ihr unterstehen an die 70 000 Moscheen. Unter ihrer Ägide wird eine Art sunnitischer Staatsislam als Grundlage für Religionsunterricht und religiöse Bildung praktiziert. Dies ist etwas grundlegend anderes als säkulare Religionsfreiheit; die nach wie vor beschämende Lage der Christen in der Türkei, die ungeachtet papierner Deklarationen fortbesteht, bestätigt dies nur. Weiter ist zu bemerken, dass diese Art der Laizität von oben verordnet wurde; die Menschen wurden vom Staatsgründer Kemal Atatürk autoritär in sie hineingezwungen. Soweit die Laizität Elemente von Säkularisation oder Säkularismus enthält, sind diese nicht aus den Wurzeln des Islam erwachsen, auch nicht als ein Produkt geistiger Auseinandersetzung mit dem Islam entstanden, die diesen selbst veränderte; schließlich sind sie bislang nur von einem geringen Teil der Menschen in der Türkei mental akzeptiert. Immer wieder hat es seit Atatürk in der Türkei islamistische Gegenbewegungen gegeben, am deutlichsten noch kürzlich in der Wohlfahrtspartei von Neçmettin Erbakan, der auch der gegenwärtige Ministerpräsident Erdogan, selbst ein frommer Muslim, zunächst angehörte. Von einer der europäischen vergleichbaren Mentalität oder geistig-kulturellen Identität kann nach alledem keine Rede sein. Es besteht insoweit eine Andersheit und Fremdheit, und diese lässt sich durch schnell hintereinander kommende Reformerlasse, denen (noch) das Widerlager im geistigen Bewusstsein der Menschen fehlt, nicht kurzerhand beseitigen.
c) Die hier deutlich gewordene mentale und kulturelle Unterschiedenheit wirkt auch auf die politisch-integrativen Probleme ein, die bei einem Beitritt der Türkei sowohl für die EU wie auch für die Türkei selbst entstehen. Für einen Staatenverbund, der auf eine politische Union und Gemeinschaft abzielt, reicht als gemeinsame Grundlage nicht aus, dass alle darin miteinander Verbundenen Menschen sind und sich als solche in ihren Menschenrechten anerkennen. Für eine politische Union in Europa bedarf es über ein solches neminem laedere hinaus einer Gemeinsamkeit und Solidarität, die ungeachtet der eigenen nationalen Identität auf ein gemeinschaftliches Zusammenleben mit anderen Völkern und Nationen bezogen ist. Solche Übereinstimmung kristallisiert sich in Fragen wie: Wer sind wir? und: Wie sollen und wollen wir miteinander leben? Als nur relative Gemeinsamkeit kann und muss sie Raum lassen für vielfache Differenzierung, Eigenheit und auch Unterscheidung; die Völker und Nationen sollen nicht aufgelöst oder absorbiert, sondern nur übergriffen werden. Aber sie muss zugleich auch eine rational begründete und in gewissem Umfang auch emotionale Verbundenheit aufweisen. Erst aus dieser heraus kann so etwas wie ein gemeinsames »WirGefühl« entstehen und sich forttragen. Eine Schweizer und daher gewiss unverdächtige Stimme formuliert es so: »Zwischen den zu integrierenden Einheiten müssen Bindeglieder, Ligaturen vorhanden sein, geschichtlich gewachsene Übereinstimmungen, Ähnlichkeiten, Ergänzungen, Komplementarität. Völlig Fremdes lässt sich nicht verbinden.« Ein solches gemeinsames Wir-Gefühl prägt sich darin aus, dass mental wie auch emotional dasjenige, was die anderen betrifft, auch mich angeht, nicht von der eigenen Existenz getrennt wird. Auf dieser Grundlage kommt es – Ausdruck der Solidarität – zur Anerkennung gemeinsamer Verantwortung, von Einstandspflichten und wechselseitiger Leistungsbereitschaft. Es ist der »sense of belonging«, von dem Lord Dahrendorf spricht, das Bewusstsein, Empfinden und der Wille, zusammen eine Gemeinschaft zu bilden, ihr anzugehören und an ihr – im Angenehmen und Nützlichen wie im Schweren und Belastenden – teilzuhaben. Nicht zuletzt gehört dazu zumindest in Umrissen auch ein gemeinsames Geschichtsbild als Anker solcher Gemeinsamkeit. Dieser sense of belonging, das darf nicht übersehen werden, muss in demokratisch organisierten Gemeinschaften stärker ausgebildet sein als in autoritär oder technokratisch verfassten. In jenen müssen die zum Bestand und zur Fortentwicklung der Gemeinschaft ergehenden Entscheidungen von den Menschen nur hingenommen werden, als von anderer Seite auferlegt und nicht selbst zu verantworten. In dem Maße, in dem eine Gemeinschaft demokratisch organisiert und auf demokratische Legitimationsverfahren angelegt ist, müssen diese Entscheidungen von den Menschen positiv mitgetragen werden, als von ihnen selbst getroffene und ausgehende. Daher bedarf es in weiterem Umfang gemeinsamer Auffassungen und Zielvorstellungen, die das aktive Handeln der Gemeinschaft mittragen und sie dazu befähigen. Dies alles will bedacht sein, wenn es um eine Aufnahme der Türkei als gleichberechtigtes Mitglied der Europäischen Union geht. Schon die gerade vollzogene Osterweiterung der EU bringt insgesamt insoweit erhebliche Probleme mit sich. Sie sind aber vergleichsweise gering gegenüber denjenigen, die bei einem Beitritt der Türkei ins Haus stehen. Eine in ihrer Integrationskraft und Integrationsbereitschaft überforderte EU kann leicht in Agonie geraten und Aggressionspotenziale, statt sie abzubauen, zuallererst freisetzen. Die hier aufgewiesenen Probleme und Schwierigkeiten lassen sich auch nicht mit dem Hinweis auf Europa als Wertegemeinschaft beiseite stellen. Gewiss sind Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in den Mitgliedstaaten der EU, wenn auch in unterschiedlicher Tiefe, anerkannt und praktiziert. Insofern lässt sich, darauf bezogen, von einer Wertegemeinschaft in Europa sprechen. Auch die Türkei hätte daran Anteil, falls sie die genannten Merkmale aufweist, sie nicht nur proklamiert, sondern auch realisiert. Diese Merkmale sind fraglos wichtig als Voraussetzung und notwendiger Boden für eine politische Union in Europa. Aber sie enthalten aus sich heraus noch nicht den positiven politischen Impetus und Antrieb für eine solche Union; sie sind zwar eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für die Zusammengehörigkeit, den sense of belonging und auch die Interessengemeinschaft, aus denen eine politische Gemeinschaft von selbstständigen Staaten ihre Handlungsfähigkeit und Handlungswilligkeit bezieht. Käme es nur auf die genannte Wertegemeinschaft an, könnte sich die EU ohne weiteres auf Australien, Neuseeland oder auch Japan erstrecken und diese Länder zu Beitrittskandidaten machen. Umgekehrt kann deshalb die Mitgliedschaft in der EU auch nicht auf eine Anerkennungsprämie für die Reformbereitschaft der Türkei reduziert werden. Für ein positives Miteinander in einer politischen Union ist in deren wie im Interesse der Türkei mehr erforderlich als der Standard einer Wertegemeinschaft, den jeder Staat fraglos auch für sich allein verwirklichen kann und sollte.
d) Das politisch-integrative Problem, das wir bislang behandelt haben, erfährt durch die demographische Dimension eine weitere Zuspitzung. Für die Bevölkerungsentwicklung der Türkei bis 2050 kommt eine Dokumentation der UN von 2003, die auf Revisionen im Jahr 2002 beruht, auf Grund der Basiszahl von 68,3 Millionen für 2000 – je nach der Annahme über die Reproduktions- beziehungsweise Fertilisationsrate unter Berücksichtigung der Steigerung der Lebenserwartung – zu folgenden Prognosen: Geht man von der oberen Annahme von 2,7 bis 2,35 aus, ist 2050 mit einer Bevölkerung von 119,9 Millionen zu rechnen, bei einer mittleren Annahme (2,3 bis 1,85) mit 97,8 Millionen und bei einer unteren Annahme (1,9 bis 1,35) mit 78,4 Millionen. Hierbei sind die Steigerung der Lebenserwartung und Migrationsanteile eingerechnet. Im Blick auf die fortschreitende Modernisierung in der Türkei erscheint Professor Birg aus Bielefeld die mittlere Annahme, bei der eine deutliche degressive Entwicklung berücksichtigt ist, am ehesten realistisch. Danach ergeben sich für das Jahr 2015 82,2 Millionen, für 2020 85,7 Millionen, für 2030 91,9 Millionen an Bevölkerungszahl. Die Türkei wird also bei einem Beitritt 2015 oder später unweigerlich der bevölkerungsreichste Mitgliedsstaat der EU sein. Entsprechend gestalten sich die Zahl der Sitze und damit die Einflusspositionen im Europäischen Parlament, der Anspruch auf angemessene Vertretung in der Kommission und das Gewicht beim Zustandekommen und gegebenenfalls der Verhinderung von Mehrheitsentscheidungen im Europäischen Rat. Repartitionen gerade für die Türkei sind hier nicht denkbar, sie bedeuteten eine Diskriminierung und wären gerade mit den Wertegrundlagen der EU unvereinbar. Weiter sind die Auswirkungen der vier Freiheiten des EG-Vertrages, insbesondere die der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, zu beachten. Zuzugsbewegungen aus der Türkei im Rahmen europäischer Dienstleistungsund Niederlassungsfreiheit sind primär nach Deutschland hin zu erwarten, weniger zur EU insgesamt, weil in Deutschland bereits die meisten Türken, etwa 2,8 Millionen, sesshaft sind. Zwar können solche Zuzüge durch Übergangsfristen etliche Jahre hinausgezögert, jedoch auf der Basis gleichberechtigter Mitgliedschaft nicht endgültig abgewehrt werden. Greift man dennoch zu »unbefristeten«, das heißt auf Dauer gestellten Beschränkungen von Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, wie sie jetzt sogar der Kommissionsbericht als Möglichkeit in Erwägung zieht, schafft man eine geminderte Mitgliedschaft, einen Beitritt zweiter Klasse; das wäre nichts anderes als ein Einstieg in die sonst entschieden abgelehnte privilegierte Partnerschaft. Es ist also offensichtlich, dass die Bevölkerungszahl und das daran sich orientierende politische Gewicht der Türkei das politisch-integrative Problem noch zusätzlich erschwert. Fehlendes Zusammengehörigkeitsbewusstsein und »Wir-Gefühl« wirken sich hier verstärkt aus, und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen EU-weit für die gemeinsame, von politischer Solidarität getragene Handlungsfähigkeit und die wechselseitige Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen und Einstandspflichten – eine Bedingung für das Fortschreiten einer politischen Union auf demokratischer Grundlage. Zum andern im nationalen Bereich für die konkrete Integrationsbereitschaft über bestehende Andersheit hinweg. Es sei nur auf das schon heute bestehende Problem von Grundschulklassen mit deutlicher Mehrheit ausländischer, nicht zuletzt türkischer Kinder hingewiesen und auf die möglichen Folgen des gleichen Kommunalwahlrechts für alle EG-Ausländer, wenn in großen Städten etwa eine türkische Gruppierung zweitstärkste oder gar stärkste Fraktion im Gemeindeparlament wird. Können aber solche Schwierigkeiten nicht abgefangen werden durch plurale Lösungen auf der Grundlage der Anerkennung von kultureller und sprachlicher Eigenheit und Vielfalt? Das mag so scheinen und erwünscht sein. Aber es würde ein anderes Integrationsmodell als das bisher verfolgte bedingen. Was war die Grundlage für das oft über Jahrhunderte hinweg im Großen und Ganzen friedliche und beziehungsreiche Miteinanderleben von Menschen verschiedener Herkunft, Religion, Sprache und Kultur im alten Europa? Es war die Anerkennung ihrer Eigenheit und Lebensform durch einen eigenen Rechtsstatus, der ihnen religiöse und kulturelle Eigenständigkeit gewährleistete. Denken wir als Beispiele an die Hugenotten in Berlin, die Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen in Ungarn beziehungsweise später in Rumänien und – noch im 20. Jahrhundert – die Muslime und Christen in Bosnien-Herzegowina. Sie alle sollten im Rahmen staatlich festgelegter Verträglichkeit nach ihren Religionsbegriffen, wie es alteuropäisch so schön hieß, nach ihren Sitten, ihrer Sprache, ihrem Recht leben, also ihre Wurzeln behalten können. Was heute als Parallelgesellschaft ausgemacht wird und als Gefahr erscheint, war durch Anerkennung in eine übergreifende Ordnung eingebunden und insofern integriert. Ginge es hiernach, müssten etwa in Berlin, legte man Grundsätze und Praxis im alten Österreich-Ungarn zu Grunde, nicht nur eigene türkischsprachige Schulen, sondern auch eine türkischsprachige Universität bestehen. Solche Art kultureller Vielfalt steht freilich in einem dauernden Spannungsverhältnis zum modernen Nationalstaat, verstärkt zur nationalstaatlichen Demokratie. Diese beruht auf der Nation als einer politischen Willens- und Kulturgemeinschaft, einem einheitlichen, für alle verbindlichen nationalen Recht, prägt sich in der eigenen nationalen Kultur aus und empfindet sprachlich und kulturell deutlich anders Geprägtes als fremd. Ihre Integration soll weithin durch Eingewöhnung, Einfügung in und Übernahme von Ordnung und Lebensform, insbesondere die Übernahme der eigenen Sprache erreicht werden. Das ist in sich nicht ohne Folgerichtigkeit. Aber es bedeutet, dass die Aufnahme- und Integrationskapazität in solchen Staaten und Gesellschaften durchaus eine begrenzte ist und nicht überfordert werden darf. Anders mag es in expliziten Einwanderungsländern wie den USA sein. Ein solches Einwanderungsland lässt sich aber nicht allein durch entsprechende rechtliche Regelungen schaffen, es muss auch beiderseits mental fundiert sein, sodass einerseits die Einwanderer oder Zuzügler positiv aufgenommen statt beziehungslos sich selbst überlassen oder ausgegrenzt werden, andererseits diese Menschen von sich aus zur Integration und das heißt zur weit gehenden Assimilation bereit sind.
e) Auch die ökonomischen Probleme sind nicht leicht zu nehmen. Nach verlässlichen Angaben beträgt die Wirtschaftskraft der Türkei derzeit nur 25 Prozent der durchschnittlichen Wirtschaftskraft der EU. Ein Beitritt der Türkei würde mithin das regionale Wirtschaftsgefälle innerhalb der EU erheblich verstärken und, wie der jüngste Kommissionsbericht ausführt, der Türkei lange Zeit Anspruch auf erhebliche Unterstützung aus den Mitteln des Strukturfonds und des Kohäsionsfonds geben. Gleiches gilt hinsichtlich der Teilnahme an der gemeinsamen Agrarpolitik. Insgesamt werden die notwendigen Aufwendungen für eine längere Zeit auf 20 Milliarden Euro jährlich beziffert. Es ist daher nicht polemisch, sondern ernsthaft zu fragen, wie weit solche Beträge die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der übrigen EU-Mitglieder übersteigen, zumal ja die Anforderungen der gerade ins Werk gesetzten Osterweiterung noch zu verarbeiten sind. Andererseits ist im ökonomisch-verteilungspolitischen Bereich Raum für Verhandlungen und Veränderungen; die Herausforderungen, die ein Beitritt der Türkei insoweit mit sich bringt, können auch Anlass sein, die Agrar-, Kohäsions- und Strukturpolitik der EU grundlegend neu zu formulieren und so realisierbar zu halten. Das würde freilich keine einfache Prozedur, weil vielerlei Besitzstände auf den Prüfstand kommen müssten. Doch liegt darin zugleich eine Chance für die EU, zu einer stärker rational bestimmten ökonomischen Struktur und Politik zu kommen. Die Aufgabe, die Türkei ökonomisch an die EU heranzuführen und in sie zu integrieren, kann so nicht von vornherein als unlösbar angesehen werden.
IV
Was gegen einen vollen Beitritt der Türkei zur EU als politischer Union spricht und ihn höchst bedenklich macht, liegt mithin nicht eigentlich im ökonomischen Bereich, obwohl auch dieser nicht ohne Risiken ist; es ergibt sich primär und durchschlagend aus den dargelegten geographisch-geopolitischen, kulturellen und politisch-integrativen Problemen in Verbindung mit demographischen Gesichtspunkten. Hinzu tritt die gegenwärtige, in die Zukunft hineinwirkende Befindlichkeit der Europäischen Union selbst. Diese bringt für längere Zeit herausfordernde Probleme mit sich, als Stichworte seien nur Zusammenwachsen, institutionelle Reform, wirklicher Aufbruch zu gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik genannt. Kommt hier noch die Beitrittsproblematik mit allem, was daran hängt, hinzu, führt das zu einer nicht mehr lösbaren Problemüberfrachtung. Die Folge wäre eine resignative Rückentwicklung der EU zur bloßen Wirtschaftsgemeinschaft und Freihandelszone. Die Verankerung Europas bei den Bürgern, die Europa als etwas Eigenes, von ihnen Mitgetragenes erleben und eine positive Zugehörigkeit dazu empfinden, wäre dahin.
a) Wie kann dann aber eine angemessene Lösung des Beitrittsproblems, auch auf dem Hintergrund der der Türkei gemachten Zusagen aussehen? Es kann und muss ein besonders enges Verhältnis der Türkei zur EU hergestellt werden, das nicht nur den Handel und die Wirtschaftsförderung mit dem Ziel der Angleichung der Lebensverhältnisse umfasst, sondern auch darüber hinausgeht. Zu diesem Verhältnis kann auch die Teilnahme an der Euro-Währung gehören sowie jenseits von Handel und Wirtschaft eine enge, institutionell ausgestaltete Kooperation mit
Beteiligungs- und Anhörungsrechten, wie sie durchaus schon bestehen, mit Konsultationen und auch – allerdings überstimmbaren – Einspruchsrechten. Hier ist vieles möglich und auch realisierbar, was unterhalb der Grenze der förmlichen vollen Mitgliedschaft bleibt, die Türkei aber gleichwohl in eine enge und als solche erkennbare Verbindung mit der EU bringt, die ihr die eingangs erwähnte Brückenfunktion ermöglicht und sie darin unterstützt. Der Ausdruck »privilegierte Partnerschaft« scheint dafür allerdings nicht gut gewählt. Er stellt doch stark auf Begrenzung und Trennung ab: Eine bloße Partnerschaft, wie sie generell mit den Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, besteht, wenn auch eine privilegierte und dadurch hervorgehobene. Richtiger und der Sache angemessen wäre es, auf die besondere Verbundenheit und Teilhabe abzustellen, die positive und institutionell näher ausgeformte Beziehung, um die es in der Sache geht und auch gehen sollte. In politics there is sometimes much in a word. Als das Paulskirchen-Parlament 1848/49 den Versuch machte, die österreichische Monarchie, einen Vielvölkerstaat, wenigstens teilweise in den zu errichtenden nationalen deutschen Staat einzubeziehen, sprach der Abgeordnete von Gagern von dem »engeren und weiteren Bund«, den es zu schaffen gelte. Kann es nicht ebenso im Verhältnis zur Türkei um die engere und eine weitere europäische Union gehen, mit einer Art assoziierter Mitgliedschaft?
b) Kommt ein solcher Status aber nicht gleichwohl in Konflikt mit Verpflichtungen, die Europa gegenüber der Türkei eingegangen ist, und Zusicherungen, die ihr gemacht wurden? Die Lage ist nicht so einfach, wie sie oft dargestellt wird. Das Assoziationsabkommen mit der Türkei von 1963, ersichtlich auch unter Auspizien des Ost-West-Gegensatzes abgeschlossen, hatte das Ziel, eine »beständige und ausgewogene Verstärkung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen« zwischen der EWG und der Türkei zu erreichen; es sah dafür drei Phasen vor, die Endphase sollte auf einer Zollunion beruhen, die 1995 vollendet wurde, und eine verstärkte Koordination der Wirtschaftspolitiken einschließen (Art. 5). Die Annäherungs- und Beitrittsperspektive, von der heute oft die Rede ist, war entsprechend dem damaligen Charakter der EWG auf eine Wirtschaftsgemeinschaft gerichtet, nicht auf mehr. Das machte heute kein Problem, und insofern wäre das Abkommen von 1963 auch erfüllt. Indem diese Perspektive aber fortgeschrieben und bestätigt wurde, als die EG nach den Ereignissen der Jahre 1989 und 90 – Zusammenbruch des Ostblocks und Wiedervereinigung – im Vertrag von Maastricht sich als Europäische Union auf eine politische Union auszurichten begann und zudem die Osterweiterung ins Auge fasste, erhielt sie einen anderen Inhalt. Die Zäsur liegt – ob den Beteiligten bewusst oder nicht – im Beschluss des Europäischen Rates in Helsinki 1999. Er erkannte der Türkei ausdrücklich den Status eines Bewerberlandes zu, das auf der Grundlage derselben Kriterien, die auch für die übrigen Bewerberländer gelten, Mitglied der Union werden solle. Noch 1998 hatte Bundeskanzler Kohl, wie er gerade jetzt in einem Fernsehgespräch mitgeteilt hat, gegenüber dem türkischen Ministerpräsidenten Ylmaz erklärt, dass ein Beitritt der Türkei zur EU nicht in Betracht komme. Diese Position hatte Europa mit Helsinki verlassen, vielmehr eine Beitrittsoption zur EU als politischer Union für die Türkei eröffnet und sie durch den Beschluss von Kopenhagen Ende 2002 noch einmal verstärkt. Die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen rundweg abzulehnen, muss nach alledem, von rechtlichen Problemen abgesehen, tiefe politische Zerwürfnisse hervorrufen, zumal die Türkei ihrerseits beträchtliche Anstrengungen unternommen hat, um sich beitrittsfähig zu machen. Aber eine Beitrittsoption ist noch keine Beitrittszusage, sodass nur noch über die Modalitäten zu verhandeln wäre. Auch das Ob eines Beitritts – voller Beitritt oder andere Formen spezifischer Verbundenheit – ist dabei offen und kann durch entsprechende Verlautbarungen offen gehalten werden. Dies muss dann aber auch ausdrücklich geschehen, will man der normativen Kraft des Faktischen, die sich gerade in diesen Fragen vehement breit macht, wirksam entgegentreten. Eine tragfähige Anknüpfung dafür gibt es übrigens in den Beitrittskriterien von Kopenhagen selbst. Denn im Gesamttext der Kriterien findet sich ein heute eher verschwiegener Zusatz, den eine französische Diplomatin wieder zu Tage gefördert hat. Er hebt »die Kapazität der EU, neue Mitglieder zu integrieren«, als ein »wichtiges Element« vor der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen hervor. An eben dieser Integrationskapazität der EU, will sie eine politische Union bleiben, fehlt es heute und auf absehbare Zeit, und dies kann gegenüber der Türkei geltend gemacht werden.
c) Die Bereitschaft, einen solchen Vorbehalt zu empfehlen und sich dafür einzusetzen, fehlt indes sowohl bei der Europäischen Kommission wie bei der Bundesregierung. Wie jüngste Äußerungen von EU-Kommissar Verheugen, Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer zeigen, wird unter dem Eindruck des 11. September 2001 ein neues Strategiekonzept für die EU verfolgt, das – ohne weitere Diskussion – die Finalité der europäischen Integration nachhaltig verändert. Nunmehr ist die Frage des endgültigen Platzes der Türkei in Europa eine sicherheitspolitische Frage, und zwar, wie Verheugen sagt, ganz und gar. Die EU erscheint als ökonomisch gestützte ausgreifende Stabilisierungsund Aktionskraft im Kampf gegen den weltweiten Terrorismus und in der Auseinandersetzung mit der islamischen Welt. Das macht ihre weite Ausdehnung mit der Türkei als Vorposten nach Asien hin notwendig, nicht zuletzt auch, um die Vereinbarkeit des Islam mit westlicher Welt und Demokratie unter Beweis zu stellen. Die EU übernimmt eine fortentwickelte und erweiterte Sicherheitsfunktion in Ergänzung zur NATO und soll, selbstständig oder eingefügt in das Weltvorherrschaftskonzept der USA, ein weltpolitischer Akteur werden. Dieses Konzept mag schlüssig sein oder nicht; ob es politisch unerlässlich ist, erscheint zweifelhaft. Jedenfalls aber bedeutet es einen folgenreichen Strategie- und Finalitätswechsel für die europäische Integration, übrigens zum dritten Mal in deren Geschichte. Steht das sicherheitspolitische Ziel so dominant im Vordergrund, kann es auf andere Erfordernisse und Gegebenheiten, die für eine politische Union notwendig sind, nicht mehr in gleicher Weise ankommen; diese müssen hinter dem neuen Ziel zurücktreten, gegebenenfalls auch unter Inkaufnahme einer Änderung der Struktur der Europäischen Union. Das ist, kurz gesagt, der Weg, der nun beschritten werden soll. Für die EU bedeutet dieser Weg einen Scheideweg. Denn die volle Einbeziehung der Türkei in die Union aus Gründen und unter Dominanz eines sicherheitsstrategischen Konzepts steht einer Fortentwicklung der Union als politischer Union, die von einer Gemeinsamkeit und Verbundenheit der Völker, die in ihr leben, getragen und bestimmt wird, entgegen. Beides zugleich – dies habe ich versucht darzulegen – kann man nicht haben. Bei einem vollen Beitritt der Türkei wird die EU zwar nicht untergehen, aber sich rückbilden zu einer Wirtschaftsgemeinschaft mit Binnenmarkt- und Industriepolitik, was ohnehin im Interesse Großbritanniens und wohl auch der USA liegt, dabei überlagert von sicherheitsstrategischer Zielsetzung. Die EU steht also in der Tat am Scheideweg. Die Entscheidungen, die der Europäische Rat am 17. Dezember zu treffen hat, werden für sie eine Stunde der Wahrheit. Videant consules!
Das Wagnis der Freiheit
Im Vorfeld der Hannah-Arendt-Preisverleihung fand am 3. Dezember 2004 in der Bremischen Bürgerschaft eine Podiumsdiskussion statt, in der es um Fragen des freiheitlich säkularen Staates, die Bedeutung der Religion und die Sicherung der Freiheit ging. Die thematische Einleitung und die Vorstellung der Podiumsteilnehmer durch die Diskussionsleiterin Marie-Luise Knott, freie Publizistin und Chefredakteurin der deutschsprachigen Le Monde Diplomatique, musste aus Platzgründen hier ebenso entfallen wie die sich anschließende Diskussion auf dem Podium. Das Motto der Podiumsdiskussion war ein zentrales Zitat von Ernst-Wolfgang Böckenförde: »Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist.«
Ulrich K. Preuss
Dieser Satz besitzt eine ungeheure Sogwirkung. Er ist so suggestiv, dass, wenn man ihn einmal gehört oder gelesen hat, man gar nicht umhin kann, ihn bei nächstbester Gelegenheit wieder zu zitieren. Das ist natürlich ein großes Kompliment an Herrn Böckenförde, denn wenigen Menschen beziehungsweise wenigen Intellektuellen gelingt es, solche prägenden klaren Sätze zu produzieren, die im Grunde genommen – und damit komme ich schon zum kritischen Teil meiner Bemerkung – in jedem relativ beliebigen Zusammenhang immer irgendetwas Richtiges aussagen. Das ist natürlich auch das Problem dieses Satzes, den wir uns deswegen noch etwas genauer anschauen sollten. Dieser Satz ist ja im Grunde so etwas wie ein geflügeltes Wort, und wie Geflügel nun mal ist, fliegt es mal dahin und mal dahin. Man kann es eigentlich nicht richtig festmachen. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht zur Einleitung mal fünf Stationen benenne, wo dieser Vogel sich entweder schon niedergelassen hat oder leicht niederlassen könnte. Das sind Zusammenhänge, die sehr unterschiedlicher Art sind. Der erste Vogel, den ich mit einem berühmten Namen assoziiere, ist Alexis de Tocqueville. Alle diejenigen, die ihn ein wenig kennen und die Literatur um ihn herum, werden sagen: »Dieser Satz ist im Grunde genommen gar nichts Neues. Das wissen wir doch alles schon von Tocqueville.« Tocqueville hat an einer Stelle mal gesagt: »Die Institutionen einer Gesellschaft sind von dem sozialen Zustand des Volkes abhängig.« Das ist eine altbackene Sprache des 19. Jahrhunderts beziehungsweise eine Übersetzung, aber genau das ist im Grunde der Inhalt dieses Satzes, wie man ihn jedenfalls auch zuschreiben kann. Wir müssen uns vorstellen, dass eigentlich gleichsam vorinstitutionelle Bedingungen der Gesellschaft vorhanden sein müssen oder, anders gesagt, dass die vorinstitutionellen Bedingungen der Gesellschaft den Grad der Institutionen prägen. Das ist eine klassische tocquevillesche Aussage, die er über die Amerikaner oder über die berühmte Demokratie in Amerika ausgeführt hat. In dieser Tradition steht ebenfalls ein berühmter Amerikaner namens Robert Putnam, der ein Buch geschrieben hat über Making Democracy Work. Dort sagte er im Grunde genommen – und diesen Satz könnte man heute modifizieren –, dass der freiheitlich demokratische oder auch säkularisierte Staat von der Voraussetzung einer lebendigen Zivilgesellschaft lebt. Das haben wir erfahren, als wir über die Transformation von postkommunistischen Gesellschaften gesprochen haben und das kann man auch jetzt im Grunde wieder in der Ukraine erleben. Dass nämlich ohne eine lebendige Zivilgesellschaft eigentlich ein Verfassungssystem gar nicht funktionieren kann, sondern gewissermaßen ein rein formales »Implantat« darstellt. Das wäre eine Aussage oder Interpretation, wie man sie bei Tocqueville, Putnam – und wie man sie natürlich auch häufig versteht – vorstellen kann. Es gibt aber auch eine etwas abgründigere Interpretation, die mit einem Autor zu tun hat, der wiederum Herrn Böckenförde gar nicht fremd ist, nämlich Carl Schmitt. Dies ist eine Interpretation von einer besonders kritischen Position aus. Dieser Satz ist insofern gefährlich, als er im Grunde genommen behauptet, dass die Gesellschaft und ihre Rechtsordnung in ihrer Verfasstheit von der Existenz und damit auch von der Existenznotwendigkeit von »vorund nichtverfassten Räumen« lebt. Wenn wir von »nichtverfassten Räumen« sprechen, dann assoziieren zumindest Juristen, aber auch der normale Bürger, wenn er darüber nachdenkt, den Ausnahmezustand. Das ist nämlich der Zustand, in dem das Recht endet und in dem, nach Carl Schmitt, über die Bedingungen gestritten und entschieden wird, ob Recht überhaupt gilt. Das ist eine Aussage, bei dem dieser Satz schon eine Kolorierung erhält, die man wahrscheinlich nicht so ohne Weiteres mit Kopfnicken und Wohlgefallen akzeptieren kann, sondern sagt: »Halt! Diesen Satz darf man so unbefangen nicht einfach unkommentiert weitergeben, geschweige denn einmeißeln.« Ich denke, dass wir da doch einmal innehalten sollten.
Natürlich sind alle diese Interpretationen, die ich gebe, nicht Unterstellungen, um zu zeigen, dass das von Herrn Böckenförde gemeint ist, sondern der Satz hat ja seine »objektive Selbstständigkeit« gewonnen. Jeder macht damit, was er will. Das ist ja genau der Tenor meiner Ausführungen. Das heißt, es gibt auch durchaus Autoren, die das daraus machen können, was auch Carl Schmitt gesagt hat: »Bevor Recht ist, muss Ordnung sein«, und diese Ordnung wird im Ausnahmezustand oder auch vorrechtlichen Zustand geschaffen und deshalb ist dieser Satz uns sehr willkommen. So würde oder könnte jemand zumindest sagen!
Dann gibt es eine dritte Aussage. Einen Ort, der natürlich hier am heutigen Tag und auch morgen prominent ist. Das ist eine Aussage von Hannah Arendt. Hannah Arendt würde nun diesen Satz – aus meiner Sicht und wie ich sie verstehe und interpretiere – ablehnen. Sie würde sagen: »Dieser Satz unterstellt einen Dualismus von Politik, die gewissermaßen gestaltet wird im Medium von Souveränität und Staatlichkeit. – Der säkularisierte Staat ist es ja hier, der angerufen wird. – Staatlichkeit, das heißt Souveränität! In seiner Funktionsfähigkeit ist er gewissermaßen bestimmt durch die Herstellung von kollektivbindenden Entscheidungen und all das, was damit assoziiert wird.« Wir alle wissen und vor allen diejenigen, die diesen Preis verleihen, wissen, dass das ein Politikverständnis ist, das Hannah Arendt radikal abgelehnt hat. Souveränität ist für sie gewissermaßen das Ende der Politik und nicht ein Medium von Politik. Für sie liegt Politik im Grunde genommen im Vermögen des Menschen zu handeln, zu versprechen und zu verzeihen. Das sind die drei elementaren Merkmale von Politik bei Hannah Arendt, die vollkommen ohne jede Form von Souveränität auskommen. Das würde bedeuten, dass damit der Rekurs auf gleichsam vor der Souveränität liegende gesellschaftliche Ressourcen bei ihr keinen Ort hat, weil Politik selbst in diesem vorpolitischen Raum konstituiert wird. Politik konstituiert sich sozusagen aus diesem Raum heraus. Dieser Dualismus, der hier konstruiert wird in diesem Satz, den würde Hannah Arendt ablehnen. Das wäre die Hannah Arendt’sche Interpretation. Nun komme ich zu einer Interpretation eines weiteren prominenten Autors, nämlich Ernst-Wolfgang Böckenförde selbst, denn er hat das Recht, präzise zitiert zu werden, präzise verstanden zu werden und nicht gleichsam für jede beliebige Zielsetzung genutzt zu werden. Ich glaube, er hat das Recht darauf, dass man ihn zum Beispiel von der Unterstellung, die bei vielen immer mitschwingt, freispricht: Die Unterstellung, dass er im Grunde meint, dass der Verfassungsstaat (auch der unsrige heute) nur funktioniert, wenn wir so etwas wie einen Wertekonsens haben, und dass dieser Wertekonsens etwas ist, das wir gleichsam vorpolitisch voraussetzen müssen, und wenn dieser nicht gegeben ist, dann funktioniert die Demokratie nicht. Also müssen wir, damit die Demokratie funktioniert, diejenigen, die am Wertekonsens nicht teilhaben wollen, in irgendeiner Form isolieren oder was immer man damit machen soll. Jedenfalls wäre die Unterstellung: »Wir brauchen einen Wertekonsens« – und das ist genau das, was der Satz von Herrn Böckenförde nicht sagt. Zumindest nicht in dem Kontext, in dem der Satz steht. Deshalb sagte ich: »Wir müssen diesen Satz so wörtlich nehmen, wie er ihn geschrieben hat.« Er sagt, dass der Appell an den Wertekonsens ein höchst dürftiger und auch gefährlicher Ersatz wäre, denn – ich möchte das hier jetzt noch einmal ausdrücklich zitieren – »er eröffnet dem Subjektivismus und Positivismus der Tageswertungen das Feld, die je für sich objektive Geltungen verlangen und die Freiheit eher zerstören als fundieren«. Ich glaube, das ist die authentische und hier wörtlich so ausformulierte These, die hier in Erinnerung gerufen werden sollte, damit sich nicht die falschen Propheten an diesen Satz anhängen. Wenn dann am Schluss dieses Aufsatzes Herr Böckenförde dennoch auf die Religion zu sprechen kommt, so ist das etwas höchst Persönliches. Religion ist hier nicht als gesellschaftliches Gebilde, das Gemeinschaft stiftet und einen Werte- und Gemeinschaftskonsens bildet, gemeint, sondern es ist jenes individuelle Gewissen gemeint, als ein für das Funktionieren des Verfassungsstaates verantwortliches Individuum. Ich glaube das ist eine wichtige Präzisierung, wie sie mir immer wieder erforderlich erscheint.
Dann gibt es eine fünfte Position von einem Autor, der nicht weiter bekannt ist. Ich identifiziere ihn aber mit mir: Ulrich K. Preuss. Dieser gibt eine Deutung, die abweicht von der böckenfördischen und von allen anderen Deutungen ebenfalls. Diese Deutung ist nicht besonders originell, aber ich glaube, sie sollte schon in die Diskussion hier eingebracht werden. Aus meiner Sicht erweckt der Satz nämlich die Vorstellung, als wenn die vorpolitischen Voraussetzungen der Politik und die vorrechtlichen Voraussetzungen des Rechts etwas Statisches, Gegebenes oder auch Prä-Existentes sind, auf das der säkularisierte Staat gar keinen Zugriff hat. Ich glaube, dass das eine falsche Sichtweise ist. Wir müssen uns diesen Prozess der Herbeiführung der Funktionsbedingungen des Verfassungsstaates viel dynamischer vorstellen. Es ist ein Prozess wechselseitiger Kreation und wechselseitiger Inspiration. Das heißt also, dass der Verfassungsstaat wohl durchaus durch die wesentlichen Voraussetzungen und auch die kulturellen Voraussetzungen eine Menge von Möglichkeiten hat, sich das Individuum (das hört sich jetzt sehr missverständlich an) zu formen – denken Sie doch nur an die Schule! Die Schule als die »Schule der Nation«, wie Willy Brandt gesagt hat, oder auch die Bundeswehr, als vielleicht nicht mehr ganz geeignete »Schule der Nation«. Ich will das nicht so passiv im Sinne des »Einwirkens« verstehen, aber doch als einen Prozess, in dem die Bürger, die die Träger dieser freiheitlichen Ordnung sind, »heranerzogen« werden (muss man wirklich sagen), sodass also der Fatalismus, der in diesem Satz mitschwingt, aus meiner Sicht unangebracht ist. Damit habe ich Ihnen fünf mögliche Interpretationen gegeben. Vielleicht sind sie aus Ihrer Sicht vollkommen abwegig. Vielleicht können sie auch durch andere Interpretationen ergänzt werden. Aus meiner Sicht steht aber fest, dass dieser Satz immens interpretationsfähig und -bedürftig ist, was seine Suggestivkraft, aber auch seine Instrumentalisierbarkeit für verschiedenste politische Zwecke zum Ausdruck bringt.
Zdzislaw Krasnodebski
»Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist.« – An diesen berühmten Satz von Ernst-Wolfgang Böckenförde wird auch im »neuen Europa« erinnert. Die Demokratien, die nach dem Kommunismus aufgebaut wurden, werden mit Problemen konfrontiert, die die aktuelle und brisante Bedeutung dieses Satzes deutlich machen. Es stellte sich noch einmal deutlich heraus, dass das formale Bestehen demokratischer Institutionen noch nicht Freiheit oder Gleichheit vor dem Gesetz garantiert, dass das Recht ohne einen entsprechenden Kontext ausgehöhlt wird. So würden fast alle von uns der These zustimmen, dass der Staat, obwohl er ein »weltanschaulich-neutraler Staat« ist, als »das politische Gemeinwesen eine geistliche Grundlage und die erforderliche relative Gemeinsamkeit« benötigt (S. 433). Aber was bedeutet dies? Welches sind denn die Voraussetzungen, von denen der freiheitliche säkularisierte Staat lebt? Wann kann man sagen, dass sie nicht mehr erfüllt werden und woran erkennen wir, dass sie bedrohlich schwach geworden sind? Das ist nicht mehr selbstverständlich, mehr noch, gerade dies wird zum Thema der heftigsten politischen Auseinandersetzungen. Eine Antwort schien uns sehr lange klar zu sein. Was die freiheitliche Ordnung bedroht, sind der Fundamentalismus, der Fanatismus, der »Populismus« oder der Nationalismus und so fort. Das Remedium gegen diese Krankheiten sollte die Zivilgesellschaft, der Pluralismus, darstellen. Die Bürger und die Eliten sollten die Menschen sein, die nicht fundamentalistisch gesinnt sind, tolerant, offen, pragmatisch, bereit zum Dialog, säkularisiert und flexibel. Nach fünfzehn Jahren der Demokratie im »neuen Europa« haben wir jedoch festgestellt, dass die größten Probleme woanders liegen. Was unsere Demokratie immer mehr zur Fassade macht und unsere Freiheit bedroht, sind nicht so sehr zu starke Überzeugungen, sondern ein Mangel an Überzeugungen, nicht der starre Dogmatismus, sondern zu viel Flexibilität, nicht der verabsolutierte Moralismus oder Fanatismus, sondern die Beliebigkeit, der Zynismus und Nihilismus, nicht zu wenig Individualismus, sondern zu wenig Gemeinsamkeit, auch nicht zu viel Religion, sondern zu wenig eines echten Glaubens, der auch im alltäglichen Leben wirksam wird, nicht zu starkes Nationalbewusstsein, sondern seine Fragmentierung und eine Entnationalisierung der Eliten, die alles das übersteigt, was Samuel Huntington über amerikanische Eliten geschrieben hat. Das sind alles Erscheinungen, die auch im »alten Europa« bekannt sind, aber vielleicht manifestieren sie sich nicht als akute Bedrohung, weil sie dieses Problem auf andere Weise gelöst – oder scheinbar gelöst haben. Oder weil wir es hier mit einer schleichenden, langsamen Erosion zu tun haben, während in Ostmitteleuropa dies alles schneller und sichtbarer verläuft. Die Frage nach der Gemeinsamkeit ist akut geworden: »Wächst dem Staat diese Gemeinsamkeit unproblematisch zu, etwa durch das politisch-kulturelle Erbe, durch rationale Einsicht oder aktuellen Konsens? Oder steht er dann, wie Hegel etwa meinte, ›in der Luft‹ (S. 433), sodass er schließlich einer so genannten Zivilreligion bedarf, die aus Setzung lebt, aber gleichwohl den Anspruch auf Gültigkeit macht und machen muss?« Es ist schwierig, den historiosophischen Optimismus von Jürgen Habermas zu teilen, der uns in seinem ganzen Werk zu überzeugen versucht, dass die Moderne von sich selbst Normen hervorbringt und neue Solidarität schafft: »Normalerweise beziehen die Angehörigen einer Lebenswelt so etwas wie Solidarität aus überlieferten Werten und Normen, aus eingespielten und standarisierten Mustern der Kommunikation. Im Laufe der Rationalisierung schrumpft oder zersplittert jedoch dieser askriptive Hintergrundkonsens. Er muss im selben Maße durch erzielte Interpretationsleistungen der Kommunikationsteilnehmer selbst ersetzt werden. ... Rationalisierte Lebenswelten verfügen mit der Institutionalisierung von Diskursen über einen eigenen Mechanismus der Erzeugung neuer Bindungen und normativer Arrangements. In der Sphäre der Lebenswelt verstopft ›Rationalisierung‹ nicht die Quellen der Solidarität, sondern erschließt neue, wenn die alten versiegen.« (Konzeption der Moderne. Ein Rückblick auf zwei Traditionen, S. 229)
Dabei kommt man nicht umhin zu fragen, ob die Aushöhlung der Demokratie in Ostmitteleuropa nicht durch die Überzeugung verursacht wird, dass die moralischen und religiösen Überzeugungen nichts in der politischen Sphäre zu suchen haben, wenn der Staat völlig neutral ist und die Gesellschaft völlig pluralistisch. Durch die Lektüre von Ernst-Wolfgang Böckenförde kann man viele falsche oder zu einfache Vorstellungen korrigieren, vor allem was das Verhältnis zwischen Religion und Politik angeht. Zum Ersten erinnert er daran, dass die Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften keine radikale sein muss, wie im laizistischen Frankreich, sondern »eine balancierte Trennung« (S. 431) wie in der Bundesrepublik sein kann. Zweitens verweist er darauf, dass die Religion, wenn sie zu einem Angebot unter anderen wird, nicht aus der öffentlichen, politischen Sphäre verschwindet, dass die Kirche in der Ausübung ihres Hüter- und Wächteramtes oft in die Politik eingreifen muss. So lesen wir, dass »inwieweit sie [die staatliche Rechtsordnung und die Lebensordnung der Gesellschaft] davon geprägt sein können, hängt zum einen vom ordre public und der Eigenart des politischen Gemeinwesens ab, zum anderen davon, in welcher Weise und in welchem Ausmaß die Rechts- und Lebensordnung dieses Gemeinwesens durch die gesellschaftlichen und politischen Kräfte geformt sind.« Drittens schreibt er, dass trotz dieser Trennung der weite Bereich der »res mixtae« existiert, in denen der Staat und die religiösen Gemeinschaften sich treffen. Deshalb wird es immer Konflikte und Reibungen geben, auch zwischen Politik und Religion, solange sie lebendig bleibt: »Der Anschein ... dass im Zeichen des modernen Verfassungsstaats, der Religionsfreiheit gewährt, und in den heutigen Kirchen, die diese Religionsfreiheit anerkennen und in Anspruch nehmen, die alte Spannung ihre Auflösung findet und ein unproblematisches Nebeneinander von Religion und Politik möglich ist, trügt.« (S. 326) Viertens führt er aus, dass – wie es Carl Schmitt zeigte– sich das Politische nicht einzäunen und beschränken lässt: »Das Politische ist kein abgrenzbarer Gegenstandsbereich, der neben oder unterhalb des religiösen Bereichs steht, es stellt vielmehr ein öffentliches Beziehungsfeld zwischen Menschen und Menschengruppen dar, das durch einen bestimmten Intensitätsgrad der Assoziation oder Dissoziation gekennzeichnet ist, der sein ›Material‹ aus allen Sach- und Lebensbereichen beziehen kann.« (S. 327)
Kann man jedoch überhaupt sagen, dass der gegenwärtige Staat, auch wenn er auf dem Prinzip der Religionsfreiheit gründet, »weltanschaulich-neutral« ist? Wenn es auch wahr ist, dass »die Aufgabe des Rechts in der modernen Gesellschaft sich ... umschreiben lässt als verbindliche, auf soziale Geltung abzielende Regelung des äußeren zwischenmenschlichen Zusammenlebens in einer Weise, die äußeren Frieden, persönliche Freiheit und Sicherheit für alle und jeden Einzelnen sowie die Ermöglichung angemessener Wohlfahrt sichert beziehungsweise verbürgt«, so lernen wir doch von Ernst-Wolfgang Böckenförde, dass im Recht immer ein Menschenbild enthalten ist. »In der Art, wie das Recht dies ... tut [d. h. das zwischenmenschliche Zusammenleben regelt, Anm. Z. K.], lässt es ausdrücklich oder indirekt eine Vorstellung vom Menschen erkennen: Als wer ist er anzusehen und was kommt ihm zu, worin ist er zu schützen, was ist ihm zu ermöglichen und wovon ist er fern zu halten.« (Vom Wandel des Menschenbildes im Recht, S. 5) Wenn es aber ein Bild von Menschen im Recht enthält, dann ist es immer philosophisch beladen, dann ist es immer auch mit einer »Weltanschauung« verbunden. Der Staat und das Recht bleiben Ausdruck einer politischen Gemeinschaft, der Staat ist Rahmen, aber zugleich Teil des politischen Prozesses.
Paul Nolte:
Ja, Böckenförde! Meine erste Begegnung fand als Student der Geschichte in Bielefeld statt. Vielleicht wehte damals auch noch der Geist von Herrn Böckenförde dort, den ich persönlich aber nicht kennen gelernt hatte. Damals lernte man vor allen Dingen, dass die konstitutionelle Monarchie, die die charakteristische Verfassung Deutschlands beziehungsweise der deutschen Teilstaaten im 19. Jahrhundert gewesen ist, auf Sand gebaut war – sozusagen aus sich heraus zu ihrer eigenen Überwindung drängte: zu einer Parlamentarisierung, zu einem parlamentarischen demokratischen Staatswesen des 20. Jahrhunderts drängte. Das war gedacht gegen die Überhöhung dieser deutschen konstitutionellen Monarchie und argumentiert gegen Ernst Rudolf Huber (einen bekannten Verfassungsgeschichtler und Verfassungstheoretiker aus einer wesentlich älteren Generation), der gesagt hat: »Nein, wir Deutschen sind anders. Wir haben diese konstitutionelle Monarchie und die sollte uns eigentlich auch auszeichnen und erhalten bleiben, denn das war eigentlich das Besondere.« Man lernte also, dass Böckenförde im Grunde in Richtung einer Verwestlichung argumentierte und dass Deutschland diesen Sonderweg der konstitutionellen Monarchie nicht weitergehen sollte.
Erst später bin ich dann auch auf diesen Satz gestoßen, mit dem wir es heute zu tun haben. Eine Antwort auf die Frage, was daran aktuell ist und warum wir uns noch mit diesem Satz beschäftigen sollten, ist ja schon gegeben worden.
Die Antwort sollte auf jeden Fall nicht zu vordergründig sein. Der Satz von Ernst-Wolfgang Böckenförde ist viel zitiert und aber auch aus dem Kontext gerissen worden. Kein Wunder dann, dass er auch aus ganz unterschiedlichen Richtungen instrumentalisiert, in Anspruch genommen, aber auch natürlich legitimerweise weitergedacht worden ist. Nicht zuletzt deshalb und auch weil ich Historiker bin, wähle ich zunächst einmal den kleinen Umweg über die Geschichte. Ich frage also – 1967 ist ja mittlerweile auch Geschichte geworden – zunächst einmal nach dem historischen Kontext und nach den historischen Bedeutungsschichten dieses, auf den ersten Blick vielleicht ungemein einleuchtenden, dann aber wieder komplizierter werdenden Satzes. Meine Grundthese wäre, dass dieser Satz, dieses Böckenförde-Diktum (unter diesen Stichwort kann man das auch »googlen«, habe ich festgestellt) – historisch gesehen – ein Scharnier bildet im Übergang von einer eher autoritär-etatistischen zu einer liberalen Staats- und Gesellschaftsauffassung in Deutschland. Es markiert im Grunde den Punkt, an dem die deutsche Staatstheorie und Staatsauffassung aus dem Schatten des allmächtigen Leviathan herausgetreten ist. Es markiert auch den Punkt – in dieser charakteristischen Formulierung – der freiwilligen Selbstaufgabe des Leviathan, ja, das Wagnis. Dies ist nicht zufällig ein Prozess, der in der Mitte der Sechzigerjahre seinen Höhe- und Wendepunkt erreichte. Die Sechzigerjahre waren eine Scharnierepoche.
Dazu hier noch vier kurze Bemerkungen:
1. Die Sechzigerjahre waren eine Scharnierepoche in sozialgeschichtlicher und bewegungsgeschichtlicher Hinsicht (Studentenbewegung usw.), aber auch geistes- und wissenschaftsgeschichtlich. Das fing an mit einem Impuls der Entdogmatisierung. Man wollte die alten Dogmen loswerden und wollte auch Dinge wie den Staat historisch betrachten sowie historisieren. Ein historisierender – und wie das damals sehr im Schwange war –, begriffsgeschichtlicher Ansatzpunkt ist ja auch der methodische Ansatzpunkt des Aufsatzes, an dessen Ende dieser berühmte Satz dann steht.
2. Ernst-Wolfgang Böckenförde ist Teil oder auch Mitglied der Nachkriegsgeneration, die heute so bezeichneten 45er-Intellektuellen. Also derjenigen Intellektuellengeneration, die durch die Zäsur 1945 in der deutschen Geschichte ihre besondere Prägung erfahren hat und über die jetzt vielfach auch schon historisierend geschrieben worden ist. Das ist ja vielleicht die wichtigste, kompakteste Intellektuellengeneration, die es, ich möchte durchaus sagen: je in der deutschen Geschichte gegeben hat. Es geht um die Geburtsjahrgänge etwa zwischen 1926/27 und 1932/33. Sie liegen da genau in der Mitte, Herr Böckenförde, mit so berühmten Namen wie Habermas oder Dahrendorf, Lübbe und Nipperdey, Enzensberger, Grass und so fort. Sie alle waren geprägt von der Erfahrung des Nationalsozialismus. Sie sind die so genannte Flakhelfergeneration. Sie sind nicht mehr diejenigen, die an die Front gemusst haben, aber noch eine Sozialisationserinnerung und -erfahrung im Nationalsozialismus mitgenommen haben, die auch geprägt wurden durch die Auseinandersetzung mit akademischen Lehrern, die dem Nationalsozialismus gedient haben: ob das nun Carl Schmitt war oder Ernst Forsthoff oder Theodor Schieder. Eine Generation, für die der Lernprozess im Vordergrund stand und das Bemühen – ich habe das vorhin schon angedeutet – die politische Kultur der Bundesrepublik eindeutig an die liberale Kultur des Westens anzuschließen.
3. Dies bedeutete in der damaligen Situation und in die nachwirkenden Jahrzehnte hinein eine Brückenfunktion. Eine Brücke, zum einen von traditionell rechten zu linken und liberalen Staatsauffassungen (und die Staatstheorie in Deutschland ist ja vorwiegend von rechten Positionen beherrscht gewesen), und das Böckenförde-Diktum ist dann in vielfacher Weise in linksliberalen Staats- und Gesellschaftstheorien aufgenommen und anverwandelt worden. Man kann Spuren auch bei Jürgen Habermas zum Beispiel im »Konzept des Verfassungspatriotismus« und anderswo finden. Dieses Denken hat aber auch andererseits eine Modernisierungsfunktion für die eher rechten Staatstheorien selber gehabt und ihnen die Möglichkeit zur Demokratisierung und Liberalisierung eröffnet. So wurde also auch dem rechten Denken die Möglichkeit gezeigt und der Weg gewiesen, aus dem Schatten von Diktatur und autoritärem Staat hinaus zu treten.
4. Ernst-Wolfgang Böckenförde bringt – ich glaube nicht, dass das nur er persönlich ist, aber ich glaube sicherlich auch – einen kritischen Katholizismus in die Staats- und Gesellschaftstheorie der Bundesrepublik mit ein. Der Schlusssatz dieses Aufsatzes wird nicht häufig gelesen und zitiert, ist aber auch zitierenswert. Die Aufforderung, dass die Christen diesen Staat in seiner Weltlichkeit nicht länger als etwas Fremdes, ihrem Glauben Feindliches erkennen, sondern als Chance der Freiheit, die zu erhalten und zu realisieren auch ihre Aufgabe ist, wäre – so meine These – vom Protestantismus als der preußisch-deutschen Staatsreligion aus nicht möglich gewesen. Ein Protestant hätte so nicht schreiben können. Hintergrund dieser Formulierung und dieses Denkens ist (wenn man das historisch sieht) die Versöhnung einer katholischen Minderheit in Deutschland mit einem Staat, den sie als feindlich und säkularisierend erlebt hat – seit dem Kulturkampf nicht zuletzt.
Heute sieht das natürlich längst ganz anders aus. Heute ist auch der Protestantismus längst von seinem etatistischen Sockel gestürzt und die Aufforderung Böckenfördes, die ich gerade zitiert habe, das heißt den Staat in seiner Weltlichkeit nicht als etwas Fremdes und dem Glauben Feindliches zu erkennen, könnte man inzwischen insofern eher als einen Appell an den europäischen Islam und seine notwendige Selbstaufklärung lesen. In meinem zweiten Teil möchte ich drei Bemerkungen machen zur Aktualität des böckenfördeschen Diktums. Ich schließe hier gleich bei diesem letzen Problem an. Mein erster Punkt für die Diskussion der Aktualität wäre die Frage von Religion und Säkularität, Christentum und Islam. Die gesellschaftliche Säkularisierung, nicht nur die theologische oder institutionelle, ist seit den Sechzigerjahren, seitdem dieser Aufsatz geschrieben beziehungsweise diese Formulierung geprägt worden ist, noch einmal massiv fortgeschritten. Zugleich aber ist es auch eine nicht nachlassende, eher wieder zunehmende Präsenz (wir haben darauf schon angespielt) von Religion im öffentlichen Diskurs.
Ich meine, von ErnstWolfgang Böckenförde lernen, heißt weiterhin zu insistieren auf der Säkularität des Staates als der Bedingung der bürgerlichen Freiheit, aber andererseits auch den Bedarf nach denjenigen Sinnpotenzialen im politischen Raum zu erkennen, die durch die Säkularisierung aus diesem verdrängt worden sind. Dann ergibt sich eine neue Notwendigkeit, nach den »inneren Antrieben und Findungskräften, die der religiöse Glaube vermittelt«, zu fragen. Böckenförde wäre dann schon 1967 so etwas gewesen wie der Theoretiker der postsäkularen Gesellschaft »avant la lettre«.
Zweitens – und davon war bislang interessanterweise noch gar nicht die Rede – scheinen mir zwei Begriffe bei Böckenförde sehr wichtig: Sozialstaat und Demokratie. Der Satz Böckenfördes und der ganze Kontext und die ganze Argumentationsrichtung dieses Aufsatzes und anderer Schriften verweist – und das wird weniger häufig gesehen – ganz zentral auf Legitimationsfragen des Staates und die Rolle des »Staates der Daseinsvorsorge«. Diesen Begriff hat Ernst Forsthoff, ein berühmter Staatsrechtler in den Dreißigerjahren (1937, glaube ich), in der Zeit des Nationalsozialismus geprägt und hier liegen ja auch wichtige Wurzeln unseres sozialstaatlichen Denkens. Kann der Staat, so wird bei Böckenförde gefragt, dadurch stabilisiert werden, dass er zum »Erfüllungsgehilfen der eudämonistischen Lebenserwartung seiner Bürger wird«, zum Erfüllungsgehilfen des privaten Glückes also oder auch der Selbstverwirklichung? Daran hat Böckenförde Zweifel geäußert, die sich wie ein vorweggenommener Zweifel an der Selbstverwirklichungs-, Egound Spaßgesellschaft der Achtziger- und Neunzigerjahre und der Selbstbedienungsmentalität der Bürger am Staat lesen. Es gibt ja ein fundamentales Spannungsverhältnis, auch schon in der konservativen, der schmittschen Staatstheorie der späten Sechzigerund frühen Siebzigerjahre, aus deren Wurzeln Böckenförde selber in mancher Hinsicht kommt.
Einerseits wird der Staat gedacht (Forsthoff) als Versorgungs-, als Dienstleistungs-, als Sozialstaat und als Staat der Gesellschaftsplanung. Andererseits wurde gleichzeitig davor gewarnt, dass (berühmte Formulierung von Arnold Gehlen) »der Staat, der Leviathan, nicht zur Milchkuh werden dürfe«, der von den Bürgern nur sozusagen transfermäßig abgezapft wird. An dieses Dilemma mit seinen ganzen Problemen, die daran hängen, kann man sicherlich nicht umstandslos anknüpfen, aber ein ähnliches Dilemma prägt ja durchaus unsere gegenwärtigen Debatten über den Sozialstaat. Wenn Leistungsversprechen des Staates zurückgefahren werden, darf darunter die Stabilität der Demokratie/der freiheitlichen Ordnung nicht leiden. Das wollen wir jedenfalls nicht. Also müssen die Bürger dafür gewonnen werden, die Demokratie nicht nur oder nicht primär wegen ihrer sozialstaatlichen Versorgungsfunktion zu schätzen. Gleichzeitig, und das macht das Dilemma daran aus, bleibt die soziale Verpflichtung des Staates zu verteidigen.
Dritter und letzter Punkt der Aktualität ist natürlich die plurale Kultur und Wertebindung. Homogenität als Leitkultur? Ernst-Wolfgang Böckenförde erinnert in den und für die gegenwärtigen Kontroversen daran, dass es nicht Aufgabe des Staates sein kann, in einer pluralen und individualisierten Gesellschaft verbindliche Ideologiestiftung vorzunehmen. Der Staat gibt selber keine Kultur der Freiheit vor. Er produziert sie nicht als konkrete Handlungsanweisung für seine Bürger. Er muss sich vielmehr auf diejenigen Ressourcen des Zusammenhalts und der Freiheitsstiftung verlassen, die in der Gesellschaft selber generiert werden. Sonst droht der (Zitate aus dem Buch von Herrn Böckenförde selber) »Totalitätsanspruch«, die »verordnete Staatsideologie«, man könnte auch sagen: der rousseauistische Konformismus.
Doch zugleich gilt es eben diese Ressourcen im Blick zu halten. Sie kommen aus zwei Quellen (so scheint mir das zumindest bei Böckenförde gedacht zu sein): aus einer individualistischen und andererseits aus einer eher gesellschaftlichen Quelle. Aus der (ich greife wieder Ausdrücke von Böckenförde selber auf) »moralischen Substanz des Einzelnen« und aus der »Homogenität der Gesellschaft«.
Mit dem individualistischen Teil würden wir uns heute prinzipiell leichter tun als mit der gesellschaftlichen Homogenität, von der Böckenförde damals gesprochen hat, was nicht heißt, dass es leichter wäre, die moralische Substanz des Einzelnen im Sinne freiheitlicher Überzeugungen zu stärken.
Verbirgt sich hinter der zweiten, der gesellschaftlichen Quelle »Homogenität der Gesellschaften«, nicht sogar mehr als eine Leitkultur?, so möchte ich kritisch fragen. Unter einer Leitkultur könnte man ja einen Bezugsrahmen, einen demokratisch-zivilen, freiheitlichen Minimalkonsens pluraler Gesellschaft verstehen – in dieser weiter gehenden Vorstellung aber die Idee, die Einheit und die bindenden Kräfte noch fundamentaler, nämlich in der Struktur einer homogenisierten Gesellschaft, erzeugen zu wollen. Man muss auch dem Böckenförde von 1967 – erst recht nicht dem späteren – diese kritische Lesart geben. Das Problem aber bleibt, wie denn eine Gesellschaft die Voraussetzungen der Freiheit, eben über die moralische Substanz des Einzelnen hinaus, auch intersubjektiv klären und anerkennungsfähig machen kann. Vielleicht sollte man dann, und das wäre mein Vorschlag, doch über die Werte sprechen, obwohl Ernst-Wolfgang Böckenförde dem Rekurs auf die Werte (wir haben es vorhin schon gehört) sehr skeptisch gegenübersteht.
Müssen Werte an die »Skylla: Beliebigkeit des Subjektivismus der Tageswertungen« (das hatte Herr Preuss schon zitiert) einerseits, an die »Charybdis: Totalitarismus der Werte« andererseits führen? Ich glaube, es gibt andere, zum Beispiel eher aus angelsächsischen Traditionen argumentierende Strategien der Wertebegründung, an die man hier anknüpfen könnte.
Ernst-Wolfgang Böckenförde
Das ist ja eine etwas eigenartige Situation, wenn man an einer Diskussion teilnimmt, bei der über die Sinnhaftigkeit, Bedeutungsvielfalt oder auch Problematik eines Satzes diskutiert wird, der vor 37 Jahren geschrieben worden ist. Ich glaube, es ist dann immer gut, wenn man dem mal auf die Spur kommen will, was der Satz eigentlich besagt, die Entstehungssituation und den Kontext aufzusuchen.
Man sollte sich dabei aber doch im Klaren darüber sein, dass, wenn so ein Satz entsteht und seine Karriere macht, es dann natürlich so ist, dass das, was man eigentlich gesagt hat, erst der andere Tag sagt. Es ist unter Umständen mehr und auch etwas anderes, als das, was der Autor sich beim Schreiben dabei vorgestellt hat.
Nun aber zur Entstehungssituation des Satzes. Er steht in einem historischen (verfassungshistorischen) Beitrag über die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation (verfassungshistorisch und auch etwas theoriegeschichtlich) und er ist formuliert als diagnostischer Satz.
Er sagt, dass der Staat entstanden ist als Vorgang der Säkularisation, das heißt, er wurde zunehmend entlassen und emanzipierte sich aus kirchlich-geistlicher, christlicher Herrschaft und Bestimmung und wurde ein weltliches Gemeinwesen, das weltliche Aufgaben wahrnimmt und in der Religion nicht mehr seine Grundlage sieht. Anerkennung der Religionsfreiheit (der Freiheit zu glauben oder nicht zu glauben, den Glauben zu bekennen oder nicht, die Religion öffentlich auszuüben oder das nicht zu tun) als Freiheitsrecht, das war im Grunde der zentrale oder auch der Schlusspunkt seiner Verweltlichung. Dadurch entsteht dann die Frage, wenn der Staat dies tut und auf Religion als seine verbindliche Grundlage verzichtet, woraus lebt der Staat dann? Dies gilt ja nicht allein für die Religionsfreiheit, sondern die Freiheitsrechte des liberalen Staates beziehen sich ja auch auf die Kultur (die Kunst und die Wissenschaft). Alles dies ist in Freiheit gesetzt und von daher vom Staat nicht mehr zu regulieren, nicht mehr in bestimmter Weise verbindlich zu machen und anderes auszuschalten.
Die Frage, die dann eben entsteht, ist, woraus lebt ein freiheitlich geordnetes Gemeinwesen dann? Woraus erzielt es seine Kräfte? Es bedarf solcher Kräfte. Wie die Freiheit regulieren, wie ihr Impulse geben, wenn sie ausgeübt wird und wenn alles zusammen bestehen soll? Der Satz sagt dann ganz bewusst, »der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht garantieren kann«. Er sagt ja nicht – und da kommen die Deutungen und, aus meiner Sicht, zum Teil die Fehldeutungen zu Stande – der Staat kann dafür überhaupt nichts tun. Er sagt eher, der Staat kann das nicht garantieren. Er kann nicht mit seinen spezifischen Mitteln, das heißt hoheitlichen Anordnungen und gesetzlichem Gebot, irgendetwas zu garantieren versuchen, aber er kann natürlich etwas fördern, er kann etwas stützen und schützen. Insofern – das war auch damals schon die Intention – sollte es eine Problemanzeige sein.
Der Staat, der als freiheitlicher Staat – mit den Freiheitsrechten des Einzelnen – organisiert ist, ist jetzt sozusagen auf Kräfte angewiesen, die er seinerseits nicht garantieren und auch nicht aus sich heraus schaffen kann. Vorhandene Kräfte kann er aber stützen und auch schützen. Insofern kann der Staat sich dafür Raum geben und Bedingungen schaffen, dass sich das entwickeln kann, aber er ist daran gebunden, dass sich da etwas von selbst herstellt und erneuert. Ich glaube das deckt sich ja weithin mit der einen Deutung, die Herr Preuss – als seine eigene – gebracht hat.
Von mir aus hat dieser Satz eine Anzeigefunktion für das, was Herr Krasnodebski gesagt hat. Ja, inwieweit kann und soll der Staat neutral sein? Er kann ja gar nicht völlig inhaltslos sein und er kann eben nicht rein aus formalen Institutionen heraus leben, sondern er braucht Kräfte und Grundhaltungen, die ihn tragen
Jetzt komme ich auf den Satz mit der Homogenität. Man kann das Wort ja kaum noch in den Mund nehmen. Ich habe – damals noch nicht, aber später – von relativer Homogenität gesprochen. Damit meine ich gewisse gemeinsame Grundauffassungen, die Ausdruck einer Zusammengehörigkeit sind beziehungsweise, dass man sich in gewissen Dingen versteht oder auch einig ist. Man kann das Problem auch mit einem Wort von Adolf Arndt charakterisieren, der ja insofern ein unverdächtiger Zeuge ist. Er sagt: »Demokratie als System der Mehrheitsentscheidung setzt die Einigkeit über das Unabstimmbare voraus.« Niemand ist bereit, sich bei Dingen, die für ihn beste Überzeugungskraft haben, sozusagen niederstimmen zu lassen von einer Mehrheit. Also die Einigkeit über das Unabstimmbare – das würde ich sagen – zeigt das an, auch wenn man über relative Homogenität vernünftig diskutieren will.
Ja, jetzt noch eine konkrete Frage im Hinblick auch auf die Aktualität. – Da würde ich in der historischen Deutungsgeschichte erneut weitgehend Herrn Nolte zustimmen. Es war in der Tat eine Brückenfunktion für eine Vermittlung zwischen Rechts und Links in der Staatsauffassung oder Staatstheorie. Ich habe das ja selbst erlebt: Erinnern wir uns in Niedersachsen an die Kämpfe um die Konfessionsschulen. Das war in den Fünfzigerjahren und ging bis in die Sechzigerjahre hinein. Da kam immer die Begründung: »Der Staat, der ist ja nicht mehr ein christlicher Staat.« Das führte (stärker bei den Katholiken als bei den evangelischen Christen) zu einem Vorbehalt. Da war die Intention zu sagen: Der freiheitliche oder der weltliche Staat kann kein christlicher Staat sein und das kann man ja an der Religionsfreiheit festmachen. Denn ein Staat, der Religionsfreiheit gewährt, hat nicht die Religion als verbindliche Grundlage seiner Ordnung. Er hat die Möglichkeit von Religion, aber er garantiert nicht Religion. Das war auch der Impetus des letzten Satzes. Ihr, meine lieben Glaubensbrüder, jetzt seht doch mal zu, hängt nicht dem verlorenen Ideal eines christlichen Staates nach.
Für den katholischen Bereich: Die Staatslehre des katholischen Leo XIII. war ja damals noch aktuell und der Widerruf von Johannes Paul II. war noch nicht geschehen. Johannes Paul der II. hat ja alles implizit widerrufen, indem er den religiös-neutralen Staat anerkennt und sagt, das ist genau das, was von der Religionsfreiheit als Menschenrecht her gefordert und geboten ist, es bringt eine Versöhnung mit sich. Auf der anderen Seite hatte er auch eine Brückenfunktion in dem Sinne, dass auch Freiheiten möglich sind, aber auch an Bedingungen geknüpft sind und dass der Staat auch gewisse Aufgaben hat. Das war damals noch nicht aktualisiert. Ich finde, was in der Diskussion auch viel zu wenig betont worden ist, ist die Aufgabe der Schule und der Erziehung.
Wenn dies von gewissen Grundeinstellungen und Auffassungen abhängt und wenn Freiheit – was meine Auffassung ist – aus Fundamenten lebt, die ihr voraus liegen. Freiheit aktualisiert etwas, was der Einzelne an Überzeugungen, an Auffassungen, an Zielen in sich trägt und wozu er sich bekennt. Dann ist es eine Aufgabe, das zu aktivieren, lebendig zu erhalten und die Erziehungsaufgabe der Schule ernst zu nehmen. Nicht im Sinne einer Staatsideologie, sondern in dem Sinne, dass diese Kräfte – die Fundamente der Freiheit – lebendig gehalten werden und dass sie sich in den Generationen wieder erneuern. Man kann das auch noch etwas prinzipieller fassen und damit möchte ich dann schließen.
Wir haben ja allgemein so gerne die Auffassung (sie scheint heute ziemlich konveniert zu sein), dass wir alle »okay« sind. Wenn das so ist, dass wir alle »okay« sind, dann gehört bei der Erziehung ja nur noch dazu, das alles frei sich entwickeln zu lassen, und dann kommt das schon alles an sein gutes und richtiges Ziel. Wenn man aber die Auffassung hat (und der neige ich zu), dass der Mensch von Natur aus ambivalent ist: Er ist weder von Natur aus böse, noch von Natur aus gut, sondern er hat eine Ambivalenz in sich – beide Möglichkeiten –, dann kommt es für Erziehung (im Elternhaus, in der Schule) darauf an, die eine Möglichkeit zu fördern, zu stützen und zu entwickeln und die andere zurückzudrängen. Also nicht alles einfach nur sich selbst zu überlassen, weil es ohnehin schon »okay« ist! Wenn das so geschieht und die Erziehungsaufgabe so wahrgenommen wird, dann stellen sich auch die Grundlagen immer wieder her, die der freiheitliche Staat braucht, um als solcher – ohne seine Freiheitlichkeit aufgeben zu müssen – existieren zu können.
Das Widerständige des böckenfördeschen Diktums
Wahrheit und Sinn sind nicht dasselbe. Der Grundirrtum, dem alle speziellen metaphysischen Trugschlüsse nachgeordnet sind, besteht darin, den Sinn nach der Art der Wahrheit aufzufassen. Hannah Arendt, 1977 Auch wenn der Begriff der Menschenwürde aus christlichen Wurzeln heraus entstanden und geformt worden ist, erhält die unabdingbare Subjektstellung, auf welche die Würde abhebt, ein unterschiedliches konkretes Profil, je nachdem, ob der Mensch als Gemeinschaftswesen im Sinne des Aristoteles, als auf sich gestelltes Individuum, als imago dei im Sinne des christlichen Menschenbildes oder davon abgelöst verstanden wird. Ernst-Wolfgang Böckenförde, 2001 Die Politik Arendts als eine Antwort auf den modernen Nihilismus zu sehen, bedeutet ihren Hinweis, dass wir die Politik um der Welt willen brauchen, verstehen.
Bonnie Honig, 1991
Der Arendt-Preis, das Diktum und die Interventionen Böckenfördes: gute gegenseitige Beleuchtungen
Unsere Ausgangsthese: Die arendtsche Wiederbelebung eines emphatischen Politikverständnisses bildet einen vorzüglichen Hintergrund für die Erfassung der zentralen Aporie des Diktums der öffentlichen und denkerischen Interventionen Böckenfördes, zu denen eine spezifische Widerständigkeit gegenüber den übermächtigen Naturalisierungen und abstrakten Moralisierungen unserer geschichtlichen Welt gehört. Sie ist somit auch eine spezifische Resistenz gegenüber dem, was in unserer Zeit, prozesshaft und scheinbar nicht unterbrechbar, mit dem Anschein der Endgültigkeit in der Modernisierung und »Globalisierung« der Welt auftritt. Wo können wir nun die fragliche und spezifische Widerständigkeit im Diktum verorten? Sie tritt in der Widerständigkeit seiner spannungsgeladenen Aporie gegenüber allen Versuchen ihrer geschichtsphilosophischen oder funktionalistischen Auflösung auf. Das Diktum lässt gerade den »säkularisierten Staat«, den Sicherheitsgaranten moderner Gesellschaftlichkeit schlechthin, als das Produkt eines einzigartigen »Wagnisses« erscheinen. Unsere so »gewagte« politische Sicherungseinheit wird, in dieser Konstellation, durch keine noch so perfektionierte »Sicherheitspolitik« wagnisfreier. Das, was hier mit »um der Freiheit willen« charakterisiert wird, ist, genau besehen, nicht mehr eindeutig auf einen objektivierbaren Staatsinnenraum beziehbar. Das Politische unserer institutionalisierten modernen Einheitsformen erscheint als ein im klassischen, rationalistischen Sinn Unbegründbares. War es die eigentümlich ansprechende Spannung dieser Aporie, die dem Diktum die – in der Moderne seltene – Bedeutsamkeit eines Spruches verlieh? Auch wenn hier nicht auf das Spezifische der Widerständigkeit, die hier gegenüber dem Anspruch des politischen Begründungswissens im Spiel ist, länger eingegangen werden kann, ist es schon auf den ersten Blick deutlich: Es ist, im Unterschied zu den klassischen, ideologisch-politischen »Widerständigkeiten« weder an eine Fortschritts- noch an eine Verfallsgeschichte gebunden. Sie ist folglich weder »fortschrittlich« noch »konservativ« verortbar. Zur Parallele: Es ist schon seit einiger Zeit deutlich geworden, dass es innerhalb der neu belebten politischen Rationalismen der zweiten Nachkriegszeit lange Zeit unmöglich war, den »Ort« wahrzunehmen, von dem aus die Werke Hannah Arendts gedacht und geschrieben wurden. Da dieser »Ort« auf den geistesgeschichtlichen Karten zwar schon öfters aufgetaucht, aber noch bei weitem nicht richtig bekannt ist, kommt es noch immer zu absurden Topologien, in denen, zum Beispiel, es eine Arendt gibt, die aus einem »guten« (jüdischen) Ort heraus schreibt, und eine andere, die es aus einem weniger guten (deutschen) Ort heraus betreibt.
Politisierende Interventionen
Die Parallelsetzung der Widerständigkeit der Aporie und des »entgründeten« Politikverständnisses im Diktum mit der arendtschen Art des widerständigen Denkens und Verstehens muss zunächst als eine gewaltsame erscheinen. Kann sie durch relevante Züge im Werk und in den Interventionen Böckenfördes in etwa bestätigt werden? Gewiss: Das Denken und die Interventionen Böckenfördes kommen nicht mit der Fahne des Widerständigen und des radikalen Einspruchs einher. Es fällt aber nicht schwer, auf Interventionen und auf hochbedeutsame Einsprüche gegenüber von nach wie vor hegemonischen Verständnisweisen unserer politischen und geschichtlichen Wirklichkeit hinzuweisen, die bestimmte Parallelen nahe legen.
Wir sehen sie, zum Beispiel, im vielleicht wichtigsten Essay Böckenfördes der letzten Jahre, im: Der Wandel des Menschenbilds im Recht (2001). Zentral im Essay ist die Herausstellung eines spezifischen und symptomatischen Vergessens des Politischen in der durchgehenden Zentralität eines liberal-individualistischen »Menschenbildes« und Rechtsverständnisses. So wird, zeigt Böckenförde, in der zur Selbstverständlichkeit geronnenen Formel: »Der Mensch ist nicht für den Staat da, sondern der Staat für den Menschen« schlicht vergessen, »dass der Mensch auch für die politische Gemeinschaft da ist«. Dabei geht es Böckenförde nicht um die übliche »Überwindung« des Vergessens. Es ist ihm klar, dass es »zu nichts führt, religiöse oder philosophische
Begründungen normativer Menschenbilder« gegen dieses Vergessen (oder Vergessenwollen) heraufzubeschwören. Es geht ihm wohl eher um eine Arbeit gegen das »Vergessen des Vergessens« (um eine heideggersche Formel anzuwenden), gegen die schicksalsergebene Kollaboration mit demselben, in der auch der Sinn des Politischen zu schwinden droht. Die Parallelen mit der nichtinstrumentellen Art des arendtschen Verständnisses der antignostischen Widerständigkeit sind, meine ich, wahrnehmbar. Wir sehen sie auch in der breiter wahrgenommenen »resistenten« Intervention Böckenfördes zu der Neufassung des maßgeblichen Kommentars zum Grundgesetz. Er sieht in der besagten Neufassung eine verschleierte »Zäsur«, durch die, wie es im Titel seines diesbezüglichen Essays hieß, der Satz: »Die Würde des Menschen ist unantastbar« sich in Wahrheit zum Satz: »Die Würde des Menschen war unantastbar« wandelt. Die Neuinterpretation bringt, so stellt es Böckenförde heraus, eine neue Qualität des Abwägens in die Anwendungen des Satzes hinein, die den Prinzipiencharakter des Satzes radikal verändert.
Es gibt noch eine wesentliche Widerständigkeit im Denken Böckenfördes gegenüber einem fast selbstverständlich gewordenen Grundmuster unseres politischen und moralischen Handlungsverständnisses. Wie kaum ein anderer, auch in der politischen Öffentlichkeit auftretender Denker in Deutschland wendet er sich gegen das bequeme Falschspiel, das, Politik verdeckend, mit den Bezügen auf »Werte«, »Grundwerte« und »Wertegemeinschaften« getrieben wird. Bekanntlich sollten diese Bezüge als »übermaterielle« Supplemente der – auch als selbstverständlich vorausgesetzten – Individual- und Kollektiv-»Interessen« dienen. Sie sollten nicht bloß – wirklichkeitsfern – »gelten« (so wie sie ursprünglich in den Idealismusresten des Neokantianismus konzipiert worden sind). Sie sollten – in einer imaginären Paarformierung mit den »Interessen«, einen nobleren Zement für den konkreten Zusammenhalt der Gesellschaft oder der politischen Gemeinschaft bilden. Mit den Werten, so Böckenförde, postuliert man eine abgehobene Konsensform unserer politischen Einheiten, die »die Wirklichkeit unseres Lebens und Zusammenlebens verfehlt«. Das ideologisch-politisch Entscheidende dabei ist, dass die Sprache der Werte genau dort auftaucht, wo die geschichtliche, symbolische an das andere ansprechende Dimension unserer konfliktiven Zusammenhalte durch abstrakt-allgemeine Werte ersetzt werden sollte. Die Bedeutung dieser ungewohnten öffentlichen Hinterfragung der Selbstverständlichkeit, mit der durch die Gegensatzpaare: Interessen – Werte (d. h.: naturhaftes Sein – moralisch Gebietendes) die Gesamtheit der legitimen Gründe des politischen Handelns abgedeckt wird, kann leicht unterschätzt werden. Zwei kurze Beleuchtungen sollen sie besser herausheben. Es kann gezeigt werden, dass die implizite Sozialontologie dessen, was Böckenförde präzise die neokantianische »Auseinanderreißung von Sein und Sollen« benennt, das im emphatischen Sinn Politische im Vorhinein ausschließt. Zwischen den Determinismen des naturhaft Gesellschaftlichen, die in den biologistischen Vorstellungsweisen von »Evolution« oder von »System-Umwelt«-Totalisierungen vorherrschen, und des werthaft Normativen, das ein ambivalenzbereinigtes Gutes gleichsam garantierend repräsentiert, bleibt für symbolisch und ereignishaft übertragene, freiheitsbezogene und plurale Erfahrungs- und Handlungsräume einfach kein Platz. Die eigenständige Artikulierung dieser Hinterfragung erfolgt bei Böckenförde aus einem »Ort« heraus, der nicht in diesen Artikulierungen selber entstand. Er entstand vornehmlich in jener krisenhaften Konstellation der westlichen Erfahrungs- und Denkgeschichte der »mitteleuropäischen« Zwanzigerjahre. So hat ihre Relevanz allerdings ein bemerkenswertes Nachleben in den Versuchen, die Einbrüche des 20. Jahrhunderts als Unfälle zu buchen, die die Grundcharakteristiken der Geschichte nicht wesentlich tangieren. Wie es bekannt sein dürfte, hatte der arendtsche Widerstandsort heideggersche Grundzüge. Der von Böckenförde kam wohl in der Carl Schmitt’schen Neubelebung eines emphatischen und ereignisbezogenen Politikbegriffes zu Stande.
PS: Wir können hier nur mit einem Satz auf die Bedeutung der Art und Weise hinweisen, in der die Widerständigkeit Böckenfördes bei aktuellen politisch-geschichtlichen Fragen ins Spiel kommt. Seine Bremer Preisrede zum EU-Beitritt der Türkei – mit einem sonst kaum thematisierten politikgeschichtlichen Hintergrund – hat zu Recht Irritationen in jenem Meinungsspektrum ausgelöst, für die es eine Zumutung bedeutet, das Politische anders als unter funktionalistischen oder moralischen Perspektiven wahrzunehmen.
Ernst Wolfgang Böckenförde (†), Rechtsphilosoph; lebte im Breisgau
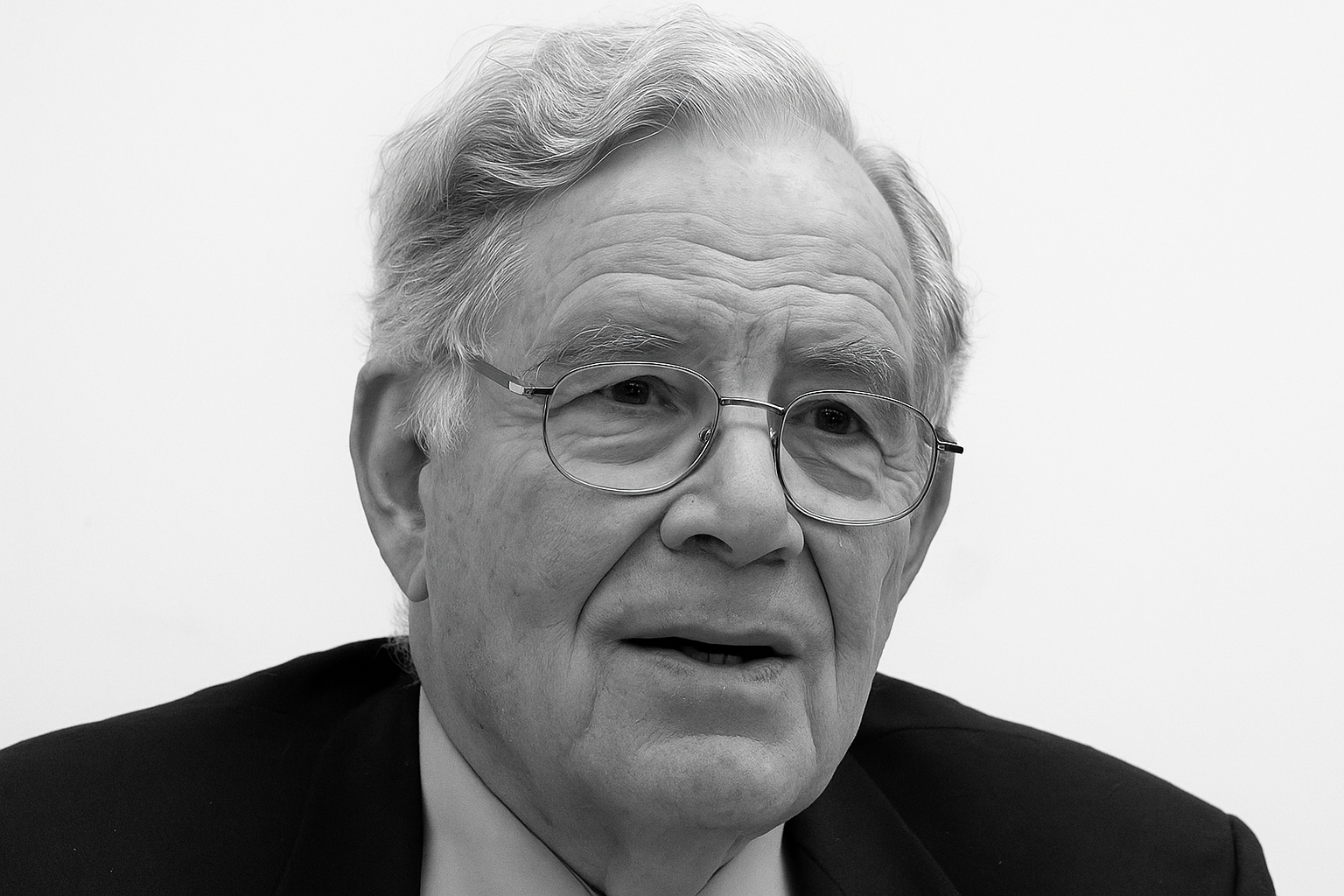
© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Ein erneuernder Konservativer?
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur diesjährigen Verleihung des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«. Ganz besonders heiße ich den Preisträger, Ernst-Wolfgang Böckenförde und seine Frau sowie die Gäste, die zu seiner Ehrung nach Bremen gekommen sind, willkommen. Unser jährliches Treffen zur Preisverleihung hat ja inzwischen Tradition. Wir blicken zurück auf eine ansehnliche Reihe von Preisträgerinnen und Preisträgern. Ágnes Heller (1995), François Furet (1996), Freimut Duve und Joachim Gauck (1997), Antje Vollmer und Claude Lefort (1998), Massimo Cacciari (1999), Jelena Bonner (2000), Ernst Vollrath und Daniel CohnBendit (2001), Gianni Vattimo (2002), Michael Ignatieff (2003). Lassen Sie mich ein kurzes Wort des Gedenkens an den in diesem Jahr verstorbenen Preisträger Ernst Vollrath einbringen. Er gehörte zu denen, die seit den Siebzigerjahren das Denken Arendts im Westen Deutschlands kenntlich gemacht haben, gegen viele Widerstände in den wissenschaftlichen Zünften. Seine Skepsis gegenüber säkularen Erlösungssehnsüchten hat ihm in den Siebzigerjahren den Ruf eingetragen, ein konservativer, das heißt bloß bewahrender Denker zu sein. Doch war er einer der wenigen, deren Denken immer um die Erneuerung der politischen Sphäre kreiste.
Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, sucht eine internationale Jury die jeweiligen Preisträger aus. Im Laufe der Jahre hat es sehr unterschiedliche Jury-Sitzungen gegeben, leichte und eindeutige, schwierige und kontroverse. Immer aber waren die Preisträger mit Themen verbunden. Manchmal hat ein Thema sich einen Preisträger gesucht, mitunter war es umgekehrt, dass erst über den Preisträger eine Idee erkennbar wurde. Doch selten haben ein Thema und ein Preisträger so selbstverständlich zueinander gefunden. Das Thema ist bei den Preisverleihungen der vergangenen Jahre immer wieder angespielt worden, ohne dass es so klar wie dieses Mal in Erscheinung getreten wäre: die Idee und die Geschichte einer immer wieder neu zu beginnenden Suche nach politischen, religiösen, moralischen, individuellen und kollektiven Sinnstiftungsmöglichkeiten im menschlichen Zusammenleben. Jedes Mal, wenn in der Vergangenheit verkündet wurde, der endgültige Sinn sei gefunden, erwies sich diese Verkündung als eine große Selbst-Täuschung, die zum Auseinanderbrechen der politisch verfassten Gesellschaften führte. Aus der Distanz können wir erkennen, dass Täuschungen zum Prozess der Suche hinzugehören und dass die Suche ein risikoreicher Weg ist. Vor dem Sturz in den Abgrund kann sich nur bewahren, wer fähig ist, die Täuschungen zu erkennen. Doch aus diesen Täuschungen zu schließen, dass die Suche beendet sei, wäre selbst eine Täuschung. Hannah Arendt hat aus dem Bruch der Tradition in der Mitte des 20. Jahrhunderts den Schluss gezogen, dass das Nachdenken über die Sinnhaftigkeit der Welt nicht festzuschreiben ist, dass es aber auch nicht grundlos ist. Seine Fundierung sah sie in den menschlichen Beziehungen, die durch Handeln und Sprechen, durch Denken und Urteilen gestiftet werden. Dieser Zusammenhang zwischen der aktuellen Debatte über »Europa und die Suche nach sich selbst« und dem uralten Thema der Stiftung von Sinnhaftigkeit im menschlichen Zusammenleben war es, der die Jury am Ende so sicher machte, in Ernst-Wolfgang Böckenförde den richtigen Träger des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken 2004« gefunden zu haben. Ernst-Wolfgang Böckenförde geht den Ideen nach, die in politischen Gemeinwesen wie in religiösen Gemeinschaften präsent sind, die zu Täuschungen werden können, aber auch unabdingbare Produktivkraft in politischen Sinnstiftungsprozessen sind. Herr Böckenförde ist Rechtsphilosoph und Rechtshistoriker. Nach seiner Promotion und Habilitation hat er von 1964 bis 1969 Rechtsphilosophie sowie Verfassungs- und Rechtsgeschichte an der Universität Heidelberg gelehrt. Er wurde später auf eine Professur für öffentliches Recht nach Bielefeld berufen und nahm schließlich 1977 den Ruf an die Juristische Fakultät in Freiburg im Breisgau an, wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1995 lehrte. Seit 1970 ist er Mitglied der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, von 1971 bis 1976 war er Mitglied der Enquetekommission Verfassungsreform des Deutschen Bundestages. 1983 wurde er in den Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts berufen und nahm diese Aufgabe bis 1996 wahr. Von seinen Werken nenne ich nur die jüngsten: die viel beachtete »Geschichte der Rechtsund Staatsphilosophie in der Antike und im Mittelalter« von 2002, die sich hervorragend auch für die Politikwissenschaft eignet, und die 2004 erschienene Aufsatzsammlung »Kirche und christlicher Glaube in den Herausforderungen der Zeit«, deren Themen bei dem Round Table-Gespräch heute Nachmittag eine Rolle gespielt haben. Etlichen von Ihnen ist Ernst-Wolfgang Böckenförde durch seine aktuellen Interventionen zu Fragen der Zeit bekannt, etwa zur Stellung des Individuums in unserem Rechtsverständnis oder zur religiösen Pluralität in säkularen Gesellschaften. Ihm geht der Ruf voraus, ein konservativer Denker zu sein. Diese Zuordnung scheint mir eigenartig quer zu stehen zu dem, was ErnstWolfgang Böckenförde antreibt, nämlich das Offenhalten und Erneuern der uralten Frage: Was bewirkt eigentlich, dass wir uns plural und sinnstiftend aufeinander beziehen können? Diese Frage wird seit Aristoteles immer wieder gestellt und es ist fast ein Wunder und auch wieder kein Zufall, dass sie in Zeiten der scheinbar vollständigen Säkularisierung und der Reduzierung des politischen Gemeinwesens auf die so unbefriedigende Dualität von Staat und Sozialverband immer wieder durchdringt. Von daher scheint mir Herr Böckenförde eher zu den Erneuerern als zu den Bewahrern zu gehören, aber wir wissen ja – und dies nicht erst seit Martin Heideggers Kritik an der geisteswissenschaftlichen Begrifflichkeit –, dass sich Begriffe von ihrem Gehalt lösen können. Vor diesem Hintergrund wäre denn Herr Böckenförde vielleicht als erneuernder Konservativer zu bezeichnen.
Wie immer wieder an dieser Stelle möchte ich den Geldgebern herzlich danken: der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bremer Senat, die Abende wie diesen ermöglichen. Großer Dank gilt natürlich auch der Jury und dem Kreis der Freunde und Mitstreiter – Lothar Probst, Peter Rüdel und Zoltán Szankay –, die den Preis mit neuen Ideen füttern und verhindern, dass dieser seine Sperrigkeit verliert: Die Jury hat entschieden, dass der Preisträger aus unterschiedlichen Perspektiven gewürdigt werden soll. Es gibt daher zwei Laudationes, eine von Tine Stein, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin, und die andere von Joachim Gauck, ehemals Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR und – zusammen mit Freimut Duve – Träger des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken« des Jahres 1997.
Ich bin nun der Fünfte, der sich in Reihenfolge an diesem Riesenaufriss von Ernst-Wolfgang Böckenförde abarbeiten will. Ich will es deshalb mal so machen: Erstens freue ich mich, dass es gelungen ist, in dieser Kombination so einen Preisträger auszugucken. Das war eine richtige Überraschung und das finde ich für beide Seiten erstaunlich und schön. Ich freue mich mit darüber. Als Zweites kann ich jeden Satz, den Ralf Fücks gesagt hat, unterstreichen. Das ist offenbar auch das Verdienst des Denkanstoßes unseres Preisträgers, dass so sehr unterschiedliche Leute wie der »Grüne« Ralf Fücks und der »brave Sozialdemokrat« Henning Scherf in einer großen Koalition gemeinsame Antworten finden. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich Sie so hörte – besonders Joachim Gauck, als er uns seine Biografie vorgetragen hat –, warum es mir anders als Ihnen geht. Also, mir geht es mit dem, was ich bei Ernst-Wolfgang Böckenförde höre, nicht so, dass ich auf meine Biografie zurückfalle, sondern mich fasziniert die Argumentationskraft des Juristen. Viele von Ihnen sind ja keine Juristen und halten Juristen eigentlich für eine anstrengende Spezies, die zwar nicht übersehen werden kann, aber die man eigentlich möglichst links oder rechts liegen lassen sollte oder, wenn überhaupt, als eine Art Techniker oder als Machttechniker ertragen muss. Sie lernen, finde ich und das habe ich eben auch bei diesem Vortrag gesehen, sie lernen, wie wir Juristen versuchen zu argumentieren. Das ist eine eigene Sorte von Umgang mit Ratio, Umgang mit Vernunft. Das ist ein Stück Säkularisierung, das ist auch ein Stück kultureller und zivilisatorischer Fortschritt. Diesen Vortrag eben – auf den ich genauso reagiert habe wie Ralf Fücks – habe ich erlebt wie ein Gutachten, früher, als ich noch Römisches Recht machen und argumentieren musste. Auf solch eine Art hat er das aufgebaut. Er sortiert seine Argumente und er sortiert auch die Argumente, die dagegen sprechen und kommt nicht gleich auf irgendeine machtpolitische Schlussfolgerung, bei der alles machtpolitisch plausibel oder nützlich wird. Das ist nicht nur intellektuell faszinierend, das ist auch grundlegend für Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft verlangt diese Form der Rationalisierung und diese Form des rationellen Umgangs mit Argumenten, auch mit anderen Argumenten. Wenn das aufgegeben wird oder würde und eigentlich nur noch polemisiert und Partei ergriffen wird und alle niedergemacht werden, die eine andere Meinung haben, dann geht Zivilgesellschaft kaputt, und dann geht auch die säkularisierte Gesellschaft und auch Vernunft kaputt. Wenn man sorgfältige Argumentation, die Betrachtung der anderen Seite eben nicht nur bei dem Verfassungsrechtler, sondern auch bei dem politischen Wissenschaftler findet – Ernst-Wolfgang Böckenförde ist ja ein großer Jurist, ein großer Verfassungsrechtler, ein großer Verfassungshistoriker und auf eben besondere Weise auch Politikwissenschaftler, aber immer mit dieser Sorgfalt der Argumentation –, dann ist das sehr befreiend. Wir haben uns nämlich alle darauf eingerichtet, eigentlich immer nur Machtfragen zu analysieren und diese immer nur auf ökonomische Interessenlagen zu reduzieren. Welches Interesse steckt hinter irgendeiner Entscheidung? Wenn man das weiß und das identifiziert hat, dann ist schon klar, woher die Entscheidung kommt. Das ist bei Ernst-Wolfgang Böckenförde ganz sorgfältig anders, und das ist entscheidend und wichtig. Das ist ein Stück unserer zivilisatorischen Entwicklung. Das ist ein Ergebnis der Aufklärung, das ist ein Ergebnis der Emanzipation. Und nun kommt er wieder und sagt zu uns, dass das auch das ist, was die Kirche betrieben hat, obwohl wir ja wissen, wie die Kirche darunter auch gelitten hat, als der Aufklärer den Theologen das Heft aus der Hand genommen hat. Die Säkularisierung ist das Ergebnis von theologischer Anstrengung, Reflexion und einem ernsthaften »Sich-Kümmern«. Das kann ich genau so sagen, da fühle ich mich aufgehoben und bin glücklich darüber, dass so eine Stimme so zentral in der Republik ist und so zentral von allen Seiten – auch wenn sie anstrengend ist und widersprüchlich sein mag – wahrgenommen wird. Ganz ausdrücklich bedanken möchte ich mich noch für diese ungewöhnliche Intervention in der »Kopftuchfrage«. Marie-Luise Beck und ich kämpfen da mit dem Rücken an der Wand. Wir haben – das können wir hier ruhig mal sagen – in unseren Parteien und überall inzwischen nur noch Abwehr gegen diese Lösung. Ich habe selber hier in Bremen grandios auf meinem SPD-Landesparteitag die erste fette Niederlage erlebt. Alle wollen mich hier halten in der Regierung, aber in dieser Frage bin ich so richtig niedergemacht und niedergestimmt worden und knabbere daran herum, aber ich will nicht aufgeben. Ich will nicht sagen: »Das ist jetzt erledigt«, sondern ich will mit dieser Argumentationshilfe überzeugen. Die müssen wir richtig nutzen. Wir müssen mit Ihnen »die Hans-Jochen Vogels« und »die Schilys« richtig in Verlegenheit bringen. Otto Schily kann man mit Ihnen richtig in Verlegenheit bringen. Das weiß ich, weil der Otto Schily ist ein kluger Jurist, und den kann man auch mit klugen juristischen verfassungsrechtlichen Argumentationen zur Nachdenklichkeit bringen. Ich finde, das ist ungewöhnlich und dafür danke ich Ihnen sehr, denn das wünsche ich mir auch, dass Religionsfreiheit natürlich für jeden gilt, und dass das nicht in einer Beliebigkeit endet – dass wir womöglich Angst haben vor Leuten, die zeigen, was sie glauben –, sondern dass das vielleicht eine Aufforderung wird, endlich rauszukommen aus der Beliebigkeit und dieser feigen »Wegduckerei«, die wir in den Kirchen übrigens ständig erleben. Das wissen Sie ja genauso wie ich auch. Überall wird so »weggeduckt«, weil sie Angst haben, dass sie in einer Minderheitsposition wahrgenommen werden und dann womöglich öffentlich lächerlich gemacht werden, deshalb sagen sie lieber gar nichts mehr. Grässlich, furchtbar, eine schreckliche Perspektive! Wenn wir wirklich alle zu Feiglingen werden und dann denen, die sich noch trauen, mit Polizeigewalt das noch verbieten. Also – Glückwunsch zu diesem ungewöhnlichen Preis. Diese Verleihung ist völlig anders als die des Guardini-Preises. Ich habe mir überlegt, wie das da in München war, als sich um Ernst-Wolfgang Böckenförde herum die CSU versammelt hatte und mit dem Kardinal zusammen darauf stolz war, dass nun ein so kluger Mann den Guardini-Preis kriegte. Das hier ist fast genau das Gegenteil davon, und das ist wunderbar. Es ist wunderbar, die Erfahrung zu machen, dass es Gestalten gibt – wie Ernst-Wolfgang Böckenförde –, die das in beiden unterschiedlichen Gesellschaften sagen können, frei und unverwechselbar sagen können. Das macht mich glücklich und ich bedanke mich besonders bei der Jury, dass sie auf diese grandiose Idee gekommen ist. – Ich hätte euch das nicht zugetraut.
Nach vielen klugen Worten möchte ich nur noch einige bescheidene Anmerkungen von meiner Seite und für die Heinrich-Böll-Stiftung machen. Die Jury hat auch in diesem Jahr die – immer mal wieder leise aufkommende – Befürchtung, dem Hannah-Arendt-Preis könnten die überzeugenden Preisträger ausgehen, auf eine eindrucksvolle Weise widerlegt. Ernst-Wolfgang Böckenförde ist zweifellos einer der markantesten politischen Denker unserer Republik, kein leichtfüßiger Meinungshändler im Talkshow-Format, sondern ein ebenso scharfsinniger wie unbequemer Kopf, der seinen Hörern und Lesern den Gebrauch des eigenen Verstandes abverlangt. – Ganz in der Tradition von Hannah Arendt. Ich erinnere an vier öffentliche Interventionen aus Ihrer Zeit, nachdem Sie aus dem Verfassungsgericht ausgeschieden waren. Es ist schon mehrfach auf Ihre Verteidigung der Religionsfreiheit und der aus ihr abgeleiteten Gleichberechtigung der religiösen Bekenntnisse hingewiesen worden. Ein Plädoyer gerade aus der Position des bekennenden Christenmenschen. Also nicht aus einer Haltung der Selbstabdankung der christlichen Kultur und Tradition, sondern gerade umgekehrt: als ein Zeichen Ihres Selbstbewusstseins, Ihrer Stärke und der Bedeutung, die die Menschenwürde – gerade in dieser christlichen Konzeption – hat und die sich eben auch beweist in dem Respekt und in der Anerkennung des Andersgläubigen. Man würde den deutschen Christdemokraten ein bisschen mehr von dieser Kombination von Liberalität und wertkonservativer Haltung, die Sie verkörpern, wünschen. Gerade wenn man an die aktuelle, fast hysterische Debatte über das angebliche Ende der multikulturellen und damit auch der multireligiösen Gesellschaft denkt. Ich erinnere als ein Zweites an Ihre Verteidigung der Geisteswissenschaften gegen eine kurzschlüssige Wissenschafts- und Hochschulpolitik, die die Geisteswissenschaften über den utilitaristischen Leisten schlägt und nur noch unter dem Kriterium ihrer ökonomischen Verwertbarkeit beurteilt – auch ein sehr aktuelles Thema. Ich erinnere an Ihren ebenso präzisen, wie donnernden Alarmruf gegen die relativierende Interpretation des Artikels 1 des Grundgesetzes, der unter dem Titel »Die Würde des Menschen war unantastbar« erschien. Auch dies ist keine akademische Frage, sondern eine höchst aktuelle in Zeiten der verwertenden Embryonenforschung oder des Überschreitens des Folterverbotes unter den Vorzeichen des Kampfes gegen den Terrorismus. Schließlich erinnere ich an Ihre mehrfachen Interventionen zu Fragen der Verfasstheit der Europäischen Union und der Zukunft der europäischen Demokratie, mit dem Ziel einer föderalen, europäisch-demokratischen Ordnung, die den Nationalstaat einerseits transzendiert und gleichzeitig sie zurückbindet an den Nationalstaat als eine Basis des politischen Lebens der Nationen in Europa. Das bringt mich natürlich unvermeidlich zu Ihrem Vortrag. Gestatten Sie mir als Referenz an diese Herausforderung ein paar kleine Bemerkungen. Es ist wohl wahr – und ich teile diese Analyse –, dass zwischen einer forcierten Erweiterungspolitik der Europäischen Union und dem proklamierten Ziel ihrer politischen Vertiefungen kein Harmonieverhältnis besteht, sondern ein Spannungsverhältnis und ab einem bestimmten Punkt sogar ein Konfliktverhältnis. Ich bin aber überzeugt, dass diese Frage sich zwar besonders scharf am Bespiel der Türkei stellt – genau aus den Gründen, die Sie genannt haben –, aber nicht exklusiv an der Türkei. Wenn man die Erweiterungsdynamik der Europäischen Union auf jetzt 25 Mitglieder vor Augen hat – mit Rumänien und Bulgarien an der Schwelle des Beitrittes und den Staaten des südlichen Balkan und Kroatien als nächstem Staat –, dann haben wir unschwer bald eine Europäische Union der 32 oder auch 33 Mitglieder vor Augen – auch ohne die Türkei. Mit welchem politisch-moralischen und historischen Recht wollten wir einer demokratischen Ukraine den Beitritt in die Europäische Union verweigern, nachdem wir zumindest sehr ernsthaft die Frage des Bei trittes der Türkei zur Europäischen Union aufgeworfen haben? Gerade erleben wir nämlich einen dieser seltenen historischen Momente, in dem die Kontinuität der Machtverhältnisse durchbrochen wird und die Bürgergesellschaft als politisches Subjekt auf den Plan tritt. Es geht ja um viel mehr als um einen Machtkampf zwischen zwei Kandidaten, die beide aus – sagen wir mal – der kommunistischen Tradition und ihren Parteien kommen, sondern es geht tatsächlich um den Konflikt zwischen einer erwachten selbstbewussten Zivilgesellschaft und dem krypto-sowjetischen Machtsystem. Es geht um die Fortsetzung dieser langen Welle der Demokratisierungen, die 1989 in der DDR, in Polen, in Tschechien und in Ungarn erfolgreich war und sich dann mit dem Sturz von Milosevic und vor fast genau vor einem Jahr in Georgien fortgesetzt hat. Diese Entwicklung braucht unsere ganze Sympathie und sie ist auch ein Prüfstein dafür, wie ernst es die Europäische Union mit ihren eigenen demokratischen Prinzipien nimmt, und dass sie nicht bereit ist, ihre demokratischen Grundsätze auf dem Altar der strategischen Partnerschaft mit Russlands Putin oder Putins Russland zu opfern. Also – das Problem, auf das Sie hingewiesen haben, dass eine forcierte Expansion der Europäischen Union möglicherweise ihre Fähigkeit, zu politischer Integration und die dafür notwendige (nicht nur formale) Kohäsion, sondern auch einen Zusammenhalt, der auf gemeinsamen Werten und gemeinsamen Orientierungen beruht, untergräbt, das ist wohl gegeben. Es war mir aber ein Schuss zu viel und ein bisschen zuviel Fatalismus in dieser Analyse. Ich setze doch stärker auf das Zutrauen auf die Reformfähigkeit der Europäischen Union und auf ihre Fähigkeit sich auf immer neue Herausforderungen immer neu einzustellen und sich immer neu selbst zu erfinden, und ich setze auf die Anziehungskraft der europäischen Demokratie und des europäischen Gesellschaftsmodells einer freiheitlich-sozialen Lebensform. Ich glaube Sie haben Recht, es wird am Ende zu einer Art engeren und weiteren Union kommen – mit oder ohne Beitritt der Türkei. Es wird zu einer stärkeren inneren Differenzierung kommen, aber nicht zu einer scharfen Abgrenzung dieser inneren und äußeren Union, sondern zu ganz differenzierten Niveaus von Zusammenarbeit und Integration; hoffentlich nicht in Form eines fest abgegrenzten Kerneuropas, dem ein Randeuropa gegenübersteht, sondern als ein offenes und flexibles System der Zusammenarbeit. Das – ganz am Ende – geopolitische Argument, dem Sie zu Recht einen zentralen Stellenwert gegeben haben, das ist, glaube ich, am Ende ein sehr schwerwiegendes Pro-Argument. Die Vorstellung der Europäischen Union als einer politischen Ordnungsmacht, die eine pro-aktive Stabilitätspolitik gegenüber ihren krisenhaften Nachbarregionen im Kaukasus, in Zentralasien und im Vorderen und Mittleren Orient betreibt, das ist sicher eine sehr andere Europäische Union als die der letzten zwanzig, dreißig Jahre. Ich halte aber die politische Herausforderung für ganz entscheidend, vor allem mit Blick auf die Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit der islamischen Welt. Ich setzte zudem darauf, dass die Europäische Union diese stabilisierende Funktion weniger durch die Macht ihrer Waffen als durch die Anziehungskraft ihrer demokratisch-politischen Kultur und auch durch die Magnetkraft ihres Binnenmarktes wird wahrnehmen können. Man kann, glaube ich, mit guten Gründen für den Beitritt der Türkei in die Europäische Union sein, aber man muss wissen, welche Probleme und welche Herausforderungen man sich damit an Bord holt und, dass man dafür einen Preis wird bezahlen müssen (nicht nur einen ökonomischen). In diesem Sinne fand ich Ihren Vortrag eine wunderbare Herausforderung. Herzlichen Dank. Ich verbinde den Glückwunsch an den Preisträger mit dem Glückwunsch an die Jury und einem Dankeschön für das – im besten Sinne – ehrenamtliche Engagement, mit dem sie diesen Preis nicht nur aus der Taufe gehoben, sondern groß gemacht hat.
Religions- und Gewissensfreiheit als zwingendes Recht
In Ernst-Wolfgang Böckenförde ehren wir mit dem HannahArendt-Preis für politisches Denken 2004 einen Gelehrten, einen politisch wirkmächtigen Intellektuellen und einen Bürger, der eines der höchsten republikanischen Ämter innehatte. Sein Amtsverständnis war von einem besonderen Ethos getragen. Böckenförde versteht es, in einer dialektischen Überlegung einerseits weltliche Rechtsordnung und göttliche Ordnung klar zu unterscheiden, andererseits den inhärenten Zusammenhang von Politik und Religion aufzuweisen. Darin liegt das große intellektuelle und vor allem auch politische Verdienst Ernst-Wolfgang Böckenfördes. Denn dies enthält eine Antwort auf die immer drängende und gegenwärtig besonders virulente Frage, wie das friedliche Zusammenleben in einer Gesellschaft gelingen kann, in der religiöse und säkulare Wahrheitsansprüche, ja, selbst die Negation eines Wahrheitsanspruchs, miteinander konkurrieren. Ernst-Wolfgang Böckenförde beschreibt in dem Aufsatz »Als Christ im Amt des Verfassungsrichters«, warum er bei der Vereidigung zum Bundesverfassungsrichter den Eid mit der religiösen Beteuerung abgeleistet hat – im Unterschied zu vorangegangenen Gelegenheiten. Während für den Normalfall des bürgerlichen Lebens die allzu häufige öffentliche Bezugnahme auf Gott ihm wohl weder als Christ noch als Bürger geboten erschien, so wollte er doch für die Amtsführung des Richters die innersten Bindungskräfte, die das Anrufen des göttlichen Beistands zu mobilisieren vermag, erbitten – wofür? Dafür, dass er sich als Richter allein auf die positive Rechtsordnung stützen möge und dem Prinzip der weltanschaulich-religiösen Neutralität gemäß die Rechtsprechung in höchstem Maße professionell auszuüben in der Lage sein werde – und das heißt: in Absehung persönlicher politischer und religiöser Überzeugungen. Die Bindungen und Verpflichtungen, denen der Verfassungsrichter sich zu fügen hat, sind die dieses spezifischen Amtes, nicht aber solche, denen die Person, welche das Richteramt bekleidet, in anderen Bezügen unterliegt, seien es jene, die aus einer Parteizugehörigkeit oder jene, die aus einer Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft resultieren. Es ist dieses Amtsverständnis, für das Böckenförde den Amtseid mit religiöser Bekräftigung geleistet hat, damit das Vertrauen, welches in der Verfassungsordnung dem Verfassungsrichteramt entgegenzubringen ist, nicht ge- und enttäuscht wird. Die Tatsache, dass die Richter in vielen genuin politischen Konflikten das letzte Wort haben, erfordert eine besondere Skrupulösität in der Interpretation der Verfassung, die in ihren Begründungen sich frei von religiös-metaphysischen Erwägungen halten muss. Das stellt an einen Richter, der als Person an die Wahrheit der geschichtlichen Gottesoffenbarung glaubt und der als Gelehrter ein sensibler Kenner der christlichen Rechtstheologie, insbesondere des thomistischen Naturrechts, ist – so möchte man in Böckenfördes Fall hinzufügen – eine besondere Anforderung. Das Dialektische ist nun, dass Ernst-Wolfgang Böckenförde zu diesem deutlichen – und wohl mitunter manche der konfessionellen Glaubensgeschwister wie politischen Freunde etwas enttäuscht habenden – Rollenverständnis nicht allein aus der eingehenden historischen Analyse der »Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation« gelangt; nicht allein aus der für den Juristen typischen Wertschätzung des positiven Rechts, das in der Lage ist, gerade weil es neutral gegenüber der Religion ist, Frieden und Sicherheit zu schaffen. Nein, Böckenförde kommt auch aus einer religiös motivierten Perspektive zu diesem Rollenverständnis. Denn nur wenn im Staat die Trennlinie zwischen der religiösen Sphäre und dem Regelungsbereich des Staates eingehalten wird, kann sich die Religions- und Gewissensfreiheit entfalten. Diese Freiheit ist eben nicht eine bloße Duldung gegenüber einer Abweichung, nicht eine Haltung der Toleranz der Mehrheit gegenüber der Minderheit oder gegenüber einem vom irrenden Gewissen fehlgeleiteten Glauben, wie es in den päpstlichen Stellungnahmen bis in die Fünfzigerjahre hinein zu lesen war. Sondern die Religions- und Gewissensfreiheit ist zwingendes Recht der Person, unabhängig vom jeweiligen Glaubensinhalt. Dies folgt für Böckenförde aus der theologisch begründeten Erkenntnis, dass der Glaube nur in Freiheit angenommen werden kann. Böckenförde hat mit sehr deutlichen Worten kritisiert, dass die Katholische Kirche eine unfassbar lange Zeit gebraucht hat, bis zum Zweiten Vatikanum nämlich, um zu dieser Wahrheit des Evangeliums durchzustoßen: dass die Wahrheit der Offenbarung verlangt, der Mensch möge sich in Freiheit zu ihr bekennen. Das umschließt notwendig die Möglichkeit, zu Gott nein sagen zu können. In den Schriften des Alten und Neuen Testaments wird der Mensch als mit einem Gewissen begabte sittliche Person vorgestellt. Das ist für die moderne Geschichte der Freiheit von ausschlaggebender Bedeutung. »Civis simul et christianus« – als Bürger und als Christ gelangt Böckenförde zu der Überzeugung, dass im religiös-weltanschaulich neutralen Staat es die Religionsfreiheit gebietet, ein Amt so auszuüben, wie es der säkularen Verfassungsordnung entspricht, und auf dieses Amtsverständnis hat er den Eid mit religiöser Beteuerung geleistet. Für Ernst-Wolfgang Böckenförde ist also die Trennung von politisch gesetzter Rechtsordnung und geoffenbarter Wahrheit als Quelle religiöser und ethischer Normen grundlegend. Die Rechtsordnung des freiheitlichen Verfassungsstaates verlangt Rechtstreue, aber nicht ein Bekenntnis innerer Loyalität, wie es das Bundesverfassungsgericht im Fall der Zeugen Jehovas unterstrichen hat. Das Gericht lässt es sich übrigens in diesem Zusammenhang der Frage von Staat und Religionsgemeinschaft auch nicht nehmen, an den berühmten Satz Böckenfördes zu erinnern, indem es festhält: »Dass sie (die Religionsgemeinschaften) ihre Tätigkeit frei von staatlicher Bevormundung und Einflussnahme entfalten können, schafft die Voraussetzung und den Rahmen, in dem die Religionsgemeinschaften das Ihre zu den Grundlagen von Staat und Gesellschaft beitragen können.« (BVerfGE 102, 370 ff [394] – als Literatur wird auf den Aufsatz zur Entstehung des Staates verwiesen.) Vor der Erwartung einer loyalen Gesinnung schützt die in Artikel 4 des Grundgesetzes verbürgte Religions- und Gewissensfreiheit. Kein Fürst dieser Welt kann für sich die metaphysische Legitimation in Anspruch nehmen, hier auf Erden letzte Gerechtigkeit zu versprechen – ob er sich nun als Repräsentant Gottes oder einer höheren Wahrheit versteht oder diese gar selbst zu verkörpern meint. Wohin solches Ansinnen führt, darüber unterrichtet die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Ost und West zur Genüge. (Und es bleibt deprimierend, dass ausgerechnet Carl Schmitt als einer der Klassiker des politischen und rechtlichen Denkens des vergangenen Jahrhunderts, der – obwohl er vom Menschen als einem »geistlich-weltlichen, spiritual-temporalen Doppelwesen« gesprochen hat – für die irdische Existenz der Menschen diese zu einer identitären politischen Einheit im Staat bringen wollte.)
Wenn also demgegenüber im religiös-weltanschaulich neutralen Staat der Verfügungsanspruch über die Bürger prinzipiell auf deren äußere Handlungen beschränkt ist, so ist zugleich darüber zu sprechen, woraus denn die Bürger die innerlichen Antriebsund Bindungskräfte beziehen, die zu jenem Minimum an ethischer Tugendhaftigkeit und wechselseitiger Solidarität führen, ohne die der Verfassungsstaat, der eben kein »Leviathan«, sondern freiheitlicher Staat ist, nicht funktionieren kann. Dass es allein die nackte Anerkennung und Ausübung der verfassungsmäßig garantierten Rechte eines jeden und die dort verankerten demokratischen Verfahrensweisen sind, die aus einer Gesellschaft von Fremden die zumutungsreiche Rechtsgemeinschaft machen, eine Gemeinschaft also, in der die Rechtsgenossen nicht nur um ihr eigenes Wohl, sondern auch um das der anderen und der Gesamtheit besorgt sind, das ist eine aus liberaler Sicht vielleicht für manche sympathische Hoffnung, aber letztlich eine weder theoretisch besonders plausible noch historisch gut belegte Vermutung. Auch die »Anrufung« einer dem Grundgesetz vermeintlich inhärenten Wertordnung kann dem positiven Recht nicht einen Mehrwert an Überzeugungskraft und Verbindlichkeit erbringen, wie Ernst-Wolfgang Böckenförde in seiner luziden Kritik der Wertordnungslehre klargestellt hat. Interessant ist nun gerade, dass Böckenförde die Frage nach dem »einigenden Band«, das der Gewährleistung der Freiheit des Einzelnen vorausliegt, nicht mit den gemeinsamen Wertüberzeugungen der Glaubensanhänger des Christentums zu einer Antwort kurzschließt. So einfach ist es nicht, wie manche Vertreter der politischen Klasse in diesen Tagen zu meinen scheinen, dass es bei der Integration des Staates bloß darauf ankomme, wahlweise a) die Liebe zum Vaterland in den Stundenplan der Öffentlichkeit neu aufzunehmen oder b) eine immerhin nominell noch zählbare christliche Mehrheit durch einen leitkulturellen Artenschutz zu privilegieren und womöglich zu fordern, dass im Lichte dieser Leitkultur dann auch die Rechte Anders- und Nichtgläubiger auszulegen seien. Die Position Böckenfördes im Kopftuchstreit ist diesbezüglich im Übrigen eindeutig: Aus dem Prinzip der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates folgt auch das Gebot der Gleichbehandlung. Entweder die symbolischen Zeichen des individuellen Glaubens sind für alle Religionsgemeinschaften gleichermaßen zulässig oder aber für alle gleichermaßen verboten, gleichviel ob Kopftuch, Kreuz oder Kippa. Das Bundesland Berlin hat sich für Letzteres entschieden und den französischen Weg eingeschlagen. Gewiss: Exklusiv-Rechte kann es für die Mehrheitsreligion nicht geben. Aber sichtbar sein in ihrer Religiosität – das sollen die Bürger, die es wollen, auch sein können, ob nun Anhänger des mehrheitlich vorherrschenden Glaubens oder der Minderheit. Im Unterschied zum französischen Modell des Laizismus, das dieser Tage durch den Präsidentschaftsbewerber Sarkozy kritisch hinterfragt wird, ist der deutsche Weg der offenen Neutralität ein anderer, worauf Böckenförde mit großer Geduld bei zahllosen Gelegenheiten immer wieder aufmerksam gemacht hat: Der Öffentlichkeitsanspruch, der für Religionen wie das Christentum und den Islam typisch ist, wird nicht aus der politisch-öffentlichen Sphäre in das Reich des Privaten verbannt.
Hat Böckenförde nun aber eine andere ungleiche Bewertung eingebracht, nämlich eine hinsichtlich religiöser und nicht-religiöser Bürger? Hat er gesagt, dass nur der ein guter Bürger für den demokratischen Verfassungsstaat sein kann, für den das Ereignis der geschichtlichen Gottesoffenbarung eine Glaubensgewissheit ist, noch kürzer gesagt: dass nur derjenige über Moral, Sittlichkeit und Ethos verfügt, der diese aus transzendenten Quellen speist? Eine solche Exklusivitätsbehauptung ist nicht zu finden, ja, sie wird auch nicht insinuiert. Das würde die Stoßrichtung der Argumentation verkennen: Es geht Ernst-Wolfgang Böckenförde nicht darum, die gläubigen Bürger besonders zu adeln, sondern sie aufzufordern, sich zu fragen, was sie über die Rechtstreue hinaus einbringen können. Das ist keine Forderung, die von staatlichen Organen an die Bürger ergehen kann, aber umso
wichtiger ist es, auf Grund der »Freigabe des Ethos« der Einzelnen diese in dem Dauerdiskurs der Öffentlichkeit auch an ihre Verantwortung für das Gelingen der freiheitlichen Ordnung zu erinnern. Im Kontext vor annähernd vierzig Jahren, als der berühmte Satz, nach welchem der freiheitliche säkularisierte Verfassungsstaat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann, das erste Mal, authentisch vom Autor selbst, in der Öffentlichkeit ausgesprochen wurde, ging es darum, die Christen aufzufordern, den säkularen Staat nicht als Feindesland zu begreifen. Heute sind die Probleme andere. Der Aufruf zur Einmischung, als der einzigen Möglichkeit realistisch zu bleiben, wie man mit Heinrich Böll ergänzen möchte, wäre heute anderen Charakters. Es geht darum, die in den religiösen Wahrheiten aufgehobenen Erkenntnisse in einer Weise in das politische Räsonnement einzubringen, die auch für den religiös Unmusikalischen eine Bereicherung darstellen kann. Jürgen Habermas hat in seiner Rede »Glauben und Wissen« hierfür den Begriff des Übersetzens vorgeschlagen. Und das hat Ernst-Wolfgang Böckenförde wahrlich ein ganzes reiches Gelehrtenleben lang getan. Seine Beiträge zur politisch-theologischen Verfassungsgeschichte, die nun in dem Band Kirche und christlicher Glaube in den Herausforderungen der Zeit versammelt sind, geben davon ein beredtes Zeugnis ab. Insbesondere hat er immer wieder eindringlich den Elementarbegriff der Menschenwürde herausgestellt. So wie die Souveränität des Volkes sich historisch nicht ohne die Vorstellung von Gottes Allmacht ausgebildet hat, so ist die Entwicklung der Unbedingtheit der Menschenwürde nicht ohne die in den biblischen Erzählungen bewahrte und theologisch begründete Idee der Gottebenbildlichkeit denkbar. Gewiss, die Menschenwürde lässt sich begründen ohne theologische Metaphysik, und einer im System des positiven Rechts verbleibende Verfassungsinterpretation des Artikels 1 Grundgesetz durch das Bundesverfassungsgericht muss
dies auch gelingen. Aber wie arm wäre unsere geistige Auseinandersetzung über die normativen Grundlagen unserer Rechtsordnung, wenn nicht auch die religiös inspirierten Begründungen in den wissenschaftlichen und öffentlichen Foren diskutiert würden. Warum auch sollte sich eine Gesellschaft von diesem Teil ihrer Herkunftsbedingungen gewissermaßen abschneiden, die doch ansonsten ganz auf die Pluralität der Sichtweisen im öffentlichen Ringen um das Gemeinwohl setzt? Mit der Menschenwürdegarantie ist ein meta-positives Prinzip positiviert worden, mit dem, wie es Böckenförde gesagt hat, ein »Anker« ausgeworfen, ein »Pfeiler im Strom des fließenden Verfassungsdiskurses« gesetzt wird. Gilt dies aber auch dann noch, wenn die Mehrheit der juristischen Kommentare diese Interpretation nicht mehr teilen sollte – weder die Auffassung, dass es sich um ein meta-positives Prinzip handelt, noch die der Unbedingtheit der Menschenwürde? Es mag dann noch auf dem Papier des Grundgesetzes der Satz stehen: »Die Würde des Menschen ist unantastbar«, es mag noch die Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 Grundgesetz suggerieren, eine Änderung habe nicht stattgefunden. Aber es würde sich dann doch wahrscheinlich bald um eine andere rechtliche Grundordnung handeln, in der die Idee der Gottebenbildlichkeit nicht länger eine gelungene säkulare Übersetzung in das Prinzip der unbedingten Menschenwürde findet. Ernst-Wolfgang Böckenförde hat uns das begriffliche und argumentative Instrumentarium an die Hand gegeben, diesen Wandel in aller Schärfe zu erkennen und ihn zu kritisieren.
Welche Art von Neutralität wollen wir?
Wie war das mit dem berühmten Böckenförde-Satz, der im Zentrum meiner Annäherung steht, die ich – ein Nicht-Jurist und Nicht-Politikwissenschaftler – als Bürger versuchen werde zu betrachten? Ich will ihn noch einmal zitieren: »Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert.« Was habe ich gesagt? Eine Annäherung soll es sein, die Anreise eines Bürgers auf diesen Boden, der mit einem solchen Wort beschrieben ist. Es ist eine Annäherung an eine Person, die mich als Christ und Bürger fasziniert. Es ist auch eine Annäherung an einen Gelehrten, aber in jedem Fall an eine Person, die ganz Ja sagen kann zum säkularen Staat, obwohl sie sich erkennbar letztlich aus ganz anderen Quellen geformt hat. Einst, als ich im dunklen Osten lebte, wollte ich nicht sein wie die, die den Raum beherrschten. Noch im Krieg geboren, war ich zu klein, um von den damaligen Diktatoren verführt zu werden. Größer geworden, trat neues Unrecht so dicht an mich – den Heranwachsenden – heran, dass, wenn man sich nicht aufgeben und mit den »Wölfen heulen« wollte, ein Fluchtpunkt gefunden werden musste, der dem örtlich Bleibenden eine geistige Heimat anderswo anbot.
Ich glaube nicht, dass mich die spärlichen protestantischen Traditionen meines Elternhauses, meiner Familie zu einem Glaubenden hätten machen können, aber die Nähe des Unrechts und der Ungerechtigkeit sehr wohl. Es war das öffentliche Unrecht, dass sich in der Binnenwelt des Jungen ein freiheitshungriges und gerechtigkeitssüchtiges Ich erschuf, das mit dem Unwesen nun zu ringen begann. In solchen Situationen entdeckt man gleich gesinnte Suchende und wappnet sich mit einer Rüstung, die einem niemand nehmen kann, nämlich mit der besseren Moral des Unterdrückten.
Über die nach innen wirkende Bedrohlichkeit dieser Rüstung wird man sich erst später klar werden. Zunächst einmal ist sie nur rettend. Der mächtige Außenfeind vermag sie vorerst nicht zu überwinden. Selbst viele faktisch Unterworfene führen eine eiserne Ration der besseren Moral mit sich. Sie geben den Tyrannen nur portionenweise Loyalität. Sie wissen, gäben sie dem Tyrannen alles, verlören sie sich selber. Ihnen eignet zwar nicht mehr die Würde eines Bürgers, da sie nur Staatsinsassen sind, aber in dem Maße, in dem sie selbst und andere um sie herum entwürdigt und entrechtet werden, kompensieren sie den Verlust durch das Anlegen eines inneren Kapitals. Sie jedenfalls wissen um ihre Würde, sie jedenfalls glauben an die Gerechtigkeit. Diese Haltung ist für die meisten Staatsbürger nicht von Dauer. Die Erwachsenen unterliegen Zwängen, die das Leben schafft. Man will verdienen, man will seinen Platz im Leben finden. In dieser Phase tauschen dann viele ihre moralische Sicherheit gegen eine Lebens- und Alltagssicherheit. Die Unterdrücker haben bei ihrem Tun, der Menschenüberwältigung, ja einen mächtigen Verbündeten, aber einen anderen, als wir vermuten. Es ist die Ratio. Die Staatsinsassen lernen: Eigentlich ist es unvernünftig, sich auf eine innere Reserve und auf Gegenwelten zu verlassen, die Teilhabe ausschließen. Heilige, Widerständler, Rebellen und Märtyrer werden mit ihrer Moral selig. Die Massen aber nehmen widerwillig oder gehorsam die Betriebsmoral der Organisatoren des sozialen Umfeldes an, und erlangen sie Partizipation auch nur um den Preis der Unterwerfung, so werden sie doch – und das ist der Gewinn – ein Teil der Mehrheitskultur, die sich ja auch längst darüber verständigt hat, dass man der normativen Kraft des Faktischen nicht entgehen kann.
Je durchherrschter nun und je langlebiger eine derartige Situation ist, desto mehr existieren intellektuelle und ideologische Verbrämungssysteme. Sie beruhigen, indem sie das Ungereimte reimen – so jedenfalls würde Wolf Biermann die Tätigkeit nennen. Mochte man einst ja an eine zur Person gehörende Fähigkeit der Unterscheidung von Gut und Böse geglaubt haben, so war man aber in Vereinzelung und Hilflosigkeit und Einflusslosigkeit angekommen. War es demnach nicht klüger, darauf zu setzen, dass das Gemeinwesen aus sich heraus die Normen setzen, die Moral erschaffen solle? – Geschieht dies aber, so werden nicht nur Facetten einer Betriebsmoral gestaltet, sondern die ganze Rechtsordnung, die Philosophie, alles wird vom Geist der Zeit in Besitz genommen. Nun durften wir erleben, dass diese Politikwelten endlich waren. Die zahllosen so genannten Philosophen und sonstige Ideologen – auch die elenden Panegyriker –, die es in Massen gab, konnten dem totalitären Herrschaftssystem nicht das ewige Leben verschaffen. Václav Havel und die anderen behaupteten, man müsse nicht mit der Lüge leben, weil er auch lehrte, dass die Macht der Mächtigen von der Ohnmacht der Ohnmächtigen käme. Ich übergehe die so irdische wie wunderbare Revolutionszeit und lenke nur unseren Blick auf das erstaunliche Phänomen, dass nach einer unendlich langen Gewöhnung an den Status eines Staatsinsassen nunmehr der Bürger auf der politischen Ebene erscheint: Was wird er tun? Wie wird er sich definieren?
Ich lasse diejenigen aus, die nach dem Zusammenbruch der Diktatur deren – quasi gereinigte – Ideologie als Grundlage für neues Recht und eine neuere Moral ausgaben. Ebenfalls lasse ich die aus, die ihren inneren Besitz – etwa an religiösen Wertorientierungen – jetzt zum allgemeinen Gesetz machen wollten. Einer höheren Gerechtigkeit hatten sie all die Jahre die Treue gehalten, nun sollte nichts weniger als eben die Gerechtigkeit politisch ins Leben gerufen werden. Als Norm von Ewigkeiten her und mit – quasi göttlicher oder ausgesprochen göttlicher – Autorität ausgestattet. Auch davon – von diesem Ansatz – will ich hier nicht reden. Aber wie nun würde der politische Raum in der politischen Moderne zu gestalten sein? So etwa musste sich, der – damals noch Pfarrer – Joachim Gauck fragen, als er auf die Ebene des Politischen eintrat.
Wenn nichts ewig Gültiges zur Verfügung stand, was war dann die Richtschnur der Gestaltung? Gott sei Dank gab es das Modell des säkularen Verfassungsstaates. Eine Verfassung mit Grundrechten und eine behauptete und verfassungsbefestigte »Würde des Menschen«. Der Freund der Moderne lernte, dass er auf eine letzte Autorität verzichten könne, ja, müsse, um sein Gemeinwesen zu gründen, zu definieren und zu gestalten. Bärbel Bohley zwar maulte, dass man die Gerechtigkeit gewollt habe, aber nur den Rechtsstaat bekommen habe, aber sie konnte mit diesem Unbehagen eben nicht in der Öffentlichkeit gestaltend Politik machen. Die Diskurse – so lernten wir –, sie würden uns den Weg weisen. Das klingt ja schon ein wenig eigenartig, aber doch, es weht auch ein großer Atem, wo Befreite – ohne Rückgriff auf letzte Autoritäten – ihre Rechtsordnung, ihre Politikinhalte und sich selbst im Gemeinwesen bestimmen. Ermächtigte wollen das! Sie erlangen ja eine, nie zuvor gekannte, jetzt besondere und neue Würde, nämlich: Sie haben eine Wahl. Sie entscheiden! Sie haben eine gestaltende Rolle. Es ist wirklich eine schöne, neue Welt – im ursprünglichen, nicht im ironischen Wortsinne.
Wenn nicht die Mühen der Ebene, nicht zunehmend die Mühen mit den Apparaten, den Strukturen der Ebene wären. Der individuelle Diskursteilnehmer weiß eben oft nicht mehr, ob er den Diskurs führt oder der Apparat, in dem er integriert ist. Auch gelten seine Werte, sein Glauben nicht mehr, sondern eine scheinbar offenkundige Logik der Entwicklung. Auch können alle möglichen Wolken des Zeitgeistes eine Rationalität erlangen, die kaum Widerspruch zulässt. Noch will der Freund der Moderne ja dem optimistischen Trotz von Soziologen folgen: In der Freiheit pendle sich schon aus, was wir zu tun und zu lassen hätten. Die Moderne könne sich ihrer Freiheit nicht begeben und wieder Letztgültigkeiten installieren. Die Demokratie habe nicht umsonst hinlängliche Regelungstechniken entwickelt und demokratische Verhaltensnormen geschaffen und – ja – der herrschaftsfreie Diskurs erschaffe selbst alle erforderlichen Elemente für eine gute, gemeinsame Zukunft aller.
Aber wenn der Freund der Moderne gleichzeitig ein gebranntes Kind des vergangenen blutigen Jahrhunderts ist und wenn er den Massenmord als das andere Gesicht der Moderne gesehen hat, befällt ihn nicht da eine gesunde Skepsis? Vielleicht war es ein Gebot der politischen Aufklärung, die Welt zu entzaubern und damals Gott für tot zu erklären. Ich zitiere: »Sie schuf einen verhängnisvollen leeren Raum, den des obersten Herrn und Richters, des Planers und Richters der Weltordnung. Dieser Raum konnte auf Dauer nicht unbesetzt bleiben, denn Gott war zwar vom Thron gestoßen, doch der Thron war noch unbeschädigt und wirkte in der gesamten moderneren Epoche auf Abenteurer und Visionäre wie eine Einladung, eine unwiderstehliche Versuchung. Die Sterblichen schickten sich nun an, den Traum allumfassender Ordnung und Harmonie und somit ihre Überlegenheit unter Beweis zu stellen. Der Mensch verstand die Welt als Garten, der vor dem Sturz ins Chaos zu bewahren war, wähnte sich verantwortlich dafür, dass die Klarheit der gesetzlichen Ordnung nicht durch Fremde, nicht durch Aufsässige, Klassen oder Rassen gefährdet würde. Es galt die verlorene – einst in Gott garantierte – Transparenz der Welt und des menschlichen Standorts wieder herzustellen; nun aber ausschließlich gestützt auf menschliche Erfindungsgabe und Verantwortung (oder wie sich herausstellte, menschliche Verantwortungslosigkeit). Schließlich erlangte menschliche Grausamkeit ihren spezifisch modernen Charakter und ermöglichte Auschwitz, den Gulag, Hiroshima und machte diese vielleicht sogar unvermeidlich.« Das Zitat ist nicht von Ernst-Wolfgang Böckenförde. Es ist auch nicht von einem Moralprediger, es ist nicht einmal von einem Theologen. Es stammt von einem Fachmann der Moderne, es stammt von einem Soziologen. Sein Name ist Zygmund Bauman.
Ein jüdisch-polnischer Soziologe, von dem wir eine Menge über die Moderne lernen können. Bauman, der sich ausdrücklich auf Hannah Arendts Skepsis gegenüber dem Konzept der »sozialen Fundierung der Moral« beruft, betont mit ihr eine ursprüngliche, menschliche Fähigkeit, Gut und Böse unterscheiden zu können. »Man muss für diese Fähigkeit eine andere Quelle annehmen als das kollektive gesellschaftliche Bewusstsein. Diese Fähigkeit gehört vielmehr zur Ausstattung des Menschen, wie seine biologische Konstitution«, und »der Sozialisierungsprozess dient der Manipulation der moralischen Fähigkeit, nicht ihrer Erzeugung«.
Wenn ich das alles lese, fällt mir ein, was ich gelebt habe und was Millionen Unschuldige mit ihrem Leben bezahlen mussten. Ich wollte Ihnen, verehrter Preisträger, lieber Ernst-Wolfgang Böckenförde, nicht erzählen, was ich von Ihnen in Vorbereitung dieses Tages gelesen habe oder was ich alles nicht weiß – das noch weniger –, aber Leben und Lesen haben mich in eine dankbare Nähe zu Ihnen gebracht, zu einem Menschen, der den drohenden Verlust der Dimension des Religiösen im öffentlichen Raum nicht klag- und argumentationslos hinnehmen will. Dabei ist er sich sicher, dass das Nebeneinander von Religion und Politik nicht unproblematisch sein kann. Bei aller Neutralität – etwa des modernen Staates – ist deutlich zu unterscheiden, welche Art von Neutralität wir wollen. Ob es eine distanzierende ist, die sich der Staat einfach nehmen muss, wenn es um sein hoheitliches Handeln und um die Rechtspflege geht, oder ob es eine offene – wir könnten auch sagen eine einladende und gewährende – Neutralität ist, für die Böckenförde immer wieder wirbt und für die er genügend Beispiele aus dem Leben anführt.
Das Modell des laizistischen Frankreich sieht er gerade nicht als ein Beispiel. Das hat mich berührt, wie er in einer Abhandlung über politische Theorie und politische Theologie diese als Moment politischer Theorie ausweist und die Unaufgebbarkeit des politischen Inhalts, politischer Theologie beschreibt. Er endet in diesem Aufsatz beim Papst, bei Johannes Paul II. – das wird vielen hier im protestantischen Bremen nicht gefallen –, dessen politische Theologie ihn ganz enorm einnimmt, und er sagt auch, warum: Sie sei ganz unpolitisch und sei allein auf die Verkündigung der christlichen Heilsbotschaft gerichtet: »Die Wahrheit Christi sei auch die Wahrheit für den Menschen«, so sagt es der Papst. Sie sei für die Menschen und vom Menschen und von der Würde, dem Recht, der Freiheit und der letzten Bestimmung des Menschen. Eine gemeinhin christliche Botschaft – eine ganz genuin christliche Botschaft –, die gleichzeitig im Stande ist, außerordentlich konkret in eine immanent politische Welt hineinzuwirken. Ich wünschte mir – in dem Land, in dem ich leben möchte, und in einer Zukunft, die ich sehen möchte – mehr Menschen, die bei dem Versuch, das Bild des Menschen zu bewahren, darum wissen, dass die Moderne aus jenen jüdisch-christlichen Wurzeln erwuchs, die das Besondere des Menschen in seiner »Gottebenbildlichkeit« sah. Das mag vielen merkwürdig klingen, aber verlören wir den Raum für dieses Zeugnis, wandelte sich wohl das Bild vom Menschen, das wir uns wünschen und gestalten wollen noch schneller, als wir es ahnten, zu einem Zerrbild. Davor bewahre uns Gott und Menschen wie dieser.
I
Die gegenwärtige öffentliche Diskussion über die Frage eines Beitritts der Türkei zur Europäischen Union kann nicht befriedigen. In ihr stehen Positionsnahmen einander gegenüber, die sich wechselseitig versteifen, auch polemisch gegeneinander richten, sich aber auf die Probleme in der Sache nur bedingt oder gar nicht einlassen. Das trifft ebenso die These, es gebe zu einem Beitritt der Türkei als Ziel und dem Beginn von Beitrittsverhandlungen auf Grund der bisherigen Entwicklung keine Alternative, wie die Gegenthese, ein Beitritt der Türkei und Verhandlungen daraufhin bedeuteten das Ende der Europäischen Union als politischer Union. Beide Positionen machen geltend, die Entscheidung über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die nun unmittelbar ansteht, sei mehr als eine unverbindliche prozedurale Zwischenentscheidung, sie habe vielmehr weichenstellende und ein Stück weit irreversible Bedeutung. Es mag sein, dass das so ist. Gerade dann aber erscheint eine intensiv auf die Sache selbst bezogene Diskussion, die jenseits populistischer Versuchbarkeit Argumente vorträgt, prüft und wägt, unerlässlich. Gefordert ist an Stelle schneller und vereinfachender Parolen ein nüchternes und klares politisches Denken, das das Handeln leitet, ein politisches Denken im Sinne Hannah Arendts, die ja in gewisser Weise die Schirmherrin dieser Veranstaltung ist. Denken muss man mit Haut und Haaren oder es bleiben lassen, lässt Joachim Fest Hannah Arendt demgegenüber sagen, und sie hat dies in ihren Werken wie in ihrem Leben immer wieder realisiert: ein Denken, gerichtet auf das, was wirklich ist und was als das Richtige erscheint, darin unnachgiebig und konsequent, ein Denken ohne (rückversicherndes) Geländer, um wiederum Hannah Arendt zu zitieren. Bemüht man sich um solches politisches Denken im Hinblick auf unser Thema, kann die Beitrittsfrage von vornherein nicht allein oder primär unter dem Gesichtspunkt der Bedürfnisse und der Eignung der Türkei für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union behandelt werden, welcher Gesichtspunkt indes im Augenblick vorherrschend geworden ist. Mindestens ebenso wichtig, ja noch wichtiger ist eine Erörterung im Blick auf die Eignung der Europäischen Union für eine Mitgliedschaft der Türkei und ihr politisches, kulturelles und ökonomisches Interesse daran. Was bedeutet der Beitritt der Türkei für die EU, welche Herausforderungen, Vorteile und Chancen, welche Risiken, Verluste und Gefahren bringt er mit sich? Wie weit sind die Voraussetzungen für einen solchen Beitritt nicht nur von Seiten der Türkei, sondern auch von Seiten der EU gegeben? Um eben diese Fragen soll es im Folgenden gehen.
II
Sucht man die Diskussion in diesem Sinn von Grund auf zu führen, kann zunächst die Frage nach der Finalität der europäischen Einigung, ihrem Wozu und Um-willen, nicht ausgeklammert werden. Was ist das eigentliche Ziel, auf das hin die EU konzipiert ist und sich entwickeln soll? Diese Diskussion ist seit dem Scheitern der EVG im Jahre 1954 ausdrücklich nie geführt worden. Vielmehr lagen und liegen unterschiedliche Vorstellungen in- und nebeneinander, sind zum Teil auch gegeneinander gerichtet: Europa als Friedensordnung, seine Integration als endgültige Besiegelung nationalistischer Kämpfe der europäischen Staaten und Völker gegeneinander; Europa als liberale Marktordnung mit freigesetztem Wettbewerb als Quelle des Wohlstandes, der funktionierende Binnenmarkt mit Offenheit zum Welthandel als sich selbst genügendes Ziel; Europa als Wirtschafts- und Sozialraum, der sich auf Angleichung der Lebensverhältnisse hin entfaltet, eine wirtschaftlich-entwicklungspolitische Union mit entsprechender Förderungs- und Ausgleichsfunktion; Europa als leistungsfähiger Konkurrent im globalen Wettbewerb um technologisch-ökonomische Führung mit gezielter Industriepolitik; Europa als auch politische Union und politischer Akteur auf Grund seiner vereinten Wirtschaftsmacht und einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
Die ausbleibende Diskussion wurde von den politischen Akteuren in Europa lange Zeit durch einen situationsgebundenen Pragmatismus ersetzt. Mal stand und steht die eine, mal mehr eine andere Zielvorstellung im Vordergrund, aber ohne gemeinsames, von allen Mitgliedsstaaten getragenes Konzept. Die Frage des Beitritts der Türkei lässt sich jedoch nicht mehr im Wege eines solchen Pragmatismus behandeln und voranbringen. Die Türkei ist nach geographischer Ausdehnung, Bevölkerungszahl, nationaler und kultureller Identität, ökonomischer und politischer Struktur von einer Bedeutung und Eigenart, die im Hinblick auf ihren Beitritt die Frage nach dem Konzept, der Finalité der europäischen Einigung, unausweichlich macht. Schiebt man diese Frage auch jetzt weiter vor sich her, wird sie angesichts der gegebenen Konstellation nicht wiederum vertagt, sondern indirekt, via facti, in bestimmter Weise beantwortet und entschieden. Denn die Frage der Eignung der EU für eine Aufnahme der Türkei und der Türkei für eine Mitgliedschaft in der EU ist anders gelagert und hat eine andere Dimension, wenn das Konzept und Ziel der europäischen Integration eine politische Union mit auch politischer Handlungsfähigkeit und darauf bezogener Konsistenz und demokratischer Struktur ist, wenn es sich lediglich auf eine Freihandelszone mit funktionsfähigem Binnenmarkt samt dazu erforderlicher ökonomischer Entwicklung und Angleichung richtet, oder wenn es primär auf eine sicherheitsstrategische Vormacht in der Bekämpfung des internationalen Terrorismus zielt, gewissermaßen als Seitenstück und Juniorpartner der Weltpolitik der USA.
Betrachten wir die Entwicklung der letzten zehn bis fünfzehn Jahre, so hat die europäische Integration freilich durch politische Aktivitäten, Beschlüsse und vertragliche Übereinkommen tatsächlich eine Richtung erhalten, die auf eine politische Union zielt, über eine Wirtschaftsgemeinschaft und einen europäischen Binnenmarkt hinaus. Das begann mit der Errichtung der Währungsunion im Vertrag von Maastricht; diese wurde von vielen der beteiligten Akteure gerade auch wegen eines aus deren eigener Logik damit verbundenen politischen Integrationszwangs gewollt und ins Werk gesetzt. Es setzte sich im Amsterdamer Vertrag und in den Beitrittsverhandlungen um die Erweiterung der EU vor allem nach Ostmitteleuropa hin fort, schließlich kam der jetzt unterzeichnete europäische Verfassungsvertrag hinzu. Eben dieser Verfassungsvertrag zielt in Umrissen ebenso auf eine institutionell und kompetenziell politisch handlungsfähige Union, nicht zuletzt im Bereich der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wie auf einen gewissen Ausbau der demokratischen Legitimation in der Union. Soll dieser Weg weitergegangen und nicht etwa abgebrochen oder zurückgenommen werden, kommt es auf die Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen an, die sich von den Grunderfordernissen und der Eigenart der Europäischen Union als politischer Union her für eine Mitgliedschaft der Türkei ergeben. Eine politische Union bedarf anderer Grundlagen und Gemeinsamkeiten, einer anderen Art von Zusammengehörigkeit und Solidarität als eine Freihandels- und Wirtschaftsgemeinschaft oder eine sicherheitsstrategische Aktionsgemeinschaft. Unter diesem Gesichtspunkt sind mehrere Faktoren in Betracht zu ziehen: geographisch-geopolitische, geschichtlich-kulturelle, politisch-integrative und im Zusammenhang damit demographische und ökonomische. Auch dürfen die Verpflichtungen und Zusagen, die gegenüber der Türkei eingegangen worden sind, und das was daraus folgt, nicht unberücksichtigt bleiben.
III
a) Beginnen wir mit dem geographisch-geopolitischen Faktor. Geographisch bedeutet eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU deren Ausdehnung nach Asien, und zwar in erheblichem Umfang. Nur ein kleiner Teil der Türkei, die westliche Landzunge diesseits des Bosporus, die nicht mehr als drei Prozent des Staatsgebietes der Türkei umfasst, gehört geographisch zu Europa. Die Türkei erstreckt sich über 1500 Kilometer auf asiatisches Gebiet, was in der Länge mehr bedeutet als die Entfernung von Warschau nach London. Sie wäre mithin weit mehr als nur ein Anhängsel zum europäischen Teil der EU. Geographisch wird mit dem Beitritt der Türkei aus der Europäischen Union eine europäisch-kleinasiatische Union. Einer meiner staatsrechtlichen Kollegen geht der Frage nach, ob diese Art der Ausdehnung über das geographische Europa hinaus noch vom Begriff des »vereinten Europa« in Artikel 23 und der Präambel des Grundgesetzes gedeckt sei, ob dieser Begriff nicht auch einen geographischen Gehalt habe und insofern beliebiger Ausdehnung Grenzen setze. Doch möchte ich das hier beiseite lassen. Wichtiger erscheint die geopolitische und geostrategische Komponente, die mit solcher geographischer Ausdehnung verbunden ist. Eine um die Türkei erweiterte EU hat direkte Grenzen mit Armenien, Georgien, Iran, Irak und Syrien. Die Außengrenzen der EU reichen dann bis nach Kaukasien und zum vorderen und mittleren Orient, mit allen Problemen, die damit verbunden sind. Eine so erstreckte EU wird von den Interessenkonstellationen, Konflikten und Unruheherden, die sich dort ergeben, unmittelbar mitbetroffen. Sie unterliegt möglichen Reaktionszwängen, denen sie – Grenzland und Anlieger – nicht ausweichen kann. Was bedeutet das für die politische Handlungsfähigkeit und innere Konsolidierung der EU? Jede politische Gemeinschaft, die über Warenaustausch, Dienstleistungsverkehr und Geldtransfer hinaus politisch aktionsfähig sein will, bedarf einer gebietsmäßigen Begrenzung, die strategisch, aber auch binnenstrukturell Kohärenz vermittelt und eine Problemüberlastung fern hält. Ungehemmte Ausdehnung bewirkt eher eine Schwächung als eine Stärkung politischer Handlungsfähigkeit, indem sie ein Übermaß an Problemdruck und Involviertheit hervorruft – die Schwächung durch Überdehnung. Besteht aber nicht – gerade auch geostrategisch und geopolitisch – eine notwendige Brückenfunktion der Türkei zwischen Europa und der islamischen Welt? In der Tat ist die Türkei der Staat der islamischen Welt, der sich Europa am meisten angenähert hat. Nicht nur blickt die Türkei historisch seit langem nach Europa – denken wir an die Jahrhunderte langen konfliktbeladenen Beziehungen des Osmanischen Reiches zu Europa und seinen Besitzstand in Europa – auch die Modernisierung der Türkei, seit Kemal Atatürk betrieben, ist in der weit gehenden Adaption europäischen Rechts und der Veränderung der Gesellschaftsstruktur stark an Europa ausgerichtet; nicht zuletzt belegen das die Reformbestrebungen der jüngsten Zeit. Die Türkei ist also zu einer Brücken- und Vermittlungsfunktion zwischen Europa und der islamischen Welt durchaus berufen und, sofern sie ihren Charakter als islamisches Land nicht negiert, auch in der Lage. Aber ist die Ausübung dieser Funktion nicht gerade an die Selbstständigkeit der Türkei, ihre politische Selbstständigkeit und Eigenständigkeit, gebunden? Wird die Türkei über eine volle Mitgliedschaft integrierter Teil der EU, kann das durchaus die Wirkung haben, dass sie von der islamischen Welt, insbesondere der islamisch-arabischen Welt, als islamisches Land abgeschrieben wird, eben weil sie ins westliche Lager, ein dem Islam feindliches Lager, übergetreten und damit dem Islam untreu geworden ist. Blickt man auf die gegenwärtige Verfasstheit der islamischen Welt, ist diese Reaktion eher wahrscheinlich – klares politisches Denken darf mentale Gegebenheiten nicht außer Acht lassen. Kann und soll die Türkei helfen, Aggressionen der islamischen Welt gegen den Westen, die westliche Welt, vermittelnd abzubauen, und selbst demonstrieren, dass westlich-europäische Lebensform und Islam keine unvereinbaren Gegensätze sind, so spricht viel dafür, dass dies gerade die Selbstständigkeit und Eigenständigkeit, auch die volle Souveränität einer Türkei – mag sie auch wirtschaftlich und eventuell monetär mit der EU eng verbunden sein – voraussetzt. Wie ja auch eine Brücke mehr und anderes ist als ein bloßer Brückenkopf; die Brücke verbindet eigenständig aus sich heraus verschiedene, vielleicht auch gegensätzliche Ufer oder Länder, und sie vermag das nicht als bloßer Vorposten der einen oder anderen Seite.
b) Geschichtlich-kulturell sind Europa und die Türkei nicht nur am Rande, sondern grundlegend unterschieden. Darüber dürfen die zum Teil hektischen Reformgesetze der jüngsten Zeit, so anerkennenswert sie als Anpassung an europäische Standards sein mögen, nicht hinwegtäuschen. Dieser Unterschied greift erheblich weiter als alle kulturellen Unterschiede innerhalb der bisherigen Europäischen Union, die Osterweiterung des Jahres 2004 eingeschlossen. Was ist der Grund dafür? Zumeist wird die Prägung durch die christliche Religion und durch den Islam angeführt, die Europa und die Türkei voneinander scheide. Das Problem liegt jedoch weniger in der Religion als solcher. Es liegt in der einerseits von der christlichen Religion, andererseits vom Islam geprägten Kultur und Mentalität in Europa und der Türkei. Hier und dort haben sich unterschiedliche Grundeinstellungen, Denkmuster, Traditionen und Lebensformen herausgebildet. Sie haben – zusammen mit anderen Kräften und Wirkungsfaktoren – eine je eigene kulturelle Identität geformt, die sich auch in den Charakteren der Völker niederschlägt. Dieses kulturelle Erbe hat die Menschen über Jahrhunderte geprägt und geformt, mit entsprechenden Auswirkungen auf ihr Denken und Empfinden. In dieser Vermittlung gehört die christliche Religion zum kulturellen Boden Europas, der Islam zum kulturellen Boden der Türkei. Was besagt dies für die Beitrittsfrage? Kann nicht, so lässt sich fragen, im Zeichen von Religionsfreiheit und Toleranz aus der Anerkennung des jeweils anderen eine gemeinsame Grundlage für ein produktives Zusammenwirken entstehen? Versteht sich das Europa der EU nicht selbst als säkulare, ja säkularisierte Ordnung, offen für verschiedene Religionen, ebenso wie für A-Religiosität? Gewiss hat das heutige Europa säkularen Charakter und existiert, von Malta und teilweise Griechenland vielleicht abgesehen, in der Form säkularisierter Gesellschaften. Aber dieser Charakter ist erwachsen nicht durch Beiseitestellen, sondern in lebendiger Auseinandersetzung mit dem fortwirkenden Christentum und in der Umsetzung gerade auch christlicher Gedanken. Die Kultur Europas – genauer und politisch unkorrekt, aber zutreffend: des lateinischen Europas – ist geprägt durch epochale Vorgänge, wie zunächst den Investiturstreit, den ersten Freiheitskampf zwischen Kirche und politischer Ordnung, sodann die Reformation, den europäischen Rationalismus und die Aufklärung, schließlich die Menschenrechtsbewegung. Diese Vorgänge haben tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis und der Mentalität der Völker des lateinischen Europas hinterlassen. Sie haben deren Identität in der Weise geprägt, dass praktizierte Religion und säkularisierter Staat, christlicher Glaube und freiheitliche Ordnung neben- und miteinander bestehen, sich sogar wechselseitig ergänzen können. An einer in dieser oder einer vergleichbaren Weise geprägten geistig-kulturellen Identität fehlt es in der Türkei. Sie lässt sich auch nicht durch die viel berufene Laizität der Türkei ersetzen oder kompensieren. Die türkische Laizität ist, was oft übersehen wird, keineswegs gleichbedeutend mit der laicité in Frankreich. Diese hat die völlige Freigabe der Religion bei ihrer Beschränkung auf den privat-persönlichen Bereich zum Inhalt, die türkische Laizität demgegenüber die Gestaltung der Religion des Islam – ohne Freiheit für andere Religionen – durch den Staat, um sie einerseits zu entpolitisieren und andererseits in das kemalistische nationale Modernisierungsprogramm zu integrieren; deshalb auch die neutralisierenden Züge. So sind Glaubensfragen und der religiöse Kult dem Direktorium für Religionsangelegenheiten (Diyanet), einer staatlichen Behörde, unterstellt; sie hat nach der letzten, 2003 beschlossenen Vergrößerung etwa 100 000 Angestellte, darunter Vorbeter, Prediger, Gebetsrufer und so fort, und ihr unterstehen an die 70 000 Moscheen. Unter ihrer Ägide wird eine Art sunnitischer Staatsislam als Grundlage für Religionsunterricht und religiöse Bildung praktiziert. Dies ist etwas grundlegend anderes als säkulare Religionsfreiheit; die nach wie vor beschämende Lage der Christen in der Türkei, die ungeachtet papierner Deklarationen fortbesteht, bestätigt dies nur. Weiter ist zu bemerken, dass diese Art der Laizität von oben verordnet wurde; die Menschen wurden vom Staatsgründer Kemal Atatürk autoritär in sie hineingezwungen. Soweit die Laizität Elemente von Säkularisation oder Säkularismus enthält, sind diese nicht aus den Wurzeln des Islam erwachsen, auch nicht als ein Produkt geistiger Auseinandersetzung mit dem Islam entstanden, die diesen selbst veränderte; schließlich sind sie bislang nur von einem geringen Teil der Menschen in der Türkei mental akzeptiert. Immer wieder hat es seit Atatürk in der Türkei islamistische Gegenbewegungen gegeben, am deutlichsten noch kürzlich in der Wohlfahrtspartei von Neçmettin Erbakan, der auch der gegenwärtige Ministerpräsident Erdogan, selbst ein frommer Muslim, zunächst angehörte. Von einer der europäischen vergleichbaren Mentalität oder geistig-kulturellen Identität kann nach alledem keine Rede sein. Es besteht insoweit eine Andersheit und Fremdheit, und diese lässt sich durch schnell hintereinander kommende Reformerlasse, denen (noch) das Widerlager im geistigen Bewusstsein der Menschen fehlt, nicht kurzerhand beseitigen.
c) Die hier deutlich gewordene mentale und kulturelle Unterschiedenheit wirkt auch auf die politisch-integrativen Probleme ein, die bei einem Beitritt der Türkei sowohl für die EU wie auch für die Türkei selbst entstehen. Für einen Staatenverbund, der auf eine politische Union und Gemeinschaft abzielt, reicht als gemeinsame Grundlage nicht aus, dass alle darin miteinander Verbundenen Menschen sind und sich als solche in ihren Menschenrechten anerkennen. Für eine politische Union in Europa bedarf es über ein solches neminem laedere hinaus einer Gemeinsamkeit und Solidarität, die ungeachtet der eigenen nationalen Identität auf ein gemeinschaftliches Zusammenleben mit anderen Völkern und Nationen bezogen ist. Solche Übereinstimmung kristallisiert sich in Fragen wie: Wer sind wir? und: Wie sollen und wollen wir miteinander leben? Als nur relative Gemeinsamkeit kann und muss sie Raum lassen für vielfache Differenzierung, Eigenheit und auch Unterscheidung; die Völker und Nationen sollen nicht aufgelöst oder absorbiert, sondern nur übergriffen werden. Aber sie muss zugleich auch eine rational begründete und in gewissem Umfang auch emotionale Verbundenheit aufweisen. Erst aus dieser heraus kann so etwas wie ein gemeinsames »WirGefühl« entstehen und sich forttragen. Eine Schweizer und daher gewiss unverdächtige Stimme formuliert es so: »Zwischen den zu integrierenden Einheiten müssen Bindeglieder, Ligaturen vorhanden sein, geschichtlich gewachsene Übereinstimmungen, Ähnlichkeiten, Ergänzungen, Komplementarität. Völlig Fremdes lässt sich nicht verbinden.« Ein solches gemeinsames Wir-Gefühl prägt sich darin aus, dass mental wie auch emotional dasjenige, was die anderen betrifft, auch mich angeht, nicht von der eigenen Existenz getrennt wird. Auf dieser Grundlage kommt es – Ausdruck der Solidarität – zur Anerkennung gemeinsamer Verantwortung, von Einstandspflichten und wechselseitiger Leistungsbereitschaft. Es ist der »sense of belonging«, von dem Lord Dahrendorf spricht, das Bewusstsein, Empfinden und der Wille, zusammen eine Gemeinschaft zu bilden, ihr anzugehören und an ihr – im Angenehmen und Nützlichen wie im Schweren und Belastenden – teilzuhaben. Nicht zuletzt gehört dazu zumindest in Umrissen auch ein gemeinsames Geschichtsbild als Anker solcher Gemeinsamkeit. Dieser sense of belonging, das darf nicht übersehen werden, muss in demokratisch organisierten Gemeinschaften stärker ausgebildet sein als in autoritär oder technokratisch verfassten. In jenen müssen die zum Bestand und zur Fortentwicklung der Gemeinschaft ergehenden Entscheidungen von den Menschen nur hingenommen werden, als von anderer Seite auferlegt und nicht selbst zu verantworten. In dem Maße, in dem eine Gemeinschaft demokratisch organisiert und auf demokratische Legitimationsverfahren angelegt ist, müssen diese Entscheidungen von den Menschen positiv mitgetragen werden, als von ihnen selbst getroffene und ausgehende. Daher bedarf es in weiterem Umfang gemeinsamer Auffassungen und Zielvorstellungen, die das aktive Handeln der Gemeinschaft mittragen und sie dazu befähigen. Dies alles will bedacht sein, wenn es um eine Aufnahme der Türkei als gleichberechtigtes Mitglied der Europäischen Union geht. Schon die gerade vollzogene Osterweiterung der EU bringt insgesamt insoweit erhebliche Probleme mit sich. Sie sind aber vergleichsweise gering gegenüber denjenigen, die bei einem Beitritt der Türkei ins Haus stehen. Eine in ihrer Integrationskraft und Integrationsbereitschaft überforderte EU kann leicht in Agonie geraten und Aggressionspotenziale, statt sie abzubauen, zuallererst freisetzen. Die hier aufgewiesenen Probleme und Schwierigkeiten lassen sich auch nicht mit dem Hinweis auf Europa als Wertegemeinschaft beiseite stellen. Gewiss sind Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in den Mitgliedstaaten der EU, wenn auch in unterschiedlicher Tiefe, anerkannt und praktiziert. Insofern lässt sich, darauf bezogen, von einer Wertegemeinschaft in Europa sprechen. Auch die Türkei hätte daran Anteil, falls sie die genannten Merkmale aufweist, sie nicht nur proklamiert, sondern auch realisiert. Diese Merkmale sind fraglos wichtig als Voraussetzung und notwendiger Boden für eine politische Union in Europa. Aber sie enthalten aus sich heraus noch nicht den positiven politischen Impetus und Antrieb für eine solche Union; sie sind zwar eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für die Zusammengehörigkeit, den sense of belonging und auch die Interessengemeinschaft, aus denen eine politische Gemeinschaft von selbstständigen Staaten ihre Handlungsfähigkeit und Handlungswilligkeit bezieht. Käme es nur auf die genannte Wertegemeinschaft an, könnte sich die EU ohne weiteres auf Australien, Neuseeland oder auch Japan erstrecken und diese Länder zu Beitrittskandidaten machen. Umgekehrt kann deshalb die Mitgliedschaft in der EU auch nicht auf eine Anerkennungsprämie für die Reformbereitschaft der Türkei reduziert werden. Für ein positives Miteinander in einer politischen Union ist in deren wie im Interesse der Türkei mehr erforderlich als der Standard einer Wertegemeinschaft, den jeder Staat fraglos auch für sich allein verwirklichen kann und sollte.
d) Das politisch-integrative Problem, das wir bislang behandelt haben, erfährt durch die demographische Dimension eine weitere Zuspitzung. Für die Bevölkerungsentwicklung der Türkei bis 2050 kommt eine Dokumentation der UN von 2003, die auf Revisionen im Jahr 2002 beruht, auf Grund der Basiszahl von 68,3 Millionen für 2000 – je nach der Annahme über die Reproduktions- beziehungsweise Fertilisationsrate unter Berücksichtigung der Steigerung der Lebenserwartung – zu folgenden Prognosen: Geht man von der oberen Annahme von 2,7 bis 2,35 aus, ist 2050 mit einer Bevölkerung von 119,9 Millionen zu rechnen, bei einer mittleren Annahme (2,3 bis 1,85) mit 97,8 Millionen und bei einer unteren Annahme (1,9 bis 1,35) mit 78,4 Millionen. Hierbei sind die Steigerung der Lebenserwartung und Migrationsanteile eingerechnet. Im Blick auf die fortschreitende Modernisierung in der Türkei erscheint Professor Birg aus Bielefeld die mittlere Annahme, bei der eine deutliche degressive Entwicklung berücksichtigt ist, am ehesten realistisch. Danach ergeben sich für das Jahr 2015 82,2 Millionen, für 2020 85,7 Millionen, für 2030 91,9 Millionen an Bevölkerungszahl. Die Türkei wird also bei einem Beitritt 2015 oder später unweigerlich der bevölkerungsreichste Mitgliedsstaat der EU sein. Entsprechend gestalten sich die Zahl der Sitze und damit die Einflusspositionen im Europäischen Parlament, der Anspruch auf angemessene Vertretung in der Kommission und das Gewicht beim Zustandekommen und gegebenenfalls der Verhinderung von Mehrheitsentscheidungen im Europäischen Rat. Repartitionen gerade für die Türkei sind hier nicht denkbar, sie bedeuteten eine Diskriminierung und wären gerade mit den Wertegrundlagen der EU unvereinbar. Weiter sind die Auswirkungen der vier Freiheiten des EG-Vertrages, insbesondere die der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, zu beachten. Zuzugsbewegungen aus der Türkei im Rahmen europäischer Dienstleistungsund Niederlassungsfreiheit sind primär nach Deutschland hin zu erwarten, weniger zur EU insgesamt, weil in Deutschland bereits die meisten Türken, etwa 2,8 Millionen, sesshaft sind. Zwar können solche Zuzüge durch Übergangsfristen etliche Jahre hinausgezögert, jedoch auf der Basis gleichberechtigter Mitgliedschaft nicht endgültig abgewehrt werden. Greift man dennoch zu »unbefristeten«, das heißt auf Dauer gestellten Beschränkungen von Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, wie sie jetzt sogar der Kommissionsbericht als Möglichkeit in Erwägung zieht, schafft man eine geminderte Mitgliedschaft, einen Beitritt zweiter Klasse; das wäre nichts anderes als ein Einstieg in die sonst entschieden abgelehnte privilegierte Partnerschaft. Es ist also offensichtlich, dass die Bevölkerungszahl und das daran sich orientierende politische Gewicht der Türkei das politisch-integrative Problem noch zusätzlich erschwert. Fehlendes Zusammengehörigkeitsbewusstsein und »Wir-Gefühl« wirken sich hier verstärkt aus, und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen EU-weit für die gemeinsame, von politischer Solidarität getragene Handlungsfähigkeit und die wechselseitige Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen und Einstandspflichten – eine Bedingung für das Fortschreiten einer politischen Union auf demokratischer Grundlage. Zum andern im nationalen Bereich für die konkrete Integrationsbereitschaft über bestehende Andersheit hinweg. Es sei nur auf das schon heute bestehende Problem von Grundschulklassen mit deutlicher Mehrheit ausländischer, nicht zuletzt türkischer Kinder hingewiesen und auf die möglichen Folgen des gleichen Kommunalwahlrechts für alle EG-Ausländer, wenn in großen Städten etwa eine türkische Gruppierung zweitstärkste oder gar stärkste Fraktion im Gemeindeparlament wird. Können aber solche Schwierigkeiten nicht abgefangen werden durch plurale Lösungen auf der Grundlage der Anerkennung von kultureller und sprachlicher Eigenheit und Vielfalt? Das mag so scheinen und erwünscht sein. Aber es würde ein anderes Integrationsmodell als das bisher verfolgte bedingen. Was war die Grundlage für das oft über Jahrhunderte hinweg im Großen und Ganzen friedliche und beziehungsreiche Miteinanderleben von Menschen verschiedener Herkunft, Religion, Sprache und Kultur im alten Europa? Es war die Anerkennung ihrer Eigenheit und Lebensform durch einen eigenen Rechtsstatus, der ihnen religiöse und kulturelle Eigenständigkeit gewährleistete. Denken wir als Beispiele an die Hugenotten in Berlin, die Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen in Ungarn beziehungsweise später in Rumänien und – noch im 20. Jahrhundert – die Muslime und Christen in Bosnien-Herzegowina. Sie alle sollten im Rahmen staatlich festgelegter Verträglichkeit nach ihren Religionsbegriffen, wie es alteuropäisch so schön hieß, nach ihren Sitten, ihrer Sprache, ihrem Recht leben, also ihre Wurzeln behalten können. Was heute als Parallelgesellschaft ausgemacht wird und als Gefahr erscheint, war durch Anerkennung in eine übergreifende Ordnung eingebunden und insofern integriert. Ginge es hiernach, müssten etwa in Berlin, legte man Grundsätze und Praxis im alten Österreich-Ungarn zu Grunde, nicht nur eigene türkischsprachige Schulen, sondern auch eine türkischsprachige Universität bestehen. Solche Art kultureller Vielfalt steht freilich in einem dauernden Spannungsverhältnis zum modernen Nationalstaat, verstärkt zur nationalstaatlichen Demokratie. Diese beruht auf der Nation als einer politischen Willens- und Kulturgemeinschaft, einem einheitlichen, für alle verbindlichen nationalen Recht, prägt sich in der eigenen nationalen Kultur aus und empfindet sprachlich und kulturell deutlich anders Geprägtes als fremd. Ihre Integration soll weithin durch Eingewöhnung, Einfügung in und Übernahme von Ordnung und Lebensform, insbesondere die Übernahme der eigenen Sprache erreicht werden. Das ist in sich nicht ohne Folgerichtigkeit. Aber es bedeutet, dass die Aufnahme- und Integrationskapazität in solchen Staaten und Gesellschaften durchaus eine begrenzte ist und nicht überfordert werden darf. Anders mag es in expliziten Einwanderungsländern wie den USA sein. Ein solches Einwanderungsland lässt sich aber nicht allein durch entsprechende rechtliche Regelungen schaffen, es muss auch beiderseits mental fundiert sein, sodass einerseits die Einwanderer oder Zuzügler positiv aufgenommen statt beziehungslos sich selbst überlassen oder ausgegrenzt werden, andererseits diese Menschen von sich aus zur Integration und das heißt zur weit gehenden Assimilation bereit sind.
e) Auch die ökonomischen Probleme sind nicht leicht zu nehmen. Nach verlässlichen Angaben beträgt die Wirtschaftskraft der Türkei derzeit nur 25 Prozent der durchschnittlichen Wirtschaftskraft der EU. Ein Beitritt der Türkei würde mithin das regionale Wirtschaftsgefälle innerhalb der EU erheblich verstärken und, wie der jüngste Kommissionsbericht ausführt, der Türkei lange Zeit Anspruch auf erhebliche Unterstützung aus den Mitteln des Strukturfonds und des Kohäsionsfonds geben. Gleiches gilt hinsichtlich der Teilnahme an der gemeinsamen Agrarpolitik. Insgesamt werden die notwendigen Aufwendungen für eine längere Zeit auf 20 Milliarden Euro jährlich beziffert. Es ist daher nicht polemisch, sondern ernsthaft zu fragen, wie weit solche Beträge die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der übrigen EU-Mitglieder übersteigen, zumal ja die Anforderungen der gerade ins Werk gesetzten Osterweiterung noch zu verarbeiten sind. Andererseits ist im ökonomisch-verteilungspolitischen Bereich Raum für Verhandlungen und Veränderungen; die Herausforderungen, die ein Beitritt der Türkei insoweit mit sich bringt, können auch Anlass sein, die Agrar-, Kohäsions- und Strukturpolitik der EU grundlegend neu zu formulieren und so realisierbar zu halten. Das würde freilich keine einfache Prozedur, weil vielerlei Besitzstände auf den Prüfstand kommen müssten. Doch liegt darin zugleich eine Chance für die EU, zu einer stärker rational bestimmten ökonomischen Struktur und Politik zu kommen. Die Aufgabe, die Türkei ökonomisch an die EU heranzuführen und in sie zu integrieren, kann so nicht von vornherein als unlösbar angesehen werden.
IV
Was gegen einen vollen Beitritt der Türkei zur EU als politischer Union spricht und ihn höchst bedenklich macht, liegt mithin nicht eigentlich im ökonomischen Bereich, obwohl auch dieser nicht ohne Risiken ist; es ergibt sich primär und durchschlagend aus den dargelegten geographisch-geopolitischen, kulturellen und politisch-integrativen Problemen in Verbindung mit demographischen Gesichtspunkten. Hinzu tritt die gegenwärtige, in die Zukunft hineinwirkende Befindlichkeit der Europäischen Union selbst. Diese bringt für längere Zeit herausfordernde Probleme mit sich, als Stichworte seien nur Zusammenwachsen, institutionelle Reform, wirklicher Aufbruch zu gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik genannt. Kommt hier noch die Beitrittsproblematik mit allem, was daran hängt, hinzu, führt das zu einer nicht mehr lösbaren Problemüberfrachtung. Die Folge wäre eine resignative Rückentwicklung der EU zur bloßen Wirtschaftsgemeinschaft und Freihandelszone. Die Verankerung Europas bei den Bürgern, die Europa als etwas Eigenes, von ihnen Mitgetragenes erleben und eine positive Zugehörigkeit dazu empfinden, wäre dahin.
a) Wie kann dann aber eine angemessene Lösung des Beitrittsproblems, auch auf dem Hintergrund der der Türkei gemachten Zusagen aussehen? Es kann und muss ein besonders enges Verhältnis der Türkei zur EU hergestellt werden, das nicht nur den Handel und die Wirtschaftsförderung mit dem Ziel der Angleichung der Lebensverhältnisse umfasst, sondern auch darüber hinausgeht. Zu diesem Verhältnis kann auch die Teilnahme an der Euro-Währung gehören sowie jenseits von Handel und Wirtschaft eine enge, institutionell ausgestaltete Kooperation mit
Beteiligungs- und Anhörungsrechten, wie sie durchaus schon bestehen, mit Konsultationen und auch – allerdings überstimmbaren – Einspruchsrechten. Hier ist vieles möglich und auch realisierbar, was unterhalb der Grenze der förmlichen vollen Mitgliedschaft bleibt, die Türkei aber gleichwohl in eine enge und als solche erkennbare Verbindung mit der EU bringt, die ihr die eingangs erwähnte Brückenfunktion ermöglicht und sie darin unterstützt. Der Ausdruck »privilegierte Partnerschaft« scheint dafür allerdings nicht gut gewählt. Er stellt doch stark auf Begrenzung und Trennung ab: Eine bloße Partnerschaft, wie sie generell mit den Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, besteht, wenn auch eine privilegierte und dadurch hervorgehobene. Richtiger und der Sache angemessen wäre es, auf die besondere Verbundenheit und Teilhabe abzustellen, die positive und institutionell näher ausgeformte Beziehung, um die es in der Sache geht und auch gehen sollte. In politics there is sometimes much in a word. Als das Paulskirchen-Parlament 1848/49 den Versuch machte, die österreichische Monarchie, einen Vielvölkerstaat, wenigstens teilweise in den zu errichtenden nationalen deutschen Staat einzubeziehen, sprach der Abgeordnete von Gagern von dem »engeren und weiteren Bund«, den es zu schaffen gelte. Kann es nicht ebenso im Verhältnis zur Türkei um die engere und eine weitere europäische Union gehen, mit einer Art assoziierter Mitgliedschaft?
b) Kommt ein solcher Status aber nicht gleichwohl in Konflikt mit Verpflichtungen, die Europa gegenüber der Türkei eingegangen ist, und Zusicherungen, die ihr gemacht wurden? Die Lage ist nicht so einfach, wie sie oft dargestellt wird. Das Assoziationsabkommen mit der Türkei von 1963, ersichtlich auch unter Auspizien des Ost-West-Gegensatzes abgeschlossen, hatte das Ziel, eine »beständige und ausgewogene Verstärkung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen« zwischen der EWG und der Türkei zu erreichen; es sah dafür drei Phasen vor, die Endphase sollte auf einer Zollunion beruhen, die 1995 vollendet wurde, und eine verstärkte Koordination der Wirtschaftspolitiken einschließen (Art. 5). Die Annäherungs- und Beitrittsperspektive, von der heute oft die Rede ist, war entsprechend dem damaligen Charakter der EWG auf eine Wirtschaftsgemeinschaft gerichtet, nicht auf mehr. Das machte heute kein Problem, und insofern wäre das Abkommen von 1963 auch erfüllt. Indem diese Perspektive aber fortgeschrieben und bestätigt wurde, als die EG nach den Ereignissen der Jahre 1989 und 90 – Zusammenbruch des Ostblocks und Wiedervereinigung – im Vertrag von Maastricht sich als Europäische Union auf eine politische Union auszurichten begann und zudem die Osterweiterung ins Auge fasste, erhielt sie einen anderen Inhalt. Die Zäsur liegt – ob den Beteiligten bewusst oder nicht – im Beschluss des Europäischen Rates in Helsinki 1999. Er erkannte der Türkei ausdrücklich den Status eines Bewerberlandes zu, das auf der Grundlage derselben Kriterien, die auch für die übrigen Bewerberländer gelten, Mitglied der Union werden solle. Noch 1998 hatte Bundeskanzler Kohl, wie er gerade jetzt in einem Fernsehgespräch mitgeteilt hat, gegenüber dem türkischen Ministerpräsidenten Ylmaz erklärt, dass ein Beitritt der Türkei zur EU nicht in Betracht komme. Diese Position hatte Europa mit Helsinki verlassen, vielmehr eine Beitrittsoption zur EU als politischer Union für die Türkei eröffnet und sie durch den Beschluss von Kopenhagen Ende 2002 noch einmal verstärkt. Die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen rundweg abzulehnen, muss nach alledem, von rechtlichen Problemen abgesehen, tiefe politische Zerwürfnisse hervorrufen, zumal die Türkei ihrerseits beträchtliche Anstrengungen unternommen hat, um sich beitrittsfähig zu machen. Aber eine Beitrittsoption ist noch keine Beitrittszusage, sodass nur noch über die Modalitäten zu verhandeln wäre. Auch das Ob eines Beitritts – voller Beitritt oder andere Formen spezifischer Verbundenheit – ist dabei offen und kann durch entsprechende Verlautbarungen offen gehalten werden. Dies muss dann aber auch ausdrücklich geschehen, will man der normativen Kraft des Faktischen, die sich gerade in diesen Fragen vehement breit macht, wirksam entgegentreten. Eine tragfähige Anknüpfung dafür gibt es übrigens in den Beitrittskriterien von Kopenhagen selbst. Denn im Gesamttext der Kriterien findet sich ein heute eher verschwiegener Zusatz, den eine französische Diplomatin wieder zu Tage gefördert hat. Er hebt »die Kapazität der EU, neue Mitglieder zu integrieren«, als ein »wichtiges Element« vor der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen hervor. An eben dieser Integrationskapazität der EU, will sie eine politische Union bleiben, fehlt es heute und auf absehbare Zeit, und dies kann gegenüber der Türkei geltend gemacht werden.
c) Die Bereitschaft, einen solchen Vorbehalt zu empfehlen und sich dafür einzusetzen, fehlt indes sowohl bei der Europäischen Kommission wie bei der Bundesregierung. Wie jüngste Äußerungen von EU-Kommissar Verheugen, Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer zeigen, wird unter dem Eindruck des 11. September 2001 ein neues Strategiekonzept für die EU verfolgt, das – ohne weitere Diskussion – die Finalité der europäischen Integration nachhaltig verändert. Nunmehr ist die Frage des endgültigen Platzes der Türkei in Europa eine sicherheitspolitische Frage, und zwar, wie Verheugen sagt, ganz und gar. Die EU erscheint als ökonomisch gestützte ausgreifende Stabilisierungsund Aktionskraft im Kampf gegen den weltweiten Terrorismus und in der Auseinandersetzung mit der islamischen Welt. Das macht ihre weite Ausdehnung mit der Türkei als Vorposten nach Asien hin notwendig, nicht zuletzt auch, um die Vereinbarkeit des Islam mit westlicher Welt und Demokratie unter Beweis zu stellen. Die EU übernimmt eine fortentwickelte und erweiterte Sicherheitsfunktion in Ergänzung zur NATO und soll, selbstständig oder eingefügt in das Weltvorherrschaftskonzept der USA, ein weltpolitischer Akteur werden. Dieses Konzept mag schlüssig sein oder nicht; ob es politisch unerlässlich ist, erscheint zweifelhaft. Jedenfalls aber bedeutet es einen folgenreichen Strategie- und Finalitätswechsel für die europäische Integration, übrigens zum dritten Mal in deren Geschichte. Steht das sicherheitspolitische Ziel so dominant im Vordergrund, kann es auf andere Erfordernisse und Gegebenheiten, die für eine politische Union notwendig sind, nicht mehr in gleicher Weise ankommen; diese müssen hinter dem neuen Ziel zurücktreten, gegebenenfalls auch unter Inkaufnahme einer Änderung der Struktur der Europäischen Union. Das ist, kurz gesagt, der Weg, der nun beschritten werden soll. Für die EU bedeutet dieser Weg einen Scheideweg. Denn die volle Einbeziehung der Türkei in die Union aus Gründen und unter Dominanz eines sicherheitsstrategischen Konzepts steht einer Fortentwicklung der Union als politischer Union, die von einer Gemeinsamkeit und Verbundenheit der Völker, die in ihr leben, getragen und bestimmt wird, entgegen. Beides zugleich – dies habe ich versucht darzulegen – kann man nicht haben. Bei einem vollen Beitritt der Türkei wird die EU zwar nicht untergehen, aber sich rückbilden zu einer Wirtschaftsgemeinschaft mit Binnenmarkt- und Industriepolitik, was ohnehin im Interesse Großbritanniens und wohl auch der USA liegt, dabei überlagert von sicherheitsstrategischer Zielsetzung. Die EU steht also in der Tat am Scheideweg. Die Entscheidungen, die der Europäische Rat am 17. Dezember zu treffen hat, werden für sie eine Stunde der Wahrheit. Videant consules!
Das Wagnis der Freiheit
Im Vorfeld der Hannah-Arendt-Preisverleihung fand am 3. Dezember 2004 in der Bremischen Bürgerschaft eine Podiumsdiskussion statt, in der es um Fragen des freiheitlich säkularen Staates, die Bedeutung der Religion und die Sicherung der Freiheit ging. Die thematische Einleitung und die Vorstellung der Podiumsteilnehmer durch die Diskussionsleiterin Marie-Luise Knott, freie Publizistin und Chefredakteurin der deutschsprachigen Le Monde Diplomatique, musste aus Platzgründen hier ebenso entfallen wie die sich anschließende Diskussion auf dem Podium. Das Motto der Podiumsdiskussion war ein zentrales Zitat von Ernst-Wolfgang Böckenförde: »Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist.«
Ulrich K. Preuss
Dieser Satz besitzt eine ungeheure Sogwirkung. Er ist so suggestiv, dass, wenn man ihn einmal gehört oder gelesen hat, man gar nicht umhin kann, ihn bei nächstbester Gelegenheit wieder zu zitieren. Das ist natürlich ein großes Kompliment an Herrn Böckenförde, denn wenigen Menschen beziehungsweise wenigen Intellektuellen gelingt es, solche prägenden klaren Sätze zu produzieren, die im Grunde genommen – und damit komme ich schon zum kritischen Teil meiner Bemerkung – in jedem relativ beliebigen Zusammenhang immer irgendetwas Richtiges aussagen. Das ist natürlich auch das Problem dieses Satzes, den wir uns deswegen noch etwas genauer anschauen sollten. Dieser Satz ist ja im Grunde so etwas wie ein geflügeltes Wort, und wie Geflügel nun mal ist, fliegt es mal dahin und mal dahin. Man kann es eigentlich nicht richtig festmachen. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht zur Einleitung mal fünf Stationen benenne, wo dieser Vogel sich entweder schon niedergelassen hat oder leicht niederlassen könnte. Das sind Zusammenhänge, die sehr unterschiedlicher Art sind. Der erste Vogel, den ich mit einem berühmten Namen assoziiere, ist Alexis de Tocqueville. Alle diejenigen, die ihn ein wenig kennen und die Literatur um ihn herum, werden sagen: »Dieser Satz ist im Grunde genommen gar nichts Neues. Das wissen wir doch alles schon von Tocqueville.« Tocqueville hat an einer Stelle mal gesagt: »Die Institutionen einer Gesellschaft sind von dem sozialen Zustand des Volkes abhängig.« Das ist eine altbackene Sprache des 19. Jahrhunderts beziehungsweise eine Übersetzung, aber genau das ist im Grunde der Inhalt dieses Satzes, wie man ihn jedenfalls auch zuschreiben kann. Wir müssen uns vorstellen, dass eigentlich gleichsam vorinstitutionelle Bedingungen der Gesellschaft vorhanden sein müssen oder, anders gesagt, dass die vorinstitutionellen Bedingungen der Gesellschaft den Grad der Institutionen prägen. Das ist eine klassische tocquevillesche Aussage, die er über die Amerikaner oder über die berühmte Demokratie in Amerika ausgeführt hat. In dieser Tradition steht ebenfalls ein berühmter Amerikaner namens Robert Putnam, der ein Buch geschrieben hat über Making Democracy Work. Dort sagte er im Grunde genommen – und diesen Satz könnte man heute modifizieren –, dass der freiheitlich demokratische oder auch säkularisierte Staat von der Voraussetzung einer lebendigen Zivilgesellschaft lebt. Das haben wir erfahren, als wir über die Transformation von postkommunistischen Gesellschaften gesprochen haben und das kann man auch jetzt im Grunde wieder in der Ukraine erleben. Dass nämlich ohne eine lebendige Zivilgesellschaft eigentlich ein Verfassungssystem gar nicht funktionieren kann, sondern gewissermaßen ein rein formales »Implantat« darstellt. Das wäre eine Aussage oder Interpretation, wie man sie bei Tocqueville, Putnam – und wie man sie natürlich auch häufig versteht – vorstellen kann. Es gibt aber auch eine etwas abgründigere Interpretation, die mit einem Autor zu tun hat, der wiederum Herrn Böckenförde gar nicht fremd ist, nämlich Carl Schmitt. Dies ist eine Interpretation von einer besonders kritischen Position aus. Dieser Satz ist insofern gefährlich, als er im Grunde genommen behauptet, dass die Gesellschaft und ihre Rechtsordnung in ihrer Verfasstheit von der Existenz und damit auch von der Existenznotwendigkeit von »vorund nichtverfassten Räumen« lebt. Wenn wir von »nichtverfassten Räumen« sprechen, dann assoziieren zumindest Juristen, aber auch der normale Bürger, wenn er darüber nachdenkt, den Ausnahmezustand. Das ist nämlich der Zustand, in dem das Recht endet und in dem, nach Carl Schmitt, über die Bedingungen gestritten und entschieden wird, ob Recht überhaupt gilt. Das ist eine Aussage, bei dem dieser Satz schon eine Kolorierung erhält, die man wahrscheinlich nicht so ohne Weiteres mit Kopfnicken und Wohlgefallen akzeptieren kann, sondern sagt: »Halt! Diesen Satz darf man so unbefangen nicht einfach unkommentiert weitergeben, geschweige denn einmeißeln.« Ich denke, dass wir da doch einmal innehalten sollten.
Natürlich sind alle diese Interpretationen, die ich gebe, nicht Unterstellungen, um zu zeigen, dass das von Herrn Böckenförde gemeint ist, sondern der Satz hat ja seine »objektive Selbstständigkeit« gewonnen. Jeder macht damit, was er will. Das ist ja genau der Tenor meiner Ausführungen. Das heißt, es gibt auch durchaus Autoren, die das daraus machen können, was auch Carl Schmitt gesagt hat: »Bevor Recht ist, muss Ordnung sein«, und diese Ordnung wird im Ausnahmezustand oder auch vorrechtlichen Zustand geschaffen und deshalb ist dieser Satz uns sehr willkommen. So würde oder könnte jemand zumindest sagen!
Dann gibt es eine dritte Aussage. Einen Ort, der natürlich hier am heutigen Tag und auch morgen prominent ist. Das ist eine Aussage von Hannah Arendt. Hannah Arendt würde nun diesen Satz – aus meiner Sicht und wie ich sie verstehe und interpretiere – ablehnen. Sie würde sagen: »Dieser Satz unterstellt einen Dualismus von Politik, die gewissermaßen gestaltet wird im Medium von Souveränität und Staatlichkeit. – Der säkularisierte Staat ist es ja hier, der angerufen wird. – Staatlichkeit, das heißt Souveränität! In seiner Funktionsfähigkeit ist er gewissermaßen bestimmt durch die Herstellung von kollektivbindenden Entscheidungen und all das, was damit assoziiert wird.« Wir alle wissen und vor allen diejenigen, die diesen Preis verleihen, wissen, dass das ein Politikverständnis ist, das Hannah Arendt radikal abgelehnt hat. Souveränität ist für sie gewissermaßen das Ende der Politik und nicht ein Medium von Politik. Für sie liegt Politik im Grunde genommen im Vermögen des Menschen zu handeln, zu versprechen und zu verzeihen. Das sind die drei elementaren Merkmale von Politik bei Hannah Arendt, die vollkommen ohne jede Form von Souveränität auskommen. Das würde bedeuten, dass damit der Rekurs auf gleichsam vor der Souveränität liegende gesellschaftliche Ressourcen bei ihr keinen Ort hat, weil Politik selbst in diesem vorpolitischen Raum konstituiert wird. Politik konstituiert sich sozusagen aus diesem Raum heraus. Dieser Dualismus, der hier konstruiert wird in diesem Satz, den würde Hannah Arendt ablehnen. Das wäre die Hannah Arendt’sche Interpretation. Nun komme ich zu einer Interpretation eines weiteren prominenten Autors, nämlich Ernst-Wolfgang Böckenförde selbst, denn er hat das Recht, präzise zitiert zu werden, präzise verstanden zu werden und nicht gleichsam für jede beliebige Zielsetzung genutzt zu werden. Ich glaube, er hat das Recht darauf, dass man ihn zum Beispiel von der Unterstellung, die bei vielen immer mitschwingt, freispricht: Die Unterstellung, dass er im Grunde meint, dass der Verfassungsstaat (auch der unsrige heute) nur funktioniert, wenn wir so etwas wie einen Wertekonsens haben, und dass dieser Wertekonsens etwas ist, das wir gleichsam vorpolitisch voraussetzen müssen, und wenn dieser nicht gegeben ist, dann funktioniert die Demokratie nicht. Also müssen wir, damit die Demokratie funktioniert, diejenigen, die am Wertekonsens nicht teilhaben wollen, in irgendeiner Form isolieren oder was immer man damit machen soll. Jedenfalls wäre die Unterstellung: »Wir brauchen einen Wertekonsens« – und das ist genau das, was der Satz von Herrn Böckenförde nicht sagt. Zumindest nicht in dem Kontext, in dem der Satz steht. Deshalb sagte ich: »Wir müssen diesen Satz so wörtlich nehmen, wie er ihn geschrieben hat.« Er sagt, dass der Appell an den Wertekonsens ein höchst dürftiger und auch gefährlicher Ersatz wäre, denn – ich möchte das hier jetzt noch einmal ausdrücklich zitieren – »er eröffnet dem Subjektivismus und Positivismus der Tageswertungen das Feld, die je für sich objektive Geltungen verlangen und die Freiheit eher zerstören als fundieren«. Ich glaube, das ist die authentische und hier wörtlich so ausformulierte These, die hier in Erinnerung gerufen werden sollte, damit sich nicht die falschen Propheten an diesen Satz anhängen. Wenn dann am Schluss dieses Aufsatzes Herr Böckenförde dennoch auf die Religion zu sprechen kommt, so ist das etwas höchst Persönliches. Religion ist hier nicht als gesellschaftliches Gebilde, das Gemeinschaft stiftet und einen Werte- und Gemeinschaftskonsens bildet, gemeint, sondern es ist jenes individuelle Gewissen gemeint, als ein für das Funktionieren des Verfassungsstaates verantwortliches Individuum. Ich glaube das ist eine wichtige Präzisierung, wie sie mir immer wieder erforderlich erscheint.
Dann gibt es eine fünfte Position von einem Autor, der nicht weiter bekannt ist. Ich identifiziere ihn aber mit mir: Ulrich K. Preuss. Dieser gibt eine Deutung, die abweicht von der böckenfördischen und von allen anderen Deutungen ebenfalls. Diese Deutung ist nicht besonders originell, aber ich glaube, sie sollte schon in die Diskussion hier eingebracht werden. Aus meiner Sicht erweckt der Satz nämlich die Vorstellung, als wenn die vorpolitischen Voraussetzungen der Politik und die vorrechtlichen Voraussetzungen des Rechts etwas Statisches, Gegebenes oder auch Prä-Existentes sind, auf das der säkularisierte Staat gar keinen Zugriff hat. Ich glaube, dass das eine falsche Sichtweise ist. Wir müssen uns diesen Prozess der Herbeiführung der Funktionsbedingungen des Verfassungsstaates viel dynamischer vorstellen. Es ist ein Prozess wechselseitiger Kreation und wechselseitiger Inspiration. Das heißt also, dass der Verfassungsstaat wohl durchaus durch die wesentlichen Voraussetzungen und auch die kulturellen Voraussetzungen eine Menge von Möglichkeiten hat, sich das Individuum (das hört sich jetzt sehr missverständlich an) zu formen – denken Sie doch nur an die Schule! Die Schule als die »Schule der Nation«, wie Willy Brandt gesagt hat, oder auch die Bundeswehr, als vielleicht nicht mehr ganz geeignete »Schule der Nation«. Ich will das nicht so passiv im Sinne des »Einwirkens« verstehen, aber doch als einen Prozess, in dem die Bürger, die die Träger dieser freiheitlichen Ordnung sind, »heranerzogen« werden (muss man wirklich sagen), sodass also der Fatalismus, der in diesem Satz mitschwingt, aus meiner Sicht unangebracht ist. Damit habe ich Ihnen fünf mögliche Interpretationen gegeben. Vielleicht sind sie aus Ihrer Sicht vollkommen abwegig. Vielleicht können sie auch durch andere Interpretationen ergänzt werden. Aus meiner Sicht steht aber fest, dass dieser Satz immens interpretationsfähig und -bedürftig ist, was seine Suggestivkraft, aber auch seine Instrumentalisierbarkeit für verschiedenste politische Zwecke zum Ausdruck bringt.
Zdzislaw Krasnodebski
»Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist.« – An diesen berühmten Satz von Ernst-Wolfgang Böckenförde wird auch im »neuen Europa« erinnert. Die Demokratien, die nach dem Kommunismus aufgebaut wurden, werden mit Problemen konfrontiert, die die aktuelle und brisante Bedeutung dieses Satzes deutlich machen. Es stellte sich noch einmal deutlich heraus, dass das formale Bestehen demokratischer Institutionen noch nicht Freiheit oder Gleichheit vor dem Gesetz garantiert, dass das Recht ohne einen entsprechenden Kontext ausgehöhlt wird. So würden fast alle von uns der These zustimmen, dass der Staat, obwohl er ein »weltanschaulich-neutraler Staat« ist, als »das politische Gemeinwesen eine geistliche Grundlage und die erforderliche relative Gemeinsamkeit« benötigt (S. 433). Aber was bedeutet dies? Welches sind denn die Voraussetzungen, von denen der freiheitliche säkularisierte Staat lebt? Wann kann man sagen, dass sie nicht mehr erfüllt werden und woran erkennen wir, dass sie bedrohlich schwach geworden sind? Das ist nicht mehr selbstverständlich, mehr noch, gerade dies wird zum Thema der heftigsten politischen Auseinandersetzungen. Eine Antwort schien uns sehr lange klar zu sein. Was die freiheitliche Ordnung bedroht, sind der Fundamentalismus, der Fanatismus, der »Populismus« oder der Nationalismus und so fort. Das Remedium gegen diese Krankheiten sollte die Zivilgesellschaft, der Pluralismus, darstellen. Die Bürger und die Eliten sollten die Menschen sein, die nicht fundamentalistisch gesinnt sind, tolerant, offen, pragmatisch, bereit zum Dialog, säkularisiert und flexibel. Nach fünfzehn Jahren der Demokratie im »neuen Europa« haben wir jedoch festgestellt, dass die größten Probleme woanders liegen. Was unsere Demokratie immer mehr zur Fassade macht und unsere Freiheit bedroht, sind nicht so sehr zu starke Überzeugungen, sondern ein Mangel an Überzeugungen, nicht der starre Dogmatismus, sondern zu viel Flexibilität, nicht der verabsolutierte Moralismus oder Fanatismus, sondern die Beliebigkeit, der Zynismus und Nihilismus, nicht zu wenig Individualismus, sondern zu wenig Gemeinsamkeit, auch nicht zu viel Religion, sondern zu wenig eines echten Glaubens, der auch im alltäglichen Leben wirksam wird, nicht zu starkes Nationalbewusstsein, sondern seine Fragmentierung und eine Entnationalisierung der Eliten, die alles das übersteigt, was Samuel Huntington über amerikanische Eliten geschrieben hat. Das sind alles Erscheinungen, die auch im »alten Europa« bekannt sind, aber vielleicht manifestieren sie sich nicht als akute Bedrohung, weil sie dieses Problem auf andere Weise gelöst – oder scheinbar gelöst haben. Oder weil wir es hier mit einer schleichenden, langsamen Erosion zu tun haben, während in Ostmitteleuropa dies alles schneller und sichtbarer verläuft. Die Frage nach der Gemeinsamkeit ist akut geworden: »Wächst dem Staat diese Gemeinsamkeit unproblematisch zu, etwa durch das politisch-kulturelle Erbe, durch rationale Einsicht oder aktuellen Konsens? Oder steht er dann, wie Hegel etwa meinte, ›in der Luft‹ (S. 433), sodass er schließlich einer so genannten Zivilreligion bedarf, die aus Setzung lebt, aber gleichwohl den Anspruch auf Gültigkeit macht und machen muss?« Es ist schwierig, den historiosophischen Optimismus von Jürgen Habermas zu teilen, der uns in seinem ganzen Werk zu überzeugen versucht, dass die Moderne von sich selbst Normen hervorbringt und neue Solidarität schafft: »Normalerweise beziehen die Angehörigen einer Lebenswelt so etwas wie Solidarität aus überlieferten Werten und Normen, aus eingespielten und standarisierten Mustern der Kommunikation. Im Laufe der Rationalisierung schrumpft oder zersplittert jedoch dieser askriptive Hintergrundkonsens. Er muss im selben Maße durch erzielte Interpretationsleistungen der Kommunikationsteilnehmer selbst ersetzt werden. ... Rationalisierte Lebenswelten verfügen mit der Institutionalisierung von Diskursen über einen eigenen Mechanismus der Erzeugung neuer Bindungen und normativer Arrangements. In der Sphäre der Lebenswelt verstopft ›Rationalisierung‹ nicht die Quellen der Solidarität, sondern erschließt neue, wenn die alten versiegen.« (Konzeption der Moderne. Ein Rückblick auf zwei Traditionen, S. 229)
Dabei kommt man nicht umhin zu fragen, ob die Aushöhlung der Demokratie in Ostmitteleuropa nicht durch die Überzeugung verursacht wird, dass die moralischen und religiösen Überzeugungen nichts in der politischen Sphäre zu suchen haben, wenn der Staat völlig neutral ist und die Gesellschaft völlig pluralistisch. Durch die Lektüre von Ernst-Wolfgang Böckenförde kann man viele falsche oder zu einfache Vorstellungen korrigieren, vor allem was das Verhältnis zwischen Religion und Politik angeht. Zum Ersten erinnert er daran, dass die Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften keine radikale sein muss, wie im laizistischen Frankreich, sondern »eine balancierte Trennung« (S. 431) wie in der Bundesrepublik sein kann. Zweitens verweist er darauf, dass die Religion, wenn sie zu einem Angebot unter anderen wird, nicht aus der öffentlichen, politischen Sphäre verschwindet, dass die Kirche in der Ausübung ihres Hüter- und Wächteramtes oft in die Politik eingreifen muss. So lesen wir, dass »inwieweit sie [die staatliche Rechtsordnung und die Lebensordnung der Gesellschaft] davon geprägt sein können, hängt zum einen vom ordre public und der Eigenart des politischen Gemeinwesens ab, zum anderen davon, in welcher Weise und in welchem Ausmaß die Rechts- und Lebensordnung dieses Gemeinwesens durch die gesellschaftlichen und politischen Kräfte geformt sind.« Drittens schreibt er, dass trotz dieser Trennung der weite Bereich der »res mixtae« existiert, in denen der Staat und die religiösen Gemeinschaften sich treffen. Deshalb wird es immer Konflikte und Reibungen geben, auch zwischen Politik und Religion, solange sie lebendig bleibt: »Der Anschein ... dass im Zeichen des modernen Verfassungsstaats, der Religionsfreiheit gewährt, und in den heutigen Kirchen, die diese Religionsfreiheit anerkennen und in Anspruch nehmen, die alte Spannung ihre Auflösung findet und ein unproblematisches Nebeneinander von Religion und Politik möglich ist, trügt.« (S. 326) Viertens führt er aus, dass – wie es Carl Schmitt zeigte– sich das Politische nicht einzäunen und beschränken lässt: »Das Politische ist kein abgrenzbarer Gegenstandsbereich, der neben oder unterhalb des religiösen Bereichs steht, es stellt vielmehr ein öffentliches Beziehungsfeld zwischen Menschen und Menschengruppen dar, das durch einen bestimmten Intensitätsgrad der Assoziation oder Dissoziation gekennzeichnet ist, der sein ›Material‹ aus allen Sach- und Lebensbereichen beziehen kann.« (S. 327)
Kann man jedoch überhaupt sagen, dass der gegenwärtige Staat, auch wenn er auf dem Prinzip der Religionsfreiheit gründet, »weltanschaulich-neutral« ist? Wenn es auch wahr ist, dass »die Aufgabe des Rechts in der modernen Gesellschaft sich ... umschreiben lässt als verbindliche, auf soziale Geltung abzielende Regelung des äußeren zwischenmenschlichen Zusammenlebens in einer Weise, die äußeren Frieden, persönliche Freiheit und Sicherheit für alle und jeden Einzelnen sowie die Ermöglichung angemessener Wohlfahrt sichert beziehungsweise verbürgt«, so lernen wir doch von Ernst-Wolfgang Böckenförde, dass im Recht immer ein Menschenbild enthalten ist. »In der Art, wie das Recht dies ... tut [d. h. das zwischenmenschliche Zusammenleben regelt, Anm. Z. K.], lässt es ausdrücklich oder indirekt eine Vorstellung vom Menschen erkennen: Als wer ist er anzusehen und was kommt ihm zu, worin ist er zu schützen, was ist ihm zu ermöglichen und wovon ist er fern zu halten.« (Vom Wandel des Menschenbildes im Recht, S. 5) Wenn es aber ein Bild von Menschen im Recht enthält, dann ist es immer philosophisch beladen, dann ist es immer auch mit einer »Weltanschauung« verbunden. Der Staat und das Recht bleiben Ausdruck einer politischen Gemeinschaft, der Staat ist Rahmen, aber zugleich Teil des politischen Prozesses.
Paul Nolte:
Ja, Böckenförde! Meine erste Begegnung fand als Student der Geschichte in Bielefeld statt. Vielleicht wehte damals auch noch der Geist von Herrn Böckenförde dort, den ich persönlich aber nicht kennen gelernt hatte. Damals lernte man vor allen Dingen, dass die konstitutionelle Monarchie, die die charakteristische Verfassung Deutschlands beziehungsweise der deutschen Teilstaaten im 19. Jahrhundert gewesen ist, auf Sand gebaut war – sozusagen aus sich heraus zu ihrer eigenen Überwindung drängte: zu einer Parlamentarisierung, zu einem parlamentarischen demokratischen Staatswesen des 20. Jahrhunderts drängte. Das war gedacht gegen die Überhöhung dieser deutschen konstitutionellen Monarchie und argumentiert gegen Ernst Rudolf Huber (einen bekannten Verfassungsgeschichtler und Verfassungstheoretiker aus einer wesentlich älteren Generation), der gesagt hat: »Nein, wir Deutschen sind anders. Wir haben diese konstitutionelle Monarchie und die sollte uns eigentlich auch auszeichnen und erhalten bleiben, denn das war eigentlich das Besondere.« Man lernte also, dass Böckenförde im Grunde in Richtung einer Verwestlichung argumentierte und dass Deutschland diesen Sonderweg der konstitutionellen Monarchie nicht weitergehen sollte.
Erst später bin ich dann auch auf diesen Satz gestoßen, mit dem wir es heute zu tun haben. Eine Antwort auf die Frage, was daran aktuell ist und warum wir uns noch mit diesem Satz beschäftigen sollten, ist ja schon gegeben worden.
Die Antwort sollte auf jeden Fall nicht zu vordergründig sein. Der Satz von Ernst-Wolfgang Böckenförde ist viel zitiert und aber auch aus dem Kontext gerissen worden. Kein Wunder dann, dass er auch aus ganz unterschiedlichen Richtungen instrumentalisiert, in Anspruch genommen, aber auch natürlich legitimerweise weitergedacht worden ist. Nicht zuletzt deshalb und auch weil ich Historiker bin, wähle ich zunächst einmal den kleinen Umweg über die Geschichte. Ich frage also – 1967 ist ja mittlerweile auch Geschichte geworden – zunächst einmal nach dem historischen Kontext und nach den historischen Bedeutungsschichten dieses, auf den ersten Blick vielleicht ungemein einleuchtenden, dann aber wieder komplizierter werdenden Satzes. Meine Grundthese wäre, dass dieser Satz, dieses Böckenförde-Diktum (unter diesen Stichwort kann man das auch »googlen«, habe ich festgestellt) – historisch gesehen – ein Scharnier bildet im Übergang von einer eher autoritär-etatistischen zu einer liberalen Staats- und Gesellschaftsauffassung in Deutschland. Es markiert im Grunde den Punkt, an dem die deutsche Staatstheorie und Staatsauffassung aus dem Schatten des allmächtigen Leviathan herausgetreten ist. Es markiert auch den Punkt – in dieser charakteristischen Formulierung – der freiwilligen Selbstaufgabe des Leviathan, ja, das Wagnis. Dies ist nicht zufällig ein Prozess, der in der Mitte der Sechzigerjahre seinen Höhe- und Wendepunkt erreichte. Die Sechzigerjahre waren eine Scharnierepoche.
Dazu hier noch vier kurze Bemerkungen:
1. Die Sechzigerjahre waren eine Scharnierepoche in sozialgeschichtlicher und bewegungsgeschichtlicher Hinsicht (Studentenbewegung usw.), aber auch geistes- und wissenschaftsgeschichtlich. Das fing an mit einem Impuls der Entdogmatisierung. Man wollte die alten Dogmen loswerden und wollte auch Dinge wie den Staat historisch betrachten sowie historisieren. Ein historisierender – und wie das damals sehr im Schwange war –, begriffsgeschichtlicher Ansatzpunkt ist ja auch der methodische Ansatzpunkt des Aufsatzes, an dessen Ende dieser berühmte Satz dann steht.
2. Ernst-Wolfgang Böckenförde ist Teil oder auch Mitglied der Nachkriegsgeneration, die heute so bezeichneten 45er-Intellektuellen. Also derjenigen Intellektuellengeneration, die durch die Zäsur 1945 in der deutschen Geschichte ihre besondere Prägung erfahren hat und über die jetzt vielfach auch schon historisierend geschrieben worden ist. Das ist ja vielleicht die wichtigste, kompakteste Intellektuellengeneration, die es, ich möchte durchaus sagen: je in der deutschen Geschichte gegeben hat. Es geht um die Geburtsjahrgänge etwa zwischen 1926/27 und 1932/33. Sie liegen da genau in der Mitte, Herr Böckenförde, mit so berühmten Namen wie Habermas oder Dahrendorf, Lübbe und Nipperdey, Enzensberger, Grass und so fort. Sie alle waren geprägt von der Erfahrung des Nationalsozialismus. Sie sind die so genannte Flakhelfergeneration. Sie sind nicht mehr diejenigen, die an die Front gemusst haben, aber noch eine Sozialisationserinnerung und -erfahrung im Nationalsozialismus mitgenommen haben, die auch geprägt wurden durch die Auseinandersetzung mit akademischen Lehrern, die dem Nationalsozialismus gedient haben: ob das nun Carl Schmitt war oder Ernst Forsthoff oder Theodor Schieder. Eine Generation, für die der Lernprozess im Vordergrund stand und das Bemühen – ich habe das vorhin schon angedeutet – die politische Kultur der Bundesrepublik eindeutig an die liberale Kultur des Westens anzuschließen.
3. Dies bedeutete in der damaligen Situation und in die nachwirkenden Jahrzehnte hinein eine Brückenfunktion. Eine Brücke, zum einen von traditionell rechten zu linken und liberalen Staatsauffassungen (und die Staatstheorie in Deutschland ist ja vorwiegend von rechten Positionen beherrscht gewesen), und das Böckenförde-Diktum ist dann in vielfacher Weise in linksliberalen Staats- und Gesellschaftstheorien aufgenommen und anverwandelt worden. Man kann Spuren auch bei Jürgen Habermas zum Beispiel im »Konzept des Verfassungspatriotismus« und anderswo finden. Dieses Denken hat aber auch andererseits eine Modernisierungsfunktion für die eher rechten Staatstheorien selber gehabt und ihnen die Möglichkeit zur Demokratisierung und Liberalisierung eröffnet. So wurde also auch dem rechten Denken die Möglichkeit gezeigt und der Weg gewiesen, aus dem Schatten von Diktatur und autoritärem Staat hinaus zu treten.
4. Ernst-Wolfgang Böckenförde bringt – ich glaube nicht, dass das nur er persönlich ist, aber ich glaube sicherlich auch – einen kritischen Katholizismus in die Staats- und Gesellschaftstheorie der Bundesrepublik mit ein. Der Schlusssatz dieses Aufsatzes wird nicht häufig gelesen und zitiert, ist aber auch zitierenswert. Die Aufforderung, dass die Christen diesen Staat in seiner Weltlichkeit nicht länger als etwas Fremdes, ihrem Glauben Feindliches erkennen, sondern als Chance der Freiheit, die zu erhalten und zu realisieren auch ihre Aufgabe ist, wäre – so meine These – vom Protestantismus als der preußisch-deutschen Staatsreligion aus nicht möglich gewesen. Ein Protestant hätte so nicht schreiben können. Hintergrund dieser Formulierung und dieses Denkens ist (wenn man das historisch sieht) die Versöhnung einer katholischen Minderheit in Deutschland mit einem Staat, den sie als feindlich und säkularisierend erlebt hat – seit dem Kulturkampf nicht zuletzt.
Heute sieht das natürlich längst ganz anders aus. Heute ist auch der Protestantismus längst von seinem etatistischen Sockel gestürzt und die Aufforderung Böckenfördes, die ich gerade zitiert habe, das heißt den Staat in seiner Weltlichkeit nicht als etwas Fremdes und dem Glauben Feindliches zu erkennen, könnte man inzwischen insofern eher als einen Appell an den europäischen Islam und seine notwendige Selbstaufklärung lesen. In meinem zweiten Teil möchte ich drei Bemerkungen machen zur Aktualität des böckenfördeschen Diktums. Ich schließe hier gleich bei diesem letzen Problem an. Mein erster Punkt für die Diskussion der Aktualität wäre die Frage von Religion und Säkularität, Christentum und Islam. Die gesellschaftliche Säkularisierung, nicht nur die theologische oder institutionelle, ist seit den Sechzigerjahren, seitdem dieser Aufsatz geschrieben beziehungsweise diese Formulierung geprägt worden ist, noch einmal massiv fortgeschritten. Zugleich aber ist es auch eine nicht nachlassende, eher wieder zunehmende Präsenz (wir haben darauf schon angespielt) von Religion im öffentlichen Diskurs.
Ich meine, von ErnstWolfgang Böckenförde lernen, heißt weiterhin zu insistieren auf der Säkularität des Staates als der Bedingung der bürgerlichen Freiheit, aber andererseits auch den Bedarf nach denjenigen Sinnpotenzialen im politischen Raum zu erkennen, die durch die Säkularisierung aus diesem verdrängt worden sind. Dann ergibt sich eine neue Notwendigkeit, nach den »inneren Antrieben und Findungskräften, die der religiöse Glaube vermittelt«, zu fragen. Böckenförde wäre dann schon 1967 so etwas gewesen wie der Theoretiker der postsäkularen Gesellschaft »avant la lettre«.
Zweitens – und davon war bislang interessanterweise noch gar nicht die Rede – scheinen mir zwei Begriffe bei Böckenförde sehr wichtig: Sozialstaat und Demokratie. Der Satz Böckenfördes und der ganze Kontext und die ganze Argumentationsrichtung dieses Aufsatzes und anderer Schriften verweist – und das wird weniger häufig gesehen – ganz zentral auf Legitimationsfragen des Staates und die Rolle des »Staates der Daseinsvorsorge«. Diesen Begriff hat Ernst Forsthoff, ein berühmter Staatsrechtler in den Dreißigerjahren (1937, glaube ich), in der Zeit des Nationalsozialismus geprägt und hier liegen ja auch wichtige Wurzeln unseres sozialstaatlichen Denkens. Kann der Staat, so wird bei Böckenförde gefragt, dadurch stabilisiert werden, dass er zum »Erfüllungsgehilfen der eudämonistischen Lebenserwartung seiner Bürger wird«, zum Erfüllungsgehilfen des privaten Glückes also oder auch der Selbstverwirklichung? Daran hat Böckenförde Zweifel geäußert, die sich wie ein vorweggenommener Zweifel an der Selbstverwirklichungs-, Egound Spaßgesellschaft der Achtziger- und Neunzigerjahre und der Selbstbedienungsmentalität der Bürger am Staat lesen. Es gibt ja ein fundamentales Spannungsverhältnis, auch schon in der konservativen, der schmittschen Staatstheorie der späten Sechzigerund frühen Siebzigerjahre, aus deren Wurzeln Böckenförde selber in mancher Hinsicht kommt.
Einerseits wird der Staat gedacht (Forsthoff) als Versorgungs-, als Dienstleistungs-, als Sozialstaat und als Staat der Gesellschaftsplanung. Andererseits wurde gleichzeitig davor gewarnt, dass (berühmte Formulierung von Arnold Gehlen) »der Staat, der Leviathan, nicht zur Milchkuh werden dürfe«, der von den Bürgern nur sozusagen transfermäßig abgezapft wird. An dieses Dilemma mit seinen ganzen Problemen, die daran hängen, kann man sicherlich nicht umstandslos anknüpfen, aber ein ähnliches Dilemma prägt ja durchaus unsere gegenwärtigen Debatten über den Sozialstaat. Wenn Leistungsversprechen des Staates zurückgefahren werden, darf darunter die Stabilität der Demokratie/der freiheitlichen Ordnung nicht leiden. Das wollen wir jedenfalls nicht. Also müssen die Bürger dafür gewonnen werden, die Demokratie nicht nur oder nicht primär wegen ihrer sozialstaatlichen Versorgungsfunktion zu schätzen. Gleichzeitig, und das macht das Dilemma daran aus, bleibt die soziale Verpflichtung des Staates zu verteidigen.
Dritter und letzter Punkt der Aktualität ist natürlich die plurale Kultur und Wertebindung. Homogenität als Leitkultur? Ernst-Wolfgang Böckenförde erinnert in den und für die gegenwärtigen Kontroversen daran, dass es nicht Aufgabe des Staates sein kann, in einer pluralen und individualisierten Gesellschaft verbindliche Ideologiestiftung vorzunehmen. Der Staat gibt selber keine Kultur der Freiheit vor. Er produziert sie nicht als konkrete Handlungsanweisung für seine Bürger. Er muss sich vielmehr auf diejenigen Ressourcen des Zusammenhalts und der Freiheitsstiftung verlassen, die in der Gesellschaft selber generiert werden. Sonst droht der (Zitate aus dem Buch von Herrn Böckenförde selber) »Totalitätsanspruch«, die »verordnete Staatsideologie«, man könnte auch sagen: der rousseauistische Konformismus.
Doch zugleich gilt es eben diese Ressourcen im Blick zu halten. Sie kommen aus zwei Quellen (so scheint mir das zumindest bei Böckenförde gedacht zu sein): aus einer individualistischen und andererseits aus einer eher gesellschaftlichen Quelle. Aus der (ich greife wieder Ausdrücke von Böckenförde selber auf) »moralischen Substanz des Einzelnen« und aus der »Homogenität der Gesellschaft«.
Mit dem individualistischen Teil würden wir uns heute prinzipiell leichter tun als mit der gesellschaftlichen Homogenität, von der Böckenförde damals gesprochen hat, was nicht heißt, dass es leichter wäre, die moralische Substanz des Einzelnen im Sinne freiheitlicher Überzeugungen zu stärken.
Verbirgt sich hinter der zweiten, der gesellschaftlichen Quelle »Homogenität der Gesellschaften«, nicht sogar mehr als eine Leitkultur?, so möchte ich kritisch fragen. Unter einer Leitkultur könnte man ja einen Bezugsrahmen, einen demokratisch-zivilen, freiheitlichen Minimalkonsens pluraler Gesellschaft verstehen – in dieser weiter gehenden Vorstellung aber die Idee, die Einheit und die bindenden Kräfte noch fundamentaler, nämlich in der Struktur einer homogenisierten Gesellschaft, erzeugen zu wollen. Man muss auch dem Böckenförde von 1967 – erst recht nicht dem späteren – diese kritische Lesart geben. Das Problem aber bleibt, wie denn eine Gesellschaft die Voraussetzungen der Freiheit, eben über die moralische Substanz des Einzelnen hinaus, auch intersubjektiv klären und anerkennungsfähig machen kann. Vielleicht sollte man dann, und das wäre mein Vorschlag, doch über die Werte sprechen, obwohl Ernst-Wolfgang Böckenförde dem Rekurs auf die Werte (wir haben es vorhin schon gehört) sehr skeptisch gegenübersteht.
Müssen Werte an die »Skylla: Beliebigkeit des Subjektivismus der Tageswertungen« (das hatte Herr Preuss schon zitiert) einerseits, an die »Charybdis: Totalitarismus der Werte« andererseits führen? Ich glaube, es gibt andere, zum Beispiel eher aus angelsächsischen Traditionen argumentierende Strategien der Wertebegründung, an die man hier anknüpfen könnte.
Ernst-Wolfgang Böckenförde
Das ist ja eine etwas eigenartige Situation, wenn man an einer Diskussion teilnimmt, bei der über die Sinnhaftigkeit, Bedeutungsvielfalt oder auch Problematik eines Satzes diskutiert wird, der vor 37 Jahren geschrieben worden ist. Ich glaube, es ist dann immer gut, wenn man dem mal auf die Spur kommen will, was der Satz eigentlich besagt, die Entstehungssituation und den Kontext aufzusuchen.
Man sollte sich dabei aber doch im Klaren darüber sein, dass, wenn so ein Satz entsteht und seine Karriere macht, es dann natürlich so ist, dass das, was man eigentlich gesagt hat, erst der andere Tag sagt. Es ist unter Umständen mehr und auch etwas anderes, als das, was der Autor sich beim Schreiben dabei vorgestellt hat.
Nun aber zur Entstehungssituation des Satzes. Er steht in einem historischen (verfassungshistorischen) Beitrag über die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation (verfassungshistorisch und auch etwas theoriegeschichtlich) und er ist formuliert als diagnostischer Satz.
Er sagt, dass der Staat entstanden ist als Vorgang der Säkularisation, das heißt, er wurde zunehmend entlassen und emanzipierte sich aus kirchlich-geistlicher, christlicher Herrschaft und Bestimmung und wurde ein weltliches Gemeinwesen, das weltliche Aufgaben wahrnimmt und in der Religion nicht mehr seine Grundlage sieht. Anerkennung der Religionsfreiheit (der Freiheit zu glauben oder nicht zu glauben, den Glauben zu bekennen oder nicht, die Religion öffentlich auszuüben oder das nicht zu tun) als Freiheitsrecht, das war im Grunde der zentrale oder auch der Schlusspunkt seiner Verweltlichung. Dadurch entsteht dann die Frage, wenn der Staat dies tut und auf Religion als seine verbindliche Grundlage verzichtet, woraus lebt der Staat dann? Dies gilt ja nicht allein für die Religionsfreiheit, sondern die Freiheitsrechte des liberalen Staates beziehen sich ja auch auf die Kultur (die Kunst und die Wissenschaft). Alles dies ist in Freiheit gesetzt und von daher vom Staat nicht mehr zu regulieren, nicht mehr in bestimmter Weise verbindlich zu machen und anderes auszuschalten.
Die Frage, die dann eben entsteht, ist, woraus lebt ein freiheitlich geordnetes Gemeinwesen dann? Woraus erzielt es seine Kräfte? Es bedarf solcher Kräfte. Wie die Freiheit regulieren, wie ihr Impulse geben, wenn sie ausgeübt wird und wenn alles zusammen bestehen soll? Der Satz sagt dann ganz bewusst, »der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht garantieren kann«. Er sagt ja nicht – und da kommen die Deutungen und, aus meiner Sicht, zum Teil die Fehldeutungen zu Stande – der Staat kann dafür überhaupt nichts tun. Er sagt eher, der Staat kann das nicht garantieren. Er kann nicht mit seinen spezifischen Mitteln, das heißt hoheitlichen Anordnungen und gesetzlichem Gebot, irgendetwas zu garantieren versuchen, aber er kann natürlich etwas fördern, er kann etwas stützen und schützen. Insofern – das war auch damals schon die Intention – sollte es eine Problemanzeige sein.
Der Staat, der als freiheitlicher Staat – mit den Freiheitsrechten des Einzelnen – organisiert ist, ist jetzt sozusagen auf Kräfte angewiesen, die er seinerseits nicht garantieren und auch nicht aus sich heraus schaffen kann. Vorhandene Kräfte kann er aber stützen und auch schützen. Insofern kann der Staat sich dafür Raum geben und Bedingungen schaffen, dass sich das entwickeln kann, aber er ist daran gebunden, dass sich da etwas von selbst herstellt und erneuert. Ich glaube das deckt sich ja weithin mit der einen Deutung, die Herr Preuss – als seine eigene – gebracht hat.
Von mir aus hat dieser Satz eine Anzeigefunktion für das, was Herr Krasnodebski gesagt hat. Ja, inwieweit kann und soll der Staat neutral sein? Er kann ja gar nicht völlig inhaltslos sein und er kann eben nicht rein aus formalen Institutionen heraus leben, sondern er braucht Kräfte und Grundhaltungen, die ihn tragen
Jetzt komme ich auf den Satz mit der Homogenität. Man kann das Wort ja kaum noch in den Mund nehmen. Ich habe – damals noch nicht, aber später – von relativer Homogenität gesprochen. Damit meine ich gewisse gemeinsame Grundauffassungen, die Ausdruck einer Zusammengehörigkeit sind beziehungsweise, dass man sich in gewissen Dingen versteht oder auch einig ist. Man kann das Problem auch mit einem Wort von Adolf Arndt charakterisieren, der ja insofern ein unverdächtiger Zeuge ist. Er sagt: »Demokratie als System der Mehrheitsentscheidung setzt die Einigkeit über das Unabstimmbare voraus.« Niemand ist bereit, sich bei Dingen, die für ihn beste Überzeugungskraft haben, sozusagen niederstimmen zu lassen von einer Mehrheit. Also die Einigkeit über das Unabstimmbare – das würde ich sagen – zeigt das an, auch wenn man über relative Homogenität vernünftig diskutieren will.
Ja, jetzt noch eine konkrete Frage im Hinblick auch auf die Aktualität. – Da würde ich in der historischen Deutungsgeschichte erneut weitgehend Herrn Nolte zustimmen. Es war in der Tat eine Brückenfunktion für eine Vermittlung zwischen Rechts und Links in der Staatsauffassung oder Staatstheorie. Ich habe das ja selbst erlebt: Erinnern wir uns in Niedersachsen an die Kämpfe um die Konfessionsschulen. Das war in den Fünfzigerjahren und ging bis in die Sechzigerjahre hinein. Da kam immer die Begründung: »Der Staat, der ist ja nicht mehr ein christlicher Staat.« Das führte (stärker bei den Katholiken als bei den evangelischen Christen) zu einem Vorbehalt. Da war die Intention zu sagen: Der freiheitliche oder der weltliche Staat kann kein christlicher Staat sein und das kann man ja an der Religionsfreiheit festmachen. Denn ein Staat, der Religionsfreiheit gewährt, hat nicht die Religion als verbindliche Grundlage seiner Ordnung. Er hat die Möglichkeit von Religion, aber er garantiert nicht Religion. Das war auch der Impetus des letzten Satzes. Ihr, meine lieben Glaubensbrüder, jetzt seht doch mal zu, hängt nicht dem verlorenen Ideal eines christlichen Staates nach.
Für den katholischen Bereich: Die Staatslehre des katholischen Leo XIII. war ja damals noch aktuell und der Widerruf von Johannes Paul II. war noch nicht geschehen. Johannes Paul der II. hat ja alles implizit widerrufen, indem er den religiös-neutralen Staat anerkennt und sagt, das ist genau das, was von der Religionsfreiheit als Menschenrecht her gefordert und geboten ist, es bringt eine Versöhnung mit sich. Auf der anderen Seite hatte er auch eine Brückenfunktion in dem Sinne, dass auch Freiheiten möglich sind, aber auch an Bedingungen geknüpft sind und dass der Staat auch gewisse Aufgaben hat. Das war damals noch nicht aktualisiert. Ich finde, was in der Diskussion auch viel zu wenig betont worden ist, ist die Aufgabe der Schule und der Erziehung.
Wenn dies von gewissen Grundeinstellungen und Auffassungen abhängt und wenn Freiheit – was meine Auffassung ist – aus Fundamenten lebt, die ihr voraus liegen. Freiheit aktualisiert etwas, was der Einzelne an Überzeugungen, an Auffassungen, an Zielen in sich trägt und wozu er sich bekennt. Dann ist es eine Aufgabe, das zu aktivieren, lebendig zu erhalten und die Erziehungsaufgabe der Schule ernst zu nehmen. Nicht im Sinne einer Staatsideologie, sondern in dem Sinne, dass diese Kräfte – die Fundamente der Freiheit – lebendig gehalten werden und dass sie sich in den Generationen wieder erneuern. Man kann das auch noch etwas prinzipieller fassen und damit möchte ich dann schließen.
Wir haben ja allgemein so gerne die Auffassung (sie scheint heute ziemlich konveniert zu sein), dass wir alle »okay« sind. Wenn das so ist, dass wir alle »okay« sind, dann gehört bei der Erziehung ja nur noch dazu, das alles frei sich entwickeln zu lassen, und dann kommt das schon alles an sein gutes und richtiges Ziel. Wenn man aber die Auffassung hat (und der neige ich zu), dass der Mensch von Natur aus ambivalent ist: Er ist weder von Natur aus böse, noch von Natur aus gut, sondern er hat eine Ambivalenz in sich – beide Möglichkeiten –, dann kommt es für Erziehung (im Elternhaus, in der Schule) darauf an, die eine Möglichkeit zu fördern, zu stützen und zu entwickeln und die andere zurückzudrängen. Also nicht alles einfach nur sich selbst zu überlassen, weil es ohnehin schon »okay« ist! Wenn das so geschieht und die Erziehungsaufgabe so wahrgenommen wird, dann stellen sich auch die Grundlagen immer wieder her, die der freiheitliche Staat braucht, um als solcher – ohne seine Freiheitlichkeit aufgeben zu müssen – existieren zu können.
Das Widerständige des böckenfördeschen Diktums
Wahrheit und Sinn sind nicht dasselbe. Der Grundirrtum, dem alle speziellen metaphysischen Trugschlüsse nachgeordnet sind, besteht darin, den Sinn nach der Art der Wahrheit aufzufassen. Hannah Arendt, 1977 Auch wenn der Begriff der Menschenwürde aus christlichen Wurzeln heraus entstanden und geformt worden ist, erhält die unabdingbare Subjektstellung, auf welche die Würde abhebt, ein unterschiedliches konkretes Profil, je nachdem, ob der Mensch als Gemeinschaftswesen im Sinne des Aristoteles, als auf sich gestelltes Individuum, als imago dei im Sinne des christlichen Menschenbildes oder davon abgelöst verstanden wird. Ernst-Wolfgang Böckenförde, 2001 Die Politik Arendts als eine Antwort auf den modernen Nihilismus zu sehen, bedeutet ihren Hinweis, dass wir die Politik um der Welt willen brauchen, verstehen.
Bonnie Honig, 1991
Der Arendt-Preis, das Diktum und die Interventionen Böckenfördes: gute gegenseitige Beleuchtungen
Unsere Ausgangsthese: Die arendtsche Wiederbelebung eines emphatischen Politikverständnisses bildet einen vorzüglichen Hintergrund für die Erfassung der zentralen Aporie des Diktums der öffentlichen und denkerischen Interventionen Böckenfördes, zu denen eine spezifische Widerständigkeit gegenüber den übermächtigen Naturalisierungen und abstrakten Moralisierungen unserer geschichtlichen Welt gehört. Sie ist somit auch eine spezifische Resistenz gegenüber dem, was in unserer Zeit, prozesshaft und scheinbar nicht unterbrechbar, mit dem Anschein der Endgültigkeit in der Modernisierung und »Globalisierung« der Welt auftritt. Wo können wir nun die fragliche und spezifische Widerständigkeit im Diktum verorten? Sie tritt in der Widerständigkeit seiner spannungsgeladenen Aporie gegenüber allen Versuchen ihrer geschichtsphilosophischen oder funktionalistischen Auflösung auf. Das Diktum lässt gerade den »säkularisierten Staat«, den Sicherheitsgaranten moderner Gesellschaftlichkeit schlechthin, als das Produkt eines einzigartigen »Wagnisses« erscheinen. Unsere so »gewagte« politische Sicherungseinheit wird, in dieser Konstellation, durch keine noch so perfektionierte »Sicherheitspolitik« wagnisfreier. Das, was hier mit »um der Freiheit willen« charakterisiert wird, ist, genau besehen, nicht mehr eindeutig auf einen objektivierbaren Staatsinnenraum beziehbar. Das Politische unserer institutionalisierten modernen Einheitsformen erscheint als ein im klassischen, rationalistischen Sinn Unbegründbares. War es die eigentümlich ansprechende Spannung dieser Aporie, die dem Diktum die – in der Moderne seltene – Bedeutsamkeit eines Spruches verlieh? Auch wenn hier nicht auf das Spezifische der Widerständigkeit, die hier gegenüber dem Anspruch des politischen Begründungswissens im Spiel ist, länger eingegangen werden kann, ist es schon auf den ersten Blick deutlich: Es ist, im Unterschied zu den klassischen, ideologisch-politischen »Widerständigkeiten« weder an eine Fortschritts- noch an eine Verfallsgeschichte gebunden. Sie ist folglich weder »fortschrittlich« noch »konservativ« verortbar. Zur Parallele: Es ist schon seit einiger Zeit deutlich geworden, dass es innerhalb der neu belebten politischen Rationalismen der zweiten Nachkriegszeit lange Zeit unmöglich war, den »Ort« wahrzunehmen, von dem aus die Werke Hannah Arendts gedacht und geschrieben wurden. Da dieser »Ort« auf den geistesgeschichtlichen Karten zwar schon öfters aufgetaucht, aber noch bei weitem nicht richtig bekannt ist, kommt es noch immer zu absurden Topologien, in denen, zum Beispiel, es eine Arendt gibt, die aus einem »guten« (jüdischen) Ort heraus schreibt, und eine andere, die es aus einem weniger guten (deutschen) Ort heraus betreibt.
Politisierende Interventionen
Die Parallelsetzung der Widerständigkeit der Aporie und des »entgründeten« Politikverständnisses im Diktum mit der arendtschen Art des widerständigen Denkens und Verstehens muss zunächst als eine gewaltsame erscheinen. Kann sie durch relevante Züge im Werk und in den Interventionen Böckenfördes in etwa bestätigt werden? Gewiss: Das Denken und die Interventionen Böckenfördes kommen nicht mit der Fahne des Widerständigen und des radikalen Einspruchs einher. Es fällt aber nicht schwer, auf Interventionen und auf hochbedeutsame Einsprüche gegenüber von nach wie vor hegemonischen Verständnisweisen unserer politischen und geschichtlichen Wirklichkeit hinzuweisen, die bestimmte Parallelen nahe legen.
Wir sehen sie, zum Beispiel, im vielleicht wichtigsten Essay Böckenfördes der letzten Jahre, im: Der Wandel des Menschenbilds im Recht (2001). Zentral im Essay ist die Herausstellung eines spezifischen und symptomatischen Vergessens des Politischen in der durchgehenden Zentralität eines liberal-individualistischen »Menschenbildes« und Rechtsverständnisses. So wird, zeigt Böckenförde, in der zur Selbstverständlichkeit geronnenen Formel: »Der Mensch ist nicht für den Staat da, sondern der Staat für den Menschen« schlicht vergessen, »dass der Mensch auch für die politische Gemeinschaft da ist«. Dabei geht es Böckenförde nicht um die übliche »Überwindung« des Vergessens. Es ist ihm klar, dass es »zu nichts führt, religiöse oder philosophische
Begründungen normativer Menschenbilder« gegen dieses Vergessen (oder Vergessenwollen) heraufzubeschwören. Es geht ihm wohl eher um eine Arbeit gegen das »Vergessen des Vergessens« (um eine heideggersche Formel anzuwenden), gegen die schicksalsergebene Kollaboration mit demselben, in der auch der Sinn des Politischen zu schwinden droht. Die Parallelen mit der nichtinstrumentellen Art des arendtschen Verständnisses der antignostischen Widerständigkeit sind, meine ich, wahrnehmbar. Wir sehen sie auch in der breiter wahrgenommenen »resistenten« Intervention Böckenfördes zu der Neufassung des maßgeblichen Kommentars zum Grundgesetz. Er sieht in der besagten Neufassung eine verschleierte »Zäsur«, durch die, wie es im Titel seines diesbezüglichen Essays hieß, der Satz: »Die Würde des Menschen ist unantastbar« sich in Wahrheit zum Satz: »Die Würde des Menschen war unantastbar« wandelt. Die Neuinterpretation bringt, so stellt es Böckenförde heraus, eine neue Qualität des Abwägens in die Anwendungen des Satzes hinein, die den Prinzipiencharakter des Satzes radikal verändert.
Es gibt noch eine wesentliche Widerständigkeit im Denken Böckenfördes gegenüber einem fast selbstverständlich gewordenen Grundmuster unseres politischen und moralischen Handlungsverständnisses. Wie kaum ein anderer, auch in der politischen Öffentlichkeit auftretender Denker in Deutschland wendet er sich gegen das bequeme Falschspiel, das, Politik verdeckend, mit den Bezügen auf »Werte«, »Grundwerte« und »Wertegemeinschaften« getrieben wird. Bekanntlich sollten diese Bezüge als »übermaterielle« Supplemente der – auch als selbstverständlich vorausgesetzten – Individual- und Kollektiv-»Interessen« dienen. Sie sollten nicht bloß – wirklichkeitsfern – »gelten« (so wie sie ursprünglich in den Idealismusresten des Neokantianismus konzipiert worden sind). Sie sollten – in einer imaginären Paarformierung mit den »Interessen«, einen nobleren Zement für den konkreten Zusammenhalt der Gesellschaft oder der politischen Gemeinschaft bilden. Mit den Werten, so Böckenförde, postuliert man eine abgehobene Konsensform unserer politischen Einheiten, die »die Wirklichkeit unseres Lebens und Zusammenlebens verfehlt«. Das ideologisch-politisch Entscheidende dabei ist, dass die Sprache der Werte genau dort auftaucht, wo die geschichtliche, symbolische an das andere ansprechende Dimension unserer konfliktiven Zusammenhalte durch abstrakt-allgemeine Werte ersetzt werden sollte. Die Bedeutung dieser ungewohnten öffentlichen Hinterfragung der Selbstverständlichkeit, mit der durch die Gegensatzpaare: Interessen – Werte (d. h.: naturhaftes Sein – moralisch Gebietendes) die Gesamtheit der legitimen Gründe des politischen Handelns abgedeckt wird, kann leicht unterschätzt werden. Zwei kurze Beleuchtungen sollen sie besser herausheben. Es kann gezeigt werden, dass die implizite Sozialontologie dessen, was Böckenförde präzise die neokantianische »Auseinanderreißung von Sein und Sollen« benennt, das im emphatischen Sinn Politische im Vorhinein ausschließt. Zwischen den Determinismen des naturhaft Gesellschaftlichen, die in den biologistischen Vorstellungsweisen von »Evolution« oder von »System-Umwelt«-Totalisierungen vorherrschen, und des werthaft Normativen, das ein ambivalenzbereinigtes Gutes gleichsam garantierend repräsentiert, bleibt für symbolisch und ereignishaft übertragene, freiheitsbezogene und plurale Erfahrungs- und Handlungsräume einfach kein Platz. Die eigenständige Artikulierung dieser Hinterfragung erfolgt bei Böckenförde aus einem »Ort« heraus, der nicht in diesen Artikulierungen selber entstand. Er entstand vornehmlich in jener krisenhaften Konstellation der westlichen Erfahrungs- und Denkgeschichte der »mitteleuropäischen« Zwanzigerjahre. So hat ihre Relevanz allerdings ein bemerkenswertes Nachleben in den Versuchen, die Einbrüche des 20. Jahrhunderts als Unfälle zu buchen, die die Grundcharakteristiken der Geschichte nicht wesentlich tangieren. Wie es bekannt sein dürfte, hatte der arendtsche Widerstandsort heideggersche Grundzüge. Der von Böckenförde kam wohl in der Carl Schmitt’schen Neubelebung eines emphatischen und ereignisbezogenen Politikbegriffes zu Stande.
PS: Wir können hier nur mit einem Satz auf die Bedeutung der Art und Weise hinweisen, in der die Widerständigkeit Böckenfördes bei aktuellen politisch-geschichtlichen Fragen ins Spiel kommt. Seine Bremer Preisrede zum EU-Beitritt der Türkei – mit einem sonst kaum thematisierten politikgeschichtlichen Hintergrund – hat zu Recht Irritationen in jenem Meinungsspektrum ausgelöst, für die es eine Zumutung bedeutet, das Politische anders als unter funktionalistischen oder moralischen Perspektiven wahrzunehmen.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz