
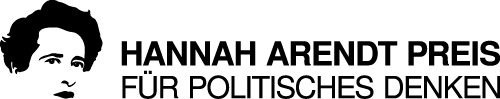

Ann Pettifor ist eine in Südafrika geborene britische Ökonomin und Autorin, die als Direktorin der Denkfabrik PRIME (Policy Research in Macroeconomics) und Fellow der New Economics Foundation tätig ist. Sie ist vor allem für ihre korrekte Vorhersage der Finanzkrise von 2007-08 in ihrem Buch The Coming First World Debt Crisis (2006) bekannt und führte die internationale Jubilee 2000-Kampagne für den Schuldenerlass der ärmsten Länder an, die zur Streichung von etwa 100 Milliarden Dollar Schulden führte.

© Pako Mera / Alamy Stock Photo
Sehr verehrte Damen und Herren,
liebe FreundInnen und UnterstützerInnen des
»Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«,
dear Mrs. Pettifor.
Ich darf Sie im Namen des Vereins »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken« und im Namen des Vereinsvorstandes ganz herzlich zur diesjährigen Preisverleihung in der festlichen Oberen Rathaushalle begrüßen.
Die internationale Jury hat entschieden, dass der »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken∑ diesmal einer politischen Ökonomin, oder: um es präziser zu sagen, einer unablässig politisch intervenierenden Denkerin überreicht wird: Ann Pettifor. Die Preisträgerin ist unter anderem Direktorin des Netzwerkes Policy Research in Macroeconomics (PRIME), das sich mit keynesianischer Geldtheorie und Politik auseinandersetzt. Sie lehrt, und ich bin wieder versucht zu sagen: unter anderem, am Political Economy Research Centre der City University London. Politisch hat sie mitunter maßgeblich an der Jubilee 2000-Kampagne mitgewirkt, einer globalen Bewegung, der Beachtliches gelungen ist, und wovon Ihnen Ann Pettifor in ihrem Festvortrag selbst berichten wird. Offenbar sind politische Interventionen nach wie vor keinesfalls aussichtslos.
Liebe Damen und Herren, der Hannah-Arendt-Preis versteht sich, wie Sie wissen, in erster Linie als ein politischer und nicht als ein akademischer Preis. Erlauben Sie mir daher kurz auf das jüngst erschienene und vorzügliche Buch der Preisträgerin hinzuweisen, welches den Titel trägt: Die Produktion des Geldes. Ein Plädoyer wider die Macht der Banken. Diese Schrift ist ebenfalls weniger eine akademische Abhandlung als vielmehr ein politisches Manifest. Es ist, ohne den Ausführungen der Jury an dieser Stelle allzu weit vorzugreifen, ein Motiv dafür gewesen, dass Ann Pettifor heute Abend der »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken« zugedacht wird. Das Buch steht geradezu exemplarisch für ihre politische Grundüberzeugung, der zufolge das, was in der Welt geschieht und alle angeht, auch von allen verstanden werden sollte. Sie pflegt, und das ist durchaus erwähnenswert, einen gewissermaßen demokratischen Schreibstil. Das heißt: Sie schreibt im Hinblick auf die bis heute nicht ausgestandene, geschweige denn hinreichend verstandene weltweite Finanzkrise und über die verheerenden Auswirkungen des globalen Finanzkapitalismus so verständlich, dass man es versteht. Dass das „Verstehen" für Ann Pettifor gleichsam „die andere Seite des Handelns" darstellt, lässt sich kaum prägnanter formulieren als in den Worten der Preisträgerin selbst, wenn sie in einem Interview betont: »The public are not stupid. They do understand these complexities. They can get it, and when they get it, they can act. But if they don't have […] facts […], it's very difficult to act and it's very difficult to change systems.«
Doch wie lässt sich die laut Ann Pettifor »despotische Macht« des von Eigeninteressen geleiteten globalen Finanzsektors zugunsten eines am Gemeinwohl orientierten Geldsystems überwinden? Wie geht überhaupt eine alternative politische Machtbildung vor sich? Wie ist es um die Selbsterneuerungsfähigkeit moderner Demokratien bestellt, die sich den scheinbar unabänderlichen neoliberalen Markterfordernissen zunehmend unterwerfen? Zusammengefasst gefragt: Wie lässt sich die geforderte »große Wende« (Ann Pettifor) politisch realisieren? Und wie sind in diesem Zusammenhang z.B. die Erfolge und Grenzen zu interpretieren, welche die weltweiten und in sich höchst heterogenen Protestbewegungen (Occupy, Attac etc. pp.) gegen den Finanzkapitalismus bislang erfahren haben?
Hierzu findet am morgigen Samstag im Institut Français, wie gewohnt um 11 Uhr, ein Symposium statt, das unter dem Titel »Die Macht der Finanzmärkte und die (Ohn-)Macht des Politischen?« steht. Es werden miteinander sprechen und diskutieren: Rudolf Hickel, Dieter Rucht und Ann Pettifor. Moderiert wird das Kolloquium von Antonia Grunenberg.
Wir sind froh, mit dem Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel und dem Protestforscher Dieter Rucht, gleich zwei höchst renommierte Wissenschaftler heute Abend begrüßen zu können. Rudolf Hickel dürfte nicht nur den BremerInnen bekannt sein. Er hat als Professor für Politische Ökonomie und später als Professor für Finanzwissenschaften an der Bremer Universität gelehrt. Rudolf Hickel ist unter anderem Direktor gewesen des an der Universität ansässigen Instituts Arbeit und Wirtschaft und ist mittlerweile dortiger Forschungsleiter. Eine seiner zahlreichen Publikationen trägt übrigens den Titel: Zerschlagt die Banken; Zivilisiert die Finanzmärkte.
Dieter Rucht, Professor für Soziologie, ist Mitbegründer des Berliner Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hat er beispielsweise die Forschungsgruppe Zivilgesellschaft, Citizenship und politische Mobilisierung mitgeleitet. Er erforscht seit mehreren Jahrzehnten vor allem soziale, politische und internationale (Protest-)Bewegungen und ist hierüber ebenfalls einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Schön, dass Sie beide hier sind.
Ich darf Sie nun mit dem weiteren Verlauf der heutigen Festveranstaltung vertraut machen.
Zunächst werden die VertreterIn der beiden preisstiftenden Institutionen zu Wort kommen. Für den Senat der Freien Hansestadt Bremen wird die Bürgermeisterin Karoline Linnert sprechen, für den Vorstand der Heinrich Böll Stiftung Ellen Ueberschär. Wir möchten den genannten Geldgebern, die den Hannah-Arendt-Preis seit so vielen Jahren finanziell und ideell unterstützen, bei dieser Gelegenheit nochmals und ausdrücklich dafür danken, dass sie es sich nicht nehmen lassen, alljährlich Abende wie diesen zu ermöglichen. Dem Senat der Stadt Bremen und der Heinrich Böll Stiftung gilt daher unser besonderer Dank.
Im Anschluss an die erwähnten Ansprachen der StifterInnen des Preises wird Monika Tokarzewska als Mitglied der Internationalen Jury die Begründung der Preisvergabe zusammen mit der Laudatio verlesen.
Es folgt dann der Festvortrag von Ann Pettifor, auf den wir alle sehr gespannt sind.
Danach werden Rudolf Hickel und Dieter Rucht dankenswerterweise bereits am heutigen Abend jeweils ihre inhaltlichen bzw. weiterführenden Kommentare zu Ann Pettifor vortragen. Wir freuen uns über diese Neuerung im Abendprogramm, die Ihnen vielleicht einen kleinen Vorgeschmack auf das morgige Kolloquium im Institut Français geben wird.
Der Abend im Rathaus klingt dann, und dies ist keine Neuerung, traditionell mit der Preisübergabe hier und einem gemeinsamen Sektempfang im Nachbarsaal aus und hoffentlich – in einem guten Sinne – noch lange nach.
Last but not least sind Sie alle, liebe Anwesende, herzlich dazu eingeladen, nach dem Sektempfang an einem kleinen Buffet, das heute Abend zu Ehren der Preisträgerin im Institut Français aus- und angerichtet wird, teilzunehmen. Ob dies nun zu einer organisatorischen Krise führen wird, ist, wie Vieles in dieser Welt, nicht absehbar; sie würde aber, und da darf ich Sie beruhigen, unsererseits dann nicht »gemanagt«, sondern schon irgendwie »gedeichselt« werden. Also: Partizipieren Sie ruhig! Damit überreiche ich nun das Wort an die Bürgermeisterin Karoline Linnert. Anschließend spricht, wie gesagt, Ellen Ueberschär für die Heinrich Böll Stiftung. Danach erfolgt die Jurybegründung und Laudatio von Monika Tokarzewska.
Vielen Dank!
Sehr geehrter Frau Pettifor,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich, dass wir heute gemeinsam den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken verleihen. Wir, das sind die Heinrich Böll Stiftung Bremen, der Verein »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken e.V.« und der Bremer Senat, für den ich hier stehe.
Wir verleihen diese Auszeichnung heute der Ökonomin und Finanzwissenschaftlerin Ann Pettifor, gebürtig aus Südafrika und heute britische Staatsangehörige.
Sehr geehrte Frau Pettifor,
Sie sind unter anderem durch ihre führende Rolle in der Jubilee 2000-Kampagne bekannt geworden. Die führte zum Jahrtausendwechsel dazu, dass 35 Entwicklungsländern Schulden in einer Gesamthöhe von rund 100 Milliarden US-Dollar erlassen wurden.
Herzlich Willkommen in Bremen! Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind!
Mit dem Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken ehren wir diejenigen Menschen, die es riskiert haben, das »Wagnis Öffentlichkeit« einzugehen und immer wieder neu eingehen. Die Preisträgerinnen und Preisträger erkennen das Neuartige in einer scheinbar sich linear fortschreibenden Welt denkend und handelnd und teilen es der Welt mit.
Das haben auch Sie, liebe Frau Pettifor, getan, als Sie eine der ganz wenigen Personen waren, die schon mit Beginn der US-Immobilienkrise – im September 2006 – sehr präzise die kurz bevor stehende, weltweite Finanz- und Bankenkrise vorher gesagt haben.
Die BBC hat Sie und drei weitere Ökonomen im Herbst 2018 deshalb als „Cassandras of the Crash" bezeichnet: Sie sind eine „Kassandra", die – wie in der griechischen Mythologie – Schlimmes vorhersehen kann, aber damit geschlagen ist, dass niemand auf sie hört – oder zumindest damals nicht auf Sie gehört hat.
Ich wünsche Ihnen sehr, dass das heute anders ist: Denn Sie haben kluge und streitbare Dinge zu sagen, veröffentlichen Bücher und Schriften und stellen sich wieder und wieder der öffentlichen Diskussion um die undemokratische und unregulierte Macht des Finanzsektors und der Banken.
Das teilt auch die Jury des Hannah-Arendt-Preises.
In ihrer Begründung heißt es: »Ann Pettifor beschreibt und erläutert sehr eindringlich die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der gegenwärtigen Geldproduktion, wie sie vorwiegend seitens der Banken in Form von digitalen Kreditvergaben betrieben wird. Im Fokus ihrer Kritik steht dabei ein sich verselbstständigender globaler Finanzsektor, der abseits der Öffentlichkeit, und somit außerhalb politischer Einflussnahmen und demokratischer Kontrollen agiert.« – So die Jury.
Und an dieser Stelle wird es interessant: Wie schaffen wir es ganz konkret, den sich verselbständigenden globalen Finanzsektor wieder unter Kontrolle zu bekommen?
Sie fordern, dass der Finanzsektor nicht länger »Herr der Wirtschaft« sein dürfe, sondern wieder auf die Rolle des klugen Dieners zurückverwiesen werden müsse.
Dazu machen Sie Vorschläge in Ihrem Buch Die Produktion des Geldes, wie etwa diesen, dass viel mehr Wissen in der Bevölkerung vorhanden sein müsste: über die Zusammenhänge im Finanzsektor, über Kapitalmobilität, Geldschöpfung, Schulden und Kredite und so weiter.
Und sie fordern eine strengere Reglementierung: Geschäftsbanken dürfen nicht einfach Geld schöpfen, indem sie „Zahlen in ihre Computertastatur tippen", wie Sie schreiben. Ich selbst finde ja, dass Banken dem Staat gehören sollten.
Es brauche klare Vorgaben für Kreditvergaben im privaten Bereich, die sich in der Regel am gesellschaftlichen Nutzen orientieren sollen, wie etwa an der Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass mit den vergebenen Mitteln Arbeitsplätze geschaffen werden, und dass das Ökosystem nicht unbegrenzt ausgebeutet wird.
Auf all diese spannenden Ansätze will ich hier nicht im Einzelnen eingehen.
Eine sehr interessante Frage ist für mich zunächst die, wie ein Staatswesen agieren kann, dass – wie Bremen – aktuell sehr hoch verschuldet ist, solange ihre Forderungen noch nicht Realität geworden sind?
Immerhin sprechen Sie sich auch gegen Ausgabenkürzungen in den öffentlichen Haushalten aus. Und gegen die Aussage: »Es ist kein Geld da.«
Diese Aussage war damals, als ich noch Sozialpolitikerin in der Opposition war, für mich der Grund, in den Haushalts- und Finanzausschuss des Parlaments zu gehen. Mir wurde auch immer gesagt. »Es ist kein Geld da.« Es war kein Geld für Soziales und für „Frauenthemen" da. Aber für „Männerthemen" war Geld da. Das wollte ich verstehen und ändern.
Aus meiner Perspektive als Finanzsenatorin dieses sehr armen Bundeslandes stellt sich die aktuelle Situation so dar, dass – wenn unsere Regierung immer mehr Schulden bei eben jenen kaum gebändigten Banken macht – wir unser Staatswesen diesen Banken immer stärker ausliefern und abhängig werden. Das darf aus demokratietheoretischen, sozial- und gesellschaftspolitischen Gründen auf keinen Fall passieren!
Arme Menschen brauchen einen sozial agierenden und unabhängigen Staat, reiche Menschen nicht so dringend. Denn reiche Menschen engagieren sich ihren Privatlehrer oder ihren Sicherheitsdienst zur Not selbst. Arme Menschen sind darauf angewiesen, dass es einen zum Wohle der Gesellschaft agierenden Staat gibt, der für kostenlose Bildung, für eine funktionierende Infrastruktur, für eine öffentliche medizinische Versorgung und für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger sorgt.
Sehr geehrte Frau Pettifor,
ich bin mir sicher, wir könnten uns wunderbar konstruktiv darüber auseinandersetzen, unter welchen Bedingungen ein Staatswesen Schulden machen darf – oder vielleicht sogar muss? – in welcher Höhe. Und wann ein Staat aufhören muss, sich zu verschulden.
Ein weiterer interessanter Diskussionspunkt wäre außerdem, wie viel „Keynes" unsere überwiegend nationalstaatlich angelegten Demokratien maximal vertragen, während sie sich innerhalb von EU-weiten Verträgen und innerhalb des globalen Marktes bewegen und dabei mit global agierenden Banken konfrontiert sind?
Zuletzt möchte ich noch einen Punkt anmerken, über den ich mich als Grüne und als Finanzsenatorin sehr freue: Sie schreiben den Umweltschützerinnen und Umweltschützern – uns Grünen – ins Stammbuch, dass man die Regulierung des Finanzsektors und den Schutz unseres Ökosystems nicht getrennt denken darf. Und wenn man es tut, ist der Umweltschutz zum Scheitern verurteilt. Denn wir haben es mit einem auf massiver Ausbeutung unserer Ressourcen beruhenden Finanzsektor zu tun.
Diese inhaltliche Verknüpfung nehmen mittlerweile zwar auch andere vor, aber selten in der Radikalität, wie Sie sie vortragen.
Aus tiefster Überzeugung schließe ich mich Ihrer Forderung an, dass wir unsere demokratischen Institutionen stützen und stärken müssen!
Wir müssen dem Gefühl der Abgehängtheit vieler Menschen begegnen, das auch der unregulierte Finanzmarkt ausgelöst hat.
Die Demokratieverdrossenheit, mit der wir es verstärkt zu tun haben, ist für unseren Staat und unsere Gesellschaft brandgefährlich!
Sehr geehrte Frau Pettifor,
ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zum Hannah-Arendt-Preis 2018!
Dieser Preis ist vor 24 Jahren ins Leben gerufen worden, um in den kontroversen Diskussionen über politische Gegenwartsfragen an Hannah Arendts Ausspruch zu erinnern, dass »der Sinn von Politik Freiheit (ist)«.
Da haben wir noch viel vor uns!
Lieber Preisträgerin, sehr geehrte Frau Pettifor, liebe Jury,
lieber Vorstand des Hannah-Arendt-Vereins für politisches
Denken, liebe Laudatoren, verehrte Gäste,
es ist mir eine große Freude, heute und hier das Wort an Sie richten zu dürfen im Namen der Heinrich Böll Stiftung.
Die Verleihungen des Preises habe ich in der Vergangenheit mit Neugier und großer Erwartung verfolgt – Die Verleihungen an Yfaat Weiss, an Navid Kermani, und Tony Judt haben mich regelrecht begeistert und die Vorfreude auf das Nachlesen der Laudationes und Reden der Geehrten gesteigert – meine Auswahl zeigt, dass ich im geistes- kultur- und religionswissenschaftlichen Bereich besonders begeisterungsfähig bin.
Nun aber: Ann Pettifor, eine Ökonomin, die uns erklären kann, woher das Geld kommt, warum das Vollgeld auch keine Lösung ist und dass der große Finanzcrash von 2008 nur das System konsolidiert hat, die notwendigen politischen Konsequenzen aber nicht gezogen wurden.
Und genau hier ist der spannende Punkt, an dem sich die beiden Tangenten des Preises – die Namensgeberin Hannah Arendt und die Preisträgerin – treffen.
Für Hannah Arendt war das Handeln des Menschen die höchste Form des Tätigseins. Handeln heißt: im öffentlichen Raum, durch Kontroverse und Kompromiss, versuchen die Unterschiedlichen, das Wohl der Gemeinschaft voranzubringen. Arendt entwirft ein Modell der Teilhabe aller Menschen an Wirtschaft und Gesellschaft: Alle Menschen haben das Recht auf eine vita activa in den res publicae. Aber dieses Recht ist ständig bedroht, nicht zuletzt durch übermächtige Wirtschaftsinteressen.
Schon von hier aus lässt sich eine Linie zu Ann Pettifors Fazit ihrer ökonomischen Analysen ziehen: Die Finanzindustrie sei nicht mehr Diener, sondern längst Herr der Gesellschaft.
Hannah Arendts sah diese Gefährdung des Politischen, des öffentlichen Raumes, voraus. Der gemeinsame Weg einer Gesellschaft muss Gegenstand eines permanenten Aushandlungsprozesses unterschiedlicher Interessen sein. Schon in den 1950er Jahren fürchtete sie, dass selbsternannte Experten und Berater die öffentlichen Angelegenheiten in die von ihnen gewünschte Richtung treiben und damit die Demokratie in einen Zustand versetzen würden, in dem sich die wahre Politik des gemeinsamen Gestaltens verflüchtigt. In einem solchen Zustand aber liegen die Anfänge totalitärer Herrschaft.
Die im neuen Jahrtausend aufkommende Occupy-Bewegung, die als ein Akt des Widerstands gegen diesen längst eingetretenen Zustand gelesen werden kann, vertritt mit ihrer radikalen Kapitalismus-Kritik ebendiese durchaus deftige Hannah-Arendt-Auslegung: Das globale Finanzsystem wird interpretiert als eine totalitäre Bewegung – angeführt von eben jenen Finanzmarktspezialisten –, die nicht zur Ruhe kommen wird, ehe sie nicht die ganze Welt erfasst und alles in private Hände gebracht hat, was bislang staatlicher oder zivilgesellschaftlicher Zugänglichkeit oder gar Kontrolle unterworfen war. Dazu Hannah Arendt in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1955): »Alles irgend durch Regeln Gebundene, Kontrollierbare und darum Statische muss verdampfen vor dem dynamischen Prinzip der Bewegung. Alles Individuelle, Traditionsbestimmte, kulturell Besondere und Widerständige soll durch den Kapitalismus wie durch ein reinigendes Fegefeuer, an dessen Ende die eine, gleichförmige und erlöste Welt steht.«
Sie selbst weitete Anfang der 1970er Jahre ihre Besorgnis zu einer negativen Utopie aus, dass übermächtige Wirtschafts- und Finanzinteressen die formal demokratischen Systeme industriekapitalistischer Gesellschaften bedrohen könnten und legte damit die Spur aus, in die Occupy einstieg. Aber auch jenseits radikaler Kapitalismus-Kritik offenbarte die heftige Finanzkrise von 2008, die ihr trauriges 10-jähriges Jubiläum just in diesem Jahr begeht, dass ihre Besorgnis nicht ins Leere lief.
Ann Pettifor, die – so möchte man sagen – politische Ökonomin, möchte mit ihrer Arbeit in Prime – Policy Research in Macroeconomics und als Fellow of the New Economics Foundation genau das bekämpfen, anprangern, verhindern – dass eine übermächtige Plutokratie die demokratischen Institutionen gleichsam zermalmt. Sie streitet für politische Kontrolle über die Finanzmärkte und stellt fest, dass trotz der desaströsen Erfahrungen in der Finanzkrise und der Sozialisierung des Schadens zulasten der Bürgerinnen und Bürger die Märkte alles andere als gezähmt erscheinen. Im Gegenteil: Heute sind die Bedingungen für das Finanzgeschäft überdurchschnittlich gut, weil dieses von Regierungen und Zentralbanken bestens unterstützt wird. Einige Verbesserungen in Randbereichen des Bankensystems gab es – Banken sollen eine höhere Eigenkapitalquote einhalten, aber insgesamt geschah wenig, um das riskante und sich rasant ausweitende System der Schattenbanken zu regulieren. Die globalen, privaten Finanzinstitutionen, so die Analyse von Ann Pettifor, »are too big to fail and their bosses too big to jail.«
Und ihre Empfehlung lautet, ganz auf der Arendtschen Linie des öffentlichen Aushandelns als Mittel der Rückgewinnung des Politischen, dass demokratisch gewählte Regierungen ihre Verantwortung für das globale Finanzsystem besser wahrnehmen müssen: strengere Kontrollen für die Finanzindustrie, klarere Vorgaben für die Kreditvergabe im privaten Bereich. Und vor allem: internationale Kapitalverkehrskontrollen – also eine Art Steuer auf grenzüberschreitende Kapitalflüsse – unter anderem, um die Zinssätze auf heimischen Märkten besser kontrollieren zu können. Eine Voraussetzung für all das ist, dass alle die, die eine vita activa bevorzugen, sich mit dem Finanzsystem auseinandersetzen.
»Die große Wende ist nur möglich«, – schreibt Pettifor in ihrem jüngsten Buch Die Produktion des Geldes. Ein Plädoyer wider die Macht der Banken, – »wenn wir uns mit einem umfassenden, angemessenen Verständnis für die Kapitalmobilität, für Geldschöpfung, Bankengeld und Zinsen wappnen – und dann Reformen fordern sowie die Wiederherstellung eines gerechten Geldsystems, das den Finanzsektor nicht länger Herr der Wirtschaft sein lässt, sondern wieder in die Rolle des Dieners verweist.«
Gemeint ist: des Dieners einer Demokratie, in der Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft ihre Interessen in den öffentlichen Raum einbringen. Dort ist der Ort der Verhandlung über das Gemeinwohl.
Liebe Ann Pettifor, wir freuen uns, dass sie aus dem Vereinigten – und noch europäischen – Königreich nach Bremen gekommen ist und gratulieren herzlich zum Hannah-Arendt-Preis 2018.
In Zeiten des leichten und des teuren Geldes
Die Entscheidung der Jury, den Hannah-Arendt-Preis für Politisches Denken Ann Pettifor, der britisch- südafrikanischen Wissenschaftlerin für Finanzwesen zu verleihen, mag auf den ersten Blick überraschen. Kann ein Denken über Geld ein politisches Denken sein? Ein politisches Denken in einem tieferen Sinn, nicht als Gemeinplatz, dass jedes soziale Phänomen ohnehin politisch sei?
In der politischen Theorie kommen das Geld und die Finanzwelt selbstredend vor, mit der Globalisierung und Digitalisierung der Finanzwelt ist ihr Einfluss auf den klassisch verstandenen politischen Raum schließlich und endlich nicht mehr zu ignorieren. Dieser Einfluss erscheint jedoch wie eine fremde, von außen kommende Macht, die in unsere Welt eingreift, die politische Institutionen von ihr mit dem unwiderlegbaren Argument „dafür ist kein Geld da" abhängig macht, die Demokratie aushöhlt und für wachsende soziale Spannungen sorgt, mit einem Wort unser Tun und Lassen bestimmt. Diskurstheoretiker beklagen – zu Recht –, dass die der Ökonomie entlehnten Kategorien und Begriffe unsere Sprache kolonisieren. Man spricht von Effizienz und Optimierung, Selbstvermarktung, Management und dergleichen. Gegen diese Macht, ja Übermacht kann man protestieren und ankämpfen, man kann sie auch ignorieren, wenn einem das Schicksal diese Lösung gestattet; der schwierigste Weg ist jedoch, ihren Mechanismen zumindest etwas von der verschlossenen Härte zu nehmen. Und gerade dies tut Ann Pettifor, insbesondere in ihrem letzten Buch Die Produktion des Geldes. Ein Plädoyer gegen die Macht der Banken. Sie möchte nichts weniger und nichts mehr als eine Wende erreichen, die groß sein und beim Kleinen beginnen soll, nämlich mit Wissen darüber, wie Geld entsteht.
Sie gewährt uns – dem breiten Publikum – den Einblick in eine Art 'black box', vor der, der nicht Spezialist ist, hilflos dasteht. Das Geld wird – wie sie es mit einer Prise Herausforderung formuliert – „aus dem Nichts" geschöpft. Ann Pettifor führt die Worte Ben Bernankes, des Chefs der Federal Reserve vom 15. März 2009 an, der auf die Frage, woher die Fed das nötige Geld hat, um die von der Finanzkrise bedrohten Banken zu retten, mit dem Satz antwortete: „Wenn wir einer Bank Geld leihen, setzen wir einfach im Computer ihren Kontostand herauf." Die Summe, um die es damals ging, betrug 85 Milliarden Dollar. Das machen Geschäftsbanken schon immer, fügt Ann Pettifor hinzu, um zugleich zu betonen, dass dies eine »große Macht« sei. Und gerade deswegen dürfe es der Gesellschaft nicht gleichgültig sein, wer über die Geldschöpfung entscheidet und zu welchem Zweck es geschöpft wird.
Dass Geld mittels Kredit zustande kommt, ist nicht erst eine späte Erscheinung unserer hochkomplizierten Zivilisation. Ann Pettifor erinnert in ihrem höchst gegenwartsbezogenem Werk immer wieder daran, wie es einst war, indem sie Momente aus der Geldgeschichte oder gar Geldanthropologie einblendet. „Das, was wir als Geld bezeichnen", betont sie, »hat seinen Ursprung in einem Glauben. Das Wort »Kredit» leitet sich vom lateinischen »credo» ab, ich glaube. »Ich glaube, dass du […] heute oder irgendwann in der Zukunft mein Geld zurückzahlen wirst. […] Der Zinssatz wurde zu einem Maß für dieses Vertrauen oder Versprechen. Und wenn das Vertrauen fehlt wird er zu einem Maß für den Mangel an Vertrauen.«
Dank der Erfindung des Kredits kann jemand, der etwas vorhat, aber dafür über keine Mittel verfügt, diese erhalten. Dafür muss er jedoch mit seinem Besitz, vielleicht mit einem Stück Boden oder mit der Leistung seines Geistes und Körpers bürgen. Auf diese Weise werden Dinge der Natur zu Elementen des Gesellschaftssystems. Wahrscheinlich ist der Kredit eine der ältesten Vergesellschaftungsformen der Menschen, da er ein Netz von Verbindlichkeiten und Verpflichtungen schafft, die durch Sicherheiten gedeckt werden. Wir sind gewohnt, die Entstehung des Geldes vom Tausch her zu verstehen, es sind aber, sagt Pettifor die „Schulden, nicht der Tausch, [die] seit den Anfängen zum Leben in Gemeinschaft [gehören]."
Ann Pettifor gelingt es, indem sie diese historische und anthropologische Dimension des Geldes in ihrem Buch durchschimmern lässt, dem Phänomen Geld das Odium einer Macht zu nehmen, die wir spätestens seit Marx mit Selbstentfremdung bezeichnen. Pettifor hält dagegen, dass das Geld eine große kulturelle Erfindung sei. Dank der Geldschöpfung mittels gegenseitiger Verbindlichkeiten kann die Gesellschaft etwas wagen, wozu sie sonst nicht imstande wäre, wenn sie nur auf das bloß Vorhandene, das Ersparte angewiesen wäre.
Dem Leser von Pettifors Werk wird zunehmend klar, dass dieser Griff über das bloß Gegebene hinaus, in das versprechende und zugleich verpflichtende Noch-Nicht, eine der wichtigsten Quellen der zivilisatorischen Dynamik darstellt, wobei, das sei hier angemerkt, die Autorin mit solch weitgreifenden Thesen bescheiden umgeht. Sie sieht sich selbst in der Denktradition John Maynard Keynes', den sie auf eine innovative Weise als Geldtheoretiker liest. Als einen früheren Wegbereiter für diese Tradition erwähnt sie auch Georg Simmel, den Autor der Philosophie des Geldes. Über das Vertrauen und das Geld schrieb er:
Wie ohne den Glauben der Menschen aneinander überhaupt die Gesellschaft auseinanderfallen würde, – denn wie wenige Verhältnisse gründen sich wirklich nur auf das, was der eine beweisbar vom anderen weiß, wie wenige würden irgendeine Zeitlang dauern, wenn der Glaube nicht ebenso stark und oft stärker wäre, als verstandesmäßige Beweise und sogar als der Augenschein! – so würde ohne ihn der Geldverkehr zusammenbrechen.
Eben deshalb ist es eine brennende Aufgabe, unterstreicht Pettifor und wir tun es mit ihr, die Geldschöpfung der Gesellschaft zurückzugeben und es in den politischen Raum, dem es genuin angehört, zurückzuführen. Derzeit befindet sich Geldproduktion leider Gottes außerhalb des Politischen. Unter dem Politischen versteht Ann Pettifor, ganz im Sinne von Hannah Arendt, den Raum der demokratischen öffentlichen Debatte.
In der heutigen Zeit ist Geld vorwiegend digitales Kreditgeld, das nicht nur außerhalb der Öffentlichkeit „produziert wird", sondern sich auch dem Wissen der Gesellschaft entzieht. Es lasse sich darüber nicht diskutieren, höchstens in der Form, dass die Mittel knapp seien, was die politische Debatte entarten lässt; Populismus jeglicher Art ist nur eine der Folgen dieser Entwicklung. Hinzu kommt, dass die menschliche Arbeit und die Erde als beschränkte Ressourcen für die nach mathematischen Algorithmen wachsenden Schuldenberge herhalten müssen, denn diese steigen als abstrakte Größen prozentual in die Höhe, während sich die natürlichen Reserven, darunter nicht zuletzt der menschliche Körper und menschliche Geist nur langsam regenerieren, während ihnen aber immer mehr Leistung abgepresst wird.
Ann Pettifors Formel, dass das Geld »aus dem Nichts« geschöpft wird und deshalb für die Bedürfnisse der Gesellschaft immer vorhanden sein könnte, haftet etwas Zauberhaftes an. Wir wissen aber, wie es Goethes leichtsinnigem Zauberlehrling ergangen ist. Er steht in Pettifors Buch als Symbol für unsere Zeit der globalen Finanzwirtschaft. Wir leben in einer Zeit des leichten und zugleich teuren Geldes. Ausgegeben wird es allzu oft für Dinge, die keine Zukunftsperspektive eröffnen. Das betrifft bei weitem nicht nur Entscheidungen auf Milliardenebene; Ann Pettifor führt an einer Stelle auch das Beispiel einer englischen Schönheitsklinik an. Wer sich da entschieden hat, Kunde zu werden, dem wurde gleich ein angeblich äußerst günstiger Kredit angeboten.
Indem Pettifor die Frage der Geldschöpfung zu einer politischen macht, provoziert sie uns zum Denken und Umdenken. Sie folgt hier, ohne sich darauf zu beziehen, dem Vorbild Hannah Arendts. In den letzten Zeilen der Vita activa, lobt Arendt ausgerechnet das Denken, das sie bisher zugunsten des Handelns außer Acht gelassen hatte. Sie diagnostiziert – aus anderen Gründen als Pettifor es tut – eine Verengung und Entmachtung des Politischen in der Moderne, insbesondere des politischen Handelns. Damit das Handeln aber ein wirklich politisches ist, braucht es freies und mutiges Denken. Arendt kommt zu dem paradoxen Schluss, dass „das reine Denken alle Tätigkeiten an schierem Tätigsein" übertrifft.
Ann Pettifors „Plädoyer gegen die Macht der Banken" setzt sich zum Ziel, uns zu solch reflexivem Tätigsein zu veranlassen. Denn wenn es sich mit dem Geld so verhält, können wir ein Experiment machen und die Perspektive umkehren. Zum Kredit gehören beide Seiten; der, der ihn anbietet, und der, der ihn nimmt. Auch wenn der Einzelne in seiner Isolierung nicht zählt, stellen doch die unzähligen kleinen Geldentscheidungen, die wir täglich treffen, insgesamt eine große Macht dar. Sie sind es, zusammengenommen, die die größte Quelle der Geldschöpfung ausmachen. Mir scheint es nicht verfehlt, hier eine Parallele zu den Ideen der Genossenschaftsbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts zu sehen. Pettifor hat keine staatliche Kontrolle der Geldmenge und keine zentralistische Verwaltung im Auge, sondern bewusstes Handeln der Bürger.
Die Bürger haben im Grunde mehr Macht über die Produktion des Geldes, als sie wahrzunehmen gewohnt sind, meint Ann Pettifor. Der Eigendynamik des exzessiven Konsums, das durch Werbung und allgegenwärtige Kreditangebote und anderem angekurbelt wird und die aus uns atomisierte Kunden macht, muss ein Handeln entgegengesetzt werden, das zwischenmenschliche Wirklichkeiten, in denen wir leben, mit einschließt: insbesondere das Wohlergehen der Gesellschaften und Gemeinschaften, deren Mitglieder wir sind, denn indem wir mit dem Geld umgehen, nehmen wir die Erde und uns selbst in Pacht mit Blick in die ungewisse Zukunft. Sobald wir die Geldfrage so stellen, offenbart sich das ganze Spektrum verwandter Themen, die berücksichtigt und mitdiskutiert werden müssen: in erster Linie die Umwelt, der Lebensstil, die Werte, auch die Religion und vieles mehr, was gerade zur Debatte steht.
Ann Pettifor geht auch auf die Frage ein, ob der Kapitalismus die Demokratie als seine Voraussetzung braucht. Wir sind ja seit einigen Jahrzehnten Zeugen des ökonomischen Aufstiegs von Staaten, die das Gegenteil zu beweisen scheinen. Ihre Antwort in dieser Debatte lautet: „Die Deregulierung des Finanzsektors hat gezeigt, dass ein von der Demokratie isolierter Kapitalismus zu Renditegier, Kriminalität und Korruption in großem Stil verkommt".
Nicht zuletzt verbindet Ann Pettifor auch in ihrer Biographie das Arendtsche Prinzip der Wechselwirkung von Denken und politischem Handeln. Geboren und aufgewachsen in Südafrika, ist sie Mitbegründerin der weltweiten Kampagne Jubilee-2000. Dank dieser Initiative wurden 35 Entwicklungsländern Schulden in einer Gesamthöhe von rund 100 Milliarden US-Dollar erlassen. Zu den vielen Initiativen, an denen sie mitwirkt, zählt u. a. Kampagne MamaYe, die sich für die Gesundheit von Schwangeren, jungen Müttern und Babys in Afrika einsetzt. Pettifor hat die Weltwirtschaftskrise 2008 vorausgesagt und früh vor ihr gewarnt. Sie ist Direktorin des Netzwerks Policy Research in Macroeconomics, das sich mit der Keynesisnischen Geld- und Politiktheorie beschäftigt.
Da für Hannah Arendt die Sprache und das Leben des Geistes aufs Engste miteinander verschränkt sind, sei unterstrichen, dass Ann Pettifors Werk in einer Sprache verfasst ist, die es für einen breiten Kreis von Nichtspezialisten lesbar macht. Dies ist kein Nebeneffekt, sondern Kern der Aufgabe, für die sie plädiert: dass die Geldproduktion der Gesellschaft zurückgegeben werden soll und muss, aber dazu brauchen wir Wissen und eine Sprache, welche die politische Debatte möglich macht. Diese Sprache zu gewinnen, ist der erste notwendige Schritt. Auch wenn wir dann mit und womöglich gegen Ann Pettifor streiten sollten, muss zuerst ein fehlendes Stück unserer Streitkultur hergestellt werden. Wir hoffen, dass es dazu kommen wird, auch dank des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken.
»Wo es Politik gibt, da gibt es Freiheit«
Wenn Sie erlauben, würde ich gerne beginnen, indem ich die Worte Hannah Arendts wiedergebe, als sie den Lessing Preis 1959 von der Freien und Hansestadt Hamburg verliehen bekam: »Der Preis ist eine Ehrung, die uns eine sehr eindringliche Lektion in Bescheidenheit erteilt. Aber die Ehrung mahnt uns nicht nur auf besondere, unüberhörbare Weise an die Dankbarkeit, die wir der Welt schulden; sie ist darüber hinaus in einem sehr hohen Maße weltverpflichtend.« Ihre damalige Rede trug den Titel Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten.
Es ist sowohl außergewöhnlich als auch erfreulich, dass die Stadt Bremen und die Heinrich Böll Stiftung gerade in diesen Zeiten den Preis mir, einer britischen Staatsbürgerin, verleihen möchten. Indem ich ihn annehme, verpflichte ich mich, mein Engagement in der Welt aufrechtzuerhalten.
Ich möchte der Stadt und der Stiftung danken, nicht nur für den Preis, sondern auch für die Gelegenheit, Hannah Arendt wiederzuentdecken. Ihre Werke erneut zu lesen hat Emotionen geweckt, die allgemein wohl als »sich verlieben« bezeichnet werden können. Ich habe die blendende Klarheit ihrer Gedanken wiederentdeckt (obwohl ihr Stil durchaus sehr drückend sein kann!), ihre gründliche und furchtlose Suche nach der Wahrheit (wie während des Eichmann-Prozesses) und ihren unerschütterlichen Mut, als ihre Arbeit auf Empörung traf.
Es wäre überwältigend gewesen sie kennenzulernen, mit ihr einen Kaffee in einem geschäftigen Bistro zu trinken, während sie eine Zigarette pafft. Es wäre wundervoll gewesen, eine ihrer Schülerinnen zu sein. Es ist eine Ehre und eine Freude, heute hier zu stehen und mit einer Frau assoziiert zu werden, so international bekannt, so intellektuell couragiert und so beeindruckend wie Hannah Arendt.
Sie lebte während furchtbar dunkler Zeiten. Heute stehen wir in Europa und der ganzen Welt Herausforderungen gegenüber, denen auch ihre Generation gegenüberstand – einem beängstigenden Anstieg von Anti-Semitismus, Rassismus, Nationalismus und sogar Faschismus. Wir können diesen Bedrohungen nur entgegentreten, indem wir politisch agieren und uns engagieren. Und da Hannah Arendt argumentierte, dass Politik Freiheit ist, müssen wir die Möglichkeiten unserer Politik nutzen, um unsere Freiheit zu schützen.
Ich habe Hoffnung, dass wir das menschliche Befinden verändern, dass wir die Gefahren, die uns begegnen, überwinden können. Das können wir erreichen, indem wir klar denken, indem wir mit unseren Mitmenschen interagieren, indem wir politisch handeln – mit dem von ihr gezeigten unerschütterlichen Mut handeln. Das bedeutet nicht, dass es keine dunklen Zeiten mehr geben wird. Die wird es geben. Jedoch wird es, seien Sie versichert, auch Veränderung geben.
Bertolt Brecht fragte:
»In den finsteren Zeiten
Wird da auch gesungen werden?
Da wird auch gesungen werden [antwortete er].
Von den finsteren Zeiten.«
Nichts in unserer heutigen Zeit erschiene Hannah Arendt fragwürdiger als unsere Haltung zur Welt, »zu einer Welt und Öffentlichkeit nämlich, welcher wir den Raum verdanken, in dem wir sprechen und in dem wir gehört werden.«
Politik, sagte sie, befasst sich mit der Koexistenz und dem Miteinander unterschiedlicher Männer (und Frauen). Politik basiert auf dem, was zwischen Männern und Frauen liegt und als Beziehungen etabliert wird.
Als hellhäutige Südafrikanerin wuchs ich unter dem rassistischen und unterdrückenden Afrikaaner-Nationalismus-Regime auf, das Millionen dunkel- und hellhäutigen Menschen die Freiheit verwehrte, mit- und nebeneinander zu existieren. Dunkelhäutigen Menschen wurde aufgrund ihrer Hautfarbe die Freiheit einer sicheren Existenz von der Wiege bis zur Bahre verweigert. Ihnen wurden die Menschenrechte abgesprochen, die das Privileg der hellhäutigen Südafrikaner waren.
Doch vor allem verweigerte das Afrikaaner-Nationalismus-Regime, das beinahe 50 Jahre von 1947 bis 1994 regierte, der dunkelhäutigen Bevölkerung die Freiheit des politischen Aktivismus – nicht nur das Recht für eine Regierung ihrer Wahl zu stimmen. Sondern auch das Recht auf Bündnisse.
Bereits 1950 wurde die Zensur in der Gesetzgebung zur inneren Sicherheit verankert, die auf dem Suppression of Communism Act [Gesetz zur Unterdrückung des Kommunismus] basiert. Dies untersagte das Zitieren gesperrter Personen sowie von Veröffentlichungen und Organisationen, darunter dem African National Congress (ANC), dem südafrikanischen Demokratenkongress, dem Pan African Congress (PAC), des Defense-and-Aid-Fonds, der südafrikanischen Kommunistischen Partei und der Afrikanischen Widerstandsbewegung. Das Verbot des von Nelson Mandela geführten ANC wurde erst 40 Jahre später, am 2. Februar 1990, aufgehoben.
Dunkelhäutigen Südafrikanern wurde das Recht abgesprochen politisch zu handeln. Das hat mich gelehrt, niemals Politik zu verspotten, sie zu belächeln oder von der Politik abzusehen, denn wo es Politik gibt, gibt es Freiheit.
Für Hannah Arendt ist der Sinn von Politik Freiheit. Und diese Freiheit wurde nicht negativ verstanden – mit anderen Worten, sie wurde nicht als »nicht beherrscht oder versklavt« verstanden. Stattdessen war es Freiheit, die den Staat – die Menschen – befähigte, sich politisch zu engagieren, sich mitzuteilen, zu verstehen und schließlich zu handeln.
»This freedom to interact in speech with many others ... is not the end purpose of politics« wrote Arendt.
»It is rather the substance and meaning of all things political. In this sense, politics and freedom are identical, and wherever this kind of freedom does not exist, there is no political space in the true sense.«
Es sollte daher wenig überraschen, dass ich das Ergebnis der südafrikanischen Zustände während meiner Kindheit und Jugend bin. Ich habe Glück, denn ich bin politisch. Ich habe eine unfreie und größtenteils unpolitische Gesellschaft durchgestanden.
Als junge Frau hatte ich keine Wahl als gegen diese Unfreiheit zu rebellieren und politisch aktiv zu werden. Im Südafrika der Apartheid Mensch zu sein – meine rassistische, kolonisierte und gespaltene Gesellschaft »in ihrer Objektivität und Sichtbarkeit von allen Seiten« zu verstehen – bedeutete, »to interact in speech with many others and experience the diversity that the world always is, in its totally.« In den abgetrennten und geschlossenen Gemeinden der weißen Südafrikaner gefangen zu sein war nicht menschlich.
Damals – als Studentin in den 1960er Jahren in Johannesburg – war Politik schwierig, sie war gefährlich und sie schien hoffnungslos. Doch sie war nicht hoffnungslos. Unser Handeln – unsere Entschlossenheit Wege zu finden, mit dunkelhäutigen Studenten zu interagieren, gegen ein schwer bewaffnetes und augenscheinlich unbezwingbares rassistisches Regime zu protestieren, unsere Proteste zu internationalisieren, indem wir Bobby Kennedy einluden, vor Studenten der Universität zu sprechen – all diese kleinen Handlungen brachten uns – und letztlich dem Land – mehr Freiheit.
Für mich war die Freilassung Nelson Mandelas 1989 und der darauffolgende Zusammenbruch der Apartheid ein »Wunder«. Deswegen bin ich optimistisch gegenüber der Zukunft. Denn ich habe eine Politik großer Veränderungen durchlebt und erfahren.
Ich habe eine Zeit erlebt, in der beinahe über Nacht die augenscheinlich unbezwingbare Sowjetunion zusammenbrach, Deutschland wiedervereint wurde und Europa sich veränderte.
Ich habe eine tragende Rolle in einer globalen Bewegung – Jubilee 2000/Entwicklung braucht Entschuldung – gespielt, die Millionen Menschen in über 60 Ländern mobilisierte – und politisierte –, reiche und mächtige Kreditnationen davon zu überzeugen, den ärmsten Ländern ihre Schulden zu erlassen. Während des 25. G8-Treffens 1999 in Köln, begannen Kanzler Schröder und die anderen Regierungsoberhäupter die Durchführung – das »Wunder« – der Tilgung von über 100 Milliarden Dollar Schulden, verteilt auf 35 der ärmsten Länder weltweit.
In den 1990er Jahren und im Zuge der Jubilee 2000/Entwicklung braucht Entschuldung-Bewegung betraten wir neue Wege, indem wir das Internet nutzten, um die Millionen Menschen zu erreichen und zu mobilisieren, die hinter unserem Ziel der Schuldentilgung bis zum Jahr 2000 standen, und mit ihnen zu diskutieren und debattieren. Das Internet gab uns die Möglichkeit zusammenzuarbeiten, über Grenzen hinaus zu denken und zu debattieren, und politisch zu handeln – das Machtverhältnis zwischen internationalen Gläubigern und Schuldnern zu verändern. Um zusammenzukommen, um sich einzusetzen, um für den Beginn des Wandels der Menschheit einzutreten.
Und jetzt müssen wir zusammenkommen, um die dreifache Krise zu bewältigen, mit der wir konfrontiert sind: ein global vernetztes und systemisches Finanzsystem, das anfällig für Krisen ist, der Klimawandel und drittens die »Energiekrise«, die durch die Verlagerung weg von fossilen Brennstoffen verursacht wurde, die notwendig ist, um den Klimawandel abzuschwächen.
Denn in diesen dunklen Zeiten, und zusätzlich zu den menschlichen Ängsten, sehen wir uns einer noch ernsteren Bedrohung gegenüber: dem Zusammenbruch des Planeten. Es ist eine Bedrohung, die so ernst ist, dass sie den Verstand abschreckt. Das Ausmaß der Gefahr ist für die meisten Bürger unverständlich – jenseits unserer Vorstellungskraft.
So wie wir uns die globale Finanzkrise 2007 bis 2009 nicht vorstellen konnten und von dem Ausmaß und der Schwere der Krise verblüfft waren. Aber obwohl wir uns das vorstellen müssen, ist die Gefahr eines Klimawandels für diejenigen in Kalifornien oder im Nahen Osten, in Griechenland oder in Indien, die Häuser, Lebensgrundlagen und Leben durch Brände und Überschwemmungen verloren haben, nicht mehr imaginär.
Zehn Jahre nach der GFC wurde die »fantastische, selbstregulierende Maschinerie«, die das globale Finanzsystem antreibt, nicht unter demokratische Verwaltung gestellt. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass Ökonomen, Politiker, aber auch wir, die Öffentlichkeit, die Aktivitäten des Finanzsektors ignoriert haben. Wir Frauen glaubten, dass die Finanzbranche für »Männer in Nadelstreifenanzügen« sei – diejenigen, die das gemeistert hätten, was wir als die Komplexität des Währungssystems, hypothekarisch gesicherte Wertpapiere, besicherte Schuldverschreibungen, strukturierte Investitionen ... und so weiter angesehen haben. Und so überließen wir die globalisierte Finanzbranche den »Herren des Universums«. Unsere Unwissenheit machte uns hilflos, aber auch impotent.
Wir können es uns nicht mehr leisten, das Finanzwesen den wenigen auf den globalen Kapitalmärkten tätigen Unternehmen zu überlassen. Vor allem wir Frauen müssen ein Thema in den Griff bekommen, das, wie ich Ihnen versichern kann, keine Raketenwissenschaft ist. Es mag in eine Sprache gekleidet sein, die die wahren Aktivitäten des Sektors verbergen und verbergen soll – aber es ist keine Raketenwissenschaft. Wir müssen unser Verständnis für die internationale Finanzarchitektur und das Währungssystem stärken.
Ich weiß, dass dies möglich ist, denn Millionen von einfachen Männern und Frauen, viele tausend deutsche Männer und Frauen, haben das internationale System der Staatsverschuldung in seiner ganzen Komplexität in den Griff bekommen und die wirtschaftlichen Möglichkeiten von mehr als 30 Ländern mit niedrigem Einkommen verändert.
Daher sind Verständnis, gemeinsame Diskussion und Debatte entscheidend für den Wandel. Wir können nicht das verändern, von dem wir nicht wissen, dass es existiert; oder das, was wir nicht verstehen. Wir wurden von den Sirenen des Marktes verführt. Solange wir unsere Kreditkarten benutzen konnten, wurden wir dazu gebracht, uns zufrieden zu fühlen. Solange wir Geld von Maschinen beziehen konnten, wo immer wir um die Welt reisten, war die Globalisierung für uns in Ordnung. Vor allem wurden wir dazu verleitet, mit der Finanzwirtschaft zum Einkaufen zu gehen – um den Konsum zu steigern. Wie bei Autos, die an Tankstellen ankommen, haben wir uns gerne mit finanziellem Treibstoff bei unseren Banken oder online eingedeckt – ohne zu verstehen, ob der finanzielle Treibstoff nachhaltig war. Und wir nutzten – oder ließen uns vom Finanzkapitalismus überreden das Geld zu nutzen, das wir uns geliehen oder verdient hatten, um den Konsum zu steigern. Und so trieb EasyMoney die Easy-»Markenfamilie« voran: EasyEnergy, EasyProperty, EasyShopping und EasyJet.
Einer der Gründe, warum ich es für wichtig halte, dass wir in Bezug auf die Finanzen politisch werden, ist, dass wir lernen, das System zu verstehen, mit anderen zusammenarbeiten, uns zu verbinden und letztendlich uns zu organisieren – weil ich überzeugt bin, dass es eine direkte Verbindung zwischen EasyMoney, EasyShopping und EasyJet gibt. Mit anderen Worten, zwischen unregulierter Kreditvergabe, Konsum und toxischen Emissionen.
Bis die Grünen verstehen, dass wir diese Aktivitäten nicht in ihren getrennten Lagern halten können – dass wir zuerst das Finanzsystem regulieren müssen, wenn wir den Verbrauch steuern und die toxischen Emissionen reduzieren wollen – werden unsere Bemühungen zur Verhinderung und Milderung des Klimawandels sinnlos sein.
Natürlich hat unsere verschwenderische Verbrennung fossiler Brennstoffe bereits zu einem Klimasturz geführt – und wir waren zu langsam, zu ängstlich, zu gierig, um es anzugehen. Unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen hat uns gefangen gehalten. Wir hatten nicht die Freiheit, politisch zu handeln, um einen Zusammenbruch des Planeten zu verhindern. Bis jetzt.
Einige, vor allem junge Menschen, fliehen aus dem Käfig der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und säen Samen der Hoffnung. Auf der ganzen Welt setzen sie sich für die Rettung des Planeten ein und fordern einen Green New Deal. Aber vielleicht am wichtigsten ist, dass diese jungen Menschen in dem aktiv sind, was viele als den »Bauch der Bestie« wahrnehmen – dem Kongress der Vereinigten Staaten. Sie werden von einer jungen Frau – Alexandria Ocasio Cortez aus New York – und einer als Justice Democrats bekannten Gruppe angeführt. Unmittelbar nach den jüngsten Zwischenwahlen haben sie ihre Freiheit genutzt, um Raum für Diskussionen über Alternativen zu einer auf fossilen Brennstoffen basierenden Wirtschaft zu schaffen – und um politisch zu handeln. Sie besetzten einen Teil des US-Kongresses, um Veränderungen zu fordern.
Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2007, versammelte sich seit mehr als einem Jahr regelmäßig eine viel ältere Gruppe von Menschen – eine Gruppe von Ökonomen, Energieexperten und Umweltschützern (einschließlich Caroline Lucas, die damalige grüne Europaabgeordnete) – in unserer kleinen Wohnung nahe der Baker Street, London. Wir haben uns zusammengetan, um ein Dokument zu entwerfen, das die »dreifache Krise« angeht – die Kombination aus einer kreditgetriebenen Finanzkrise, der Beschleunigung des Klimawandels und steigenden Energiepreisen –, gestützt auf das, was wir damals fälschlicherweise für einen unkontrollierten Höhepunkt der Ölproduktion gehalten hatten. Diese drei sich überschneidenden Ereignisse drohten, so argumentierten wir, zu einem Unwetter zu werden, wie es seit der Weltwirtschaftskrise nicht mehr zu sehen war. Um dies zu verhindern, entwarfen und veröffentlichten wir 2008 A Green New Deal.
Nach der Publikation unseres Berichts, sprachen wir mit vielen anderen und machten dabei die Erfahrung, wie vielfältig die Welt ist (Arendt Zitat: we »interacted in speech with many others to experience the diversity that the world always is, in its totally«).
Viele unterstützten unseren Bericht, darunter angesehene Persönlichkeiten der Vereinten Nationen und die Regierungsoberhäupter kleiner exponierter Volkswirtschaften. Wie Sie alle wissen hat die Heinrich Böll Stiftung 2009 Toward a Transatlantic Green New Deal/Auf dem Weg zu einem Green New Deal veröffentlicht, 2010 den Artikel Green New Deal in Ukraine? The Energy Sector and modernizing a National Economy und 2011 den Beitrag Protests for Social Justice: A Green New Deal for Israel?/Proteste für soziale Gerechtigkeit: Ein Green New Deal für Israel?
Er wurde als Teil der Kampagne der Europäischen Grünen Partei bei den Parlamentswahlen der EU im Jahr 2009 verwendet. Die US-amerikanische Präsidentschaftskandidatin Jill Stein setzte unseren Bericht in ihren Kampagnen von 2012 und 2016 ein.
Anfang 2018 klopften dann zwei Amerikaner an meine Tür. Es waren Zack Exely und Saikat Chakrabarti von den Justice Democrats. Sie waren von Gegnern wegen der wirtschaftlichen Lage herausgefordert worden. Wie wollten sie den Wirtschaftswandel weg von fossilen Brennstoffen – den Green New Deal – finanzieren? Sie hatten mein kurzes Buch The Production of Money gelesen und wollten mit britischen Wirtschaftswissenschaftlern zusammenarbeiten, um die Frage zu beantworten, wie die Geldpolitik (nicht nur die Steuerpolitik) gesteuert werden kann, um den Green New Deal zu finanzieren. Sie waren besonders beeindruckt von Keynes Behauptung in seiner berühmten Rede »National Self Sufficiency« an der Yale University im Juni 1933, dass wir, dank der soliden Entwicklung der Währungssysteme und gestützt durch lebenswichtige Institutionen, uns leisten können, was wir schaffen können. Dass wir uns leisten können, was wir tun können – innerhalb unserer eigenen physischen Grenzen und innerhalb der Grenzen des Ökosystems.
Kurz darauf trafen sich Zack und Saikat mit Miss Osario-Cortez und überredeten sie, den amtierenden New Yorker Demokraten in den Vorwahlen herauszufordern. Zum Erstaunen und zur Freude aller hat sie gewonnen. Dank ihrer politischen Tätigkeit – dank ihrer Freiheit, politisch zu handeln – bewegen sich die Forderungen nach einem Green New Deal nun in den politischen Mainstream der USA.
Das gibt mir Hoffnung. Denn gemeinsam haben wir den Raum geschaffen, in dem Menschen mit Worten und mit Aktion interagieren können – und in diesem Raum wird Politik lebendig und Veränderungen sind möglich.
Hannah Arendt schrieb (in What is Freedom?), es sei notwendig:
»to be prepared for and expect ‚miracles' in the political realm. And the more heavily the scales are weighted in favour of disaster, the more miraculous will the deed done in freedom appear ...«
»für und in Erwartung von ‚Wundern' im politischen Bereich gewappnet zu sein. Und je mehr sich die Waagschalen gen Desaster neigen, desto wunderbarer wird die in Freiheit ausgeführte Handlung erscheinen.«
Objektiv betrachtet, sind Männer und Frauen die Anfänge und die Anfänger, schreibt sie.
»The decisive difference between the ‚infinite improbabilities' on which the reality of our earthly life rests and the miraculous character inherent in those events which establish historical reality is that, in the realm of human affairs, we know the author of the ‚miracles'.
It is men and women who perform them – because they have received the twofold gift of freedom and action and can establish a reality of their own.«
»Der entscheidende Unterschied zwischen den ‚unendlichen Unwahrscheinlichkeiten', auf denen die Realität unseres irdischen Lebens beruht, und dem wunderbaren Charakter derjenigen Ereignisse, die die historische Wirklichkeit begründen, besteht darin, dass wir im Bereich der menschlichen Angelegenheiten den Urheber der ‚Wunder' kennen.
Es sind Männer und Frauen, welche sie vollbringen – weil sie das zweifache Geschenk der Freiheit und Handlungsfähigkeit erhalten haben und eine eigene Realität schaffen können.«
In meinem Leben habe ich ‚Wunder' erlebt, die von Männern und Frauen vollbracht wurden. Aus diesem Grund und solange wir frei und politisch sind, werde ich von der Hoffnung getragen.
Vielen Dank.
Die Bankenwelt reformieren
Die jüngste Finanzmarktkrise hat sich bereits seit den Neunzehnhundertachtziger-Jahren herausgebildet. Die Lehmann-Brothers Pleite am 15. September vor zehn Jahren konnte am Ende nur noch symbolhaft den Zusammenbruch dieses neuen durch die Finanzmärkte getriebenen Spekulationskapitalismus sichtbar machen. Im Kern geht es um die ökonomische Wertschöpfung, die durch die Macht der Finanzmärkte kommandiert wird. Der Zusammenbruch dieser von der dienenden Funktion für die Wirtschaft und Gesellschaft relativ entkoppelten Finanzwirtschaft wirkte systembedrohend: Pleiten von Banken, Zusammenbruch des wichtigen Interbankenmarktes, Absturz der gesamtwirtschaftlichen Produktion (in Deutschland 2009 um 5 Prozent), Verlust an Arbeitsplätzen, Finanzierung von teuren Programmen zur Rettung von Banken durch den Steuerstaat. Vor allem aber ist die dadurch ausgelöste, tiefe Krise des Vertrauens in die Stabilität der geldwirtschaftlichen Grundordnung bis heute noch nicht überwunden. Im Gegenteil, die Ängste vor einem neuen Absturz zu Lasten der »kleinen Leute« ist groß und hat auf das Wahlverhalten Einfluss. Unlängst ist in einer Studie über die politischen Folgen von Finanzkrisen in den letzten 200 Jahren im »European Economic Review« erneut die Demokratiegefährdung dechiffriert worden. Nicht nur in Deutschland schlachten Rechte diese Akzeptanzkrise des Systems für ihre Politik aus.
Man sollte meinen, spätestens die Bedrohung der demokratischen Grundlagen der Gesellschaft führt dazu, die Ursachen und Folgen dieser Finanzmarktherrschaft schonungslos zu untersuchen, um dagegen eine Politik der Entmachtung der Finanzmarktoligarchie in Gang zu setzen. Jedoch, bis auf wenige rühmliche Ausnahmen, vor allem die Politik beratende »Mainstream-Economics« versagt wieder einmal. Es nehmen die Versuche zu, die Krisenanfälligkeit des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus zu bagatellisieren, gar zu leugnen.
Gegen dieses interessengeleitete Verdrängen der Ursachen und Folgen der Finanzmarktkrise stemmt sich das so wertvolle Buch von Ann Pettifor. Der Titel signalisiert ein doppeltes Programm: Analyse der »Produktion des Geldes«, der logisch konsequent »ein Plädoyer wider die Macht der Banken« folgt.
Es drängt mich, auf die vielen wertvollen Details dieser Analysearbeit einzugehen. Das geht an dieser Stelle leider nicht. Daher wenige Hinweise zu den wichtigsten Aussagen:
Das Buch ist vom unerschütterlichen Glauben an die Aufklärung als Basis des ökonomischen Machtabbaus zugunsten demokratischer Reformen geprägt (»bereits allgemeines Verständnis für Geld, Kredit und die Funktionsweise des Banken- und Finanzsystems zu einer wirklichen Veränderung führen.«).
Das Epizentrum der Finanzmarktkrise wird zu Recht in der Politik der Deregulierung der Finanzmärkte, also deren neoliberale Entfesselung, gesehen. Die Politik hat bereits vor über 30 Jahren dem Druck der renditegierigen Geldkapitalanleger/innen nachgegeben und die Ordnung des Geld- und Währungssystems demontiert. Der Start erfolgte am 27. Oktober 1986 mit Maggy Thatchers »Big Bang« am Finanzplatz London. Danach wurde eine »Internationale der Deregulierung« durchgesetzt, übrigens mit Bill Clinton 1999 durch die Aufhebung des Glass-Steagall Acts von 1932/33.
Gegen diese zerstörerische Deregulierungspolitik entwickelt Frau Pettifor detailliert die Alternative mit dem Ziel nachhaltiger Regulierungen des gesamten Finanzsystems. Durch ihre Neuordnung der Finanzwelt wird die Macht der Banken sowie der Finanzoligarchen (»Raubritter«) reduziert und damit das Finanzsystem wieder auf die dienenden Funktionen für die Wirtschaft und Gesellschaft konzentriert. Ordnungspolitisch hat Frau Pettifor Adam Smith (Wealth of Nations, 1776) auf ihrer Seite. Adam Smith hat sich im Rahmen eines Bankengesetzes mit der Frage auseinandergesetzt, wann man mit einem Gesetz »die persönliche Freiheit … schützen, statt einschränken sollte«. Die Antwort ist klar: »Wenn einige wenige dieses Naturrecht (persönliche Freiheit, R. H.) so nutzen, dass sie die Sicherheit des ganzen Landes gefährden können, so schränkt jede Regierung … dieses Recht gesetzlich ein, und zwar zu Recht.«
Im Streit der ökonomischen Theorie ist Frau Pettifors Wirtschafts- und Währungsanalyse stark durch das Werk von John Maynard Keynes geprägt. Sie geißelt eindrucksvoll die weit verbreitete Behauptung, J. M. Keynes sei der Erfinder staatlicher Defizitpolitik. Welch ein Unsinn, darüber steht kein Wort in seiner Allgemeinen Theorie von 1936. Vielmehr hat Keynes die Entwicklung zum Kasinohaften des Kapitalismus durch wachsende Spekulationen, die für die Wirtschaft schädlich sind, erstmals beschrieben. Übrigens vergleichbar spricht Marx (3. Band Das Kapital) vom »Spiel, das an der Stelle der Arbeit als die ursprüngliche Erwerbsarbeit von Kapitaleigentum erscheint«.
Die Kritik an der Austeritätspolitik – also einer von gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen völlig losgelösten staatlichen Einsparpolitik – ist Pflichtlektüre für die Anhänger der schwarzen/roten Null.
Ihr Plädoyer für eine abgestimmte Geld- und Fiskalpolitik lässt sich zur Offenlegung eines Dilemmas im Euroraum nutzen. Die Europäische Zentralbank, die seit September 2012 mit expansiver Geldpolitik (»quantitative Easing«) erfolgreich den Euroraum stabilisiert hat, ist durch eine restriktive Finanzpolitik (»EU-Fiskalpakt«) konterkariert worden.
Es muss dem Geldtheoretiker erlaubt sein, an dieser Stelle auf zwei besonders innovative Hinweise in diesem Buch einzugehen:
– Gegen die neoklassisch monetaristische Fehlsicht betont Frau Pettifor: Nicht das Sparen bestimmt das Investieren, sondern das Sparen ist die Folge von wirtschaftlichen Aktivitäten.
– Liebe Frau Pettifor, ich muss Ihnen mitteilen, ihre Ausführungen zur Geldschöpfung durch profitwirtschaftliche Banken im Rahmen der Kreditvergabe (FIAT-Geld) haben zu Missverständnissen im Vorfeld dieser Preisverleihung geführt. Wie Sie berichten, richtet sich gegen diese Buchgeldschöpfung die Vollgeldinitiative, die die Kompetenz einzig und allein der jeweiligen Zentralbank überlassen will. Zuerst äußern Sie ihre Sympathie, weil die Grundfragen der Geldschöpfung angesprochen werden. Dann kritisieren sie jedoch die Vollgeldinitiative eindrucksvoll mit einem Hinweis zur Mikroökonomie: Es sind doch die Kreditnehmer/innen der Banken – also die Kunden/innen –, die den Spielraum der Banken für die Geldschöpfung durch Kreditvergabe bestimmen. Deshalb bezeichnen Sie das Geldsystem als »trotz großer Macht der Geschäftsbanken« in »gewisser Weise demokratisch«. Zu Ende gedacht: Die Giralgeldschöpfung wird völlig problemlos, wenn die Macht der Banken demontiert worden ist.
Mein zusammengefasstes Urteil: Ich bin als denkverwandter Ökonom darüber glücklich, dass sie den »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken 2018« erhalten. Ihr Werk verdient diese Anerkennung in hohem Maße.
Möge dieser Preis der flächendeckenden Verbreitung Ihres Werkes dienen. Im Sinne Ihres Aufklärungsoptimismus geht es darum, gegen machtvolle Interessen die Bankenwelt zu reformieren. Jedenfalls werden im Sinn von Hannah Arendt durch diese Publikation die Demokratie und zivilisatorischen Kräfte durch Abbau der Finanzmarktmacht gestärkt.
Rudolf Hickel ist Wirtschaftswissenschaftler und war bis 2009 Direktor des »Instituts für Arbeit und Wirtschaft (IAW)«. 2017 wurde Hickel die Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen verliehen.
Ann Pettifor ist eine in Südafrika geborene britische Ökonomin und Autorin, die als Direktorin der Denkfabrik PRIME (Policy Research in Macroeconomics) und Fellow der New Economics Foundation tätig ist. Sie ist vor allem für ihre korrekte Vorhersage der Finanzkrise von 2007-08 in ihrem Buch The Coming First World Debt Crisis (2006) bekannt und führte die internationale Jubilee 2000-Kampagne für den Schuldenerlass der ärmsten Länder an, die zur Streichung von etwa 100 Milliarden Dollar Schulden führte.

© Pako Mera / Alamy Stock Photo
Sehr verehrte Damen und Herren,
liebe FreundInnen und UnterstützerInnen des
»Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«,
dear Mrs. Pettifor.
Ich darf Sie im Namen des Vereins »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken« und im Namen des Vereinsvorstandes ganz herzlich zur diesjährigen Preisverleihung in der festlichen Oberen Rathaushalle begrüßen.
Die internationale Jury hat entschieden, dass der »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken∑ diesmal einer politischen Ökonomin, oder: um es präziser zu sagen, einer unablässig politisch intervenierenden Denkerin überreicht wird: Ann Pettifor. Die Preisträgerin ist unter anderem Direktorin des Netzwerkes Policy Research in Macroeconomics (PRIME), das sich mit keynesianischer Geldtheorie und Politik auseinandersetzt. Sie lehrt, und ich bin wieder versucht zu sagen: unter anderem, am Political Economy Research Centre der City University London. Politisch hat sie mitunter maßgeblich an der Jubilee 2000-Kampagne mitgewirkt, einer globalen Bewegung, der Beachtliches gelungen ist, und wovon Ihnen Ann Pettifor in ihrem Festvortrag selbst berichten wird. Offenbar sind politische Interventionen nach wie vor keinesfalls aussichtslos.
Liebe Damen und Herren, der Hannah-Arendt-Preis versteht sich, wie Sie wissen, in erster Linie als ein politischer und nicht als ein akademischer Preis. Erlauben Sie mir daher kurz auf das jüngst erschienene und vorzügliche Buch der Preisträgerin hinzuweisen, welches den Titel trägt: Die Produktion des Geldes. Ein Plädoyer wider die Macht der Banken. Diese Schrift ist ebenfalls weniger eine akademische Abhandlung als vielmehr ein politisches Manifest. Es ist, ohne den Ausführungen der Jury an dieser Stelle allzu weit vorzugreifen, ein Motiv dafür gewesen, dass Ann Pettifor heute Abend der »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken« zugedacht wird. Das Buch steht geradezu exemplarisch für ihre politische Grundüberzeugung, der zufolge das, was in der Welt geschieht und alle angeht, auch von allen verstanden werden sollte. Sie pflegt, und das ist durchaus erwähnenswert, einen gewissermaßen demokratischen Schreibstil. Das heißt: Sie schreibt im Hinblick auf die bis heute nicht ausgestandene, geschweige denn hinreichend verstandene weltweite Finanzkrise und über die verheerenden Auswirkungen des globalen Finanzkapitalismus so verständlich, dass man es versteht. Dass das „Verstehen" für Ann Pettifor gleichsam „die andere Seite des Handelns" darstellt, lässt sich kaum prägnanter formulieren als in den Worten der Preisträgerin selbst, wenn sie in einem Interview betont: »The public are not stupid. They do understand these complexities. They can get it, and when they get it, they can act. But if they don't have […] facts […], it's very difficult to act and it's very difficult to change systems.«
Doch wie lässt sich die laut Ann Pettifor »despotische Macht« des von Eigeninteressen geleiteten globalen Finanzsektors zugunsten eines am Gemeinwohl orientierten Geldsystems überwinden? Wie geht überhaupt eine alternative politische Machtbildung vor sich? Wie ist es um die Selbsterneuerungsfähigkeit moderner Demokratien bestellt, die sich den scheinbar unabänderlichen neoliberalen Markterfordernissen zunehmend unterwerfen? Zusammengefasst gefragt: Wie lässt sich die geforderte »große Wende« (Ann Pettifor) politisch realisieren? Und wie sind in diesem Zusammenhang z.B. die Erfolge und Grenzen zu interpretieren, welche die weltweiten und in sich höchst heterogenen Protestbewegungen (Occupy, Attac etc. pp.) gegen den Finanzkapitalismus bislang erfahren haben?
Hierzu findet am morgigen Samstag im Institut Français, wie gewohnt um 11 Uhr, ein Symposium statt, das unter dem Titel »Die Macht der Finanzmärkte und die (Ohn-)Macht des Politischen?« steht. Es werden miteinander sprechen und diskutieren: Rudolf Hickel, Dieter Rucht und Ann Pettifor. Moderiert wird das Kolloquium von Antonia Grunenberg.
Wir sind froh, mit dem Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel und dem Protestforscher Dieter Rucht, gleich zwei höchst renommierte Wissenschaftler heute Abend begrüßen zu können. Rudolf Hickel dürfte nicht nur den BremerInnen bekannt sein. Er hat als Professor für Politische Ökonomie und später als Professor für Finanzwissenschaften an der Bremer Universität gelehrt. Rudolf Hickel ist unter anderem Direktor gewesen des an der Universität ansässigen Instituts Arbeit und Wirtschaft und ist mittlerweile dortiger Forschungsleiter. Eine seiner zahlreichen Publikationen trägt übrigens den Titel: Zerschlagt die Banken; Zivilisiert die Finanzmärkte.
Dieter Rucht, Professor für Soziologie, ist Mitbegründer des Berliner Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hat er beispielsweise die Forschungsgruppe Zivilgesellschaft, Citizenship und politische Mobilisierung mitgeleitet. Er erforscht seit mehreren Jahrzehnten vor allem soziale, politische und internationale (Protest-)Bewegungen und ist hierüber ebenfalls einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Schön, dass Sie beide hier sind.
Ich darf Sie nun mit dem weiteren Verlauf der heutigen Festveranstaltung vertraut machen.
Zunächst werden die VertreterIn der beiden preisstiftenden Institutionen zu Wort kommen. Für den Senat der Freien Hansestadt Bremen wird die Bürgermeisterin Karoline Linnert sprechen, für den Vorstand der Heinrich Böll Stiftung Ellen Ueberschär. Wir möchten den genannten Geldgebern, die den Hannah-Arendt-Preis seit so vielen Jahren finanziell und ideell unterstützen, bei dieser Gelegenheit nochmals und ausdrücklich dafür danken, dass sie es sich nicht nehmen lassen, alljährlich Abende wie diesen zu ermöglichen. Dem Senat der Stadt Bremen und der Heinrich Böll Stiftung gilt daher unser besonderer Dank.
Im Anschluss an die erwähnten Ansprachen der StifterInnen des Preises wird Monika Tokarzewska als Mitglied der Internationalen Jury die Begründung der Preisvergabe zusammen mit der Laudatio verlesen.
Es folgt dann der Festvortrag von Ann Pettifor, auf den wir alle sehr gespannt sind.
Danach werden Rudolf Hickel und Dieter Rucht dankenswerterweise bereits am heutigen Abend jeweils ihre inhaltlichen bzw. weiterführenden Kommentare zu Ann Pettifor vortragen. Wir freuen uns über diese Neuerung im Abendprogramm, die Ihnen vielleicht einen kleinen Vorgeschmack auf das morgige Kolloquium im Institut Français geben wird.
Der Abend im Rathaus klingt dann, und dies ist keine Neuerung, traditionell mit der Preisübergabe hier und einem gemeinsamen Sektempfang im Nachbarsaal aus und hoffentlich – in einem guten Sinne – noch lange nach.
Last but not least sind Sie alle, liebe Anwesende, herzlich dazu eingeladen, nach dem Sektempfang an einem kleinen Buffet, das heute Abend zu Ehren der Preisträgerin im Institut Français aus- und angerichtet wird, teilzunehmen. Ob dies nun zu einer organisatorischen Krise führen wird, ist, wie Vieles in dieser Welt, nicht absehbar; sie würde aber, und da darf ich Sie beruhigen, unsererseits dann nicht »gemanagt«, sondern schon irgendwie »gedeichselt« werden. Also: Partizipieren Sie ruhig! Damit überreiche ich nun das Wort an die Bürgermeisterin Karoline Linnert. Anschließend spricht, wie gesagt, Ellen Ueberschär für die Heinrich Böll Stiftung. Danach erfolgt die Jurybegründung und Laudatio von Monika Tokarzewska.
Vielen Dank!
Sehr geehrter Frau Pettifor,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich, dass wir heute gemeinsam den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken verleihen. Wir, das sind die Heinrich Böll Stiftung Bremen, der Verein »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken e.V.« und der Bremer Senat, für den ich hier stehe.
Wir verleihen diese Auszeichnung heute der Ökonomin und Finanzwissenschaftlerin Ann Pettifor, gebürtig aus Südafrika und heute britische Staatsangehörige.
Sehr geehrte Frau Pettifor,
Sie sind unter anderem durch ihre führende Rolle in der Jubilee 2000-Kampagne bekannt geworden. Die führte zum Jahrtausendwechsel dazu, dass 35 Entwicklungsländern Schulden in einer Gesamthöhe von rund 100 Milliarden US-Dollar erlassen wurden.
Herzlich Willkommen in Bremen! Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind!
Mit dem Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken ehren wir diejenigen Menschen, die es riskiert haben, das »Wagnis Öffentlichkeit« einzugehen und immer wieder neu eingehen. Die Preisträgerinnen und Preisträger erkennen das Neuartige in einer scheinbar sich linear fortschreibenden Welt denkend und handelnd und teilen es der Welt mit.
Das haben auch Sie, liebe Frau Pettifor, getan, als Sie eine der ganz wenigen Personen waren, die schon mit Beginn der US-Immobilienkrise – im September 2006 – sehr präzise die kurz bevor stehende, weltweite Finanz- und Bankenkrise vorher gesagt haben.
Die BBC hat Sie und drei weitere Ökonomen im Herbst 2018 deshalb als „Cassandras of the Crash" bezeichnet: Sie sind eine „Kassandra", die – wie in der griechischen Mythologie – Schlimmes vorhersehen kann, aber damit geschlagen ist, dass niemand auf sie hört – oder zumindest damals nicht auf Sie gehört hat.
Ich wünsche Ihnen sehr, dass das heute anders ist: Denn Sie haben kluge und streitbare Dinge zu sagen, veröffentlichen Bücher und Schriften und stellen sich wieder und wieder der öffentlichen Diskussion um die undemokratische und unregulierte Macht des Finanzsektors und der Banken.
Das teilt auch die Jury des Hannah-Arendt-Preises.
In ihrer Begründung heißt es: »Ann Pettifor beschreibt und erläutert sehr eindringlich die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der gegenwärtigen Geldproduktion, wie sie vorwiegend seitens der Banken in Form von digitalen Kreditvergaben betrieben wird. Im Fokus ihrer Kritik steht dabei ein sich verselbstständigender globaler Finanzsektor, der abseits der Öffentlichkeit, und somit außerhalb politischer Einflussnahmen und demokratischer Kontrollen agiert.« – So die Jury.
Und an dieser Stelle wird es interessant: Wie schaffen wir es ganz konkret, den sich verselbständigenden globalen Finanzsektor wieder unter Kontrolle zu bekommen?
Sie fordern, dass der Finanzsektor nicht länger »Herr der Wirtschaft« sein dürfe, sondern wieder auf die Rolle des klugen Dieners zurückverwiesen werden müsse.
Dazu machen Sie Vorschläge in Ihrem Buch Die Produktion des Geldes, wie etwa diesen, dass viel mehr Wissen in der Bevölkerung vorhanden sein müsste: über die Zusammenhänge im Finanzsektor, über Kapitalmobilität, Geldschöpfung, Schulden und Kredite und so weiter.
Und sie fordern eine strengere Reglementierung: Geschäftsbanken dürfen nicht einfach Geld schöpfen, indem sie „Zahlen in ihre Computertastatur tippen", wie Sie schreiben. Ich selbst finde ja, dass Banken dem Staat gehören sollten.
Es brauche klare Vorgaben für Kreditvergaben im privaten Bereich, die sich in der Regel am gesellschaftlichen Nutzen orientieren sollen, wie etwa an der Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass mit den vergebenen Mitteln Arbeitsplätze geschaffen werden, und dass das Ökosystem nicht unbegrenzt ausgebeutet wird.
Auf all diese spannenden Ansätze will ich hier nicht im Einzelnen eingehen.
Eine sehr interessante Frage ist für mich zunächst die, wie ein Staatswesen agieren kann, dass – wie Bremen – aktuell sehr hoch verschuldet ist, solange ihre Forderungen noch nicht Realität geworden sind?
Immerhin sprechen Sie sich auch gegen Ausgabenkürzungen in den öffentlichen Haushalten aus. Und gegen die Aussage: »Es ist kein Geld da.«
Diese Aussage war damals, als ich noch Sozialpolitikerin in der Opposition war, für mich der Grund, in den Haushalts- und Finanzausschuss des Parlaments zu gehen. Mir wurde auch immer gesagt. »Es ist kein Geld da.« Es war kein Geld für Soziales und für „Frauenthemen" da. Aber für „Männerthemen" war Geld da. Das wollte ich verstehen und ändern.
Aus meiner Perspektive als Finanzsenatorin dieses sehr armen Bundeslandes stellt sich die aktuelle Situation so dar, dass – wenn unsere Regierung immer mehr Schulden bei eben jenen kaum gebändigten Banken macht – wir unser Staatswesen diesen Banken immer stärker ausliefern und abhängig werden. Das darf aus demokratietheoretischen, sozial- und gesellschaftspolitischen Gründen auf keinen Fall passieren!
Arme Menschen brauchen einen sozial agierenden und unabhängigen Staat, reiche Menschen nicht so dringend. Denn reiche Menschen engagieren sich ihren Privatlehrer oder ihren Sicherheitsdienst zur Not selbst. Arme Menschen sind darauf angewiesen, dass es einen zum Wohle der Gesellschaft agierenden Staat gibt, der für kostenlose Bildung, für eine funktionierende Infrastruktur, für eine öffentliche medizinische Versorgung und für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger sorgt.
Sehr geehrte Frau Pettifor,
ich bin mir sicher, wir könnten uns wunderbar konstruktiv darüber auseinandersetzen, unter welchen Bedingungen ein Staatswesen Schulden machen darf – oder vielleicht sogar muss? – in welcher Höhe. Und wann ein Staat aufhören muss, sich zu verschulden.
Ein weiterer interessanter Diskussionspunkt wäre außerdem, wie viel „Keynes" unsere überwiegend nationalstaatlich angelegten Demokratien maximal vertragen, während sie sich innerhalb von EU-weiten Verträgen und innerhalb des globalen Marktes bewegen und dabei mit global agierenden Banken konfrontiert sind?
Zuletzt möchte ich noch einen Punkt anmerken, über den ich mich als Grüne und als Finanzsenatorin sehr freue: Sie schreiben den Umweltschützerinnen und Umweltschützern – uns Grünen – ins Stammbuch, dass man die Regulierung des Finanzsektors und den Schutz unseres Ökosystems nicht getrennt denken darf. Und wenn man es tut, ist der Umweltschutz zum Scheitern verurteilt. Denn wir haben es mit einem auf massiver Ausbeutung unserer Ressourcen beruhenden Finanzsektor zu tun.
Diese inhaltliche Verknüpfung nehmen mittlerweile zwar auch andere vor, aber selten in der Radikalität, wie Sie sie vortragen.
Aus tiefster Überzeugung schließe ich mich Ihrer Forderung an, dass wir unsere demokratischen Institutionen stützen und stärken müssen!
Wir müssen dem Gefühl der Abgehängtheit vieler Menschen begegnen, das auch der unregulierte Finanzmarkt ausgelöst hat.
Die Demokratieverdrossenheit, mit der wir es verstärkt zu tun haben, ist für unseren Staat und unsere Gesellschaft brandgefährlich!
Sehr geehrte Frau Pettifor,
ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zum Hannah-Arendt-Preis 2018!
Dieser Preis ist vor 24 Jahren ins Leben gerufen worden, um in den kontroversen Diskussionen über politische Gegenwartsfragen an Hannah Arendts Ausspruch zu erinnern, dass »der Sinn von Politik Freiheit (ist)«.
Da haben wir noch viel vor uns!
Lieber Preisträgerin, sehr geehrte Frau Pettifor, liebe Jury,
lieber Vorstand des Hannah-Arendt-Vereins für politisches
Denken, liebe Laudatoren, verehrte Gäste,
es ist mir eine große Freude, heute und hier das Wort an Sie richten zu dürfen im Namen der Heinrich Böll Stiftung.
Die Verleihungen des Preises habe ich in der Vergangenheit mit Neugier und großer Erwartung verfolgt – Die Verleihungen an Yfaat Weiss, an Navid Kermani, und Tony Judt haben mich regelrecht begeistert und die Vorfreude auf das Nachlesen der Laudationes und Reden der Geehrten gesteigert – meine Auswahl zeigt, dass ich im geistes- kultur- und religionswissenschaftlichen Bereich besonders begeisterungsfähig bin.
Nun aber: Ann Pettifor, eine Ökonomin, die uns erklären kann, woher das Geld kommt, warum das Vollgeld auch keine Lösung ist und dass der große Finanzcrash von 2008 nur das System konsolidiert hat, die notwendigen politischen Konsequenzen aber nicht gezogen wurden.
Und genau hier ist der spannende Punkt, an dem sich die beiden Tangenten des Preises – die Namensgeberin Hannah Arendt und die Preisträgerin – treffen.
Für Hannah Arendt war das Handeln des Menschen die höchste Form des Tätigseins. Handeln heißt: im öffentlichen Raum, durch Kontroverse und Kompromiss, versuchen die Unterschiedlichen, das Wohl der Gemeinschaft voranzubringen. Arendt entwirft ein Modell der Teilhabe aller Menschen an Wirtschaft und Gesellschaft: Alle Menschen haben das Recht auf eine vita activa in den res publicae. Aber dieses Recht ist ständig bedroht, nicht zuletzt durch übermächtige Wirtschaftsinteressen.
Schon von hier aus lässt sich eine Linie zu Ann Pettifors Fazit ihrer ökonomischen Analysen ziehen: Die Finanzindustrie sei nicht mehr Diener, sondern längst Herr der Gesellschaft.
Hannah Arendts sah diese Gefährdung des Politischen, des öffentlichen Raumes, voraus. Der gemeinsame Weg einer Gesellschaft muss Gegenstand eines permanenten Aushandlungsprozesses unterschiedlicher Interessen sein. Schon in den 1950er Jahren fürchtete sie, dass selbsternannte Experten und Berater die öffentlichen Angelegenheiten in die von ihnen gewünschte Richtung treiben und damit die Demokratie in einen Zustand versetzen würden, in dem sich die wahre Politik des gemeinsamen Gestaltens verflüchtigt. In einem solchen Zustand aber liegen die Anfänge totalitärer Herrschaft.
Die im neuen Jahrtausend aufkommende Occupy-Bewegung, die als ein Akt des Widerstands gegen diesen längst eingetretenen Zustand gelesen werden kann, vertritt mit ihrer radikalen Kapitalismus-Kritik ebendiese durchaus deftige Hannah-Arendt-Auslegung: Das globale Finanzsystem wird interpretiert als eine totalitäre Bewegung – angeführt von eben jenen Finanzmarktspezialisten –, die nicht zur Ruhe kommen wird, ehe sie nicht die ganze Welt erfasst und alles in private Hände gebracht hat, was bislang staatlicher oder zivilgesellschaftlicher Zugänglichkeit oder gar Kontrolle unterworfen war. Dazu Hannah Arendt in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1955): »Alles irgend durch Regeln Gebundene, Kontrollierbare und darum Statische muss verdampfen vor dem dynamischen Prinzip der Bewegung. Alles Individuelle, Traditionsbestimmte, kulturell Besondere und Widerständige soll durch den Kapitalismus wie durch ein reinigendes Fegefeuer, an dessen Ende die eine, gleichförmige und erlöste Welt steht.«
Sie selbst weitete Anfang der 1970er Jahre ihre Besorgnis zu einer negativen Utopie aus, dass übermächtige Wirtschafts- und Finanzinteressen die formal demokratischen Systeme industriekapitalistischer Gesellschaften bedrohen könnten und legte damit die Spur aus, in die Occupy einstieg. Aber auch jenseits radikaler Kapitalismus-Kritik offenbarte die heftige Finanzkrise von 2008, die ihr trauriges 10-jähriges Jubiläum just in diesem Jahr begeht, dass ihre Besorgnis nicht ins Leere lief.
Ann Pettifor, die – so möchte man sagen – politische Ökonomin, möchte mit ihrer Arbeit in Prime – Policy Research in Macroeconomics und als Fellow of the New Economics Foundation genau das bekämpfen, anprangern, verhindern – dass eine übermächtige Plutokratie die demokratischen Institutionen gleichsam zermalmt. Sie streitet für politische Kontrolle über die Finanzmärkte und stellt fest, dass trotz der desaströsen Erfahrungen in der Finanzkrise und der Sozialisierung des Schadens zulasten der Bürgerinnen und Bürger die Märkte alles andere als gezähmt erscheinen. Im Gegenteil: Heute sind die Bedingungen für das Finanzgeschäft überdurchschnittlich gut, weil dieses von Regierungen und Zentralbanken bestens unterstützt wird. Einige Verbesserungen in Randbereichen des Bankensystems gab es – Banken sollen eine höhere Eigenkapitalquote einhalten, aber insgesamt geschah wenig, um das riskante und sich rasant ausweitende System der Schattenbanken zu regulieren. Die globalen, privaten Finanzinstitutionen, so die Analyse von Ann Pettifor, »are too big to fail and their bosses too big to jail.«
Und ihre Empfehlung lautet, ganz auf der Arendtschen Linie des öffentlichen Aushandelns als Mittel der Rückgewinnung des Politischen, dass demokratisch gewählte Regierungen ihre Verantwortung für das globale Finanzsystem besser wahrnehmen müssen: strengere Kontrollen für die Finanzindustrie, klarere Vorgaben für die Kreditvergabe im privaten Bereich. Und vor allem: internationale Kapitalverkehrskontrollen – also eine Art Steuer auf grenzüberschreitende Kapitalflüsse – unter anderem, um die Zinssätze auf heimischen Märkten besser kontrollieren zu können. Eine Voraussetzung für all das ist, dass alle die, die eine vita activa bevorzugen, sich mit dem Finanzsystem auseinandersetzen.
»Die große Wende ist nur möglich«, – schreibt Pettifor in ihrem jüngsten Buch Die Produktion des Geldes. Ein Plädoyer wider die Macht der Banken, – »wenn wir uns mit einem umfassenden, angemessenen Verständnis für die Kapitalmobilität, für Geldschöpfung, Bankengeld und Zinsen wappnen – und dann Reformen fordern sowie die Wiederherstellung eines gerechten Geldsystems, das den Finanzsektor nicht länger Herr der Wirtschaft sein lässt, sondern wieder in die Rolle des Dieners verweist.«
Gemeint ist: des Dieners einer Demokratie, in der Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft ihre Interessen in den öffentlichen Raum einbringen. Dort ist der Ort der Verhandlung über das Gemeinwohl.
Liebe Ann Pettifor, wir freuen uns, dass sie aus dem Vereinigten – und noch europäischen – Königreich nach Bremen gekommen ist und gratulieren herzlich zum Hannah-Arendt-Preis 2018.
In Zeiten des leichten und des teuren Geldes
Die Entscheidung der Jury, den Hannah-Arendt-Preis für Politisches Denken Ann Pettifor, der britisch- südafrikanischen Wissenschaftlerin für Finanzwesen zu verleihen, mag auf den ersten Blick überraschen. Kann ein Denken über Geld ein politisches Denken sein? Ein politisches Denken in einem tieferen Sinn, nicht als Gemeinplatz, dass jedes soziale Phänomen ohnehin politisch sei?
In der politischen Theorie kommen das Geld und die Finanzwelt selbstredend vor, mit der Globalisierung und Digitalisierung der Finanzwelt ist ihr Einfluss auf den klassisch verstandenen politischen Raum schließlich und endlich nicht mehr zu ignorieren. Dieser Einfluss erscheint jedoch wie eine fremde, von außen kommende Macht, die in unsere Welt eingreift, die politische Institutionen von ihr mit dem unwiderlegbaren Argument „dafür ist kein Geld da" abhängig macht, die Demokratie aushöhlt und für wachsende soziale Spannungen sorgt, mit einem Wort unser Tun und Lassen bestimmt. Diskurstheoretiker beklagen – zu Recht –, dass die der Ökonomie entlehnten Kategorien und Begriffe unsere Sprache kolonisieren. Man spricht von Effizienz und Optimierung, Selbstvermarktung, Management und dergleichen. Gegen diese Macht, ja Übermacht kann man protestieren und ankämpfen, man kann sie auch ignorieren, wenn einem das Schicksal diese Lösung gestattet; der schwierigste Weg ist jedoch, ihren Mechanismen zumindest etwas von der verschlossenen Härte zu nehmen. Und gerade dies tut Ann Pettifor, insbesondere in ihrem letzten Buch Die Produktion des Geldes. Ein Plädoyer gegen die Macht der Banken. Sie möchte nichts weniger und nichts mehr als eine Wende erreichen, die groß sein und beim Kleinen beginnen soll, nämlich mit Wissen darüber, wie Geld entsteht.
Sie gewährt uns – dem breiten Publikum – den Einblick in eine Art 'black box', vor der, der nicht Spezialist ist, hilflos dasteht. Das Geld wird – wie sie es mit einer Prise Herausforderung formuliert – „aus dem Nichts" geschöpft. Ann Pettifor führt die Worte Ben Bernankes, des Chefs der Federal Reserve vom 15. März 2009 an, der auf die Frage, woher die Fed das nötige Geld hat, um die von der Finanzkrise bedrohten Banken zu retten, mit dem Satz antwortete: „Wenn wir einer Bank Geld leihen, setzen wir einfach im Computer ihren Kontostand herauf." Die Summe, um die es damals ging, betrug 85 Milliarden Dollar. Das machen Geschäftsbanken schon immer, fügt Ann Pettifor hinzu, um zugleich zu betonen, dass dies eine »große Macht« sei. Und gerade deswegen dürfe es der Gesellschaft nicht gleichgültig sein, wer über die Geldschöpfung entscheidet und zu welchem Zweck es geschöpft wird.
Dass Geld mittels Kredit zustande kommt, ist nicht erst eine späte Erscheinung unserer hochkomplizierten Zivilisation. Ann Pettifor erinnert in ihrem höchst gegenwartsbezogenem Werk immer wieder daran, wie es einst war, indem sie Momente aus der Geldgeschichte oder gar Geldanthropologie einblendet. „Das, was wir als Geld bezeichnen", betont sie, »hat seinen Ursprung in einem Glauben. Das Wort »Kredit» leitet sich vom lateinischen »credo» ab, ich glaube. »Ich glaube, dass du […] heute oder irgendwann in der Zukunft mein Geld zurückzahlen wirst. […] Der Zinssatz wurde zu einem Maß für dieses Vertrauen oder Versprechen. Und wenn das Vertrauen fehlt wird er zu einem Maß für den Mangel an Vertrauen.«
Dank der Erfindung des Kredits kann jemand, der etwas vorhat, aber dafür über keine Mittel verfügt, diese erhalten. Dafür muss er jedoch mit seinem Besitz, vielleicht mit einem Stück Boden oder mit der Leistung seines Geistes und Körpers bürgen. Auf diese Weise werden Dinge der Natur zu Elementen des Gesellschaftssystems. Wahrscheinlich ist der Kredit eine der ältesten Vergesellschaftungsformen der Menschen, da er ein Netz von Verbindlichkeiten und Verpflichtungen schafft, die durch Sicherheiten gedeckt werden. Wir sind gewohnt, die Entstehung des Geldes vom Tausch her zu verstehen, es sind aber, sagt Pettifor die „Schulden, nicht der Tausch, [die] seit den Anfängen zum Leben in Gemeinschaft [gehören]."
Ann Pettifor gelingt es, indem sie diese historische und anthropologische Dimension des Geldes in ihrem Buch durchschimmern lässt, dem Phänomen Geld das Odium einer Macht zu nehmen, die wir spätestens seit Marx mit Selbstentfremdung bezeichnen. Pettifor hält dagegen, dass das Geld eine große kulturelle Erfindung sei. Dank der Geldschöpfung mittels gegenseitiger Verbindlichkeiten kann die Gesellschaft etwas wagen, wozu sie sonst nicht imstande wäre, wenn sie nur auf das bloß Vorhandene, das Ersparte angewiesen wäre.
Dem Leser von Pettifors Werk wird zunehmend klar, dass dieser Griff über das bloß Gegebene hinaus, in das versprechende und zugleich verpflichtende Noch-Nicht, eine der wichtigsten Quellen der zivilisatorischen Dynamik darstellt, wobei, das sei hier angemerkt, die Autorin mit solch weitgreifenden Thesen bescheiden umgeht. Sie sieht sich selbst in der Denktradition John Maynard Keynes', den sie auf eine innovative Weise als Geldtheoretiker liest. Als einen früheren Wegbereiter für diese Tradition erwähnt sie auch Georg Simmel, den Autor der Philosophie des Geldes. Über das Vertrauen und das Geld schrieb er:
Wie ohne den Glauben der Menschen aneinander überhaupt die Gesellschaft auseinanderfallen würde, – denn wie wenige Verhältnisse gründen sich wirklich nur auf das, was der eine beweisbar vom anderen weiß, wie wenige würden irgendeine Zeitlang dauern, wenn der Glaube nicht ebenso stark und oft stärker wäre, als verstandesmäßige Beweise und sogar als der Augenschein! – so würde ohne ihn der Geldverkehr zusammenbrechen.
Eben deshalb ist es eine brennende Aufgabe, unterstreicht Pettifor und wir tun es mit ihr, die Geldschöpfung der Gesellschaft zurückzugeben und es in den politischen Raum, dem es genuin angehört, zurückzuführen. Derzeit befindet sich Geldproduktion leider Gottes außerhalb des Politischen. Unter dem Politischen versteht Ann Pettifor, ganz im Sinne von Hannah Arendt, den Raum der demokratischen öffentlichen Debatte.
In der heutigen Zeit ist Geld vorwiegend digitales Kreditgeld, das nicht nur außerhalb der Öffentlichkeit „produziert wird", sondern sich auch dem Wissen der Gesellschaft entzieht. Es lasse sich darüber nicht diskutieren, höchstens in der Form, dass die Mittel knapp seien, was die politische Debatte entarten lässt; Populismus jeglicher Art ist nur eine der Folgen dieser Entwicklung. Hinzu kommt, dass die menschliche Arbeit und die Erde als beschränkte Ressourcen für die nach mathematischen Algorithmen wachsenden Schuldenberge herhalten müssen, denn diese steigen als abstrakte Größen prozentual in die Höhe, während sich die natürlichen Reserven, darunter nicht zuletzt der menschliche Körper und menschliche Geist nur langsam regenerieren, während ihnen aber immer mehr Leistung abgepresst wird.
Ann Pettifors Formel, dass das Geld »aus dem Nichts« geschöpft wird und deshalb für die Bedürfnisse der Gesellschaft immer vorhanden sein könnte, haftet etwas Zauberhaftes an. Wir wissen aber, wie es Goethes leichtsinnigem Zauberlehrling ergangen ist. Er steht in Pettifors Buch als Symbol für unsere Zeit der globalen Finanzwirtschaft. Wir leben in einer Zeit des leichten und zugleich teuren Geldes. Ausgegeben wird es allzu oft für Dinge, die keine Zukunftsperspektive eröffnen. Das betrifft bei weitem nicht nur Entscheidungen auf Milliardenebene; Ann Pettifor führt an einer Stelle auch das Beispiel einer englischen Schönheitsklinik an. Wer sich da entschieden hat, Kunde zu werden, dem wurde gleich ein angeblich äußerst günstiger Kredit angeboten.
Indem Pettifor die Frage der Geldschöpfung zu einer politischen macht, provoziert sie uns zum Denken und Umdenken. Sie folgt hier, ohne sich darauf zu beziehen, dem Vorbild Hannah Arendts. In den letzten Zeilen der Vita activa, lobt Arendt ausgerechnet das Denken, das sie bisher zugunsten des Handelns außer Acht gelassen hatte. Sie diagnostiziert – aus anderen Gründen als Pettifor es tut – eine Verengung und Entmachtung des Politischen in der Moderne, insbesondere des politischen Handelns. Damit das Handeln aber ein wirklich politisches ist, braucht es freies und mutiges Denken. Arendt kommt zu dem paradoxen Schluss, dass „das reine Denken alle Tätigkeiten an schierem Tätigsein" übertrifft.
Ann Pettifors „Plädoyer gegen die Macht der Banken" setzt sich zum Ziel, uns zu solch reflexivem Tätigsein zu veranlassen. Denn wenn es sich mit dem Geld so verhält, können wir ein Experiment machen und die Perspektive umkehren. Zum Kredit gehören beide Seiten; der, der ihn anbietet, und der, der ihn nimmt. Auch wenn der Einzelne in seiner Isolierung nicht zählt, stellen doch die unzähligen kleinen Geldentscheidungen, die wir täglich treffen, insgesamt eine große Macht dar. Sie sind es, zusammengenommen, die die größte Quelle der Geldschöpfung ausmachen. Mir scheint es nicht verfehlt, hier eine Parallele zu den Ideen der Genossenschaftsbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts zu sehen. Pettifor hat keine staatliche Kontrolle der Geldmenge und keine zentralistische Verwaltung im Auge, sondern bewusstes Handeln der Bürger.
Die Bürger haben im Grunde mehr Macht über die Produktion des Geldes, als sie wahrzunehmen gewohnt sind, meint Ann Pettifor. Der Eigendynamik des exzessiven Konsums, das durch Werbung und allgegenwärtige Kreditangebote und anderem angekurbelt wird und die aus uns atomisierte Kunden macht, muss ein Handeln entgegengesetzt werden, das zwischenmenschliche Wirklichkeiten, in denen wir leben, mit einschließt: insbesondere das Wohlergehen der Gesellschaften und Gemeinschaften, deren Mitglieder wir sind, denn indem wir mit dem Geld umgehen, nehmen wir die Erde und uns selbst in Pacht mit Blick in die ungewisse Zukunft. Sobald wir die Geldfrage so stellen, offenbart sich das ganze Spektrum verwandter Themen, die berücksichtigt und mitdiskutiert werden müssen: in erster Linie die Umwelt, der Lebensstil, die Werte, auch die Religion und vieles mehr, was gerade zur Debatte steht.
Ann Pettifor geht auch auf die Frage ein, ob der Kapitalismus die Demokratie als seine Voraussetzung braucht. Wir sind ja seit einigen Jahrzehnten Zeugen des ökonomischen Aufstiegs von Staaten, die das Gegenteil zu beweisen scheinen. Ihre Antwort in dieser Debatte lautet: „Die Deregulierung des Finanzsektors hat gezeigt, dass ein von der Demokratie isolierter Kapitalismus zu Renditegier, Kriminalität und Korruption in großem Stil verkommt".
Nicht zuletzt verbindet Ann Pettifor auch in ihrer Biographie das Arendtsche Prinzip der Wechselwirkung von Denken und politischem Handeln. Geboren und aufgewachsen in Südafrika, ist sie Mitbegründerin der weltweiten Kampagne Jubilee-2000. Dank dieser Initiative wurden 35 Entwicklungsländern Schulden in einer Gesamthöhe von rund 100 Milliarden US-Dollar erlassen. Zu den vielen Initiativen, an denen sie mitwirkt, zählt u. a. Kampagne MamaYe, die sich für die Gesundheit von Schwangeren, jungen Müttern und Babys in Afrika einsetzt. Pettifor hat die Weltwirtschaftskrise 2008 vorausgesagt und früh vor ihr gewarnt. Sie ist Direktorin des Netzwerks Policy Research in Macroeconomics, das sich mit der Keynesisnischen Geld- und Politiktheorie beschäftigt.
Da für Hannah Arendt die Sprache und das Leben des Geistes aufs Engste miteinander verschränkt sind, sei unterstrichen, dass Ann Pettifors Werk in einer Sprache verfasst ist, die es für einen breiten Kreis von Nichtspezialisten lesbar macht. Dies ist kein Nebeneffekt, sondern Kern der Aufgabe, für die sie plädiert: dass die Geldproduktion der Gesellschaft zurückgegeben werden soll und muss, aber dazu brauchen wir Wissen und eine Sprache, welche die politische Debatte möglich macht. Diese Sprache zu gewinnen, ist der erste notwendige Schritt. Auch wenn wir dann mit und womöglich gegen Ann Pettifor streiten sollten, muss zuerst ein fehlendes Stück unserer Streitkultur hergestellt werden. Wir hoffen, dass es dazu kommen wird, auch dank des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken.
»Wo es Politik gibt, da gibt es Freiheit«
Wenn Sie erlauben, würde ich gerne beginnen, indem ich die Worte Hannah Arendts wiedergebe, als sie den Lessing Preis 1959 von der Freien und Hansestadt Hamburg verliehen bekam: »Der Preis ist eine Ehrung, die uns eine sehr eindringliche Lektion in Bescheidenheit erteilt. Aber die Ehrung mahnt uns nicht nur auf besondere, unüberhörbare Weise an die Dankbarkeit, die wir der Welt schulden; sie ist darüber hinaus in einem sehr hohen Maße weltverpflichtend.« Ihre damalige Rede trug den Titel Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten.
Es ist sowohl außergewöhnlich als auch erfreulich, dass die Stadt Bremen und die Heinrich Böll Stiftung gerade in diesen Zeiten den Preis mir, einer britischen Staatsbürgerin, verleihen möchten. Indem ich ihn annehme, verpflichte ich mich, mein Engagement in der Welt aufrechtzuerhalten.
Ich möchte der Stadt und der Stiftung danken, nicht nur für den Preis, sondern auch für die Gelegenheit, Hannah Arendt wiederzuentdecken. Ihre Werke erneut zu lesen hat Emotionen geweckt, die allgemein wohl als »sich verlieben« bezeichnet werden können. Ich habe die blendende Klarheit ihrer Gedanken wiederentdeckt (obwohl ihr Stil durchaus sehr drückend sein kann!), ihre gründliche und furchtlose Suche nach der Wahrheit (wie während des Eichmann-Prozesses) und ihren unerschütterlichen Mut, als ihre Arbeit auf Empörung traf.
Es wäre überwältigend gewesen sie kennenzulernen, mit ihr einen Kaffee in einem geschäftigen Bistro zu trinken, während sie eine Zigarette pafft. Es wäre wundervoll gewesen, eine ihrer Schülerinnen zu sein. Es ist eine Ehre und eine Freude, heute hier zu stehen und mit einer Frau assoziiert zu werden, so international bekannt, so intellektuell couragiert und so beeindruckend wie Hannah Arendt.
Sie lebte während furchtbar dunkler Zeiten. Heute stehen wir in Europa und der ganzen Welt Herausforderungen gegenüber, denen auch ihre Generation gegenüberstand – einem beängstigenden Anstieg von Anti-Semitismus, Rassismus, Nationalismus und sogar Faschismus. Wir können diesen Bedrohungen nur entgegentreten, indem wir politisch agieren und uns engagieren. Und da Hannah Arendt argumentierte, dass Politik Freiheit ist, müssen wir die Möglichkeiten unserer Politik nutzen, um unsere Freiheit zu schützen.
Ich habe Hoffnung, dass wir das menschliche Befinden verändern, dass wir die Gefahren, die uns begegnen, überwinden können. Das können wir erreichen, indem wir klar denken, indem wir mit unseren Mitmenschen interagieren, indem wir politisch handeln – mit dem von ihr gezeigten unerschütterlichen Mut handeln. Das bedeutet nicht, dass es keine dunklen Zeiten mehr geben wird. Die wird es geben. Jedoch wird es, seien Sie versichert, auch Veränderung geben.
Bertolt Brecht fragte:
»In den finsteren Zeiten
Wird da auch gesungen werden?
Da wird auch gesungen werden [antwortete er].
Von den finsteren Zeiten.«
Nichts in unserer heutigen Zeit erschiene Hannah Arendt fragwürdiger als unsere Haltung zur Welt, »zu einer Welt und Öffentlichkeit nämlich, welcher wir den Raum verdanken, in dem wir sprechen und in dem wir gehört werden.«
Politik, sagte sie, befasst sich mit der Koexistenz und dem Miteinander unterschiedlicher Männer (und Frauen). Politik basiert auf dem, was zwischen Männern und Frauen liegt und als Beziehungen etabliert wird.
Als hellhäutige Südafrikanerin wuchs ich unter dem rassistischen und unterdrückenden Afrikaaner-Nationalismus-Regime auf, das Millionen dunkel- und hellhäutigen Menschen die Freiheit verwehrte, mit- und nebeneinander zu existieren. Dunkelhäutigen Menschen wurde aufgrund ihrer Hautfarbe die Freiheit einer sicheren Existenz von der Wiege bis zur Bahre verweigert. Ihnen wurden die Menschenrechte abgesprochen, die das Privileg der hellhäutigen Südafrikaner waren.
Doch vor allem verweigerte das Afrikaaner-Nationalismus-Regime, das beinahe 50 Jahre von 1947 bis 1994 regierte, der dunkelhäutigen Bevölkerung die Freiheit des politischen Aktivismus – nicht nur das Recht für eine Regierung ihrer Wahl zu stimmen. Sondern auch das Recht auf Bündnisse.
Bereits 1950 wurde die Zensur in der Gesetzgebung zur inneren Sicherheit verankert, die auf dem Suppression of Communism Act [Gesetz zur Unterdrückung des Kommunismus] basiert. Dies untersagte das Zitieren gesperrter Personen sowie von Veröffentlichungen und Organisationen, darunter dem African National Congress (ANC), dem südafrikanischen Demokratenkongress, dem Pan African Congress (PAC), des Defense-and-Aid-Fonds, der südafrikanischen Kommunistischen Partei und der Afrikanischen Widerstandsbewegung. Das Verbot des von Nelson Mandela geführten ANC wurde erst 40 Jahre später, am 2. Februar 1990, aufgehoben.
Dunkelhäutigen Südafrikanern wurde das Recht abgesprochen politisch zu handeln. Das hat mich gelehrt, niemals Politik zu verspotten, sie zu belächeln oder von der Politik abzusehen, denn wo es Politik gibt, gibt es Freiheit.
Für Hannah Arendt ist der Sinn von Politik Freiheit. Und diese Freiheit wurde nicht negativ verstanden – mit anderen Worten, sie wurde nicht als »nicht beherrscht oder versklavt« verstanden. Stattdessen war es Freiheit, die den Staat – die Menschen – befähigte, sich politisch zu engagieren, sich mitzuteilen, zu verstehen und schließlich zu handeln.
»This freedom to interact in speech with many others ... is not the end purpose of politics« wrote Arendt.
»It is rather the substance and meaning of all things political. In this sense, politics and freedom are identical, and wherever this kind of freedom does not exist, there is no political space in the true sense.«
Es sollte daher wenig überraschen, dass ich das Ergebnis der südafrikanischen Zustände während meiner Kindheit und Jugend bin. Ich habe Glück, denn ich bin politisch. Ich habe eine unfreie und größtenteils unpolitische Gesellschaft durchgestanden.
Als junge Frau hatte ich keine Wahl als gegen diese Unfreiheit zu rebellieren und politisch aktiv zu werden. Im Südafrika der Apartheid Mensch zu sein – meine rassistische, kolonisierte und gespaltene Gesellschaft »in ihrer Objektivität und Sichtbarkeit von allen Seiten« zu verstehen – bedeutete, »to interact in speech with many others and experience the diversity that the world always is, in its totally.« In den abgetrennten und geschlossenen Gemeinden der weißen Südafrikaner gefangen zu sein war nicht menschlich.
Damals – als Studentin in den 1960er Jahren in Johannesburg – war Politik schwierig, sie war gefährlich und sie schien hoffnungslos. Doch sie war nicht hoffnungslos. Unser Handeln – unsere Entschlossenheit Wege zu finden, mit dunkelhäutigen Studenten zu interagieren, gegen ein schwer bewaffnetes und augenscheinlich unbezwingbares rassistisches Regime zu protestieren, unsere Proteste zu internationalisieren, indem wir Bobby Kennedy einluden, vor Studenten der Universität zu sprechen – all diese kleinen Handlungen brachten uns – und letztlich dem Land – mehr Freiheit.
Für mich war die Freilassung Nelson Mandelas 1989 und der darauffolgende Zusammenbruch der Apartheid ein »Wunder«. Deswegen bin ich optimistisch gegenüber der Zukunft. Denn ich habe eine Politik großer Veränderungen durchlebt und erfahren.
Ich habe eine Zeit erlebt, in der beinahe über Nacht die augenscheinlich unbezwingbare Sowjetunion zusammenbrach, Deutschland wiedervereint wurde und Europa sich veränderte.
Ich habe eine tragende Rolle in einer globalen Bewegung – Jubilee 2000/Entwicklung braucht Entschuldung – gespielt, die Millionen Menschen in über 60 Ländern mobilisierte – und politisierte –, reiche und mächtige Kreditnationen davon zu überzeugen, den ärmsten Ländern ihre Schulden zu erlassen. Während des 25. G8-Treffens 1999 in Köln, begannen Kanzler Schröder und die anderen Regierungsoberhäupter die Durchführung – das »Wunder« – der Tilgung von über 100 Milliarden Dollar Schulden, verteilt auf 35 der ärmsten Länder weltweit.
In den 1990er Jahren und im Zuge der Jubilee 2000/Entwicklung braucht Entschuldung-Bewegung betraten wir neue Wege, indem wir das Internet nutzten, um die Millionen Menschen zu erreichen und zu mobilisieren, die hinter unserem Ziel der Schuldentilgung bis zum Jahr 2000 standen, und mit ihnen zu diskutieren und debattieren. Das Internet gab uns die Möglichkeit zusammenzuarbeiten, über Grenzen hinaus zu denken und zu debattieren, und politisch zu handeln – das Machtverhältnis zwischen internationalen Gläubigern und Schuldnern zu verändern. Um zusammenzukommen, um sich einzusetzen, um für den Beginn des Wandels der Menschheit einzutreten.
Und jetzt müssen wir zusammenkommen, um die dreifache Krise zu bewältigen, mit der wir konfrontiert sind: ein global vernetztes und systemisches Finanzsystem, das anfällig für Krisen ist, der Klimawandel und drittens die »Energiekrise«, die durch die Verlagerung weg von fossilen Brennstoffen verursacht wurde, die notwendig ist, um den Klimawandel abzuschwächen.
Denn in diesen dunklen Zeiten, und zusätzlich zu den menschlichen Ängsten, sehen wir uns einer noch ernsteren Bedrohung gegenüber: dem Zusammenbruch des Planeten. Es ist eine Bedrohung, die so ernst ist, dass sie den Verstand abschreckt. Das Ausmaß der Gefahr ist für die meisten Bürger unverständlich – jenseits unserer Vorstellungskraft.
So wie wir uns die globale Finanzkrise 2007 bis 2009 nicht vorstellen konnten und von dem Ausmaß und der Schwere der Krise verblüfft waren. Aber obwohl wir uns das vorstellen müssen, ist die Gefahr eines Klimawandels für diejenigen in Kalifornien oder im Nahen Osten, in Griechenland oder in Indien, die Häuser, Lebensgrundlagen und Leben durch Brände und Überschwemmungen verloren haben, nicht mehr imaginär.
Zehn Jahre nach der GFC wurde die »fantastische, selbstregulierende Maschinerie«, die das globale Finanzsystem antreibt, nicht unter demokratische Verwaltung gestellt. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass Ökonomen, Politiker, aber auch wir, die Öffentlichkeit, die Aktivitäten des Finanzsektors ignoriert haben. Wir Frauen glaubten, dass die Finanzbranche für »Männer in Nadelstreifenanzügen« sei – diejenigen, die das gemeistert hätten, was wir als die Komplexität des Währungssystems, hypothekarisch gesicherte Wertpapiere, besicherte Schuldverschreibungen, strukturierte Investitionen ... und so weiter angesehen haben. Und so überließen wir die globalisierte Finanzbranche den »Herren des Universums«. Unsere Unwissenheit machte uns hilflos, aber auch impotent.
Wir können es uns nicht mehr leisten, das Finanzwesen den wenigen auf den globalen Kapitalmärkten tätigen Unternehmen zu überlassen. Vor allem wir Frauen müssen ein Thema in den Griff bekommen, das, wie ich Ihnen versichern kann, keine Raketenwissenschaft ist. Es mag in eine Sprache gekleidet sein, die die wahren Aktivitäten des Sektors verbergen und verbergen soll – aber es ist keine Raketenwissenschaft. Wir müssen unser Verständnis für die internationale Finanzarchitektur und das Währungssystem stärken.
Ich weiß, dass dies möglich ist, denn Millionen von einfachen Männern und Frauen, viele tausend deutsche Männer und Frauen, haben das internationale System der Staatsverschuldung in seiner ganzen Komplexität in den Griff bekommen und die wirtschaftlichen Möglichkeiten von mehr als 30 Ländern mit niedrigem Einkommen verändert.
Daher sind Verständnis, gemeinsame Diskussion und Debatte entscheidend für den Wandel. Wir können nicht das verändern, von dem wir nicht wissen, dass es existiert; oder das, was wir nicht verstehen. Wir wurden von den Sirenen des Marktes verführt. Solange wir unsere Kreditkarten benutzen konnten, wurden wir dazu gebracht, uns zufrieden zu fühlen. Solange wir Geld von Maschinen beziehen konnten, wo immer wir um die Welt reisten, war die Globalisierung für uns in Ordnung. Vor allem wurden wir dazu verleitet, mit der Finanzwirtschaft zum Einkaufen zu gehen – um den Konsum zu steigern. Wie bei Autos, die an Tankstellen ankommen, haben wir uns gerne mit finanziellem Treibstoff bei unseren Banken oder online eingedeckt – ohne zu verstehen, ob der finanzielle Treibstoff nachhaltig war. Und wir nutzten – oder ließen uns vom Finanzkapitalismus überreden das Geld zu nutzen, das wir uns geliehen oder verdient hatten, um den Konsum zu steigern. Und so trieb EasyMoney die Easy-»Markenfamilie« voran: EasyEnergy, EasyProperty, EasyShopping und EasyJet.
Einer der Gründe, warum ich es für wichtig halte, dass wir in Bezug auf die Finanzen politisch werden, ist, dass wir lernen, das System zu verstehen, mit anderen zusammenarbeiten, uns zu verbinden und letztendlich uns zu organisieren – weil ich überzeugt bin, dass es eine direkte Verbindung zwischen EasyMoney, EasyShopping und EasyJet gibt. Mit anderen Worten, zwischen unregulierter Kreditvergabe, Konsum und toxischen Emissionen.
Bis die Grünen verstehen, dass wir diese Aktivitäten nicht in ihren getrennten Lagern halten können – dass wir zuerst das Finanzsystem regulieren müssen, wenn wir den Verbrauch steuern und die toxischen Emissionen reduzieren wollen – werden unsere Bemühungen zur Verhinderung und Milderung des Klimawandels sinnlos sein.
Natürlich hat unsere verschwenderische Verbrennung fossiler Brennstoffe bereits zu einem Klimasturz geführt – und wir waren zu langsam, zu ängstlich, zu gierig, um es anzugehen. Unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen hat uns gefangen gehalten. Wir hatten nicht die Freiheit, politisch zu handeln, um einen Zusammenbruch des Planeten zu verhindern. Bis jetzt.
Einige, vor allem junge Menschen, fliehen aus dem Käfig der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und säen Samen der Hoffnung. Auf der ganzen Welt setzen sie sich für die Rettung des Planeten ein und fordern einen Green New Deal. Aber vielleicht am wichtigsten ist, dass diese jungen Menschen in dem aktiv sind, was viele als den »Bauch der Bestie« wahrnehmen – dem Kongress der Vereinigten Staaten. Sie werden von einer jungen Frau – Alexandria Ocasio Cortez aus New York – und einer als Justice Democrats bekannten Gruppe angeführt. Unmittelbar nach den jüngsten Zwischenwahlen haben sie ihre Freiheit genutzt, um Raum für Diskussionen über Alternativen zu einer auf fossilen Brennstoffen basierenden Wirtschaft zu schaffen – und um politisch zu handeln. Sie besetzten einen Teil des US-Kongresses, um Veränderungen zu fordern.
Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2007, versammelte sich seit mehr als einem Jahr regelmäßig eine viel ältere Gruppe von Menschen – eine Gruppe von Ökonomen, Energieexperten und Umweltschützern (einschließlich Caroline Lucas, die damalige grüne Europaabgeordnete) – in unserer kleinen Wohnung nahe der Baker Street, London. Wir haben uns zusammengetan, um ein Dokument zu entwerfen, das die »dreifache Krise« angeht – die Kombination aus einer kreditgetriebenen Finanzkrise, der Beschleunigung des Klimawandels und steigenden Energiepreisen –, gestützt auf das, was wir damals fälschlicherweise für einen unkontrollierten Höhepunkt der Ölproduktion gehalten hatten. Diese drei sich überschneidenden Ereignisse drohten, so argumentierten wir, zu einem Unwetter zu werden, wie es seit der Weltwirtschaftskrise nicht mehr zu sehen war. Um dies zu verhindern, entwarfen und veröffentlichten wir 2008 A Green New Deal.
Nach der Publikation unseres Berichts, sprachen wir mit vielen anderen und machten dabei die Erfahrung, wie vielfältig die Welt ist (Arendt Zitat: we »interacted in speech with many others to experience the diversity that the world always is, in its totally«).
Viele unterstützten unseren Bericht, darunter angesehene Persönlichkeiten der Vereinten Nationen und die Regierungsoberhäupter kleiner exponierter Volkswirtschaften. Wie Sie alle wissen hat die Heinrich Böll Stiftung 2009 Toward a Transatlantic Green New Deal/Auf dem Weg zu einem Green New Deal veröffentlicht, 2010 den Artikel Green New Deal in Ukraine? The Energy Sector and modernizing a National Economy und 2011 den Beitrag Protests for Social Justice: A Green New Deal for Israel?/Proteste für soziale Gerechtigkeit: Ein Green New Deal für Israel?
Er wurde als Teil der Kampagne der Europäischen Grünen Partei bei den Parlamentswahlen der EU im Jahr 2009 verwendet. Die US-amerikanische Präsidentschaftskandidatin Jill Stein setzte unseren Bericht in ihren Kampagnen von 2012 und 2016 ein.
Anfang 2018 klopften dann zwei Amerikaner an meine Tür. Es waren Zack Exely und Saikat Chakrabarti von den Justice Democrats. Sie waren von Gegnern wegen der wirtschaftlichen Lage herausgefordert worden. Wie wollten sie den Wirtschaftswandel weg von fossilen Brennstoffen – den Green New Deal – finanzieren? Sie hatten mein kurzes Buch The Production of Money gelesen und wollten mit britischen Wirtschaftswissenschaftlern zusammenarbeiten, um die Frage zu beantworten, wie die Geldpolitik (nicht nur die Steuerpolitik) gesteuert werden kann, um den Green New Deal zu finanzieren. Sie waren besonders beeindruckt von Keynes Behauptung in seiner berühmten Rede »National Self Sufficiency« an der Yale University im Juni 1933, dass wir, dank der soliden Entwicklung der Währungssysteme und gestützt durch lebenswichtige Institutionen, uns leisten können, was wir schaffen können. Dass wir uns leisten können, was wir tun können – innerhalb unserer eigenen physischen Grenzen und innerhalb der Grenzen des Ökosystems.
Kurz darauf trafen sich Zack und Saikat mit Miss Osario-Cortez und überredeten sie, den amtierenden New Yorker Demokraten in den Vorwahlen herauszufordern. Zum Erstaunen und zur Freude aller hat sie gewonnen. Dank ihrer politischen Tätigkeit – dank ihrer Freiheit, politisch zu handeln – bewegen sich die Forderungen nach einem Green New Deal nun in den politischen Mainstream der USA.
Das gibt mir Hoffnung. Denn gemeinsam haben wir den Raum geschaffen, in dem Menschen mit Worten und mit Aktion interagieren können – und in diesem Raum wird Politik lebendig und Veränderungen sind möglich.
Hannah Arendt schrieb (in What is Freedom?), es sei notwendig:
»to be prepared for and expect ‚miracles' in the political realm. And the more heavily the scales are weighted in favour of disaster, the more miraculous will the deed done in freedom appear ...«
»für und in Erwartung von ‚Wundern' im politischen Bereich gewappnet zu sein. Und je mehr sich die Waagschalen gen Desaster neigen, desto wunderbarer wird die in Freiheit ausgeführte Handlung erscheinen.«
Objektiv betrachtet, sind Männer und Frauen die Anfänge und die Anfänger, schreibt sie.
»The decisive difference between the ‚infinite improbabilities' on which the reality of our earthly life rests and the miraculous character inherent in those events which establish historical reality is that, in the realm of human affairs, we know the author of the ‚miracles'.
It is men and women who perform them – because they have received the twofold gift of freedom and action and can establish a reality of their own.«
»Der entscheidende Unterschied zwischen den ‚unendlichen Unwahrscheinlichkeiten', auf denen die Realität unseres irdischen Lebens beruht, und dem wunderbaren Charakter derjenigen Ereignisse, die die historische Wirklichkeit begründen, besteht darin, dass wir im Bereich der menschlichen Angelegenheiten den Urheber der ‚Wunder' kennen.
Es sind Männer und Frauen, welche sie vollbringen – weil sie das zweifache Geschenk der Freiheit und Handlungsfähigkeit erhalten haben und eine eigene Realität schaffen können.«
In meinem Leben habe ich ‚Wunder' erlebt, die von Männern und Frauen vollbracht wurden. Aus diesem Grund und solange wir frei und politisch sind, werde ich von der Hoffnung getragen.
Vielen Dank.
Die Bankenwelt reformieren
Die jüngste Finanzmarktkrise hat sich bereits seit den Neunzehnhundertachtziger-Jahren herausgebildet. Die Lehmann-Brothers Pleite am 15. September vor zehn Jahren konnte am Ende nur noch symbolhaft den Zusammenbruch dieses neuen durch die Finanzmärkte getriebenen Spekulationskapitalismus sichtbar machen. Im Kern geht es um die ökonomische Wertschöpfung, die durch die Macht der Finanzmärkte kommandiert wird. Der Zusammenbruch dieser von der dienenden Funktion für die Wirtschaft und Gesellschaft relativ entkoppelten Finanzwirtschaft wirkte systembedrohend: Pleiten von Banken, Zusammenbruch des wichtigen Interbankenmarktes, Absturz der gesamtwirtschaftlichen Produktion (in Deutschland 2009 um 5 Prozent), Verlust an Arbeitsplätzen, Finanzierung von teuren Programmen zur Rettung von Banken durch den Steuerstaat. Vor allem aber ist die dadurch ausgelöste, tiefe Krise des Vertrauens in die Stabilität der geldwirtschaftlichen Grundordnung bis heute noch nicht überwunden. Im Gegenteil, die Ängste vor einem neuen Absturz zu Lasten der »kleinen Leute« ist groß und hat auf das Wahlverhalten Einfluss. Unlängst ist in einer Studie über die politischen Folgen von Finanzkrisen in den letzten 200 Jahren im »European Economic Review« erneut die Demokratiegefährdung dechiffriert worden. Nicht nur in Deutschland schlachten Rechte diese Akzeptanzkrise des Systems für ihre Politik aus.
Man sollte meinen, spätestens die Bedrohung der demokratischen Grundlagen der Gesellschaft führt dazu, die Ursachen und Folgen dieser Finanzmarktherrschaft schonungslos zu untersuchen, um dagegen eine Politik der Entmachtung der Finanzmarktoligarchie in Gang zu setzen. Jedoch, bis auf wenige rühmliche Ausnahmen, vor allem die Politik beratende »Mainstream-Economics« versagt wieder einmal. Es nehmen die Versuche zu, die Krisenanfälligkeit des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus zu bagatellisieren, gar zu leugnen.
Gegen dieses interessengeleitete Verdrängen der Ursachen und Folgen der Finanzmarktkrise stemmt sich das so wertvolle Buch von Ann Pettifor. Der Titel signalisiert ein doppeltes Programm: Analyse der »Produktion des Geldes«, der logisch konsequent »ein Plädoyer wider die Macht der Banken« folgt.
Es drängt mich, auf die vielen wertvollen Details dieser Analysearbeit einzugehen. Das geht an dieser Stelle leider nicht. Daher wenige Hinweise zu den wichtigsten Aussagen:
Das Buch ist vom unerschütterlichen Glauben an die Aufklärung als Basis des ökonomischen Machtabbaus zugunsten demokratischer Reformen geprägt (»bereits allgemeines Verständnis für Geld, Kredit und die Funktionsweise des Banken- und Finanzsystems zu einer wirklichen Veränderung führen.«).
Das Epizentrum der Finanzmarktkrise wird zu Recht in der Politik der Deregulierung der Finanzmärkte, also deren neoliberale Entfesselung, gesehen. Die Politik hat bereits vor über 30 Jahren dem Druck der renditegierigen Geldkapitalanleger/innen nachgegeben und die Ordnung des Geld- und Währungssystems demontiert. Der Start erfolgte am 27. Oktober 1986 mit Maggy Thatchers »Big Bang« am Finanzplatz London. Danach wurde eine »Internationale der Deregulierung« durchgesetzt, übrigens mit Bill Clinton 1999 durch die Aufhebung des Glass-Steagall Acts von 1932/33.
Gegen diese zerstörerische Deregulierungspolitik entwickelt Frau Pettifor detailliert die Alternative mit dem Ziel nachhaltiger Regulierungen des gesamten Finanzsystems. Durch ihre Neuordnung der Finanzwelt wird die Macht der Banken sowie der Finanzoligarchen (»Raubritter«) reduziert und damit das Finanzsystem wieder auf die dienenden Funktionen für die Wirtschaft und Gesellschaft konzentriert. Ordnungspolitisch hat Frau Pettifor Adam Smith (Wealth of Nations, 1776) auf ihrer Seite. Adam Smith hat sich im Rahmen eines Bankengesetzes mit der Frage auseinandergesetzt, wann man mit einem Gesetz »die persönliche Freiheit … schützen, statt einschränken sollte«. Die Antwort ist klar: »Wenn einige wenige dieses Naturrecht (persönliche Freiheit, R. H.) so nutzen, dass sie die Sicherheit des ganzen Landes gefährden können, so schränkt jede Regierung … dieses Recht gesetzlich ein, und zwar zu Recht.«
Im Streit der ökonomischen Theorie ist Frau Pettifors Wirtschafts- und Währungsanalyse stark durch das Werk von John Maynard Keynes geprägt. Sie geißelt eindrucksvoll die weit verbreitete Behauptung, J. M. Keynes sei der Erfinder staatlicher Defizitpolitik. Welch ein Unsinn, darüber steht kein Wort in seiner Allgemeinen Theorie von 1936. Vielmehr hat Keynes die Entwicklung zum Kasinohaften des Kapitalismus durch wachsende Spekulationen, die für die Wirtschaft schädlich sind, erstmals beschrieben. Übrigens vergleichbar spricht Marx (3. Band Das Kapital) vom »Spiel, das an der Stelle der Arbeit als die ursprüngliche Erwerbsarbeit von Kapitaleigentum erscheint«.
Die Kritik an der Austeritätspolitik – also einer von gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen völlig losgelösten staatlichen Einsparpolitik – ist Pflichtlektüre für die Anhänger der schwarzen/roten Null.
Ihr Plädoyer für eine abgestimmte Geld- und Fiskalpolitik lässt sich zur Offenlegung eines Dilemmas im Euroraum nutzen. Die Europäische Zentralbank, die seit September 2012 mit expansiver Geldpolitik (»quantitative Easing«) erfolgreich den Euroraum stabilisiert hat, ist durch eine restriktive Finanzpolitik (»EU-Fiskalpakt«) konterkariert worden.
Es muss dem Geldtheoretiker erlaubt sein, an dieser Stelle auf zwei besonders innovative Hinweise in diesem Buch einzugehen:
– Gegen die neoklassisch monetaristische Fehlsicht betont Frau Pettifor: Nicht das Sparen bestimmt das Investieren, sondern das Sparen ist die Folge von wirtschaftlichen Aktivitäten.
– Liebe Frau Pettifor, ich muss Ihnen mitteilen, ihre Ausführungen zur Geldschöpfung durch profitwirtschaftliche Banken im Rahmen der Kreditvergabe (FIAT-Geld) haben zu Missverständnissen im Vorfeld dieser Preisverleihung geführt. Wie Sie berichten, richtet sich gegen diese Buchgeldschöpfung die Vollgeldinitiative, die die Kompetenz einzig und allein der jeweiligen Zentralbank überlassen will. Zuerst äußern Sie ihre Sympathie, weil die Grundfragen der Geldschöpfung angesprochen werden. Dann kritisieren sie jedoch die Vollgeldinitiative eindrucksvoll mit einem Hinweis zur Mikroökonomie: Es sind doch die Kreditnehmer/innen der Banken – also die Kunden/innen –, die den Spielraum der Banken für die Geldschöpfung durch Kreditvergabe bestimmen. Deshalb bezeichnen Sie das Geldsystem als »trotz großer Macht der Geschäftsbanken« in »gewisser Weise demokratisch«. Zu Ende gedacht: Die Giralgeldschöpfung wird völlig problemlos, wenn die Macht der Banken demontiert worden ist.
Mein zusammengefasstes Urteil: Ich bin als denkverwandter Ökonom darüber glücklich, dass sie den »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken 2018« erhalten. Ihr Werk verdient diese Anerkennung in hohem Maße.
Möge dieser Preis der flächendeckenden Verbreitung Ihres Werkes dienen. Im Sinne Ihres Aufklärungsoptimismus geht es darum, gegen machtvolle Interessen die Bankenwelt zu reformieren. Jedenfalls werden im Sinn von Hannah Arendt durch diese Publikation die Demokratie und zivilisatorischen Kräfte durch Abbau der Finanzmarktmacht gestärkt.
Rudolf Hickel ist Wirtschaftswissenschaftler und war bis 2009 Direktor des »Instituts für Arbeit und Wirtschaft (IAW)«. 2017 wurde Hickel die Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen verliehen.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz