
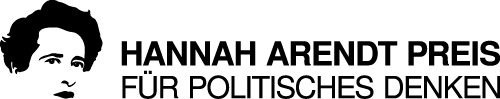

Agnes Heller, ungarische Philosophin; lebt in USA und Ungarn
Sehr geehrte Preisträgerin,
Liebe Ágnes Heller,
Sehr geehrter Herr Senatspräsident und Erster Bürgermeister der Hansestadt Bremen,
Lieber Henning Scherf,
Meine Damen und Herren,
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir sind heute abend hier zusammengekommen, um zum ersten Mal den Hannah-Arendt- Preis für politisches Denken zu vergeben und dieses Ereignis gebührend zu feiern. Lassen Sie mich kurz darauf zurückkommen, wie die Idee zu diesem Preis entstand, der im übrigen nicht identisch ist mit dem gleichnamigen Wiener Preis für politische Institutionen in mitteleuropäischen Staaten.
Im Sommer 1994 fand sich eine Gruppe von interessierten Menschen aus Wissenschaft, Publizistik und Politik zusammen. Sie alle bewegte die Erfahrung, daß das herkömmliche politische Denken den großen Herausforderungen, die durch den Zusammenbruch der Blöcke und die Öffnung Europas seit 1989 entstanden sind, nicht gewachsen ist. 1989 war einer jener „großen Glücksfälle der Geschichte, in denen der Sinn von Politik, und zwar das Heil wie das Unheil des Politischen voll in Erscheinung“ treten, wie es bei Hannah Arendt heißt, aber das politische Denken konnte diesen Glücksfall nur momentweise durchdringen. Seine Protagonisten fielen alsbald wieder in die Sprache des „business as usual“ zurück. Was fehlt, ist die Inanspruchnahme des öffentlichen Raumes für streitbares politisches Denken. Damit ist zunächst der Vorgang des öffentlichen Verstehens gemeint, das heißt die Auslotung des Raumes, in dem Politik geschieht.
Viele Vertreter des gegenwärtigen politischen Denkens im Westen möchten gerne glauben, daß sich politische Veränderungen im Osten und im Süden Europas durch den reinen institutionellen Nachvollzug der westlichen Demokratien quasi konzeptionell „herstellen“ lassen. Die Erfahrungen zeigen, daß dies nicht der Fall ist, da der politische Zusammenhalt eines Gemeinwesens eben in mehr besteht als seinen Institutionen. Das gängige Politikverständnis geht davon aus, daß die Aufgabe der Politik darin besteht, das gesellschaftliche Leben zu organisieren. Gleichzeitig erfahren diejenigen, die für Politik heute verantwortlich sind, neuartige Grenzen ihres bisherigen politischen Denkens und Handelns. Sie sehen sich einer Dynamik ausgesetzt, in der disparate Kulturen und Denkweisen den demokratischen Universalismus in Frage stellen, und in der die sozialen Probleme wie Arbeitslosigkeit und Armut nicht mehr zu lösen sind, sondern nur noch umorganisiert werden können. In dieser Situation heißt politisches Denken, aus den gewohnten Bahnen auszusteigen und das eigene Verstehen einer als disparat erfahrenen Welt zum Gegenstand des Denkens zu machen. Politisches Denken heute heißt, sich auf die Gründe des politischen Zusammenseins in Gesellschaften zu besinnen.
In diesem Kontext war die Entdeckung der politischen Denkerin Hannah Arendt naheliegend, ja überfällig. In der Bundesrepublik ist Hannah Arendt als deutsch-jüdische Denkerin freilich bisher wenig wahrgenommen worden. Erst der Umweg über das Exil in den Vereinigten Staa- ten, die ihr zur Heimat wurden, hat sie den Deutschen nähergebracht. Und auch dann hatten ihre Schriften es schwer, sich gegen die links-rechts Polarisierung der akademischen Öffentlichkeit in der Bundesrepublik durchzusetzen.
Wie keine andere Denkerin hat Hannah Arendt die tiefen Brüche dieses Jahrhunderts sowohl persönlich erfahren als auch denkend erarbeitet. Aus der Offenheit diesen Brüchen gegenüber entstand ihr öffentliches Nachdenken über die Gründe und die Möglichkeiten politischen Zusammenhalts der Bürger, das sich durch alle ihre Werke zieht. Hannah Arendts Denken, das in dieser unserer Zeit der Brüche so überaus aktuell ist, war uns Ermutigung genug, in ihrem Namen einen Preis für politisches Denken zu stiften, der die Aktualität ihres Denkens weitertragen soll.
Wir vergeben diesen Preis heute zum ersten Mal. Die erste Preisträgerin ist die ungarische Philosophin Ágnes Heller, die mit Hannah Arendt auf vielfache Weise verbunden ist, und dies nicht nur über den ehrenwerten Umstand, daß sie gegenwärtig den „Hannah Arendt- Lehrstuhl für politische Philosophie“ an der New School of Social Research in New York innehat, der Universität, an der auch Arendt zeitweise lehrte. Wie Hannah Arendt hat auch Ágnes Heller, die Jüngere, die Brüche und Aufbrüche dieses Jahrhunderts persönlich erfahren und intellektuell verarbeitet. Die beiden großen politischen Herausforderungen dieses Jahrhunderts, Marxis- mus und Nationalsozialismus/Faschismus, begleiten ihr Schaffen und führen auch sie immer wieder zu der Frage nach den Weisen des politischen Zusammenwirkens der Bürger und den Gestaltungsmöglichkeiten der Freiheit. Wie Arendt versucht Ágnes Heller das Unmögliche zu denken, nicht weil es unmöglich ist, sondern weil es ein Noch-nicht-Möglich ist, das in den Raum des Möglichen gehoben werden kann, wie sie es einmal sinngemäß formulierte.
Ágnes Heller hat den Arendtschen Ansatz, Politik neu zu denken jenseits der Organisierung des sozialen Leben, weitergeführt. Es ist uns eine Freude, Ihnen, liebe Ágnes Heller, den diesjährigen Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken zu überreichen.
Liebe Ágnes, lieber Bürgermeister, lieber Henning,liebe Frau Antonia Grunenberg, verehrte Anwesende,
Hannah Arendt war im Universitätsjahr 1968/69 meine höchst eindrucksvolle Kollegin an der Graduate Faculty der New School for Social Research in New York. Sie brachte der ehemaligen „University of Exile“ , die vielen aus Europa vor den Nazis geflohenen Wissenschaftlern als erste Heimstätte gedient hatte, noch einmal ein Stück jüdisch- deutscher Geistigkeit zurück, das dankbar willkommen geheißen wurde. Zu den amüsanten Anekdoten, die sie gelegentlich zu erzählen wußte, gehört auch der Bericht von einer Studentin, die nach einem Vortrag, in dem viel von Rosa Luxemburg die Rede gewesen war, Hannah Arendt versehentlich als „Rosa Luxemburg“ anredete. Sie hat sich über diese Verwechslung offensichtlich gefreut. Heute ist Ágnes Heller die Inhaberin des nach Hannah Arendt benannten Lehrstuhls an der New School. Meine Bekanntschaft und Freundschaft mit ihr reicht viele Jahre zurück - wir haben erst eben festgestellt, daß es fast genau 30 Jahre her sind, seit sie meine Familie in Frankfurt besucht hat und von dem lebendigen Treiben einer „Vier-Kinder- Familie“ amüsiert und beeindruckt war. Wenn ich Ágnes heute preisen soll, dann habe ich nicht nur die berühmte Gelehrte und engagierte Intellektuelle vor Augen, sondern auch die damals erst „eingeweihten“ Kollegen als Lieblingsschülerin von Georg Lukàcs bekannte Philosophin. Am deutlichsten ist mir in Erinnerung mit welchem Mut sie sich dem Protesttelegramm anschloß, das wir Teilnehmer am „Sommerkurs in Korcula“ anläßlich des Einmarsches von Warschauer-Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei 1968 an Breschnew geschickt haben. Wir protestierten bei Herrn (nicht Genossen) Breschnew gegen diese ungeheuerliche Verletzung der Souveränität eines Staates, der unter der Initiative eines freiheitlich denkenden Kommunisten - Alexander Dubzek- eine Reform des „real existierenden Sozialismus“ in Angriff genommen hatte. Einen Augenblick lang tauchte die Frage auf, ob Bürger von Staaten, die unter kommunistischen Regierungen lebten, nicht besser auf eine Unterschrift verzichten sollten, um sich Repressalien zu ersparen. Ágnes Heller aber war ganz entschieden dafür, solidarisch mit den tschechoslowakischen Reformern den Protest zu unterschreiben. Die unvermeidlichen Folgen nahm sie - nach Ungarn zurückgekehrt - gelassen in Kauf. Ihre Zivilcourage habe ich - nicht nur bei dieser Gelegenheit - bewundert. In Budapest erwartete sie der Ausschluß aus der Akademie der Wissenschaften. Zum zweiten Mal war der unvermeidliche Konflikt zwischen ihr und der autoritären Parteiführung offen ausgebrochen. Übersetzungsarbeiten und ein Stipendium, das ihr eine Zeitlang in Berlin zu arbeiten ermöglichte, erlaubten ihr das „geistige Überleben“. Seit 1977 lehrte sie dann im Ausland zunächst in Melbourne in Australien, schließlich an der Graduate Faculty der New School in New York. Erst das Ende des kommunistischen Regimes in Ungarn ermöglichte ihr auch dort wieder akademisch tätig zu sein.
Georg Lucàcs, auf den ich 1970 die Laudatio anläßlich der Verleihung des Goethe-Preises der Stadt Frankfurt halten durfte, war eine Ausnahmeerscheinung unter den kommunistischen Intellektuellen. Als junger Mann hatte er sich für Sören Kierkegaard interessiert und eine existentialistische Phase durchgemacht. Voller Sympathie förderte er die junge avantgardistische ungarische Literatur. All das hat er im Rückblick als „dekadent“ heftig verurteilt. Aus Heidelberg nach Ungarn heimgekehrt schloß er sich den kommunistischen Revolutionären unter Bela Kun an, die in Ungarn nach sowjetischem Vorbild eine sozialistische Gesellschaft errichten wollten. Nach der Niederlage der Revolution schrieb er in Wien eine Reihe von Essays, die unter dem Titel „Geschichte und Klassenbewußtsein“ gesammelt 1923 veröffentlicht wurden und einen nachhaltigen Einfluß vor allem auf „westliche Marxisten“ - nicht zuletzt auch die „Frankfurter“ - ausübten. In diesem Buch entwickelte er eine ungemein anspruchsvolle philosophische Theorie der leninistischen Avantgarde-Partei, die dem Proletariat zum adäquaten Klassenbewußtsein verhelfen und es damit als „Subjekt-Objekt der Geschichte“ handlungsfähig machen soll. Den orthodoxen Marxisten mißfiel diese Arbeit. Einmal, weil sie zu eindeutig vom Ziel der Emanzipation der Klasse sprach, zum anderen, weil sie - ungewollt - deutlich machte, daß die Leninsche Avantgarde-Partei nur mit Hilfe einer idealistischen Philosophie gerechtfertigt werden konnte. Diese Partei war für Lucàcs die Inkarnation des richtigen Klassenbewußtseins, die - im Interesse der Revolution - eine „selbständige Gestalt“ angenommen hatte. Kurz - die orthodoxen Hüter der „reinen Lehre“ zwangen Lucàcs zur Selbstkritik. Hierauf zog er sich auf das Gebiet der Literaturwissenschaft und Literaturkritik im großen Stil zurück. Auch da, wo er sich dem obligaten Kanon des „sozialistischen Realismus“ anbequemte, gelang es ihm durch Rückgriff auf die großen „bürgerlichen Realisten“ Balzac, Fontane und Thomas Mann indirekt Kriterien für die Qualität von Literatur auch für die sozialistischen Zeitgenossen festzuschreiben. Daß er zugleich mit den so gewonnenen Qualitätsnormen der großen Autoren des 19ten und 20ten Jahrhunderts auch moralische und humanistische Anforderungen transportierte, war vor allem seinen parteipolitischen Gegnern bewußt. Immer am Rande der Dissidenz - von ihm stammt wohl auch die ironische Bemerkung „Intelligenz ist schon eine Abweichung“ schützte ihn sein internationales Ansehen vor dem Äußersten, so daß er - als Kulturminister der Regierung Nagy 1956 verhaftet und nach Rumänien exiliert wurde. 1971, in seinem Todesjahr, schrieb er in einem Brief an das Literary Supplement der Times , von dem er „nach den Büchern der Zukunft“ gefragt worden war - über Ágnes Heller: „Die Budapester Schule“ steht für eine in verschiedene Richtungen sich verzweigende, aber zusammenhängende und kohärente Gedankenwelt. Ihre produktivste Persönlichkeit ist Ágnes Heller, aus deren Arbeit drei Bücher die Tendenz des Marxismus der Budapester Schule vorbildlich repräsentieren. Die „Ethik des Aristoteles“ und der „Renaissance Mensch“ sind historische Monographien. Die erste charakterisiert das Ganze der platonischen und aristotelischen Philosophie in vielseitiger Weise, die zweite gibt ein prägnantes und dynamisches Bild von einer Epoche des Denkens, die bisher vom Marxismus nur flüchtig und beiläufig beachtet worden war. Diese zwei Bücher bedeuten aber mehr als bloße historische Analyse: sie stellten Epochen dar - das Ende der Antike und die Renaissance Stadt-Gemeinschaft -, in denen die Entfremdung am wenigsten entfaltet, die Distanz zwischen den Wesenskräften der menschlichen Gattung und ihrem individuellen Reichtum die kleinste war. Gerade diese Problematik führte Ágnes Heller zu ihrem bislang reifsten Werk, zur Monographie „Das Alltagsleben“, worin die Untersuchung der dynamischen Totalität der alltäglichen Tätigkeitstypen und Denkweisen das Hauptthema bildet. Das letztgenannte Buch ist zugleich eines der wichtigsten Werke der sich im letzten Jahrzehnt erneuernden marxistischen Ontologie. Ágnes Heller war vermutlich schon damals mit diesem letzten Satz nicht ganz einverstanden, aber Lucàcs hebt doch zu Recht hervor, daß zwischen ihrem Ausgang vom Denken des frühen Marx und den späteren Arbeiten von Ágnes Heller ein direkter Zusammenhang besteht. In ihren Büchern „Theorie der Bedürfnisse bei Marx“, „Das Leben ändern -radikale Bedürfnisse, Frauen, Utopie“, „Theorie der Gefühle“, „Alltag und Geschichte“ bis hin zu ihrem jüngsten Buch „Ist die Moderne lebensfähig?“ - geht es ihr immer um das konkrete Leben von Menschen unter je spezifischen sozialen, politischen institutionellen und emotionalen Verhältnissen. Dabei spielt ihre Auseinandersetzung mit dem „real existierenden Sozialismus“ ein wachsende Rolle. Dieser angebliche Sozialismus vermochte keine der Erwartungen zu erfüllen, die Marx noch ganz deutlich in den „Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie“ eindrucksvoll artikuliert hatte. In der Formel „Diktatur über die Bedürfnisse“ faßt Ágnes Heller die - alle menschlichen Möglichkeiten unterdrückende - Auswirkung der kommunistischen Einparteienherrschaft prägnant zusammen.
Als Georg Lucàcs nach der abermaligen Verhinderung einer durchgreifenden Reform des Staatssozialismus in der Tschechoslowakei resigniert meinte, die Oktoberrevolution des Jahres 1917 sei doch nicht die große welthistorische Wende zur Emanzipation gewesen, an die er sein Leben lang geglaubt hat, tröstete ihn die Hoffnung auf die jungen Rebellen in der westlichen Welt, über die ihm Ágnes Heller berichtet hatte. Als sie dann selbst für längere Zeit in den Westen kam, mußte sie auch diese Hoffnung wieder begraben. Diese phantasievollen Rebellen hatten keinen genügend langen Atem und übersahen die Lehren, die aus den Erfahrungen der Menschen unter kommunistischem Regime gezogen werden müssen. Aus diesem Grunde verkannten sie den Wert der institutionellen Errungenschaften der liberalen Demokratie - Menschenrechtsartikel der Verfassungen, Gewaltenteilung, politische Rechte einschließlich der Informationsfreiheit, der Koalitionsfreiheit usw. Über einem idealisierten Marx hatten sie Kant und die kritische Tradition der bürgerlichen Aufklärung vergessen.
In ihrem leider etwas zu rasch übersetzten jüngsten Buch „Ist die Moderne lebensfähig“ setzt sich Ágnes Heller unter anderem mit dem Schlagwort „Tod des Subjekts“ auseinander und kritisiert den intellektuellen und moralischen Monopolanspruch sowohl der Transzendentalpragmatik von Karl Otto Apel als auch die Gleichgültigkeit gegenüber jeder sozialphilosophischen und ethischen Fundierung der Demokratie bei Richard Rorty. Beide - so ihre einsichtige These - verabsolutieren Teilwahrheiten. Apel hat sicher recht, wenn er die Transzendentalpragmatik als eine logisch stimmige Legitimierung universaler ethischer Werte bezeichnet, aber er übersieht, daß es andere Begründungen für sittliches Verhalten - auf Grund spontaner Intuition des Gewissens - gibt, die deshalb nicht wertlos sind. Die Grenze, an die Apel stößt, wird durch die Frage nach der Handlungsmotivation sichtbar, auf die jene im Gewissen sich meldende Intuition weit eher eine Antwort zu geben vermag. Aber auch Rorty hat, wenn man seine These nicht mit einem Monopolanspruch verabsolutiert, einen Punkt: die Existenz von individuelle Freiheit für alle koexistierenden Personen gewährleistenden Institutionen, ist in der Tat in ruhigen Zeiten ausreichend. In Krisenzeiten bedarf es aber sehr wohl der legitimierenden Begründung, wie sie z.B. die Transzendentalpragmatik (oder auch Kants praktische Philosophie) zu geben vermag. In den Worten von Ágnes Heller: „Womöglich bieten die Institutionen der liberalen Demokratie die besten Rahmenbedingungen für politische Entscheidungen und Praktiken, für Lebensformen allerdings nicht. Und damit bin ich bei Rortys Problem. Es ist zwar gut, daß sich der Staat wenig um unsere private Moral, ja nicht einmal um unsere öffentlichen Tugenden kümmert. Im Fall der restlosen Auflösung der moralischen Bindungen eines Volkes jedoch wären solche liberalal-demokratischen Institutionen nicht endlos reproduzierbar. Mögen auch Kulturkritiker das Nachlassen der Moral übertrieben haben, so ist dennoch zivilisierte Barbarei nichts, was man angesichts der Möglichkeiten der zeitgenössischen Geschichte leichthin abtun dürfte“. Ich würde an dieser Stelle noch einen Schritt weitergehen und behaupten, daß die bloße Existenz liberal- demokratischer Institutionen nie genügt, wenn nicht wenigstens ein erheblicher Teil der Bevölkerung sich als Citoyen verhält und die von ihnen mehrheitlich gemeinsam beschlossenen Gesetze respektiert. Was Richard Rorty für selbstverständlich hält, weil er auf die Erfahrung einer traditionellen liberalen Demokratie zurückblickt, gilt gewiß nicht für Staaten, die - wie die aus der zerfallenen Sowjetunion hervorgegangenen - eben erst nach Jahrzehnten totaler bürokratischer Betreuung und Bevormundung freiheitliche Institutionen erhalten oder sich gegeben haben.
Im gleichen Buch, das die Frage nach der „Lebensfähigkeit der Moderne“ stellt, unternimmt Ágnes Heller auch einen interessanten Versuch zur angemessenen Beurteilung der Philosophien von Martin Heidegger und Georg Lucàcs im Unterschied zur moralischen Beurteilung dieser Personen. Ihre paradox klingende Formel hierfür lautet, daß Philosophien als spekulative Ganzheiten „unschuldig“ sind oder - wie sie in einer etwas esoterisch klingenden Philosophensprache sagt -„adiaphorisch“, während sie zugleich gefährlich sind, wenn sie partiell (stückweise) rezipiert werden. Adiaphora sind „gleichgültige Dinge“, die - nach Auffassung der Kyniker und Stoiker Verhaltensweisen bezeichnen, die zwischen Gut und Böse liegen. Jede einigermaßen relevante Philosophie ist damit zugleich adiaphorisch und gefährlich. Die Person der Philosophen kann aber nur für die voraussehbaren Folgen einer partiellen Rezeption ihrer Gedanken verantwortlich gemacht werden. Sie sind allerdings auch verpflichtet, Einspruch zu erheben, wenn solche Folgen eingetreten sind. Ich vermute, daß Ágnes Heller annimmt, daß Georg Lucàcs durch seine - freilich sehr späte - offene Kritik am diktatorischen System des "real existierenden Sozialismus" bis zum gewissen Grade als Person exkulpiert werden kann, während sich Heidegger als Person einer analogen Aufgabe in Bezug auf den Nationalsozialismus hartnäckig entzogen hat. Es ist schade, daß wir Hannah Arendt, der gerade in letzter Zeit wieder posthum ihr Verhältnis zu Heidegger vorgehalten wurde, nicht zu dieser Problematik befragen können. Vermutlich würde ihr die Unterscheidung zwischen der „adiaphorischen“ Philosophie und der Schuldfähigkeit der philosophierenden Person gefallen haben.
Mit einem Kapitel über „Freiheit und Glückseligkeit in der politischen Philosophie Kants“ kehrt Ágnes Heller noch einmal zu dem Thema der Bedürfnisse zurück, mit dem sie sich als eine der wenigen Zeitgenossen intensiv beschäftigt hat. Sie unterstreicht zunächst die Gründe für Kants Ablehnung einer Orientierung der Politik auf die Bewirkung von Glückseligkeit. Sodann kritisiert sie aber Kants allzuengen Begriff des Bedürfnisses, der für ihn durch die drei „Süchte“ Herrschsucht, Ehrsucht und Habsucht erschöpft sei. Ohne daß es Kant selbst erkannt hätte, kennt er aber auch ein weiteres Bedürfnis - nämlich nach Geselligkeit und faktisch gibt es bei ihm offensichtlich auch ein menschliches Freiheitsbedürfnis. In dieser Hinsicht darf man daher Kants apodiktische Formulierung - auf Grund seiner eigenen Arbeiten - korrigieren. Wenn auch Kant die „Diskussion“ von Bedürfnisansprüchen nicht aus der Öffentlichkeit ausschließen wollte, so verneinte er doch die Möglichkeit, daß die Teilnahme an einer beständigen politischen Diskussion durch etwas anderes motiviert sein könnte als durch Pflicht. „Pflicht aber ist mit Sicherheit“ - konstatiert Ágnes Heller - „kein Bedürfnis.“ Darin erblickt sie einen gravierenden Mangel Kants, den Hannah Arendt aber nicht geteilt habe, da sie dessen dualistisches Menschenbild nicht übernommen habe.
Ich bin bewußt zum Schluß meiner Laudatio noch einmal auf die zentrale Bedeutung des Begriffs der Bedürfnisse im Werk von Ágnes Heller zu sprechen gekommen. Ihr eigentümlicher Humanismus ist um diesen Begriff zentriert. Sie hat sowohl die Verkürzung des Bedürfniskatalogs auf materielle Versorgung und bevormundende Betreuung durch die autoritären Institutionen des „real existierenden Sozialismus“ kritisiert, als auch deren beschränkte Berücksichtigung in der im übrigen wegweisenden Demokratiekonzeption Kants. Ihr Denken war von Anfang an einem konkreten Bild des Menschen mit seinen vielfältigen legitimen Bedürfnissen und meist unentfalteten Möglichkeiten orientiert. Das Konzept konkreter Freiheit fiel für sie mit der freien Entfaltung aller in einem Individuum angelegten Potenzen und Bedürfnissen unentfremdeter Menschen zusammen. Die Kategorien, mit denen der frühe Marx die zeitgenössische Gesellschaft und die Behinderung und Deformation der in ihr lebenden Menschen kritisiert hat, bleiben für Ágnes Heller der Ausgangspunkt der Auseinandersetzung auch mit Gesellschaften, die sich - zu Unrecht - auf das „humanistische Erbe“ der bürgerlichen Revolution und Karl Marx berufen haben. Sie gibt aber auch der postmodernen Resignation und posthistorischen Beliebigkeit nicht nach, sondern hält an der verpflichtenden Norm einer freien und gerechten Ordnung menschlichen Zusammenlebens fest. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lautete der Titel eines damals vielbeachteten Vortrages in Tübingen: „Haben wir das Recht zu verzweifeln?“ Ágnes Heller und ihre Philosophie, die übrigens für mich keineswegs adiaphorisch ist, macht uns mit ihrem jüngsten Buch jedenfalls Hoffnung, daß die Moderne lern- und lebensfähig ist und auch dafür gebührt ihr der Hannah-Arendt-Preis, zu dem ich ihr von Herzen gratuliere.
Befreiung hoffen, Befreiung wollen, Befreiung leben
Als Fremdling unter Hannah-Arendt- und Àgnes-Heller-Fachleuten komme ich zu der Ehre, heute zu Ihnen zu sprechen. Nicht als "Kundiger" kann ich reden - lediglich als Liebhaber jener Befreiung, die ich als Thema gewählt habe und mithin als Bewunderer und Liebhaber von solchen Befreiten, denen Erkenntnis nicht zu Ruhe und Beruhigung, sondern zur Unruhe verholfen hat.
Zu Beginn möchte ich bei aktuellem Lebensgefühl, aktuellen Debatten einkehren, die mich unversehens in die Nähe Hannah Arendts gebracht haben. Ich meine die Hannah Arendt, die 1950, zurückgekommen nach Deutschland, merkwürdiger Phänomene gewahr wurde: Sie war unter eine Generation Unbeteiligter geraten.
Im Land der Täter wurde der Opfer mit einem erschreckenden Manko an Mitgefühl gedacht - wenn man sich überhaupt an sie erinnerte.
Im Land der Täter spielte die Frage nach Verantwortlichkeit und nach Schuld kaum eine Rolle Im Land der Täter kannten hingegen viele die philosophisch-theologische Grundaussage: "Alle Menschen sind Sünder".
Die offensichtliche Richtigkeit dieser Sentenz vermochte Hannah Arendt jedoch keineswegs zu erfreuen: In jenem historischen Kontext war der Weg kurz von der "Richtigkeit" über die Banalität zur Lüge. Diejenigen, die damals "Wahrheiten", die nichts kosteten, liebten, waren für Hannah Arendt doppelt gestraft: Einmal mit offensichtlicher Gefühlsarmut, Gefühlskälte, vielleicht sogar Gefühlslosigkeit (wenn man nicht das Selbstmitleid für Mitgefühl erklären wollte), zum anderen mit dem Verlust von Wirklichkeit.
Unter den Zeitgenossen hatte sich der schönende Blick auf schlimme Zeiten verwandelt in eine schönende Erinnerung der schlimmen Zeiten. Die Gegenwart hingegen wurde scheeläugig, also mit bösem Blick angeschaut. Allüberall das Elend, unsere Städte kaputt (die Alliierten: auch Kriegsverbrecher, überhaupt: prinzipiell hätte jeder Staat den Krieg angefangen haben können ...), die Demokratie auch nicht besser als früher, wo man wenigstens abends ungestört von Kriminellen nach Hause gehen konnte, als jedermann Arbeit hatte, die Autobahnen von deutschem Fleiß kündeten und die Volksgenossen mit dem KDF-Schiffen nach Norwegen fuhren.
Als ich derlei Dinge las, hatte ich ein Deja-vu-Erlebnis: Als Mecklenburger, jetzt Berlin-Mitte (40 % PDS-Wähler), bin ich häufiger Teilhaber an postkommunistischem Erinnerungsgut, das dem postfaschistischen verblüffend ähnlich ist.
Zugegeben: Das mit den Autobahnen hört man jetzt nicht. Aber ersetzen Sie bitte dieses Wort durch "Kindergärten" und komplettieren Sie mit "Vollbeschäftigung" und "keine Kriminalität", begegnet Ihnen das nämliche Lebensgefühl. Was ist es? Ignoranz, Larmoyanz, Niedertracht, Nostalgie? Mag sein. Aber Hannah Arendt weist auf schlimmeres hin: Totalitäre Herrschaft hat zur Folge, daß die Beherrschten Schritt für Schritt "Wirklichkeit" verlieren. Nicht nur, weil sie zu oft Lügen ausgesetzt waren, sondern weil die Fakten, die Realität selbst ihrer Rolle als Erkenntnisgrundlage beraubt werden. "Alle Fakten können verändert und alle Lügen wahrgemacht werden". Folge ist eine "Unfähigkeit" und ein "Widerwille" "überhaupt, zwischen Tatsache und Meinung zu unterscheiden". "Die intellektuelle Atmosphäre ist von vagen Gemeinplätzen durchdrungen ... man fühlt sich erdrückt von einer um sich greifenden öffentlichen Dummheit, der man kein korrektes Urteil in elementaren Dingen zutrauen kann". So Hannah Arendt 1950.
Für mich ist evident: In meinen heimatlichen Niederungen ist 1995 1950. Es gibt peinliche und peinigende Parallelen, betrachtet man die Lebensgefühle und die Neigung, aus schlechten Zeiten Gutes zu erinnern.
In einer Umfrage des Instituts Allensbach aus dem Jahr 1948 antworten 57% der erwachsenen Westdeutschen auf die Frage "Glauben Sie, daß der Nationalsozialismus eine gute Sache war, die schlecht gemacht wurde?" mit ja.
Es wird Sie nach dem Gesagten nicht verwundern, daß meine ostdeutschen Landsleute in den Jahren 1990 und folgende dem Institut Allensbach auf diese Frage bezogen auf "Sozialismus", resp. "Kommunismus" mit einer signifikant ähnlichen Mehrheit reagieren. Es fällt auf, daß braune und rote nicht legitimierte Herrscher einander oft ähnlich sind. Aber noch erschreckender ist die Ähnlichkeit der Unterdrückten. Es gibt offensichtlich eine mentale und emotionale Verwandtschaft der Unterdrückten aller Diktaturen. Und wie tief der Gestus des Untertanen in uns steckt, wenn wir nicht nur 12, sondern 12 plus 44 Jahre gelernt haben, das Haupt zu beugen, haben wir exakt noch gar nicht festgestellt. Befreiung zu wollen, ist nicht nur ein kurzer revolutionärer Akt auf den neu eroberten oder zu erobernden Straßen.
Wenn diese - gelobt die Zeit, da sie stattfand - nicht gefolgt wird von einer nachfolgenden Befreiung von Geist, Gefühl und Haltung bleibt Freiheit wie eine Proklamation, der keine neue Wirklichkeit folgt.
Mit Erschrecken nehmen wir wahr: Neben der Schwierigkeit, Wirklichkeit neu zu entdecken, Fakten und Realität als solche gegen die "Meinungen" auszutauschen, neben der Mühe, die es kostet der selektiven Wahrnehmung, dieser Feindin der Wahrheit den Abschied zu geben, haben wir es bei der Gewinnung von Freiheit und Selbstbestimmung mit dem Phänomen des verzögerten Mentalitätenwechsels zu tun.
Wie schnell begreift unser Intellekt neues (technisches o. a.) Wissen. Wie langsam verändert sich die habituelle Prägung. Als Kind der Aufklärung fällt es einem nicht leicht festzustellen, daß offenbar tief in uns ein jahrhundertealtes Programm, das Unterwerfung als etwas quasi Natürliches annimmt, wirksam ist.
Wohnte nicht zugleich in uns eine ursprüngliche, tiefe, geheimnisvolle, oft verbogene, dann machtvolle Sehnsucht nach Freiheit - der Untertan hätte ein ewiges Reich in der Seele der Menschen und die Diktatur wäre das allzeit gültige Gesellschaftsmodell.
Da dies aber so nicht ist, hat der Habitus des Untertanen nur ein auf Gewohnheit begründetes zeitweiliges Wohnrecht in uns. Wie dessen Lebensform "Feigheit", so sollte uns seine Existenz als Zutat gelten, nicht aber als Essenz des humanum.
Als wir es 1989 im Osten unterließen, die intellektuellen Beheimatungsversuche im Reich der Unfreiheit fortzusetzen, als wir bei der ursprünglichen Sehnsucht nach Freiheit ankamen, als daraus die konkrete Hoffnung auf Befreiung erwuchs, da hatten wir eine schwere Aufgabe: wir mußten verlernen, was wir so lange gelernt hatten: Beuge Dein Haupt, und es wird dir gut gehen.
Wir hatten dabei unterschiedliche Lehrer: Àgnes Heller gehörte gewiß zu ihnen, aber bevor ich sie zum Schluß zitiere, will ich auf ein Wort kommen, das für die Revolutionäre in meiner Heimatstadt Rostock von Bedeutung war. Wir wollten die Macht der Mächtigen brechen. Was uns 1953, den Ungarn 1956 nicht gelungen war, was die Polen fast ein Jahrzehnt zuvor begonnen hatten, das sollte nun bei uns endlich geschehen.
Damals haben wir ein Wort von Vaclav Havel zitiert: "Die Macht der Mächtigen kommt von der Ohnmacht der Ohnmächtigen". Neues zu leben wollen heißt, Altes verlernen zu müssen. Sie, liebe Àgnes Heller, haben darauf hingewiesen, daß Hannah Arendt gesagt hat, "daß die schönsten Augenblicke des Lebens die Augenblicke der Befreiung sind". Daß die Schönheit und Kraft solcher Augenblicke nicht ausreicht, um Freiheit auf Dauer zu sichern, daß die Anstrengungen des Erkennens, Gestaltens folgen müssen, das ist etwas, was wir von Ihnen lernen können.
Wer Befreiung leben will, darf weder die Mühen der politischen Ebenen scheuen, noch der Vergangenheit ihren Rang absprechen.
Sie, Àgnes Heller, haben kürzlich in einem Text über das 20. Jahrhundert die "Erinnerung als Andacht" gefordert, "Andenken an alles, was hier in Europa passierte". Solche Erinnerung "verpflichtet". "Man muß über die Schuld der attraktiven Hoffnungen und erhabenen Gedanken nachdenken, man muß wagen, das Dämonische zu denken." Nur beim ersten Hören hat man die Empfindung: merkwürdige Worte für eine Aufklärerin.
Natürlich haben Sie das nicht gesagt, um modisch auf der Linie eines Kunstverstandes zu sein, indem das Dämonische beliebter ist als das Aufklärerische. Sondern Sie haben es aus einem tiefen Wissen um etwas böse Geheimnisvolles formuliert. Eine böse Konstellation müssen wir begraben können, so Ihre Worte, wie die Opfer von bösen Zeiten. Aber mit dem Begraben von bösen Konstellationen passiert etwas anderes, als wenn man nur Menschen begräbt, die dann dahin sind, ein für allemal. Die Konstellationen können ja wieder erstehen, darum, so meinten Sie, sei es wichtig, das Böse ernst zu nehmen und der These von der Banalität des Bösen zutiefst zu widersprechen. Und Außerdem sei es wichtig, 'das Böse freiwillig zu fürchten, so daß man es nicht mehr unfreiwillig fürchten muß'.
Ich hätte es eigentlich lieber, solche Wahrheiten nicht lernen zu müssen, aber wenn man angefangen hat, den Weg der Aufklärung zu gehen, dann wird man ihn zu Ende gehen müssen. Dabei lasse ich mich von Ihnen auf diesem Weg gern an die Hand nehmen.
Begraben können und wollen, was einen am Leben hindert, das heißt also, daß wir erinnern müssen, was zu begraben ist., und dieses können wir nur, wenn wir den schönendem Blick für die Gegenwart entsagen, den sich so viele Zeitgenossen geleistet haben, auch bei unserem Erinnern. Das Erinnern mutet uns zu, dem rückschauend nochmals zu begegnen, was uns im aktuellen Leben oft mißlungen ist. Wir sind vielfältig und meisterhaft in der selektiven Wahrnehmung und im schönenden Blick gewesen. Wir können zur Rechtfertigung dessen allerhand edle Motive vortragen. Und doch waren wir stumme oder gelegentlich gar böse Zeugen böser Tage und Taten oder um mit Raoul Hilberg zu sprechen: Zuschauer schlimmer Taten, ohne daß wir uns herausgefordert gefühlt hätten, einzugreifen. Darum also erinnern, nicht nur um wahrzunehmen, was gewesen ist, ohne Selektion und Ersetzung der Realität durch Meinungen, sondern auch, um wenigstens das, was damals nur begrenzt erkannt worden ist, im Kern zu erfassen. Und dann - jetzt haben Sie mir etwas geschenkt, was ich diesem Auditorium auch weitergeben möchte - dann, bei diesem Begraben passiert etwas Merkwürdiges. Die Trauer des Begräbnisses paart sich in diesen Fällen mit dem Erlebnis von Befreiung. Über diese Befreiung habe ich eingangs bereits gesprochen, auch darüber, daß wir die Befreiung fortsetzen müssen, wenn wir denn Liebhaber der Freiheit bleiben wollen. Es fällt mir zur Zeit nicht so besonders leicht, in einem so schönen Land wie Deutschland zu leben. Als ich in Ostdeutschland anfing, politisch für die Einheit Deutschlands zu streiten, tat ich das mit dem sicheren Gefühl, wenn wir erst die Einheit hätten, würde ich es mit einer Vielzahl von zivilcouragierten Menschen zu tun bekommen, da die Deutschen im Westen ja 40 Jahre der Beugung durch Diktatoren nicht ausgesetzt waren.
Nach meiner Ankunft im vereinten Deutschland fällt mir bei der Begegnung mit den hiesigen Landsleuten nicht gerade ein Übermaß an Mut und Zivilcourage auf. Vielleicht ist es so, daß ein Land, das keine Sehnsucht nach Freiheit mehr kennt und darum eine Hoffnung auf fortwährende Freiheit nicht für nötig erachtet, in der tiefen Gefahr steht, die Freiheit mit etwas ganz Nebensächlichem zu verwechseln. Es klang heute schon an, etwa mit Libertinage (obwohl ich auch dafür gelegentlich etwas übrig habe). Aber es zu verwechseln, das nicht zu kennen, was in uns als Keim jeder Besserung angelegt ist, nämlich Befreiung zu glauben oder festzustellen, daß die Sehnsucht nach Freiheit uns abhanden gekommen ist, daran möchte ich nicht teilhaben. Und darum gehört zu dem Begraben der 'schuldigen Konstellationen' was nötig ist, eben um der Gerechtigkeit willen, die Hoffnung jener, die sich nicht stören lassen, wenn ihre Sehnsucht nach Freiheit eine ganze Zeit mißverstanden wird, nicht gesehen, nicht gewünscht, abgeschafft, unterdrückt, verleugnet, aus der Welt verbannt wird. Befreiung zu hoffen und Befreiung zu wollen heißt auch, daß wir Befreiung leben können. Auch wenn unser Jahrhundert das Jahrhundert der allergrößten Unfreiheit geworden ist. Daran nicht zu krepieren, das lehren Sie uns in der Schule von Hannah Arendt. Mögen und solche Schulen erhalten bleiben, meine Damen und Herren.
GRUSSWORTE
Liebe Ágnes Heller, liebe Gäste, verehrte Anwesende,
,,Die einzige Rettung" liegt ,,in der Schule des öffentlichen Lebens... in der unumschränktesten, breitesten Demokratie und öffentlichen Meinungsäußerung." So zitiert Hannah Arendt die von ihr geliebte und geschätzte Rosa Luxemburg, die in ihren Bemerkungen über die ,,Russische Revolution" die Bolschewiken scharf kritisierte, weil sie, wie sie schreibt, ,,eine deformierte Revolution weit mehr als eine erfolgreiche" fürchtete. ,,Die einzige Rettung liegt in der Schule des öffentlichen Lebens" - dieser Gedanke durchzieht Hannah Arendts gesamtes politisches Denken.
,,Nichts als dieses unaufhörliche Gespräch unter den Menschen rettet die menschlichen Angelegenheiten" schreibt sie in ihrem Buch ,,Über die Revolution". ,,Auf keinen Fall", heißt es kurz vorher, ,,ist auf ein wie immer geartetes Wirtschaftssystem in Sachen der Freiheit Verlaß. Es ist durchaus denkbar, daß das ständige Ansteigen der Produktivkräfte sich eines Tages aus einem Segen in einen Fluch verwandelt, und niemals können die wirtschaftlichen Faktoren automatisch in die Freiheit führen oder als Beweis für die freiheitliche Natur einer Regierung ins Feld geführt werden."
Was Freiheit auszeichnet, ist für Hannah Arendt die Möglichkeit, daß die Menschen einer Gesellschaft zu Bürgerinnen und Bürgern werden, daß sie sich an der Gestaltung der Welt beteiligen können, daß sie handelnd und sprechend in ihr tätig sein können. Das schlimmste, was einer Gesellschaft passieren kann, ist für Hannah Arendt das Verschwinden der Politik. Sie hat erfahren, daß mehr und mehr Menschen in den Ländern der westlichen Welt ,,Freiheit von Politik" als eine der Grundfreiheiten begreifen, von dieser Freiheit Gebrauch machen und sich von der Welt und den Verpflichtungen in ihr zurückziehen. So heißt es in ihren ,,Gedanken zu Lessing".
Und sie fährt fort: ,,Dieser Rückzug aus der Welt braucht den Menschen nicht zu schaden,... nur tritt mit einem jeden solchen Rückzug ein beinahe nachweisbarer Weltverlust ein; was verloren geht, ist der spezifische und meist unersetzliche Zwischenraum, der sich gerade zwischen diese Menschen und seinen Mitmenschen gebildet hätte." In ihrem Buch ,,Vita activa oder vom tätigen Leben" schreibt Hannah Arendt: ,,Es ist durchaus denkbar, daß die Neuzeit, die mit einer so unerhörten und unerhört vielversprechenden Aktivierung aller menschlichen Vermögen und Tätigkeiten begonnen hat, schließlich in der tödlichsten, sterilsten Passivität enden wird, die die Geschichte je gekannt hat."
Sie weiß, daß Menschen, wenn sie sich immer mehr zu Untertanen degradiert sehen, wenn sie immer weniger auf die Sicherheit ihrer Rechte bauen können, wenn sie spüren, daß Regierung und Opposition einander immer ähnlicher werden und ihre Macht zu wählen und zu kontrollieren dadurch schwächer wird, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Politik als etwas erleben, das ihnen äußerlich ist, das sie im Grunde nichts angeht und auf das sie keinen Einfluß haben, daß sich dann diese Menschen von der Politik und auch von der Demokratie abwenden. Dann können sie irgendwann in populistischen oder antiliberalen Strömungen ihrem Ärger Luft machen, dann können sie sich nach dem Gift des Gehorsams sehnen, das von allen autoritären Regimen erfolgreich verabreicht werden kann, dann wird aus Politikverdrossenheit im Nu Demokratieverdrossenheit mit der Sehnsucht nach Führerfiguren, die persönliche Rachegefühle befriedigen, die die Eigenverantwortung abnehmen und vermeintliche Klarheit schaffen in der allgemeinen Unübersichtlichkeit. Die Vernichtung des Politischen kann eine Politik der Vernichtung bewirken. Wir können von Hannah Arendt lernen, der Vergiftung und Betäubung unserer Gesellschaft zu widerstehen, indem wir Bürgermut fördern statt Konformismus indem wir uns Dissidenten wünschen statt Mitläufer.
Die politischen und gesellschaftlichen Probleme scheinen heute stärker zu wachsen als die Mittel und Möglichkeiten, sie zu lösen. Daher wächst die Angst vieler Menschen vor der Zukunft. Sie spüren den Abstand zwischen dem, was getan werden müßte, und dem, was geschieht.
In den sechziger Jahren konnten wir Überfluß und Fortschritt verwalten. Das war verantwortbar, weil der Weg in eines bessere Zukunft zu führen schien. Heute sind wir oft gezwungen, Mängel und Risiken zu verwalten, von denen wir nicht wissen, wohin sie führen können. Die parlamentarische Demokratie lebt vom Streit, vom Ringen um den besseren Weg, von Differenz und Polarisierung. Sie lebt aber auch von Wahlkampf zu Wahlkampf. Dies bringt immer die Gefahr mit sich, daß Parteien und Regierungen notwendige Vorhaben nur deshalb nicht öffentlich einfordern, weil sie schwer zustimmungsfähig erscheinen. Und die Versuchung ist groß, dann Probleme zu verzögern, sie vor sich herzuschieben, sie kleinzureden. Mit der Folge: Die Schwierigkeiten wachsen weiter, Lösungen werden erschwert und der Mut schwindet, entschlossen zu handeln. Die Politik muß den Mut zur Wahrheit finden, sie muß Wege weisen, die eine Richtung erkennen lassen. Sie muß an die Stelle kurzatmiger und egoistischer Teillösungen umfassende Strategien setzen, die das Ganze berücksichtigen. Erst wenn es uns gelingt, unser gegenwärtiges politisches Handeln so auszurichten, als müßten wir heute schon die Konsequenzen unseres Tuns tragen, handeln wir glaubwürdig und verantwortungsvoll. Doch eine Politik in diesem Sinne kann in einer Demokratie nur dann lebendig werden und Kraft gewinnen, wenn sie von unten getragen wird. Bei der Dramatik der gesellschaftlichen Veränderungen und den Risiken, die daraus erwachsen, braucht die demokratische Gesellschaft die Talente und Fähigkeiten von allen ihren Mitgliedern.
Für Hannah Arendt sind Menschen handelnde Wesen in der Welt. Was ihr menschliches Wesen ausmacht, ist ihre Fähigkeit zu handeln, etwas Neues zu beginnen, sich an der Gestaltung der Welt zu beteiligen. Sie schließt ihr Hauptwerk ,,Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft" mit einem Wort des Kirchenvaters Augustin: ,,lnitium ut esset, creatus est homo - damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen." Und sie fährt fort: ,,Dieser Anfang ist immer und überall da und bereit. Seine Kontinuität kann nicht unterbrochen werden, denn sie ist garantiert durch die Geburt jedes Menschen." Immer wieder hat Hannah Arendt Pindar zitiert: ,,Werde, was Du bist."
Je mehr Menschen ihr Menschsein verwirklichen, werden, was sie sind, je mehr sie ihrer Verantwortung zum Handeln, zum Tätigsein in der Welt gerecht werden, desto eher wird es gelingen, um sie noch einmal zu zitieren, ,,aus der Finsternis der Kreatur in die Helle des Menschlichen zu gelangen".
Sehr verehrte Frau Professor Heller!
Sie kennen Hannah Arendts Buch ,,Menschen in finsteren Zeiten". In ihrem Vorwort schreibt sie: ,,Die Überzeugung, daß wir selbst dann, wenn die Zeiten am dunkelsten sind, das Recht haben, auf etwas Erhellung zu hoffen, und daß solche Erhellung weniger von Theorien und Begriffen als von jenem unsicheren, flackernden und oft schwachen Licht ausgehen könnte, welches einige Männer und Frauen unter beinahe allen Umständen in ihrem Leben und ihren Werken anzünden und über der ihnen auf der Erde gegebenen Lebenszeit leuchten lassen - diese Überzeugung bildet den unausgesprochenen Hintergrund für die hier vorgelegten Persönlichkeitsprofile."
Sie, liebe Ágnes Heller, sind mit uns der Überzeugung, daß Hannah Arendt zu diesen Frauen und Männern gehört die ein wenig Licht in dieses dunkle Jahrhundert gebracht haben. Nicht nur wir hier in Bremen sind überzeugt, daß auch Sie in diese Reihe von Menschen gehören. Und deshalb ist es für uns eine ganz besondere Freude daß Sie die erste Preisträgerin des ,,Hannah Arendt-Preises für politisches Denken" sind.
DANKESWORTE
Liebe Damen und Herren, liebe Freunde,
Ich gehöre zu denen, die fast ihr ganzes Leben in einer Welt verbrachten und tätig waren, wo man ehrliches Denken und aufrichtige politische Reflexion eher bestrafte als auszeichnete. Meine Generation aus Ostmitteleuropa ist nicht daran gewöhnt, Preise anzunehmen.
Vielleicht ist es ein, mit unseren Erfahrungen zu erklärender Abwehrmechanismus, daß wir grundsätzlich gleichgültig gegen alle institutionellen Anerkennung geworden sind, vielleicht mehr als es jetzt sich ziemte. Preise mit Decorum anzunehmen muß man ebenso lernen, wie sie, wenn es nötig ist, mit Decorum abzulehnen.
Diesmal brauche ich jedoch meine alte Hemmung nicht zu kontrollieren, den Preis, die Sie mir verleihen, mit Freude und Dankbarkeit anzunehmen. Ich freue mich über diesen Preis eben weil es dieser Preis ist.
Ich freue mich, weil mir diesen Preis Leute erteilten die ich als "Freunde im Denken" bezeichnen könnte. "Freunde im Denken" sind nicht Philosophen die an dieselbe Wahrheit glauben, sie sind auch nicht Kameraden, die zusammen für dieselbe Sache kämpfen. Sie sind eher Männer und Frauen, die ähnlich wie ich über die Welt denken. Sie, meine "Freunde im politischen Denken" verknüpfen Realismus und Radikalismus miteinander. Sie wollen nicht über Rhodus, über unsere Zeit springen, doch sie glauben daran, wie auch ich es glaube, daß es auch heute politische Freiheitsräume für authentisches Handeln und für selbständiges Denken gibt.
Ich freue mich, weil dieser Preis durch die Würdigung des Selbstdenkens in der versunkenen Welt des ehemaligen totalitären Ostmitteleuropas - mit mir und in meiner Person- auch meine Freunde würdigt. Ich meine z.B. Leszek Kolakowski und Adam Michnik, aber diesmal, und hier besonders, die Mitglieder der damaligen Budapester Schule, Ferenc Fehér, György Márkus und Mihály Vajda. In diesem Kreis der Freunde kam ich von meiner selbstverschuldeten Unmündigkeit heraus, um freies Denken in finsteren Zeiten zu lernen. Dort habe ich "Freundschaft im Denken" als das höchste Gut schätzen gelernt.
Ich freue mich, weil dieser Preis den Namen von Hannah Arendt trägt. Denn Hannah Arendt ist auch einer meiner Freunde im Denken. Weil sie der Versuchung widerstanden hat, ein System zu schaffen, weil sie alle "ismen" verabscheute, weil sie die Marginalität akzeptierte, ohne sich damit selbst weh zu tun oder zu verbittern. Weil sie in den Begriffen von Vergänglichkeit und Endlichkeit dachte. Weil sie unserem Zeitalter und unserem Wissen keine privilegierte Position in der sogenannten Geschichte zuordnete; weil sie ihrer Fehlbarkeit bewußt war; weil sie leidenschaftlich war, aber nie zornig. Weil sie sich dafür aussprach sowohl zu handeln wie auch etwas zu schaffen, für die persönliche wie für die politische Freiheit; weil ihre Philosophie freundlich und einladend ist - nie hat sie jemanden aus der Kommunikation ausgeschlossen. Weil sie keine Universalistin im banausenhaften Sinne war - sie trat für vielschichtige Identitäten ein; aber sie war auch nicht die banausenhafte Verteidigerin des Unterschieds - sie behandelte die Männer als geliebte Mitgeschöpfe. Weil sie keine Angst hatte, Fehler zu machen; weil sie - zu Recht oder zu Unrecht - übertrieb; weil sie unsere Zeiten als finster erkannte, aber sich nie im Grand Hotel Abgrund einrichtete. Weil sie sich zwar manchmal von falschen Illusionen hinreißen ließ, aber sich nie hohlen Hoffnungen hingab.
Weil in ihr Denken das Leben die Sache selbst war, die einzige Sache einer philosophischen Reflexion würdig; nicht das Leben der Lebensphilosophie oder von Bergson, nicht das Erlebnis, nicht einmal das Leben von Nietzsche, sondern nur das ganz normale Leben, wie wir es alle führen, das Leben unserer Vorfahren und Zeitgenossen, wo nichts zu Ende geht, wo die Dinge nicht ordentlich zusammenstimmen; nichts als das chaotische, formlose vita activa und vita contemplativa, die unser Leben ausmachen. Wegen ihrer Liebe zur Gebürtlichkeit, der Freude daran, in diese Welt einzutauchen und wieder von vorne anzufangen.
Denn wenn wir uns an Arendt halten, können wir nicht nur dem Lehrer, sondern auch den Mitschülern widersprechen. Was wir hier alle, heute und morgen, tun werden. Vielen Dank, liebe Freunde, für Eure warmen Worte. Es ist Zeit, weil es immer die rechte Zeit ist, für uns alle zu beginnen.
Agnes Heller, ungarische Philosophin; lebt in USA und Ungarn
Sehr geehrte Preisträgerin,
Liebe Ágnes Heller,
Sehr geehrter Herr Senatspräsident und Erster Bürgermeister der Hansestadt Bremen,
Lieber Henning Scherf,
Meine Damen und Herren,
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir sind heute abend hier zusammengekommen, um zum ersten Mal den Hannah-Arendt- Preis für politisches Denken zu vergeben und dieses Ereignis gebührend zu feiern. Lassen Sie mich kurz darauf zurückkommen, wie die Idee zu diesem Preis entstand, der im übrigen nicht identisch ist mit dem gleichnamigen Wiener Preis für politische Institutionen in mitteleuropäischen Staaten.
Im Sommer 1994 fand sich eine Gruppe von interessierten Menschen aus Wissenschaft, Publizistik und Politik zusammen. Sie alle bewegte die Erfahrung, daß das herkömmliche politische Denken den großen Herausforderungen, die durch den Zusammenbruch der Blöcke und die Öffnung Europas seit 1989 entstanden sind, nicht gewachsen ist. 1989 war einer jener „großen Glücksfälle der Geschichte, in denen der Sinn von Politik, und zwar das Heil wie das Unheil des Politischen voll in Erscheinung“ treten, wie es bei Hannah Arendt heißt, aber das politische Denken konnte diesen Glücksfall nur momentweise durchdringen. Seine Protagonisten fielen alsbald wieder in die Sprache des „business as usual“ zurück. Was fehlt, ist die Inanspruchnahme des öffentlichen Raumes für streitbares politisches Denken. Damit ist zunächst der Vorgang des öffentlichen Verstehens gemeint, das heißt die Auslotung des Raumes, in dem Politik geschieht.
Viele Vertreter des gegenwärtigen politischen Denkens im Westen möchten gerne glauben, daß sich politische Veränderungen im Osten und im Süden Europas durch den reinen institutionellen Nachvollzug der westlichen Demokratien quasi konzeptionell „herstellen“ lassen. Die Erfahrungen zeigen, daß dies nicht der Fall ist, da der politische Zusammenhalt eines Gemeinwesens eben in mehr besteht als seinen Institutionen. Das gängige Politikverständnis geht davon aus, daß die Aufgabe der Politik darin besteht, das gesellschaftliche Leben zu organisieren. Gleichzeitig erfahren diejenigen, die für Politik heute verantwortlich sind, neuartige Grenzen ihres bisherigen politischen Denkens und Handelns. Sie sehen sich einer Dynamik ausgesetzt, in der disparate Kulturen und Denkweisen den demokratischen Universalismus in Frage stellen, und in der die sozialen Probleme wie Arbeitslosigkeit und Armut nicht mehr zu lösen sind, sondern nur noch umorganisiert werden können. In dieser Situation heißt politisches Denken, aus den gewohnten Bahnen auszusteigen und das eigene Verstehen einer als disparat erfahrenen Welt zum Gegenstand des Denkens zu machen. Politisches Denken heute heißt, sich auf die Gründe des politischen Zusammenseins in Gesellschaften zu besinnen.
In diesem Kontext war die Entdeckung der politischen Denkerin Hannah Arendt naheliegend, ja überfällig. In der Bundesrepublik ist Hannah Arendt als deutsch-jüdische Denkerin freilich bisher wenig wahrgenommen worden. Erst der Umweg über das Exil in den Vereinigten Staa- ten, die ihr zur Heimat wurden, hat sie den Deutschen nähergebracht. Und auch dann hatten ihre Schriften es schwer, sich gegen die links-rechts Polarisierung der akademischen Öffentlichkeit in der Bundesrepublik durchzusetzen.
Wie keine andere Denkerin hat Hannah Arendt die tiefen Brüche dieses Jahrhunderts sowohl persönlich erfahren als auch denkend erarbeitet. Aus der Offenheit diesen Brüchen gegenüber entstand ihr öffentliches Nachdenken über die Gründe und die Möglichkeiten politischen Zusammenhalts der Bürger, das sich durch alle ihre Werke zieht. Hannah Arendts Denken, das in dieser unserer Zeit der Brüche so überaus aktuell ist, war uns Ermutigung genug, in ihrem Namen einen Preis für politisches Denken zu stiften, der die Aktualität ihres Denkens weitertragen soll.
Wir vergeben diesen Preis heute zum ersten Mal. Die erste Preisträgerin ist die ungarische Philosophin Ágnes Heller, die mit Hannah Arendt auf vielfache Weise verbunden ist, und dies nicht nur über den ehrenwerten Umstand, daß sie gegenwärtig den „Hannah Arendt- Lehrstuhl für politische Philosophie“ an der New School of Social Research in New York innehat, der Universität, an der auch Arendt zeitweise lehrte. Wie Hannah Arendt hat auch Ágnes Heller, die Jüngere, die Brüche und Aufbrüche dieses Jahrhunderts persönlich erfahren und intellektuell verarbeitet. Die beiden großen politischen Herausforderungen dieses Jahrhunderts, Marxis- mus und Nationalsozialismus/Faschismus, begleiten ihr Schaffen und führen auch sie immer wieder zu der Frage nach den Weisen des politischen Zusammenwirkens der Bürger und den Gestaltungsmöglichkeiten der Freiheit. Wie Arendt versucht Ágnes Heller das Unmögliche zu denken, nicht weil es unmöglich ist, sondern weil es ein Noch-nicht-Möglich ist, das in den Raum des Möglichen gehoben werden kann, wie sie es einmal sinngemäß formulierte.
Ágnes Heller hat den Arendtschen Ansatz, Politik neu zu denken jenseits der Organisierung des sozialen Leben, weitergeführt. Es ist uns eine Freude, Ihnen, liebe Ágnes Heller, den diesjährigen Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken zu überreichen.
Liebe Ágnes, lieber Bürgermeister, lieber Henning,liebe Frau Antonia Grunenberg, verehrte Anwesende,
Hannah Arendt war im Universitätsjahr 1968/69 meine höchst eindrucksvolle Kollegin an der Graduate Faculty der New School for Social Research in New York. Sie brachte der ehemaligen „University of Exile“ , die vielen aus Europa vor den Nazis geflohenen Wissenschaftlern als erste Heimstätte gedient hatte, noch einmal ein Stück jüdisch- deutscher Geistigkeit zurück, das dankbar willkommen geheißen wurde. Zu den amüsanten Anekdoten, die sie gelegentlich zu erzählen wußte, gehört auch der Bericht von einer Studentin, die nach einem Vortrag, in dem viel von Rosa Luxemburg die Rede gewesen war, Hannah Arendt versehentlich als „Rosa Luxemburg“ anredete. Sie hat sich über diese Verwechslung offensichtlich gefreut. Heute ist Ágnes Heller die Inhaberin des nach Hannah Arendt benannten Lehrstuhls an der New School. Meine Bekanntschaft und Freundschaft mit ihr reicht viele Jahre zurück - wir haben erst eben festgestellt, daß es fast genau 30 Jahre her sind, seit sie meine Familie in Frankfurt besucht hat und von dem lebendigen Treiben einer „Vier-Kinder- Familie“ amüsiert und beeindruckt war. Wenn ich Ágnes heute preisen soll, dann habe ich nicht nur die berühmte Gelehrte und engagierte Intellektuelle vor Augen, sondern auch die damals erst „eingeweihten“ Kollegen als Lieblingsschülerin von Georg Lukàcs bekannte Philosophin. Am deutlichsten ist mir in Erinnerung mit welchem Mut sie sich dem Protesttelegramm anschloß, das wir Teilnehmer am „Sommerkurs in Korcula“ anläßlich des Einmarsches von Warschauer-Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei 1968 an Breschnew geschickt haben. Wir protestierten bei Herrn (nicht Genossen) Breschnew gegen diese ungeheuerliche Verletzung der Souveränität eines Staates, der unter der Initiative eines freiheitlich denkenden Kommunisten - Alexander Dubzek- eine Reform des „real existierenden Sozialismus“ in Angriff genommen hatte. Einen Augenblick lang tauchte die Frage auf, ob Bürger von Staaten, die unter kommunistischen Regierungen lebten, nicht besser auf eine Unterschrift verzichten sollten, um sich Repressalien zu ersparen. Ágnes Heller aber war ganz entschieden dafür, solidarisch mit den tschechoslowakischen Reformern den Protest zu unterschreiben. Die unvermeidlichen Folgen nahm sie - nach Ungarn zurückgekehrt - gelassen in Kauf. Ihre Zivilcourage habe ich - nicht nur bei dieser Gelegenheit - bewundert. In Budapest erwartete sie der Ausschluß aus der Akademie der Wissenschaften. Zum zweiten Mal war der unvermeidliche Konflikt zwischen ihr und der autoritären Parteiführung offen ausgebrochen. Übersetzungsarbeiten und ein Stipendium, das ihr eine Zeitlang in Berlin zu arbeiten ermöglichte, erlaubten ihr das „geistige Überleben“. Seit 1977 lehrte sie dann im Ausland zunächst in Melbourne in Australien, schließlich an der Graduate Faculty der New School in New York. Erst das Ende des kommunistischen Regimes in Ungarn ermöglichte ihr auch dort wieder akademisch tätig zu sein.
Georg Lucàcs, auf den ich 1970 die Laudatio anläßlich der Verleihung des Goethe-Preises der Stadt Frankfurt halten durfte, war eine Ausnahmeerscheinung unter den kommunistischen Intellektuellen. Als junger Mann hatte er sich für Sören Kierkegaard interessiert und eine existentialistische Phase durchgemacht. Voller Sympathie förderte er die junge avantgardistische ungarische Literatur. All das hat er im Rückblick als „dekadent“ heftig verurteilt. Aus Heidelberg nach Ungarn heimgekehrt schloß er sich den kommunistischen Revolutionären unter Bela Kun an, die in Ungarn nach sowjetischem Vorbild eine sozialistische Gesellschaft errichten wollten. Nach der Niederlage der Revolution schrieb er in Wien eine Reihe von Essays, die unter dem Titel „Geschichte und Klassenbewußtsein“ gesammelt 1923 veröffentlicht wurden und einen nachhaltigen Einfluß vor allem auf „westliche Marxisten“ - nicht zuletzt auch die „Frankfurter“ - ausübten. In diesem Buch entwickelte er eine ungemein anspruchsvolle philosophische Theorie der leninistischen Avantgarde-Partei, die dem Proletariat zum adäquaten Klassenbewußtsein verhelfen und es damit als „Subjekt-Objekt der Geschichte“ handlungsfähig machen soll. Den orthodoxen Marxisten mißfiel diese Arbeit. Einmal, weil sie zu eindeutig vom Ziel der Emanzipation der Klasse sprach, zum anderen, weil sie - ungewollt - deutlich machte, daß die Leninsche Avantgarde-Partei nur mit Hilfe einer idealistischen Philosophie gerechtfertigt werden konnte. Diese Partei war für Lucàcs die Inkarnation des richtigen Klassenbewußtseins, die - im Interesse der Revolution - eine „selbständige Gestalt“ angenommen hatte. Kurz - die orthodoxen Hüter der „reinen Lehre“ zwangen Lucàcs zur Selbstkritik. Hierauf zog er sich auf das Gebiet der Literaturwissenschaft und Literaturkritik im großen Stil zurück. Auch da, wo er sich dem obligaten Kanon des „sozialistischen Realismus“ anbequemte, gelang es ihm durch Rückgriff auf die großen „bürgerlichen Realisten“ Balzac, Fontane und Thomas Mann indirekt Kriterien für die Qualität von Literatur auch für die sozialistischen Zeitgenossen festzuschreiben. Daß er zugleich mit den so gewonnenen Qualitätsnormen der großen Autoren des 19ten und 20ten Jahrhunderts auch moralische und humanistische Anforderungen transportierte, war vor allem seinen parteipolitischen Gegnern bewußt. Immer am Rande der Dissidenz - von ihm stammt wohl auch die ironische Bemerkung „Intelligenz ist schon eine Abweichung“ schützte ihn sein internationales Ansehen vor dem Äußersten, so daß er - als Kulturminister der Regierung Nagy 1956 verhaftet und nach Rumänien exiliert wurde. 1971, in seinem Todesjahr, schrieb er in einem Brief an das Literary Supplement der Times , von dem er „nach den Büchern der Zukunft“ gefragt worden war - über Ágnes Heller: „Die Budapester Schule“ steht für eine in verschiedene Richtungen sich verzweigende, aber zusammenhängende und kohärente Gedankenwelt. Ihre produktivste Persönlichkeit ist Ágnes Heller, aus deren Arbeit drei Bücher die Tendenz des Marxismus der Budapester Schule vorbildlich repräsentieren. Die „Ethik des Aristoteles“ und der „Renaissance Mensch“ sind historische Monographien. Die erste charakterisiert das Ganze der platonischen und aristotelischen Philosophie in vielseitiger Weise, die zweite gibt ein prägnantes und dynamisches Bild von einer Epoche des Denkens, die bisher vom Marxismus nur flüchtig und beiläufig beachtet worden war. Diese zwei Bücher bedeuten aber mehr als bloße historische Analyse: sie stellten Epochen dar - das Ende der Antike und die Renaissance Stadt-Gemeinschaft -, in denen die Entfremdung am wenigsten entfaltet, die Distanz zwischen den Wesenskräften der menschlichen Gattung und ihrem individuellen Reichtum die kleinste war. Gerade diese Problematik führte Ágnes Heller zu ihrem bislang reifsten Werk, zur Monographie „Das Alltagsleben“, worin die Untersuchung der dynamischen Totalität der alltäglichen Tätigkeitstypen und Denkweisen das Hauptthema bildet. Das letztgenannte Buch ist zugleich eines der wichtigsten Werke der sich im letzten Jahrzehnt erneuernden marxistischen Ontologie. Ágnes Heller war vermutlich schon damals mit diesem letzten Satz nicht ganz einverstanden, aber Lucàcs hebt doch zu Recht hervor, daß zwischen ihrem Ausgang vom Denken des frühen Marx und den späteren Arbeiten von Ágnes Heller ein direkter Zusammenhang besteht. In ihren Büchern „Theorie der Bedürfnisse bei Marx“, „Das Leben ändern -radikale Bedürfnisse, Frauen, Utopie“, „Theorie der Gefühle“, „Alltag und Geschichte“ bis hin zu ihrem jüngsten Buch „Ist die Moderne lebensfähig?“ - geht es ihr immer um das konkrete Leben von Menschen unter je spezifischen sozialen, politischen institutionellen und emotionalen Verhältnissen. Dabei spielt ihre Auseinandersetzung mit dem „real existierenden Sozialismus“ ein wachsende Rolle. Dieser angebliche Sozialismus vermochte keine der Erwartungen zu erfüllen, die Marx noch ganz deutlich in den „Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie“ eindrucksvoll artikuliert hatte. In der Formel „Diktatur über die Bedürfnisse“ faßt Ágnes Heller die - alle menschlichen Möglichkeiten unterdrückende - Auswirkung der kommunistischen Einparteienherrschaft prägnant zusammen.
Als Georg Lucàcs nach der abermaligen Verhinderung einer durchgreifenden Reform des Staatssozialismus in der Tschechoslowakei resigniert meinte, die Oktoberrevolution des Jahres 1917 sei doch nicht die große welthistorische Wende zur Emanzipation gewesen, an die er sein Leben lang geglaubt hat, tröstete ihn die Hoffnung auf die jungen Rebellen in der westlichen Welt, über die ihm Ágnes Heller berichtet hatte. Als sie dann selbst für längere Zeit in den Westen kam, mußte sie auch diese Hoffnung wieder begraben. Diese phantasievollen Rebellen hatten keinen genügend langen Atem und übersahen die Lehren, die aus den Erfahrungen der Menschen unter kommunistischem Regime gezogen werden müssen. Aus diesem Grunde verkannten sie den Wert der institutionellen Errungenschaften der liberalen Demokratie - Menschenrechtsartikel der Verfassungen, Gewaltenteilung, politische Rechte einschließlich der Informationsfreiheit, der Koalitionsfreiheit usw. Über einem idealisierten Marx hatten sie Kant und die kritische Tradition der bürgerlichen Aufklärung vergessen.
In ihrem leider etwas zu rasch übersetzten jüngsten Buch „Ist die Moderne lebensfähig“ setzt sich Ágnes Heller unter anderem mit dem Schlagwort „Tod des Subjekts“ auseinander und kritisiert den intellektuellen und moralischen Monopolanspruch sowohl der Transzendentalpragmatik von Karl Otto Apel als auch die Gleichgültigkeit gegenüber jeder sozialphilosophischen und ethischen Fundierung der Demokratie bei Richard Rorty. Beide - so ihre einsichtige These - verabsolutieren Teilwahrheiten. Apel hat sicher recht, wenn er die Transzendentalpragmatik als eine logisch stimmige Legitimierung universaler ethischer Werte bezeichnet, aber er übersieht, daß es andere Begründungen für sittliches Verhalten - auf Grund spontaner Intuition des Gewissens - gibt, die deshalb nicht wertlos sind. Die Grenze, an die Apel stößt, wird durch die Frage nach der Handlungsmotivation sichtbar, auf die jene im Gewissen sich meldende Intuition weit eher eine Antwort zu geben vermag. Aber auch Rorty hat, wenn man seine These nicht mit einem Monopolanspruch verabsolutiert, einen Punkt: die Existenz von individuelle Freiheit für alle koexistierenden Personen gewährleistenden Institutionen, ist in der Tat in ruhigen Zeiten ausreichend. In Krisenzeiten bedarf es aber sehr wohl der legitimierenden Begründung, wie sie z.B. die Transzendentalpragmatik (oder auch Kants praktische Philosophie) zu geben vermag. In den Worten von Ágnes Heller: „Womöglich bieten die Institutionen der liberalen Demokratie die besten Rahmenbedingungen für politische Entscheidungen und Praktiken, für Lebensformen allerdings nicht. Und damit bin ich bei Rortys Problem. Es ist zwar gut, daß sich der Staat wenig um unsere private Moral, ja nicht einmal um unsere öffentlichen Tugenden kümmert. Im Fall der restlosen Auflösung der moralischen Bindungen eines Volkes jedoch wären solche liberalal-demokratischen Institutionen nicht endlos reproduzierbar. Mögen auch Kulturkritiker das Nachlassen der Moral übertrieben haben, so ist dennoch zivilisierte Barbarei nichts, was man angesichts der Möglichkeiten der zeitgenössischen Geschichte leichthin abtun dürfte“. Ich würde an dieser Stelle noch einen Schritt weitergehen und behaupten, daß die bloße Existenz liberal- demokratischer Institutionen nie genügt, wenn nicht wenigstens ein erheblicher Teil der Bevölkerung sich als Citoyen verhält und die von ihnen mehrheitlich gemeinsam beschlossenen Gesetze respektiert. Was Richard Rorty für selbstverständlich hält, weil er auf die Erfahrung einer traditionellen liberalen Demokratie zurückblickt, gilt gewiß nicht für Staaten, die - wie die aus der zerfallenen Sowjetunion hervorgegangenen - eben erst nach Jahrzehnten totaler bürokratischer Betreuung und Bevormundung freiheitliche Institutionen erhalten oder sich gegeben haben.
Im gleichen Buch, das die Frage nach der „Lebensfähigkeit der Moderne“ stellt, unternimmt Ágnes Heller auch einen interessanten Versuch zur angemessenen Beurteilung der Philosophien von Martin Heidegger und Georg Lucàcs im Unterschied zur moralischen Beurteilung dieser Personen. Ihre paradox klingende Formel hierfür lautet, daß Philosophien als spekulative Ganzheiten „unschuldig“ sind oder - wie sie in einer etwas esoterisch klingenden Philosophensprache sagt -„adiaphorisch“, während sie zugleich gefährlich sind, wenn sie partiell (stückweise) rezipiert werden. Adiaphora sind „gleichgültige Dinge“, die - nach Auffassung der Kyniker und Stoiker Verhaltensweisen bezeichnen, die zwischen Gut und Böse liegen. Jede einigermaßen relevante Philosophie ist damit zugleich adiaphorisch und gefährlich. Die Person der Philosophen kann aber nur für die voraussehbaren Folgen einer partiellen Rezeption ihrer Gedanken verantwortlich gemacht werden. Sie sind allerdings auch verpflichtet, Einspruch zu erheben, wenn solche Folgen eingetreten sind. Ich vermute, daß Ágnes Heller annimmt, daß Georg Lucàcs durch seine - freilich sehr späte - offene Kritik am diktatorischen System des "real existierenden Sozialismus" bis zum gewissen Grade als Person exkulpiert werden kann, während sich Heidegger als Person einer analogen Aufgabe in Bezug auf den Nationalsozialismus hartnäckig entzogen hat. Es ist schade, daß wir Hannah Arendt, der gerade in letzter Zeit wieder posthum ihr Verhältnis zu Heidegger vorgehalten wurde, nicht zu dieser Problematik befragen können. Vermutlich würde ihr die Unterscheidung zwischen der „adiaphorischen“ Philosophie und der Schuldfähigkeit der philosophierenden Person gefallen haben.
Mit einem Kapitel über „Freiheit und Glückseligkeit in der politischen Philosophie Kants“ kehrt Ágnes Heller noch einmal zu dem Thema der Bedürfnisse zurück, mit dem sie sich als eine der wenigen Zeitgenossen intensiv beschäftigt hat. Sie unterstreicht zunächst die Gründe für Kants Ablehnung einer Orientierung der Politik auf die Bewirkung von Glückseligkeit. Sodann kritisiert sie aber Kants allzuengen Begriff des Bedürfnisses, der für ihn durch die drei „Süchte“ Herrschsucht, Ehrsucht und Habsucht erschöpft sei. Ohne daß es Kant selbst erkannt hätte, kennt er aber auch ein weiteres Bedürfnis - nämlich nach Geselligkeit und faktisch gibt es bei ihm offensichtlich auch ein menschliches Freiheitsbedürfnis. In dieser Hinsicht darf man daher Kants apodiktische Formulierung - auf Grund seiner eigenen Arbeiten - korrigieren. Wenn auch Kant die „Diskussion“ von Bedürfnisansprüchen nicht aus der Öffentlichkeit ausschließen wollte, so verneinte er doch die Möglichkeit, daß die Teilnahme an einer beständigen politischen Diskussion durch etwas anderes motiviert sein könnte als durch Pflicht. „Pflicht aber ist mit Sicherheit“ - konstatiert Ágnes Heller - „kein Bedürfnis.“ Darin erblickt sie einen gravierenden Mangel Kants, den Hannah Arendt aber nicht geteilt habe, da sie dessen dualistisches Menschenbild nicht übernommen habe.
Ich bin bewußt zum Schluß meiner Laudatio noch einmal auf die zentrale Bedeutung des Begriffs der Bedürfnisse im Werk von Ágnes Heller zu sprechen gekommen. Ihr eigentümlicher Humanismus ist um diesen Begriff zentriert. Sie hat sowohl die Verkürzung des Bedürfniskatalogs auf materielle Versorgung und bevormundende Betreuung durch die autoritären Institutionen des „real existierenden Sozialismus“ kritisiert, als auch deren beschränkte Berücksichtigung in der im übrigen wegweisenden Demokratiekonzeption Kants. Ihr Denken war von Anfang an einem konkreten Bild des Menschen mit seinen vielfältigen legitimen Bedürfnissen und meist unentfalteten Möglichkeiten orientiert. Das Konzept konkreter Freiheit fiel für sie mit der freien Entfaltung aller in einem Individuum angelegten Potenzen und Bedürfnissen unentfremdeter Menschen zusammen. Die Kategorien, mit denen der frühe Marx die zeitgenössische Gesellschaft und die Behinderung und Deformation der in ihr lebenden Menschen kritisiert hat, bleiben für Ágnes Heller der Ausgangspunkt der Auseinandersetzung auch mit Gesellschaften, die sich - zu Unrecht - auf das „humanistische Erbe“ der bürgerlichen Revolution und Karl Marx berufen haben. Sie gibt aber auch der postmodernen Resignation und posthistorischen Beliebigkeit nicht nach, sondern hält an der verpflichtenden Norm einer freien und gerechten Ordnung menschlichen Zusammenlebens fest. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lautete der Titel eines damals vielbeachteten Vortrages in Tübingen: „Haben wir das Recht zu verzweifeln?“ Ágnes Heller und ihre Philosophie, die übrigens für mich keineswegs adiaphorisch ist, macht uns mit ihrem jüngsten Buch jedenfalls Hoffnung, daß die Moderne lern- und lebensfähig ist und auch dafür gebührt ihr der Hannah-Arendt-Preis, zu dem ich ihr von Herzen gratuliere.
Befreiung hoffen, Befreiung wollen, Befreiung leben
Als Fremdling unter Hannah-Arendt- und Àgnes-Heller-Fachleuten komme ich zu der Ehre, heute zu Ihnen zu sprechen. Nicht als "Kundiger" kann ich reden - lediglich als Liebhaber jener Befreiung, die ich als Thema gewählt habe und mithin als Bewunderer und Liebhaber von solchen Befreiten, denen Erkenntnis nicht zu Ruhe und Beruhigung, sondern zur Unruhe verholfen hat.
Zu Beginn möchte ich bei aktuellem Lebensgefühl, aktuellen Debatten einkehren, die mich unversehens in die Nähe Hannah Arendts gebracht haben. Ich meine die Hannah Arendt, die 1950, zurückgekommen nach Deutschland, merkwürdiger Phänomene gewahr wurde: Sie war unter eine Generation Unbeteiligter geraten.
Im Land der Täter wurde der Opfer mit einem erschreckenden Manko an Mitgefühl gedacht - wenn man sich überhaupt an sie erinnerte.
Im Land der Täter spielte die Frage nach Verantwortlichkeit und nach Schuld kaum eine Rolle Im Land der Täter kannten hingegen viele die philosophisch-theologische Grundaussage: "Alle Menschen sind Sünder".
Die offensichtliche Richtigkeit dieser Sentenz vermochte Hannah Arendt jedoch keineswegs zu erfreuen: In jenem historischen Kontext war der Weg kurz von der "Richtigkeit" über die Banalität zur Lüge. Diejenigen, die damals "Wahrheiten", die nichts kosteten, liebten, waren für Hannah Arendt doppelt gestraft: Einmal mit offensichtlicher Gefühlsarmut, Gefühlskälte, vielleicht sogar Gefühlslosigkeit (wenn man nicht das Selbstmitleid für Mitgefühl erklären wollte), zum anderen mit dem Verlust von Wirklichkeit.
Unter den Zeitgenossen hatte sich der schönende Blick auf schlimme Zeiten verwandelt in eine schönende Erinnerung der schlimmen Zeiten. Die Gegenwart hingegen wurde scheeläugig, also mit bösem Blick angeschaut. Allüberall das Elend, unsere Städte kaputt (die Alliierten: auch Kriegsverbrecher, überhaupt: prinzipiell hätte jeder Staat den Krieg angefangen haben können ...), die Demokratie auch nicht besser als früher, wo man wenigstens abends ungestört von Kriminellen nach Hause gehen konnte, als jedermann Arbeit hatte, die Autobahnen von deutschem Fleiß kündeten und die Volksgenossen mit dem KDF-Schiffen nach Norwegen fuhren.
Als ich derlei Dinge las, hatte ich ein Deja-vu-Erlebnis: Als Mecklenburger, jetzt Berlin-Mitte (40 % PDS-Wähler), bin ich häufiger Teilhaber an postkommunistischem Erinnerungsgut, das dem postfaschistischen verblüffend ähnlich ist.
Zugegeben: Das mit den Autobahnen hört man jetzt nicht. Aber ersetzen Sie bitte dieses Wort durch "Kindergärten" und komplettieren Sie mit "Vollbeschäftigung" und "keine Kriminalität", begegnet Ihnen das nämliche Lebensgefühl. Was ist es? Ignoranz, Larmoyanz, Niedertracht, Nostalgie? Mag sein. Aber Hannah Arendt weist auf schlimmeres hin: Totalitäre Herrschaft hat zur Folge, daß die Beherrschten Schritt für Schritt "Wirklichkeit" verlieren. Nicht nur, weil sie zu oft Lügen ausgesetzt waren, sondern weil die Fakten, die Realität selbst ihrer Rolle als Erkenntnisgrundlage beraubt werden. "Alle Fakten können verändert und alle Lügen wahrgemacht werden". Folge ist eine "Unfähigkeit" und ein "Widerwille" "überhaupt, zwischen Tatsache und Meinung zu unterscheiden". "Die intellektuelle Atmosphäre ist von vagen Gemeinplätzen durchdrungen ... man fühlt sich erdrückt von einer um sich greifenden öffentlichen Dummheit, der man kein korrektes Urteil in elementaren Dingen zutrauen kann". So Hannah Arendt 1950.
Für mich ist evident: In meinen heimatlichen Niederungen ist 1995 1950. Es gibt peinliche und peinigende Parallelen, betrachtet man die Lebensgefühle und die Neigung, aus schlechten Zeiten Gutes zu erinnern.
In einer Umfrage des Instituts Allensbach aus dem Jahr 1948 antworten 57% der erwachsenen Westdeutschen auf die Frage "Glauben Sie, daß der Nationalsozialismus eine gute Sache war, die schlecht gemacht wurde?" mit ja.
Es wird Sie nach dem Gesagten nicht verwundern, daß meine ostdeutschen Landsleute in den Jahren 1990 und folgende dem Institut Allensbach auf diese Frage bezogen auf "Sozialismus", resp. "Kommunismus" mit einer signifikant ähnlichen Mehrheit reagieren. Es fällt auf, daß braune und rote nicht legitimierte Herrscher einander oft ähnlich sind. Aber noch erschreckender ist die Ähnlichkeit der Unterdrückten. Es gibt offensichtlich eine mentale und emotionale Verwandtschaft der Unterdrückten aller Diktaturen. Und wie tief der Gestus des Untertanen in uns steckt, wenn wir nicht nur 12, sondern 12 plus 44 Jahre gelernt haben, das Haupt zu beugen, haben wir exakt noch gar nicht festgestellt. Befreiung zu wollen, ist nicht nur ein kurzer revolutionärer Akt auf den neu eroberten oder zu erobernden Straßen.
Wenn diese - gelobt die Zeit, da sie stattfand - nicht gefolgt wird von einer nachfolgenden Befreiung von Geist, Gefühl und Haltung bleibt Freiheit wie eine Proklamation, der keine neue Wirklichkeit folgt.
Mit Erschrecken nehmen wir wahr: Neben der Schwierigkeit, Wirklichkeit neu zu entdecken, Fakten und Realität als solche gegen die "Meinungen" auszutauschen, neben der Mühe, die es kostet der selektiven Wahrnehmung, dieser Feindin der Wahrheit den Abschied zu geben, haben wir es bei der Gewinnung von Freiheit und Selbstbestimmung mit dem Phänomen des verzögerten Mentalitätenwechsels zu tun.
Wie schnell begreift unser Intellekt neues (technisches o. a.) Wissen. Wie langsam verändert sich die habituelle Prägung. Als Kind der Aufklärung fällt es einem nicht leicht festzustellen, daß offenbar tief in uns ein jahrhundertealtes Programm, das Unterwerfung als etwas quasi Natürliches annimmt, wirksam ist.
Wohnte nicht zugleich in uns eine ursprüngliche, tiefe, geheimnisvolle, oft verbogene, dann machtvolle Sehnsucht nach Freiheit - der Untertan hätte ein ewiges Reich in der Seele der Menschen und die Diktatur wäre das allzeit gültige Gesellschaftsmodell.
Da dies aber so nicht ist, hat der Habitus des Untertanen nur ein auf Gewohnheit begründetes zeitweiliges Wohnrecht in uns. Wie dessen Lebensform "Feigheit", so sollte uns seine Existenz als Zutat gelten, nicht aber als Essenz des humanum.
Als wir es 1989 im Osten unterließen, die intellektuellen Beheimatungsversuche im Reich der Unfreiheit fortzusetzen, als wir bei der ursprünglichen Sehnsucht nach Freiheit ankamen, als daraus die konkrete Hoffnung auf Befreiung erwuchs, da hatten wir eine schwere Aufgabe: wir mußten verlernen, was wir so lange gelernt hatten: Beuge Dein Haupt, und es wird dir gut gehen.
Wir hatten dabei unterschiedliche Lehrer: Àgnes Heller gehörte gewiß zu ihnen, aber bevor ich sie zum Schluß zitiere, will ich auf ein Wort kommen, das für die Revolutionäre in meiner Heimatstadt Rostock von Bedeutung war. Wir wollten die Macht der Mächtigen brechen. Was uns 1953, den Ungarn 1956 nicht gelungen war, was die Polen fast ein Jahrzehnt zuvor begonnen hatten, das sollte nun bei uns endlich geschehen.
Damals haben wir ein Wort von Vaclav Havel zitiert: "Die Macht der Mächtigen kommt von der Ohnmacht der Ohnmächtigen". Neues zu leben wollen heißt, Altes verlernen zu müssen. Sie, liebe Àgnes Heller, haben darauf hingewiesen, daß Hannah Arendt gesagt hat, "daß die schönsten Augenblicke des Lebens die Augenblicke der Befreiung sind". Daß die Schönheit und Kraft solcher Augenblicke nicht ausreicht, um Freiheit auf Dauer zu sichern, daß die Anstrengungen des Erkennens, Gestaltens folgen müssen, das ist etwas, was wir von Ihnen lernen können.
Wer Befreiung leben will, darf weder die Mühen der politischen Ebenen scheuen, noch der Vergangenheit ihren Rang absprechen.
Sie, Àgnes Heller, haben kürzlich in einem Text über das 20. Jahrhundert die "Erinnerung als Andacht" gefordert, "Andenken an alles, was hier in Europa passierte". Solche Erinnerung "verpflichtet". "Man muß über die Schuld der attraktiven Hoffnungen und erhabenen Gedanken nachdenken, man muß wagen, das Dämonische zu denken." Nur beim ersten Hören hat man die Empfindung: merkwürdige Worte für eine Aufklärerin.
Natürlich haben Sie das nicht gesagt, um modisch auf der Linie eines Kunstverstandes zu sein, indem das Dämonische beliebter ist als das Aufklärerische. Sondern Sie haben es aus einem tiefen Wissen um etwas böse Geheimnisvolles formuliert. Eine böse Konstellation müssen wir begraben können, so Ihre Worte, wie die Opfer von bösen Zeiten. Aber mit dem Begraben von bösen Konstellationen passiert etwas anderes, als wenn man nur Menschen begräbt, die dann dahin sind, ein für allemal. Die Konstellationen können ja wieder erstehen, darum, so meinten Sie, sei es wichtig, das Böse ernst zu nehmen und der These von der Banalität des Bösen zutiefst zu widersprechen. Und Außerdem sei es wichtig, 'das Böse freiwillig zu fürchten, so daß man es nicht mehr unfreiwillig fürchten muß'.
Ich hätte es eigentlich lieber, solche Wahrheiten nicht lernen zu müssen, aber wenn man angefangen hat, den Weg der Aufklärung zu gehen, dann wird man ihn zu Ende gehen müssen. Dabei lasse ich mich von Ihnen auf diesem Weg gern an die Hand nehmen.
Begraben können und wollen, was einen am Leben hindert, das heißt also, daß wir erinnern müssen, was zu begraben ist., und dieses können wir nur, wenn wir den schönendem Blick für die Gegenwart entsagen, den sich so viele Zeitgenossen geleistet haben, auch bei unserem Erinnern. Das Erinnern mutet uns zu, dem rückschauend nochmals zu begegnen, was uns im aktuellen Leben oft mißlungen ist. Wir sind vielfältig und meisterhaft in der selektiven Wahrnehmung und im schönenden Blick gewesen. Wir können zur Rechtfertigung dessen allerhand edle Motive vortragen. Und doch waren wir stumme oder gelegentlich gar böse Zeugen böser Tage und Taten oder um mit Raoul Hilberg zu sprechen: Zuschauer schlimmer Taten, ohne daß wir uns herausgefordert gefühlt hätten, einzugreifen. Darum also erinnern, nicht nur um wahrzunehmen, was gewesen ist, ohne Selektion und Ersetzung der Realität durch Meinungen, sondern auch, um wenigstens das, was damals nur begrenzt erkannt worden ist, im Kern zu erfassen. Und dann - jetzt haben Sie mir etwas geschenkt, was ich diesem Auditorium auch weitergeben möchte - dann, bei diesem Begraben passiert etwas Merkwürdiges. Die Trauer des Begräbnisses paart sich in diesen Fällen mit dem Erlebnis von Befreiung. Über diese Befreiung habe ich eingangs bereits gesprochen, auch darüber, daß wir die Befreiung fortsetzen müssen, wenn wir denn Liebhaber der Freiheit bleiben wollen. Es fällt mir zur Zeit nicht so besonders leicht, in einem so schönen Land wie Deutschland zu leben. Als ich in Ostdeutschland anfing, politisch für die Einheit Deutschlands zu streiten, tat ich das mit dem sicheren Gefühl, wenn wir erst die Einheit hätten, würde ich es mit einer Vielzahl von zivilcouragierten Menschen zu tun bekommen, da die Deutschen im Westen ja 40 Jahre der Beugung durch Diktatoren nicht ausgesetzt waren.
Nach meiner Ankunft im vereinten Deutschland fällt mir bei der Begegnung mit den hiesigen Landsleuten nicht gerade ein Übermaß an Mut und Zivilcourage auf. Vielleicht ist es so, daß ein Land, das keine Sehnsucht nach Freiheit mehr kennt und darum eine Hoffnung auf fortwährende Freiheit nicht für nötig erachtet, in der tiefen Gefahr steht, die Freiheit mit etwas ganz Nebensächlichem zu verwechseln. Es klang heute schon an, etwa mit Libertinage (obwohl ich auch dafür gelegentlich etwas übrig habe). Aber es zu verwechseln, das nicht zu kennen, was in uns als Keim jeder Besserung angelegt ist, nämlich Befreiung zu glauben oder festzustellen, daß die Sehnsucht nach Freiheit uns abhanden gekommen ist, daran möchte ich nicht teilhaben. Und darum gehört zu dem Begraben der 'schuldigen Konstellationen' was nötig ist, eben um der Gerechtigkeit willen, die Hoffnung jener, die sich nicht stören lassen, wenn ihre Sehnsucht nach Freiheit eine ganze Zeit mißverstanden wird, nicht gesehen, nicht gewünscht, abgeschafft, unterdrückt, verleugnet, aus der Welt verbannt wird. Befreiung zu hoffen und Befreiung zu wollen heißt auch, daß wir Befreiung leben können. Auch wenn unser Jahrhundert das Jahrhundert der allergrößten Unfreiheit geworden ist. Daran nicht zu krepieren, das lehren Sie uns in der Schule von Hannah Arendt. Mögen und solche Schulen erhalten bleiben, meine Damen und Herren.
GRUSSWORTE
Liebe Ágnes Heller, liebe Gäste, verehrte Anwesende,
,,Die einzige Rettung" liegt ,,in der Schule des öffentlichen Lebens... in der unumschränktesten, breitesten Demokratie und öffentlichen Meinungsäußerung." So zitiert Hannah Arendt die von ihr geliebte und geschätzte Rosa Luxemburg, die in ihren Bemerkungen über die ,,Russische Revolution" die Bolschewiken scharf kritisierte, weil sie, wie sie schreibt, ,,eine deformierte Revolution weit mehr als eine erfolgreiche" fürchtete. ,,Die einzige Rettung liegt in der Schule des öffentlichen Lebens" - dieser Gedanke durchzieht Hannah Arendts gesamtes politisches Denken.
,,Nichts als dieses unaufhörliche Gespräch unter den Menschen rettet die menschlichen Angelegenheiten" schreibt sie in ihrem Buch ,,Über die Revolution". ,,Auf keinen Fall", heißt es kurz vorher, ,,ist auf ein wie immer geartetes Wirtschaftssystem in Sachen der Freiheit Verlaß. Es ist durchaus denkbar, daß das ständige Ansteigen der Produktivkräfte sich eines Tages aus einem Segen in einen Fluch verwandelt, und niemals können die wirtschaftlichen Faktoren automatisch in die Freiheit führen oder als Beweis für die freiheitliche Natur einer Regierung ins Feld geführt werden."
Was Freiheit auszeichnet, ist für Hannah Arendt die Möglichkeit, daß die Menschen einer Gesellschaft zu Bürgerinnen und Bürgern werden, daß sie sich an der Gestaltung der Welt beteiligen können, daß sie handelnd und sprechend in ihr tätig sein können. Das schlimmste, was einer Gesellschaft passieren kann, ist für Hannah Arendt das Verschwinden der Politik. Sie hat erfahren, daß mehr und mehr Menschen in den Ländern der westlichen Welt ,,Freiheit von Politik" als eine der Grundfreiheiten begreifen, von dieser Freiheit Gebrauch machen und sich von der Welt und den Verpflichtungen in ihr zurückziehen. So heißt es in ihren ,,Gedanken zu Lessing".
Und sie fährt fort: ,,Dieser Rückzug aus der Welt braucht den Menschen nicht zu schaden,... nur tritt mit einem jeden solchen Rückzug ein beinahe nachweisbarer Weltverlust ein; was verloren geht, ist der spezifische und meist unersetzliche Zwischenraum, der sich gerade zwischen diese Menschen und seinen Mitmenschen gebildet hätte." In ihrem Buch ,,Vita activa oder vom tätigen Leben" schreibt Hannah Arendt: ,,Es ist durchaus denkbar, daß die Neuzeit, die mit einer so unerhörten und unerhört vielversprechenden Aktivierung aller menschlichen Vermögen und Tätigkeiten begonnen hat, schließlich in der tödlichsten, sterilsten Passivität enden wird, die die Geschichte je gekannt hat."
Sie weiß, daß Menschen, wenn sie sich immer mehr zu Untertanen degradiert sehen, wenn sie immer weniger auf die Sicherheit ihrer Rechte bauen können, wenn sie spüren, daß Regierung und Opposition einander immer ähnlicher werden und ihre Macht zu wählen und zu kontrollieren dadurch schwächer wird, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Politik als etwas erleben, das ihnen äußerlich ist, das sie im Grunde nichts angeht und auf das sie keinen Einfluß haben, daß sich dann diese Menschen von der Politik und auch von der Demokratie abwenden. Dann können sie irgendwann in populistischen oder antiliberalen Strömungen ihrem Ärger Luft machen, dann können sie sich nach dem Gift des Gehorsams sehnen, das von allen autoritären Regimen erfolgreich verabreicht werden kann, dann wird aus Politikverdrossenheit im Nu Demokratieverdrossenheit mit der Sehnsucht nach Führerfiguren, die persönliche Rachegefühle befriedigen, die die Eigenverantwortung abnehmen und vermeintliche Klarheit schaffen in der allgemeinen Unübersichtlichkeit. Die Vernichtung des Politischen kann eine Politik der Vernichtung bewirken. Wir können von Hannah Arendt lernen, der Vergiftung und Betäubung unserer Gesellschaft zu widerstehen, indem wir Bürgermut fördern statt Konformismus indem wir uns Dissidenten wünschen statt Mitläufer.
Die politischen und gesellschaftlichen Probleme scheinen heute stärker zu wachsen als die Mittel und Möglichkeiten, sie zu lösen. Daher wächst die Angst vieler Menschen vor der Zukunft. Sie spüren den Abstand zwischen dem, was getan werden müßte, und dem, was geschieht.
In den sechziger Jahren konnten wir Überfluß und Fortschritt verwalten. Das war verantwortbar, weil der Weg in eines bessere Zukunft zu führen schien. Heute sind wir oft gezwungen, Mängel und Risiken zu verwalten, von denen wir nicht wissen, wohin sie führen können. Die parlamentarische Demokratie lebt vom Streit, vom Ringen um den besseren Weg, von Differenz und Polarisierung. Sie lebt aber auch von Wahlkampf zu Wahlkampf. Dies bringt immer die Gefahr mit sich, daß Parteien und Regierungen notwendige Vorhaben nur deshalb nicht öffentlich einfordern, weil sie schwer zustimmungsfähig erscheinen. Und die Versuchung ist groß, dann Probleme zu verzögern, sie vor sich herzuschieben, sie kleinzureden. Mit der Folge: Die Schwierigkeiten wachsen weiter, Lösungen werden erschwert und der Mut schwindet, entschlossen zu handeln. Die Politik muß den Mut zur Wahrheit finden, sie muß Wege weisen, die eine Richtung erkennen lassen. Sie muß an die Stelle kurzatmiger und egoistischer Teillösungen umfassende Strategien setzen, die das Ganze berücksichtigen. Erst wenn es uns gelingt, unser gegenwärtiges politisches Handeln so auszurichten, als müßten wir heute schon die Konsequenzen unseres Tuns tragen, handeln wir glaubwürdig und verantwortungsvoll. Doch eine Politik in diesem Sinne kann in einer Demokratie nur dann lebendig werden und Kraft gewinnen, wenn sie von unten getragen wird. Bei der Dramatik der gesellschaftlichen Veränderungen und den Risiken, die daraus erwachsen, braucht die demokratische Gesellschaft die Talente und Fähigkeiten von allen ihren Mitgliedern.
Für Hannah Arendt sind Menschen handelnde Wesen in der Welt. Was ihr menschliches Wesen ausmacht, ist ihre Fähigkeit zu handeln, etwas Neues zu beginnen, sich an der Gestaltung der Welt zu beteiligen. Sie schließt ihr Hauptwerk ,,Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft" mit einem Wort des Kirchenvaters Augustin: ,,lnitium ut esset, creatus est homo - damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen." Und sie fährt fort: ,,Dieser Anfang ist immer und überall da und bereit. Seine Kontinuität kann nicht unterbrochen werden, denn sie ist garantiert durch die Geburt jedes Menschen." Immer wieder hat Hannah Arendt Pindar zitiert: ,,Werde, was Du bist."
Je mehr Menschen ihr Menschsein verwirklichen, werden, was sie sind, je mehr sie ihrer Verantwortung zum Handeln, zum Tätigsein in der Welt gerecht werden, desto eher wird es gelingen, um sie noch einmal zu zitieren, ,,aus der Finsternis der Kreatur in die Helle des Menschlichen zu gelangen".
Sehr verehrte Frau Professor Heller!
Sie kennen Hannah Arendts Buch ,,Menschen in finsteren Zeiten". In ihrem Vorwort schreibt sie: ,,Die Überzeugung, daß wir selbst dann, wenn die Zeiten am dunkelsten sind, das Recht haben, auf etwas Erhellung zu hoffen, und daß solche Erhellung weniger von Theorien und Begriffen als von jenem unsicheren, flackernden und oft schwachen Licht ausgehen könnte, welches einige Männer und Frauen unter beinahe allen Umständen in ihrem Leben und ihren Werken anzünden und über der ihnen auf der Erde gegebenen Lebenszeit leuchten lassen - diese Überzeugung bildet den unausgesprochenen Hintergrund für die hier vorgelegten Persönlichkeitsprofile."
Sie, liebe Ágnes Heller, sind mit uns der Überzeugung, daß Hannah Arendt zu diesen Frauen und Männern gehört die ein wenig Licht in dieses dunkle Jahrhundert gebracht haben. Nicht nur wir hier in Bremen sind überzeugt, daß auch Sie in diese Reihe von Menschen gehören. Und deshalb ist es für uns eine ganz besondere Freude daß Sie die erste Preisträgerin des ,,Hannah Arendt-Preises für politisches Denken" sind.
DANKESWORTE
Liebe Damen und Herren, liebe Freunde,
Ich gehöre zu denen, die fast ihr ganzes Leben in einer Welt verbrachten und tätig waren, wo man ehrliches Denken und aufrichtige politische Reflexion eher bestrafte als auszeichnete. Meine Generation aus Ostmitteleuropa ist nicht daran gewöhnt, Preise anzunehmen.
Vielleicht ist es ein, mit unseren Erfahrungen zu erklärender Abwehrmechanismus, daß wir grundsätzlich gleichgültig gegen alle institutionellen Anerkennung geworden sind, vielleicht mehr als es jetzt sich ziemte. Preise mit Decorum anzunehmen muß man ebenso lernen, wie sie, wenn es nötig ist, mit Decorum abzulehnen.
Diesmal brauche ich jedoch meine alte Hemmung nicht zu kontrollieren, den Preis, die Sie mir verleihen, mit Freude und Dankbarkeit anzunehmen. Ich freue mich über diesen Preis eben weil es dieser Preis ist.
Ich freue mich, weil mir diesen Preis Leute erteilten die ich als "Freunde im Denken" bezeichnen könnte. "Freunde im Denken" sind nicht Philosophen die an dieselbe Wahrheit glauben, sie sind auch nicht Kameraden, die zusammen für dieselbe Sache kämpfen. Sie sind eher Männer und Frauen, die ähnlich wie ich über die Welt denken. Sie, meine "Freunde im politischen Denken" verknüpfen Realismus und Radikalismus miteinander. Sie wollen nicht über Rhodus, über unsere Zeit springen, doch sie glauben daran, wie auch ich es glaube, daß es auch heute politische Freiheitsräume für authentisches Handeln und für selbständiges Denken gibt.
Ich freue mich, weil dieser Preis durch die Würdigung des Selbstdenkens in der versunkenen Welt des ehemaligen totalitären Ostmitteleuropas - mit mir und in meiner Person- auch meine Freunde würdigt. Ich meine z.B. Leszek Kolakowski und Adam Michnik, aber diesmal, und hier besonders, die Mitglieder der damaligen Budapester Schule, Ferenc Fehér, György Márkus und Mihály Vajda. In diesem Kreis der Freunde kam ich von meiner selbstverschuldeten Unmündigkeit heraus, um freies Denken in finsteren Zeiten zu lernen. Dort habe ich "Freundschaft im Denken" als das höchste Gut schätzen gelernt.
Ich freue mich, weil dieser Preis den Namen von Hannah Arendt trägt. Denn Hannah Arendt ist auch einer meiner Freunde im Denken. Weil sie der Versuchung widerstanden hat, ein System zu schaffen, weil sie alle "ismen" verabscheute, weil sie die Marginalität akzeptierte, ohne sich damit selbst weh zu tun oder zu verbittern. Weil sie in den Begriffen von Vergänglichkeit und Endlichkeit dachte. Weil sie unserem Zeitalter und unserem Wissen keine privilegierte Position in der sogenannten Geschichte zuordnete; weil sie ihrer Fehlbarkeit bewußt war; weil sie leidenschaftlich war, aber nie zornig. Weil sie sich dafür aussprach sowohl zu handeln wie auch etwas zu schaffen, für die persönliche wie für die politische Freiheit; weil ihre Philosophie freundlich und einladend ist - nie hat sie jemanden aus der Kommunikation ausgeschlossen. Weil sie keine Universalistin im banausenhaften Sinne war - sie trat für vielschichtige Identitäten ein; aber sie war auch nicht die banausenhafte Verteidigerin des Unterschieds - sie behandelte die Männer als geliebte Mitgeschöpfe. Weil sie keine Angst hatte, Fehler zu machen; weil sie - zu Recht oder zu Unrecht - übertrieb; weil sie unsere Zeiten als finster erkannte, aber sich nie im Grand Hotel Abgrund einrichtete. Weil sie sich zwar manchmal von falschen Illusionen hinreißen ließ, aber sich nie hohlen Hoffnungen hingab.
Weil in ihr Denken das Leben die Sache selbst war, die einzige Sache einer philosophischen Reflexion würdig; nicht das Leben der Lebensphilosophie oder von Bergson, nicht das Erlebnis, nicht einmal das Leben von Nietzsche, sondern nur das ganz normale Leben, wie wir es alle führen, das Leben unserer Vorfahren und Zeitgenossen, wo nichts zu Ende geht, wo die Dinge nicht ordentlich zusammenstimmen; nichts als das chaotische, formlose vita activa und vita contemplativa, die unser Leben ausmachen. Wegen ihrer Liebe zur Gebürtlichkeit, der Freude daran, in diese Welt einzutauchen und wieder von vorne anzufangen.
Denn wenn wir uns an Arendt halten, können wir nicht nur dem Lehrer, sondern auch den Mitschülern widersprechen. Was wir hier alle, heute und morgen, tun werden. Vielen Dank, liebe Freunde, für Eure warmen Worte. Es ist Zeit, weil es immer die rechte Zeit ist, für uns alle zu beginnen.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz