
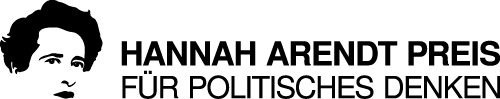

Christian Teichmann ist Osteuropahistoriker und am Institut für Geschichtswissenschaften der HumboldtUniversität Berlin.2015: Wurde kein Preis verliehen. „Welt in Scherben. Menschenrechte, Religion und politisches Denken heute“ war stattdessen der Titel der Konferenz anlässlich 20 Jahre Hannah Arendt Preis für politisches Denken am 4. Dezember 2015 ab 14:00 in der Obere Rathaushalle Bremen.
Meine Damen und Herren
in fast allen Ländern der westlichen Welt erfahren wir gegenwärtig eine tektonische Verschiebung der politischen Landschaften: Volksparteien verlieren ihre Stammwähler. Nationalistischer Populismus keimt auf. Das Repräsentationsprinzip wird in Frage gestellt. Ansprüche auf plebiszitäre Herrschaft werden via Wahlzettel und digitalem Shitstorm geltend gemacht. Der Souverän manifestiert sich sichtbar und unsichtbar, im digitalen Netz und auf der Straße als Generalkritiker der parlamentarischen Ordnung, das er „System“ nennt. Ein Typus von Politiker kommt auf, der sich als Rächer der Beleidigten geriert. Anführer dieser Art bedienen sich einer totalitären Sprache, die mit simplen Klischees arbeitet und Ressentiments schürt: gegen die Elite, gegen Fremde und Flüchtlinge, gegen parlamentarische Verfahrensweisen, gegen rechtsstaatliche Prinzipien. Noch ist nicht abzusehen, ob die Volksparteien in der Lage sind, sich zu regenerieren – und gleichzeitig genügend Standhaftigkeit beweisen, um eine harte Streitkultur zu bestehen, die uns in den nächsten Jahren begleiten wird.
Diese Gemengelage hat scheinbar nichts mit dem Thema unserer diesjährigen Preisverleihung zu tun. Und doch gibt es subkutane Verbindungen. Der diesjährige Preisträger greift ein Thema auf, das so alt ist wie das zwanzigste Jahrhundert: die totale Herrschaft, ihre inneren Strukturen und Dynamiken. Er führt an Beispielen aus der sowjetischen Geschichte in Zentralasien vor, wie die Funktionäre der Partei- und Regierungszentrale in Moskau unter dem Banner der Parole „Verwirklichung des neuen Menschen und der neuen Gesellschaft“ eine Spur der Vernichtung legen, indem sie alle Formen der Selbstorganisation des politischen Willens wie auch der Vergemeinschaftung aus Erfahrung auf unabsehbare Zeit zerstören und die betroffenen sozialen Gruppen der Vernichtung durch Hungertod oder Massenerschießungen preisgeben.
Eine der wichtigen Fragen, die sich aus Teichmanns Studie ergeben, ist die nach den Nachwirkungen dieser Geschichte, die einmalig war und zugleich ihre Schatten auf die Nachwelt wirft. Es geht im Nachklang auch um neue Erscheinungsformen des Totalitären. Und die gehen eben nicht nur auf das Wirken des Nationalsozialismus und des Faschismus zurück, wie manche glauben machen wollen, sondern auch auf die Praxis und die Ideologie des sowjetischen Kommunismus. Beide haben Wurzeln in den sozialen und technologischen Ideologien des 19. Jahrhunderts. Und beide leuchten immer wieder auf.
Geschichte wiederholt sich nicht, bemerkte Karl Marx bissig in „Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte“. Anders als von Hegel behauptet, vollziehe sie sich vielmehr einmal als Tragödie und kehre das andere Mal als Farce zurück. Das sporadische Aufleben totalitärer Elemente in westlichen Demokratien könnte man als Farce bezeichnen, wenn nicht die Gefahr bestünde, daß man dann nicht ernst genug nähme, dass demokratische Gesellschaften nicht nur freiheitlich agieren, sondern auch über die Fähigkeit der Selbstzerstörung verfügen. Die Kenntnis der ideologisch begründeten Zerstörung der pluralen Welt durch die verschiedenen Typen der totalen Herrschaft trägt dazu bei, totalitäre Elemente der Gegenwart als Gespenster ihrer Urform zu erkennen.
Auf diesen einen Punkt möchte ich hier verweisen und gebe jetzt an Karol Sauerland weiter, der stellvertretend für die internationale Jury die Preisvergabe begründet.
Sehr geehrter Herr Teichmann, sehr geehrte Damen und Herren,
es freut mich Sie im Namen des Senates zur Verleihung des diesjährigen Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken im Bremer Rathaus begrüßen zu dürfen.
Der Hannah-Arendt-Preis wird seit über 20 Jahren verliehen. Das Ziel der Preisgründerinnen und Gründer war es, Hannah Arendt einen gebührenden Platz in der öffentlichen Wahrnehmung zu sichern. Dieses Ziel ist sicherlich erreicht worden.
Der Preis soll im Sinn des Wirkens von Hannah Arendt Menschen auszeichnen. Ihre pointierte Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus und Ihr Streiten für „die Sache der Freiheit gegen das Unheil der Zwangsherrschaft jeglicher Art“ liefern die Leitlinien für die Preisvergabe. Hannah Arendt sah in diesem Streiten das Wesen von Politik. Ein Wesen der Politik, das in den heutigen Tagen besonders gefordert ist.
Der Jury ist es gelungen mit Herrn Teichmann einen würdigen Preisträger auszuwählen. Mit seinem Werk Macht der Unordnung – Stalins Herrschaft in Zentralasien 1920 – 1950 zeigt er auf, dass das Wirken der sowjetischen Staatsführung keineswegs eine Erfolgsgeschichte war. Bewässerung, Infrastruktur und Staatsbildung sind allerdings erst einmal positiv konnotiert und lassen uns frei nach Monty Python an den Ausspruch denken: „Was haben uns die Russen jemals gebracht, außer …?“
Doch Herr Teichmann schaut genauer hin, nimmt die Widersprüche in den Blick und erweitert die Analysekategorien. Statt Ordnung zu schaffen, sei der Prozess der Staatswerdung und der Herrschaftsausübung durch Unordnung geprägt. Als Anschauungsobjekt dient ihm der Wasserbau als Instrument der Modernisierungsstrategie. Hieran wird aber auch deutlich, welche fatalen Konsequenzen willkürliche Entscheidungen aus Moskau und repressive Maßnahmen insbesondere der Geheimdienst hat. Unsicherheit vernichtet persönliche Initiative und technisches Wissen der Bevölkerung.
Herr Teichmann verbindet mit Hannah Arendt eine Auseinandersetzung mit einem totalitären Regime. Dennoch kommt er in Bezug auf die Herrschaft Stalins zu gänzlich anderen Schlussfolgerungen. Hannah Arendt sah den Terror in solchen Regimen durch Ideologie begründet und damit nicht durch willkürliche Entscheidungen eines Führers. Dies treffe aber auf Stalin nicht zu, argumentiert der Preisträger des heutigen Abends, bei dessen Herrschaft Unordnung ein zentrales Element war.
Diese These steht bewusst im Widerspruch zu einer weitverbreiteten Lesart, dass die Sowjetunion durch Modernisierung, Bürokratisierung und Militarisierung zu einem modernen Staat geworden sei.
Die Unordnung als Instrument der Durchsetzung von Macht liefert einen Erklärungsansatz, warum nicht nur die Baumwollproduktion ihre Ziele nicht erreicht. Sondern auch die Modernisierung scheiterte und politische Stabilität nicht eintrat. Und auch nicht eintreten sollte.
Als Konsequenz hält Herr Teichmann fest, dass Ergebnisse nicht vorhersehbar, Prozesse nicht planbar und Gesellschaften nicht formbar sind.
So trivial diese Aussage beim ersten Lesen dieser Aussage wirkt, so wirkungsvoll ist Aussage bei der Betrachtung der aktuellen Weltpolitik. Das Buch ist damit nicht nur eine lesenswerte Geschichtsstudie, sondern liefert viel Anlass für Diskussion für hier und heute.
In diesem Sinne gratuliere ich dem Preisträger und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Preisträger Christian Teichmann, liebe Jury, lieber Laudator, verehrte Gäste,
ich freue mich sehr für die Heinrich Böll Stiftung ein paar Sätze zu Ihnen sprechen zu dürfen. Wir sind dem Hannah Arendt – Preis, der hier in Bremen vergeben wird, sehr verbunden und beteiligen uns gerne am Preisgeld. Hannah Arendt steht wie kaum eine andere für ein öffentliches politisches Nachdenken und Sprechen jenseits von hermetischem Fachjargon und anbiedernder Politikberatung. Sie war im besten Sinne eine „Öffentliche Intellektuelle“. Dieser Typus ist heute mehr gefragt als seit langer Zeit – und kaum noch zu finden. Der Wunsch nach „Public Intellectuals“, also nach Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die eine Sprache finden, die es uns überhaupt ermöglicht, öffentlich gemeinsam zu sprechen, ist wahrscheinlich eine der großen Preisfragen unserer Zeit.
Das gilt umso mehr für ein poltisch-intellektuelles Nachdenken mit historischem Resonanzraum. Und auch deshalb gilt mein herzlicher Dank dem Preisträger Christian Teichmann, der mit seinem Buch Macht der Unordnung nicht weniger als einen neuen Ansatz der Interpretation totalitärer Systeme vorgelegt hat. Für ihn ist die Geschichte der sowjetischen Herrschaft in Mittelasien unter Stalin nicht die Geschichte des Aufbaus einer neuen Machtordnung, sondern eine der permanenten Zerschlagung und Verunsicherung von Ordnung.
Geschichte wiederholt sich nicht einfach – und ist dennoch für die Reflexion auf Gegenwart und Zukunft unverzichtbar. Warum ist die Teichmannsche Frage für die heutigen Gesellschaften so interessant? Unsere Welt fühlt sich an vielen Stellen an, als sei etwas aus den Fugen geraten: Der Aufstieg des Populismus, die Herrschaft der Autokraten – und zugleich ein gewisses „Ohnmachtsgefühl“ gegenüber den globalen Entwicklungen von der Klimakrise bis zur Krise der Finanzmärkte. Auch Hannah Arendt sprach bereits von der Gefahr der „Niemandsherrschaft“ in der Moderne – aus der sich die Bedeutung der Demokratie besser verstehen lässt, gerade im Kampf gegen die autoritären, anti-modernistischen Versuchungen. Bei Politik geht es immer um Transformation, um die Gestaltung von Veränderungsprozessen. Die Welt steht nie still. Und deshalb können wir auch nur dann die Dinge bewahren, die uns wichtig sind, wenn wir den Mut zur Veränderung aufbringen.
Politik, die glaubt, sie könnte Sicherheit dadurch herstellen, dass einfach alles so bleibt, wie es ist, oder dass möglicherweise sogar alles früher viel besser war, verfehlt ihre Aufgabe. Umso mehr ist die Frage: Wie gelingt es eigentlich, neue Sicherheit für die Menschen durch Wandel herzustellen? Und wie gelingt es gleichzeitig, den Wandel in Sicherheit zu gestalten, das sind zwei entscheidende Fragen – nicht nur in totalitären Systemen.
Unsere Gesellschaft steht – wie viele andere – vor einer umfassenden ökonomischen Transformation in doppelter Hinsicht: Ökologisierung und Digitalisierung. Die Frage, wie sich die Transformationsprozesse entlang der Frage von „Sicherheit und Wandel“ gestalten lassen, ist für die Zukunft – nicht nur – unserer Gesellschaft von allergrößter Bedeutung.
Wie bereits gesagt: Geschichte wiederholt sich nicht einfach. Aber Geschichte bietet Anlass, noch einmal neu über Dinge nachzudenken. Diesen Anlass sollten wir in stürmischen Zeiten dringend wahrnehmen – auch wenn der Engel der Geschichte ja leider mit dem Rücken zur Zukunft fliegt, wie uns Walter Benjamin gelehrt hat.
Dazu hat der diesjährige Preisträger Christian Teichmann einen wichtigen Beitrag geleistet. Ihm gilt mein herzlicher Dank.
Der Bremer Hannah-Arendt-Preis wird für Neuansätze im politischen Denken verliehen. Die Jury fand, dass Sie, Herr Teichmann, mit Ihrem Buch Macht der Unordnung – Stalins Herrschaft in Zentralasien 1920 –1950 einen solchen Neuansatz vermittelt haben. Sie verweisen auf ein einmaliges Phänomen, nämlich darauf, dass nicht die Ordnung, wie allgemein – insbesondere in der Totalitarismusforschung – angenommen, für die Machtentfaltung und Machterhaltung unentbehrlich ist, sondern deren Zerstörung und die Schaffung von Unordnung, noch dazu in gigantischem Ausmaß. Das war der beste Weg, „die Vergangenheit“ zu begraben und, um Lenin zu zitieren, eine Wiedergeburt des Alten zu verunmöglichen. Im weiteren Verlauf der Sowjetgeschichte ging es dann nur noch um Macht, um deren Ausbau und Fortbestand. Einen besonders schwachen Punkt für das Sowjetregime stellte der zentralasiatische Raum dar, den sich die verschiedensten Bevölkerungsgruppen teilten. „Es gab dort weder Nationen noch Klassen“, wie Sie, Herr Teichmann, ausführen, „weder standardisierte Schriftsprachen noch eine allgemein verbindliche Lebensweise. Selbst das Band des Islam wirkte weniger vereinheitlichend, als man annehmen konnte, weil trotz sunnitischer Dominanz unterschiedlicher Auslegung, Riten und Glaubenspraktiken oft unverbunden nebeneinander existierten. Was das Zusammenleben der Bevölkerungen Zentralasiens verband, war das Ineinander sesshafter und nomadischer Lebensweisen und damit die Symbiose zwischen iranischen und türkischen Lebenswelten, die sich wirtschaftlich ergänzten und ökonomisch aufeinander angewiesen waren“. Diese jahrhundertlang währende Symbiose musste zerschlagen werden. Es gelang durch ein Riesenbewässerungsprogramm, dessen Misserfolge eine Voraussetzung für die Sowjetherrschaft waren. „Unordnung wurde zum wichtigsten Instrument der Herrschaftssicherung“, obwohl oder weil sie die Herrschaftsausübung zugleich „unterminierte und destabilisierte“. Es müsse daher gefragt werden, „wie staatliche Herrschaft funktioniert, wenn sie an der ‚Stabilität der Lebensverhältnisse keinen Gefallen‘ findet und sich ‚in der unablässigen Terrorisierung der Bevölkerung, in der Zerstörung der Ordnung‘ gefällt“. Sie gehen dieser Frage nach, zwar konzentrieren Sie sich auf den zentralasiatischen Raum und überschreiten den von Ihnen gesetzten Zeitrahmen zwischen 1920 und 1950 kaum, aber die Art, wie Sie die Geschehnisse überaus erzählerisch und höchst differenziert darstellen – Ihr Buch liest sich fast wie ein Roman, wie alle Jurymitglieder betonten –, wirkt auf den politisch Denkenden in vielfacher Hinsicht inspirierend. Sie bemängeln im letzten Satz Ihres Buches zu Recht, dass die jeweiligen Probleme und scheinbaren Unverständlichkeiten stets zu sehr zu Gunsten von Erfolgsgeschichten der Modernisierung und Bürokratisierung „eingeebnet“ werden. Die Forscher, konstatieren Sie, ich würde es auf Intellektuelle, Journalisten und Politiker insgesamt ausdehnen, machen sich wenig aus der „Tatsache, dass Ergebnisse nicht vorhersehbar, Prozesse nicht planbar und Gesellschaften nicht formbar sind“. Daraus ergibt sich der Schluss, vieles von dem heutigen Geschehen würden wir gewiss besser begreifen, wenn wir in der Kategorie der Unordnung ein gewollt-ungewolltes Machtinstrument zu erkennen vermöchten und einen Weg fänden, sie als ein Element politischer Analyse einzusetzen. Das betrifft auch die heutige Zeit. Halten sich einige autoritäre und totalitäre Regime nicht dank der Schaffung von größter Unübersichtlichkeit? Sie wird zugleich als der Weg zu der ersehnten Stabilität hingestellt.
Insgesamt kam die Jury zu dem Schluss, dass Sie durch Ihre Ausführungen eine Korrektur der klassischen Totalitarismustheorien eines Carl Joachim Friedrich oder Zbigniew Brzezinski vorgenommen haben. Gegen deren Überbetonung der Rolle der Ideologie, des Zentralismus und Terrors zur Durchsetzung der neuen Ordnung setzten sie, dass Stalins Herrschaft keineswegs eine „utopische Neuordnung der sozialen Verhältnisse“ anstrebte. Sie war vielmehr der permanente Versuch, Ordnung, Erwartungssicherheit und Zukunftsgewissheit zu verweigern“. Sie, lieber Herr Teichmann, haben es mit einem Wort wie Hannah Arendt verstanden, Einzelbeobachtungen und Verallgemeinerungen miteinander zu verbinden, eine neue Sicht auf Herrschaftsmechanismen aus einem konkreten Einzelfall heraus zu entwickeln.
Wir ehren heute das Buch von Christian Teichmann, das uns alle noch einmal an die schreckliche Geschichte von Stalinismus erinnern lässt. Das passiert heute – in der Zeit, als wir gerade in wenigen Tagen den 25. Jahrestag des Verfalls der Sowjetunion begehen werden.
Das Buch ist reich an faktischem Material und Gedanken und motiviert uns zum Nachdenken.
Es entsteht aber die Frage: In welchem Maße sollen wir die im Buch beschriebenen Ereignisse nicht einfach als Gegenstand von reinem akademischen Interesse betrachten und damit nicht auf der Ebene von „beschreibender Impotenz“ (Peter Handke) bleiben?
Jeder Akt des Denkens, jede öffentliche Besprechung beginnen nie ex nihilio und müssen sich im ‚hier‘ und ‚jetzt‘ unseres heutigen Daseins verwurzeln. Das passiert oft unbewusst. Wir plädieren in diesem Fall den neutralen, objektiven Standpunkt zu vertreten, und vergessen dabei die bekannte Formulierung von H.-G. Gadamer, dass „Vor-Urteile“, etwa, was uns immer beeinflußt, viel mehr als „Urteile“ unser Denken bestimmen.
Wo befinden wir uns jetzt im 21. Jahrhundert? In welchem Maße sind wir wirklich bereit, die notwendigen Schlussfolgerungen aus den tragischen Erfahrungen des vorigen Jahrhunderts zu ziehen?
Viele der Anwesenden erinnern sich noch ganz gut an die Tage, als wir uns, vor 17 Jahren, auf den Anfang des neuen Jahrhunderts vorbereiteten. Diesmal war er auch mit dem Beginn des neuen Millenium zusammengefallen. Die Hoffnung war verbreitet, das wir im 21. Jahrhundert endlich die schrecklichen Ereignisse der vorigen Geschichte hinter uns lassen und die Welt in eine neue Phase ihrer Entwicklung eingetreten ist. Es schien, dass wir für eine solche Stimmung mehr als genug Gründe hatten.
Hinter uns lagen zwei monströse Regime der totalitären Natur – nationalsozialistische und stalinistische, die die Vernichtung von mehreren Millionen von menschlichen Leben gefordert haben: vorbei war die Zeit des Kalten Krieges, die ständig mit der Bedrohung der Kernwaffenkatastrophe für die ganze Menschheit verbunden war; die Widervereinigung von Deutschland und die Befreiung von Osteuropa von fremder Dominierung hat stattgefunden; die Welt erlebte das Ende der Herrschaft des Kolonialismus; und endlich der Zusammenbruch der Sowjetunion.
Wir sehen jetzt, wie naiv wir in unseren Erwartungen waren. Ein Versuch aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts unsre Realität zu begreifen, bedeutet, dass wir nochmals die Art des Denkens gegenüber der Herausforderungen der heutigen Welt in Frage stellen können.
Die Ereignisse von September 2001 in New York, wirtschaftliche und finanzielle Krise von 2007 –2008, Schwierigkeiten bei der Demokratisierung von Afghanistan, Irak oder Libyen, wirtschaftliche Krise in Griechenland, letzte Terrorattacke in Belgien, Frankreich, Bundesrepublik und der Zuwachs der Welle von Flüchtlingen; die Verbreitung von rechtsradikalen Stimmungen in Europa; Brexit, Trump … die kommenden Wahlen in Frankreich, das Referendum am 4. Dezember in Italien … Immer wieder erscheinen uns alle diese Ereignisse als etwas völlig Unerwartetes.
Das Buch, das wir heute besprechen, ist ein Teil der schrecklichen Geschichte, die wir manchmal gern als Ereignisse einer bereits verabschiedeten Vergangenheit betrachten möchten.
Wir stehen nun zugleich vor der Aufgabe, die Versuchung eines distanzierten akademischen Kommentierens zu vermeiden und bezüglich den Verbrechen des Stalinismus die Art und Weise der Analyse anzuwenden, die Hannah Arendt vorwiegend am Beispiel des Nationalsozialismus unternommen hat, und die für unsere Gegenwart aktuell bleiben kann.
Es ist bekannt, dass sie in keinem Fall das Wesen des Totalitarismus als etwas völlig Außerordentliches betrachtet hat. Auf die Frage „wie solche Dinge möglich sind“, antwortet Arendt 1953: „das Heraufkommen der totalitären Regierungen“ ist „das Hauptereignis in unserer Welt“ (Understanding and Politics, 1953. S. 377)
Sie meint, dass gegenüber der einmaligen Schrecklichkeiten des Totalitarismus wir plötzlich „die Tatsache entdecken, dass wir unsere Instrumente für das Verstehen verloren haben“ (S. 383). Das bedeutet aber, dass wir es mit einem Phänomen zu tun haben, das sich dem Begreifen zu entziehen scheint.
Die Übel des Totalitarismus „haben unsere Kategorien des politischen Denkens und unsere Maßstäbe für das moralische Urteil eindeutig gesprengt“ (S. 379). Das bedeutet, dass wir für das, was uns oft als unerwartet erscheint, die allgemeinen Regeln des Denkens nicht mehr besitzen.
Es geht damit um das Anwachsen der Sinnlosigkeit im 20. Jahrhundert und um die Abwesenheit des Vermögens des Denkens, auf das wir uns gewöhnlich verlassen, um uns in der Welt zu orientieren. Arendt warnte uns vor der Gefahr der Zeit, „wenn die Tradition ihre lebendige Zeit verloren hat, wenn die Begriffe abgenutzt und die Kategorien platt geworden sind“.
Bereits mit dem 19. Jahrhundert gingen, ihrer Meinung nach, die Antworten auf die moralischen und politischen Fragen unserer Zeit aus: „Die Quellen, aus denen solche Antworten natürlicherweise hätten sprudeln sollen, waren ausgetrocknet. Den ganzen Rahmen, in dem Verstehen und Urteilen entstehen konnten, gibt es nicht mehr“.
Das bedeutet, dass wir im Schatten einer großen Katastrophe leben und denken, und deshalb müssen wir entsprechend der Herausforderungen unserer Zeit, traditionelle Denkschemata in Frage stellen. Was bedeutet überhaupt etwas zu begreifen, wenn unsere Denkkategorien und Urteilsmaßstäbe zerstört sind?
Die entscheidende Frage: was „heißt den Totalitarismus verstehen?“ heute, im 21. Jahrhundert, bedeutet gar nicht, dass wir noch einmal die schrecklichen geschichtlichen Ereignisse nur beschreiben.
Postsowjetische, poststalinsche Realität und alles, was sich jetzt in diesem Raum abspielt, gibt mehr als genug Gründe, besorgt zu sein. Das Problem ist aber, dass wir mit einer großen Verspätung auf alles das reagieren und ignorieren dabei die Konsequenzen von Entwicklungen, die in dem Buch von Christian Teichmann so beindruckend geschildert sind und die zugleich zerstörerisch nicht nur für das Bewusstsein der Bevölkerung von Zentralasien waren.
Ich komme aus Belarus, einem Land, von dem einmal, am Beginn der 90er-Jahre hier im Westen, auch in der Bundesrepublik, positive Entwicklungen in die Überwindung des totalitären Erbes erwartet hatten. Wo befinden wir uns jetzt, nach 25 Jahren? Den „Fall Belarus“ konnte man als ein typologisches Beispiel betrachten, wie schief alles laufen kann, wenn man von Beginn an auf der Grundlage von Wunschdenken handelt. Sind wir heute wirklich bereit auf die Herausforderungen unserer Zeit entsprechend zu reagieren?
Die Rolle von Intellektuellen
In 1942, während der schrecklichen Ereignisse des zweiten Weltkrieges, schreibt Ortega y Gasset: „Das ganze Buch konnte man über das Thema „Von der Verantwortung und Unverantwortungslosigkeit der Philosophie schreiben“. Diese Frage aber ist für ihn zugleich ein Teil von einem mehr allgemeinen Thema „Gedanken über die intellektuelle Verantwortung“. Es ist offensichtlich, dass die Radikalität dieser Formulierung nur aus dem Kontext der Dramatik der Zeit zu verstehen ist, in der diese Zeilen geschrieben sind.
Wir sind hier mit dem Problem konfrontiert, dass in keinem Fall seine Aktualität für unsere Zeit verliert.
In seinen Bemühungen die Rolle von Intellektuellen für die Gesellschaft zu definieren, bemerkt Ortega, dass man oft diese Figur mit einem bestimmtem Beruf, etwa Schriftsteller, Wissenschaftler, Pädagoge, Journalist usw. verwechselt, die nur eine spezifische professionelle Funktion in der Gesellschaft ausüben.
„Die meisten Intellektuellen“ – schreibt er –, die sich in unseren Gesellschaftsordnungen herumtreiben, sind natürlich keine Intellektuellen, sondern spielen sich als solche auf; mitunter leben sie auch ganz korrekt und versehen mit Redlichkeit und nicht geringem Nutzen das Amt, auf das sie eingeschworen sind, füllen den „Posten, den sie einnehmen“ aus“. Als Resultat „ist die Welt voll von Intellektuellen ohne Intelligenz“. Die Gefahr, die von heutigen Intellektuellen ausgeht, ist, dem Denken Ortega‘s entsprechend, „eine Kultur der Ideen zu schaffen“. Wenn früher diese Ideen „hauptsächlich die Ideen von Dingen, von Gefühlen, von Normen, Unternehmungen, Göttern“ waren, sind sie jetzt „Ideen von Ideen“ geworden. Die Kultur der letzten Jahrhunderte „ist in steigendem Maße intellektualistisch gewesen“. Wir sind mit Ideen vollgestopft und zugleich unfähig, sie handzuhaben und zu beherrschen. Die Meinungen, die sich aus diesen Ideen herausbilden, sind für erfolgreiche Handlungen nicht geeignet. Der Gegenteil ist eher das Faktum: „Wenn dem Anderen eine Idee kommt, verwandelt sie sich ins Gegenteil, in ein Dogma“.
Ortegas Forderung an die Intellektuellen zu einem Rückzug von den Höhen der Gesellschaft, zu einer Besinnung auf sich selbst, scheint heute kaum irgendwelche bedeutende Resonanz zu finden. Aber besonders bedrohlich ist diese Situation dort, wo im Laufe der Jahrzehnte dauernden Zeit der Herrschaft der totalitären Ideologie selbst die Wurzeln der möglichen geistigen Erneuerung zerstört worden waren. Als Resultat dominieren im postsowjetischen Raum heftige Auseinandersetzungen, emotionale Polemik, gegenseitige Beschuldigungen. Es gibt keine Bereitschaft, selbstkritisch den eigenen Zustand einzuschätzen. Das alles erschwert die mögliche und notwendige Konsolidierung von kaum vorhandenen Kräften angesichts der wachsenden Enttäuschung über die Misserfolge von nicht sehr professionell durchgeführten Reformen.
Die negativen Konsequenzen, die damit verbunden sind, ist das Faktum, dass das Denken, oder was Hannah Arendt eher „Urteilskraft“ nennen möchte, einfach mit einer abstrakten Phraseologie ersetzt ist. Genau auf die Abwesenheit dieser Urteilskraft im Sinne Kants, die als „Dummheit“, ein „Gebrechen“, dem nicht aufzuhelfen ist, hat Arendt hingewiesen. Sie meint dabei, das „sie sich nicht nur auf unsere Schwierigkeiten beim Verstehen des Totalitarismus“ beschränkt. Das Paradoxon der modernen Situation scheint zu sein, so Arendt, dass wir unsere Instrumente des Verstehens verloren haben. Unsere Suche nach Sinn wird durch unsere Unfähigkeit, Sinn zu erzeugen, zugleich angetrieben und vereitelt. Kants Definition der Dummheit ist keinesfalls unzutreffend. Seit dem Beginn dieses Jahrhunderts ist das Wachstum von Sinnlosigkeit eine Begleiterscheinung des Verlustes an gesundem Menschenverstand gewesen … und die Dummheit hat zugenommen.
Damit entsteht eine bestimmte Tendenz, die besondere Gefahren für eine Politik bringt, die sich zu oft mit einem Gerede begnügt, das leider nichts mit der faktischen Realität zu tun hat. Durch dieses „phrasenhafte Denken“ schaffen wir einen Kosmos von imaginären Wirklichkeiten (Pseudowirklichkeiten), so Ortega, denen keine tatsächliche reale Welt entspricht. Es beherrscht unsere Vision und Handlungen, macht unsere Welt sehr bequem für uns. Es stimuliert eine bestimmte Haltung des Utopismus bezüglich der Realität und befreit sie „von allen Dunkelheiten, Rätseln und Überraschungen“.
Besonders gefährliche Konsequenzen bringt dieses phrasenhafte Denken in der gegenwärtigen Situation der Globalisierung. Im Bereich der Politik führt solcher Schwarm normativer Phrasen zur Versuchung, die akuten Probleme des gesellschaftlichen Lebens durch klischeehafte Handlungen zu lösen.
Ortega’s Forderung für die Intellektuellen, zu einem Rückzug von den Höhen des Reflektierens zu einer Besinnung auf sich selbst zu kommen, scheint heute kaum irgendwelche bedeutende Resonanz zu finden. Die Frage bleibt immer noch offen, ob wir diese „theoretische Haltung“ (vita contemplativa) gegenüber den Herausforderungen der gegenwärtigen Welt in unsere „vita activa“ verwandeln können. Das ist nur eine von vielen Konsequenzen, vor der wir alle nach dem Lesen des Buches stehen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
lange habe ich darüber nachgedacht, was ich Ihnen am heutigen Abend am besten erzählen sollte. Dazu habe ich die Bücher von Hannah Arendt gewälzt. Ich habe die aktuelle Forschungsliteratur gelesen. Ich habe mich gefragt, wer heute wie mit den Schriften und Gedanken von Hannah Arendt umgeht. Ich habe mich gefragt, was politisches Denken und Öffentlichkeit in der heutigen Zeit sind und was sie sein könnten. Was sagen uns Hannah Arendts Gedanken heute? Wie sprechen uns ihre Texte über Diktatur und totalitäre Herrschaft an? Lange habe ich mich mit diesen Themen beschäftigt, um über viele Umwege am Ende zur eigentlich offensichtlichsten Schlussfolgerung zu kommen: Ihnen heute Abend etwas über die Macht der Unordnung zu erzählen.
Erlauben Sie mir also – ich bin ja Historiker – mit einer Geschichte zu beginnen: Im Sommer 1931 machte sich der Journalist Egon Erwin Kisch zu seiner zweiten großen Reise in die Sowjetunion auf. Sein Ziel lag diesmal nicht im russischen Kernland der Sowjetunion, den er schon 1926 besucht hatte, sondern in Zentralasien, dem sowjetischen Orient. Er flog von Moskau nach Taschkent, besuchte Samarkand und Buchara und gelangte schließlich ins südliche Tadschikistan an die sowjetisch-afghanische Grenze.
Die Reise des erfolgreichen Journalisten im Jahr 1931 war ebenso sorgfältig von den sowjetischen Behörden vorbereitet worden, wie alle Reisen von ausländischen Besuchern in Stalins Sowjetunion. Deshalb sah Kisch saubere Hotelzimmer, er aß gut und reichlich, absolvierte eine genau durchgeplante Reiseroute und traf handverlesene Gesprächspartner in inszenierten Gesprächssituationen. Kisch, ein wunderbar leichtfüßiger Schreiber und überzeugter Kommunist, lebte auf in der fiktiven Wirklichkeit der sowjetischen Propaganda. Man müsse, schrieb er seiner Leserschaft ins Stammbuch „die Zeitungen der Sowjetunion lesen“, die „voll von ökonomischen Kriegsberichten“ seien.
Kisch nahm für sich in Anspruch, als Augenzeuge der Veränderungen in Stalins Sowjetunion authentisch darüber berichten zu können. Er lobte die Kollektivierung der Landwirtschaft, verteidigte die seit Beginn der dreißiger Jahre in der Sowjetunion weitverbreitete Zwangsarbeit und traf, als er in der zentralasiatischen Sowjetrepublik Usbekistan Baumwoll-Kolchosen besichtigte, keine desillusionierten und hungernden Bauern, sondern „begeisterte“ und „fröhlich“ arbeitende Menschen. Er berichtete, wie er in seinem Buch Asien gründlich verändert schrieb, über die „tausendundeinen wahren Geschichten“ aus dem sowjetischen Zentralasien.
Am Ende von Kischs Reiseroute stand die Besichtigung eines der erstaunlichsten Projekte, die Stalins erster Fünfjahrplan hervorbringen sollte: der Bau eines neuen Bewässerungssystems im südlichen Tadschikistan unmittelbar an der sowjetisch-afghanischen Grenze. In einem von der Außenwelt völlig isolierten Tal am Fluss Wachsch, einem Zulauf des Amu Daria, sollte durch Bewässerung ein riesiges neues Baumwollanbaugebiet von 100 Tausend Hektar Größe entstehen.
Die Dimension des Unterfangens versetzten sogar den hartgesottenen Weltbürger Kisch in Erstaunen. Es gab noch nicht einmal Straßen, geschweige denn Eisenbahnlinien oder Schiffsverbindungen, als er das Wachsch-Tal am Fuß des Pamir-Gebirges besuchte. Das Tal, in dem ein mächtiges Stauwerk gebaut und große Bewässerungskanäle gegraben werden sollten, war 1931 eine dünn besiedelte Wildnis mit extrem kontinentalem Klima, mit Sandstürmen im Sommer und Schneemassen im Winter. „Aus einer jahrtausendelang ausgedörrten Steinwüste einen Baumwollgarten zu machen“ hielt selbst Kisch für eine „Phantasmagorie“.
Was zwischen 1930 und 1950 am Fluss Wachsch geschah, fängt all die unterschiedlichen Elemente von Macht und Ohnmacht ein, die typisch für Stalins Herrschaft in der Sowjetunion waren. Darum lohnt es sich, diesen trostlosen Ort etwas eingehender zu besichtigen. Denn er zeigt etwas auf über den sowjetischen Versuch, durch die Veränderung der Natur eine Veränderung der Gesellschaft herbeizuführen. Zudem demonstriert er den engen Zusammenhang Vortrag Christian Teichmann 9 zwischen Herrschaftsbildung und der Gewinnung von Industrierohstoffen – im Fall Zentralasiens von Baumwolle, in anderen Fällen und anderen Teilen der Sowjetunion von Kohle, Gold, Holz oder Rohöl. Und drittens zeigt er, wie Stalins Herrschaft im Chaos florierte und wie es möglich wurde, aus Unordnung immer neue Machtchancen zu gewinnen.
Seit 1931 zählte das neue Bewässerungssystem am Fluss Wachsch zu den 150 Großbaustellen des Ersten Fünfjahrplans. Damit war es ebenso wichtig wie die Moskauer Metro oder das vielgerühmte Stahlwerk von Magnitogorsk. Wie alle großen Bauprojekte dieser Jahre begannen die Arbeiten ohne ausreichende Erkundung des Geländes, ohne genaue Baupläne und ohne erfahrene Ingenieure. Darum wurden die schwierigen Arbeiten beim Schleusenbau und am Kanalnetz immer wieder von schweren Unfällen und todbringenden Überschwemmungen des Baugeländes unterbrochen. Hinzu kamen das extreme Klima, die unzureichende Nahrungsmittelversorgung und epidemische Krankheiten.
Selbst der Direktor der Bauunternehmung, ein Vorbildkommunist, verglich die sozialistische Großbaustelle 1932 mit einem Zwangsarbeitslager, wo „Straftäter“, „Schwindler“ und „Sünder“ zur „Arbeit auf Bewährung“ landeten. Die „besonders ungünstigen klimatischen Bedingungen“, berichtete er, erforderten eine „heroische Kraftanstrengung“. Aber zu dieser Kraftanstrengung seien nur die wenigsten Arbeiter im Tal bereit, denn „gutwillige und geeignete Leute“ seien am Wachsch „absolute Einzelfälle“. „Eine kleine Gruppe von Aktivisten“ nehme die „ganze Bürde der Arbeit allein auf sich“ und nur sie arbeitete, wie der Baudirektor wortwörtlich schrieb, „nicht aus Angst, sondern aus Überzeugung“.
Als das Bewässerungswerk im Oktober 1933 in Betrieb ging, erwies es sich als fatale Fehlplanung. Das Stauwerk war eine Fehlkonstruktion und nicht in der Lage, die Wasserversorgung für das Bewässerungssystem zu gewährleisten. Die Kanalanlagen waren übergroß dimensioniert. Daher wechselten sich Wassermangel und Überschwemmungen durch die reißenden Fluten des Gebirgsflusses Wachsch regelmäßig ab.
Der Kanalbau führte zudem zu schwerwiegenden ökologischen Veränderungen im Tal. Einerseits sorgte ein steigender Grundwasserspiegel dafür, dass anstatt von Baumwollfeldern Sumpflandschaften und Moraste entstanden. Andererseits führte der unkontrollierte Zustrom von Wasser zur Versalzung und Austrocknung der Böden. Drittens unterspülte das Grundwasser die Böden und untergrub damit ihre innere Stabilität. Plötzliche Absenkungen und metertiefe Bodeneinbrüche gehörten zum Alltag des Tals und seiner Bewohner. Der Boden verschlang Maschinen, Tiere und Menschen auf Nimmerwiedersehen. Ein Zeitzeuge erinnerte sich folgendermaßen: „Da steht einer auf dem Feld und schaut, ob die Baumwolle ordentlich gewässert wird, und plötzlich ist er verschwunden“. Und schließlich sorgte ein Erdbeben 1935 dafür, dass der Fluss seinen Lauf veränderte und sein Flussbett die Schleuse nicht mehr erreichte. Mit großem Aufwand mussten Auffangkonstruktionen errichtet werden, um das vorbeifließende Wasser in das Bewässerungssystem einzuleiten.
Mit derselben Unbarmherzigkeit, mit der die kollabierenden Böden Talbewohner verschlangen, handelten auch die sowjetischen Staatsvertreter. Mit dem Beginn des Bauprojekts im Wachsch-Tal setzen Bemühungen zur Ansiedlung einer Kolonistenbevölkerung in der Grenzregion ein. Schon 1929 waren 50 Tausend Menschen in das Tal zwangsumgesiedelt worden, aber nach den bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen während der Kollektivierung fehlte 1931 von diesen Menschen jede Spur. Schwierig war es auch, Arbeitskräfte für das Bewässerungsbauwerk zu gewinnen. Die schlechten Lebensbedingungen, Hunger, Hitze, Kälte und gefährliche Krankheiten (vor allem Malaria und Sandmückenfieber) sorgten dafür, dass die Arbeiter das Tal ebenso schnell wieder verließen wie die Ingenieure, Baudirektoren und Parteifunktionäre, die dorthin abgeordnet wurden.
Darum blieben alle Besiedlungsmaßnahmen bis Mitte der 1930er erfolglos. Das musste auch das Politbüro-Mitglied Walerian Kuibyschew feststellen, der im Herbst 1934 das Wachsch-Tal besuchte. Den zuständigen staatlichen Stellen gelang es weder, genügend Arbeitskräfte anzuwerben, noch eine permanente Siedlerbevölkerung anzusiedeln. Im März 1935 berieten Stalin und die Mitglieder des Moskauer Politbüros, welche Maßnahmen zur Kolonisation im Wachsch-Tal ergriffen werden sollten. Der Besiedlung des Tals wurde von nun an von höchster Stelle absolute Priorität eingeräumt.
Die Tragödie, die aus diesem Umstand folgte, trug unverkennbar Stalins Handschrift. Die Moskauer Staatsführung informierte die Regierung Tadschikistans, dass ein „Spezialkontingent“ von 2000 Lagerhäftlingen und sogenannten „Sonderumsiedler“ zusammengestellt und in das Wachsch-Tal deportiert werden würde.
In Tadschikistan traf diese Entscheidung alle Beteiligten völlig überraschend. Eilig bildete die dortige Regierung eine Sonderkommission. Die Kommission stellte sich die Aufgabe, die „Sonderumsiedler“, die binnen Monatsfrist eintreffen sollten, mit dem Nötigsten zu versorgen: Bauholz, Brennholz, Lebensmitteln, Kühen, Pferden, Eimern, Tassen und Waschtischen. Dann stellte aber sich heraus, dass das „Spezialkontingent“ von Häftlingen nicht wie angekündigt 2000 Personen umfassen würde, sondern die Geheimpolizei NKWD wesentlich mehr Menschen auf den Weg in das Wachsch-Tal geschickt hatte. Zwischen Anfang April und Mitte Mai 1935 trafen 4900 Deportierte ein. Das Kontingent dieser „Kolonisten“ war bunt gemischt. Es umfasste 315 deutschstämmige Mennoniten, 758 Häftlinge aus den Arbeitslagern und 3822 „Sonderumsiedler“ aus Leningrad, die dort in Straßenrazzien gefangen genommen und kurzerhand ans andere Ende der Sowjetunion deportiert wurden.
Die „Sonderumsiedler“ aus Russland wurden nach ihrer Ankunft im Tal auf verschiedenen Landabschnitten entlang der Bewässerungskanäle verteilt, lebten in Baracken, Zelten und Erdhütten und standen unter der Aufsicht von Geheimdienst-Kommandanturen. Zeitzeugen berichteten in ihren Erinnerungen, dass die neuen Siedlungen am Rand von bestehenden Oasen entstanden, Oasen, die „wie eine Insel in einem unendlichen Schilfmeer“ lagen und nichts zu bieten hatten als Sümpfe und wüstes Land ringsum. Häufig mangelte es nicht nur an Essbarem, sondern auch an Trinkwasser.
Nach ihrer Ankunft säten die Zwangsumgesiedelten, wie es der Plan gebot, Baumwolle aus, wo es sich gerade anbot. Nur eine kleine Minderheit der neuen Talbewohner wusste überhaupt etwas über den Anbau von Baumwolle. Deshalb sorgte selbst die Parteiorganisation Tadschikistans dafür, dass die wirtschaftliche Diversifizierung und die kommunale Arbeitsteilung in den Umsiedler-Kolchosen schnellstmöglich voranschritten. Wer eine handwerkliche Qualifikation hatte, konnte als Arbeiter auf der Kanalbaustelle tätig werden. Einigen Umsiedlern wurde erlaubt, Fischerei-Kolchosen zu bilden. Andere begannen, sich als freie Händler auf den lokalen Märkten zu betätigen. Jede und jeder musste versuchen, schnellstmöglich eine ökonomische Nische zu finden, um sich und seine Familie irgendwie ernähren zu können: Baumwolle kann man nicht essen. Im Herbst 1935 war klar, dass die Umsiedler den bevorstehenden Winter ohne Nahrungsmittelhilfe aus Moskau nicht überstehen würden. Vom Ziel, mehr Baumwolle anzubauen, sprach inzwischen niemand mehr.
Stalin persönlich verfolgte den Fortschritt der Besiedlung des Wachsch-Tals minutiös. Anfang Februar 1936 erkundigte er sich, ob sein Befehl, eintausend Familien aus Usbekistan nach Tadschikistan zwangsumzusiedeln, schon erfüllt worden sei. „Berichten Sie uns, wie Sie für die Ausführung unseres Beschlusses sorgen“, telegraphierte er in seinem typischen lakonischen Stil aus dem Kreml.
Innerhalb dreier Jahre kamen ungefähr 12 Tausend Umsiedlerfamilien in das Tal, konservativ gerechnet knapp 50 Tausend Menschen. Ein Großteil dieser Familien stammte aus Zentralasien, aber mindestens ein Drittel kam aus russischen Großstädten wie Leningrad. Gegenüber den aus Zentralasien stammenden Zwangsumsiedlern stellten die vom NKWD deportierten „Sonderumsiedler“ eine besonders schwere Belastung für die fragile Ökonomie und die instabile Versorgungslage des Wachsch-Tals dar. Mehr als ein Drittel der Talbewohner waren völlig unerfahren mit der Arbeit in der Baumwollwirtschaft und unvertraut mit den harschen Lebensbedingungen in der Region.
Seitens der tadschikischen Behörden wurde getan, was möglich war, um die Menschen wirtschaftlich auf eigene Füße zu stellen, damit sie sich irgendwie selbst versorgen konnten. Sie sollten Gärten anlegen, Getreide anbauen und Nahrungsmittel für den Eigenbedarf erzeugen. Der Baumwollanbau geriet immer weiter in den Hintergrund.
Je mehr „Sonderumsiedler“ in das Tal gelangten, desto gewichtiger wurde die Rolle der Geheimpolizei als Wirtschaftsmacht am Wachsch. Angesichts mangelnder finanzieller Ressourcen, einer dünnen Personaldecke, des fortwährenden Kompetenzchaos und der offensichtlich fehlgeleiteten Besiedlungspolitik Moskaus, übertrug die tadschikische Regierung es schließlich den Geheimdienstmitarbeitern des NKWD im Wachsch-Tal, für die „Sonderumsiedler“ aus Russland Sorge zu tragen. Die Geheimdienstleute sollten nicht nur für die Unterbringung, Verpflegung und medizinische Versorgung der Umsiedler verantwortlich sein, sondern auch für deren Bereitstellung von Arbeitskräften zur Landvermessung und zur Erfüllung von Bewässerungsarbeiten.
Auf diese Weise konnte sich der tadschikische Staatsapparat von schwierigen und unerfreulichen Problemen befreien. Dies geschah aus gutem Grund. Trotz der grauenhaften Lebensbedingungen und der schlimmen wirtschaftlichen Lage drängten Stalin und mit ihm die Moskauer Geheimdienstzentrale in der Ljubinka auf weitere Deportationen. Dabei war die Lage im Tal für weite Teile der Bevölkerung prekär. Das galt nicht nur für die „Sonderumsiedler“, über die die Geheimpolizei das Regiment führte. Es galt auch für Umsiedlerfamilien aus Zentralasien. Die Bilanz war ernüchternd, wie man einem Bericht vom Sommer 1937 entnehmen kann: „Weil das Projekt am Wachsch über riesige materielle Summen verfügte, hätte man gute Lebensbedingungen, einen gesunden Finanzhaushalt und eine Transportinfrastruktur schaffen können. Unterdessen gibt es bis zum heutigen Tag nichts davon: Die Krankenhäuser und die Schulen sind zusammengebrochen. Wir haben weder Schulen noch Krankenhäuser! Und die Infrastruktur steht in Ruinen.“
Doch die Deportation immer neuer Menschen hielt unvermindert an. Selbst im Frühjahr 1945, als die Rote Armee Berlin eroberte und in Tadschikistan eine schwere Hungersnot herrschte, kamen tausende Neudeportierte in das Tal. Das Ende der gewaltsamen Umsiedlungsaktionen kam erst mit Stalins Tod im Jahr 1953.
Man könnte das Bewässerungsprojekt am Wachsch als typisch für das Scheitern von Großprojekten als Form staatlicher Entwicklungspolitik halten, wie man es aus allen Regionen der Welt kennt. Keines der wirtschaftlichen Ziele, das bei Baubeginn verkündet worden war, konnte umgesetzt werden. Die Bewässerungsanlagen funktionierten nicht, von einem weißen Baumwollgarten war nichts zu sehen und die zwangsweise angesiedelte Bevölkerung hatte schwer damit zu tun, sich das Nötigste für ihren Lebensunterhalt zu beschaffen. Selbst die Wirtschaftstätigkeit der Geheimpolizei konnte an diesem Zustand nichts ändern und schon gar nicht die örtlichen Parteiorganisationen und lokalen Regierungsstellen. Allein: Diese Einschätzung würde dem Kern der stalinistischen Herrschaftsausübung nicht gerecht werden.
Denn ein Ziel war am Wachsch erreicht worden: einen Landstrich in eine Sumpflandschaft zu verwandeln, in der sich Menschen aufhalten mussten, die fernab ihrer Heimat verarmt und entwurzelt lebten. Möglicherweise hatten diese Menschen für ein besseres Leben im Sozialismus gekämpft und hatten dafür viele Opfer auf sich genommen. Aber was von ihrer Erfahrung blieb, war das alltägliche Erleben eines brutalen, feindseligen und böswilligen Staats. In den Händen der Bolschewiki sollte der Staat eine unerbittliche Disziplinierungsmaschine sein, die widerspenstige Gesellschaften und feindliche Naturräume unterwarf. So hatte es Lenin vorausgesehen und so behauptete es Stalin in seinen Parteitagsreden.
In der Praxis blieb die sowjetische Staatsmaschine störanfällig und unzuverlässig. Fortwährend klagten die Führer über fehlenden Gehorsam, mangelnde Disziplin und ungebrochene Widerstände. Manchmal schien es den bolschewistischen Revolutionären, als sei ihr Staat wie ein Holzschiff im Packeis gestrandet. Um diesen Zustand zu verändern, war den Bolschewiki jedes Mittel recht. Unordnung diente ihnen als Mittel, um aus dem Chaos heraus politische Macht zu manifestieren. Unordnung schaffen hatte aus ihrer Sicht das Ziel, traditionelle soziale und politische Strukturen zu vernichten, um die sowjetische Herrschaft als einzigen Sanktionsmechanismus durchzusetzen.
Die Macht der Unordnung konnte sich dabei gegen die eigenen Adepten und Vollstrecker richten. Parteimitglieder und Regierungsmitarbeiter gerieten ebenso unter die Räder wie die einfache Landbevölkerung und die Arbeiterschaft. Paradoxerweise kannte die Herrschaftsausübung in der Stalinära nach außen und nach innen keine Routine, die feste Verfahrensweisen, anerkannte Normen und Regeln schuf: Die sowjetische Herrschaftsroutine kennzeichnete die Machtausübung durch gezielt inszenierte und instrumentelle Unordnung. Darum war der sowjetische Parteistaat eine Welt der Gegensätze – gleichzeitig stark und schwach, durchdringend und oberflächlich, ordnungsbesessen und chaotisch.
Viele Historikerinnen und Historiker, die über die sowjetische Geschichte geforscht und geschrieben haben, würden mit dieser Lesart der Ereignisse übereinstimmen: den Stalinismus als eine Gewaltherrschaft, die nicht auf Legitimität, sondern auf Gehorsam abzielte zu verstehen, deren stärkster Motor unumschränkter Terror und dessen Rückgrat Massendeportationen und Arbeitslager waren. Diese Lesart teilte auch Hannah Arendt.
Auf der anderen Seite gibt es eine andere, unter Historikerinnen und Historikern ebenso stark vertretene, fast gegensätzliche Lesart des Stalinismus. Aller Verwerfungen der Stalinzeit zum Trotz behauptet sie, dass die revolutionären Veränderungen in der Sowjetunion ein legitimes Unterfangen gewesen wären, die Partizipation und Entwicklung nicht nur versprachen, sondern auch in die Tat umsetzten. Diese Forschungsrichtung beschreibt den Stalinismus als Teil eines globalen Modernisierungsprozesses, dessen Ausdruck auch in der Sowjetunion Urbanisierung und Industrialisierung, Bürokratisierung und die Entstehung einer medienvermittelten Massenkultur gewesen wären. Häufig geraten dabei Terror und Unordnung in die Fußnoten im Anmerkungsteil. Von manchen Historikerinnen und Historikern werden sie sogar als populäre, quasi-demokratische Prozesse verstanden, mit denen sich die Bevölkerung der Sowjetunion von ihren angeblich tatsächlich vorhandenen inneren „Feinden“ befreite.
Auch wenn diese, durchaus verbissen geführte, Diskussion auf die sogenannte Fachöffentlichkeit beschränkt bleibt, so hat sie doch eine größere politische Dimension, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Denn wie man über die sowjetische Geschichte urteilt, bestimmt, in welches Verhältnis man Stalinismus und Sozialismus zueinander stellt. Es bestimmt, wie man die Möglichkeiten und Grenzen von Diktaturen beurteilt – zwar immer mit Blick auf die Vergangenheit, aber immer auch mit einem Auge auf die Gegenwart. Es bestimmt nicht zuletzt, wie man aufgrund der historischen Erfahrung der Sowjetunion die gegenwärtige politische Situation in Russland einschätzt.
Die sowjetische Geschichte hat es also, genauer betrachtet, auch in unserer Gegenwart ziemlich in sich. Dabei geht es, abstrakter gesagt, um eine historische Tiefenbestimmung von Gegenwärtigkeit. Historikerinnen und Historiker vermitteln in ihrem Schreiben immer ein bestimmtes Bild der Gegenwart. Manche tun dies eher unbewusst und manche sehr bewusst. Auch wenn sie sich hinter Quellen, Fußnoten und Archivsiglen verschanzen, handeln sie – im Idealfall – von den Geschehnissen, Erfahrungen und Verwerfungen in der Vergangenheit mit dem Ziel, die unendliche Variationsbreite und damit die der Welt innewohnende Pluralität zu vergegenwärtigen und immer wieder neu zu beleben. Dabei können Historikerinnen und Historiker die Schriften und Gedanken von Hannah Arendt immer wieder neu inspirieren.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, dass ein Buch über Stalins Herrschaft in Zentralasien, dessen Gegenstand so fernab unserer hiesigen Erfahrungswelt liegt, mit dem Hannah-ArendtPreis ausgezeichnet wurde, freut mich über alle Maßen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken: Zuerst bei den Preisstiftern, der Heinrich Böll Stiftung und der Hansestadt Bremen. Dann bei der Jury, die auf ein Buch, das zunächst für ein Fachpublikum geschrieben wurde, aufmerksam geworden ist, es gelobt und prämiert hat. Dann bei der Hamburger Edition, deren Verlagsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter aus einem unordentlichen Manuskript ein schönes und lesbares Buch gemacht haben. Dank gilt meinen Berliner Kolleginnen und Kollegen, die mir zeigten, dass gute Wissenschaft nie im stillen Kämmerlein gemacht wird, sondern immer ein kollektives Unterfangen ist und sein muss. Und schließlich möchte ich mich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass Sie heute, auch wenn es anderes zu tun gegeben hätte, zusammen mit mir diese Feierstunde begehen!
Christian Teichmann ist Osteuropahistoriker und am Institut für Geschichtswissenschaften der HumboldtUniversität Berlin.2015: Wurde kein Preis verliehen. „Welt in Scherben. Menschenrechte, Religion und politisches Denken heute“ war stattdessen der Titel der Konferenz anlässlich 20 Jahre Hannah Arendt Preis für politisches Denken am 4. Dezember 2015 ab 14:00 in der Obere Rathaushalle Bremen.
Meine Damen und Herren
in fast allen Ländern der westlichen Welt erfahren wir gegenwärtig eine tektonische Verschiebung der politischen Landschaften: Volksparteien verlieren ihre Stammwähler. Nationalistischer Populismus keimt auf. Das Repräsentationsprinzip wird in Frage gestellt. Ansprüche auf plebiszitäre Herrschaft werden via Wahlzettel und digitalem Shitstorm geltend gemacht. Der Souverän manifestiert sich sichtbar und unsichtbar, im digitalen Netz und auf der Straße als Generalkritiker der parlamentarischen Ordnung, das er „System“ nennt. Ein Typus von Politiker kommt auf, der sich als Rächer der Beleidigten geriert. Anführer dieser Art bedienen sich einer totalitären Sprache, die mit simplen Klischees arbeitet und Ressentiments schürt: gegen die Elite, gegen Fremde und Flüchtlinge, gegen parlamentarische Verfahrensweisen, gegen rechtsstaatliche Prinzipien. Noch ist nicht abzusehen, ob die Volksparteien in der Lage sind, sich zu regenerieren – und gleichzeitig genügend Standhaftigkeit beweisen, um eine harte Streitkultur zu bestehen, die uns in den nächsten Jahren begleiten wird.
Diese Gemengelage hat scheinbar nichts mit dem Thema unserer diesjährigen Preisverleihung zu tun. Und doch gibt es subkutane Verbindungen. Der diesjährige Preisträger greift ein Thema auf, das so alt ist wie das zwanzigste Jahrhundert: die totale Herrschaft, ihre inneren Strukturen und Dynamiken. Er führt an Beispielen aus der sowjetischen Geschichte in Zentralasien vor, wie die Funktionäre der Partei- und Regierungszentrale in Moskau unter dem Banner der Parole „Verwirklichung des neuen Menschen und der neuen Gesellschaft“ eine Spur der Vernichtung legen, indem sie alle Formen der Selbstorganisation des politischen Willens wie auch der Vergemeinschaftung aus Erfahrung auf unabsehbare Zeit zerstören und die betroffenen sozialen Gruppen der Vernichtung durch Hungertod oder Massenerschießungen preisgeben.
Eine der wichtigen Fragen, die sich aus Teichmanns Studie ergeben, ist die nach den Nachwirkungen dieser Geschichte, die einmalig war und zugleich ihre Schatten auf die Nachwelt wirft. Es geht im Nachklang auch um neue Erscheinungsformen des Totalitären. Und die gehen eben nicht nur auf das Wirken des Nationalsozialismus und des Faschismus zurück, wie manche glauben machen wollen, sondern auch auf die Praxis und die Ideologie des sowjetischen Kommunismus. Beide haben Wurzeln in den sozialen und technologischen Ideologien des 19. Jahrhunderts. Und beide leuchten immer wieder auf.
Geschichte wiederholt sich nicht, bemerkte Karl Marx bissig in „Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte“. Anders als von Hegel behauptet, vollziehe sie sich vielmehr einmal als Tragödie und kehre das andere Mal als Farce zurück. Das sporadische Aufleben totalitärer Elemente in westlichen Demokratien könnte man als Farce bezeichnen, wenn nicht die Gefahr bestünde, daß man dann nicht ernst genug nähme, dass demokratische Gesellschaften nicht nur freiheitlich agieren, sondern auch über die Fähigkeit der Selbstzerstörung verfügen. Die Kenntnis der ideologisch begründeten Zerstörung der pluralen Welt durch die verschiedenen Typen der totalen Herrschaft trägt dazu bei, totalitäre Elemente der Gegenwart als Gespenster ihrer Urform zu erkennen.
Auf diesen einen Punkt möchte ich hier verweisen und gebe jetzt an Karol Sauerland weiter, der stellvertretend für die internationale Jury die Preisvergabe begründet.
Sehr geehrter Herr Teichmann, sehr geehrte Damen und Herren,
es freut mich Sie im Namen des Senates zur Verleihung des diesjährigen Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken im Bremer Rathaus begrüßen zu dürfen.
Der Hannah-Arendt-Preis wird seit über 20 Jahren verliehen. Das Ziel der Preisgründerinnen und Gründer war es, Hannah Arendt einen gebührenden Platz in der öffentlichen Wahrnehmung zu sichern. Dieses Ziel ist sicherlich erreicht worden.
Der Preis soll im Sinn des Wirkens von Hannah Arendt Menschen auszeichnen. Ihre pointierte Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus und Ihr Streiten für „die Sache der Freiheit gegen das Unheil der Zwangsherrschaft jeglicher Art“ liefern die Leitlinien für die Preisvergabe. Hannah Arendt sah in diesem Streiten das Wesen von Politik. Ein Wesen der Politik, das in den heutigen Tagen besonders gefordert ist.
Der Jury ist es gelungen mit Herrn Teichmann einen würdigen Preisträger auszuwählen. Mit seinem Werk Macht der Unordnung – Stalins Herrschaft in Zentralasien 1920 – 1950 zeigt er auf, dass das Wirken der sowjetischen Staatsführung keineswegs eine Erfolgsgeschichte war. Bewässerung, Infrastruktur und Staatsbildung sind allerdings erst einmal positiv konnotiert und lassen uns frei nach Monty Python an den Ausspruch denken: „Was haben uns die Russen jemals gebracht, außer …?“
Doch Herr Teichmann schaut genauer hin, nimmt die Widersprüche in den Blick und erweitert die Analysekategorien. Statt Ordnung zu schaffen, sei der Prozess der Staatswerdung und der Herrschaftsausübung durch Unordnung geprägt. Als Anschauungsobjekt dient ihm der Wasserbau als Instrument der Modernisierungsstrategie. Hieran wird aber auch deutlich, welche fatalen Konsequenzen willkürliche Entscheidungen aus Moskau und repressive Maßnahmen insbesondere der Geheimdienst hat. Unsicherheit vernichtet persönliche Initiative und technisches Wissen der Bevölkerung.
Herr Teichmann verbindet mit Hannah Arendt eine Auseinandersetzung mit einem totalitären Regime. Dennoch kommt er in Bezug auf die Herrschaft Stalins zu gänzlich anderen Schlussfolgerungen. Hannah Arendt sah den Terror in solchen Regimen durch Ideologie begründet und damit nicht durch willkürliche Entscheidungen eines Führers. Dies treffe aber auf Stalin nicht zu, argumentiert der Preisträger des heutigen Abends, bei dessen Herrschaft Unordnung ein zentrales Element war.
Diese These steht bewusst im Widerspruch zu einer weitverbreiteten Lesart, dass die Sowjetunion durch Modernisierung, Bürokratisierung und Militarisierung zu einem modernen Staat geworden sei.
Die Unordnung als Instrument der Durchsetzung von Macht liefert einen Erklärungsansatz, warum nicht nur die Baumwollproduktion ihre Ziele nicht erreicht. Sondern auch die Modernisierung scheiterte und politische Stabilität nicht eintrat. Und auch nicht eintreten sollte.
Als Konsequenz hält Herr Teichmann fest, dass Ergebnisse nicht vorhersehbar, Prozesse nicht planbar und Gesellschaften nicht formbar sind.
So trivial diese Aussage beim ersten Lesen dieser Aussage wirkt, so wirkungsvoll ist Aussage bei der Betrachtung der aktuellen Weltpolitik. Das Buch ist damit nicht nur eine lesenswerte Geschichtsstudie, sondern liefert viel Anlass für Diskussion für hier und heute.
In diesem Sinne gratuliere ich dem Preisträger und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Preisträger Christian Teichmann, liebe Jury, lieber Laudator, verehrte Gäste,
ich freue mich sehr für die Heinrich Böll Stiftung ein paar Sätze zu Ihnen sprechen zu dürfen. Wir sind dem Hannah Arendt – Preis, der hier in Bremen vergeben wird, sehr verbunden und beteiligen uns gerne am Preisgeld. Hannah Arendt steht wie kaum eine andere für ein öffentliches politisches Nachdenken und Sprechen jenseits von hermetischem Fachjargon und anbiedernder Politikberatung. Sie war im besten Sinne eine „Öffentliche Intellektuelle“. Dieser Typus ist heute mehr gefragt als seit langer Zeit – und kaum noch zu finden. Der Wunsch nach „Public Intellectuals“, also nach Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die eine Sprache finden, die es uns überhaupt ermöglicht, öffentlich gemeinsam zu sprechen, ist wahrscheinlich eine der großen Preisfragen unserer Zeit.
Das gilt umso mehr für ein poltisch-intellektuelles Nachdenken mit historischem Resonanzraum. Und auch deshalb gilt mein herzlicher Dank dem Preisträger Christian Teichmann, der mit seinem Buch Macht der Unordnung nicht weniger als einen neuen Ansatz der Interpretation totalitärer Systeme vorgelegt hat. Für ihn ist die Geschichte der sowjetischen Herrschaft in Mittelasien unter Stalin nicht die Geschichte des Aufbaus einer neuen Machtordnung, sondern eine der permanenten Zerschlagung und Verunsicherung von Ordnung.
Geschichte wiederholt sich nicht einfach – und ist dennoch für die Reflexion auf Gegenwart und Zukunft unverzichtbar. Warum ist die Teichmannsche Frage für die heutigen Gesellschaften so interessant? Unsere Welt fühlt sich an vielen Stellen an, als sei etwas aus den Fugen geraten: Der Aufstieg des Populismus, die Herrschaft der Autokraten – und zugleich ein gewisses „Ohnmachtsgefühl“ gegenüber den globalen Entwicklungen von der Klimakrise bis zur Krise der Finanzmärkte. Auch Hannah Arendt sprach bereits von der Gefahr der „Niemandsherrschaft“ in der Moderne – aus der sich die Bedeutung der Demokratie besser verstehen lässt, gerade im Kampf gegen die autoritären, anti-modernistischen Versuchungen. Bei Politik geht es immer um Transformation, um die Gestaltung von Veränderungsprozessen. Die Welt steht nie still. Und deshalb können wir auch nur dann die Dinge bewahren, die uns wichtig sind, wenn wir den Mut zur Veränderung aufbringen.
Politik, die glaubt, sie könnte Sicherheit dadurch herstellen, dass einfach alles so bleibt, wie es ist, oder dass möglicherweise sogar alles früher viel besser war, verfehlt ihre Aufgabe. Umso mehr ist die Frage: Wie gelingt es eigentlich, neue Sicherheit für die Menschen durch Wandel herzustellen? Und wie gelingt es gleichzeitig, den Wandel in Sicherheit zu gestalten, das sind zwei entscheidende Fragen – nicht nur in totalitären Systemen.
Unsere Gesellschaft steht – wie viele andere – vor einer umfassenden ökonomischen Transformation in doppelter Hinsicht: Ökologisierung und Digitalisierung. Die Frage, wie sich die Transformationsprozesse entlang der Frage von „Sicherheit und Wandel“ gestalten lassen, ist für die Zukunft – nicht nur – unserer Gesellschaft von allergrößter Bedeutung.
Wie bereits gesagt: Geschichte wiederholt sich nicht einfach. Aber Geschichte bietet Anlass, noch einmal neu über Dinge nachzudenken. Diesen Anlass sollten wir in stürmischen Zeiten dringend wahrnehmen – auch wenn der Engel der Geschichte ja leider mit dem Rücken zur Zukunft fliegt, wie uns Walter Benjamin gelehrt hat.
Dazu hat der diesjährige Preisträger Christian Teichmann einen wichtigen Beitrag geleistet. Ihm gilt mein herzlicher Dank.
Der Bremer Hannah-Arendt-Preis wird für Neuansätze im politischen Denken verliehen. Die Jury fand, dass Sie, Herr Teichmann, mit Ihrem Buch Macht der Unordnung – Stalins Herrschaft in Zentralasien 1920 –1950 einen solchen Neuansatz vermittelt haben. Sie verweisen auf ein einmaliges Phänomen, nämlich darauf, dass nicht die Ordnung, wie allgemein – insbesondere in der Totalitarismusforschung – angenommen, für die Machtentfaltung und Machterhaltung unentbehrlich ist, sondern deren Zerstörung und die Schaffung von Unordnung, noch dazu in gigantischem Ausmaß. Das war der beste Weg, „die Vergangenheit“ zu begraben und, um Lenin zu zitieren, eine Wiedergeburt des Alten zu verunmöglichen. Im weiteren Verlauf der Sowjetgeschichte ging es dann nur noch um Macht, um deren Ausbau und Fortbestand. Einen besonders schwachen Punkt für das Sowjetregime stellte der zentralasiatische Raum dar, den sich die verschiedensten Bevölkerungsgruppen teilten. „Es gab dort weder Nationen noch Klassen“, wie Sie, Herr Teichmann, ausführen, „weder standardisierte Schriftsprachen noch eine allgemein verbindliche Lebensweise. Selbst das Band des Islam wirkte weniger vereinheitlichend, als man annehmen konnte, weil trotz sunnitischer Dominanz unterschiedlicher Auslegung, Riten und Glaubenspraktiken oft unverbunden nebeneinander existierten. Was das Zusammenleben der Bevölkerungen Zentralasiens verband, war das Ineinander sesshafter und nomadischer Lebensweisen und damit die Symbiose zwischen iranischen und türkischen Lebenswelten, die sich wirtschaftlich ergänzten und ökonomisch aufeinander angewiesen waren“. Diese jahrhundertlang währende Symbiose musste zerschlagen werden. Es gelang durch ein Riesenbewässerungsprogramm, dessen Misserfolge eine Voraussetzung für die Sowjetherrschaft waren. „Unordnung wurde zum wichtigsten Instrument der Herrschaftssicherung“, obwohl oder weil sie die Herrschaftsausübung zugleich „unterminierte und destabilisierte“. Es müsse daher gefragt werden, „wie staatliche Herrschaft funktioniert, wenn sie an der ‚Stabilität der Lebensverhältnisse keinen Gefallen‘ findet und sich ‚in der unablässigen Terrorisierung der Bevölkerung, in der Zerstörung der Ordnung‘ gefällt“. Sie gehen dieser Frage nach, zwar konzentrieren Sie sich auf den zentralasiatischen Raum und überschreiten den von Ihnen gesetzten Zeitrahmen zwischen 1920 und 1950 kaum, aber die Art, wie Sie die Geschehnisse überaus erzählerisch und höchst differenziert darstellen – Ihr Buch liest sich fast wie ein Roman, wie alle Jurymitglieder betonten –, wirkt auf den politisch Denkenden in vielfacher Hinsicht inspirierend. Sie bemängeln im letzten Satz Ihres Buches zu Recht, dass die jeweiligen Probleme und scheinbaren Unverständlichkeiten stets zu sehr zu Gunsten von Erfolgsgeschichten der Modernisierung und Bürokratisierung „eingeebnet“ werden. Die Forscher, konstatieren Sie, ich würde es auf Intellektuelle, Journalisten und Politiker insgesamt ausdehnen, machen sich wenig aus der „Tatsache, dass Ergebnisse nicht vorhersehbar, Prozesse nicht planbar und Gesellschaften nicht formbar sind“. Daraus ergibt sich der Schluss, vieles von dem heutigen Geschehen würden wir gewiss besser begreifen, wenn wir in der Kategorie der Unordnung ein gewollt-ungewolltes Machtinstrument zu erkennen vermöchten und einen Weg fänden, sie als ein Element politischer Analyse einzusetzen. Das betrifft auch die heutige Zeit. Halten sich einige autoritäre und totalitäre Regime nicht dank der Schaffung von größter Unübersichtlichkeit? Sie wird zugleich als der Weg zu der ersehnten Stabilität hingestellt.
Insgesamt kam die Jury zu dem Schluss, dass Sie durch Ihre Ausführungen eine Korrektur der klassischen Totalitarismustheorien eines Carl Joachim Friedrich oder Zbigniew Brzezinski vorgenommen haben. Gegen deren Überbetonung der Rolle der Ideologie, des Zentralismus und Terrors zur Durchsetzung der neuen Ordnung setzten sie, dass Stalins Herrschaft keineswegs eine „utopische Neuordnung der sozialen Verhältnisse“ anstrebte. Sie war vielmehr der permanente Versuch, Ordnung, Erwartungssicherheit und Zukunftsgewissheit zu verweigern“. Sie, lieber Herr Teichmann, haben es mit einem Wort wie Hannah Arendt verstanden, Einzelbeobachtungen und Verallgemeinerungen miteinander zu verbinden, eine neue Sicht auf Herrschaftsmechanismen aus einem konkreten Einzelfall heraus zu entwickeln.
Wir ehren heute das Buch von Christian Teichmann, das uns alle noch einmal an die schreckliche Geschichte von Stalinismus erinnern lässt. Das passiert heute – in der Zeit, als wir gerade in wenigen Tagen den 25. Jahrestag des Verfalls der Sowjetunion begehen werden.
Das Buch ist reich an faktischem Material und Gedanken und motiviert uns zum Nachdenken.
Es entsteht aber die Frage: In welchem Maße sollen wir die im Buch beschriebenen Ereignisse nicht einfach als Gegenstand von reinem akademischen Interesse betrachten und damit nicht auf der Ebene von „beschreibender Impotenz“ (Peter Handke) bleiben?
Jeder Akt des Denkens, jede öffentliche Besprechung beginnen nie ex nihilio und müssen sich im ‚hier‘ und ‚jetzt‘ unseres heutigen Daseins verwurzeln. Das passiert oft unbewusst. Wir plädieren in diesem Fall den neutralen, objektiven Standpunkt zu vertreten, und vergessen dabei die bekannte Formulierung von H.-G. Gadamer, dass „Vor-Urteile“, etwa, was uns immer beeinflußt, viel mehr als „Urteile“ unser Denken bestimmen.
Wo befinden wir uns jetzt im 21. Jahrhundert? In welchem Maße sind wir wirklich bereit, die notwendigen Schlussfolgerungen aus den tragischen Erfahrungen des vorigen Jahrhunderts zu ziehen?
Viele der Anwesenden erinnern sich noch ganz gut an die Tage, als wir uns, vor 17 Jahren, auf den Anfang des neuen Jahrhunderts vorbereiteten. Diesmal war er auch mit dem Beginn des neuen Millenium zusammengefallen. Die Hoffnung war verbreitet, das wir im 21. Jahrhundert endlich die schrecklichen Ereignisse der vorigen Geschichte hinter uns lassen und die Welt in eine neue Phase ihrer Entwicklung eingetreten ist. Es schien, dass wir für eine solche Stimmung mehr als genug Gründe hatten.
Hinter uns lagen zwei monströse Regime der totalitären Natur – nationalsozialistische und stalinistische, die die Vernichtung von mehreren Millionen von menschlichen Leben gefordert haben: vorbei war die Zeit des Kalten Krieges, die ständig mit der Bedrohung der Kernwaffenkatastrophe für die ganze Menschheit verbunden war; die Widervereinigung von Deutschland und die Befreiung von Osteuropa von fremder Dominierung hat stattgefunden; die Welt erlebte das Ende der Herrschaft des Kolonialismus; und endlich der Zusammenbruch der Sowjetunion.
Wir sehen jetzt, wie naiv wir in unseren Erwartungen waren. Ein Versuch aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts unsre Realität zu begreifen, bedeutet, dass wir nochmals die Art des Denkens gegenüber der Herausforderungen der heutigen Welt in Frage stellen können.
Die Ereignisse von September 2001 in New York, wirtschaftliche und finanzielle Krise von 2007 –2008, Schwierigkeiten bei der Demokratisierung von Afghanistan, Irak oder Libyen, wirtschaftliche Krise in Griechenland, letzte Terrorattacke in Belgien, Frankreich, Bundesrepublik und der Zuwachs der Welle von Flüchtlingen; die Verbreitung von rechtsradikalen Stimmungen in Europa; Brexit, Trump … die kommenden Wahlen in Frankreich, das Referendum am 4. Dezember in Italien … Immer wieder erscheinen uns alle diese Ereignisse als etwas völlig Unerwartetes.
Das Buch, das wir heute besprechen, ist ein Teil der schrecklichen Geschichte, die wir manchmal gern als Ereignisse einer bereits verabschiedeten Vergangenheit betrachten möchten.
Wir stehen nun zugleich vor der Aufgabe, die Versuchung eines distanzierten akademischen Kommentierens zu vermeiden und bezüglich den Verbrechen des Stalinismus die Art und Weise der Analyse anzuwenden, die Hannah Arendt vorwiegend am Beispiel des Nationalsozialismus unternommen hat, und die für unsere Gegenwart aktuell bleiben kann.
Es ist bekannt, dass sie in keinem Fall das Wesen des Totalitarismus als etwas völlig Außerordentliches betrachtet hat. Auf die Frage „wie solche Dinge möglich sind“, antwortet Arendt 1953: „das Heraufkommen der totalitären Regierungen“ ist „das Hauptereignis in unserer Welt“ (Understanding and Politics, 1953. S. 377)
Sie meint, dass gegenüber der einmaligen Schrecklichkeiten des Totalitarismus wir plötzlich „die Tatsache entdecken, dass wir unsere Instrumente für das Verstehen verloren haben“ (S. 383). Das bedeutet aber, dass wir es mit einem Phänomen zu tun haben, das sich dem Begreifen zu entziehen scheint.
Die Übel des Totalitarismus „haben unsere Kategorien des politischen Denkens und unsere Maßstäbe für das moralische Urteil eindeutig gesprengt“ (S. 379). Das bedeutet, dass wir für das, was uns oft als unerwartet erscheint, die allgemeinen Regeln des Denkens nicht mehr besitzen.
Es geht damit um das Anwachsen der Sinnlosigkeit im 20. Jahrhundert und um die Abwesenheit des Vermögens des Denkens, auf das wir uns gewöhnlich verlassen, um uns in der Welt zu orientieren. Arendt warnte uns vor der Gefahr der Zeit, „wenn die Tradition ihre lebendige Zeit verloren hat, wenn die Begriffe abgenutzt und die Kategorien platt geworden sind“.
Bereits mit dem 19. Jahrhundert gingen, ihrer Meinung nach, die Antworten auf die moralischen und politischen Fragen unserer Zeit aus: „Die Quellen, aus denen solche Antworten natürlicherweise hätten sprudeln sollen, waren ausgetrocknet. Den ganzen Rahmen, in dem Verstehen und Urteilen entstehen konnten, gibt es nicht mehr“.
Das bedeutet, dass wir im Schatten einer großen Katastrophe leben und denken, und deshalb müssen wir entsprechend der Herausforderungen unserer Zeit, traditionelle Denkschemata in Frage stellen. Was bedeutet überhaupt etwas zu begreifen, wenn unsere Denkkategorien und Urteilsmaßstäbe zerstört sind?
Die entscheidende Frage: was „heißt den Totalitarismus verstehen?“ heute, im 21. Jahrhundert, bedeutet gar nicht, dass wir noch einmal die schrecklichen geschichtlichen Ereignisse nur beschreiben.
Postsowjetische, poststalinsche Realität und alles, was sich jetzt in diesem Raum abspielt, gibt mehr als genug Gründe, besorgt zu sein. Das Problem ist aber, dass wir mit einer großen Verspätung auf alles das reagieren und ignorieren dabei die Konsequenzen von Entwicklungen, die in dem Buch von Christian Teichmann so beindruckend geschildert sind und die zugleich zerstörerisch nicht nur für das Bewusstsein der Bevölkerung von Zentralasien waren.
Ich komme aus Belarus, einem Land, von dem einmal, am Beginn der 90er-Jahre hier im Westen, auch in der Bundesrepublik, positive Entwicklungen in die Überwindung des totalitären Erbes erwartet hatten. Wo befinden wir uns jetzt, nach 25 Jahren? Den „Fall Belarus“ konnte man als ein typologisches Beispiel betrachten, wie schief alles laufen kann, wenn man von Beginn an auf der Grundlage von Wunschdenken handelt. Sind wir heute wirklich bereit auf die Herausforderungen unserer Zeit entsprechend zu reagieren?
Die Rolle von Intellektuellen
In 1942, während der schrecklichen Ereignisse des zweiten Weltkrieges, schreibt Ortega y Gasset: „Das ganze Buch konnte man über das Thema „Von der Verantwortung und Unverantwortungslosigkeit der Philosophie schreiben“. Diese Frage aber ist für ihn zugleich ein Teil von einem mehr allgemeinen Thema „Gedanken über die intellektuelle Verantwortung“. Es ist offensichtlich, dass die Radikalität dieser Formulierung nur aus dem Kontext der Dramatik der Zeit zu verstehen ist, in der diese Zeilen geschrieben sind.
Wir sind hier mit dem Problem konfrontiert, dass in keinem Fall seine Aktualität für unsere Zeit verliert.
In seinen Bemühungen die Rolle von Intellektuellen für die Gesellschaft zu definieren, bemerkt Ortega, dass man oft diese Figur mit einem bestimmtem Beruf, etwa Schriftsteller, Wissenschaftler, Pädagoge, Journalist usw. verwechselt, die nur eine spezifische professionelle Funktion in der Gesellschaft ausüben.
„Die meisten Intellektuellen“ – schreibt er –, die sich in unseren Gesellschaftsordnungen herumtreiben, sind natürlich keine Intellektuellen, sondern spielen sich als solche auf; mitunter leben sie auch ganz korrekt und versehen mit Redlichkeit und nicht geringem Nutzen das Amt, auf das sie eingeschworen sind, füllen den „Posten, den sie einnehmen“ aus“. Als Resultat „ist die Welt voll von Intellektuellen ohne Intelligenz“. Die Gefahr, die von heutigen Intellektuellen ausgeht, ist, dem Denken Ortega‘s entsprechend, „eine Kultur der Ideen zu schaffen“. Wenn früher diese Ideen „hauptsächlich die Ideen von Dingen, von Gefühlen, von Normen, Unternehmungen, Göttern“ waren, sind sie jetzt „Ideen von Ideen“ geworden. Die Kultur der letzten Jahrhunderte „ist in steigendem Maße intellektualistisch gewesen“. Wir sind mit Ideen vollgestopft und zugleich unfähig, sie handzuhaben und zu beherrschen. Die Meinungen, die sich aus diesen Ideen herausbilden, sind für erfolgreiche Handlungen nicht geeignet. Der Gegenteil ist eher das Faktum: „Wenn dem Anderen eine Idee kommt, verwandelt sie sich ins Gegenteil, in ein Dogma“.
Ortegas Forderung an die Intellektuellen zu einem Rückzug von den Höhen der Gesellschaft, zu einer Besinnung auf sich selbst, scheint heute kaum irgendwelche bedeutende Resonanz zu finden. Aber besonders bedrohlich ist diese Situation dort, wo im Laufe der Jahrzehnte dauernden Zeit der Herrschaft der totalitären Ideologie selbst die Wurzeln der möglichen geistigen Erneuerung zerstört worden waren. Als Resultat dominieren im postsowjetischen Raum heftige Auseinandersetzungen, emotionale Polemik, gegenseitige Beschuldigungen. Es gibt keine Bereitschaft, selbstkritisch den eigenen Zustand einzuschätzen. Das alles erschwert die mögliche und notwendige Konsolidierung von kaum vorhandenen Kräften angesichts der wachsenden Enttäuschung über die Misserfolge von nicht sehr professionell durchgeführten Reformen.
Die negativen Konsequenzen, die damit verbunden sind, ist das Faktum, dass das Denken, oder was Hannah Arendt eher „Urteilskraft“ nennen möchte, einfach mit einer abstrakten Phraseologie ersetzt ist. Genau auf die Abwesenheit dieser Urteilskraft im Sinne Kants, die als „Dummheit“, ein „Gebrechen“, dem nicht aufzuhelfen ist, hat Arendt hingewiesen. Sie meint dabei, das „sie sich nicht nur auf unsere Schwierigkeiten beim Verstehen des Totalitarismus“ beschränkt. Das Paradoxon der modernen Situation scheint zu sein, so Arendt, dass wir unsere Instrumente des Verstehens verloren haben. Unsere Suche nach Sinn wird durch unsere Unfähigkeit, Sinn zu erzeugen, zugleich angetrieben und vereitelt. Kants Definition der Dummheit ist keinesfalls unzutreffend. Seit dem Beginn dieses Jahrhunderts ist das Wachstum von Sinnlosigkeit eine Begleiterscheinung des Verlustes an gesundem Menschenverstand gewesen … und die Dummheit hat zugenommen.
Damit entsteht eine bestimmte Tendenz, die besondere Gefahren für eine Politik bringt, die sich zu oft mit einem Gerede begnügt, das leider nichts mit der faktischen Realität zu tun hat. Durch dieses „phrasenhafte Denken“ schaffen wir einen Kosmos von imaginären Wirklichkeiten (Pseudowirklichkeiten), so Ortega, denen keine tatsächliche reale Welt entspricht. Es beherrscht unsere Vision und Handlungen, macht unsere Welt sehr bequem für uns. Es stimuliert eine bestimmte Haltung des Utopismus bezüglich der Realität und befreit sie „von allen Dunkelheiten, Rätseln und Überraschungen“.
Besonders gefährliche Konsequenzen bringt dieses phrasenhafte Denken in der gegenwärtigen Situation der Globalisierung. Im Bereich der Politik führt solcher Schwarm normativer Phrasen zur Versuchung, die akuten Probleme des gesellschaftlichen Lebens durch klischeehafte Handlungen zu lösen.
Ortega’s Forderung für die Intellektuellen, zu einem Rückzug von den Höhen des Reflektierens zu einer Besinnung auf sich selbst zu kommen, scheint heute kaum irgendwelche bedeutende Resonanz zu finden. Die Frage bleibt immer noch offen, ob wir diese „theoretische Haltung“ (vita contemplativa) gegenüber den Herausforderungen der gegenwärtigen Welt in unsere „vita activa“ verwandeln können. Das ist nur eine von vielen Konsequenzen, vor der wir alle nach dem Lesen des Buches stehen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
lange habe ich darüber nachgedacht, was ich Ihnen am heutigen Abend am besten erzählen sollte. Dazu habe ich die Bücher von Hannah Arendt gewälzt. Ich habe die aktuelle Forschungsliteratur gelesen. Ich habe mich gefragt, wer heute wie mit den Schriften und Gedanken von Hannah Arendt umgeht. Ich habe mich gefragt, was politisches Denken und Öffentlichkeit in der heutigen Zeit sind und was sie sein könnten. Was sagen uns Hannah Arendts Gedanken heute? Wie sprechen uns ihre Texte über Diktatur und totalitäre Herrschaft an? Lange habe ich mich mit diesen Themen beschäftigt, um über viele Umwege am Ende zur eigentlich offensichtlichsten Schlussfolgerung zu kommen: Ihnen heute Abend etwas über die Macht der Unordnung zu erzählen.
Erlauben Sie mir also – ich bin ja Historiker – mit einer Geschichte zu beginnen: Im Sommer 1931 machte sich der Journalist Egon Erwin Kisch zu seiner zweiten großen Reise in die Sowjetunion auf. Sein Ziel lag diesmal nicht im russischen Kernland der Sowjetunion, den er schon 1926 besucht hatte, sondern in Zentralasien, dem sowjetischen Orient. Er flog von Moskau nach Taschkent, besuchte Samarkand und Buchara und gelangte schließlich ins südliche Tadschikistan an die sowjetisch-afghanische Grenze.
Die Reise des erfolgreichen Journalisten im Jahr 1931 war ebenso sorgfältig von den sowjetischen Behörden vorbereitet worden, wie alle Reisen von ausländischen Besuchern in Stalins Sowjetunion. Deshalb sah Kisch saubere Hotelzimmer, er aß gut und reichlich, absolvierte eine genau durchgeplante Reiseroute und traf handverlesene Gesprächspartner in inszenierten Gesprächssituationen. Kisch, ein wunderbar leichtfüßiger Schreiber und überzeugter Kommunist, lebte auf in der fiktiven Wirklichkeit der sowjetischen Propaganda. Man müsse, schrieb er seiner Leserschaft ins Stammbuch „die Zeitungen der Sowjetunion lesen“, die „voll von ökonomischen Kriegsberichten“ seien.
Kisch nahm für sich in Anspruch, als Augenzeuge der Veränderungen in Stalins Sowjetunion authentisch darüber berichten zu können. Er lobte die Kollektivierung der Landwirtschaft, verteidigte die seit Beginn der dreißiger Jahre in der Sowjetunion weitverbreitete Zwangsarbeit und traf, als er in der zentralasiatischen Sowjetrepublik Usbekistan Baumwoll-Kolchosen besichtigte, keine desillusionierten und hungernden Bauern, sondern „begeisterte“ und „fröhlich“ arbeitende Menschen. Er berichtete, wie er in seinem Buch Asien gründlich verändert schrieb, über die „tausendundeinen wahren Geschichten“ aus dem sowjetischen Zentralasien.
Am Ende von Kischs Reiseroute stand die Besichtigung eines der erstaunlichsten Projekte, die Stalins erster Fünfjahrplan hervorbringen sollte: der Bau eines neuen Bewässerungssystems im südlichen Tadschikistan unmittelbar an der sowjetisch-afghanischen Grenze. In einem von der Außenwelt völlig isolierten Tal am Fluss Wachsch, einem Zulauf des Amu Daria, sollte durch Bewässerung ein riesiges neues Baumwollanbaugebiet von 100 Tausend Hektar Größe entstehen.
Die Dimension des Unterfangens versetzten sogar den hartgesottenen Weltbürger Kisch in Erstaunen. Es gab noch nicht einmal Straßen, geschweige denn Eisenbahnlinien oder Schiffsverbindungen, als er das Wachsch-Tal am Fuß des Pamir-Gebirges besuchte. Das Tal, in dem ein mächtiges Stauwerk gebaut und große Bewässerungskanäle gegraben werden sollten, war 1931 eine dünn besiedelte Wildnis mit extrem kontinentalem Klima, mit Sandstürmen im Sommer und Schneemassen im Winter. „Aus einer jahrtausendelang ausgedörrten Steinwüste einen Baumwollgarten zu machen“ hielt selbst Kisch für eine „Phantasmagorie“.
Was zwischen 1930 und 1950 am Fluss Wachsch geschah, fängt all die unterschiedlichen Elemente von Macht und Ohnmacht ein, die typisch für Stalins Herrschaft in der Sowjetunion waren. Darum lohnt es sich, diesen trostlosen Ort etwas eingehender zu besichtigen. Denn er zeigt etwas auf über den sowjetischen Versuch, durch die Veränderung der Natur eine Veränderung der Gesellschaft herbeizuführen. Zudem demonstriert er den engen Zusammenhang Vortrag Christian Teichmann 9 zwischen Herrschaftsbildung und der Gewinnung von Industrierohstoffen – im Fall Zentralasiens von Baumwolle, in anderen Fällen und anderen Teilen der Sowjetunion von Kohle, Gold, Holz oder Rohöl. Und drittens zeigt er, wie Stalins Herrschaft im Chaos florierte und wie es möglich wurde, aus Unordnung immer neue Machtchancen zu gewinnen.
Seit 1931 zählte das neue Bewässerungssystem am Fluss Wachsch zu den 150 Großbaustellen des Ersten Fünfjahrplans. Damit war es ebenso wichtig wie die Moskauer Metro oder das vielgerühmte Stahlwerk von Magnitogorsk. Wie alle großen Bauprojekte dieser Jahre begannen die Arbeiten ohne ausreichende Erkundung des Geländes, ohne genaue Baupläne und ohne erfahrene Ingenieure. Darum wurden die schwierigen Arbeiten beim Schleusenbau und am Kanalnetz immer wieder von schweren Unfällen und todbringenden Überschwemmungen des Baugeländes unterbrochen. Hinzu kamen das extreme Klima, die unzureichende Nahrungsmittelversorgung und epidemische Krankheiten.
Selbst der Direktor der Bauunternehmung, ein Vorbildkommunist, verglich die sozialistische Großbaustelle 1932 mit einem Zwangsarbeitslager, wo „Straftäter“, „Schwindler“ und „Sünder“ zur „Arbeit auf Bewährung“ landeten. Die „besonders ungünstigen klimatischen Bedingungen“, berichtete er, erforderten eine „heroische Kraftanstrengung“. Aber zu dieser Kraftanstrengung seien nur die wenigsten Arbeiter im Tal bereit, denn „gutwillige und geeignete Leute“ seien am Wachsch „absolute Einzelfälle“. „Eine kleine Gruppe von Aktivisten“ nehme die „ganze Bürde der Arbeit allein auf sich“ und nur sie arbeitete, wie der Baudirektor wortwörtlich schrieb, „nicht aus Angst, sondern aus Überzeugung“.
Als das Bewässerungswerk im Oktober 1933 in Betrieb ging, erwies es sich als fatale Fehlplanung. Das Stauwerk war eine Fehlkonstruktion und nicht in der Lage, die Wasserversorgung für das Bewässerungssystem zu gewährleisten. Die Kanalanlagen waren übergroß dimensioniert. Daher wechselten sich Wassermangel und Überschwemmungen durch die reißenden Fluten des Gebirgsflusses Wachsch regelmäßig ab.
Der Kanalbau führte zudem zu schwerwiegenden ökologischen Veränderungen im Tal. Einerseits sorgte ein steigender Grundwasserspiegel dafür, dass anstatt von Baumwollfeldern Sumpflandschaften und Moraste entstanden. Andererseits führte der unkontrollierte Zustrom von Wasser zur Versalzung und Austrocknung der Böden. Drittens unterspülte das Grundwasser die Böden und untergrub damit ihre innere Stabilität. Plötzliche Absenkungen und metertiefe Bodeneinbrüche gehörten zum Alltag des Tals und seiner Bewohner. Der Boden verschlang Maschinen, Tiere und Menschen auf Nimmerwiedersehen. Ein Zeitzeuge erinnerte sich folgendermaßen: „Da steht einer auf dem Feld und schaut, ob die Baumwolle ordentlich gewässert wird, und plötzlich ist er verschwunden“. Und schließlich sorgte ein Erdbeben 1935 dafür, dass der Fluss seinen Lauf veränderte und sein Flussbett die Schleuse nicht mehr erreichte. Mit großem Aufwand mussten Auffangkonstruktionen errichtet werden, um das vorbeifließende Wasser in das Bewässerungssystem einzuleiten.
Mit derselben Unbarmherzigkeit, mit der die kollabierenden Böden Talbewohner verschlangen, handelten auch die sowjetischen Staatsvertreter. Mit dem Beginn des Bauprojekts im Wachsch-Tal setzen Bemühungen zur Ansiedlung einer Kolonistenbevölkerung in der Grenzregion ein. Schon 1929 waren 50 Tausend Menschen in das Tal zwangsumgesiedelt worden, aber nach den bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen während der Kollektivierung fehlte 1931 von diesen Menschen jede Spur. Schwierig war es auch, Arbeitskräfte für das Bewässerungsbauwerk zu gewinnen. Die schlechten Lebensbedingungen, Hunger, Hitze, Kälte und gefährliche Krankheiten (vor allem Malaria und Sandmückenfieber) sorgten dafür, dass die Arbeiter das Tal ebenso schnell wieder verließen wie die Ingenieure, Baudirektoren und Parteifunktionäre, die dorthin abgeordnet wurden.
Darum blieben alle Besiedlungsmaßnahmen bis Mitte der 1930er erfolglos. Das musste auch das Politbüro-Mitglied Walerian Kuibyschew feststellen, der im Herbst 1934 das Wachsch-Tal besuchte. Den zuständigen staatlichen Stellen gelang es weder, genügend Arbeitskräfte anzuwerben, noch eine permanente Siedlerbevölkerung anzusiedeln. Im März 1935 berieten Stalin und die Mitglieder des Moskauer Politbüros, welche Maßnahmen zur Kolonisation im Wachsch-Tal ergriffen werden sollten. Der Besiedlung des Tals wurde von nun an von höchster Stelle absolute Priorität eingeräumt.
Die Tragödie, die aus diesem Umstand folgte, trug unverkennbar Stalins Handschrift. Die Moskauer Staatsführung informierte die Regierung Tadschikistans, dass ein „Spezialkontingent“ von 2000 Lagerhäftlingen und sogenannten „Sonderumsiedler“ zusammengestellt und in das Wachsch-Tal deportiert werden würde.
In Tadschikistan traf diese Entscheidung alle Beteiligten völlig überraschend. Eilig bildete die dortige Regierung eine Sonderkommission. Die Kommission stellte sich die Aufgabe, die „Sonderumsiedler“, die binnen Monatsfrist eintreffen sollten, mit dem Nötigsten zu versorgen: Bauholz, Brennholz, Lebensmitteln, Kühen, Pferden, Eimern, Tassen und Waschtischen. Dann stellte aber sich heraus, dass das „Spezialkontingent“ von Häftlingen nicht wie angekündigt 2000 Personen umfassen würde, sondern die Geheimpolizei NKWD wesentlich mehr Menschen auf den Weg in das Wachsch-Tal geschickt hatte. Zwischen Anfang April und Mitte Mai 1935 trafen 4900 Deportierte ein. Das Kontingent dieser „Kolonisten“ war bunt gemischt. Es umfasste 315 deutschstämmige Mennoniten, 758 Häftlinge aus den Arbeitslagern und 3822 „Sonderumsiedler“ aus Leningrad, die dort in Straßenrazzien gefangen genommen und kurzerhand ans andere Ende der Sowjetunion deportiert wurden.
Die „Sonderumsiedler“ aus Russland wurden nach ihrer Ankunft im Tal auf verschiedenen Landabschnitten entlang der Bewässerungskanäle verteilt, lebten in Baracken, Zelten und Erdhütten und standen unter der Aufsicht von Geheimdienst-Kommandanturen. Zeitzeugen berichteten in ihren Erinnerungen, dass die neuen Siedlungen am Rand von bestehenden Oasen entstanden, Oasen, die „wie eine Insel in einem unendlichen Schilfmeer“ lagen und nichts zu bieten hatten als Sümpfe und wüstes Land ringsum. Häufig mangelte es nicht nur an Essbarem, sondern auch an Trinkwasser.
Nach ihrer Ankunft säten die Zwangsumgesiedelten, wie es der Plan gebot, Baumwolle aus, wo es sich gerade anbot. Nur eine kleine Minderheit der neuen Talbewohner wusste überhaupt etwas über den Anbau von Baumwolle. Deshalb sorgte selbst die Parteiorganisation Tadschikistans dafür, dass die wirtschaftliche Diversifizierung und die kommunale Arbeitsteilung in den Umsiedler-Kolchosen schnellstmöglich voranschritten. Wer eine handwerkliche Qualifikation hatte, konnte als Arbeiter auf der Kanalbaustelle tätig werden. Einigen Umsiedlern wurde erlaubt, Fischerei-Kolchosen zu bilden. Andere begannen, sich als freie Händler auf den lokalen Märkten zu betätigen. Jede und jeder musste versuchen, schnellstmöglich eine ökonomische Nische zu finden, um sich und seine Familie irgendwie ernähren zu können: Baumwolle kann man nicht essen. Im Herbst 1935 war klar, dass die Umsiedler den bevorstehenden Winter ohne Nahrungsmittelhilfe aus Moskau nicht überstehen würden. Vom Ziel, mehr Baumwolle anzubauen, sprach inzwischen niemand mehr.
Stalin persönlich verfolgte den Fortschritt der Besiedlung des Wachsch-Tals minutiös. Anfang Februar 1936 erkundigte er sich, ob sein Befehl, eintausend Familien aus Usbekistan nach Tadschikistan zwangsumzusiedeln, schon erfüllt worden sei. „Berichten Sie uns, wie Sie für die Ausführung unseres Beschlusses sorgen“, telegraphierte er in seinem typischen lakonischen Stil aus dem Kreml.
Innerhalb dreier Jahre kamen ungefähr 12 Tausend Umsiedlerfamilien in das Tal, konservativ gerechnet knapp 50 Tausend Menschen. Ein Großteil dieser Familien stammte aus Zentralasien, aber mindestens ein Drittel kam aus russischen Großstädten wie Leningrad. Gegenüber den aus Zentralasien stammenden Zwangsumsiedlern stellten die vom NKWD deportierten „Sonderumsiedler“ eine besonders schwere Belastung für die fragile Ökonomie und die instabile Versorgungslage des Wachsch-Tals dar. Mehr als ein Drittel der Talbewohner waren völlig unerfahren mit der Arbeit in der Baumwollwirtschaft und unvertraut mit den harschen Lebensbedingungen in der Region.
Seitens der tadschikischen Behörden wurde getan, was möglich war, um die Menschen wirtschaftlich auf eigene Füße zu stellen, damit sie sich irgendwie selbst versorgen konnten. Sie sollten Gärten anlegen, Getreide anbauen und Nahrungsmittel für den Eigenbedarf erzeugen. Der Baumwollanbau geriet immer weiter in den Hintergrund.
Je mehr „Sonderumsiedler“ in das Tal gelangten, desto gewichtiger wurde die Rolle der Geheimpolizei als Wirtschaftsmacht am Wachsch. Angesichts mangelnder finanzieller Ressourcen, einer dünnen Personaldecke, des fortwährenden Kompetenzchaos und der offensichtlich fehlgeleiteten Besiedlungspolitik Moskaus, übertrug die tadschikische Regierung es schließlich den Geheimdienstmitarbeitern des NKWD im Wachsch-Tal, für die „Sonderumsiedler“ aus Russland Sorge zu tragen. Die Geheimdienstleute sollten nicht nur für die Unterbringung, Verpflegung und medizinische Versorgung der Umsiedler verantwortlich sein, sondern auch für deren Bereitstellung von Arbeitskräften zur Landvermessung und zur Erfüllung von Bewässerungsarbeiten.
Auf diese Weise konnte sich der tadschikische Staatsapparat von schwierigen und unerfreulichen Problemen befreien. Dies geschah aus gutem Grund. Trotz der grauenhaften Lebensbedingungen und der schlimmen wirtschaftlichen Lage drängten Stalin und mit ihm die Moskauer Geheimdienstzentrale in der Ljubinka auf weitere Deportationen. Dabei war die Lage im Tal für weite Teile der Bevölkerung prekär. Das galt nicht nur für die „Sonderumsiedler“, über die die Geheimpolizei das Regiment führte. Es galt auch für Umsiedlerfamilien aus Zentralasien. Die Bilanz war ernüchternd, wie man einem Bericht vom Sommer 1937 entnehmen kann: „Weil das Projekt am Wachsch über riesige materielle Summen verfügte, hätte man gute Lebensbedingungen, einen gesunden Finanzhaushalt und eine Transportinfrastruktur schaffen können. Unterdessen gibt es bis zum heutigen Tag nichts davon: Die Krankenhäuser und die Schulen sind zusammengebrochen. Wir haben weder Schulen noch Krankenhäuser! Und die Infrastruktur steht in Ruinen.“
Doch die Deportation immer neuer Menschen hielt unvermindert an. Selbst im Frühjahr 1945, als die Rote Armee Berlin eroberte und in Tadschikistan eine schwere Hungersnot herrschte, kamen tausende Neudeportierte in das Tal. Das Ende der gewaltsamen Umsiedlungsaktionen kam erst mit Stalins Tod im Jahr 1953.
Man könnte das Bewässerungsprojekt am Wachsch als typisch für das Scheitern von Großprojekten als Form staatlicher Entwicklungspolitik halten, wie man es aus allen Regionen der Welt kennt. Keines der wirtschaftlichen Ziele, das bei Baubeginn verkündet worden war, konnte umgesetzt werden. Die Bewässerungsanlagen funktionierten nicht, von einem weißen Baumwollgarten war nichts zu sehen und die zwangsweise angesiedelte Bevölkerung hatte schwer damit zu tun, sich das Nötigste für ihren Lebensunterhalt zu beschaffen. Selbst die Wirtschaftstätigkeit der Geheimpolizei konnte an diesem Zustand nichts ändern und schon gar nicht die örtlichen Parteiorganisationen und lokalen Regierungsstellen. Allein: Diese Einschätzung würde dem Kern der stalinistischen Herrschaftsausübung nicht gerecht werden.
Denn ein Ziel war am Wachsch erreicht worden: einen Landstrich in eine Sumpflandschaft zu verwandeln, in der sich Menschen aufhalten mussten, die fernab ihrer Heimat verarmt und entwurzelt lebten. Möglicherweise hatten diese Menschen für ein besseres Leben im Sozialismus gekämpft und hatten dafür viele Opfer auf sich genommen. Aber was von ihrer Erfahrung blieb, war das alltägliche Erleben eines brutalen, feindseligen und böswilligen Staats. In den Händen der Bolschewiki sollte der Staat eine unerbittliche Disziplinierungsmaschine sein, die widerspenstige Gesellschaften und feindliche Naturräume unterwarf. So hatte es Lenin vorausgesehen und so behauptete es Stalin in seinen Parteitagsreden.
In der Praxis blieb die sowjetische Staatsmaschine störanfällig und unzuverlässig. Fortwährend klagten die Führer über fehlenden Gehorsam, mangelnde Disziplin und ungebrochene Widerstände. Manchmal schien es den bolschewistischen Revolutionären, als sei ihr Staat wie ein Holzschiff im Packeis gestrandet. Um diesen Zustand zu verändern, war den Bolschewiki jedes Mittel recht. Unordnung diente ihnen als Mittel, um aus dem Chaos heraus politische Macht zu manifestieren. Unordnung schaffen hatte aus ihrer Sicht das Ziel, traditionelle soziale und politische Strukturen zu vernichten, um die sowjetische Herrschaft als einzigen Sanktionsmechanismus durchzusetzen.
Die Macht der Unordnung konnte sich dabei gegen die eigenen Adepten und Vollstrecker richten. Parteimitglieder und Regierungsmitarbeiter gerieten ebenso unter die Räder wie die einfache Landbevölkerung und die Arbeiterschaft. Paradoxerweise kannte die Herrschaftsausübung in der Stalinära nach außen und nach innen keine Routine, die feste Verfahrensweisen, anerkannte Normen und Regeln schuf: Die sowjetische Herrschaftsroutine kennzeichnete die Machtausübung durch gezielt inszenierte und instrumentelle Unordnung. Darum war der sowjetische Parteistaat eine Welt der Gegensätze – gleichzeitig stark und schwach, durchdringend und oberflächlich, ordnungsbesessen und chaotisch.
Viele Historikerinnen und Historiker, die über die sowjetische Geschichte geforscht und geschrieben haben, würden mit dieser Lesart der Ereignisse übereinstimmen: den Stalinismus als eine Gewaltherrschaft, die nicht auf Legitimität, sondern auf Gehorsam abzielte zu verstehen, deren stärkster Motor unumschränkter Terror und dessen Rückgrat Massendeportationen und Arbeitslager waren. Diese Lesart teilte auch Hannah Arendt.
Auf der anderen Seite gibt es eine andere, unter Historikerinnen und Historikern ebenso stark vertretene, fast gegensätzliche Lesart des Stalinismus. Aller Verwerfungen der Stalinzeit zum Trotz behauptet sie, dass die revolutionären Veränderungen in der Sowjetunion ein legitimes Unterfangen gewesen wären, die Partizipation und Entwicklung nicht nur versprachen, sondern auch in die Tat umsetzten. Diese Forschungsrichtung beschreibt den Stalinismus als Teil eines globalen Modernisierungsprozesses, dessen Ausdruck auch in der Sowjetunion Urbanisierung und Industrialisierung, Bürokratisierung und die Entstehung einer medienvermittelten Massenkultur gewesen wären. Häufig geraten dabei Terror und Unordnung in die Fußnoten im Anmerkungsteil. Von manchen Historikerinnen und Historikern werden sie sogar als populäre, quasi-demokratische Prozesse verstanden, mit denen sich die Bevölkerung der Sowjetunion von ihren angeblich tatsächlich vorhandenen inneren „Feinden“ befreite.
Auch wenn diese, durchaus verbissen geführte, Diskussion auf die sogenannte Fachöffentlichkeit beschränkt bleibt, so hat sie doch eine größere politische Dimension, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Denn wie man über die sowjetische Geschichte urteilt, bestimmt, in welches Verhältnis man Stalinismus und Sozialismus zueinander stellt. Es bestimmt, wie man die Möglichkeiten und Grenzen von Diktaturen beurteilt – zwar immer mit Blick auf die Vergangenheit, aber immer auch mit einem Auge auf die Gegenwart. Es bestimmt nicht zuletzt, wie man aufgrund der historischen Erfahrung der Sowjetunion die gegenwärtige politische Situation in Russland einschätzt.
Die sowjetische Geschichte hat es also, genauer betrachtet, auch in unserer Gegenwart ziemlich in sich. Dabei geht es, abstrakter gesagt, um eine historische Tiefenbestimmung von Gegenwärtigkeit. Historikerinnen und Historiker vermitteln in ihrem Schreiben immer ein bestimmtes Bild der Gegenwart. Manche tun dies eher unbewusst und manche sehr bewusst. Auch wenn sie sich hinter Quellen, Fußnoten und Archivsiglen verschanzen, handeln sie – im Idealfall – von den Geschehnissen, Erfahrungen und Verwerfungen in der Vergangenheit mit dem Ziel, die unendliche Variationsbreite und damit die der Welt innewohnende Pluralität zu vergegenwärtigen und immer wieder neu zu beleben. Dabei können Historikerinnen und Historiker die Schriften und Gedanken von Hannah Arendt immer wieder neu inspirieren.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, dass ein Buch über Stalins Herrschaft in Zentralasien, dessen Gegenstand so fernab unserer hiesigen Erfahrungswelt liegt, mit dem Hannah-ArendtPreis ausgezeichnet wurde, freut mich über alle Maßen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken: Zuerst bei den Preisstiftern, der Heinrich Böll Stiftung und der Hansestadt Bremen. Dann bei der Jury, die auf ein Buch, das zunächst für ein Fachpublikum geschrieben wurde, aufmerksam geworden ist, es gelobt und prämiert hat. Dann bei der Hamburger Edition, deren Verlagsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter aus einem unordentlichen Manuskript ein schönes und lesbares Buch gemacht haben. Dank gilt meinen Berliner Kolleginnen und Kollegen, die mir zeigten, dass gute Wissenschaft nie im stillen Kämmerlein gemacht wird, sondern immer ein kollektives Unterfangen ist und sein muss. Und schließlich möchte ich mich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass Sie heute, auch wenn es anderes zu tun gegeben hätte, zusammen mit mir diese Feierstunde begehen!
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz