
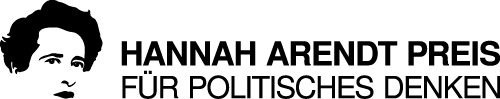

Ernst Vollrath (†), Professor für Politische Philosophie; lebte in Köln und Daniel Cohn-Bendit, Publizist und Politiker; lebt in Frankfurt am Main
Lieber Daniel Cohn-Bendit, lieber Christian Vollrath, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass wir uns wieder hier im Rathaus versammeln, um den jährlichen HannahArendt-Preis verleihen zu können. Ich finde nach wie vor die Idee gut, die nun schon eine ganze Reihe von Legislaturperioden in Bremen überstanden hat, und die auch von der Großen Koalition, die eigentlich nicht die Erfinder dieses Preises waren, aber immerhin akzeptiert wird ... jetzt lacht sogar Daniel Cohn-Bendit. Und entgegen allen Unkenrufen gibt es auch keine Entrüstung bei der CDU über diesen Preisträger. Das ist alles erfunden, sie finden es okay, dass die freie Jury, ohne dass reingeredet worden ist und dass irgendwelche Wünsche adressiert worden sind, diese Entscheidung getroffen hat. Ich versuche mich in diese Entscheidung reinzudenken, was nicht ganz einfach ist. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, diese beiden Preisträger zusammenzubinden. Das ist noch komplizierter als Antonia Grunenberg es in ihrer Rede gesagt hat. Denn das mit der Demokratie 68, das stimmt ja nicht. Ich habe 68 mit Leuten zu tun gehabt, die haben an alles andere gedacht als an Demokratie. Die wollten die Avantgarde durchsetzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das habe ich am eigenen Leibe erlebt. Koschnik war damals exponierter als ich, aber lieber Hans, ich war auch schon einer von diesen eigentlich diskreditierten Sozialdemokraten, die so revisionistische Kulturen hatten, und unsere Demokratie-Parteinahme hat uns gerade verdächtig gemacht vor der Studentenbewegung – das muss man doch bitte auch bedenken dürfen. Also, die 68er dürfen im Nachhinein nicht illuminiert werden als die Erfinder von demokratischen Prozessen in dieser Gesellschaft, sondern es ist eher etwas anderes. Also ich habe das – ich will Ihnen das ganz offen und herzlich sagen, ohne irgendwelche Rechthaberei –, ich habe das eher als einen Aufstand gegen die bürgerlichen Elternhäuser erlebt, gegen die konservativen akademischen Leiter, also auch einen Aufstand gegen Ernst Vollrath und seine Kollegen; die Studenten sind eben nicht mehr in die Kollegs gegangen, haben sich nicht mehr den Diskursen gestellt, haben nicht mehr demokratisch mit ihren Lehrmeistern diskutiert, sondern haben sie gehindert zu reden. Das kann man wirklich von ganz vielen sagen. Ich erinnere mich, wie Habermas oder wie Adorno nicht mehr reden durften. Daniel Cohn-Bendit war da nicht dabei, aber viele seiner Freunde haben sie damals am Reden gehindert. Und das muss man doch auch ein Stück bearbeiten. Also ich jedenfalls versuche das, ich versuche immer wieder da anzuknüpfen, wo damals eigentlich alles falsch gelaufen ist. Das, was mich tröstet, ist, dass wir das alles gemeinsam überwunden haben. Das finde ich eigentlich wichtig, und das nimmt mich für alle ein, die damals so exponiert waren, dass wir aus den unterschiedlichen Lagen heraus – ich vermute auch von den Hochschullehrern, also auch Leute wie Ernst Vollrath, den ich nicht so gut kenne, aber Kollegen von ihm kenne ich ganz gut – Nachsicht mit dieser nicht demokratischen, nicht fairen, nicht offenen, sondern totalitären, gewaltorientierten, gerade in den Diskursen gewaltorientierten Studentengeneration hatten und keine Abrechnung veranstaltet haben. Es wurde dann versucht, die Korrektur dieser Erfahrung zu stärken und wieder neue Einladungen auszusprechen, und dass dann auch viele, viele der Akteure eben nicht emigriert sind in irgendwelche grotesken Kulturen, sondern dass sie mitgemacht haben. Heute müssen sie diesen parallel laufenden Parteitag der Grünen in Rostock aushalten. Und wenn man sich diesen Spagat überlegt, dann ist das wirklich konstituierend für das, was wir alle gerne wollen: offen und frei und ohne den Avantgardeanspruch anderen aufzudrängen uns immer wieder rauswühlen aus dieser Voreingenommenheit und auch aus dieser Intransigenz, die ich bei den 68ern erlebt habe. Noch etwas ganz persönliches, das hat nichts mit Regierungserklärungen zu tun. Ich finde, die 68er sind mit Hannah Arendt überhaupt nicht fair umgegangen, und Hannah Arendt ist auch mit dieser Generation sehr kritisch umgegangen. Und bitte tun Sie nicht so, als wenn das alles immer eine Geschichte war, sondern ich kenne viele, die gegen Hannah Arendt als konservative, vorgefasste, nicht kritische Ideologin, Emigrantin, opponiert haben, und zwar militant opponiert haben, und sie war ja so eine Streitfrau, die hat immer zurückgegeben, sie hat sich eingelassen auf diese Diskurse, sie ist ja nicht so eine konsensorientierte Vereinnahmerin gewesen, sondern so eine, die den Diskurs angenommen hat. Nach wie vor finde ich anstrengend, was sie mit Habermas und Habermas mit ihr in den Versuchen, sich auseinander zu setzen und sich zu vereinnahmen, gemacht haben. Ich habe die Rede, die Ernst Vollrath zu Hannah Arendt geschrieben hat, zu verstehen versucht und habe gedacht, ja ja, so geht es wahrscheinlich. Dass man ohne Partei zu ergreifen wirklich sehr sorgfältig Schritt für Schritt diese Kontroverse und diese Vereinnahmung sozusagen durchleuchtet und transparent und nachvollziehbar macht. Ich selber, ich bin ja viel zu alt um 68er zu sein, also ich war 62/63 von der Uni weg. Ich habe aber in meiner Studienzeit Hannah Arendt als Konservative erlebt, also richtig auch so diskutiert. In Freiburg, weiß ich, haben sich Konservative auf sie berufen. Alle meine philosophischen und politischen Seminare, an denen ich teilgenommen habe, waren immer linkskritische Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt. Warum sage ich das? Wenn jetzt die Linkesie vereinnahmt, muss sie auch ein Stück diese Kontroverse benennen, die dahinter steht und die ich noch nicht zu Ende gebracht habe. Darf ich das sagen? Ich denke, das ist immer noch anstrengend, das ist immer noch nicht wirklich voll zusammengebracht, sondern unterm Strich die Anklage einer Emigrantin, einer jüdischen Emigrantin, die über Freundschaft mit Heidegger, die sehr persönliche Erfahrungen mit Nationalsozialisten gemacht hat, die sie nicht kritisch aufgearbeitet hat, sondern die sie bis zu ihrem Tode sozusagen stehen gelassen hat, und die dann aber über die Emigration zu Recht die Anklage gegen totalitäre Systeme erhebt. Das begreife ich, das kann ich nachvollziehen und da denke ich, da muss ich auch irgendwie zugehören – aber dazwischen sind ganz große Brüche, ganz große intellektuelle, politische Brüche. Warum sage ich das? Weil das unser Alltag ja auch ist.
Also wenn die Grünen heute streiten, ob sie in der Bundesregierung bleiben oder nicht, ob wir diese Allianz gegen den Terror mittragen oder nicht oder das anderen überlassen, dann ist das wieder das Herz von Hannah Arendt. Ich bin nicht sicher, ob da einer Hannah Arendt zitiert in Rostock, aber sie wäre ein guter Bezug für diese Debatte. Man könnte mit vielen, vielen Bezügen aus ihrer eigenen, auch polemischen Arbeit in diese Debatte hinein Argumente finden. Und darum ist sie so aktuell und darum ist sie so lebendig und darum ist es gut, dass die Jury sich nicht bequeme Preisträger aussucht, sondern dass sie so kontroverse Positionen benennt und uns allen die Möglichkeit gibt, sich damit auseinander zu setzen. Ernst Vollrath gelten ganz herzliche Grüße – und mit dieser Preisverleihung wird doch hoffentlich auch für ihn die positive und angenehme Erfahrung vermittelt, dass er bei dieser großen politischen Auseinandersetzung mit seinem philosophischen Arbeiten und mit seinem philosophischen Lehren nicht einfach ad acta gelegt wird, sondern einbezogen wird – und dass sich selbst solche Akteure wie Daniel Cohn-Bendit, und ich bin ja auch irgendwie ein Akteur, sich dann auch wieder solch einer wissenschaftlichen, sorgfältigen, kritischen, nicht opportunistischen Analyse und Auseinandersetzung stellen. Darum herzlichen Glückwunsch der Jury, dass Sie sich zu so einem komplizierten Vorschlag oder so einem komplizierten Duo entschieden haben.
Herzlichen Glückwunsch also ihrem Vater und gute Besserung – vielleicht kommt er mal, wenn er wieder bei Kräften ist nach Bremen; es gibt an der Bremer Universität Leute, die Antonia Grunenberg und andere, die ihn gerne mal hören würden, da soll er keinen Bogen drum machen; es gibt inzwischen eine völlig veränderte akademische Öffentlichkeit, die ihn gerne einbeziehen möchte und ihn nicht ausgrenzen möchte. Und Daniel Cohn-Bendit – ich weiß, dass er hier auf Kohlen sitzt, er würde lieber in Rostock eine große Rede schwingen, aber die vielen Vorveröffentlichungen reichen ja vielleicht für einen Parteitagsbeitrag – herzlichen Dank, dass Sie hergekommen sind, herzlichen Glückwunsch für diesen Preis, und Ihnen allen ein weiteres Nachdenken mit Hannah Arendt und mit diesen Preisträgern.
Neben Ernst Vollrath, der aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen kann, wobei ich mich aber freue, seinen Sohn Christian Vollrath begrüßen zu können, der den Preis für seinen Vater entgegennehmen wird, gibt es eine weitere Entschuldigung vorzubringen. Ralf Fücks, der Sie an dieser Stelle für die Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen wollte, muss zu dieser Zeit in Rostock sein, wo die Bundesdelegiertenversammlung der Grünen beginnt. Ralf Fücks, zusammen mit Dany Cohn- Bendit und anderen, ist dort mit einem Antrag vertreten, der versucht, die Neuausrichtung der grünen Außenpolitik zu formulieren. Die Präsenz eines der Hauptantragsteller ist dazu erforderlich. Dass es keine Debatte unter vielen ist, sondern mitentscheidend für das grüne Projekt, haben Sie mitbekommen, daher die Bitte, Herrn Fücks zu entschuldigen. Für die Heinrich-Böll-Stiftung Bremen möchte ich Sie herzlich begrüßen. Die Heinrich-BöllStiftung Berlin und die Bremer Landesstiftung sind ja der eine Teil der Stifter des Preises, der andere Teil wird getragen von der Stadt Bremen, die trotz bekannt knapper Kassen dankenswerterweise an dem Preis festhält und hoffentlich dabei bleibt – denn nur die Gemeinsamkeit gibt ihm Gewicht. Vor allem da es einige gibt, die die Preisidee gerne übernehmen würden und nur darauf warten, dass wir schwächeln. Der Dritte im Bunde ist der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken e.V., der das inhaltliche Profil verantwortet und der für die nötige Unabhängigkeit der Entscheidungen Gewähr leisten soll. Die Jury trifft sich immer in der ersten Jahreshälfte in Bremen, dadurch habe ich deren Entscheidung unmittelbar erfahren und war schon etwas verwundert darüber. Nicht dass Ernst Vollrath und Daniel Cohn-Bendit jeweils als Preisträger verständlich wären – aber beide zusammen?
Ich weiß nicht, ob Sie sich gleich daran erinnert hätten, dass es die 68er-Debatte war, die die erste Jahreshälfte bestimmte, über sie nachdenkend, bekam die Entscheidung zunehmend einen Sinn. Ich hatte, Anfang der Siebzigerjahre, nach dem Abitur und bevor ich studierte, eher zufällig Hannah Arendts „Totalitarismusbuch“ und „Eichmannbuch“ gelesen, war angetan bis begeistert und kam mit wenig, aber auch diesem theoretischen Rüstzeug an die Uni, natürlich als Linker. Es ergaben sich Situationen, in denen ich „meine“ Hannah Arendt in die Debatte warf, und war doch erstaunt ob der eisigen Reaktionen, wenn sie denn jemand überhaupt kannte. In diese, in dieser Hinsicht wenig freiheitliche Atmosphäre kam Ernst Vollrath 1976 nach Deutschland zurück und hat einer politischen und werkgetreuen Rezeption Hannah Arendts den Weg geebnet. – Eine Leistung, deren Mut und persönlicher Einsatz hoch zu bewerten ist. Und Daniel Cohn-Bendit: Stand er nicht auf der anderen Seite der Barrikade? Vielleicht noch der von 68, aber der Dany der Siebzigerjahre? Es war nicht zuletzt Joschka Fischer, der Cohn-Bendit bescheinigte, ihn vom Abgrund des Terrorismus geholt zu haben. Wenn man so will, ist Dany so etwas wie die Verkörperung des „Politischen“, das sich durch sein antitotalitäres Denken, seine Neuanfänge, sein Neu-beginnen-Können auszeichnet. Geschichte ist eben nicht die Abfolge logischer Ketten, das Politische muss immer wieder neu begründet werden. In dieser Tradition Hannah Arendts gehören beide zusammen, der eine als politischer Philosoph, der andere als Politiker der Öffentlichkeit. Es scheint nicht zufällig, dass es wieder Cohn-Bendit ist, der nach dem 11. September in der Öffentlichkeit präsent ist wie kaum ein anderer, weil er weiterdenkt, ohne sich in ideologische und politische Lager einbinden zu lassen. So eindeutig er sich auch für die militärische Bekämpfung des Terrorismus einsetzt, so eindeutig wendet er sich gegen lauter werdende Töne, die den Krieg als die Fortsetzung der Abwesenheit der Politik mit anderen Mitteln betreiben wollen, um Baudrillard zu zitieren. Es gibt bei der Verleihung des Hannah-Arendt-Preises schon fast so etwas wie eine deutschfranzösische Tradition, für die nicht nur Daniel Cohn-Bendit steht, sondern auch die Laudatorin der diesjährigen Preisverleihung, Frau Sauzay, Beraterin des Bundeskanzlers für deutschfranzösische Koordination, die ich auch herzlich begrüßen möchte.
Denkwege und Aufbrüche
Wir haben die diesjährige Preisverleihung unter das Motto: “1989 – 1968 – 1949: Politische Imaginationen und das Versprechen der Freiheit“ gestellt. Mit diesem Thema spielen wir darauf an, dass das politische Handeln in historisch einzigartigen Situationen immer auch zu etwas Neuem führt, zu einer politischen Gründung wie 1949 die Bundesrepublik Deutschland oder 1989 zur Erringung der Freiheit für die ehemalige DDR und zur Wiederöffnung Europas. Das Jahr 1968 steht wie eine Irritation zwischen den beiden anderen Daten. War denn 1968 ein Aufbruch der Freiheit? Nicht wenige haben dies hier zu Lande im vergangenen Jahr öffentlich bezweifelt. War dieses “Bewegung“ genannte Massenereignis vielleicht nur eine psychosoziale Generationenrevolte? Ihre Protagonisten Brüllhälse, die ihren hedonistischen Vorlieben knapp an der Grenze zur Kriminalität nachgingen? Sie alle wissen, wovon ich rede. Öffentliche Schuldbekenntnisse sind eingefordert worden. Damit einher ging der Versuch, den politischen Akten der Sechziger- und Siebzigerjahre ihren öffentlich-bedeutsamen Charakter zu nehmen und zum Ergebnis unentschuldbaren individuellen Fehlverhaltens ihrer Protagonisten zu erklären. Mit dem Untertitel “Politische Imaginationen und das Versprechen der Freiheit“ haben die Veranstalter auf etwas angespielt, das in allen drei geschichtlichen Ereignissen eine Rolle spielt: das politische Denken und das Versprechen der Freiheit. Dieses Versprechen gibt es auch 1968. Wenn man die beiden diesjährigen Preisträger in Augenschein nimmt, so fällt einem spontan zuerst das Trennende ein: Ernst Vollrath ein Theoretiker, Daniel Cohn-Bendit ein Praktiker; der eine von der aristotelischen Tradition und vom Denken Hannah Arendts geprägt, der andere von den Straßenkämpfen und den öffentlichen Redeschlachten. Der eine ein Philosoph von der Universität, der andere ein Politiker des Hier und Jetzt. Ich bin mir auch sicher, dass Ernst Vollrath und Daniel Cohn-Bendit in den Sechziger- und Siebzigerjahren viel zu streiten gehabt hätten. Vollrath konnte die anmaßende Art von manchen der so genannten Achtundsechziger, die politische Sphäre zur “Bewegung“ zu instrumentalisieren, nicht billigen. In einem Brief an Hannah Arendt vom 5. Februar 1970 schreibt er: “Ich habe den Eindruck, daß der Moment herangekommen ist, an dem Saint-Just gesagt haben würde: la révolution est glacée. Abgesehen von der ganz anderen Lage ist dies die Folge davon, daß man sich immer noch an den verfluchten ,Bewegungscharakter‘ des Politischen angehängt hat. Es ist zum Verzweifeln!“ Es ist also ist nicht die Kritik an den Regelverletzungen, die Vollrath umtreibt, sondern dass die Studenten das Politische zur Bewegung manipulieren.
Daniel Cohn-Bendit hätte freilich seinerzeit den Zugang von Ernst Vollrath zu der politischen Sphäre viel zu konservativ und theoretisch gefunden.
Was sich die Jury nun dabei gedacht hat, zwei so grundverschiedene Persönlichkeiten unter dem Dach eines Preises zusammenzubringen, möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Beide, Ernst Vollrath und Daniel Cohn-Bendit, sind auf ihre Weise mit der Nachgeschichte des deutschen und europäischen Totalitarismus verbunden. Ernst Vollrath, indem er, den Denkwegen Hannah Arendts folgend und zugleich über sie hinausweisend, die Rekonstruktion des Politischen in den Vordergrund seines Nachdenkens stellt, Daniel Cohn-Bendit, indem er als Handelnder einen neuen Aufbruch in die Freiheit forderte.
Die zweifache Preisvergabe nimmt auch einen Gedanken wieder auf, der bei der Gründung des Preises maßgeblich war: Der “Hannah Arendt-Preis für politisches Denken“ richtet sich sowohl an Persönlichkeiten aus der Sphäre des philosophischen und politischen Denkens wie auch an solche im politischen Raum. Mit Freimut Duve und Joachim Gauck und auch mit Claude Lefort und Antje Vollmer wurden Persönlichkeiten geehrt, die etwas für das Versprechen der Freiheit getan hatten: Joachim Gauck, der das historische Verdienst hat, die Staatssicherheitsakten zur öffentlichen Einsichtnahme gebracht zu haben, Freimut Duve, der als einer der Ersten für eine europäische Intervention in Bosnien aus politischen Gründen plädierte, Antje Vollmer, die eine festgefahrene Pattsituation in den deutsch-tschechischen Beziehungen durch mutiges Auftreten außer der Reihe aufzulösen half. Claude Lefort, der die Nachwirkungen des Totalitarismus im Lichte der Ereignisse von 1989 neu überdachte.
Allen bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern ist gemeinsam, dass sie jenen Kräften widersprachen, die das Politische auf instrumentelles Handeln oder auf den Glauben an unverrückbare Werte reduzieren. Die Weltlage seit dem 11. September 2001 hat wieder einmal darauf aufmerksam gemacht, dass das reduzierte Verständnis von politischem Handeln zwar zu verständlichen Sicherheitsreflexen führt, aber die Wahrnehmung neuer Handlungsräume und Denkhorizonte eher blockiert. Ohne ein politisches Denken, das auch das heute Unmögliche anspricht, würde es heute in Mazedonien keine Verfassung geben, darauf hat Daniel Cohn-Bendit kürzlich hingewiesen. Ohne das Unmögliche zu wagen, könnte man anfügen, wird es schwerlich einen tragfähigen Frieden in Afghanistan oder im Nahen Osten geben. Diese Dimension des unmöglichen Möglichen spielt bei den beiden Persönlichkeiten eine besondere Rolle: bei Ernst Vollrath im Nachdenken über das, was das Politische an der Politik sein könnte, bei Daniel Cohn-Bendit im Reden und Streiten über die Erneuerung des Politischen im Handeln.
Ernst Vollrath begann sein Wirken in einer Zeit, in der das Handeln im öffentlichen Raum durch den Wiederaufbau und die dringend notwendige Stabilisierung der demokratischen Institutionen gekennzeichnet war. Eine entscheidende Prägung in seinem Denken erhielt er durch die Freundschaft mit Hannah Arendt in den Siebzigerjahren sowie durch seine Lehrtätigkeit an Arendts Hausuniversität, der New School for Social Research in New York City. Durch sein Werk ist Hannah Arendt in Deutschland als politische Denkerin sui generis bekannt geworden. Als politische Publizistin war sie schon vorher weithin bekannt, wofür Dolf Sternberger sehr viel getan hatte, aber auch ihre eigenen Vortragsreisen und natürlich ihr Buch über den EichmannProzess. Vollraths Büchern und Aufsätzen ist zu entnehmen, wie schwierig dieses Unterfangen war, gegen den Strom der Zeit auf einem anderen Begriff des Politischen zu beharren. Gegenüber einer Linken, die lange Zeit das Werk Arendts nicht wahrnehmen wollte, und gegenüber einem liberalen und konservativen Lager, die das arendtsche Denken zwar für sich vereinnahmten, es in seiner Vielfältigkeit aber nicht würdigen konnten, hat Ernst Vollrath beharrlich darauf bestanden, dass es mit dem arendtschen Werk etwas ganz Besonderes zu entdecken galt, eine besondere Dimension des Politischen. Worin unterscheidet sich das Politische von dem, was wir als Politik kennen: Vollrath arbeitet heraus, dass es vor allem darin liegt, dass das Politische nicht objektiv und nicht kausal ist. Mit Hannah Arendt geht Ernst Vollrath davon aus, dass politisches Handeln nicht in einer Zweck-Mittel-Relation steht. Das Gegenwärtige kann nicht aus dem Vergangenen abgeleitet werden: “Das Ereignis erhellt seine eigene Vergangenheit, niemals kann es aus ihr abgeleitet werden“, heißt es bei Arendt. Ebenso wenig können die Folgen gegenwärtigen Handelns in der Zukunft kontrolliert werden. Das Politische ist ein Handeln, das etwas in Gang setzt, dessen Ergebnisse aber nicht kontrollieren kann. Das Politische wird von einem “Wir“ getragen; dieses “Wir“ ist der Prozess der Meinungsbildung, in dem die Handelnden urteilen. Das “Wir“ bedeutet auch, dass politisches Handeln von Einflüssen bedingt ist, die es nicht beherrschen kann, aber mit denen es in Beziehung tritt. Das ist die Pluralität des politischen Raums. In ihr herrscht keineswegs nur Harmonie; Meinungsbildung und Urteilsbildung vollziehen sich konflikthaft.
Es zeichnet Ernst Vollrath aus, dass er diese Position bezogen hat zu einer Zeit, als namhafte Denker verkündeten, Politik bestünde in der Herstellung von Einmütigkeit durch herrschaftsfreie Kommunikation. Der Preis, den Ernst Vollrath für das Beharren auf seinem Widerspruch gezahlt hat, war hoch. Er ist nur einem kleinen Kreis von Kollegen und Studierenden bekannt geworden. Ja, man kann sagen, Ernst Vollrath ist der politische Philosoph, dessen Bedeutung in der deutschen Öffentlichkeit bis heute am radikalsten verdrängt wurde. Es mag ihn ein wenig trösten, dass die Verhältnisse ihm Recht gegeben haben; doch möchte man nicht auch die Anerkennung der Zeitgenossen haben? Die nächste Generation kann von ihm lernen, dass man für seine Position streitet, auch wenn sie gegen den Mainstream steht. Wichtiger noch ist freilich, dass Vollrath den Jüngeren mit seinen Büchern etwas Kostbares übereignet: die Kenntnis von jenem Versprechen der Freiheit, dem jede nachkommende Generation erneut gegenübersteht.
Gegen Daniel Cohn-Bendit als Preisträger ist mancherlei eingewendet worden. Lassen Sie mich deshalb kurz anführen, was nach Meinung der Jury gerade für ihn spricht. Cohn-Bendit ist biografisch und politisch eng mit Frankreich und Deutschland und ihrer Geschichte in den letzten fünfzig Jahren verbunden. Als Kind deutscher Juden, dessen Eltern aus Deutschland vertrieben wurden, ist er im Exil in Frankreich geboren, in Deutschland aufgewachsen, wieder nach Frankreich verzogen, 1968 aus Frankreich vertrieben und erneut in Deutschland tätig geworden. Heute ist er in beiden Ländern zu Hause. Seine wechselvolle Lebensgeschichte – zu der auch die Freundschaft seines Vaters zu Hannah Arendt gehört –, seine Lebensgeschichte also, ist einerseits ein Teil der vielen noch unerzählten Geschichten von Flucht, Vertreibung und ihren Nachwirkungen. Auf der anderen Seite ist sie ein lebendiges Zeichen für die Entstehungsgeschichte eines neuen Europa, an dem Cohn-Bendit mitwirkt. Daniel Cohn-Bendit steht wie kein Zweiter für die Ereignisse von 1968, in Frankreich und in Deutschland, und zwar in dem Sinne, dass das politische Handeln, jenseits der Irrtümer, in die es läuft, immer auch etwas ermöglichen kann. Ein politisch Handelnder begibt sich immer in einen Handlungszusammenhang hinein, in dem er Irrtümern und Fehlern unterliegen kann, für die er Verantwortung trägt. Doch retrospektiv betrachtet hat Cohn-Bendit dieses 1968 als einen noch immer andauernden Auftrag angenommen, sich an der Gestaltung des neuen Europa zu beteiligen, zuerst in Frankreich, dann in Deutschland, bei der Gründung der Grünen und seit jüngstem nun als europäischer Politiker.
Mit der Preisvergabe an Daniel Cohn-Bendit hat die Jury zu erkennen gegeben, dass sie die Ereignisse von 1968 als Zäsur in der politischen Geschichte der Bundesrepublik und Europas anerkennt, in der die demokratische Frage neu gestellt wurde und ein politischer Neubeginn eingefordert wurde, dessen Impulse bis heute andauern. Daniel Cohn-Bendit steht mit seinem Wirken als Abgeordneter im Europaparlament – ebenso wie der frühere Preisträger Massimo Cacciari – für die Schaffung einer republikanischen politischen Kultur in Europa. In seiner Lebensgeschichte und in seinem politischen Wirken wird deutlich, dass der politische Raum konfliktreich ist, zugleich aber immer die Chance des Eingreifens ins Geschehen birgt. Mit der Verleihung des “Hannah Arendt-Preises für politisches Denken“ an ihn nimmt die Jury natürlich auch auf die deutsch-französischen Beziehungen Bezug. Wie Sie wissen, haben 1996 Francois Furet (dessen Laudator Cohn-Bendit war) und 1998 Claude Lefort den “Hannah Arendt-Preis“ erhalten. Mit der Entscheidung für Daniel Cohn-Bendit möchte die Jury auch den “deutsch-französischen Ariadnefaden“ wieder aufnehmen, in der Hoffnung, die politische Kultur der Streitgespräche zwischen Frankreich und Deutschland zu beleben. Ernst Vollrath und Daniel Cohn-Bendit verkörpern auf je eigene Weise die intellektuellen und politischen Möglichkeiten dieser Republik und dieses Europas. Gemeinsam ist ihnen, dass beide auf ihre je spezifische Weise einen Zugang zum politischen Raum freilegen. Ernst Vollrath in der Rekonstruktion des Politischen, Daniel Cohn-Bendit als politisch Handelnder. Beide sprechen wichtige Aspekte des Arendtschen Denkens an: das Handeln ins Offene und die Freilegung eines nicht-objektivistischen politischen Denkens.
Lassen Sie mich zum Abschluss noch ein paar Worte des Dankes sagen. Dass uns der Senat der Freien und Hansestadt Bremen mit seinem Bürgermeister und die Heinrich-Böll-Stiftung mit Ralf Fücks diese Preisverleihung ermöglichen, dafür danken wir ihnen herzlich. Wir sind davon überzeugt, dass das Preisgeld, das der Bremer Senat und die Böll-Stiftung aufbringt, eine gute Investition in Gegenwart und Zukunft ist. Danken möchte ich natürlich auch meinen Mitstreitern Zoltan Szankay, Lothar Probst und Peter Rüdel und den Kolleginnen und Kollegen von der Jury für die schwierige Arbeit der Preisträgerfindung. Solch ein Preis muss immer wieder neu belebt werden, sonst verkommt er zur reinen Zierde. Der “Hannah Arendt-Preis für politisches Denken“ will bewusst auch Anstöße geben und auch ein bisschen Anstoß erregen, im wörtlichen Sinne. Dies aber geschieht nur, wenn man den Preis selbst in allen seinen Facetten auch zum Vorschein bringt. Last but not least, im Namen der Jury und des Vorstands gratuliere ich Christian Vollrath für seinen Vater Ernst Vollrath und Daniel Cohn-Bendit zum “Hannah Arendt-Preis“ 2001.
Öffentliches Handeln mit politischem Denken verbinden
Es ist mir eine große Ehre und Freude, die Laudatio auf die beiden diesjährigen Preisträger des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken, Herrn Professor Ernst Vollrath und Herrn Daniel Cohn-Bendit, zu halten. Frau Professor Grunenberg, Sie haben den Hannah-Arendt-Preis einmal als “europäischen Preis“ bezeichnet, der dazu diene, “Europa zum Sprechen zu bringen“. Damit haben Sie sicherlich nicht nur das Brüsseler Europa, das Europa der Währungsunion und des Binnenmarktes gemeint, sondern vor allem das Europa der Kultur und des Geistes, das Europa des intellektuellen Dialogs. Der Hannah-Arendt-Preis erinnert auch daran, dass dieses Europa der republikanischen Tradition der USA verbunden ist, die für Hannah Arendt – und einige Jahre auch für Sie, Herr Professor Vollrath – zur intellektuellen und materiellen Bleibe wurden. Seit dem 11. September 2001 ist uns allen wieder stärker ins Bewusstsein gerückt, dass uns – bei allen Unterschieden – mit den USA eine Denktradition und ein Menschenbild verbindet, das letztendlich in der Aufklärung und in den Menschenrechten wurzelt. Dieses Motiv also, “Europa zum Sprechen zu bringen“, halte ich für ein ausgezeichnetes; denn wenn es heute an etwas fehlt in Europa, dann sicherlich an Kommunikation, an Verständigung und damit auch an Verständnis zwischen den Menschen – über staatliche und sprachliche Grenzen hinweg. Frei nach Willy Brandt könnte man sagen, in Europa müsse künftig “zusammenwachsen, was zusammengehört“. Der Hannah-Arendt-Preis trägt dazu bei.
Oberflächlich betrachtet mag man sich – angesichts Ihrer unterschiedlichen Lebenswege und auch angesichts Ihres unterschiedlichen Verhältnisses zur Politik – wundern, dass Ihnen, Herr Professor Vollrath und Herr Cohn-Bendit, hier und heute gemeinsam der “Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken“ verliehen wird. Dennoch teilen Sie beide eine wichtige Gemeinsamkeit: Sie stehen, ebenso wie Hannah Arendt selbst, für eine nicht-ideologische Linke, für ein linkes Denken, das immer “antitotalitär“ war – und zwar auch schon zu einer Zeit, in der Sie damit eine unbequeme Position hatten, weil Sie gegen den Strom schwammen – also lange vor dem Fall der Mauer, lange bevor dies zum “mainstream“ wurde. Ein liberales Menschenbild prägt die beiden Preisträger in ihrem Denken und Wirken ebenso wie die politische Reflexion Hannah Arendts. Wenn es einen Kreuzungspunkt in den so unterschiedlichen Biografien unserer beiden Preisträger und Hannah Arendts gibt, dann sicherlich den, dass Sie deren Überzeugung, der Sinn von Politik sei Freiheit, voll und ganz teilen. Sie verkörpern damit beide auch ein Ethos des Politischen, das über den Zwängen, Moden und Ideologien der Parteipolitik und des politischen Alltagsgeschäfts steht. Interessant ist, dass Sie trotz dieser Gemeinsamkeit in der Öffentlichkeit ganz unterschiedlich rezipiert wurden: “Dany le rouge“ gehörte immer dem linken Lager an, Professor Vollrath dagegen wurde im Kontext der Totalitarismusdebatte als “Konservativer“ betrachtet. Sie beide, liebe Preisträger, sind zwei Persönlichkeiten, die im Zeichen einer dritten stehen, die Sie beide auch persönlich kannten. In Ihnen spiegeln sich zwei Facetten von Hannah Arendt wider, nämlich ihr Anspruch öffentliches Handeln mit politischem Denken zu verbinden. Sie, Herr Professor Vollrath, wirken insbesondere als Wissenschaftler, Ihr Forum war vor allem die akademische Öffentlichkeit, die Universität. Sie haben die Politik und das Politische in seinen Grundlagen analysiert, Sie haben die politische Philosophie insbesondere der Demokratie weiterentwickelt und das Denken von Tocqueville und Hannah Arendt fortgesetzt. Sie, Herr Cohn-Bendit, kennen zwar die Universität ebenfalls von innen, insbesondere die Zustände in Nanterre vor 1968 – aber wie wir wissen, blieb ihnen dort nicht immer Zeit für das stille Studium in der Bibliothek, denn die reine Theorie war Ihre Sache nicht, und Sie wählten eine breitere Öffentlichkeit außerhalb der Universität. Sie wollten – und das ist Ihnen wahrlich auch gelungen – Dinge bewegen, Politik “machen“. Sie provozierten und debattierten und haben es auf diese Weise geschafft, “Sand im Getriebe“ zu sein und gemeinsam mit anderen unsere Gesellschaft von Grund auf zu verändern. Damit haben Sie auch ein Stück der politischen Kultur Deutschlands und Frankreichs, ja, man könnte sagen, der politischen Kultur Europas verändert. Heute setzen Sie im Europäischen Parlament in gewisser Weise diesen Ansatz fort, und auch wenn Sie sich vielleicht ein wenig gemäßigt haben, bleiben Sie doch ein leidenschaftlicher Politiker und ein “Aufrührer“ im positiven Sinne.
Als Wissenschaftler haben Sie, Herr Professor Vollrath, mit Hannah Arendt von 1973 bis 1976 an der New School for Social Research in New York gewirkt. Nach Ihrer Rückkehr nach Deutschland 1976 haben Sie eine intensive Korrespondenz mit ihr fortgeführt, die zeigt, wie eng Sie wissenschaftlich und geistig mit ihr verbunden waren. Sie, Herr Professor Vollrath, entwickeln das Denken Hannah Arendts weiter und legen großen Wert auf klare begriffliche Differenzierungen: Sie definieren das Politische, “le politique“, als die Form und unterscheiden es von der Politik, “la politique“, als Inhalt. Wie bedeutsam diese analytische Klarheit für die politische Praxis ist, zeigt uns beispielsweise die aktuelle Europa-Debatte zwischen Deutschen und Franzosen: Die Franzosen fordern ein “projet européen“, Inhalte, Visionen, während die Deutschen sich auf formale, institutionelle Fragen konzentrieren, sie wollen die Architektur Europas festlegen. Mit etwas Abstraktionsvermögen und klaren Begriffen, wie Sie, Herr Professor Vollrath, sie entwickelt haben, würden wir uns viele missverständliche Diskussionen ersparen, denn beide Aspekte – das Politische und die Politik – sind komplementär, keiner der Begriffe kommt ohne den anderen aus und keiner existiert in der Realität ohne den anderen. Für überaus interessant halte ich – gerade als Französin – ferner, dass Sie, Herr Professor Vollrath, eine Metaphysik der Politik ablehnen. In Ihrem Brief an Hannah Arendt vom 6. Februar 1970 schreiben Sie: “Je mehr ich über die Sache nachdenke, umso deutlicher wird mir, dass Ihr ganzes Bemühen darauf geht, die metaphysische Konstellation des Politischen, die zu einem Verfall des Politischen geführt hat, zu destruieren.“ Dieser Gedanke ist der französischen Tradition sehr nahe: Es ist ein republikanischer Ansatz, nach welchem Politik keine Glaubensfrage ist, sondern eine permanente Debatte zwischen rechtlich gleichgestellten Bürgern, die sich in der Staatsnation, in der Vertragsnation organisiert haben. Es ist dies auch ein sehr “irdischer“ Begriff des Politischen, der in Abkehr zu einer verhängnisvollen deutschen Tradition der politischen Philosophie steht. Der letztere Ansatz ist in der Geschichte mehrfach gescheitert. Immer wenn versucht wurde, auf Erden das “gesellschaftliche Paradies“, den “neuen Menschen“ zu schaffen, so haben Staaten die “Hölle“ errichtet, sie haben damit das Politische, die politische Kultur und letztendlich den Menschen zerstört. Diese Überzeugung hat Sie, Herr Professor Vollrath, zu Ihrer zutiefst liberalen, antitotalitären Denkweise geführt. Dass Sie Hannah Arendts Totalitarismustheorie verteidigt haben, hat Ihnen einige Kritik eingebracht. Die “Ecke“, in die man Sie damals zu rücken versuchte, ist heute – so ändern sich die Zeiten – ein Ehrenplatz, um den sich viele drängeln, nicht immer berechtigterweise. Ihnen, daran besteht kein Zweifel, kommt dieser “Ehrenplatz“ voll und ganz zu für Ihre illusionslose Kritik an totalitären Systemen. Als Französin würde ich das geflügelte Wort über den kommunistischen, “engagierten“Sartre und den skeptisch-rationalen Raymond Aron umkehren und aus heutiger Sicht sagen: “Il valait mieux avoir tort avec Vollrath, que raison avec l’école de Francfort.“
Dass Gleiches auch für Hannah Arendt gilt, haben Sie, Herr Cohn-Bendit, anlässlich einer Hannah-Arendt-Tagung 1994 erläutert –
ich zitiere:
“Arendt war keine Anhängerin der so genannten ,engagierten‘ Philosophie. ... Will man den engagierten Philosophen akzeptieren, so nur, wenn man nicht vergisst, dass auch bedeutende Philosophen und Denker nicht davor geschützt sind, den größten Unsinn zu verbreiten. ... Hingegen hat sich Arendt niemals zu einem solch engagierten Opportunismus hinreißen lassen. Obwohl sie mit der Studentenbewegung sympathisierte, was sie mir geschrieben hat, war das für sie kein Grund, mit dem Denken aufzuhören.“ Soweit Cohn-Bendit. Sie erläuterten damals auch, dass Hannah Arendt für Sie zunehmend wichtiger wurde, als Sie sich von der abstrakten revolutionären Theorie emanzipierten, und zwar im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung über Gewalt in der Studentenbewegung, über den Terrorismus und die Rote-Armee-Fraktion. Ihr persönlicher Kontakt zu Hannah Arendt, die insbesondere mit Ihrem Vater befreundet war, war also auch ein immens politischer. Was Sie auszeichnet, Herr Cohn-Bendit, ist, dass Sie natürlich “engagiert“ waren und revolutionär dazu, aber als es galt, sich zwischen Gewalt und Freiheit zu entscheiden, haben Sie die Freiheit gewählt. Sie haben die antitotalitäre Linke mitentwickelt und sind gegen die Verharmlosung des kommunistischen Regimes durch die marxistische Linke eingetreten. Diesen liberalen Geist haben Sie auch sehr viel später wieder an den Tag gelegt, als die Debatten zwischen “Realos“ und “Fundis“ bei den Grünen hohe Wellen schlugen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an ein sehr französisches Zitat von Ihnen: “Was ist das für ein Land, wo die Bäume mehr zählen als die Menschen?“ (Cohn-Bendit) Sie haben – und das gilt für 1968 wie für heute – nie ein Blatt vor den Mund genommen, auch gegenüber Ihren Kampfgenossen nicht. Ihr Mut zur Kontroverse, Ihre Spontaneität und Ihr Witz, Ihre Frechheit und Ihr Freigeist haben sicherlich das Bürgertum und das Spießertum mehr erschüttert als so manche tief schürfende marxistische Diskurse. Sie haben immer die Grenzen der Freiheit ausgelotet – wofür Sie natürlich auch bezahlt haben, unter anderem mit der Ausweisung aus Frankreich durch de Gaulle. Doch sogar Alain Peyrefitte, Bildungsminister unter de Gaulle 1968 und Betreiber Ihrer Ausweisung aus Frankreich, musste in seinen Memoiren anerkennen: “Cohn-Bendit ist ein anarchistischer und ulkiger Revolutionär. Er will alles zerstören, die bürgerlichen Strukturen, zu denen auch die Kommunistische Partei zählt, und er macht es so fröhlich, dass alle ihn anhimmeln.“ Jedenfalls haben Ihr Übermut und Ihr Humor Sie vor dem “moralinsauren“, verhärmten Habitus mancher deutscher Linken bewahrt. Hannah Arendt hat Politik definiert als “das, was zwischen Menschen passiert“ – mit Ihrem Protest gegen die Geschlechtertrennung in den Studentenwohnheimen von Nanterre haben Sie diese These sehr anschaulich in die Praxis umgesetzt und ganz nebenbei natürlich damit noch den Pariser Mai 68 ausgelöst ... Ich wage zu behaupten, dass diese Abneigung gegen das ideologische Moralisieren auch von der französischen Hälfte, die Sie in sich tragen, herrührt. Für Franzosen sind politische Debatten und Argumente etwas ganz anderes als Moral – auch dies ist übrigens wieder eine Querverbindung zu Hannah Arendt. Die politische Kultur Frankreichs zeigt sich skeptisch gegenüber geschlossenen Denksystemen oder – wie schon gesagt – gegenüber ideologischen Glaubenssätzen, gegenüber einer Metaphysik des Politischen. Anlässlich der Proteste von grünen “Fundis“ gegen den von Ihnen befürworteten Kosovo-Einsatz haben Sie, Herr Cohn-Bendit, einmal gesagt, “die Regierung ist keine Vereinigung bibeltreuer Katecheten“. Vor der totalitären Versuchung, der marxistisch-ideologisch verbrämten Gewaltanwendung haben Sie also vermutlich mehrere Faktoren bewahrt: Ihr Lachen, das ironische Distanz auch zu sich selbst verrät, Ihre Auseinandersetzung mit Hannah Arendt und Ihre französische Prägung, die sich vor Globalvisionen hütet und sich auf die “irdische Condition humaine“ konzentriert, ganz in der Tradition des französischen Skeptizismus eines Montaigne, Descartes oder Pascal. Sie haben als “europäischer Bastard“, wie Sie sich selbst gerne bezeichnen, den beiden Quellen Ihrer Kultur, Deutschland und Frankreich, jeweils etwas voraus, und das macht auch Ihre Modernität aus: Den Deutschen haben Sie das Misstrauen gegenüber geschlossenen Denksystemen und den Freigeist des “libertins“ voraus. Wenn Nietzsche sagt, “Die Deutschen sind von vorgestern und übermorgen“, dann könnte man erwidern, Cohn-Bendit füllt die Lücken dazwischen aus. Den Franzosen haben Sie den Sinn für die Ökologie, die nachhaltige Entwicklung, das Ethos der Verantwortung gegenüber künftigen Generationen voraus, weil Sie auch die “pantheistische“ Sensibilität Deutschlands besitzen. Dass Sie beide Denktraditionen kennen und relativieren können, auch gegen beide rebellieren und nicht borniert an einer nationalen Prägung hängen, prädestiniert Sie dafür, der Europäer zu sein, als der Sie geboren und der Sie heute geworden sind. Ihr Gesicht symbolisiert inzwischen ja nicht nur das Jahrhundertereignis des Mai 68 (– wie andere Stationen dieses Jahrhunderts etwa Kennedy 1963, der 11. September ...), sondern Ihr Gesicht ist auch zum Symbol für eine mitreißende Europa-Begeisterung geworden. Herr Cohn-Bendit, Sie sind vielleicht der erste wirklich transnationale Politiker in Europa. Wir müssen Ihnen dankbar sein dafür, dass Sie ein Liebling der Medien, ein “politischer Superstar“ sind, denn damit haben Sie den Ansatz für eine europäische Öffentlichkeit mit geschaffen. Und Sie wissen auch, dass wir für eine europäische Demokratie noch weiter gehen müssen, dass wir transnationale Parteien, transnationale Medien, transnationale Debatten brauchen. Nach den Europa-Wahlen, als Sie für die französischen Grünen antraten, konnte man in Berlin-Schöneberg ihre französischen Wahlplakate mit deutschen Gratulationsaufschriften sehen: Das war für mich ein wirklich bewegendes Symbol, ein kleiner und dennoch riesiger Schritt für Europa. Die Tatsache, dass Sie als Angehöriger eines Staates aktiv im politischen Leben des anderen Landes mitwirken (was mich als Französin im deutschen Bundeskanzleramt im Übrigen mit Ihnen verbindet) zeigt, dass Europa zusammenwächst. Europa ist für Sie, so haben Sie einmal gesagt, eine Vision, ein Traum, eine der letzten Utopien, für die es sich zu kämpfen lohne.
Sie beide, Herr Cohn-Bendit und Herr Professor Vollrath, haben mit Ihrem Wirken und Ihrer Arbeit unsere politische Kultur geprägt und gepflegt. Sie haben Verantwortung, Freiheit und Konflikt als zentrale Begriffe der Demokratie verstanden und theoretisch wie praktisch “durchdekliniert“. Die demokratische Kultur lebt von und mit Menschen wie Ihnen beiden, denn angesichts von Politikverdrossenheit, Rechtsextremismus und Fundamentalismen unterschiedlichster Couleur gilt es immer wieder, das wertvolle Gut der Demokratie und der ihr zu Grunde liegenden Tugenden zu pflegen, zu bewahren und lebendig zu halten. Insbesondere braucht die Demokratie die schwere und unentbehrliche Tugend, Pluralität, Meinungsvielfalt und -unterschiede zu akzeptieren. Auch dafür steht der “Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken“. Ich gratuliere unseren beiden Preisträgern ganz herzlich.
Vom “radikal Bösen” zur“Banalität des Bösen”
Überlegungen zu einem Gedankengang von Hannah Arendt
Hannah Arendt ist Zeit ihres öffentlichen Wirkens in zahlreiche Kontroversen und Polemiken verwickelt gewesen, eine Folge ihres unabhängigen, unvoreingenommenen, ja radikalen Denkens. Eine besondere Stelle nimmt dabei ihr Bericht vom Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem ein, den sie für die Kulturzeitschrift The New Yorker verfasste und dann als Buch veröffentlichte: Eichmann in Jerusalem, Ein Bericht von der Banalität des Bösen. Die Thesen dieses Buches, zumal die von der Banalität des Bösen, erregten regelrecht Anstoß. Die offiziellen und offiziösen israelischen und jüdischen Organisationen wandten sich aggressiv gegen diese Thesen ihres Buches und gegen seine Verfasserin. Es kam zum Bruch mit langjährigen Freunden, so mit Hans Jonas, mit dem erst nach langer Zeit ein Ausgleich zu Stande kam. Mit anderen Freunden kam der Ausgleich nie wieder zu Stande. Aus dem ganzen Komplex dieser Kontroverse soll im Folgenden nur ein einziges Moment herausgegriffen werden: Hannah Arendts Konzept der Banalität des Bösen, das sie in Adolf Eichmann verkörpert sah. Gerade dieses Konzept traf auf schroffe Einsprüche, sofern ihr unter anderem unterschoben wurde, sie wolle damit die ganze Ungeheuerlichkeit der Untaten dieses Menschen abschwächen. Das Gegenteil ist der Fall. Der Ausdruck ist mit der Kennzeichnung “die furchtbare Banalität“ versehen. Er dient dazu, die Verruchtheit dieses Mannes und seiner Taten besonders deutlich herauszustellen. Um das kenntlich zu machen, ist es erforderlich, den genauen Umkreis zu bestimmen, in dem der Ausdruck fällt. Unter dem Galgen stehend gab Eichmann Worte von sich, die er offenbar lange vorbereitet hatte. Sie sind, wie Hannah Arendt bemerkt, von einer makabren Komik: “In einem kurzen Weilchen, meine Herren, sehen wir uns ohnehin alle wieder. Das ist das Los aller Menschen. Gottgläubig war ich im Leben. Gottgläubig sterbe ich.“ Er gebrauchte, so fährt sie fort, die Nazi-Wendung von der Gottgläubigkeit, hatte nur übersehen, dass sie eine Absage an das Christentum und den Glauben an ein Leben nach dem Tode besagte. Eichmann lässt sich weiter hören: “Es lebe Deutschland. Es lebe Argentinien. Es lebe Österreich. Das sind die drei Länder, mit denen ich am engsten verbunden war. Ich werde sie nicht vergessen.“ Im Angesicht des Todes fiel ihm genau das ein, was er in unzähligen Grabreden gehört hatte: das “Wir werden ihn, den Toten, nicht vergessen.“ Sein Gedächtnis, auf Klischees und erhebende Momente eingespielt, hatte ihm den letzten Streich gespielt: Er fühlte sich “erhoben“, wie bei einer Beerdigung und hatte vergessen, dass es die eigene war. “In dieser letzten Minute“, schreibt Hannah Arendt, das Schlusswort des Angeklagten kommentierend, “war es, als zöge Eichmann selbst das Fazit der langen Lektion in Sachen menschlicher Verruchtheit, der wir beigewohnt hatten – das Fazit von der furchtbaren Banalität des Bösen, vor der das Wort versagt und das Denken scheitert.“ Damit war die Formel geboren, die so viel Aufsehen und Polemik hervorrief. Sie trat dann auch im Untertitel der Buchveröffentlichung auf.
Ursprünglich war Hannah Arendt nach Jerusalem gekommen, um die Figur des radikal Bösen anzutreffen. So schreibt sie an S. Neumann am 15. 7. 1961: “Ich bin ja eigentlich hingefahren, weil ich partout wissen wollte, wie einer aussieht, der “radikal Böses“ getan hat.“ Eichmann als die Verkörperung des radikal Bösen: Das war sozusagen die Standardauslegung der Untaten dieses Menschen, nicht nur bei Hannah Arendt, sondern überhaupt in Israel und in der Judenschaft. Stattdessen sah sie sich einem in seiner Durchschnittlichkeit eher lächerlich anmutenden Menschen gegenüber, der sich in seinem Glaskasten durch nichts außer durch Beflissenheit auszeichnete. Wie ließ sich verstehen, dass hier jemand stand, der in seiner Unscheinbarkeit mit Verbrechen verbunden war, die alles bislang Bekannte weit überstiegen. Und dieser Täter hatte, wie er dort stand, nichts Dämonisches an sich, im Gegenteil! In den Worten von Hannah Arendt: “... in dem Bericht selbst kommt die mögliche Banalität des Bösen nur auf der Ebene des Tatsächlichen zur Sprache, als ein Phänomen, das zu übersehen unmöglich war. Eichmann war nicht Jago und nicht Macbeth, und nichts hätte ihm ferner gelegen als mit Richard III. zu beschließen, ‚ein Bösewicht zu werden‘“. Bei diesen Gestalten Shakespeares ist es richtig, vom “radikal Bösen“ zu sprechen. Ihre radikale Bösartigkeit beruht darin, dass sie alles ausschließlich in Bezug auf sich selbst zu sehen vermochten. Eichmann dagegen mangelt alle Größe dieser Verbrecher; er war ein kleiner Bürokrat, der an eine Stelle geraten war, an der er Fürchterliches anrichten konnte und dies auch getan hatte, ohne auch nur im Mindesten zu begreifen, was er da getan hatte: ein Fall von extremer Gedankenlosigkeit. Es kann sogar sein, dass er Fürchterlicheres anrichtete, als alle diese selbstbezüglichen Bösewichte. Für dieses Phänomen und seine Wahrnehmung tritt dann bei weiterem Durchdenken das Konzept der Banalität des Bösen ein: also vom “radikal Bösen“ zur “Banalität des Bösen“. Auf diesem Konzept beruht Hannah Arendts Bericht über den Eichmann-Prozess in Jerusalem.
Dieser Wechsel der Konzepte stellt ein wesentliches Moment ihrer wachsenden Einsicht in das Phänomen des Totalitarismus dar. Es handelt sich nicht um einen bloßen Austausch der Begriffe. Das neue Konzept gehört zur wachsenden Wahrnehmung durch Hannah Arendt, dass das Phänomen des Totalitarismus gegenüber den traditionellen Verfehlungen des Politischen etwas gänzlich Neuartiges darstellt, das mit den hergebrachten Kategorien nicht verständlich gemacht werden kann. Letztlich heißt dies, dass der gesamte hergebrachte Verständnishorizont des Politischen aufgegeben werden muss, um den Herausforderungen der Moderne begegnen zu können. Hannah Arendt ist die Denkerin, die dies mit zunehmender Klarheit gesehen hat und die den damit sich eröffnenden Weg eingeschlagen hat. Die Bedeutung ihres politischen Denkens beruht in hohem Maße im Aufweis einer umfassenden neuartigen Wahrnehmung des Politischen angesichts der Neuartigkeit der politischen Phänomene und überhaupt des Phänomens des Politischen, und diese neuartige Wahrnehmung stellt sich zunächst in dem Wechsel vom Konzept des “radikal Bösen“ zu dem der “Banalität des Bösen“ dar. Sie führt aber darüber hinaus. Ich möchte so weit gehen zu behaupten, dass die Neuartigkeit der Phänomenologie des Politischen bei Hannah Arendt schließlich in der vollständigen Ablösung des traditionell im deutschen Kulturkreis leitenden Paradigmas des herrschaftskategorial bestimmten Staates besteht. So stellt sich im Wechsel der Konzepte vom “radikal Bösen“ zur “Banalität des Bösen“ ein wesentliches Wegstück des neuartigen Denkens des Politischen durch Hannah Arendt dar. In dem auch in anderer Hinsicht bemerkenswerten Brief an Gershom Scholem (den sie mit der deutschen Version seines Vornamens, mit “Gerhard“, anredete, was seine Ansprechbarkeit nicht erhöht haben dürfte) vom 20. Juli 1963 heißt es: “I changed my mind und spreche nicht mehr vom radikal Bösen.“ Was sind die Gründe für diesen Meinungswechsel? Mit dem neuen Konzept sind eine ganze Reihe von Schwierigkeiten gegeben, ganz abgesehen davon, dass es zum Anlass von erheblichen Kontroversen wurde. Die arendtschen Kontrahenten in diesen Polemiken sind vielfach gar nicht auf die Ernsthaftigkeit ihrer Argumente eingegangen; ja, es kam oftmals vor, dass sie das Buch überhaupt nicht gelesen hatten. Die Kontroversen wurden mit erbitterter Schärfe geführt, und die wenigsten Kontrahenten waren bereit zu erklären: Ich habe mich geirrt.
Hannah Arendt hat das ihr vor Augen stehende Phänomen der Banalität des Bösen anhand der Figur des Adolf Eichmann eindringlich beschrieben. “Außer einer ganz gewöhnlichen Beflissenheit, alles zu tun, was seinem Fortkommen dienlich war, hatte er überhaupt keine Motive; und auch diese Beflissenheit an sich war keineswegs kriminell, er hätte bestimmt niemals seinen Vorgesetzten umgebracht, um an dessen Stelle zu rücken. Er hatte sich nur, um in der Alltagssprache zu bleiben, niemals vorgestellt, was er eigentlich anstellte.“ Damit benennt Hannah Arendt ein für sie ganz entscheidendes Moment in der Struktur des Phänomens der Banalität des Bösen, die Gedankenlosigkeit. Der Mangel an Urteilskraft, sich überhaupt nicht vorstellen zu können, was man angestellt hat, ja die Weigerung dies zu tun, ist ein wesentliches Moment der Banalität des Bösen. Hannah Arendt wird daraus ihre Beschäftigung mit der Urteilskraft entfalten, für sie das eigentlich politische Vermögen. Die Urteilskraft ist für sie das politische Vermögen, das Vermögen des Politischen schlechthin. Sie erblickt diesen Mangel leibhaftig an der Figur des Adolf Eichmann.
Was ist eigentlich das Motiv für den Paradigmenwechsel vom “radikal Bösen“ zur “Banalität des Bösen“? Natürlich kann gesagt werden die Diskrepanz zwischen der Ungeheuerlichkeit der Taten und der Unscheinbarkeit des Täters. In dem schon einmal zitierten Brief an Gershom Scholem, in dem Hannah Arendt angekündigt hatte “I changed my mind“, fährt sie fort: “Ich bin in der Tat heute der Meinung, dass das Böse immer nur extrem ist, aber niemals radikal, es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. Tief aber und radikal ist immer nur das Gute.“ Vom “radikal Bösen“ zu sprechen, teilt dem Bösen eine Größe zu, die ihm nicht zukommt. Hannah Arendt macht von einem Gedanken Gebrauch, der in einem frühen Brief von Karl Jaspers an sie so formuliert ist: “Ihre Auffassung“ [H. A. hatte zuvor erklärt, dass die Ungeheuerlichkeit der nationalsozialistischen Untaten eine juristische Erfassung unmöglich macht] “ist mir nicht ganz geheuer, weil die Schuld, die alle kriminelle Schuld übersteigt, unvermeidlich einen Zug von Größe – satanischer Größe – bekommt, die meinem Gefühl angesichts der Nazis so fern ist wie die Rede vom Dämonischen in Hitler und dergleichen. Mir scheint, man muss, weil es wirklich so war, die Dinge in ihrer ganzen Banalität nehmen, in ihrer ganz nüchternen Nichtigkeit. ... Ich sehe jeden Ansatz von Mythos und Legende mit Schrecken, und jedes Unbestimmte ist schon solcher Ansatz ... Es ist keine Idee und kein Wesen in dieser Sache.“ An die Stelle der Kennzeichnung “radikal“ für das Böse, die ihm aus den angegebenen Gründen abgesprochen wird, tritt hier die Kennzeichnung “banal“. So betrachtet würde der Ausdruck “Banalität des Bösen“ von Jaspers stammen. Hannah Arendt ist jedoch niemals auf diese Herkunft zurückgekommen, obwohl ihr das Argument von Jaspers eingeleuchtet haben muss, denn sie bringt seinen Kern in ihrem Brief an Gershom Scholem vor. Karl Jaspers selbst erwähnt später eine ganz andere Herkunft. Er schreibt ihr, ein gemeinsamer Bekannter (der Maler Al Copley) habe ihm erzählt, “Heinrich [Blücher, ihr Mann] habe die Redewendung ,Banalität des Bösen‘ erfunden und mache sich nun Vorwürfe, dass Du ausbaden musst, was er angerichtet hat“. Hannah Arendt bestätigt das zu einem gewissen Ausmaß – und auch wieder nicht. In einem verloren geglaubten Brief an Karl Jaspers vom 29. Dezember 1963, einem Brief, der nun wieder gefunden und dessen Exzerpte veröffentlicht worden sind, schreibt sie: “Von Heinrich stammt der Untertitel nicht; er hat einmal vor Jahren gesagt: Das Böse ist ein Oberflächenphänomen – und das fiel mir in Jerusalem wieder ein; daraus kam schließlich der Titel.“ So bleibt die eigentliche Herkunft der Formel im Undeutlichen. Hannah Arendt wollte sie wohl auch nicht ins Spiel bringen, um ihren Urheber aus den heftigen Kontroversen herauszuhalten, die sich um die Formel herum entzündet hatten. Wichtiger als die Herkunft war ihr die Einsicht, die sie in das Phänomen gewährte. Diese Einsicht lässt sich so zusammenfassen: Es ist die ungeheuerliche Diskrepanz zwischen der Verruchtheit der Untaten und der banalen Nullität ihres Täters, die jedoch eine Vorbedingung für das Zustandekommen dieser fürchterlichen Untaten gewesen ist.
Aber ist das Phänomen darin richtig wahrgenommen, dass es als banal erscheint? In schroffer Weise hat Gershom Scholem das abgestritten, wenn er in einem Brief im August 1963 schreibt: “Über das Böse und dessen Banalität durch Bürokratisierung (oder dessen Banalisierung in der Bürokratie), die Sie bewiesen zu haben glauben, von welchem Beweis ich aber nichts bemerkt habe, werden wir uns sicherlich einmal unterhalten. Ich glaube, dass Eichmann, als er in der SSUniform herumspazierte und genoss, wie alles vor ihm zitterte, gar nicht der banale Herr war, als den Sie ihn uns jetzt mit oder ohne Ironie aufreden wollen.“ Und auch Dan Diner hat in ähnlicher Weise wie Gershom Scholem sich geäußert, allerdings ohne dessen Aggressivität: “Der Mann im Glaskasten entsprach in seiner Farb- und Gefühllosigkeit genau jenem Naturell, auf das es ihr ankam: kleinbürgerlich angeleitet, als Person bedeutungslos, letztendlich banal. Das ist eine zutreffende Wahrnehmung, wenn auch nur die eine Perspektive ... Denn banal mag Eichmann im Glaskasten gewirkt haben – aller Insignien seiner vormaligen Stellung, seines Ranges und seiner Aura entledigt. Als etwa Joel Brand, der Eichmann in Budapest unter wenig anheimelnden Umständen begegnet war, aussagte, klang das schon ganz anders – damals, als Eichmann in schwarzer Uniform und Schaftstiefeln ihn, den unscheinbaren Budapester Juden, anherrschte oder wie Brand sich im Prozess auf Deutsch ausdrückte: anbellte und ihm jenes dämonische Angebot machte: Ware gegen Blut – Blut gegen Ware. Damals mutete Eichmann keineswegs banal an.“ Aber war nicht dieser Auftritt gerade ein richtiges Indiz für die Banalität des Bösen einer Figur von totaler Nichtigkeit, die sich mit den Insignien der Macht umkleiden muss? Was bei beiden, bei Gershom Scholem und bei Dan Diner, übersehen wird, ist die im Konzept der “Banalität des Bösen“ gegebene Einsicht in die totalitäre Struktur des Phänomens. Das Skandalwort von der “Banalität des Bösen“ intendiert nicht etwa eine Abschwächung, keine Bagatellisierung der Untaten und ihres Täters, sondern ganz im Gegenteil eine Verschärfung der Verruchtheit sowohl des Täters als auch seiner Untaten, denn diese Banalität wird ja ausdrücklich als fürchterlich gekennzeichnet. Dies soll vor allem darauf hinweisen, dass in der modernen Massengesellschaft eine gefährliche Tendenz besteht, dies alles als “normal“ erscheinen zu lassen und was wiederum dazu beiträgt, dass sich sowohl auf der Seite der kulturtragenden Schichten als auch auf der Seite des Mobs genügend Personal bereitstellt, weil die Grenze zwischen diesen beiden Schichten zusammengebrochen ist. Der Einsatz der Kennzeichnung “banal“ an Stelle der ursprünglichen Kennzeichnung “radikal“ intendiert gerade das Sichtbarmachen einer gefährlichen Möglichkeit der Moderne, dies alles auch noch als normal wahrzunehmen. Die Kennzeichnung “radikal“ ist dazu nicht im Stande, weil das Radikale, worauf Jaspers ja hingewiesen hat, stets den Charakter des Außergewöhnlichen hat. Bleibt die Frage, warum dieser Menschentypus gerade in Deutschland, das eine bildungsaristokratische Kultur von höchster Geistigkeit aufzuweisen beanspruchte, solche fürchterlichen Auswirkungen hat haben können. Hannah Arendt beantwortet diese Frage so: “Es ist richtig, daß dieser moderne Typus Mensch, den wir hier mangels eines besseren Namens mit dem alten Wort Spießer bezeichnet haben, auf deutschem Boden eine besonders gute Chance des Blühens und Gedeihens hatte. Kaum ein anderes der abendländischen Kulturländer ist von den klassischen Tugenden des öffentlichen Lebens so unberührt geblieben; in keinem haben privates Leben und private Existenz eine solche Rolle gespielt.“ Hier spricht Hannah Arendt ein fundamentales Problem des deutschen Kultur- und Selbstverständnisses an. Nur in Ansätzen kann das Problem in diesem Rahmen entfaltet werden. Das deutsche Kultur- und Selbstverständnis ist – oder war zumindest – in hohem Maße gespalten, ja regelrecht zerrissen. Auf der einen Seite existierte ein bildungsaristokratischer Individualismus, der zu den Gewöhnlichkeiten des öffentlichen Lebens Abstand hielt, zu der auch die Politik gerechnet wurde. Komplementär konnte der Politik aber auch ein Rang zugesprochen werden, der sie als die höchste Gestaltung der Kultur bewertete. Beide komplementär-antagonistischen Gestaltungen existierten wiederum in je einer hochkulturellen und einer vulgärkulturellen Version. Die Problematik des deutschen Kultur- und Selbstverständnisses vergrößerte sich noch dadurch, dass es keinerlei sicheres Kriterium der Unterscheidung zwischen diesen unterschiedlichen Variationen gab, sodass sich die eine für die andere ausgeben und so mit ihr verwechselt werden konnte. Der Spießer konnte sich und die anderen davon überzeugen, der wahre Repräsentant der deutschen Kultur und ihrer Innigkeit zu sein.
Über das Spießertum des Spießers hat sich Hannah Arendt in einem frühen Aufsatz ausgesprochen, der im April 1946 in der von Dolf Sternberger herausgegebenen Zeitschrift Die Wandlung erschien. Der Prototyp des Spießers ist hier Heinrich Himmler, einer der ungeheuerlichsten Massenmörder der Geschichte, der zu dieser Ungeheuerlichkeit gerade durch sein Spießertum und seine Banalität “befähigt“ war! Hier führt Hannah Arendt aus: “Um zu wissen, welches die eigentliche Triebfeder im Herzen der Menschen ist, durch die sie in die Maschine des Massenmordes einzuschalten waren, werden uns Spekulationen über die deutsche Geschichte und den sogenannten deutschen Nationalcharakter, von dessen Möglichkeiten die besten Kenner Deutschlands vor fünfzehn Jahren noch nicht die leiseste Ahnung hatten, wenig nutzen. Aufschlußreicher ist die eigentümliche Figur dessen, der sich rühmen kann, das organisatorische Genie des Mordes zu sein. Heinrich Himmler gehört nicht zu jenen Intellektuellen, welche aus dem dunklen Niemandsland zwischen Bohème- und Fünfgroschenjungen-Existenz stammen und auf deren Bedeutung für die Bildung der Nazielite in neuerer Zeit wiederholt hingewiesen worden ist. Er ist weder ein Bohèmien wie Goebbels noch ein Sexualverbrecher wie Streicher noch ein pervertierter Fanatiker wie Hitler noch ein Abenteurer wie Göring. Er ist ein Spießer mit allem Anschein der Respektabilität, mit allem Anschein des guten Familienvaters, der seine Frau nicht betrügt und für seine Kinder eine anständige Zukunft sichern will. Und er hat seine neueste, das gesamte Land umfassende Terrororganisation bewußt auf der Annahme aufgebaut, dass die meisten Menschen nicht Bohémiens, nicht Fanatiker, nicht Abenteurer, nicht Sexualverbrecher und nicht Sadisten sind, sondern in erster Linie ,jobholders‘ und gute Familienväter.“ Das Spießertum des Spießers, der zu allem fähig ist, sofern ihm nur die Verantwortung abgenommen wird, ist die Vorprägung der Banalität des Bösen. Es lässt in der modernen Massengesellschaft die Verantwortungslosigkeit für das Öffentliche als normal erscheinen. Heute kann gefragt werden, ob nicht doch auch die anderen Figuren des Personals der totalitären Herrschaft Züge dieses Spießertums aufweisen. Über alle Einsichten in das Phänomen des Totalitarismus und die Authentizität des Politischen hinaus kann die Bedeutung und damit die Größe des politischen Denkens von Hannah Arendt für uns und heute so festgestellt werden: In diesem Denken werden wesentliche Defizite des deutschen Kultur- und Selbstbewusstseins herausgestellt, die mit zur Anfälligkeit gegenüber dem totalitären Syndrom beigetragen haben. Diese Defizite bestehen in der abstrakten Abtrennung des Politischen von der Kultur, der wiederum eine ebenso abstrakte Überordnung der Politik in Gestalt des Staates über die Kultur antwortet. Für beide Abstraktionen lassen sich entsprechende Exempel finden. Beide Abstraktionen sind mit korrelativen Strukturen verbunden. Auf der einen Seite die Figur des “Staates an sich“, der das Monopol des Politischen für sich beansprucht, das ihn den widerspruchslosen Gehorsam seiner Untertanen einfordern lässt, ausgeübt von den legitimen oder auch nur faktischen Inhabern der staatlichen Macht. Auf der anderen Seite die isolierten Individuen, die dieser Macht willig Gehorsam zollen, auch um den Preis ihrer Verantwortlichkeit, sofern nur ihre Privatheit davon nicht betroffen ist. Was dagegen im politischen Denken von Hannah Arendt vorliegt und angeboten wird, ist das Konzept einer Kultur des Politischen, in der die angesprochenen Abstraktionen nicht auftreten. Diesem Denken zu folgen, besagt einen politikkulturellen Paradigmenwechsel vorzunehmen. Hannah Arendt hat einen entscheidenden Ansatz dazu bereitgestellt.
Der lange Marsch zu einer Politik der Freiheit
Revolutionen und Revolten zwischen Totalitarismus und Fundamentalismus
Es gibt Zitate, die passen zu allem. Ich will meinen Beitrag mit einem Zitat von Hannah Arendt beginnen. “Alles Denken unterminiert tatsächlich, was immer es an starren Regeln, allgemeinen Überzeugungen gibt. Alles, was sich im Denken ereignet, ist einer kritischen Überprüfung dessen, was ist, unterworfen. Das heißt, es gibt keine gefährlichen Gedanken aus dem einfachen Grund, weil das Denken selber ein solch gefährliches Unterfangen ist. Nicht-Denken allerdings ist noch gefährlicher. Damit leugne ich nicht, daß das Denken gefährlich ist, würde aber behaupten, daß das Nicht-Denken noch viel gefährlicher ist.“ Es wird sehr viel der Politik der Freiheit gedacht und sehr viel gesagt, wie kann überhaupt politisches Handeln aussehen? Hannah Arendt sagt an einer anderen Stelle: Ich bediene mich, wo ich kann. Ich nehme, was ich kann und was mir passt. Ich denke, einer der großen Vorteile unserer Zeit ist wirklich, dass unserer Erbschaft keinerlei Testament vorausgegangen ist. Das heißt, es steht uns vollkommen frei, uns aus den Töpfen der Erfahrungen und Gedanken unserer Vergangenheit zu bedienen; mich zwanglos zu bedienen aus den Töpfen der Vergangenheit, unserer Geschichte. 68, ich stehe anscheinend für dieses Datum. Was wollte diese Generation? Diese Generation wollte eine andere Welt. Diese Generation empfand die Welt, in der sie aufgewachsen war, in der sie lebte, als eine Welt, die durch Doppelmoral geprägt, eine Realität nicht nur nicht mehr wahrnehmen wollte, sondern überhaupt die Augen schließen wollte vor dieser Realität. Dies hatte verschiedene Namen. Es gab eine moralische Glocke, deswegen entstand dagegen das Bedürfnis, frei und anders zu leben. Es gab eine politische Glocke, deswegen rebellierte man gegen die Akzeptanz des Vietnamkrieges. Man wollte nicht schuldig sein an einem barbarischen Krieg gegen ein Volk, das sich selbst bestimmen wollte. Und letztendlich wollte man nicht, dass eine Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, überhaupt die Augen verschließt vor der eigenen Geschichte.
Dies waren kurz gesagt, die Beweggründe dieser Bewegung. Frei denken, frei leben, frei handeln zu wollen. Hannah Arendt hat das mit Recht so geschrieben. Und gleichzeitig war das aber eine Bewegung, die glaubte – ich möchte das mal mit einem berühmten Zitat beschreiben –, die Gnade der späten Geburt für sich in Anspruch nehmen zu dürfen. Sie hat nicht gewusst, dass Jahre später jemand das so beschreiben würde. Und warum? Weil diese Generation glaubte, unbefangen mit den Versatzstücken von Theorien und Geschichtsmomenten mit der unmittelbaren Vergangenheit umgehen zu können. Das bedeutet, Totalitarismus, Kommunismus – ein Problem? Nein! Deutschland, die Geschichte, die Amerikaner, das ist das Problem. Oder diese Bewegung setzte sich auseinander mit antiautoritärer Erziehung und bediente sich der proletarischen Erziehungsargumente einer ziemlich autoritären Vergangenheit. Ich könnte das fortsetzen.
Was ich damit sagen will ist, dass es einen zentralen Widerspruch gab in dieser Bewegung zwischen einem Freiheitsdrang, einem Freiheitsbedürfnis, und gleichzeitig eine Unfähigkeit, dies gedanklich zu fassen. Ich habe es mal so formuliert: Unsere Emotionen, unsere Vibrations waren okay, um das im Sprachgebrauch des damaligen Jargons zu sagen. Unsere theoretische Sprache war eine Steinzeitsprache und deswegen war das Leben historisch viel adäquater als alles, was wir historisch formulieren konnten. Dies hat fatale Entwicklungen gehabt. Dies hat Entwicklungen nach sich gezogen ab dem Moment, ab dem diese Bewegung eigentlich das erreichte, was sie erreichen konnte, nämlich die Gesellschaft aufzurühren, die Gesellschaft zu mobilisieren, der Gesellschaft ihre Selbstsicherheit wegzunehmen. Als das vollzogen war und es zum zweiten Schritt kam – Willy Brandt sagte: Demokratie wagen –, nämlich diese Demokratie gestalten zu können, waren viele von uns bereits in die Gestaltung des Sozialismus geflohen. In die Gestaltung einer Gesellschaftsordnung, die es real gab, den real existierenden Sozialismus, aber den wollte man sich überhaupt nicht ansehen.
Ich werde nie vergessen, als ich nach Deutschland kam und eine der ersten Demonstrationen mitmachte, wie aggressiv die Passanten waren, ich war ziemlich entsetzt. Und da dröhnte der Spruch: “Geh doch nach drüben!“ Beim nächsten Mal, als ich einen Pulk von sich gegen uns mobilisierenden Menschen sah, schrie ich spontan (und ich habe ein ziemlich lautes Organ): “Wenn es euch nicht gefällt, geht doch nach drüben, dort ist das Demonstrieren verboten!“ Es war absoluter Stillstand, Mitdemonstranten erstarrten als Eisblöcke, denn es wurde etwas gesagt, was unheimlich war. Nicht nur, dass man diesen Spruch übernahm, sondern man drehte ihn gegen die hiesige Gesellschaft, und darunter war ein tiefer theoretischer Satz und eine tiefe theoretische Spaltung, die ich mit dieser Bewegung in diesem Moment empfand und die mich fast nie verlassen hat in der Auseinandersetzung in der Bundesrepublik. Ich meinte, von den beiden deutschen Staaten war die Bundesrepublik Deutschland das Beste, aus dem einfachen Grund, weil man in der Bundesrepublik Deutschland, bei aller Kritik, kämpfen konnte, während man auf der anderen Seite ins Gefängnis kam, wenn man nur den Mund aufmachte. Das war für mich ein wesentliches Merkmal der Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus. Und es hat lange gedauert, bis dies verstanden wurde. Symbol dafür war theoretisch, dass diese Studentenbewegung, dass diese Bewegung als ideologische Ikone Herbert Marcuse hatte und überhaupt nicht wahrnehmen wollte oder konnte: Hannah Arendt. Denn sie war ja Sprachrohr des Konservatismus und der Rechten, weil sie es wagte, in einem Atemzug zwei Totalitarismen miteinander zu vergleichen, nämlich den Kommunismus und den Faschismus oder Nationalsozialismus. Das war der Beweis einer grundkonservativen Haltung. Niemand hat sich in dieser Zeit mit Hannah Arendt auseinander gesetzt. Und deswegen ist es meiner Meinung nach nachvollziehbar, warum diese an Freiheit hängende, nach Freiheit dürstende Bewegung, warum sie sich transformieren konnte in eine fast totalitäre nicht Bewegung, sondern in totalitäre Momente, die sich am reinsten dann darstellten bei der RAF und allen bewaffneten Kämpfern. Aber totalitär Ideologisches konnte auch bei allen kommunistisch marxistisch-leninistischen Organisationen gefunden werden und auch totalitär existieren in einer bestimmten Form auch in der Sponti-Bewegung, nämlich das Totalitäre in der Definition dessen, was richtig oder falsch war im Alltagsleben. Oder anders ausgedrückt, das Nicht-Reflektieren über gesellschaftliche Prozesse und Demokratie. Was nach sich zog, dass man überhaupt nicht mehr diskutieren konnte oder in der Lage war zu fragen: Was kann oder welcher politische Rahmen kann oder muss existieren, damit wir den Emanzipationsprozess, den wir wollen, überhaupt gestalten können?
Ich will jetzt eine Klammer machen. Ich habe diese Bewegung kritisiert, doch eins möchte ich doch feststellen. Ich glaube, das Drama der Politik und der politisch handelnden Menschen ist, dass sie wahrscheinlich immer irgendwann Unsinn formulieren. In einem ungeheuerlichen Ausmaß können sehr intelligente Menschen, Menschen, die später, Jahre später, entfernt von bestimmten Ideologien, ganz profunde und fundamentale Sachen sagen, plötzlich trotzdem in einer Zeit, in der das Ideologische die einzige Brille ist, mit der die Realität überhaupt verstanden oder gesehen wird, aberwitzige Dinge tun. Als Beispiel möchte ich aus einem ganz anderen Zusammenhang ein Beispiel bringen – damit Sie alle erlöst sein können und nicht verkrampfen, sondern sagen, die Kritik ist gegen alle gerichtet, das ist nicht besonders gegen die Linke oder gegen die Rechte, sondern gegen alle. Es gibt einen sehr intelligenten Menschen, der heißt Benjamin Franklin. Benjamin Franklin war einer der Erstunterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Er ist der Erfinder des Blitzableiters. Also, man kann wirklich nicht sagen, es ist der dümmste Mensch auf Erden, und er hat, wenn man Hannah Arendt liest und die Funktionen der amerikanischen Revolution für eine Verfassung, er hat was Großes mitgeleistet. Und Benjamin Franklin hat ein kleines Problem gehabt in Amerika. Es gab zu viele Einwanderer, und die falschen Einwanderer, und das hat ihn gestört, das war grausam, und dann hat er ein Pamphlet formuliert – ein intelligenter Mensch –, über die Einwanderer. Und das möchte ich zitieren, damit wir wissen, wir sind nicht allein, wenn wir was Dummes sagen. Also, Benjamin Franklin denkt nach über ethnische Reinheit in Amerika, 1751: “Die Zahl ganz weißer Menschen in der Welt ist verhältnismäßig sehr klein. Ganz Afrika ist schwarz oder dunkel, auch ganz Amerika, außer den Neuankömmlingen. Und in Europa haben die Spanier, Italiener, Franzosen, Russen und Schweden das, was wir gewöhnlich eine dunkle Hautfarbe nennen. So sind auch die Deutschen dunkel, mit Ausnahme alleine der Sachsen, die mit den Engländern die Hauptmasse der weißen Bevölkerung auf der Erdoberfläche ausmachen. Ich wollte, es wären ihrer mehr.“
Dies will ich Otto Schily widmen zur Einwanderungsdebatte. Wir können es drehen und wenden wie wir wollen – wir haben zum Glück 68 politisch verloren, und wir haben zum Glück sozial vieles gewonnen. Wir haben die Gesellschaft verändert, die Gesellschaft hat sich verändert, aber alle unsere politischen Vorschläge, die Rätedemokratie, die, ich würde sagen, so formuliert, wie sie ansatzweise bei uns formuliert war, ist nicht durchgekommen. Nur müssen wir uns die Frage stellen, bedeutet das die Absage an radikale Kritik, gar an Utopie? Ich glaube nicht. Und das ist sicherlich eines der großen Probleme, die wir, die Grünen, haben; wir, die Politik weitermachen nach den Sechzigerjahren. Sich auf eine Realität einzulassen, die manchmal sehr unangenehm ist und widersprüchlich, und trotzdem in der Lage zu sein, über diese Realität hinwegzudenken, sogar Positionen zu formulieren, die trotzdem emanzipatorische Ansprüche haben. Dies ist meiner Meinung nach eigentlich die Aufgabe unserer Generation. Wir sind gescheitert, viele von uns sind daran gescheitert. Ich würde sagen, dass es die Pflicht ist – ob von einzelnen, von mehreren –, eine Politik der Freiheit, das heißt, das Denken in Freiheit, das Denken über das, was heute ist, hinaus, wenigstens dieses Unterfangen zu probieren, dieses Abenteuer zu probieren, damit wir nicht immer wieder diesen Zirkel erleben: Bewegung, Emanzipationswünsche, Bewegung langsam am Ende, Fundamentalisierung dieser Bewegung – und am Ende Zusammenbruch, weil natürlich die Fundamentalisierung, das Gesinnungsfundamentale, es uns nicht mehr ermöglicht, die Realität zu sehen.
Und da gibt es viele Beispiele: Die Ökobewegung. Sie war ja richtig, sie ist ja richtig, die Kritik an der Produktionsweise unserer spätkapitalistischen Gesellschaft ist richtig, die Wachstumskritik ist richtig, und trotzdem entstand da plötzlich ein Ökofundamentalismus, der allen Menschen aufoktroyieren wollte, wie sie zu leben, zu atmen oder zu riechen haben. Und wir waren unfähig, uns die zentrale Frage zu stellen: Wenn es richtig ist, dass diese Gesellschaft, diese Produktionsweise, diese nur auf Kapitallogik organisierte Gesellschaft, ihre eigene Zerstörung organisiert, wie gewinnen wir Mehrheiten, die das verstehen? Das ist das zentrale Problem. Nicht, wie haben wir Recht, sondern wie sind wir in der Lage, so politisch zu handeln, dass das, was notwendig ist, auch von allen eingesehen oder mindestens politisch gebilligt wird? Sonst wird nur postuliert. Die Minderheiten, die Emanzipation von Rassismus, der Kampf gegen Rassismus, bis hin zu Fundamentalismus, in Amerika die schwarze Bewegung, bis hin zu den Black Panthers – das heißt, wir haben eine erschreckende Wiederholung des Immergleichen. Und dieses zu besprechen, das, glaube ich, ist die Aufgabe, die wir haben – und schon deswegen, weil wir wieder eine neue Bewegung haben. Wir haben eine neue Bewegung im Moment, die was Richtiges sagt, die eine ganz einfache Frage stellt: Wieso akzeptieren wir, dass die Welt, so, wie sie ist, so ungerecht ist? Wieso akzeptieren wir, dass, wenn man von Globalisierung redet, es bedeutet, dass der Wohlstand von wenigen in der Welt besser organisiert wird und dass diese Globalisierung nicht so ausgerichtet wird, dass die Menschen in der Welt davon profitieren können? Natürlich ist es zu einfach, werden hier kluge Neoliberale sagen, aber natürlich, von der Entwicklung, von der Öffnung der Märkte, profitieren auch die anderen. Es stimmt auch ein bisschen, vielleicht, manchmal, wenn es gerade richtig geht, wenn es gut läuft, wenn es gerade nicht die falsche Entscheidung war am falschen Ort. Nur das Problem ist auf alle Fälle, dass das Profitieren von Märkten nicht das Hauptproblem derjenigen ist, die im Moment die Globalisierung als Projekt betreiben, sondern es gibt eine neoliberale These – wieder ein neuer Fundamentalismus –: Der Markt regelt alles. Die Postulierung des Marktes. Wir hatten wieder was anderes anno dazumal: die Ablehnung der Marktwirtschaft. Da kamen alle Verrücktheiten. Man sollte Kursbuch Nr. 13 lesen, über die Selbstorganisation der Räte in Westberlin, die Enzensberger, Rudi Dutschke und andere sich vorstellten, wie man selbst Berlin praktisch organisieren kann, losgelöst vom Westen, vom Osten, von oben und von unten – das ist eine ganz spannende Diskussion. Also, nein zum Markt war ein Fundamentalismus; ja, der Markt regelt alles ist der neue, der herrschende Fundamentalismus – und in dieser Auseinandersetzung scheint es, als ob wir keine Stimme hätten, dass wir nur entweder dem einen zustimmen sollten oder dem anderen. Und das möchte ich am Ende dann wieder aufgreifen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir hier eine Schlüsselfunktion haben, ob wir wirklich nur das, was ist, akzeptieren und deswegen nur Politik machen, um das, was ist, zu gestalten, was ziemlich langweilig ist – oder ob wir andere Ansprüche haben in unserer Gestaltungsfähigkeit, als nur das, was ist, zu gestalten. Aber dafür muss ich einen Umweg machen.
Vorhin wurde gesagt, Krieg ist wieder ein Mittel der Politik, und wenn ich die Betonung richtig verstanden habe, ist das schrecklich. Dass man es schrecklich findet, ist, glaube ich, von niemandem in Abrede zu stellen. Die Frage, vor der wir uns befinden, ist schlicht und einfach: Wie gehen wir mit dieser Realität um? Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Menschen in Deutschland, nicht nur bei den Grünen, der Realität den Rücken zuwenden. Sie haben eine Vorstellung von der W elt, von dem, was sein sollte. Ab und zu riskieren sie einen Blick nach hinten, sehen Grausamkeiten und sagen: nee nee, die Welt, die wir wollen, die ist da, die Welt, wie sie ist, ist da, und dann marschieren sie dieser Realität entgegen, weil sie sich ihr entziehen wollen. Wer Politik machen will, kann sich der Welt nicht entziehen. Hannah Arendt: “Solange Europa geteilt bleibt“ – sie schreibt in den Siebzigerjahren – “kann es sich den Luxus erlauben, sich vor diesem beunruhigenden Problem der modernen Welt zu drücken. Es kann weiterhin so tun, als ob die Bedrohung unserer Zivilisation von außerhalb käme, Europa also von zwei ausländischen Mächten, die ihm gleichermaßen fremd sind, bedroht wird. Beide Strömungen, Antiamerikanismus und Neutralismus, sind in gewisser Hinsicht Anzeichen dafür, dass Europa im Augenblick nicht bereit ist, sich den Konsequenzen und Problemen seiner eigenen Geschichte zu stellen.“ Das ist nicht heute geschrieben worden, das ist nicht während Bosnien geschrieben worden, das ist 1971 geschrieben worden. Warum? Ich bin der festen Überzeugung, dass hier Hannah Arendt den Punkt trifft.
Wir haben in Deutschland, vor unserer Tür, jahrelang einen Krieg gehabt – in Bosnien: Tausende von Toten, Tausende und Tausende von Toten, es wurde gebombt, Städte wurden zerbombt von regulären Armeen, Bosnien, Kroatien. Es wurde gebombt, gemordet, und dann kam das, was wir alle wollten, die Vereinten Nationen. Und dann kam das, was wir alle wollten, dass die Blauhelme dazwischengehen. Fünfzigtausend Soldaten waren in Bosnien, Blauhelme. Sie sollten den Krieg beenden. In ihrer Anwesenheit sind Zigtausende von Menschen ermordet worden, erschlagen, Tausende von Frauen vergewaltigt worden, ins KZ gesteckt, in Anwesenheit der größten Armada, die die Vereinten Nationen je mobilisiert haben, als friedensstiftende Armee. Haben wir geschrien? Haben wir “Nie wieder Krieg!“ so geschrien wie zur Zeit des Vietnamkrieges? Waren unsere Straßen so voll? Waren wir tatsächlich empört? Waren unsere Fenster voller Laken? Nie wieder Krieg! Und hier, Blauhelme, stoppt das doch endlich! Wir haben das wahrgenommen in den Nachrichten und plötzlich, plötzlich kam Srebrenica, der zukünftige Außenminister hat es endlich verstanden, und die Auseinandersetzungen wurden dann geführt, wie Menschen gesagt haben: Nicht mehr “Nie wieder Krieg“ – “Nie wieder Srebrenica“. In Anwesenheit wieder der Blauhelme, mehrerer Tausend holländischer Blauhelme, wurden durch eine reguläre Armee sieben- bis achttausend Menschen gefangen genommen, in die Wälder getrieben und alle ermordet. So, an diesem Punkt gibt es Fragen: Wer ist schuld? Was bedeutet “Nie wieder Krieg“? Nie wieder Krieg bedeutet in diesem Moment, mit dieser Realität: Stoppt diesen Krieg! Die Blauhelme haben ihn nicht gestoppt. Also, die Blauhelme konnten nicht als Blauhelme Kriegshandlungen selbst initiieren. Da kam die NATO, da kam die Intervention, und dann waren wir elektrisiert. Nie wieder Krieg! Unsere Straßen wurden wieder voll, unsere Herzen waren wieder voller Hass, unsere Tränen waren wieder in unseren Augen, wir waren wieder da. Warum? Weil die Amerikaner da waren. Plötzlich waren wir wieder da. Vorher haben wir gelitten, still. Und dann durften wir wieder nach außen, durften wir endlich sagen, nein, diese Welt von Krieg wollen wir nicht, Krieg kann keine Probleme lösen.
Krieg kann keine Probleme lösen, sagen die Spätgeborenen in der Bundesrepublik. “Krieg kann keine Probleme lösen! Wie seid ihr frei geworden?“, sagen die Amerikaner. Durch Blauhelme? Nein, durch den Tod von irgendwelchen jungen Amerikanern aus Iowa, denen gesagt wurde, es muss sein, ihr müsst an den Stränden der Normandie für die Freiheit sterben. Natürlich für die ökonomische Macht der Amerikaner, natürlich auch dafür, weil Amerika gesagt hat, die Welt, so, wie sie ist, darf nicht mehr so sein, und wir, die Amerikaner, übernehmen die Führung in dieser Welt. Ja. Und wir haben, später mit der Nordallianz, dann auch akzeptiert, dass Stalin, die zweite große Barbarei auf dieser Welt, zum Bündnispartner wurde zur Befreiung Europas. Ohne Wenn und Aber. Schaut euch an, was es bedeutet hat, die Rote Armee in Berlin. Schaut euch das mal an! Was will ich wohl damit sagen?
Ich will damit sagen, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland und wir haben in Europa heute miteinander etwas zu klären. Gibt es historische Momente, in denen Freiheit verteidigt werden muss? Das ist eine einfache Frage. Die ist höchst kompliziert zu beantworten. Diese Frage wird von den einen instrumentalisiert – den Amerikanern in Vietnam: Im Namen der Freiheit wurde das vietnamesische Volk mit Krieg überzogen und das Land zerstört. Das heißt, wer die Frage so stellt, hat nicht immer Recht. Amerika war in den Sechzigerjahren nicht idealtypisches Abbild der Freiheit, die Schwarzen können ein Lied davon singen. Das heißt, das einfache Behaupten, ich verteidige die Freiheit, ist nicht die Antwort auf diese Frage. Aber es gibt historische Momente, in denen man sich entscheiden muss, dagegen oder dafür. Wenn man sich im Vietnamkrieg gegen die Amerikaner entschieden hat, hatte man meiner Meinung nach Recht. Ohne Wenn und Aber. Wenn man sich in Bosnien gegen die Amerikaner entschieden hat, hatte man Unrecht, weil dieser Krieg so war, dass die, die ihn begonnen haben, die Vernichtung der Bosnier wollten. Dies zu verhindern galt es, und deswegen war es Recht. Die Amerikaner waren bereit, die Vietnamesen zu vernichten, um ein politisches System aufrechtzuerhalten, wie sie es wollten. In Bosnien waren sie bereit, Menschen vor der Vernichtung zu schützen, das ist etwas ganz anderes. Deswegen sind sie nicht immer gut, und sie sind auch nicht immer böse. Man muss es politisch entscheiden.
Und dann geht es weiter mit Kosovo, Mazedonien. Wenn man Ja sagt zu einer militärischen Intervention, was ich die gleiche Logik finde, und ich will nicht noch einmal das gleiche Spiel machen über Kosovo, wie ich es zu Bosnien gemacht habe, weil es zu lange dauern würde, aber eins will ich sagen – man kann Ja zu einer Intervention sagen und trotzdem sehr kritisch mit der Art dieser Intervention umgehen. Natürlich gibt es auch ein Recht, was ein Rechtsstaat im Krieg aufrechterhalten muss, da gibt es Konditionen, da gibt es auch von der UNO, von dem Völkerrecht definierte Dinge, und da muss man genauso hart sein. Nur eins, und das meine ich mit der Realität, die Wahlen im Kosovo letzten Sonntag: Ohne das, was mit der Intervention geschah, hätte es diese Wahl nicht gegeben. Aber was war das Faszinierende an dieser Wahl? Ich war nach der Befreiung des Kosovo der Meinung, die Freiheit des serbischen Volkes auch dort geht nur über die Vertreibung von Milosevic. Nachdem dieses serbische Volk das verstanden hat, und nachdem Kostunica sich endlich entschied, im letzten Moment auch einen Aufruf zur Wahl zu machen im Kosovo, war das Faszinierende. Bis zum Anbruch der Dunkelheit hat es im Kosovo eine Wahlbeteiligung der Serben von 6 Prozent gegeben – bei Einbruch der Dunkelheit kamen Tausende und Tausende von Serben und gingen zur Wahl noch bis halb acht. Sodass die Wahlbeteiligung trotz der Bedrohung durch militante Kräfte bei sieben- oder achtundvierzig Prozent gelandet ist. Das ist meiner Meinung nach eine demokratische Lektion. Die Angst zu überwinden, um wählen zu gehen. Stellen wir uns das mal bei uns vor. In Timor haben die Menschen ihr Leben riskiert, um von den Bergen runterzukommen und wählen zu gehen. Unvorstellbar bei uns.
Diese Werte, die gilt es zu verteidigen, das ist die einzige Hoffnung – ich weiß nicht, ob es im Kosovo klappen wird. Ich weiß nicht, ob es in Mazedonien klappen wird, aber eins ist sicher: Mazedonien hat heute eine Verfassung, die den Minderheiten, den Albanern, den anderen, Rechte gibt, die sie noch nie hatten in diesem Land. Das heißt nicht, dass diese Verfassung, Verfassungsrealität, auch Lebensrealität für die Menschen jetzt in Mazedonien ist, aber alle, die ihr Gewissen mobilisiert haben, dass die Bundeswehr dort nicht die UCK entwaffnen kann, müssen dies oder dürfen das doch einmal überprüfen. Ist die Entwaffnung der UCK nicht Friedenspolitik gewesen? Ist es nicht Friedenspolitik, Hoffnung wieder zu installieren, was heißt, einem Land die Möglichkeit zu geben, eine Verfassungsrealität zu erhalten, in der sich die Menschen aus Mazedonien wieder frei fühlen. Trotzdem ist es richtig, wir hätten im Kosovo Rugova schon am Anfang unterstützen können, wir hätten schon lange wissen können, dass, wenn wir diese pazifistische Emanzipationsbewegung nicht unterstützen, es zum Kriege, zum Konflikt kommen wird. Das heißt, der Krieg im Kosovo, der Krieg in Bosnien, ist auch deswegen gewesen, weil wir versagt haben in unserer präventiven Politik. Das kann man genauso mit klaren Gedanken formulieren.
Zu Afghanistan. Natürlich sind die Amerikaner mitverantwortlich für die Verhältnisse in Afghanistan. Das ist nicht zu leugnen, genauso wie die Russen mitverantwortlich waren durch den Hitler-Stalin-Pakt. Das heißt, die Kritik an der Politik der Vereinigten Staaten, die Kritik an der maßlosen Arroganz, an der maßlosen Überheblichkeit, dass sie glauben, sie könnten die komplexe Welt heute allein führen, diese Kritik ist absolut richtig. Es ist eine politische, und diese politische Kritik müssen wir durchhalten. Deswegen sind alle Versuche, die Solidarität mit den Amerikanern durch irgendwelche Adjektive zu übersteigern, lächerlich, absolut lächerlich. Solidarität genügt, denn unabdingbare Solidarität, das müssten wenigstens die Linken wissen, die gibt es nicht mehr, spätestens seitdem wir die unabdingbare Solidarität mit den Befreiungsbewegungen aufgegeben haben, weil wir uns so oft geirrt haben. Man kann mit niemandem mehr unabdingbar solidarisch sein, auch nicht mit den Amerikanern, weil es Unsinn ist, völliger Unsinn. Das bedeutet, dass man solidarisch sein kann und seinen eigenen Kopf behält. Ohne Probleme. Die Frage aber ist: Afghanistan, worum geht es? Schlechte Zivilisation, der Islam, und da kommen alle toleranten Menschen dieser Welt und sagen, wir dürfen ja nicht den Islam verteufeln. Moment mal. Moment mal. Wir verteufeln gar nichts. Der Islam stellt sich dar, wie er ist. Wenn es nur etwas gegen den bösen Amerikanismus ist, wenn diese Gewalt, diese vernichtende Gewalt, die sich in New York artikuliert hat, nur in Amerika die Gewalt wäre, dann, wenn das alles wahr ist, dann hätte es Hunderttausende Tote in Algerien, die in Algerien umgebracht wurden von algerischen Fundamentalisten, nicht gegeben. Arme, Frauen, Kinder wurden massakriert, stranguliert, weil sie den Fundamentalisten nicht helfen wollten in Algerien gegen den korrupten Staat. Wenn die Islamisten nur gegen die Potentaten, gegen die Reichen, gegen die Symbole des Kapitalismus wären, warum mussten dann in Oran so viele Menschen sterben, warum mussten in Algier so viele Menschen sterben? Wenn die Amerikaner gar nichts tun? Vielleicht liegt es einfach in der Ideologie, an der bestimmten Interpretation des Islams, nicht der Islam als Ganzes. Aber niemand wird mir sagen, dass die Kreuzzüge mit dem Katholizismus nichts zu tun haben. Niemand wird mir sagen, dass das bestimmte Verhalten eines Papstes in einer bestimmten Situation nichts mit dem Katholizismus zu tun hat. Also wir dürfen ja noch irgendwann, auch wenn wir für Einwanderung, für Toleranz, für Offenheit sind, mal über Religion diskutieren, auch über die Vernebelung, auch über die autoritären Strategien von Religion, Menschen zu beherrschen, ohne dass man gleich zum Rassisten wird. Es ist unsere Pflicht – und dann diskutieren wir: Was ist das Taliban-Regime? Was war bin Laden? Das ist eine politische Strategie, die sich einer Religionsinterpretation bedient. Wenn man sich das letzte Video von bin Laden ansieht, da hat bin Laden nicht nur vier Punkte, sondern, Punkt fünf, nach dem Anschlag gesagt: Wiedereinführung des Kalifats. Diese Interpretation des Islam bedeutet, dass es nur eine Interpretation des Islam gibt. Dies ist gerichtet gegen andere Interpretationen, die alle nicht ausschließend sind, sondern den Islam in seiner Toleranzfassung sehen. Es gibt aber im Islam eine, die ausschließt, und das sind die wahhabitischen Interpretationen. Und das Entscheidende, natürlich kommt Palästina, natürlich kommt Israel, all das kommt vor, aber das Entscheidende ist: Saudi-Arabien. Und da sagt bin Laden, Scheich so und so, der lebt die Hälfte seines Lebens in London, die andere Hälfte in Saudi-Arabien. Und er macht eine Beschreibung der Realität in Saudi-Arabien, und zwar des korrupten Regimes und anderer Regimes, und in Pakistan, und setzt dagegen ein Projekt, ein politisches Projekt, und das Projekt ist das, was die Taliban in Afghanistan installiert haben. Diese Gesellschaftsordnung – die Frauen, die Männer, die sich nicht rasieren wollen, die Kinder, die Mädchen, die nicht zur Schule gehen dürfen –, ein System, was die höchste Sterblichkeitsrate an Kindern hat vor dem 11. September; die höchste Rate an Toten vor dem 11. September. Da sind Millionen, die sterben vor dem 11. September, auch im Krieg der Stämme miteinander und so weiter, auch in Verantwortung derjenigen, die sich später als Nordallianz strukturiert haben, politisch organisiert und strukturiert von den Amerikanern, und als die Amerikaner gemerkt haben, dies entgleitet ihnen, haben sie vor dem 11. September versucht zu verhandeln, sie haben die diplomatische Lösung gesucht, sie haben die politische Lösung gesucht, sie haben Druck auf Pakistan und Saudi-Arabien gemacht, die mitverantwortlich sind, obwohl sie als moderat gelten gegenüber anderen arabischen Staaten, in dem Sinne, dass man nicht zwei Hände abgeschnitten bekommt wie in Afghanistan, sondern nur eine Hand in der Scharia – das ist das Moderate an SaudiArabien. Die haben versucht, diese Lösung zu suchen und waren bereit zu kollaborieren mit den Taliban, die wollten überhaupt keinen Krieg mit den Taliban, die wollten die Taliban instrumentalisieren für eine Sicherung der Region, auch weil es um Öl, um Pipelines ging und so weiter. Sie haben das getan, was die gesamte Protestbewegung fordert, die politische Lösung zu suchen, aber das war nach dem 11. September nicht mehr möglich. Und warum? Weil es nicht einfach eine Kampfansage gegen Amerika war, sondern Amerika sollte getroffen werden, um in der pakistanischen Armee und in Saudi-Arabien zu zeigen: Wir sind in der Lage, indem wir die Amerikaner treffen, die Macht politisch zu übernehmen in Pakistan und Saudi-Arabien. Und das ist die politische Bewegung, Begründung, warum dies jetzt, nach dem 11. September, verhindert werden musste und warum diese Intervention meiner Meinung nach notwendig war. Das bedeutet, dass dies schrecklich ist, es gibt keinen sauberen Krieg. Und als die Alliierten in Cherbourg und Caen gelandet sind, haben sie Cherbourg und Caen bombardiert, und es sind Franzosen, Kinder und Frauen gestorben, weil es sonst nicht gegangen wäre, sie wären nie an der Küste sonst gelandet. Das leugne ich gar nicht. Nur eins – wenn wir in Deutschland immer hören, Kabul ist bombardiert, Kandahar ist bombardiert worden, mobilisiert das Dresden, Hamburg, Frankfurt, die Bombardierung der deutschen Städte? Nur das ist es nicht. Wäre dies der Fall, jetzt nachdem Kabul gefallen ist, also befreit wurde, dann schauen wir in die Augen der Menschen, sehen wir doch die Frauen, die Kinder, die Männer, die auf der Straße sind – fühlen sie sich bedroht durch die Befreiung? Hat die Weltpresse, die Weltmedien, alle Fernsehanstalten, von der ARD, von den Franzosen, die könnten uns die bombardierte Stadt zeigen, die könnten uns das Dresden, was Kabul hat, das Hamburg, was Kabul hat, das Peschawar, das Kandahar, was Hamburg hat, das könnten sie uns doch zeigen! Nein! Weil es nicht so ist. Das heißt nicht, dass die Amerikaner saubere Krieger sind. Ich sage einfach, dass sie nicht einen Krieg gegen das afghanische Volk geführt haben. Man kann immer noch gegen diesen Krieg sein. Das leugne ich nicht, ich will nur, dass man dann saubere Gedanken hat, dass man Gedankenschärfe hat. Dieser Krieg ist ein Krieg, der notwendig war – das ist meine These –, dieser Krieg darf nicht sein, ist eine andere These, aber dieser Krieg befreit auch die Afghanen, die unter dem Joch der Taliban gelebt haben. Das behaupten sie selbst. Lest heute in der Zeitung Generation, wir haben aus den Archiven der Mullahpolizei heute wirklich abgeschrieben, wie Männer gepeitscht wurden, ausgepeitscht Frauen, die sich geweigert hatten ein Kopftuch anzuziehen, die sich geweigert hatten, zu Hause zu bleiben, die Männer, weil ihr Bart zu lang war oder zu kurz war, wurden ausgepeitscht, das heißt im Alltag wurde die religiöse Repression ausgeübt.
Dies alles zusammenfassend will ich sagen: Gibt es eine Alternative zu dem, was wir heute leben? Ja. Es gibt eine. Die Alternative heißt aber, dass wir, das meine ich, und da komme ich wieder zur Globalisierung, den Amerikanern nicht die Alleinherrschaft in der Welt überlassen dürfen. Nicht, weil die Amerikaner schlecht sind, nicht, weil die Amerikaner nichts verstanden haben, sondern wenn eine Weltmacht allein ist, ist einfach die demokratische Substanz der Welt in Gefahr. Ganz, ganz kurz und bündig. Das heißt: Wir in Deutschland, Frankreich, haben eine Aufgabe, und diese Aufgabe heißt Europa. Ich habe vorhin etwas zitiert von Hannah Arendt, ich möchte noch ein Zitat bringen, 1961: “Über Deutschland wäre manches zu berichten. Ich mag im Moment nicht. Ich hatte viel Gelegenheit, mit Studenten zu reden und zu diskutieren. Die einzige Hoffnung bleibt doch eine Föderation Europas, ganz gleich, wie klein dieses Europa erst einmal ist.“ Ich glaube, dass in der Tat sowohl, was die Frage der sozial-ökologischen Regulierung der Globalisierung als auch, was die Frage des demokratischen Gleichgewichts, des politischen Gleichgewichts, angeht, wir die nationalen Sonderwege, welcher Art auch immer, ablehnen müssen. Und das ist zum Schluss meine größte Kritik, die ich an der von mir unterstützten Bundesregierung mache, an der Schröder-Fischer-Bundesregierung. Hätte es in Europa einen wirklich großen Staatsmann gegeben, dann hätte er in dieser Zeit der Krise die Gelegenheit beim Schopf gepackt, um Europa zu stärken.
Zwei Staatsmänner waren es beim Euro. Ich werde sagen wie. Es hätte den Euro in Europa nie gegeben ohne das Problem der Vereinigung. Jeder weiß das. Es gab etliche Versuche den Euro zu gestalten, vorher, es gelang nie. Gründungsbasis Europas war die Gleichberechtigung aller Staaten. Gründungskonsens in den Fünfzigerjahren war, Deutschland ist geteilt. Die Aufhebung der Teilung Europas hat Ängste mobilisiert, in Frankreich, in England. Mitterand hat nur eine Lösung gesehen, nachdem er alles versucht hat, die deutsche Einheit zu verhindern, bis hin um nach Ostberlin zu fahren, um zu sehen, ob man nicht eine demokratische DDR haben kann neben der demokratischen Bundesrepublik; und als er gemerkt hat, dass die Menschen das nicht wollen, aus guten und schlechten Gründen, weil sie Bananen und D-Mark lieber hatten als ein Versprechen auf Demokratie, die sie vielleicht nie kriegen. Das mag alles sein. Dann hat Mitterand gesagt, das Ja Frankreichs wird es nur geben, und davon hat er auch die Amerikaner überzeugt, wenn es eine Vertiefung der europäischen Einheit gibt, das heißt, wenn es die Gründung, wenn es die Schaffung des Euro gibt. Und jetzt hat der belgische Unterhändler erzählt, wie das gelaufen ist, dass Helmut Kohl mit Tränen in den Augen Ja gesagt hat. Warum? Weil er wusste, was er Deutschland antat. Sich zu verabschieden von der D-Mark für die Vereinigung. Das waren Staatsmänner, die in einer Krise den Ausgang gesucht haben, eben nicht in der Stärkung der nationalen Sonderregel, sondern dies versuchten über eine Stärkung der europäischen Perspektive – und wie hätte das heute ausgesehen? Das hätte ganz einfach ausgesehen. Die Amerikaner sagen, wir brauchen eure Hilfe. Da kommen die europäischen Staatsmänner und Schröder, wenn er groß ist, Chirac, wenn er groß ist, Jospin, wenn er groß ist – wer auch immer, kommen dann zum Ratschlag und machen folgenden Vorschlag: Wir beschließen, als europäischer Rat, dass wir als Europäer den Amerikanern beistehen werden, und zwar solidarisch, wie es die Franzosen sagen, wie es die Engländer sagen, wie es alle sagen, und wir werden als Europäer auch unsere militärische Beistandspflicht leisten. Mit so einem Beschluss gehen sie vor das europäische Parlament. Da hätte es eine der spannendsten Debatten für die europäische Öffentlichkeit gegeben, und da hätten wir in Deutschland gesehen, die europäischen Christdemokraten waren gespalten; die nordischen Christdemokraten wären dagegen gewesen. Die Deutschen, die Italiener, die Franzosen für eine militärische Bereitstellung. Die europäischen Liberalen wären gespalten gewesen. Die europäischen Sozialdemokraten wären gespalten gewesen. Die europäischen Grünen wären gespalten gewesen, und die europäischen Kommunisten wären fast nicht gespalten gewesen, weil sie immer wissen, wo es langgeht. Aber es hätte große Abstimmungen gegeben, eine große Mehrheit für die Bereitstellung und eine starke Minderheit aus allen politischen Familien. Mit vernünftigen Begründungen oder unvernünftigen dagegen. Und mit dieser Abstimmung im europäischen Parlament hätten dann die nationalen Parlamente natürlich selbst die Bereitstellung beschließen müssen, aber unter ganz anderen Bedingungen. Die europäische Öffentlichkeit hätte gesehen, dies ist eine Frage, die nicht parteipolitisch entschieden wird, sondern die entscheiden die Abgeordneten mit Beweggründen, die unterschiedlich sind, und dann wäre es egal gewesen, mit welcher Mehrheit Schröder dies gehabt hätte, weil es das Spiegelbild der Situation gewesen wäre, die es in Europa gegeben hat, und da hätte man gesehen, dass es christdemokratische deutsche Abgeordnete gibt, die auch dagegen sind, die hätten sich dann endlich getraut, auch im Bundestag mit Sozialdemokraten aus dem Osten und mit Grünen aus dem Osten dagegen zu stimmen, ohne dass da die Parteikatastrophe ausgebrochen wäre. Und da sieht man – wenn man die historischen Momente nicht historisch beantwortet, hat man eine dramatische, kleinkrämerische Auflösung. Ich bin der festen Überzeugung, dass Hannah Arendt vielleicht etwas ganz anderes gesagt hätte, vielleicht wäre sie dagegen gewesen, vielleicht wäre sie dafür gewesen, ich weiß es nicht. Aber in einem bin ich sicher, sie hätte versucht, sich nicht opportunistisch so oder so zu schlagen, sondern sie hätte versucht, Argumente zu entwickeln, so, wie sie es über Little Rock gemacht hat, wo sie alle vor den Kopf gestoßen hat, als sie gesagt hat, natürlich muss man die Gleichberechtigung der Schwarzen erkämpfen. Aber Kinder zu instrumentalisieren, sie zu zwingen, in Schulen zu gehen, die sie nicht wollen, ist unverantwortlich, von wem auch immer. Und dieses Bild haben wir vor ein paar Wochen wieder gehabt, in Irland, wo genau das Gleiche sich abgespielt hat, und da kamen mir diese Zeilen von Hannah Arendt, die sprangen aus dem Fernseher raus – wer übernimmt die Verantwortung, dass diese katholischen Kinder durch diese Hölle gehen müssen, nur damit bewiesen wird, dass sie in diese Schule gehen. Das ist den Preis nicht wert. Und vielleicht ist der Preis dessen, was ich gesagt habe über Afghanistan, den Preis Krieg nicht wert. Aber dann zwingen wir uns, nicht über Gesinnung, nicht über Gewissen, sondern dann zwingen wir uns, Grundüberzeugungen zu diskutieren. Grundüberzeugungen müssen am Ende in einer Demokratie, die müssen irgendwie sich aufeinander abstimmen, und die müssen kompromissfähig sein. Politik ist die Kunst der Schärfe der Argumente, der Radikalität der Argumentation und der radikalen Bereitschaft, dann am Ende kompromissfähig zu sein. Dies ist meiner Meinung nach eine Lektion, die die politische Theorie von Hannah Arendt hergibt, wenn man sie individualistisch liest, wie ich sie lese.
Meine Damen und Herren, erstmal möchte ich mich nicht nur bedanken, sondern unterstreichen, dass es viele Preise gibt, die ich gern annehme, aber die mich sicherlich nicht bewegen würden. Doch der Hannah-Arendt- Preis ist für mich etwas Besonderes, und ich weiß nicht, ob heute vielleicht eine politische Dimension, an der ich teilgenommen habe, nämlich diese grüne Partei, vielleicht kaputtgeht, das wäre ja vielleicht eine Ironie der Geschichte, dass einerseits das PolitikSchaffen irgendwie in so einer Sackgasse landet und andererseits ich diese für mich besondere Würdigung erhalte, aber so ist nun mal das Leben. Nun, da ich optimistisch bin, sage ich, es wird schon weitergehen. Ich möchte nur sagen, sehr geehrter Bürgermeister, und da ich von dem Bundeskanzler gehört habe in Nürnberg, lieber Genosse Henning, denn man sagt ja noch Genosse, wie ich ihn im Fernsehen habe sagen hören, also lieber Genosse Henning, ich möchte doch eins feststellen. Gewürdigt wurde nicht 68, sondern ich. Und ich möchte doch eins in der Öffentlichkeit feststellen: Ich bin nicht 68, sondern ich bleibe ich. Und so gern ich als Projektionsfläche für 68 weiterhin fungieren werde und weiß, dass mein Name mit dieser Epoche auch verbunden ist, sollten wir uns zwingen, in der Auseinandersetzung ein bisschen schärfer zu denken. Und da meine ich, dass ich – im Gegensatz zu vielen von 68 – eng verbunden bin, nicht nur emotional, mit Hannah Arendt, sondern vor allem inhaltlich-politisch. Denn das war der Grund, warum zwischen mir zum Beispiel und dem SDS von Anfang an eine tiefe Kluft war, denn ich kam nach Deutschland als Antikommunist, 68, ich war immer Antikommunist, von links. So etwas kannte man in Deutschland überhaupt nicht, man wusste nicht, dass es eine solche Spezies gab. Und deswegen war Hannah Arendt rechts, weil sie als Antitotalitäre es gewagt hat, überhaupt Totalitarismus, Kommunismus, Faschismus zu denken, nicht als Einheit, sondern als Ausdruck der Negation der Freiheit. Und diese Auseinandersetzung, die habe ich von Anfang an geführt, und nicht umsonst schrieb Hannah Arendt 68, am 27. Juni, und das habe ich mir jetzt noch reingeholt: “Ich möchte dir nur zwei Dinge sagen: Erstens, dass ich ganz sicher bin, dass deine Eltern und vor allen Dingen dein Vater sehr zufrieden mit dir sein würden, wenn sie noch lebten, und zweitens, dass, falls du in Ungelegenheiten gerätst und vielleicht Geld brauchst, ich immer bereit sein werde nach Möglichkeit zu helfen. Viel Glück und mach’s weiter gut. Hannah.“ Und, naja, ein paar Jahrzehnte später ist das Geld in Form des Preisgeldes angekommen. Ich finde, das hat eine historische Logik. Ich möchte das auch deswegen feststellen, weil ich Hannah zum ersten Mal 1959 gesehen habe in Frankfurt, als sie in der Paulskirche die Laudatio für Jaspers gehalten hat, und sie davor bei uns zu Hause war und meine Mutter gesehen hat, das war das erste Mal – das war unwichtig. Das zweite Mal habe ich Hannah Mitte der Sechzigerjahre, ich glaube 1962 oder 1963, beim Auschwitz-Prozess getroffen, zufällig als Zuschauer. Ich war mit der Schulklasse dort, und sie war dort auch, hat sich einen Tag angehört. Und alle staunten, dass wir uns so begegneten – woher kennt er sie? Woher kennt sie ihn? Und da sagte sie mir etwas – wir diskutierten so eine Viertelstunde, zwanzig Minuten zusammen – sie sagte mir immer: Dany, vergiss nie, Totalitarismus ist nicht nur Auschwitz. Totalitarismus ist auch die Sowjetunion. Und 89, für mich war 89 nicht die erste Erfahrung, sondern 1956, da war ich 11 Jahre alt, da ging ich an der Hand meines Bruders, der 9 Jahre älter ist, zu meiner ersten Demonstration, eine Demonstration gegen den Einmarsch der Russen in Budapest. Und diese Demonstration hatte etwas für mich ganz Besonderes. Also erst mal war es meine erste, aber sie war sehr gewalttätig, und zwar aus einem Grund: Es gab die linke, linksradikale Demonstration gegen den Einmarsch der Russen, Ziel war das Parteigebäude der kommunistischen Partei und auf der anderen Seite kamen die Rechtsradikalen, deren Ziel war auch die Zentrale der kommunistischen Partei. Und da sagte mein Bruder zu mir: Das ist unser Problem, aber die Linken wollten vor allem eins, sie wollten vor den Rechtsradikalen da sein, weil sie zeigen wollten, dass es Menschen gibt – damals war mein Bruder zum Beispiel noch Sozialist, der glaubte an einen anderen Sozialismus – dass es Menschen gibt, die für Demokratie und Sozialismus sind. Das war meine erste Demonstration, und diese Auseinandersetzung habe ich dann durchgehalten, das ist auch einer der Gründe, das stimmt einfach, warum ich so in dieser Auseinandersetzung gekämpft habe gegen den Totalitarismus in unseren Reihen, und der Totalitarismus in unseren Reihen war natürlich geprägt durch den Terrorismus, der sich begründen konnte, das müssen wir anerkennen, in einem Teil unserer Theorien. Das heißt, so, wie die Kreuzzüge etwas mit Katholizismus zu tun haben, so, wie der islamische Fundamentalismus etwas auch mit dem Islam zu tun hat – nicht der Islam ist, und nicht der Katholizismus –, so hat auch der Terrorismus etwas mit unseren Theorien zu tun. Das zeigt, dass wir immer nachdenken müssen über das, was wir sagen und was wir machen, das zeigt auch, dass diese Auseinandersetzung nicht nur notwendig, sondern die einzige Auseinandersetzung, die einzigen Möglichkeiten sind, weiterzukommen.
Und dann möchte ich – leider ist Professor Vollrath nicht da – sagen, ich fühle mich geehrt, mit ihm einen Preis zu haben. Natürlich hätten wir wahrscheinlich 68 gestritten, hätten wir uns getroffen. Na und? Das Problem ist, dass sicherlich Professor Vollrath damals ein Gespür für etwas gehabt hat, nämlich unser – ich meine jetzt uns im Sinne dieser Bewegung, egal wie ich oder was ich gedacht habe – unser Unvermögen, Demokratie und Revolte praktisch zu denken, denn wir wollten doch praktisch sein. Wir haben das Bedürfnis nach Freiheit gehabt und dies drückten wir in unserer Revolte aus. Was uns gefehlt hat immer, wie, in welchem Rahmen kann diese Revolte nicht zur Negation unseres eigenen Bedürfnisses werden? Das ist glaube ich die zentrale Frage und diese Fragen haben, ich würde nicht sagen konservative, weil es völliger Quatsch ist, sondern aufgeklärte, liberale Philosophen, Denker, diese Fragen haben sie uns gestellt, und deswegen hatte Jürgen Habermas, auch wenn ich weiß, dass es einen Streit gibt um Hannah Arendt zwischen Professor Vollrath und Jürgen Habermas, aber trotzdem hat Jürgen Habermas in einem Punkt Recht gehabt, als er formuliert hat den Begriff vom Linksfaschismus. Auch da hat Jürgen Habermas eine Sensibilität gehabt für etwas, was schief lief bei uns, mit der wir uns in den Jahren danach haben auseinander setzen müssen.
Ich möchte zum Jahre 1949 etwas sagen zum Geist der Freiheit. Es wird sehr oft gesagt, Krieg löst keine Probleme und Krieg hat nie etwas Positives nach sich entwickeln lassen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur eins – meine Eltern haben die erste biologische Möglichkeit genutzt, ein Kind zu zeugen nach der Landung der Alliierten in der Normandie. Ich bin im April 45 geboren. Die Landung der Alliierten war im Juni, rechnen Sie sich aus, und deswegen würde ich sagen, ich werde nie sagen, dass eine Militärintervention nichts Positives bewirkt hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in den Debatten, die wir hier haben, es heute unsere Aufgabe ist, der deutschen Öffentlichkeit historische Bezugsrahmen zu erlauben, aber die deutsche Öffentlichkeit auch zu zwingen, Geschichte nicht nur als deutsche Geschichte immer wieder und immer wieder zu reflektieren. Und es verbindet mich mit Freimuth Duve, dass wir ganz am Anfang der Diskussion über Bosnien der deutschen Öffentlichkeit klarmachen wollten: Hört auf, wenn es um die Verteidigung der Freiheit geht, dies nur im Rahmen der deutschen Geschichte zu diskutieren; ihr müsst hier die europäische Geschichte als Bezugsrahmen sehen, weil natürlich ein Franzose anders darauf reagiert, ein Engländer, eine Engländerin, als wir, und wir müssen jetzt als Europäer eine Position bestimmen. Und mit Hans Koschnik verbindet mich ein Streit über Bosnien von Anfang an: Hans war versucht – und eben geprägt von seiner eigenen Lebenserfahrung – zu sagen: Nein, es darf nicht sein, Bundeswehrsoldaten dürfen nicht auf Grund der deutschen Geschichte – bis er selbst in Mostar gesehen hat, irgendetwas stimmt da nicht. Und das hat uns seitdem verbunden, seit er als Bosnienbeauftragter der europäischen Union dort gearbeitet hat. Und es verbindet mich mit mehreren Preisträgern des Hannah-Arendt-Preises. Viele Sachen – Claude Lefort. Claude Lefort hat ein entscheidendes Buch geschrieben, 1968, zwei Wochen nach dem Mai, zwei Wochen, mit Caudray und Edgar Morin, La breche, es ist die beste Interpretation der 68er-Bewegung, die je geschrieben wurde, dies drei Wochen nach den Ereignissen, nämlich aufgegriffen zu haben und entwickelt zu haben, was diese Bewegung aufgebrochen hat und was sie möglich gemacht hat – sich Freiheiten in dieser modernen Gesellschaft zu erkämpfen. Und deswegen möchte ich enden und sagen, wenn es einen Preis gibt – ich weiß nicht, ob ich ihn verdient habe, das würde ich nie behaupten –, den ich aber wirklich gern habe und mit dem ich, weil ich so unbescheiden bin, wahrscheinlich zu oft kokettieren werde, ist es dieser Hannah-Arendt-Preis, und ich möchte mich wirklich ganz herzlich bedanken für diese Auszeichnung. Vielen Dank.
Ernst Vollrath (†), Professor für Politische Philosophie; lebte in Köln und Daniel Cohn-Bendit, Publizist und Politiker; lebt in Frankfurt am Main
Lieber Daniel Cohn-Bendit, lieber Christian Vollrath, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass wir uns wieder hier im Rathaus versammeln, um den jährlichen HannahArendt-Preis verleihen zu können. Ich finde nach wie vor die Idee gut, die nun schon eine ganze Reihe von Legislaturperioden in Bremen überstanden hat, und die auch von der Großen Koalition, die eigentlich nicht die Erfinder dieses Preises waren, aber immerhin akzeptiert wird ... jetzt lacht sogar Daniel Cohn-Bendit. Und entgegen allen Unkenrufen gibt es auch keine Entrüstung bei der CDU über diesen Preisträger. Das ist alles erfunden, sie finden es okay, dass die freie Jury, ohne dass reingeredet worden ist und dass irgendwelche Wünsche adressiert worden sind, diese Entscheidung getroffen hat. Ich versuche mich in diese Entscheidung reinzudenken, was nicht ganz einfach ist. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, diese beiden Preisträger zusammenzubinden. Das ist noch komplizierter als Antonia Grunenberg es in ihrer Rede gesagt hat. Denn das mit der Demokratie 68, das stimmt ja nicht. Ich habe 68 mit Leuten zu tun gehabt, die haben an alles andere gedacht als an Demokratie. Die wollten die Avantgarde durchsetzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das habe ich am eigenen Leibe erlebt. Koschnik war damals exponierter als ich, aber lieber Hans, ich war auch schon einer von diesen eigentlich diskreditierten Sozialdemokraten, die so revisionistische Kulturen hatten, und unsere Demokratie-Parteinahme hat uns gerade verdächtig gemacht vor der Studentenbewegung – das muss man doch bitte auch bedenken dürfen. Also, die 68er dürfen im Nachhinein nicht illuminiert werden als die Erfinder von demokratischen Prozessen in dieser Gesellschaft, sondern es ist eher etwas anderes. Also ich habe das – ich will Ihnen das ganz offen und herzlich sagen, ohne irgendwelche Rechthaberei –, ich habe das eher als einen Aufstand gegen die bürgerlichen Elternhäuser erlebt, gegen die konservativen akademischen Leiter, also auch einen Aufstand gegen Ernst Vollrath und seine Kollegen; die Studenten sind eben nicht mehr in die Kollegs gegangen, haben sich nicht mehr den Diskursen gestellt, haben nicht mehr demokratisch mit ihren Lehrmeistern diskutiert, sondern haben sie gehindert zu reden. Das kann man wirklich von ganz vielen sagen. Ich erinnere mich, wie Habermas oder wie Adorno nicht mehr reden durften. Daniel Cohn-Bendit war da nicht dabei, aber viele seiner Freunde haben sie damals am Reden gehindert. Und das muss man doch auch ein Stück bearbeiten. Also ich jedenfalls versuche das, ich versuche immer wieder da anzuknüpfen, wo damals eigentlich alles falsch gelaufen ist. Das, was mich tröstet, ist, dass wir das alles gemeinsam überwunden haben. Das finde ich eigentlich wichtig, und das nimmt mich für alle ein, die damals so exponiert waren, dass wir aus den unterschiedlichen Lagen heraus – ich vermute auch von den Hochschullehrern, also auch Leute wie Ernst Vollrath, den ich nicht so gut kenne, aber Kollegen von ihm kenne ich ganz gut – Nachsicht mit dieser nicht demokratischen, nicht fairen, nicht offenen, sondern totalitären, gewaltorientierten, gerade in den Diskursen gewaltorientierten Studentengeneration hatten und keine Abrechnung veranstaltet haben. Es wurde dann versucht, die Korrektur dieser Erfahrung zu stärken und wieder neue Einladungen auszusprechen, und dass dann auch viele, viele der Akteure eben nicht emigriert sind in irgendwelche grotesken Kulturen, sondern dass sie mitgemacht haben. Heute müssen sie diesen parallel laufenden Parteitag der Grünen in Rostock aushalten. Und wenn man sich diesen Spagat überlegt, dann ist das wirklich konstituierend für das, was wir alle gerne wollen: offen und frei und ohne den Avantgardeanspruch anderen aufzudrängen uns immer wieder rauswühlen aus dieser Voreingenommenheit und auch aus dieser Intransigenz, die ich bei den 68ern erlebt habe. Noch etwas ganz persönliches, das hat nichts mit Regierungserklärungen zu tun. Ich finde, die 68er sind mit Hannah Arendt überhaupt nicht fair umgegangen, und Hannah Arendt ist auch mit dieser Generation sehr kritisch umgegangen. Und bitte tun Sie nicht so, als wenn das alles immer eine Geschichte war, sondern ich kenne viele, die gegen Hannah Arendt als konservative, vorgefasste, nicht kritische Ideologin, Emigrantin, opponiert haben, und zwar militant opponiert haben, und sie war ja so eine Streitfrau, die hat immer zurückgegeben, sie hat sich eingelassen auf diese Diskurse, sie ist ja nicht so eine konsensorientierte Vereinnahmerin gewesen, sondern so eine, die den Diskurs angenommen hat. Nach wie vor finde ich anstrengend, was sie mit Habermas und Habermas mit ihr in den Versuchen, sich auseinander zu setzen und sich zu vereinnahmen, gemacht haben. Ich habe die Rede, die Ernst Vollrath zu Hannah Arendt geschrieben hat, zu verstehen versucht und habe gedacht, ja ja, so geht es wahrscheinlich. Dass man ohne Partei zu ergreifen wirklich sehr sorgfältig Schritt für Schritt diese Kontroverse und diese Vereinnahmung sozusagen durchleuchtet und transparent und nachvollziehbar macht. Ich selber, ich bin ja viel zu alt um 68er zu sein, also ich war 62/63 von der Uni weg. Ich habe aber in meiner Studienzeit Hannah Arendt als Konservative erlebt, also richtig auch so diskutiert. In Freiburg, weiß ich, haben sich Konservative auf sie berufen. Alle meine philosophischen und politischen Seminare, an denen ich teilgenommen habe, waren immer linkskritische Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt. Warum sage ich das? Wenn jetzt die Linkesie vereinnahmt, muss sie auch ein Stück diese Kontroverse benennen, die dahinter steht und die ich noch nicht zu Ende gebracht habe. Darf ich das sagen? Ich denke, das ist immer noch anstrengend, das ist immer noch nicht wirklich voll zusammengebracht, sondern unterm Strich die Anklage einer Emigrantin, einer jüdischen Emigrantin, die über Freundschaft mit Heidegger, die sehr persönliche Erfahrungen mit Nationalsozialisten gemacht hat, die sie nicht kritisch aufgearbeitet hat, sondern die sie bis zu ihrem Tode sozusagen stehen gelassen hat, und die dann aber über die Emigration zu Recht die Anklage gegen totalitäre Systeme erhebt. Das begreife ich, das kann ich nachvollziehen und da denke ich, da muss ich auch irgendwie zugehören – aber dazwischen sind ganz große Brüche, ganz große intellektuelle, politische Brüche. Warum sage ich das? Weil das unser Alltag ja auch ist.
Also wenn die Grünen heute streiten, ob sie in der Bundesregierung bleiben oder nicht, ob wir diese Allianz gegen den Terror mittragen oder nicht oder das anderen überlassen, dann ist das wieder das Herz von Hannah Arendt. Ich bin nicht sicher, ob da einer Hannah Arendt zitiert in Rostock, aber sie wäre ein guter Bezug für diese Debatte. Man könnte mit vielen, vielen Bezügen aus ihrer eigenen, auch polemischen Arbeit in diese Debatte hinein Argumente finden. Und darum ist sie so aktuell und darum ist sie so lebendig und darum ist es gut, dass die Jury sich nicht bequeme Preisträger aussucht, sondern dass sie so kontroverse Positionen benennt und uns allen die Möglichkeit gibt, sich damit auseinander zu setzen. Ernst Vollrath gelten ganz herzliche Grüße – und mit dieser Preisverleihung wird doch hoffentlich auch für ihn die positive und angenehme Erfahrung vermittelt, dass er bei dieser großen politischen Auseinandersetzung mit seinem philosophischen Arbeiten und mit seinem philosophischen Lehren nicht einfach ad acta gelegt wird, sondern einbezogen wird – und dass sich selbst solche Akteure wie Daniel Cohn-Bendit, und ich bin ja auch irgendwie ein Akteur, sich dann auch wieder solch einer wissenschaftlichen, sorgfältigen, kritischen, nicht opportunistischen Analyse und Auseinandersetzung stellen. Darum herzlichen Glückwunsch der Jury, dass Sie sich zu so einem komplizierten Vorschlag oder so einem komplizierten Duo entschieden haben.
Herzlichen Glückwunsch also ihrem Vater und gute Besserung – vielleicht kommt er mal, wenn er wieder bei Kräften ist nach Bremen; es gibt an der Bremer Universität Leute, die Antonia Grunenberg und andere, die ihn gerne mal hören würden, da soll er keinen Bogen drum machen; es gibt inzwischen eine völlig veränderte akademische Öffentlichkeit, die ihn gerne einbeziehen möchte und ihn nicht ausgrenzen möchte. Und Daniel Cohn-Bendit – ich weiß, dass er hier auf Kohlen sitzt, er würde lieber in Rostock eine große Rede schwingen, aber die vielen Vorveröffentlichungen reichen ja vielleicht für einen Parteitagsbeitrag – herzlichen Dank, dass Sie hergekommen sind, herzlichen Glückwunsch für diesen Preis, und Ihnen allen ein weiteres Nachdenken mit Hannah Arendt und mit diesen Preisträgern.
Neben Ernst Vollrath, der aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen kann, wobei ich mich aber freue, seinen Sohn Christian Vollrath begrüßen zu können, der den Preis für seinen Vater entgegennehmen wird, gibt es eine weitere Entschuldigung vorzubringen. Ralf Fücks, der Sie an dieser Stelle für die Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen wollte, muss zu dieser Zeit in Rostock sein, wo die Bundesdelegiertenversammlung der Grünen beginnt. Ralf Fücks, zusammen mit Dany Cohn- Bendit und anderen, ist dort mit einem Antrag vertreten, der versucht, die Neuausrichtung der grünen Außenpolitik zu formulieren. Die Präsenz eines der Hauptantragsteller ist dazu erforderlich. Dass es keine Debatte unter vielen ist, sondern mitentscheidend für das grüne Projekt, haben Sie mitbekommen, daher die Bitte, Herrn Fücks zu entschuldigen. Für die Heinrich-Böll-Stiftung Bremen möchte ich Sie herzlich begrüßen. Die Heinrich-BöllStiftung Berlin und die Bremer Landesstiftung sind ja der eine Teil der Stifter des Preises, der andere Teil wird getragen von der Stadt Bremen, die trotz bekannt knapper Kassen dankenswerterweise an dem Preis festhält und hoffentlich dabei bleibt – denn nur die Gemeinsamkeit gibt ihm Gewicht. Vor allem da es einige gibt, die die Preisidee gerne übernehmen würden und nur darauf warten, dass wir schwächeln. Der Dritte im Bunde ist der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken e.V., der das inhaltliche Profil verantwortet und der für die nötige Unabhängigkeit der Entscheidungen Gewähr leisten soll. Die Jury trifft sich immer in der ersten Jahreshälfte in Bremen, dadurch habe ich deren Entscheidung unmittelbar erfahren und war schon etwas verwundert darüber. Nicht dass Ernst Vollrath und Daniel Cohn-Bendit jeweils als Preisträger verständlich wären – aber beide zusammen?
Ich weiß nicht, ob Sie sich gleich daran erinnert hätten, dass es die 68er-Debatte war, die die erste Jahreshälfte bestimmte, über sie nachdenkend, bekam die Entscheidung zunehmend einen Sinn. Ich hatte, Anfang der Siebzigerjahre, nach dem Abitur und bevor ich studierte, eher zufällig Hannah Arendts „Totalitarismusbuch“ und „Eichmannbuch“ gelesen, war angetan bis begeistert und kam mit wenig, aber auch diesem theoretischen Rüstzeug an die Uni, natürlich als Linker. Es ergaben sich Situationen, in denen ich „meine“ Hannah Arendt in die Debatte warf, und war doch erstaunt ob der eisigen Reaktionen, wenn sie denn jemand überhaupt kannte. In diese, in dieser Hinsicht wenig freiheitliche Atmosphäre kam Ernst Vollrath 1976 nach Deutschland zurück und hat einer politischen und werkgetreuen Rezeption Hannah Arendts den Weg geebnet. – Eine Leistung, deren Mut und persönlicher Einsatz hoch zu bewerten ist. Und Daniel Cohn-Bendit: Stand er nicht auf der anderen Seite der Barrikade? Vielleicht noch der von 68, aber der Dany der Siebzigerjahre? Es war nicht zuletzt Joschka Fischer, der Cohn-Bendit bescheinigte, ihn vom Abgrund des Terrorismus geholt zu haben. Wenn man so will, ist Dany so etwas wie die Verkörperung des „Politischen“, das sich durch sein antitotalitäres Denken, seine Neuanfänge, sein Neu-beginnen-Können auszeichnet. Geschichte ist eben nicht die Abfolge logischer Ketten, das Politische muss immer wieder neu begründet werden. In dieser Tradition Hannah Arendts gehören beide zusammen, der eine als politischer Philosoph, der andere als Politiker der Öffentlichkeit. Es scheint nicht zufällig, dass es wieder Cohn-Bendit ist, der nach dem 11. September in der Öffentlichkeit präsent ist wie kaum ein anderer, weil er weiterdenkt, ohne sich in ideologische und politische Lager einbinden zu lassen. So eindeutig er sich auch für die militärische Bekämpfung des Terrorismus einsetzt, so eindeutig wendet er sich gegen lauter werdende Töne, die den Krieg als die Fortsetzung der Abwesenheit der Politik mit anderen Mitteln betreiben wollen, um Baudrillard zu zitieren. Es gibt bei der Verleihung des Hannah-Arendt-Preises schon fast so etwas wie eine deutschfranzösische Tradition, für die nicht nur Daniel Cohn-Bendit steht, sondern auch die Laudatorin der diesjährigen Preisverleihung, Frau Sauzay, Beraterin des Bundeskanzlers für deutschfranzösische Koordination, die ich auch herzlich begrüßen möchte.
Denkwege und Aufbrüche
Wir haben die diesjährige Preisverleihung unter das Motto: “1989 – 1968 – 1949: Politische Imaginationen und das Versprechen der Freiheit“ gestellt. Mit diesem Thema spielen wir darauf an, dass das politische Handeln in historisch einzigartigen Situationen immer auch zu etwas Neuem führt, zu einer politischen Gründung wie 1949 die Bundesrepublik Deutschland oder 1989 zur Erringung der Freiheit für die ehemalige DDR und zur Wiederöffnung Europas. Das Jahr 1968 steht wie eine Irritation zwischen den beiden anderen Daten. War denn 1968 ein Aufbruch der Freiheit? Nicht wenige haben dies hier zu Lande im vergangenen Jahr öffentlich bezweifelt. War dieses “Bewegung“ genannte Massenereignis vielleicht nur eine psychosoziale Generationenrevolte? Ihre Protagonisten Brüllhälse, die ihren hedonistischen Vorlieben knapp an der Grenze zur Kriminalität nachgingen? Sie alle wissen, wovon ich rede. Öffentliche Schuldbekenntnisse sind eingefordert worden. Damit einher ging der Versuch, den politischen Akten der Sechziger- und Siebzigerjahre ihren öffentlich-bedeutsamen Charakter zu nehmen und zum Ergebnis unentschuldbaren individuellen Fehlverhaltens ihrer Protagonisten zu erklären. Mit dem Untertitel “Politische Imaginationen und das Versprechen der Freiheit“ haben die Veranstalter auf etwas angespielt, das in allen drei geschichtlichen Ereignissen eine Rolle spielt: das politische Denken und das Versprechen der Freiheit. Dieses Versprechen gibt es auch 1968. Wenn man die beiden diesjährigen Preisträger in Augenschein nimmt, so fällt einem spontan zuerst das Trennende ein: Ernst Vollrath ein Theoretiker, Daniel Cohn-Bendit ein Praktiker; der eine von der aristotelischen Tradition und vom Denken Hannah Arendts geprägt, der andere von den Straßenkämpfen und den öffentlichen Redeschlachten. Der eine ein Philosoph von der Universität, der andere ein Politiker des Hier und Jetzt. Ich bin mir auch sicher, dass Ernst Vollrath und Daniel Cohn-Bendit in den Sechziger- und Siebzigerjahren viel zu streiten gehabt hätten. Vollrath konnte die anmaßende Art von manchen der so genannten Achtundsechziger, die politische Sphäre zur “Bewegung“ zu instrumentalisieren, nicht billigen. In einem Brief an Hannah Arendt vom 5. Februar 1970 schreibt er: “Ich habe den Eindruck, daß der Moment herangekommen ist, an dem Saint-Just gesagt haben würde: la révolution est glacée. Abgesehen von der ganz anderen Lage ist dies die Folge davon, daß man sich immer noch an den verfluchten ,Bewegungscharakter‘ des Politischen angehängt hat. Es ist zum Verzweifeln!“ Es ist also ist nicht die Kritik an den Regelverletzungen, die Vollrath umtreibt, sondern dass die Studenten das Politische zur Bewegung manipulieren.
Daniel Cohn-Bendit hätte freilich seinerzeit den Zugang von Ernst Vollrath zu der politischen Sphäre viel zu konservativ und theoretisch gefunden.
Was sich die Jury nun dabei gedacht hat, zwei so grundverschiedene Persönlichkeiten unter dem Dach eines Preises zusammenzubringen, möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Beide, Ernst Vollrath und Daniel Cohn-Bendit, sind auf ihre Weise mit der Nachgeschichte des deutschen und europäischen Totalitarismus verbunden. Ernst Vollrath, indem er, den Denkwegen Hannah Arendts folgend und zugleich über sie hinausweisend, die Rekonstruktion des Politischen in den Vordergrund seines Nachdenkens stellt, Daniel Cohn-Bendit, indem er als Handelnder einen neuen Aufbruch in die Freiheit forderte.
Die zweifache Preisvergabe nimmt auch einen Gedanken wieder auf, der bei der Gründung des Preises maßgeblich war: Der “Hannah Arendt-Preis für politisches Denken“ richtet sich sowohl an Persönlichkeiten aus der Sphäre des philosophischen und politischen Denkens wie auch an solche im politischen Raum. Mit Freimut Duve und Joachim Gauck und auch mit Claude Lefort und Antje Vollmer wurden Persönlichkeiten geehrt, die etwas für das Versprechen der Freiheit getan hatten: Joachim Gauck, der das historische Verdienst hat, die Staatssicherheitsakten zur öffentlichen Einsichtnahme gebracht zu haben, Freimut Duve, der als einer der Ersten für eine europäische Intervention in Bosnien aus politischen Gründen plädierte, Antje Vollmer, die eine festgefahrene Pattsituation in den deutsch-tschechischen Beziehungen durch mutiges Auftreten außer der Reihe aufzulösen half. Claude Lefort, der die Nachwirkungen des Totalitarismus im Lichte der Ereignisse von 1989 neu überdachte.
Allen bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern ist gemeinsam, dass sie jenen Kräften widersprachen, die das Politische auf instrumentelles Handeln oder auf den Glauben an unverrückbare Werte reduzieren. Die Weltlage seit dem 11. September 2001 hat wieder einmal darauf aufmerksam gemacht, dass das reduzierte Verständnis von politischem Handeln zwar zu verständlichen Sicherheitsreflexen führt, aber die Wahrnehmung neuer Handlungsräume und Denkhorizonte eher blockiert. Ohne ein politisches Denken, das auch das heute Unmögliche anspricht, würde es heute in Mazedonien keine Verfassung geben, darauf hat Daniel Cohn-Bendit kürzlich hingewiesen. Ohne das Unmögliche zu wagen, könnte man anfügen, wird es schwerlich einen tragfähigen Frieden in Afghanistan oder im Nahen Osten geben. Diese Dimension des unmöglichen Möglichen spielt bei den beiden Persönlichkeiten eine besondere Rolle: bei Ernst Vollrath im Nachdenken über das, was das Politische an der Politik sein könnte, bei Daniel Cohn-Bendit im Reden und Streiten über die Erneuerung des Politischen im Handeln.
Ernst Vollrath begann sein Wirken in einer Zeit, in der das Handeln im öffentlichen Raum durch den Wiederaufbau und die dringend notwendige Stabilisierung der demokratischen Institutionen gekennzeichnet war. Eine entscheidende Prägung in seinem Denken erhielt er durch die Freundschaft mit Hannah Arendt in den Siebzigerjahren sowie durch seine Lehrtätigkeit an Arendts Hausuniversität, der New School for Social Research in New York City. Durch sein Werk ist Hannah Arendt in Deutschland als politische Denkerin sui generis bekannt geworden. Als politische Publizistin war sie schon vorher weithin bekannt, wofür Dolf Sternberger sehr viel getan hatte, aber auch ihre eigenen Vortragsreisen und natürlich ihr Buch über den EichmannProzess. Vollraths Büchern und Aufsätzen ist zu entnehmen, wie schwierig dieses Unterfangen war, gegen den Strom der Zeit auf einem anderen Begriff des Politischen zu beharren. Gegenüber einer Linken, die lange Zeit das Werk Arendts nicht wahrnehmen wollte, und gegenüber einem liberalen und konservativen Lager, die das arendtsche Denken zwar für sich vereinnahmten, es in seiner Vielfältigkeit aber nicht würdigen konnten, hat Ernst Vollrath beharrlich darauf bestanden, dass es mit dem arendtschen Werk etwas ganz Besonderes zu entdecken galt, eine besondere Dimension des Politischen. Worin unterscheidet sich das Politische von dem, was wir als Politik kennen: Vollrath arbeitet heraus, dass es vor allem darin liegt, dass das Politische nicht objektiv und nicht kausal ist. Mit Hannah Arendt geht Ernst Vollrath davon aus, dass politisches Handeln nicht in einer Zweck-Mittel-Relation steht. Das Gegenwärtige kann nicht aus dem Vergangenen abgeleitet werden: “Das Ereignis erhellt seine eigene Vergangenheit, niemals kann es aus ihr abgeleitet werden“, heißt es bei Arendt. Ebenso wenig können die Folgen gegenwärtigen Handelns in der Zukunft kontrolliert werden. Das Politische ist ein Handeln, das etwas in Gang setzt, dessen Ergebnisse aber nicht kontrollieren kann. Das Politische wird von einem “Wir“ getragen; dieses “Wir“ ist der Prozess der Meinungsbildung, in dem die Handelnden urteilen. Das “Wir“ bedeutet auch, dass politisches Handeln von Einflüssen bedingt ist, die es nicht beherrschen kann, aber mit denen es in Beziehung tritt. Das ist die Pluralität des politischen Raums. In ihr herrscht keineswegs nur Harmonie; Meinungsbildung und Urteilsbildung vollziehen sich konflikthaft.
Es zeichnet Ernst Vollrath aus, dass er diese Position bezogen hat zu einer Zeit, als namhafte Denker verkündeten, Politik bestünde in der Herstellung von Einmütigkeit durch herrschaftsfreie Kommunikation. Der Preis, den Ernst Vollrath für das Beharren auf seinem Widerspruch gezahlt hat, war hoch. Er ist nur einem kleinen Kreis von Kollegen und Studierenden bekannt geworden. Ja, man kann sagen, Ernst Vollrath ist der politische Philosoph, dessen Bedeutung in der deutschen Öffentlichkeit bis heute am radikalsten verdrängt wurde. Es mag ihn ein wenig trösten, dass die Verhältnisse ihm Recht gegeben haben; doch möchte man nicht auch die Anerkennung der Zeitgenossen haben? Die nächste Generation kann von ihm lernen, dass man für seine Position streitet, auch wenn sie gegen den Mainstream steht. Wichtiger noch ist freilich, dass Vollrath den Jüngeren mit seinen Büchern etwas Kostbares übereignet: die Kenntnis von jenem Versprechen der Freiheit, dem jede nachkommende Generation erneut gegenübersteht.
Gegen Daniel Cohn-Bendit als Preisträger ist mancherlei eingewendet worden. Lassen Sie mich deshalb kurz anführen, was nach Meinung der Jury gerade für ihn spricht. Cohn-Bendit ist biografisch und politisch eng mit Frankreich und Deutschland und ihrer Geschichte in den letzten fünfzig Jahren verbunden. Als Kind deutscher Juden, dessen Eltern aus Deutschland vertrieben wurden, ist er im Exil in Frankreich geboren, in Deutschland aufgewachsen, wieder nach Frankreich verzogen, 1968 aus Frankreich vertrieben und erneut in Deutschland tätig geworden. Heute ist er in beiden Ländern zu Hause. Seine wechselvolle Lebensgeschichte – zu der auch die Freundschaft seines Vaters zu Hannah Arendt gehört –, seine Lebensgeschichte also, ist einerseits ein Teil der vielen noch unerzählten Geschichten von Flucht, Vertreibung und ihren Nachwirkungen. Auf der anderen Seite ist sie ein lebendiges Zeichen für die Entstehungsgeschichte eines neuen Europa, an dem Cohn-Bendit mitwirkt. Daniel Cohn-Bendit steht wie kein Zweiter für die Ereignisse von 1968, in Frankreich und in Deutschland, und zwar in dem Sinne, dass das politische Handeln, jenseits der Irrtümer, in die es läuft, immer auch etwas ermöglichen kann. Ein politisch Handelnder begibt sich immer in einen Handlungszusammenhang hinein, in dem er Irrtümern und Fehlern unterliegen kann, für die er Verantwortung trägt. Doch retrospektiv betrachtet hat Cohn-Bendit dieses 1968 als einen noch immer andauernden Auftrag angenommen, sich an der Gestaltung des neuen Europa zu beteiligen, zuerst in Frankreich, dann in Deutschland, bei der Gründung der Grünen und seit jüngstem nun als europäischer Politiker.
Mit der Preisvergabe an Daniel Cohn-Bendit hat die Jury zu erkennen gegeben, dass sie die Ereignisse von 1968 als Zäsur in der politischen Geschichte der Bundesrepublik und Europas anerkennt, in der die demokratische Frage neu gestellt wurde und ein politischer Neubeginn eingefordert wurde, dessen Impulse bis heute andauern. Daniel Cohn-Bendit steht mit seinem Wirken als Abgeordneter im Europaparlament – ebenso wie der frühere Preisträger Massimo Cacciari – für die Schaffung einer republikanischen politischen Kultur in Europa. In seiner Lebensgeschichte und in seinem politischen Wirken wird deutlich, dass der politische Raum konfliktreich ist, zugleich aber immer die Chance des Eingreifens ins Geschehen birgt. Mit der Verleihung des “Hannah Arendt-Preises für politisches Denken“ an ihn nimmt die Jury natürlich auch auf die deutsch-französischen Beziehungen Bezug. Wie Sie wissen, haben 1996 Francois Furet (dessen Laudator Cohn-Bendit war) und 1998 Claude Lefort den “Hannah Arendt-Preis“ erhalten. Mit der Entscheidung für Daniel Cohn-Bendit möchte die Jury auch den “deutsch-französischen Ariadnefaden“ wieder aufnehmen, in der Hoffnung, die politische Kultur der Streitgespräche zwischen Frankreich und Deutschland zu beleben. Ernst Vollrath und Daniel Cohn-Bendit verkörpern auf je eigene Weise die intellektuellen und politischen Möglichkeiten dieser Republik und dieses Europas. Gemeinsam ist ihnen, dass beide auf ihre je spezifische Weise einen Zugang zum politischen Raum freilegen. Ernst Vollrath in der Rekonstruktion des Politischen, Daniel Cohn-Bendit als politisch Handelnder. Beide sprechen wichtige Aspekte des Arendtschen Denkens an: das Handeln ins Offene und die Freilegung eines nicht-objektivistischen politischen Denkens.
Lassen Sie mich zum Abschluss noch ein paar Worte des Dankes sagen. Dass uns der Senat der Freien und Hansestadt Bremen mit seinem Bürgermeister und die Heinrich-Böll-Stiftung mit Ralf Fücks diese Preisverleihung ermöglichen, dafür danken wir ihnen herzlich. Wir sind davon überzeugt, dass das Preisgeld, das der Bremer Senat und die Böll-Stiftung aufbringt, eine gute Investition in Gegenwart und Zukunft ist. Danken möchte ich natürlich auch meinen Mitstreitern Zoltan Szankay, Lothar Probst und Peter Rüdel und den Kolleginnen und Kollegen von der Jury für die schwierige Arbeit der Preisträgerfindung. Solch ein Preis muss immer wieder neu belebt werden, sonst verkommt er zur reinen Zierde. Der “Hannah Arendt-Preis für politisches Denken“ will bewusst auch Anstöße geben und auch ein bisschen Anstoß erregen, im wörtlichen Sinne. Dies aber geschieht nur, wenn man den Preis selbst in allen seinen Facetten auch zum Vorschein bringt. Last but not least, im Namen der Jury und des Vorstands gratuliere ich Christian Vollrath für seinen Vater Ernst Vollrath und Daniel Cohn-Bendit zum “Hannah Arendt-Preis“ 2001.
Öffentliches Handeln mit politischem Denken verbinden
Es ist mir eine große Ehre und Freude, die Laudatio auf die beiden diesjährigen Preisträger des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken, Herrn Professor Ernst Vollrath und Herrn Daniel Cohn-Bendit, zu halten. Frau Professor Grunenberg, Sie haben den Hannah-Arendt-Preis einmal als “europäischen Preis“ bezeichnet, der dazu diene, “Europa zum Sprechen zu bringen“. Damit haben Sie sicherlich nicht nur das Brüsseler Europa, das Europa der Währungsunion und des Binnenmarktes gemeint, sondern vor allem das Europa der Kultur und des Geistes, das Europa des intellektuellen Dialogs. Der Hannah-Arendt-Preis erinnert auch daran, dass dieses Europa der republikanischen Tradition der USA verbunden ist, die für Hannah Arendt – und einige Jahre auch für Sie, Herr Professor Vollrath – zur intellektuellen und materiellen Bleibe wurden. Seit dem 11. September 2001 ist uns allen wieder stärker ins Bewusstsein gerückt, dass uns – bei allen Unterschieden – mit den USA eine Denktradition und ein Menschenbild verbindet, das letztendlich in der Aufklärung und in den Menschenrechten wurzelt. Dieses Motiv also, “Europa zum Sprechen zu bringen“, halte ich für ein ausgezeichnetes; denn wenn es heute an etwas fehlt in Europa, dann sicherlich an Kommunikation, an Verständigung und damit auch an Verständnis zwischen den Menschen – über staatliche und sprachliche Grenzen hinweg. Frei nach Willy Brandt könnte man sagen, in Europa müsse künftig “zusammenwachsen, was zusammengehört“. Der Hannah-Arendt-Preis trägt dazu bei.
Oberflächlich betrachtet mag man sich – angesichts Ihrer unterschiedlichen Lebenswege und auch angesichts Ihres unterschiedlichen Verhältnisses zur Politik – wundern, dass Ihnen, Herr Professor Vollrath und Herr Cohn-Bendit, hier und heute gemeinsam der “Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken“ verliehen wird. Dennoch teilen Sie beide eine wichtige Gemeinsamkeit: Sie stehen, ebenso wie Hannah Arendt selbst, für eine nicht-ideologische Linke, für ein linkes Denken, das immer “antitotalitär“ war – und zwar auch schon zu einer Zeit, in der Sie damit eine unbequeme Position hatten, weil Sie gegen den Strom schwammen – also lange vor dem Fall der Mauer, lange bevor dies zum “mainstream“ wurde. Ein liberales Menschenbild prägt die beiden Preisträger in ihrem Denken und Wirken ebenso wie die politische Reflexion Hannah Arendts. Wenn es einen Kreuzungspunkt in den so unterschiedlichen Biografien unserer beiden Preisträger und Hannah Arendts gibt, dann sicherlich den, dass Sie deren Überzeugung, der Sinn von Politik sei Freiheit, voll und ganz teilen. Sie verkörpern damit beide auch ein Ethos des Politischen, das über den Zwängen, Moden und Ideologien der Parteipolitik und des politischen Alltagsgeschäfts steht. Interessant ist, dass Sie trotz dieser Gemeinsamkeit in der Öffentlichkeit ganz unterschiedlich rezipiert wurden: “Dany le rouge“ gehörte immer dem linken Lager an, Professor Vollrath dagegen wurde im Kontext der Totalitarismusdebatte als “Konservativer“ betrachtet. Sie beide, liebe Preisträger, sind zwei Persönlichkeiten, die im Zeichen einer dritten stehen, die Sie beide auch persönlich kannten. In Ihnen spiegeln sich zwei Facetten von Hannah Arendt wider, nämlich ihr Anspruch öffentliches Handeln mit politischem Denken zu verbinden. Sie, Herr Professor Vollrath, wirken insbesondere als Wissenschaftler, Ihr Forum war vor allem die akademische Öffentlichkeit, die Universität. Sie haben die Politik und das Politische in seinen Grundlagen analysiert, Sie haben die politische Philosophie insbesondere der Demokratie weiterentwickelt und das Denken von Tocqueville und Hannah Arendt fortgesetzt. Sie, Herr Cohn-Bendit, kennen zwar die Universität ebenfalls von innen, insbesondere die Zustände in Nanterre vor 1968 – aber wie wir wissen, blieb ihnen dort nicht immer Zeit für das stille Studium in der Bibliothek, denn die reine Theorie war Ihre Sache nicht, und Sie wählten eine breitere Öffentlichkeit außerhalb der Universität. Sie wollten – und das ist Ihnen wahrlich auch gelungen – Dinge bewegen, Politik “machen“. Sie provozierten und debattierten und haben es auf diese Weise geschafft, “Sand im Getriebe“ zu sein und gemeinsam mit anderen unsere Gesellschaft von Grund auf zu verändern. Damit haben Sie auch ein Stück der politischen Kultur Deutschlands und Frankreichs, ja, man könnte sagen, der politischen Kultur Europas verändert. Heute setzen Sie im Europäischen Parlament in gewisser Weise diesen Ansatz fort, und auch wenn Sie sich vielleicht ein wenig gemäßigt haben, bleiben Sie doch ein leidenschaftlicher Politiker und ein “Aufrührer“ im positiven Sinne.
Als Wissenschaftler haben Sie, Herr Professor Vollrath, mit Hannah Arendt von 1973 bis 1976 an der New School for Social Research in New York gewirkt. Nach Ihrer Rückkehr nach Deutschland 1976 haben Sie eine intensive Korrespondenz mit ihr fortgeführt, die zeigt, wie eng Sie wissenschaftlich und geistig mit ihr verbunden waren. Sie, Herr Professor Vollrath, entwickeln das Denken Hannah Arendts weiter und legen großen Wert auf klare begriffliche Differenzierungen: Sie definieren das Politische, “le politique“, als die Form und unterscheiden es von der Politik, “la politique“, als Inhalt. Wie bedeutsam diese analytische Klarheit für die politische Praxis ist, zeigt uns beispielsweise die aktuelle Europa-Debatte zwischen Deutschen und Franzosen: Die Franzosen fordern ein “projet européen“, Inhalte, Visionen, während die Deutschen sich auf formale, institutionelle Fragen konzentrieren, sie wollen die Architektur Europas festlegen. Mit etwas Abstraktionsvermögen und klaren Begriffen, wie Sie, Herr Professor Vollrath, sie entwickelt haben, würden wir uns viele missverständliche Diskussionen ersparen, denn beide Aspekte – das Politische und die Politik – sind komplementär, keiner der Begriffe kommt ohne den anderen aus und keiner existiert in der Realität ohne den anderen. Für überaus interessant halte ich – gerade als Französin – ferner, dass Sie, Herr Professor Vollrath, eine Metaphysik der Politik ablehnen. In Ihrem Brief an Hannah Arendt vom 6. Februar 1970 schreiben Sie: “Je mehr ich über die Sache nachdenke, umso deutlicher wird mir, dass Ihr ganzes Bemühen darauf geht, die metaphysische Konstellation des Politischen, die zu einem Verfall des Politischen geführt hat, zu destruieren.“ Dieser Gedanke ist der französischen Tradition sehr nahe: Es ist ein republikanischer Ansatz, nach welchem Politik keine Glaubensfrage ist, sondern eine permanente Debatte zwischen rechtlich gleichgestellten Bürgern, die sich in der Staatsnation, in der Vertragsnation organisiert haben. Es ist dies auch ein sehr “irdischer“ Begriff des Politischen, der in Abkehr zu einer verhängnisvollen deutschen Tradition der politischen Philosophie steht. Der letztere Ansatz ist in der Geschichte mehrfach gescheitert. Immer wenn versucht wurde, auf Erden das “gesellschaftliche Paradies“, den “neuen Menschen“ zu schaffen, so haben Staaten die “Hölle“ errichtet, sie haben damit das Politische, die politische Kultur und letztendlich den Menschen zerstört. Diese Überzeugung hat Sie, Herr Professor Vollrath, zu Ihrer zutiefst liberalen, antitotalitären Denkweise geführt. Dass Sie Hannah Arendts Totalitarismustheorie verteidigt haben, hat Ihnen einige Kritik eingebracht. Die “Ecke“, in die man Sie damals zu rücken versuchte, ist heute – so ändern sich die Zeiten – ein Ehrenplatz, um den sich viele drängeln, nicht immer berechtigterweise. Ihnen, daran besteht kein Zweifel, kommt dieser “Ehrenplatz“ voll und ganz zu für Ihre illusionslose Kritik an totalitären Systemen. Als Französin würde ich das geflügelte Wort über den kommunistischen, “engagierten“Sartre und den skeptisch-rationalen Raymond Aron umkehren und aus heutiger Sicht sagen: “Il valait mieux avoir tort avec Vollrath, que raison avec l’école de Francfort.“
Dass Gleiches auch für Hannah Arendt gilt, haben Sie, Herr Cohn-Bendit, anlässlich einer Hannah-Arendt-Tagung 1994 erläutert –
ich zitiere:
“Arendt war keine Anhängerin der so genannten ,engagierten‘ Philosophie. ... Will man den engagierten Philosophen akzeptieren, so nur, wenn man nicht vergisst, dass auch bedeutende Philosophen und Denker nicht davor geschützt sind, den größten Unsinn zu verbreiten. ... Hingegen hat sich Arendt niemals zu einem solch engagierten Opportunismus hinreißen lassen. Obwohl sie mit der Studentenbewegung sympathisierte, was sie mir geschrieben hat, war das für sie kein Grund, mit dem Denken aufzuhören.“ Soweit Cohn-Bendit. Sie erläuterten damals auch, dass Hannah Arendt für Sie zunehmend wichtiger wurde, als Sie sich von der abstrakten revolutionären Theorie emanzipierten, und zwar im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung über Gewalt in der Studentenbewegung, über den Terrorismus und die Rote-Armee-Fraktion. Ihr persönlicher Kontakt zu Hannah Arendt, die insbesondere mit Ihrem Vater befreundet war, war also auch ein immens politischer. Was Sie auszeichnet, Herr Cohn-Bendit, ist, dass Sie natürlich “engagiert“ waren und revolutionär dazu, aber als es galt, sich zwischen Gewalt und Freiheit zu entscheiden, haben Sie die Freiheit gewählt. Sie haben die antitotalitäre Linke mitentwickelt und sind gegen die Verharmlosung des kommunistischen Regimes durch die marxistische Linke eingetreten. Diesen liberalen Geist haben Sie auch sehr viel später wieder an den Tag gelegt, als die Debatten zwischen “Realos“ und “Fundis“ bei den Grünen hohe Wellen schlugen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an ein sehr französisches Zitat von Ihnen: “Was ist das für ein Land, wo die Bäume mehr zählen als die Menschen?“ (Cohn-Bendit) Sie haben – und das gilt für 1968 wie für heute – nie ein Blatt vor den Mund genommen, auch gegenüber Ihren Kampfgenossen nicht. Ihr Mut zur Kontroverse, Ihre Spontaneität und Ihr Witz, Ihre Frechheit und Ihr Freigeist haben sicherlich das Bürgertum und das Spießertum mehr erschüttert als so manche tief schürfende marxistische Diskurse. Sie haben immer die Grenzen der Freiheit ausgelotet – wofür Sie natürlich auch bezahlt haben, unter anderem mit der Ausweisung aus Frankreich durch de Gaulle. Doch sogar Alain Peyrefitte, Bildungsminister unter de Gaulle 1968 und Betreiber Ihrer Ausweisung aus Frankreich, musste in seinen Memoiren anerkennen: “Cohn-Bendit ist ein anarchistischer und ulkiger Revolutionär. Er will alles zerstören, die bürgerlichen Strukturen, zu denen auch die Kommunistische Partei zählt, und er macht es so fröhlich, dass alle ihn anhimmeln.“ Jedenfalls haben Ihr Übermut und Ihr Humor Sie vor dem “moralinsauren“, verhärmten Habitus mancher deutscher Linken bewahrt. Hannah Arendt hat Politik definiert als “das, was zwischen Menschen passiert“ – mit Ihrem Protest gegen die Geschlechtertrennung in den Studentenwohnheimen von Nanterre haben Sie diese These sehr anschaulich in die Praxis umgesetzt und ganz nebenbei natürlich damit noch den Pariser Mai 68 ausgelöst ... Ich wage zu behaupten, dass diese Abneigung gegen das ideologische Moralisieren auch von der französischen Hälfte, die Sie in sich tragen, herrührt. Für Franzosen sind politische Debatten und Argumente etwas ganz anderes als Moral – auch dies ist übrigens wieder eine Querverbindung zu Hannah Arendt. Die politische Kultur Frankreichs zeigt sich skeptisch gegenüber geschlossenen Denksystemen oder – wie schon gesagt – gegenüber ideologischen Glaubenssätzen, gegenüber einer Metaphysik des Politischen. Anlässlich der Proteste von grünen “Fundis“ gegen den von Ihnen befürworteten Kosovo-Einsatz haben Sie, Herr Cohn-Bendit, einmal gesagt, “die Regierung ist keine Vereinigung bibeltreuer Katecheten“. Vor der totalitären Versuchung, der marxistisch-ideologisch verbrämten Gewaltanwendung haben Sie also vermutlich mehrere Faktoren bewahrt: Ihr Lachen, das ironische Distanz auch zu sich selbst verrät, Ihre Auseinandersetzung mit Hannah Arendt und Ihre französische Prägung, die sich vor Globalvisionen hütet und sich auf die “irdische Condition humaine“ konzentriert, ganz in der Tradition des französischen Skeptizismus eines Montaigne, Descartes oder Pascal. Sie haben als “europäischer Bastard“, wie Sie sich selbst gerne bezeichnen, den beiden Quellen Ihrer Kultur, Deutschland und Frankreich, jeweils etwas voraus, und das macht auch Ihre Modernität aus: Den Deutschen haben Sie das Misstrauen gegenüber geschlossenen Denksystemen und den Freigeist des “libertins“ voraus. Wenn Nietzsche sagt, “Die Deutschen sind von vorgestern und übermorgen“, dann könnte man erwidern, Cohn-Bendit füllt die Lücken dazwischen aus. Den Franzosen haben Sie den Sinn für die Ökologie, die nachhaltige Entwicklung, das Ethos der Verantwortung gegenüber künftigen Generationen voraus, weil Sie auch die “pantheistische“ Sensibilität Deutschlands besitzen. Dass Sie beide Denktraditionen kennen und relativieren können, auch gegen beide rebellieren und nicht borniert an einer nationalen Prägung hängen, prädestiniert Sie dafür, der Europäer zu sein, als der Sie geboren und der Sie heute geworden sind. Ihr Gesicht symbolisiert inzwischen ja nicht nur das Jahrhundertereignis des Mai 68 (– wie andere Stationen dieses Jahrhunderts etwa Kennedy 1963, der 11. September ...), sondern Ihr Gesicht ist auch zum Symbol für eine mitreißende Europa-Begeisterung geworden. Herr Cohn-Bendit, Sie sind vielleicht der erste wirklich transnationale Politiker in Europa. Wir müssen Ihnen dankbar sein dafür, dass Sie ein Liebling der Medien, ein “politischer Superstar“ sind, denn damit haben Sie den Ansatz für eine europäische Öffentlichkeit mit geschaffen. Und Sie wissen auch, dass wir für eine europäische Demokratie noch weiter gehen müssen, dass wir transnationale Parteien, transnationale Medien, transnationale Debatten brauchen. Nach den Europa-Wahlen, als Sie für die französischen Grünen antraten, konnte man in Berlin-Schöneberg ihre französischen Wahlplakate mit deutschen Gratulationsaufschriften sehen: Das war für mich ein wirklich bewegendes Symbol, ein kleiner und dennoch riesiger Schritt für Europa. Die Tatsache, dass Sie als Angehöriger eines Staates aktiv im politischen Leben des anderen Landes mitwirken (was mich als Französin im deutschen Bundeskanzleramt im Übrigen mit Ihnen verbindet) zeigt, dass Europa zusammenwächst. Europa ist für Sie, so haben Sie einmal gesagt, eine Vision, ein Traum, eine der letzten Utopien, für die es sich zu kämpfen lohne.
Sie beide, Herr Cohn-Bendit und Herr Professor Vollrath, haben mit Ihrem Wirken und Ihrer Arbeit unsere politische Kultur geprägt und gepflegt. Sie haben Verantwortung, Freiheit und Konflikt als zentrale Begriffe der Demokratie verstanden und theoretisch wie praktisch “durchdekliniert“. Die demokratische Kultur lebt von und mit Menschen wie Ihnen beiden, denn angesichts von Politikverdrossenheit, Rechtsextremismus und Fundamentalismen unterschiedlichster Couleur gilt es immer wieder, das wertvolle Gut der Demokratie und der ihr zu Grunde liegenden Tugenden zu pflegen, zu bewahren und lebendig zu halten. Insbesondere braucht die Demokratie die schwere und unentbehrliche Tugend, Pluralität, Meinungsvielfalt und -unterschiede zu akzeptieren. Auch dafür steht der “Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken“. Ich gratuliere unseren beiden Preisträgern ganz herzlich.
Vom “radikal Bösen” zur“Banalität des Bösen”
Überlegungen zu einem Gedankengang von Hannah Arendt
Hannah Arendt ist Zeit ihres öffentlichen Wirkens in zahlreiche Kontroversen und Polemiken verwickelt gewesen, eine Folge ihres unabhängigen, unvoreingenommenen, ja radikalen Denkens. Eine besondere Stelle nimmt dabei ihr Bericht vom Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem ein, den sie für die Kulturzeitschrift The New Yorker verfasste und dann als Buch veröffentlichte: Eichmann in Jerusalem, Ein Bericht von der Banalität des Bösen. Die Thesen dieses Buches, zumal die von der Banalität des Bösen, erregten regelrecht Anstoß. Die offiziellen und offiziösen israelischen und jüdischen Organisationen wandten sich aggressiv gegen diese Thesen ihres Buches und gegen seine Verfasserin. Es kam zum Bruch mit langjährigen Freunden, so mit Hans Jonas, mit dem erst nach langer Zeit ein Ausgleich zu Stande kam. Mit anderen Freunden kam der Ausgleich nie wieder zu Stande. Aus dem ganzen Komplex dieser Kontroverse soll im Folgenden nur ein einziges Moment herausgegriffen werden: Hannah Arendts Konzept der Banalität des Bösen, das sie in Adolf Eichmann verkörpert sah. Gerade dieses Konzept traf auf schroffe Einsprüche, sofern ihr unter anderem unterschoben wurde, sie wolle damit die ganze Ungeheuerlichkeit der Untaten dieses Menschen abschwächen. Das Gegenteil ist der Fall. Der Ausdruck ist mit der Kennzeichnung “die furchtbare Banalität“ versehen. Er dient dazu, die Verruchtheit dieses Mannes und seiner Taten besonders deutlich herauszustellen. Um das kenntlich zu machen, ist es erforderlich, den genauen Umkreis zu bestimmen, in dem der Ausdruck fällt. Unter dem Galgen stehend gab Eichmann Worte von sich, die er offenbar lange vorbereitet hatte. Sie sind, wie Hannah Arendt bemerkt, von einer makabren Komik: “In einem kurzen Weilchen, meine Herren, sehen wir uns ohnehin alle wieder. Das ist das Los aller Menschen. Gottgläubig war ich im Leben. Gottgläubig sterbe ich.“ Er gebrauchte, so fährt sie fort, die Nazi-Wendung von der Gottgläubigkeit, hatte nur übersehen, dass sie eine Absage an das Christentum und den Glauben an ein Leben nach dem Tode besagte. Eichmann lässt sich weiter hören: “Es lebe Deutschland. Es lebe Argentinien. Es lebe Österreich. Das sind die drei Länder, mit denen ich am engsten verbunden war. Ich werde sie nicht vergessen.“ Im Angesicht des Todes fiel ihm genau das ein, was er in unzähligen Grabreden gehört hatte: das “Wir werden ihn, den Toten, nicht vergessen.“ Sein Gedächtnis, auf Klischees und erhebende Momente eingespielt, hatte ihm den letzten Streich gespielt: Er fühlte sich “erhoben“, wie bei einer Beerdigung und hatte vergessen, dass es die eigene war. “In dieser letzten Minute“, schreibt Hannah Arendt, das Schlusswort des Angeklagten kommentierend, “war es, als zöge Eichmann selbst das Fazit der langen Lektion in Sachen menschlicher Verruchtheit, der wir beigewohnt hatten – das Fazit von der furchtbaren Banalität des Bösen, vor der das Wort versagt und das Denken scheitert.“ Damit war die Formel geboren, die so viel Aufsehen und Polemik hervorrief. Sie trat dann auch im Untertitel der Buchveröffentlichung auf.
Ursprünglich war Hannah Arendt nach Jerusalem gekommen, um die Figur des radikal Bösen anzutreffen. So schreibt sie an S. Neumann am 15. 7. 1961: “Ich bin ja eigentlich hingefahren, weil ich partout wissen wollte, wie einer aussieht, der “radikal Böses“ getan hat.“ Eichmann als die Verkörperung des radikal Bösen: Das war sozusagen die Standardauslegung der Untaten dieses Menschen, nicht nur bei Hannah Arendt, sondern überhaupt in Israel und in der Judenschaft. Stattdessen sah sie sich einem in seiner Durchschnittlichkeit eher lächerlich anmutenden Menschen gegenüber, der sich in seinem Glaskasten durch nichts außer durch Beflissenheit auszeichnete. Wie ließ sich verstehen, dass hier jemand stand, der in seiner Unscheinbarkeit mit Verbrechen verbunden war, die alles bislang Bekannte weit überstiegen. Und dieser Täter hatte, wie er dort stand, nichts Dämonisches an sich, im Gegenteil! In den Worten von Hannah Arendt: “... in dem Bericht selbst kommt die mögliche Banalität des Bösen nur auf der Ebene des Tatsächlichen zur Sprache, als ein Phänomen, das zu übersehen unmöglich war. Eichmann war nicht Jago und nicht Macbeth, und nichts hätte ihm ferner gelegen als mit Richard III. zu beschließen, ‚ein Bösewicht zu werden‘“. Bei diesen Gestalten Shakespeares ist es richtig, vom “radikal Bösen“ zu sprechen. Ihre radikale Bösartigkeit beruht darin, dass sie alles ausschließlich in Bezug auf sich selbst zu sehen vermochten. Eichmann dagegen mangelt alle Größe dieser Verbrecher; er war ein kleiner Bürokrat, der an eine Stelle geraten war, an der er Fürchterliches anrichten konnte und dies auch getan hatte, ohne auch nur im Mindesten zu begreifen, was er da getan hatte: ein Fall von extremer Gedankenlosigkeit. Es kann sogar sein, dass er Fürchterlicheres anrichtete, als alle diese selbstbezüglichen Bösewichte. Für dieses Phänomen und seine Wahrnehmung tritt dann bei weiterem Durchdenken das Konzept der Banalität des Bösen ein: also vom “radikal Bösen“ zur “Banalität des Bösen“. Auf diesem Konzept beruht Hannah Arendts Bericht über den Eichmann-Prozess in Jerusalem.
Dieser Wechsel der Konzepte stellt ein wesentliches Moment ihrer wachsenden Einsicht in das Phänomen des Totalitarismus dar. Es handelt sich nicht um einen bloßen Austausch der Begriffe. Das neue Konzept gehört zur wachsenden Wahrnehmung durch Hannah Arendt, dass das Phänomen des Totalitarismus gegenüber den traditionellen Verfehlungen des Politischen etwas gänzlich Neuartiges darstellt, das mit den hergebrachten Kategorien nicht verständlich gemacht werden kann. Letztlich heißt dies, dass der gesamte hergebrachte Verständnishorizont des Politischen aufgegeben werden muss, um den Herausforderungen der Moderne begegnen zu können. Hannah Arendt ist die Denkerin, die dies mit zunehmender Klarheit gesehen hat und die den damit sich eröffnenden Weg eingeschlagen hat. Die Bedeutung ihres politischen Denkens beruht in hohem Maße im Aufweis einer umfassenden neuartigen Wahrnehmung des Politischen angesichts der Neuartigkeit der politischen Phänomene und überhaupt des Phänomens des Politischen, und diese neuartige Wahrnehmung stellt sich zunächst in dem Wechsel vom Konzept des “radikal Bösen“ zu dem der “Banalität des Bösen“ dar. Sie führt aber darüber hinaus. Ich möchte so weit gehen zu behaupten, dass die Neuartigkeit der Phänomenologie des Politischen bei Hannah Arendt schließlich in der vollständigen Ablösung des traditionell im deutschen Kulturkreis leitenden Paradigmas des herrschaftskategorial bestimmten Staates besteht. So stellt sich im Wechsel der Konzepte vom “radikal Bösen“ zur “Banalität des Bösen“ ein wesentliches Wegstück des neuartigen Denkens des Politischen durch Hannah Arendt dar. In dem auch in anderer Hinsicht bemerkenswerten Brief an Gershom Scholem (den sie mit der deutschen Version seines Vornamens, mit “Gerhard“, anredete, was seine Ansprechbarkeit nicht erhöht haben dürfte) vom 20. Juli 1963 heißt es: “I changed my mind und spreche nicht mehr vom radikal Bösen.“ Was sind die Gründe für diesen Meinungswechsel? Mit dem neuen Konzept sind eine ganze Reihe von Schwierigkeiten gegeben, ganz abgesehen davon, dass es zum Anlass von erheblichen Kontroversen wurde. Die arendtschen Kontrahenten in diesen Polemiken sind vielfach gar nicht auf die Ernsthaftigkeit ihrer Argumente eingegangen; ja, es kam oftmals vor, dass sie das Buch überhaupt nicht gelesen hatten. Die Kontroversen wurden mit erbitterter Schärfe geführt, und die wenigsten Kontrahenten waren bereit zu erklären: Ich habe mich geirrt.
Hannah Arendt hat das ihr vor Augen stehende Phänomen der Banalität des Bösen anhand der Figur des Adolf Eichmann eindringlich beschrieben. “Außer einer ganz gewöhnlichen Beflissenheit, alles zu tun, was seinem Fortkommen dienlich war, hatte er überhaupt keine Motive; und auch diese Beflissenheit an sich war keineswegs kriminell, er hätte bestimmt niemals seinen Vorgesetzten umgebracht, um an dessen Stelle zu rücken. Er hatte sich nur, um in der Alltagssprache zu bleiben, niemals vorgestellt, was er eigentlich anstellte.“ Damit benennt Hannah Arendt ein für sie ganz entscheidendes Moment in der Struktur des Phänomens der Banalität des Bösen, die Gedankenlosigkeit. Der Mangel an Urteilskraft, sich überhaupt nicht vorstellen zu können, was man angestellt hat, ja die Weigerung dies zu tun, ist ein wesentliches Moment der Banalität des Bösen. Hannah Arendt wird daraus ihre Beschäftigung mit der Urteilskraft entfalten, für sie das eigentlich politische Vermögen. Die Urteilskraft ist für sie das politische Vermögen, das Vermögen des Politischen schlechthin. Sie erblickt diesen Mangel leibhaftig an der Figur des Adolf Eichmann.
Was ist eigentlich das Motiv für den Paradigmenwechsel vom “radikal Bösen“ zur “Banalität des Bösen“? Natürlich kann gesagt werden die Diskrepanz zwischen der Ungeheuerlichkeit der Taten und der Unscheinbarkeit des Täters. In dem schon einmal zitierten Brief an Gershom Scholem, in dem Hannah Arendt angekündigt hatte “I changed my mind“, fährt sie fort: “Ich bin in der Tat heute der Meinung, dass das Böse immer nur extrem ist, aber niemals radikal, es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. Tief aber und radikal ist immer nur das Gute.“ Vom “radikal Bösen“ zu sprechen, teilt dem Bösen eine Größe zu, die ihm nicht zukommt. Hannah Arendt macht von einem Gedanken Gebrauch, der in einem frühen Brief von Karl Jaspers an sie so formuliert ist: “Ihre Auffassung“ [H. A. hatte zuvor erklärt, dass die Ungeheuerlichkeit der nationalsozialistischen Untaten eine juristische Erfassung unmöglich macht] “ist mir nicht ganz geheuer, weil die Schuld, die alle kriminelle Schuld übersteigt, unvermeidlich einen Zug von Größe – satanischer Größe – bekommt, die meinem Gefühl angesichts der Nazis so fern ist wie die Rede vom Dämonischen in Hitler und dergleichen. Mir scheint, man muss, weil es wirklich so war, die Dinge in ihrer ganzen Banalität nehmen, in ihrer ganz nüchternen Nichtigkeit. ... Ich sehe jeden Ansatz von Mythos und Legende mit Schrecken, und jedes Unbestimmte ist schon solcher Ansatz ... Es ist keine Idee und kein Wesen in dieser Sache.“ An die Stelle der Kennzeichnung “radikal“ für das Böse, die ihm aus den angegebenen Gründen abgesprochen wird, tritt hier die Kennzeichnung “banal“. So betrachtet würde der Ausdruck “Banalität des Bösen“ von Jaspers stammen. Hannah Arendt ist jedoch niemals auf diese Herkunft zurückgekommen, obwohl ihr das Argument von Jaspers eingeleuchtet haben muss, denn sie bringt seinen Kern in ihrem Brief an Gershom Scholem vor. Karl Jaspers selbst erwähnt später eine ganz andere Herkunft. Er schreibt ihr, ein gemeinsamer Bekannter (der Maler Al Copley) habe ihm erzählt, “Heinrich [Blücher, ihr Mann] habe die Redewendung ,Banalität des Bösen‘ erfunden und mache sich nun Vorwürfe, dass Du ausbaden musst, was er angerichtet hat“. Hannah Arendt bestätigt das zu einem gewissen Ausmaß – und auch wieder nicht. In einem verloren geglaubten Brief an Karl Jaspers vom 29. Dezember 1963, einem Brief, der nun wieder gefunden und dessen Exzerpte veröffentlicht worden sind, schreibt sie: “Von Heinrich stammt der Untertitel nicht; er hat einmal vor Jahren gesagt: Das Böse ist ein Oberflächenphänomen – und das fiel mir in Jerusalem wieder ein; daraus kam schließlich der Titel.“ So bleibt die eigentliche Herkunft der Formel im Undeutlichen. Hannah Arendt wollte sie wohl auch nicht ins Spiel bringen, um ihren Urheber aus den heftigen Kontroversen herauszuhalten, die sich um die Formel herum entzündet hatten. Wichtiger als die Herkunft war ihr die Einsicht, die sie in das Phänomen gewährte. Diese Einsicht lässt sich so zusammenfassen: Es ist die ungeheuerliche Diskrepanz zwischen der Verruchtheit der Untaten und der banalen Nullität ihres Täters, die jedoch eine Vorbedingung für das Zustandekommen dieser fürchterlichen Untaten gewesen ist.
Aber ist das Phänomen darin richtig wahrgenommen, dass es als banal erscheint? In schroffer Weise hat Gershom Scholem das abgestritten, wenn er in einem Brief im August 1963 schreibt: “Über das Böse und dessen Banalität durch Bürokratisierung (oder dessen Banalisierung in der Bürokratie), die Sie bewiesen zu haben glauben, von welchem Beweis ich aber nichts bemerkt habe, werden wir uns sicherlich einmal unterhalten. Ich glaube, dass Eichmann, als er in der SSUniform herumspazierte und genoss, wie alles vor ihm zitterte, gar nicht der banale Herr war, als den Sie ihn uns jetzt mit oder ohne Ironie aufreden wollen.“ Und auch Dan Diner hat in ähnlicher Weise wie Gershom Scholem sich geäußert, allerdings ohne dessen Aggressivität: “Der Mann im Glaskasten entsprach in seiner Farb- und Gefühllosigkeit genau jenem Naturell, auf das es ihr ankam: kleinbürgerlich angeleitet, als Person bedeutungslos, letztendlich banal. Das ist eine zutreffende Wahrnehmung, wenn auch nur die eine Perspektive ... Denn banal mag Eichmann im Glaskasten gewirkt haben – aller Insignien seiner vormaligen Stellung, seines Ranges und seiner Aura entledigt. Als etwa Joel Brand, der Eichmann in Budapest unter wenig anheimelnden Umständen begegnet war, aussagte, klang das schon ganz anders – damals, als Eichmann in schwarzer Uniform und Schaftstiefeln ihn, den unscheinbaren Budapester Juden, anherrschte oder wie Brand sich im Prozess auf Deutsch ausdrückte: anbellte und ihm jenes dämonische Angebot machte: Ware gegen Blut – Blut gegen Ware. Damals mutete Eichmann keineswegs banal an.“ Aber war nicht dieser Auftritt gerade ein richtiges Indiz für die Banalität des Bösen einer Figur von totaler Nichtigkeit, die sich mit den Insignien der Macht umkleiden muss? Was bei beiden, bei Gershom Scholem und bei Dan Diner, übersehen wird, ist die im Konzept der “Banalität des Bösen“ gegebene Einsicht in die totalitäre Struktur des Phänomens. Das Skandalwort von der “Banalität des Bösen“ intendiert nicht etwa eine Abschwächung, keine Bagatellisierung der Untaten und ihres Täters, sondern ganz im Gegenteil eine Verschärfung der Verruchtheit sowohl des Täters als auch seiner Untaten, denn diese Banalität wird ja ausdrücklich als fürchterlich gekennzeichnet. Dies soll vor allem darauf hinweisen, dass in der modernen Massengesellschaft eine gefährliche Tendenz besteht, dies alles als “normal“ erscheinen zu lassen und was wiederum dazu beiträgt, dass sich sowohl auf der Seite der kulturtragenden Schichten als auch auf der Seite des Mobs genügend Personal bereitstellt, weil die Grenze zwischen diesen beiden Schichten zusammengebrochen ist. Der Einsatz der Kennzeichnung “banal“ an Stelle der ursprünglichen Kennzeichnung “radikal“ intendiert gerade das Sichtbarmachen einer gefährlichen Möglichkeit der Moderne, dies alles auch noch als normal wahrzunehmen. Die Kennzeichnung “radikal“ ist dazu nicht im Stande, weil das Radikale, worauf Jaspers ja hingewiesen hat, stets den Charakter des Außergewöhnlichen hat. Bleibt die Frage, warum dieser Menschentypus gerade in Deutschland, das eine bildungsaristokratische Kultur von höchster Geistigkeit aufzuweisen beanspruchte, solche fürchterlichen Auswirkungen hat haben können. Hannah Arendt beantwortet diese Frage so: “Es ist richtig, daß dieser moderne Typus Mensch, den wir hier mangels eines besseren Namens mit dem alten Wort Spießer bezeichnet haben, auf deutschem Boden eine besonders gute Chance des Blühens und Gedeihens hatte. Kaum ein anderes der abendländischen Kulturländer ist von den klassischen Tugenden des öffentlichen Lebens so unberührt geblieben; in keinem haben privates Leben und private Existenz eine solche Rolle gespielt.“ Hier spricht Hannah Arendt ein fundamentales Problem des deutschen Kultur- und Selbstverständnisses an. Nur in Ansätzen kann das Problem in diesem Rahmen entfaltet werden. Das deutsche Kultur- und Selbstverständnis ist – oder war zumindest – in hohem Maße gespalten, ja regelrecht zerrissen. Auf der einen Seite existierte ein bildungsaristokratischer Individualismus, der zu den Gewöhnlichkeiten des öffentlichen Lebens Abstand hielt, zu der auch die Politik gerechnet wurde. Komplementär konnte der Politik aber auch ein Rang zugesprochen werden, der sie als die höchste Gestaltung der Kultur bewertete. Beide komplementär-antagonistischen Gestaltungen existierten wiederum in je einer hochkulturellen und einer vulgärkulturellen Version. Die Problematik des deutschen Kultur- und Selbstverständnisses vergrößerte sich noch dadurch, dass es keinerlei sicheres Kriterium der Unterscheidung zwischen diesen unterschiedlichen Variationen gab, sodass sich die eine für die andere ausgeben und so mit ihr verwechselt werden konnte. Der Spießer konnte sich und die anderen davon überzeugen, der wahre Repräsentant der deutschen Kultur und ihrer Innigkeit zu sein.
Über das Spießertum des Spießers hat sich Hannah Arendt in einem frühen Aufsatz ausgesprochen, der im April 1946 in der von Dolf Sternberger herausgegebenen Zeitschrift Die Wandlung erschien. Der Prototyp des Spießers ist hier Heinrich Himmler, einer der ungeheuerlichsten Massenmörder der Geschichte, der zu dieser Ungeheuerlichkeit gerade durch sein Spießertum und seine Banalität “befähigt“ war! Hier führt Hannah Arendt aus: “Um zu wissen, welches die eigentliche Triebfeder im Herzen der Menschen ist, durch die sie in die Maschine des Massenmordes einzuschalten waren, werden uns Spekulationen über die deutsche Geschichte und den sogenannten deutschen Nationalcharakter, von dessen Möglichkeiten die besten Kenner Deutschlands vor fünfzehn Jahren noch nicht die leiseste Ahnung hatten, wenig nutzen. Aufschlußreicher ist die eigentümliche Figur dessen, der sich rühmen kann, das organisatorische Genie des Mordes zu sein. Heinrich Himmler gehört nicht zu jenen Intellektuellen, welche aus dem dunklen Niemandsland zwischen Bohème- und Fünfgroschenjungen-Existenz stammen und auf deren Bedeutung für die Bildung der Nazielite in neuerer Zeit wiederholt hingewiesen worden ist. Er ist weder ein Bohèmien wie Goebbels noch ein Sexualverbrecher wie Streicher noch ein pervertierter Fanatiker wie Hitler noch ein Abenteurer wie Göring. Er ist ein Spießer mit allem Anschein der Respektabilität, mit allem Anschein des guten Familienvaters, der seine Frau nicht betrügt und für seine Kinder eine anständige Zukunft sichern will. Und er hat seine neueste, das gesamte Land umfassende Terrororganisation bewußt auf der Annahme aufgebaut, dass die meisten Menschen nicht Bohémiens, nicht Fanatiker, nicht Abenteurer, nicht Sexualverbrecher und nicht Sadisten sind, sondern in erster Linie ,jobholders‘ und gute Familienväter.“ Das Spießertum des Spießers, der zu allem fähig ist, sofern ihm nur die Verantwortung abgenommen wird, ist die Vorprägung der Banalität des Bösen. Es lässt in der modernen Massengesellschaft die Verantwortungslosigkeit für das Öffentliche als normal erscheinen. Heute kann gefragt werden, ob nicht doch auch die anderen Figuren des Personals der totalitären Herrschaft Züge dieses Spießertums aufweisen. Über alle Einsichten in das Phänomen des Totalitarismus und die Authentizität des Politischen hinaus kann die Bedeutung und damit die Größe des politischen Denkens von Hannah Arendt für uns und heute so festgestellt werden: In diesem Denken werden wesentliche Defizite des deutschen Kultur- und Selbstbewusstseins herausgestellt, die mit zur Anfälligkeit gegenüber dem totalitären Syndrom beigetragen haben. Diese Defizite bestehen in der abstrakten Abtrennung des Politischen von der Kultur, der wiederum eine ebenso abstrakte Überordnung der Politik in Gestalt des Staates über die Kultur antwortet. Für beide Abstraktionen lassen sich entsprechende Exempel finden. Beide Abstraktionen sind mit korrelativen Strukturen verbunden. Auf der einen Seite die Figur des “Staates an sich“, der das Monopol des Politischen für sich beansprucht, das ihn den widerspruchslosen Gehorsam seiner Untertanen einfordern lässt, ausgeübt von den legitimen oder auch nur faktischen Inhabern der staatlichen Macht. Auf der anderen Seite die isolierten Individuen, die dieser Macht willig Gehorsam zollen, auch um den Preis ihrer Verantwortlichkeit, sofern nur ihre Privatheit davon nicht betroffen ist. Was dagegen im politischen Denken von Hannah Arendt vorliegt und angeboten wird, ist das Konzept einer Kultur des Politischen, in der die angesprochenen Abstraktionen nicht auftreten. Diesem Denken zu folgen, besagt einen politikkulturellen Paradigmenwechsel vorzunehmen. Hannah Arendt hat einen entscheidenden Ansatz dazu bereitgestellt.
Der lange Marsch zu einer Politik der Freiheit
Revolutionen und Revolten zwischen Totalitarismus und Fundamentalismus
Es gibt Zitate, die passen zu allem. Ich will meinen Beitrag mit einem Zitat von Hannah Arendt beginnen. “Alles Denken unterminiert tatsächlich, was immer es an starren Regeln, allgemeinen Überzeugungen gibt. Alles, was sich im Denken ereignet, ist einer kritischen Überprüfung dessen, was ist, unterworfen. Das heißt, es gibt keine gefährlichen Gedanken aus dem einfachen Grund, weil das Denken selber ein solch gefährliches Unterfangen ist. Nicht-Denken allerdings ist noch gefährlicher. Damit leugne ich nicht, daß das Denken gefährlich ist, würde aber behaupten, daß das Nicht-Denken noch viel gefährlicher ist.“ Es wird sehr viel der Politik der Freiheit gedacht und sehr viel gesagt, wie kann überhaupt politisches Handeln aussehen? Hannah Arendt sagt an einer anderen Stelle: Ich bediene mich, wo ich kann. Ich nehme, was ich kann und was mir passt. Ich denke, einer der großen Vorteile unserer Zeit ist wirklich, dass unserer Erbschaft keinerlei Testament vorausgegangen ist. Das heißt, es steht uns vollkommen frei, uns aus den Töpfen der Erfahrungen und Gedanken unserer Vergangenheit zu bedienen; mich zwanglos zu bedienen aus den Töpfen der Vergangenheit, unserer Geschichte. 68, ich stehe anscheinend für dieses Datum. Was wollte diese Generation? Diese Generation wollte eine andere Welt. Diese Generation empfand die Welt, in der sie aufgewachsen war, in der sie lebte, als eine Welt, die durch Doppelmoral geprägt, eine Realität nicht nur nicht mehr wahrnehmen wollte, sondern überhaupt die Augen schließen wollte vor dieser Realität. Dies hatte verschiedene Namen. Es gab eine moralische Glocke, deswegen entstand dagegen das Bedürfnis, frei und anders zu leben. Es gab eine politische Glocke, deswegen rebellierte man gegen die Akzeptanz des Vietnamkrieges. Man wollte nicht schuldig sein an einem barbarischen Krieg gegen ein Volk, das sich selbst bestimmen wollte. Und letztendlich wollte man nicht, dass eine Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, überhaupt die Augen verschließt vor der eigenen Geschichte.
Dies waren kurz gesagt, die Beweggründe dieser Bewegung. Frei denken, frei leben, frei handeln zu wollen. Hannah Arendt hat das mit Recht so geschrieben. Und gleichzeitig war das aber eine Bewegung, die glaubte – ich möchte das mal mit einem berühmten Zitat beschreiben –, die Gnade der späten Geburt für sich in Anspruch nehmen zu dürfen. Sie hat nicht gewusst, dass Jahre später jemand das so beschreiben würde. Und warum? Weil diese Generation glaubte, unbefangen mit den Versatzstücken von Theorien und Geschichtsmomenten mit der unmittelbaren Vergangenheit umgehen zu können. Das bedeutet, Totalitarismus, Kommunismus – ein Problem? Nein! Deutschland, die Geschichte, die Amerikaner, das ist das Problem. Oder diese Bewegung setzte sich auseinander mit antiautoritärer Erziehung und bediente sich der proletarischen Erziehungsargumente einer ziemlich autoritären Vergangenheit. Ich könnte das fortsetzen.
Was ich damit sagen will ist, dass es einen zentralen Widerspruch gab in dieser Bewegung zwischen einem Freiheitsdrang, einem Freiheitsbedürfnis, und gleichzeitig eine Unfähigkeit, dies gedanklich zu fassen. Ich habe es mal so formuliert: Unsere Emotionen, unsere Vibrations waren okay, um das im Sprachgebrauch des damaligen Jargons zu sagen. Unsere theoretische Sprache war eine Steinzeitsprache und deswegen war das Leben historisch viel adäquater als alles, was wir historisch formulieren konnten. Dies hat fatale Entwicklungen gehabt. Dies hat Entwicklungen nach sich gezogen ab dem Moment, ab dem diese Bewegung eigentlich das erreichte, was sie erreichen konnte, nämlich die Gesellschaft aufzurühren, die Gesellschaft zu mobilisieren, der Gesellschaft ihre Selbstsicherheit wegzunehmen. Als das vollzogen war und es zum zweiten Schritt kam – Willy Brandt sagte: Demokratie wagen –, nämlich diese Demokratie gestalten zu können, waren viele von uns bereits in die Gestaltung des Sozialismus geflohen. In die Gestaltung einer Gesellschaftsordnung, die es real gab, den real existierenden Sozialismus, aber den wollte man sich überhaupt nicht ansehen.
Ich werde nie vergessen, als ich nach Deutschland kam und eine der ersten Demonstrationen mitmachte, wie aggressiv die Passanten waren, ich war ziemlich entsetzt. Und da dröhnte der Spruch: “Geh doch nach drüben!“ Beim nächsten Mal, als ich einen Pulk von sich gegen uns mobilisierenden Menschen sah, schrie ich spontan (und ich habe ein ziemlich lautes Organ): “Wenn es euch nicht gefällt, geht doch nach drüben, dort ist das Demonstrieren verboten!“ Es war absoluter Stillstand, Mitdemonstranten erstarrten als Eisblöcke, denn es wurde etwas gesagt, was unheimlich war. Nicht nur, dass man diesen Spruch übernahm, sondern man drehte ihn gegen die hiesige Gesellschaft, und darunter war ein tiefer theoretischer Satz und eine tiefe theoretische Spaltung, die ich mit dieser Bewegung in diesem Moment empfand und die mich fast nie verlassen hat in der Auseinandersetzung in der Bundesrepublik. Ich meinte, von den beiden deutschen Staaten war die Bundesrepublik Deutschland das Beste, aus dem einfachen Grund, weil man in der Bundesrepublik Deutschland, bei aller Kritik, kämpfen konnte, während man auf der anderen Seite ins Gefängnis kam, wenn man nur den Mund aufmachte. Das war für mich ein wesentliches Merkmal der Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus. Und es hat lange gedauert, bis dies verstanden wurde. Symbol dafür war theoretisch, dass diese Studentenbewegung, dass diese Bewegung als ideologische Ikone Herbert Marcuse hatte und überhaupt nicht wahrnehmen wollte oder konnte: Hannah Arendt. Denn sie war ja Sprachrohr des Konservatismus und der Rechten, weil sie es wagte, in einem Atemzug zwei Totalitarismen miteinander zu vergleichen, nämlich den Kommunismus und den Faschismus oder Nationalsozialismus. Das war der Beweis einer grundkonservativen Haltung. Niemand hat sich in dieser Zeit mit Hannah Arendt auseinander gesetzt. Und deswegen ist es meiner Meinung nach nachvollziehbar, warum diese an Freiheit hängende, nach Freiheit dürstende Bewegung, warum sie sich transformieren konnte in eine fast totalitäre nicht Bewegung, sondern in totalitäre Momente, die sich am reinsten dann darstellten bei der RAF und allen bewaffneten Kämpfern. Aber totalitär Ideologisches konnte auch bei allen kommunistisch marxistisch-leninistischen Organisationen gefunden werden und auch totalitär existieren in einer bestimmten Form auch in der Sponti-Bewegung, nämlich das Totalitäre in der Definition dessen, was richtig oder falsch war im Alltagsleben. Oder anders ausgedrückt, das Nicht-Reflektieren über gesellschaftliche Prozesse und Demokratie. Was nach sich zog, dass man überhaupt nicht mehr diskutieren konnte oder in der Lage war zu fragen: Was kann oder welcher politische Rahmen kann oder muss existieren, damit wir den Emanzipationsprozess, den wir wollen, überhaupt gestalten können?
Ich will jetzt eine Klammer machen. Ich habe diese Bewegung kritisiert, doch eins möchte ich doch feststellen. Ich glaube, das Drama der Politik und der politisch handelnden Menschen ist, dass sie wahrscheinlich immer irgendwann Unsinn formulieren. In einem ungeheuerlichen Ausmaß können sehr intelligente Menschen, Menschen, die später, Jahre später, entfernt von bestimmten Ideologien, ganz profunde und fundamentale Sachen sagen, plötzlich trotzdem in einer Zeit, in der das Ideologische die einzige Brille ist, mit der die Realität überhaupt verstanden oder gesehen wird, aberwitzige Dinge tun. Als Beispiel möchte ich aus einem ganz anderen Zusammenhang ein Beispiel bringen – damit Sie alle erlöst sein können und nicht verkrampfen, sondern sagen, die Kritik ist gegen alle gerichtet, das ist nicht besonders gegen die Linke oder gegen die Rechte, sondern gegen alle. Es gibt einen sehr intelligenten Menschen, der heißt Benjamin Franklin. Benjamin Franklin war einer der Erstunterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Er ist der Erfinder des Blitzableiters. Also, man kann wirklich nicht sagen, es ist der dümmste Mensch auf Erden, und er hat, wenn man Hannah Arendt liest und die Funktionen der amerikanischen Revolution für eine Verfassung, er hat was Großes mitgeleistet. Und Benjamin Franklin hat ein kleines Problem gehabt in Amerika. Es gab zu viele Einwanderer, und die falschen Einwanderer, und das hat ihn gestört, das war grausam, und dann hat er ein Pamphlet formuliert – ein intelligenter Mensch –, über die Einwanderer. Und das möchte ich zitieren, damit wir wissen, wir sind nicht allein, wenn wir was Dummes sagen. Also, Benjamin Franklin denkt nach über ethnische Reinheit in Amerika, 1751: “Die Zahl ganz weißer Menschen in der Welt ist verhältnismäßig sehr klein. Ganz Afrika ist schwarz oder dunkel, auch ganz Amerika, außer den Neuankömmlingen. Und in Europa haben die Spanier, Italiener, Franzosen, Russen und Schweden das, was wir gewöhnlich eine dunkle Hautfarbe nennen. So sind auch die Deutschen dunkel, mit Ausnahme alleine der Sachsen, die mit den Engländern die Hauptmasse der weißen Bevölkerung auf der Erdoberfläche ausmachen. Ich wollte, es wären ihrer mehr.“
Dies will ich Otto Schily widmen zur Einwanderungsdebatte. Wir können es drehen und wenden wie wir wollen – wir haben zum Glück 68 politisch verloren, und wir haben zum Glück sozial vieles gewonnen. Wir haben die Gesellschaft verändert, die Gesellschaft hat sich verändert, aber alle unsere politischen Vorschläge, die Rätedemokratie, die, ich würde sagen, so formuliert, wie sie ansatzweise bei uns formuliert war, ist nicht durchgekommen. Nur müssen wir uns die Frage stellen, bedeutet das die Absage an radikale Kritik, gar an Utopie? Ich glaube nicht. Und das ist sicherlich eines der großen Probleme, die wir, die Grünen, haben; wir, die Politik weitermachen nach den Sechzigerjahren. Sich auf eine Realität einzulassen, die manchmal sehr unangenehm ist und widersprüchlich, und trotzdem in der Lage zu sein, über diese Realität hinwegzudenken, sogar Positionen zu formulieren, die trotzdem emanzipatorische Ansprüche haben. Dies ist meiner Meinung nach eigentlich die Aufgabe unserer Generation. Wir sind gescheitert, viele von uns sind daran gescheitert. Ich würde sagen, dass es die Pflicht ist – ob von einzelnen, von mehreren –, eine Politik der Freiheit, das heißt, das Denken in Freiheit, das Denken über das, was heute ist, hinaus, wenigstens dieses Unterfangen zu probieren, dieses Abenteuer zu probieren, damit wir nicht immer wieder diesen Zirkel erleben: Bewegung, Emanzipationswünsche, Bewegung langsam am Ende, Fundamentalisierung dieser Bewegung – und am Ende Zusammenbruch, weil natürlich die Fundamentalisierung, das Gesinnungsfundamentale, es uns nicht mehr ermöglicht, die Realität zu sehen.
Und da gibt es viele Beispiele: Die Ökobewegung. Sie war ja richtig, sie ist ja richtig, die Kritik an der Produktionsweise unserer spätkapitalistischen Gesellschaft ist richtig, die Wachstumskritik ist richtig, und trotzdem entstand da plötzlich ein Ökofundamentalismus, der allen Menschen aufoktroyieren wollte, wie sie zu leben, zu atmen oder zu riechen haben. Und wir waren unfähig, uns die zentrale Frage zu stellen: Wenn es richtig ist, dass diese Gesellschaft, diese Produktionsweise, diese nur auf Kapitallogik organisierte Gesellschaft, ihre eigene Zerstörung organisiert, wie gewinnen wir Mehrheiten, die das verstehen? Das ist das zentrale Problem. Nicht, wie haben wir Recht, sondern wie sind wir in der Lage, so politisch zu handeln, dass das, was notwendig ist, auch von allen eingesehen oder mindestens politisch gebilligt wird? Sonst wird nur postuliert. Die Minderheiten, die Emanzipation von Rassismus, der Kampf gegen Rassismus, bis hin zu Fundamentalismus, in Amerika die schwarze Bewegung, bis hin zu den Black Panthers – das heißt, wir haben eine erschreckende Wiederholung des Immergleichen. Und dieses zu besprechen, das, glaube ich, ist die Aufgabe, die wir haben – und schon deswegen, weil wir wieder eine neue Bewegung haben. Wir haben eine neue Bewegung im Moment, die was Richtiges sagt, die eine ganz einfache Frage stellt: Wieso akzeptieren wir, dass die Welt, so, wie sie ist, so ungerecht ist? Wieso akzeptieren wir, dass, wenn man von Globalisierung redet, es bedeutet, dass der Wohlstand von wenigen in der Welt besser organisiert wird und dass diese Globalisierung nicht so ausgerichtet wird, dass die Menschen in der Welt davon profitieren können? Natürlich ist es zu einfach, werden hier kluge Neoliberale sagen, aber natürlich, von der Entwicklung, von der Öffnung der Märkte, profitieren auch die anderen. Es stimmt auch ein bisschen, vielleicht, manchmal, wenn es gerade richtig geht, wenn es gut läuft, wenn es gerade nicht die falsche Entscheidung war am falschen Ort. Nur das Problem ist auf alle Fälle, dass das Profitieren von Märkten nicht das Hauptproblem derjenigen ist, die im Moment die Globalisierung als Projekt betreiben, sondern es gibt eine neoliberale These – wieder ein neuer Fundamentalismus –: Der Markt regelt alles. Die Postulierung des Marktes. Wir hatten wieder was anderes anno dazumal: die Ablehnung der Marktwirtschaft. Da kamen alle Verrücktheiten. Man sollte Kursbuch Nr. 13 lesen, über die Selbstorganisation der Räte in Westberlin, die Enzensberger, Rudi Dutschke und andere sich vorstellten, wie man selbst Berlin praktisch organisieren kann, losgelöst vom Westen, vom Osten, von oben und von unten – das ist eine ganz spannende Diskussion. Also, nein zum Markt war ein Fundamentalismus; ja, der Markt regelt alles ist der neue, der herrschende Fundamentalismus – und in dieser Auseinandersetzung scheint es, als ob wir keine Stimme hätten, dass wir nur entweder dem einen zustimmen sollten oder dem anderen. Und das möchte ich am Ende dann wieder aufgreifen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir hier eine Schlüsselfunktion haben, ob wir wirklich nur das, was ist, akzeptieren und deswegen nur Politik machen, um das, was ist, zu gestalten, was ziemlich langweilig ist – oder ob wir andere Ansprüche haben in unserer Gestaltungsfähigkeit, als nur das, was ist, zu gestalten. Aber dafür muss ich einen Umweg machen.
Vorhin wurde gesagt, Krieg ist wieder ein Mittel der Politik, und wenn ich die Betonung richtig verstanden habe, ist das schrecklich. Dass man es schrecklich findet, ist, glaube ich, von niemandem in Abrede zu stellen. Die Frage, vor der wir uns befinden, ist schlicht und einfach: Wie gehen wir mit dieser Realität um? Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Menschen in Deutschland, nicht nur bei den Grünen, der Realität den Rücken zuwenden. Sie haben eine Vorstellung von der W elt, von dem, was sein sollte. Ab und zu riskieren sie einen Blick nach hinten, sehen Grausamkeiten und sagen: nee nee, die Welt, die wir wollen, die ist da, die Welt, wie sie ist, ist da, und dann marschieren sie dieser Realität entgegen, weil sie sich ihr entziehen wollen. Wer Politik machen will, kann sich der Welt nicht entziehen. Hannah Arendt: “Solange Europa geteilt bleibt“ – sie schreibt in den Siebzigerjahren – “kann es sich den Luxus erlauben, sich vor diesem beunruhigenden Problem der modernen Welt zu drücken. Es kann weiterhin so tun, als ob die Bedrohung unserer Zivilisation von außerhalb käme, Europa also von zwei ausländischen Mächten, die ihm gleichermaßen fremd sind, bedroht wird. Beide Strömungen, Antiamerikanismus und Neutralismus, sind in gewisser Hinsicht Anzeichen dafür, dass Europa im Augenblick nicht bereit ist, sich den Konsequenzen und Problemen seiner eigenen Geschichte zu stellen.“ Das ist nicht heute geschrieben worden, das ist nicht während Bosnien geschrieben worden, das ist 1971 geschrieben worden. Warum? Ich bin der festen Überzeugung, dass hier Hannah Arendt den Punkt trifft.
Wir haben in Deutschland, vor unserer Tür, jahrelang einen Krieg gehabt – in Bosnien: Tausende von Toten, Tausende und Tausende von Toten, es wurde gebombt, Städte wurden zerbombt von regulären Armeen, Bosnien, Kroatien. Es wurde gebombt, gemordet, und dann kam das, was wir alle wollten, die Vereinten Nationen. Und dann kam das, was wir alle wollten, dass die Blauhelme dazwischengehen. Fünfzigtausend Soldaten waren in Bosnien, Blauhelme. Sie sollten den Krieg beenden. In ihrer Anwesenheit sind Zigtausende von Menschen ermordet worden, erschlagen, Tausende von Frauen vergewaltigt worden, ins KZ gesteckt, in Anwesenheit der größten Armada, die die Vereinten Nationen je mobilisiert haben, als friedensstiftende Armee. Haben wir geschrien? Haben wir “Nie wieder Krieg!“ so geschrien wie zur Zeit des Vietnamkrieges? Waren unsere Straßen so voll? Waren wir tatsächlich empört? Waren unsere Fenster voller Laken? Nie wieder Krieg! Und hier, Blauhelme, stoppt das doch endlich! Wir haben das wahrgenommen in den Nachrichten und plötzlich, plötzlich kam Srebrenica, der zukünftige Außenminister hat es endlich verstanden, und die Auseinandersetzungen wurden dann geführt, wie Menschen gesagt haben: Nicht mehr “Nie wieder Krieg“ – “Nie wieder Srebrenica“. In Anwesenheit wieder der Blauhelme, mehrerer Tausend holländischer Blauhelme, wurden durch eine reguläre Armee sieben- bis achttausend Menschen gefangen genommen, in die Wälder getrieben und alle ermordet. So, an diesem Punkt gibt es Fragen: Wer ist schuld? Was bedeutet “Nie wieder Krieg“? Nie wieder Krieg bedeutet in diesem Moment, mit dieser Realität: Stoppt diesen Krieg! Die Blauhelme haben ihn nicht gestoppt. Also, die Blauhelme konnten nicht als Blauhelme Kriegshandlungen selbst initiieren. Da kam die NATO, da kam die Intervention, und dann waren wir elektrisiert. Nie wieder Krieg! Unsere Straßen wurden wieder voll, unsere Herzen waren wieder voller Hass, unsere Tränen waren wieder in unseren Augen, wir waren wieder da. Warum? Weil die Amerikaner da waren. Plötzlich waren wir wieder da. Vorher haben wir gelitten, still. Und dann durften wir wieder nach außen, durften wir endlich sagen, nein, diese Welt von Krieg wollen wir nicht, Krieg kann keine Probleme lösen.
Krieg kann keine Probleme lösen, sagen die Spätgeborenen in der Bundesrepublik. “Krieg kann keine Probleme lösen! Wie seid ihr frei geworden?“, sagen die Amerikaner. Durch Blauhelme? Nein, durch den Tod von irgendwelchen jungen Amerikanern aus Iowa, denen gesagt wurde, es muss sein, ihr müsst an den Stränden der Normandie für die Freiheit sterben. Natürlich für die ökonomische Macht der Amerikaner, natürlich auch dafür, weil Amerika gesagt hat, die Welt, so, wie sie ist, darf nicht mehr so sein, und wir, die Amerikaner, übernehmen die Führung in dieser Welt. Ja. Und wir haben, später mit der Nordallianz, dann auch akzeptiert, dass Stalin, die zweite große Barbarei auf dieser Welt, zum Bündnispartner wurde zur Befreiung Europas. Ohne Wenn und Aber. Schaut euch an, was es bedeutet hat, die Rote Armee in Berlin. Schaut euch das mal an! Was will ich wohl damit sagen?
Ich will damit sagen, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland und wir haben in Europa heute miteinander etwas zu klären. Gibt es historische Momente, in denen Freiheit verteidigt werden muss? Das ist eine einfache Frage. Die ist höchst kompliziert zu beantworten. Diese Frage wird von den einen instrumentalisiert – den Amerikanern in Vietnam: Im Namen der Freiheit wurde das vietnamesische Volk mit Krieg überzogen und das Land zerstört. Das heißt, wer die Frage so stellt, hat nicht immer Recht. Amerika war in den Sechzigerjahren nicht idealtypisches Abbild der Freiheit, die Schwarzen können ein Lied davon singen. Das heißt, das einfache Behaupten, ich verteidige die Freiheit, ist nicht die Antwort auf diese Frage. Aber es gibt historische Momente, in denen man sich entscheiden muss, dagegen oder dafür. Wenn man sich im Vietnamkrieg gegen die Amerikaner entschieden hat, hatte man meiner Meinung nach Recht. Ohne Wenn und Aber. Wenn man sich in Bosnien gegen die Amerikaner entschieden hat, hatte man Unrecht, weil dieser Krieg so war, dass die, die ihn begonnen haben, die Vernichtung der Bosnier wollten. Dies zu verhindern galt es, und deswegen war es Recht. Die Amerikaner waren bereit, die Vietnamesen zu vernichten, um ein politisches System aufrechtzuerhalten, wie sie es wollten. In Bosnien waren sie bereit, Menschen vor der Vernichtung zu schützen, das ist etwas ganz anderes. Deswegen sind sie nicht immer gut, und sie sind auch nicht immer böse. Man muss es politisch entscheiden.
Und dann geht es weiter mit Kosovo, Mazedonien. Wenn man Ja sagt zu einer militärischen Intervention, was ich die gleiche Logik finde, und ich will nicht noch einmal das gleiche Spiel machen über Kosovo, wie ich es zu Bosnien gemacht habe, weil es zu lange dauern würde, aber eins will ich sagen – man kann Ja zu einer Intervention sagen und trotzdem sehr kritisch mit der Art dieser Intervention umgehen. Natürlich gibt es auch ein Recht, was ein Rechtsstaat im Krieg aufrechterhalten muss, da gibt es Konditionen, da gibt es auch von der UNO, von dem Völkerrecht definierte Dinge, und da muss man genauso hart sein. Nur eins, und das meine ich mit der Realität, die Wahlen im Kosovo letzten Sonntag: Ohne das, was mit der Intervention geschah, hätte es diese Wahl nicht gegeben. Aber was war das Faszinierende an dieser Wahl? Ich war nach der Befreiung des Kosovo der Meinung, die Freiheit des serbischen Volkes auch dort geht nur über die Vertreibung von Milosevic. Nachdem dieses serbische Volk das verstanden hat, und nachdem Kostunica sich endlich entschied, im letzten Moment auch einen Aufruf zur Wahl zu machen im Kosovo, war das Faszinierende. Bis zum Anbruch der Dunkelheit hat es im Kosovo eine Wahlbeteiligung der Serben von 6 Prozent gegeben – bei Einbruch der Dunkelheit kamen Tausende und Tausende von Serben und gingen zur Wahl noch bis halb acht. Sodass die Wahlbeteiligung trotz der Bedrohung durch militante Kräfte bei sieben- oder achtundvierzig Prozent gelandet ist. Das ist meiner Meinung nach eine demokratische Lektion. Die Angst zu überwinden, um wählen zu gehen. Stellen wir uns das mal bei uns vor. In Timor haben die Menschen ihr Leben riskiert, um von den Bergen runterzukommen und wählen zu gehen. Unvorstellbar bei uns.
Diese Werte, die gilt es zu verteidigen, das ist die einzige Hoffnung – ich weiß nicht, ob es im Kosovo klappen wird. Ich weiß nicht, ob es in Mazedonien klappen wird, aber eins ist sicher: Mazedonien hat heute eine Verfassung, die den Minderheiten, den Albanern, den anderen, Rechte gibt, die sie noch nie hatten in diesem Land. Das heißt nicht, dass diese Verfassung, Verfassungsrealität, auch Lebensrealität für die Menschen jetzt in Mazedonien ist, aber alle, die ihr Gewissen mobilisiert haben, dass die Bundeswehr dort nicht die UCK entwaffnen kann, müssen dies oder dürfen das doch einmal überprüfen. Ist die Entwaffnung der UCK nicht Friedenspolitik gewesen? Ist es nicht Friedenspolitik, Hoffnung wieder zu installieren, was heißt, einem Land die Möglichkeit zu geben, eine Verfassungsrealität zu erhalten, in der sich die Menschen aus Mazedonien wieder frei fühlen. Trotzdem ist es richtig, wir hätten im Kosovo Rugova schon am Anfang unterstützen können, wir hätten schon lange wissen können, dass, wenn wir diese pazifistische Emanzipationsbewegung nicht unterstützen, es zum Kriege, zum Konflikt kommen wird. Das heißt, der Krieg im Kosovo, der Krieg in Bosnien, ist auch deswegen gewesen, weil wir versagt haben in unserer präventiven Politik. Das kann man genauso mit klaren Gedanken formulieren.
Zu Afghanistan. Natürlich sind die Amerikaner mitverantwortlich für die Verhältnisse in Afghanistan. Das ist nicht zu leugnen, genauso wie die Russen mitverantwortlich waren durch den Hitler-Stalin-Pakt. Das heißt, die Kritik an der Politik der Vereinigten Staaten, die Kritik an der maßlosen Arroganz, an der maßlosen Überheblichkeit, dass sie glauben, sie könnten die komplexe Welt heute allein führen, diese Kritik ist absolut richtig. Es ist eine politische, und diese politische Kritik müssen wir durchhalten. Deswegen sind alle Versuche, die Solidarität mit den Amerikanern durch irgendwelche Adjektive zu übersteigern, lächerlich, absolut lächerlich. Solidarität genügt, denn unabdingbare Solidarität, das müssten wenigstens die Linken wissen, die gibt es nicht mehr, spätestens seitdem wir die unabdingbare Solidarität mit den Befreiungsbewegungen aufgegeben haben, weil wir uns so oft geirrt haben. Man kann mit niemandem mehr unabdingbar solidarisch sein, auch nicht mit den Amerikanern, weil es Unsinn ist, völliger Unsinn. Das bedeutet, dass man solidarisch sein kann und seinen eigenen Kopf behält. Ohne Probleme. Die Frage aber ist: Afghanistan, worum geht es? Schlechte Zivilisation, der Islam, und da kommen alle toleranten Menschen dieser Welt und sagen, wir dürfen ja nicht den Islam verteufeln. Moment mal. Moment mal. Wir verteufeln gar nichts. Der Islam stellt sich dar, wie er ist. Wenn es nur etwas gegen den bösen Amerikanismus ist, wenn diese Gewalt, diese vernichtende Gewalt, die sich in New York artikuliert hat, nur in Amerika die Gewalt wäre, dann, wenn das alles wahr ist, dann hätte es Hunderttausende Tote in Algerien, die in Algerien umgebracht wurden von algerischen Fundamentalisten, nicht gegeben. Arme, Frauen, Kinder wurden massakriert, stranguliert, weil sie den Fundamentalisten nicht helfen wollten in Algerien gegen den korrupten Staat. Wenn die Islamisten nur gegen die Potentaten, gegen die Reichen, gegen die Symbole des Kapitalismus wären, warum mussten dann in Oran so viele Menschen sterben, warum mussten in Algier so viele Menschen sterben? Wenn die Amerikaner gar nichts tun? Vielleicht liegt es einfach in der Ideologie, an der bestimmten Interpretation des Islams, nicht der Islam als Ganzes. Aber niemand wird mir sagen, dass die Kreuzzüge mit dem Katholizismus nichts zu tun haben. Niemand wird mir sagen, dass das bestimmte Verhalten eines Papstes in einer bestimmten Situation nichts mit dem Katholizismus zu tun hat. Also wir dürfen ja noch irgendwann, auch wenn wir für Einwanderung, für Toleranz, für Offenheit sind, mal über Religion diskutieren, auch über die Vernebelung, auch über die autoritären Strategien von Religion, Menschen zu beherrschen, ohne dass man gleich zum Rassisten wird. Es ist unsere Pflicht – und dann diskutieren wir: Was ist das Taliban-Regime? Was war bin Laden? Das ist eine politische Strategie, die sich einer Religionsinterpretation bedient. Wenn man sich das letzte Video von bin Laden ansieht, da hat bin Laden nicht nur vier Punkte, sondern, Punkt fünf, nach dem Anschlag gesagt: Wiedereinführung des Kalifats. Diese Interpretation des Islam bedeutet, dass es nur eine Interpretation des Islam gibt. Dies ist gerichtet gegen andere Interpretationen, die alle nicht ausschließend sind, sondern den Islam in seiner Toleranzfassung sehen. Es gibt aber im Islam eine, die ausschließt, und das sind die wahhabitischen Interpretationen. Und das Entscheidende, natürlich kommt Palästina, natürlich kommt Israel, all das kommt vor, aber das Entscheidende ist: Saudi-Arabien. Und da sagt bin Laden, Scheich so und so, der lebt die Hälfte seines Lebens in London, die andere Hälfte in Saudi-Arabien. Und er macht eine Beschreibung der Realität in Saudi-Arabien, und zwar des korrupten Regimes und anderer Regimes, und in Pakistan, und setzt dagegen ein Projekt, ein politisches Projekt, und das Projekt ist das, was die Taliban in Afghanistan installiert haben. Diese Gesellschaftsordnung – die Frauen, die Männer, die sich nicht rasieren wollen, die Kinder, die Mädchen, die nicht zur Schule gehen dürfen –, ein System, was die höchste Sterblichkeitsrate an Kindern hat vor dem 11. September; die höchste Rate an Toten vor dem 11. September. Da sind Millionen, die sterben vor dem 11. September, auch im Krieg der Stämme miteinander und so weiter, auch in Verantwortung derjenigen, die sich später als Nordallianz strukturiert haben, politisch organisiert und strukturiert von den Amerikanern, und als die Amerikaner gemerkt haben, dies entgleitet ihnen, haben sie vor dem 11. September versucht zu verhandeln, sie haben die diplomatische Lösung gesucht, sie haben die politische Lösung gesucht, sie haben Druck auf Pakistan und Saudi-Arabien gemacht, die mitverantwortlich sind, obwohl sie als moderat gelten gegenüber anderen arabischen Staaten, in dem Sinne, dass man nicht zwei Hände abgeschnitten bekommt wie in Afghanistan, sondern nur eine Hand in der Scharia – das ist das Moderate an SaudiArabien. Die haben versucht, diese Lösung zu suchen und waren bereit zu kollaborieren mit den Taliban, die wollten überhaupt keinen Krieg mit den Taliban, die wollten die Taliban instrumentalisieren für eine Sicherung der Region, auch weil es um Öl, um Pipelines ging und so weiter. Sie haben das getan, was die gesamte Protestbewegung fordert, die politische Lösung zu suchen, aber das war nach dem 11. September nicht mehr möglich. Und warum? Weil es nicht einfach eine Kampfansage gegen Amerika war, sondern Amerika sollte getroffen werden, um in der pakistanischen Armee und in Saudi-Arabien zu zeigen: Wir sind in der Lage, indem wir die Amerikaner treffen, die Macht politisch zu übernehmen in Pakistan und Saudi-Arabien. Und das ist die politische Bewegung, Begründung, warum dies jetzt, nach dem 11. September, verhindert werden musste und warum diese Intervention meiner Meinung nach notwendig war. Das bedeutet, dass dies schrecklich ist, es gibt keinen sauberen Krieg. Und als die Alliierten in Cherbourg und Caen gelandet sind, haben sie Cherbourg und Caen bombardiert, und es sind Franzosen, Kinder und Frauen gestorben, weil es sonst nicht gegangen wäre, sie wären nie an der Küste sonst gelandet. Das leugne ich gar nicht. Nur eins – wenn wir in Deutschland immer hören, Kabul ist bombardiert, Kandahar ist bombardiert worden, mobilisiert das Dresden, Hamburg, Frankfurt, die Bombardierung der deutschen Städte? Nur das ist es nicht. Wäre dies der Fall, jetzt nachdem Kabul gefallen ist, also befreit wurde, dann schauen wir in die Augen der Menschen, sehen wir doch die Frauen, die Kinder, die Männer, die auf der Straße sind – fühlen sie sich bedroht durch die Befreiung? Hat die Weltpresse, die Weltmedien, alle Fernsehanstalten, von der ARD, von den Franzosen, die könnten uns die bombardierte Stadt zeigen, die könnten uns das Dresden, was Kabul hat, das Hamburg, was Kabul hat, das Peschawar, das Kandahar, was Hamburg hat, das könnten sie uns doch zeigen! Nein! Weil es nicht so ist. Das heißt nicht, dass die Amerikaner saubere Krieger sind. Ich sage einfach, dass sie nicht einen Krieg gegen das afghanische Volk geführt haben. Man kann immer noch gegen diesen Krieg sein. Das leugne ich nicht, ich will nur, dass man dann saubere Gedanken hat, dass man Gedankenschärfe hat. Dieser Krieg ist ein Krieg, der notwendig war – das ist meine These –, dieser Krieg darf nicht sein, ist eine andere These, aber dieser Krieg befreit auch die Afghanen, die unter dem Joch der Taliban gelebt haben. Das behaupten sie selbst. Lest heute in der Zeitung Generation, wir haben aus den Archiven der Mullahpolizei heute wirklich abgeschrieben, wie Männer gepeitscht wurden, ausgepeitscht Frauen, die sich geweigert hatten ein Kopftuch anzuziehen, die sich geweigert hatten, zu Hause zu bleiben, die Männer, weil ihr Bart zu lang war oder zu kurz war, wurden ausgepeitscht, das heißt im Alltag wurde die religiöse Repression ausgeübt.
Dies alles zusammenfassend will ich sagen: Gibt es eine Alternative zu dem, was wir heute leben? Ja. Es gibt eine. Die Alternative heißt aber, dass wir, das meine ich, und da komme ich wieder zur Globalisierung, den Amerikanern nicht die Alleinherrschaft in der Welt überlassen dürfen. Nicht, weil die Amerikaner schlecht sind, nicht, weil die Amerikaner nichts verstanden haben, sondern wenn eine Weltmacht allein ist, ist einfach die demokratische Substanz der Welt in Gefahr. Ganz, ganz kurz und bündig. Das heißt: Wir in Deutschland, Frankreich, haben eine Aufgabe, und diese Aufgabe heißt Europa. Ich habe vorhin etwas zitiert von Hannah Arendt, ich möchte noch ein Zitat bringen, 1961: “Über Deutschland wäre manches zu berichten. Ich mag im Moment nicht. Ich hatte viel Gelegenheit, mit Studenten zu reden und zu diskutieren. Die einzige Hoffnung bleibt doch eine Föderation Europas, ganz gleich, wie klein dieses Europa erst einmal ist.“ Ich glaube, dass in der Tat sowohl, was die Frage der sozial-ökologischen Regulierung der Globalisierung als auch, was die Frage des demokratischen Gleichgewichts, des politischen Gleichgewichts, angeht, wir die nationalen Sonderwege, welcher Art auch immer, ablehnen müssen. Und das ist zum Schluss meine größte Kritik, die ich an der von mir unterstützten Bundesregierung mache, an der Schröder-Fischer-Bundesregierung. Hätte es in Europa einen wirklich großen Staatsmann gegeben, dann hätte er in dieser Zeit der Krise die Gelegenheit beim Schopf gepackt, um Europa zu stärken.
Zwei Staatsmänner waren es beim Euro. Ich werde sagen wie. Es hätte den Euro in Europa nie gegeben ohne das Problem der Vereinigung. Jeder weiß das. Es gab etliche Versuche den Euro zu gestalten, vorher, es gelang nie. Gründungsbasis Europas war die Gleichberechtigung aller Staaten. Gründungskonsens in den Fünfzigerjahren war, Deutschland ist geteilt. Die Aufhebung der Teilung Europas hat Ängste mobilisiert, in Frankreich, in England. Mitterand hat nur eine Lösung gesehen, nachdem er alles versucht hat, die deutsche Einheit zu verhindern, bis hin um nach Ostberlin zu fahren, um zu sehen, ob man nicht eine demokratische DDR haben kann neben der demokratischen Bundesrepublik; und als er gemerkt hat, dass die Menschen das nicht wollen, aus guten und schlechten Gründen, weil sie Bananen und D-Mark lieber hatten als ein Versprechen auf Demokratie, die sie vielleicht nie kriegen. Das mag alles sein. Dann hat Mitterand gesagt, das Ja Frankreichs wird es nur geben, und davon hat er auch die Amerikaner überzeugt, wenn es eine Vertiefung der europäischen Einheit gibt, das heißt, wenn es die Gründung, wenn es die Schaffung des Euro gibt. Und jetzt hat der belgische Unterhändler erzählt, wie das gelaufen ist, dass Helmut Kohl mit Tränen in den Augen Ja gesagt hat. Warum? Weil er wusste, was er Deutschland antat. Sich zu verabschieden von der D-Mark für die Vereinigung. Das waren Staatsmänner, die in einer Krise den Ausgang gesucht haben, eben nicht in der Stärkung der nationalen Sonderregel, sondern dies versuchten über eine Stärkung der europäischen Perspektive – und wie hätte das heute ausgesehen? Das hätte ganz einfach ausgesehen. Die Amerikaner sagen, wir brauchen eure Hilfe. Da kommen die europäischen Staatsmänner und Schröder, wenn er groß ist, Chirac, wenn er groß ist, Jospin, wenn er groß ist – wer auch immer, kommen dann zum Ratschlag und machen folgenden Vorschlag: Wir beschließen, als europäischer Rat, dass wir als Europäer den Amerikanern beistehen werden, und zwar solidarisch, wie es die Franzosen sagen, wie es die Engländer sagen, wie es alle sagen, und wir werden als Europäer auch unsere militärische Beistandspflicht leisten. Mit so einem Beschluss gehen sie vor das europäische Parlament. Da hätte es eine der spannendsten Debatten für die europäische Öffentlichkeit gegeben, und da hätten wir in Deutschland gesehen, die europäischen Christdemokraten waren gespalten; die nordischen Christdemokraten wären dagegen gewesen. Die Deutschen, die Italiener, die Franzosen für eine militärische Bereitstellung. Die europäischen Liberalen wären gespalten gewesen. Die europäischen Sozialdemokraten wären gespalten gewesen. Die europäischen Grünen wären gespalten gewesen, und die europäischen Kommunisten wären fast nicht gespalten gewesen, weil sie immer wissen, wo es langgeht. Aber es hätte große Abstimmungen gegeben, eine große Mehrheit für die Bereitstellung und eine starke Minderheit aus allen politischen Familien. Mit vernünftigen Begründungen oder unvernünftigen dagegen. Und mit dieser Abstimmung im europäischen Parlament hätten dann die nationalen Parlamente natürlich selbst die Bereitstellung beschließen müssen, aber unter ganz anderen Bedingungen. Die europäische Öffentlichkeit hätte gesehen, dies ist eine Frage, die nicht parteipolitisch entschieden wird, sondern die entscheiden die Abgeordneten mit Beweggründen, die unterschiedlich sind, und dann wäre es egal gewesen, mit welcher Mehrheit Schröder dies gehabt hätte, weil es das Spiegelbild der Situation gewesen wäre, die es in Europa gegeben hat, und da hätte man gesehen, dass es christdemokratische deutsche Abgeordnete gibt, die auch dagegen sind, die hätten sich dann endlich getraut, auch im Bundestag mit Sozialdemokraten aus dem Osten und mit Grünen aus dem Osten dagegen zu stimmen, ohne dass da die Parteikatastrophe ausgebrochen wäre. Und da sieht man – wenn man die historischen Momente nicht historisch beantwortet, hat man eine dramatische, kleinkrämerische Auflösung. Ich bin der festen Überzeugung, dass Hannah Arendt vielleicht etwas ganz anderes gesagt hätte, vielleicht wäre sie dagegen gewesen, vielleicht wäre sie dafür gewesen, ich weiß es nicht. Aber in einem bin ich sicher, sie hätte versucht, sich nicht opportunistisch so oder so zu schlagen, sondern sie hätte versucht, Argumente zu entwickeln, so, wie sie es über Little Rock gemacht hat, wo sie alle vor den Kopf gestoßen hat, als sie gesagt hat, natürlich muss man die Gleichberechtigung der Schwarzen erkämpfen. Aber Kinder zu instrumentalisieren, sie zu zwingen, in Schulen zu gehen, die sie nicht wollen, ist unverantwortlich, von wem auch immer. Und dieses Bild haben wir vor ein paar Wochen wieder gehabt, in Irland, wo genau das Gleiche sich abgespielt hat, und da kamen mir diese Zeilen von Hannah Arendt, die sprangen aus dem Fernseher raus – wer übernimmt die Verantwortung, dass diese katholischen Kinder durch diese Hölle gehen müssen, nur damit bewiesen wird, dass sie in diese Schule gehen. Das ist den Preis nicht wert. Und vielleicht ist der Preis dessen, was ich gesagt habe über Afghanistan, den Preis Krieg nicht wert. Aber dann zwingen wir uns, nicht über Gesinnung, nicht über Gewissen, sondern dann zwingen wir uns, Grundüberzeugungen zu diskutieren. Grundüberzeugungen müssen am Ende in einer Demokratie, die müssen irgendwie sich aufeinander abstimmen, und die müssen kompromissfähig sein. Politik ist die Kunst der Schärfe der Argumente, der Radikalität der Argumentation und der radikalen Bereitschaft, dann am Ende kompromissfähig zu sein. Dies ist meiner Meinung nach eine Lektion, die die politische Theorie von Hannah Arendt hergibt, wenn man sie individualistisch liest, wie ich sie lese.
Meine Damen und Herren, erstmal möchte ich mich nicht nur bedanken, sondern unterstreichen, dass es viele Preise gibt, die ich gern annehme, aber die mich sicherlich nicht bewegen würden. Doch der Hannah-Arendt- Preis ist für mich etwas Besonderes, und ich weiß nicht, ob heute vielleicht eine politische Dimension, an der ich teilgenommen habe, nämlich diese grüne Partei, vielleicht kaputtgeht, das wäre ja vielleicht eine Ironie der Geschichte, dass einerseits das PolitikSchaffen irgendwie in so einer Sackgasse landet und andererseits ich diese für mich besondere Würdigung erhalte, aber so ist nun mal das Leben. Nun, da ich optimistisch bin, sage ich, es wird schon weitergehen. Ich möchte nur sagen, sehr geehrter Bürgermeister, und da ich von dem Bundeskanzler gehört habe in Nürnberg, lieber Genosse Henning, denn man sagt ja noch Genosse, wie ich ihn im Fernsehen habe sagen hören, also lieber Genosse Henning, ich möchte doch eins feststellen. Gewürdigt wurde nicht 68, sondern ich. Und ich möchte doch eins in der Öffentlichkeit feststellen: Ich bin nicht 68, sondern ich bleibe ich. Und so gern ich als Projektionsfläche für 68 weiterhin fungieren werde und weiß, dass mein Name mit dieser Epoche auch verbunden ist, sollten wir uns zwingen, in der Auseinandersetzung ein bisschen schärfer zu denken. Und da meine ich, dass ich – im Gegensatz zu vielen von 68 – eng verbunden bin, nicht nur emotional, mit Hannah Arendt, sondern vor allem inhaltlich-politisch. Denn das war der Grund, warum zwischen mir zum Beispiel und dem SDS von Anfang an eine tiefe Kluft war, denn ich kam nach Deutschland als Antikommunist, 68, ich war immer Antikommunist, von links. So etwas kannte man in Deutschland überhaupt nicht, man wusste nicht, dass es eine solche Spezies gab. Und deswegen war Hannah Arendt rechts, weil sie als Antitotalitäre es gewagt hat, überhaupt Totalitarismus, Kommunismus, Faschismus zu denken, nicht als Einheit, sondern als Ausdruck der Negation der Freiheit. Und diese Auseinandersetzung, die habe ich von Anfang an geführt, und nicht umsonst schrieb Hannah Arendt 68, am 27. Juni, und das habe ich mir jetzt noch reingeholt: “Ich möchte dir nur zwei Dinge sagen: Erstens, dass ich ganz sicher bin, dass deine Eltern und vor allen Dingen dein Vater sehr zufrieden mit dir sein würden, wenn sie noch lebten, und zweitens, dass, falls du in Ungelegenheiten gerätst und vielleicht Geld brauchst, ich immer bereit sein werde nach Möglichkeit zu helfen. Viel Glück und mach’s weiter gut. Hannah.“ Und, naja, ein paar Jahrzehnte später ist das Geld in Form des Preisgeldes angekommen. Ich finde, das hat eine historische Logik. Ich möchte das auch deswegen feststellen, weil ich Hannah zum ersten Mal 1959 gesehen habe in Frankfurt, als sie in der Paulskirche die Laudatio für Jaspers gehalten hat, und sie davor bei uns zu Hause war und meine Mutter gesehen hat, das war das erste Mal – das war unwichtig. Das zweite Mal habe ich Hannah Mitte der Sechzigerjahre, ich glaube 1962 oder 1963, beim Auschwitz-Prozess getroffen, zufällig als Zuschauer. Ich war mit der Schulklasse dort, und sie war dort auch, hat sich einen Tag angehört. Und alle staunten, dass wir uns so begegneten – woher kennt er sie? Woher kennt sie ihn? Und da sagte sie mir etwas – wir diskutierten so eine Viertelstunde, zwanzig Minuten zusammen – sie sagte mir immer: Dany, vergiss nie, Totalitarismus ist nicht nur Auschwitz. Totalitarismus ist auch die Sowjetunion. Und 89, für mich war 89 nicht die erste Erfahrung, sondern 1956, da war ich 11 Jahre alt, da ging ich an der Hand meines Bruders, der 9 Jahre älter ist, zu meiner ersten Demonstration, eine Demonstration gegen den Einmarsch der Russen in Budapest. Und diese Demonstration hatte etwas für mich ganz Besonderes. Also erst mal war es meine erste, aber sie war sehr gewalttätig, und zwar aus einem Grund: Es gab die linke, linksradikale Demonstration gegen den Einmarsch der Russen, Ziel war das Parteigebäude der kommunistischen Partei und auf der anderen Seite kamen die Rechtsradikalen, deren Ziel war auch die Zentrale der kommunistischen Partei. Und da sagte mein Bruder zu mir: Das ist unser Problem, aber die Linken wollten vor allem eins, sie wollten vor den Rechtsradikalen da sein, weil sie zeigen wollten, dass es Menschen gibt – damals war mein Bruder zum Beispiel noch Sozialist, der glaubte an einen anderen Sozialismus – dass es Menschen gibt, die für Demokratie und Sozialismus sind. Das war meine erste Demonstration, und diese Auseinandersetzung habe ich dann durchgehalten, das ist auch einer der Gründe, das stimmt einfach, warum ich so in dieser Auseinandersetzung gekämpft habe gegen den Totalitarismus in unseren Reihen, und der Totalitarismus in unseren Reihen war natürlich geprägt durch den Terrorismus, der sich begründen konnte, das müssen wir anerkennen, in einem Teil unserer Theorien. Das heißt, so, wie die Kreuzzüge etwas mit Katholizismus zu tun haben, so, wie der islamische Fundamentalismus etwas auch mit dem Islam zu tun hat – nicht der Islam ist, und nicht der Katholizismus –, so hat auch der Terrorismus etwas mit unseren Theorien zu tun. Das zeigt, dass wir immer nachdenken müssen über das, was wir sagen und was wir machen, das zeigt auch, dass diese Auseinandersetzung nicht nur notwendig, sondern die einzige Auseinandersetzung, die einzigen Möglichkeiten sind, weiterzukommen.
Und dann möchte ich – leider ist Professor Vollrath nicht da – sagen, ich fühle mich geehrt, mit ihm einen Preis zu haben. Natürlich hätten wir wahrscheinlich 68 gestritten, hätten wir uns getroffen. Na und? Das Problem ist, dass sicherlich Professor Vollrath damals ein Gespür für etwas gehabt hat, nämlich unser – ich meine jetzt uns im Sinne dieser Bewegung, egal wie ich oder was ich gedacht habe – unser Unvermögen, Demokratie und Revolte praktisch zu denken, denn wir wollten doch praktisch sein. Wir haben das Bedürfnis nach Freiheit gehabt und dies drückten wir in unserer Revolte aus. Was uns gefehlt hat immer, wie, in welchem Rahmen kann diese Revolte nicht zur Negation unseres eigenen Bedürfnisses werden? Das ist glaube ich die zentrale Frage und diese Fragen haben, ich würde nicht sagen konservative, weil es völliger Quatsch ist, sondern aufgeklärte, liberale Philosophen, Denker, diese Fragen haben sie uns gestellt, und deswegen hatte Jürgen Habermas, auch wenn ich weiß, dass es einen Streit gibt um Hannah Arendt zwischen Professor Vollrath und Jürgen Habermas, aber trotzdem hat Jürgen Habermas in einem Punkt Recht gehabt, als er formuliert hat den Begriff vom Linksfaschismus. Auch da hat Jürgen Habermas eine Sensibilität gehabt für etwas, was schief lief bei uns, mit der wir uns in den Jahren danach haben auseinander setzen müssen.
Ich möchte zum Jahre 1949 etwas sagen zum Geist der Freiheit. Es wird sehr oft gesagt, Krieg löst keine Probleme und Krieg hat nie etwas Positives nach sich entwickeln lassen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur eins – meine Eltern haben die erste biologische Möglichkeit genutzt, ein Kind zu zeugen nach der Landung der Alliierten in der Normandie. Ich bin im April 45 geboren. Die Landung der Alliierten war im Juni, rechnen Sie sich aus, und deswegen würde ich sagen, ich werde nie sagen, dass eine Militärintervention nichts Positives bewirkt hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in den Debatten, die wir hier haben, es heute unsere Aufgabe ist, der deutschen Öffentlichkeit historische Bezugsrahmen zu erlauben, aber die deutsche Öffentlichkeit auch zu zwingen, Geschichte nicht nur als deutsche Geschichte immer wieder und immer wieder zu reflektieren. Und es verbindet mich mit Freimuth Duve, dass wir ganz am Anfang der Diskussion über Bosnien der deutschen Öffentlichkeit klarmachen wollten: Hört auf, wenn es um die Verteidigung der Freiheit geht, dies nur im Rahmen der deutschen Geschichte zu diskutieren; ihr müsst hier die europäische Geschichte als Bezugsrahmen sehen, weil natürlich ein Franzose anders darauf reagiert, ein Engländer, eine Engländerin, als wir, und wir müssen jetzt als Europäer eine Position bestimmen. Und mit Hans Koschnik verbindet mich ein Streit über Bosnien von Anfang an: Hans war versucht – und eben geprägt von seiner eigenen Lebenserfahrung – zu sagen: Nein, es darf nicht sein, Bundeswehrsoldaten dürfen nicht auf Grund der deutschen Geschichte – bis er selbst in Mostar gesehen hat, irgendetwas stimmt da nicht. Und das hat uns seitdem verbunden, seit er als Bosnienbeauftragter der europäischen Union dort gearbeitet hat. Und es verbindet mich mit mehreren Preisträgern des Hannah-Arendt-Preises. Viele Sachen – Claude Lefort. Claude Lefort hat ein entscheidendes Buch geschrieben, 1968, zwei Wochen nach dem Mai, zwei Wochen, mit Caudray und Edgar Morin, La breche, es ist die beste Interpretation der 68er-Bewegung, die je geschrieben wurde, dies drei Wochen nach den Ereignissen, nämlich aufgegriffen zu haben und entwickelt zu haben, was diese Bewegung aufgebrochen hat und was sie möglich gemacht hat – sich Freiheiten in dieser modernen Gesellschaft zu erkämpfen. Und deswegen möchte ich enden und sagen, wenn es einen Preis gibt – ich weiß nicht, ob ich ihn verdient habe, das würde ich nie behaupten –, den ich aber wirklich gern habe und mit dem ich, weil ich so unbescheiden bin, wahrscheinlich zu oft kokettieren werde, ist es dieser Hannah-Arendt-Preis, und ich möchte mich wirklich ganz herzlich bedanken für diese Auszeichnung. Vielen Dank.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz