
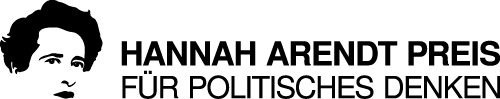

1997 erhielten Joachim Gauck und Freimut Duve den Hannah Arendt Preis für politisches Denken. Die Preisjury würdigte Joachim Gaucks dafür, „dass er die Aufregung um das Erbe der furchtbaren Stasi-Macht auf eine rationale Ebene gebracht hat und verhindert hat, dass die Vergangenheit, wie nach 1945, erst einmal aufs Eis gelegt wurde. Durch seine öffentlichen Auftritte hat Joachim Gauck einen gemeinsamen Platz des Erinnerns eröffnet, ohne den eine Republik nicht bestehen kann.“ Anlässlich der Wahl von Joachim Gauck zum Bundespräsidenten dokumentieren wir hier noch einmal die Rede der damaligen Laudatorin und Präsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Rita Süssmuth und die Dankesworte von Joachim Gauck.
Wir sind heute hier zusammengekommen, um mit Herrn Duve und Herrn Gauck zwei Personen zu ehren, die in der Haltung des aufrechten Gangs unabhängiges Denken und Handeln gelebt haben und damit zu öffentlichen Mahnern an diejenigen Grundsätze des Politischen geworden sind, auf die wir uns berufen, die aber im Alltäglichen immer in der Gefahr stehen unterzugehen. Mit ihrer vielfältigen Lebenserfahrung und daraus resultierenden unabhängigen Urteilskraft, die immer die Entwicklung in Deutschland mitreflektierte, stehen beide in den griechischen und römischen Traditionslinien einer republikanischen Haltung, die Hannah Arendt für unser heutiges Politikverständnis so fruchtbar gemacht hat.
Im Gegensatz zur Würde, die einem allein aus dem Menschsein selbst erwächst, bedarf die Ehre den Bezug der anderen, die diese dem Betreffenden zusprechen. Hannah Arendt selbst hat darauf hingewiesen, daß eine diesen Zuspruch kennzeichnende Laudatio eigentlich nur das bestätigen kann, was alle längst wissen, und zwar deswegen, weil es - wie hier heute abend - um Personen geht, die in der Öffentlichkeit stehen, also von jedermann gesehen werden. Aber gerade daran knüpft die heutige Ehrung an. Sie ist ein von anderen Bürgern erwiesenes Zeichen der Anerkennung und der Achtung, eine öffentliche Verdeutlichung Ihrer beider Ansehen und des Rufes, den Sie in der Bürgerschaft unserer Bundesrepublik erworben haben. Die Ehrung, die Sie heute erfahren, bezieht sich im Sinne Hannah Arendts auf Sie als ganze Person und nicht nur auf einzelne Worte oder Taten, und zwar deshalb, weil sie als Person mit der Ihnen jeweils eigenen Individualität das "Wagnis der Öffentlichkeit" auf sich genommen haben. Wagnis heißt, sich die eigene Meinung in Zustimmung und Ablehnung zurechnen zu lassen und dafür als ganze Person geradezustehen. Beide Preisträger haben mit dem, was sie sagten, ja nicht nur Zuspruch, sondern auch viel Ablehnung, darunter auch verletzende Bemerkungen ertragen müssen. Jeder, der sich in der Politik bewegt, weiß, wie schwierig es ist, in seinem Denken wie in seinen Entscheidungen sich nicht hinter jemand anderem, hinter einer Partei oder einer Organisation, zu verstecken, sondern eigene innere und äußere Standfestigkeit auch gegen Widerstände zu beweisen - und das heißt: ständig in der Bewährung zu stehen. Sich im Öffentlichen, in der Pluralität der Blicke der anderen zu bewegen, ist deshalb auch riskierte Freiheit. Sie wird nur durch das aufgewogen, was man Ihnen beiden zugleich auch anmerkt: Es ist die eigentümliche und ursprüngliche "Lust" - die auch Hannah Arendt auffiel - in der Öffentlichkeit als Person zu erscheinen und am öffentlichen Leben, am öffentlichen Diskurs aktiv teilzunehmen. Das Offenbar-Werden der eigenen Person - Hannah Arendt spricht von der Enthüllung des "wer einer ist" im öffentlichen Raum - kann aber dann auch zu der Haltung gelebter Humanität führen als dem "gültig Personenhaften, das einem Menschen, der es gewonnen hat, nie wieder verläßt" (Hannah Arendt). Dieses "Gültig Personenhafte", das wir an Ihnen beiden wahrnehmen, ist nicht zuletzt dem geschuldet, was dem berühmten Lessingschen Selbstdenken entspricht und Kant die "erweiterte Denkungsart" nannte. Es ist die Fähigkeit, sich in die Position des Gegenübers hineinzuversetzen und von daher verstehen zu suchen, bevor man sich die eigene Meinung, das eigene Urteil bildet. Auch diese für die Funktionsfähigkeit unseres Gemeinwesens so wichtige und zugleich doch so seltene Haltung ist etwas, was wir bei den Preisträgern immer wieder erleben und die es deshalb herauszuheben gilt. Diese Ehrung bezieht sich deswegen auch darauf, daß Sie beide im Öffentlichen mehr als andere dazu beigetragen haben, daß die zu verhandelnden Angelegenheiten klarer wurden. Hannah Arendt hat dieses, ein Wort von Karl Jaspers aufgreifend, die "Helle des Öffentlichen" genannt.
Hell wurde es, als Menschen 1989 Kerzen in das Fenster zum Zeichen des Widerstands und der Hoffnung stellten, und auch dann, als Menschen im wiedervereinigten Deutschland gegenüber rassistisch und ausländerfeindlich motivierter Gewalt Lichterketten bildeten. Es waren notwendige, symbolische Handlungen. Aber vor dem schnellen 'Verlöschen' kann diese Helle nur dann bewahrt werden, wenn sie sich zu Haltungen aufgrund von Einsichten und Prüfungen verdichten. Hell wird es deswegen vor allem da, wo nicht allein die Emotionalität des Augenblicks, erst recht nicht blinde Irrationalität oder vorurteilsgeprägte Meinungen vorherrschen, sondern wo kommunikative Vernunft waltet. Dazu gehört das, was heute nicht sehr oft anzutreffen ist: Sich in eigenständiger Weise kundig zu machen, den Dingen auf den Grund zu gehen, sie zu durchdenken, Maßstäbe heranzuziehen, sich mit anderen zu beraten, um auf diese Weise als Bürger an den öffentlichen Auseinandersetzung in gebotener Mündigkeit teilnehmen zu können. Es ist diese kommunikative Vernunft und die daraus erwachsende Urteilskraft, die die Preisträger auszeichnet. Beide sind Personen des öffentlichen Vernunftgebrauchs. Wir hören auf sie, weil sie uns etwas zu sagen haben, wir können sie achten, weil wir in ihren Urteilen ihre eigene ehrliche Auseinandersetzung vor dem Hintergrund ihrer nicht immer leichten Lebenserfahrungen spüren, und wir können sie anerkennen, weil sie, auf der ihnen individuell eigenen Weise, mit Leidenschaft am öffentlichen Leben teilnehmen und dabei doch die Geschicke von uns Deutschen im Auge haben. Bei beiden ist ein Nachdenken, eine Mobilisierung des Geistes zu spüren, der nicht im Glasperlenspiel verbleibt, sondern alltagspraktisch wird. Und das ist viel in einer Zeit, die sich an den Verlust tiefgründigen Denkens und daran gebildeter Urteile immer mehr gewöhnt, in der schubladenartige Einordnungen wie in das Rechts-Links-Schema dominieren anstelle des argumentativen Prüfens, in der häufig mediale Präsenz und die Orientierung am 'Skandalon' die politische, inhaltsbezogene Auseinandersetzungen zu ersetzen scheinen, in der oft die Parolen und das Plakative des Vordergründigen für das Ganze genommen wird. Demgegenüber beharren beide Preisträger auf Vernunft und auf das Sichvergewissern im pro und contra, sie lassen sich nicht vorschnell für eine Seite vereinnahmen, sie wollen, wie es Kant ausgedrückt hat, "sich ihres eigenen Verstandes ohne die Leitung eines anderen bedienen", von ihm "öffentlich Gebrauch machen". Auch dieser Ihnen beiden eigenen aufklärerischen Unabhängigkeit im Urteilen, zu der entsprechender Mut gehört, wie Kant wußte und Hannah Arendt nicht nur in der Eichmann-Kontroverse erfahren hat, gilt die heutige Ehrung.
Nach den Freiheitsrevolutionen von 1989 wissen wir endgültig, daß das rund einhundert Jahre dauernde Streben nach Verwirklichung der Geschichte und darin einbeschlossener objektiver Gesetze im Öffentlichen auf einem tiefen Vorurteil der Moderne über die Politik beruht. Wer allerdings nun glaubt, in der Politik handele es sich jetzt um nichts anderes als um Fragen der Herrschaft, um Interessenskämpfe, um die Verwaltung von Sachangelegenheiten, der hat sich ebenfalls getäuscht. Politik hat vielmehr, darauf hat Hannah Arendt immer nachdrücklich aufmerksam gemacht, zu tun mit dem Zusammen- und Miteinandersein von Menschen, die sich in der Sorge um die gemeinsamen Belange öffentlich besprechen und handeln. Politik entsteht also zwischen Menschen, konstituiert zuallererst einen Raum, in dem Menschen auftreten, die im kommunikativen Miteinander den "menschlichen Angelegenheiten eine ihnen sonst gar nicht zukommende Dauerhaftigkeit verleihen" (H.A.). Im Mittelpunkt des Politischen steht deshalb nicht der Kampf um den größten Anteil am wirtschaftlichen Ertrag, der Sachzwang der Experten oder der Bürokratien, wie man es heute in den Medien immer wieder vermittelt bekommt, auch nicht, wie es in der aristotelischen Tradition bestimmt wird, der von Natur aus politische Mensch, sondern die Sorge um die Welt, die die Menschen miteinander immer wieder neu bauen und die dadurch diese hält. Es war die Erfahrung mit den Diktaturen unseres Jahrhunderts, die aufzeigte, was an Menschenverachtung und Menschenvernichtung passiert, wenn die Welt brüchig und der Raum des Politischen der Gewalt geopfert wird. Die Ideologien der Apartheid, des Nationalsozialismus, des marxistisch-leninistischen Kommunismus, haben auf unterschiedliche Weise zweierlei Sorten von Menschen unterschieden und dadurch eine gemeinschaftliche Sorge um die Welt unmöglich gemacht. Die Zertrümmerung des Politischen hatte Kommunikationslosigkeit zur Folge, Freund-Feind-Einteilungen, Terror und Folter bis hin zur absoluten Weltlosigkeit der Konzentrationslager, in denen Menschenvernichtung zur alltäglichen Praxis wurde. Diese Grunderfahrungen mit der Zerstörung des politischen Raumes im 20. Jahrhundert waren es, die, wenn auch auf unterschiedliche Weise, das Leben von Herrn Duve wie Herrn Gauck prägten. Die Sorge um die Welt, die Sicherung des Raumes der Politik und die freie Kommunikation, welche das Handeln miteinander und damit Freiheit selbst ermöglicht, hat beide nicht mehr losgelassen. Sie hat ihr Engagement unter den unterschiedlichen Bedingungen der Demokratie und der Diktatur bestimmt, ihr Eintreten für Menschenrechte, für das freie Wort, für einen Umgang mit der Geschichte des eigenen Volkes, der im Rückblick auf obrigkeitsstaatliches Verhalten und geducktes Mitläufertum zu einem um so leidenschaftlicheren Einsatz für den Erhalt des politischen Raumes führt, in dem allein politische Freiheit unter den Bedingungen der Pluralität und damit der aufrechte Gang möglich ist.
Von Dürer gibt es einen berühmten Kupferstich, in dem eine Sensation zu seinen Lebzeiten dargestellt ist: Ein Kind mit einem Rumpf, aus dem zwei Oberkörper mit Köpfen wachsen. Dieses Bild könnte eine Allegorie Deutschlands in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sein. Der gemeinsame Staat, die gemeinsame Herkunft - und zugleich die vierzigjährige Trennung, die bis heute und wohl auch noch weit in die Zukunft wirkende unterschiedliche objektive Bedingungen und stark differente persönliche Erfahrungen, Prägungen wie subjektive Empfindungen zur Folge hatte. Die Sorge um das gemeinsame Deutschland, aber aus dem Erfahrungshintergrund unterschiedlicher Lebensverläufe in Demokratie und Diktatur, ist das, was die Auszuzeichnenden trennt und doch von uns als zusammengehörig betrachtet werden muß.
Freimut Duve war ein Kämpfer für die "sanfte Republik", er hat sich engagiert in den Auseinandersetzungen der westdeutschen Gesellschaft. Dabei hat er als streitbarer Journalist, Buchautor, Herausgeber und als Abgeordneter im Deutschen Bundestag nicht nur in den öffentlichen Auseinandersetzungen Stellung bezogen. Seine Positionen waren zunehmend von den Erfahrungen geprägt, die er in den politischen Auseinandersetzungen machte. Oberstes Gebot war die Einhaltung der zivilen Normen menschlichen Zusammenleben, die nicht nur die Polaritäten des Denkens und der Macht mit all den schwierigen Folgen überwindet, sondern auch zu aus Verantwortung geborener Einmischung führt, wo andere eher Halt machen. Sein Eintreten gegen den "Völkermord" im zerfallenen Jugoslawien ist dafür ein Beispiel.
Joachim Gauck ist durch seine Geburt auf die andere Seite Deutschlands geraten. Für ihn ist die Erfahrung der totalitären Diktatur von SED und Stasi lebensprägend gewesen. Als Pfarrer hat er zu tun gehabt mit den Folgen der Zerstörung des Politischen, die Menschen und ihre Lebenswege kaputt machten und Seelen schwer beschädigten. Aber er hat in der Freiheitsrevolution, bei der er zu den Gründern des Neuen Forums in Rostock gehörte, erfahren, daß aus Ohnmacht Macht im Sinne Hannah Arendts werden kann. Daß Demokratie ein kostbares Gut ist und durch tagtägliche Zivilcourage gesichert werden muß, ist für ihn eine Lebensmaxime geworden, die zugleich diejenige unserer Bürgerschaft von Ost- und Westdeutschen zusammen sein sollte. Gegenüber der "Furcht vor der Freiheit" (Fromm) und der traditionellen "Lust an der Ohnmacht" ist er für eine breite Teilnahme an der politischen Gestaltung eingetreten. Es ist diese Haltung, die ihn mahnen läßt, nicht einer "billigen, flachen Vergessensbereitschaft" und einer entsprechenden Schlußstrichmentalität anheimzufallen, sondern die Diktatur in ihrer menschenverachtenden Repression freizulegen. Denn eine in der Offenlegung des Verhalten in einer Diktatur sich gründende öffentliche Debatte um Schuld und Verstrickung löst zwar immer wieder Irritationen und Unruhe aus, bricht aber letztlich das öffentliche Beschweigen von Schuld auf, ermöglicht dadurch die politische Rehabilitierung der Opfer und ist die Voraussetzung für die Versöhnung, die allein in der freiheitlichen Demokratie geschehen kann.
Herr Duve wie Herr Gauck sind übrigens nicht aus einer bewußten frühzeitigen Entscheidung in die Politik gegangen, wie man es bei dem von Max Weber diagnostizierten "Berufspolitiker" heute so häufig findet. Es waren biographische Zufälle im Kontext der Zeitereignisse, die sie zur Politik hinführten - Erfahrungen der Apartheid in Südafrika und des Kolonialismus in Algerien bei Herrn Duve, die SED-Diktatur und dann die Freiheitsrevolution bei Herrn Gauck. Die Verletzungen der Würde des Menschen, dessen Erniedrigung und die Destruktion eines freiheitlichen, politischen Raumes - dieses waren letztlich die Ausgangspunkte des öffentlichen Engagements. Auch Hannah Arendt ist ja erst politisch geworden, als die nationalsozialistische Diktatur eine unpolitische Haltung existentiell unmöglich machte. Von daher finden wir, daß sich bei beiden das heutige Engagement im Öffentlichen in dem Ethos der "Liebe zur Welt" (Hannah Arendt) gründet, weil diese Welt die Zivilität menschlichen Zusammenlebens garantiert. Aus dieser Haltung heraus wenden sich beide gegen das Denken in verordnete Kategorien, gegen die so häufige Zuordnung in Rechts und Links, die sich nicht den Erfahrungen des Gegenüber zuwendet, den Gehalt guter Gedanken vorschnell verliert und Gefahr läuft, in der Zuspitzung zum Freund oder Feind letztlich den Menschen selbst preiszugeben. Beide sind geprägt durch die Sorge um die Grundlagen der politischen Gemeinschaft. Beide umtreibt die Frage einer bürgerlichen Republik, nämlich ob es gelingt, die Bindungskraft des Verfassungspatriotismus zu stärken und die zivile Ordnung, die sich in der Einhaltung der Regeln ausdrückt, im alltäglichen streitigen Miteinander des Öffentlichen zu wahren. Gerade weil demokratische Zivilität sich nicht verordnen läßt, sondern als Lebenskultur wie als Bürgerkultur wachsen muß, haben sich beide immer wieder in die politischen Belange eingemischt. Sie haben die Verantwortung des Intellektuellen auf sich genommen, die in der permanenten Förderung von Dialog und kommunikativ hergestellter Urteilsbildung im öffentlichen Raum besteht. Es sind die tausend kleinen Aufbrüche des Alltags, die bei beiden daraus resultieren und die zu dem großen Aufbruch der Vision des Hoffnungsprojekts einer zivilen Gesellschaft in Deutschland, in Europa, letztlich im Weltmaßstab, führen. Hannah Arendt hat dieses die Fähigkeit zur Natalität, zum Neuanfang genannt. Bei aller realistischen, ja auch skeptischen Einschätzung dessen, zu was die Menschen im Privaten wie im Öffentlichen fähig sind, resultiert aus diesem Neu-anfangen-können die optimistische Haltung, die dauerhaft auf die Vernunft und die Freiheit der Bürger setzt.
Ein Wort Bert Brechts aufgreifend hat Hannah Arendt von den 'Menschen in finsteren Zeiten' gesprochen, die ihr Denken und ihre Haltungen angesichts der Krise der Moderne, vor allem der Zerstörung des Raumes des Politischen und damit der Freiheit, in den Katastrophen und den moralischen Verwüstungen unseres Jahrhunderts, nicht aufgaben. Nun, unsere Gegenwart ist nicht mehr so finster, so dunkel wie die Zeit, die Hannah Arendt vor Augen stand. Aber sie ist immer noch in einem solchen Dämmerlicht, daß sie Personen wie diejenigen, die wir heute auszeichnen, braucht, die mit ihren Neuanfängen und ihrer unabhängigen Urteilskraft Helle in das Öffentliche bringen und damit die Gegenwart menschlicher machen
Dem Verein, der Freimut Duve und mir den diesjährigen Hannah-Arendt-Preis verleiht, gilt mein Dank für diese Auszeichnung, die mich von Herzen freut. Daß ich auch überrascht bin, mit einem Preis ausgezeichnet zu werden, der politisches Denken würdigt, will ich nicht verhehlen. Ich empfinde mich durchaus als Pragmatiker auf dem Feld des Politischen und gehöre keineswegs zu den Personen, die durch denkerische Leistungen anderen Menschen politische Wege gewiesen hätten. Beschämt muß ich rückschauend feststellen, daß ich allzu oft erst unmittelbar in einem politischen Problem, einer Herausforderung oder einer Notlage steckend, geradezu verspätet denkend und analysierend nach den Gründen für das Eingezwängtsein in den jeweiligen Situationen gesucht habe. In den unguten Politikzeiten des 'real existierenden Sozialismus' genügte oft ein schnelles In-Augenschein-nehmen der Umwelt oder eben einfach die bessere Moral, die die Unterdrückten gegenüber den Unterdrückern ins Feld führen können, um eine ausreichende Widerständigkeit zu erzeugen.
Wenn ich heute zurückschaue, bewegt mich eigentlich weniger die Qualität meiner politischen Einsichten von einst, sondern es bewegen mich vielmehr meine Irrtümer oder meine Ungenauigkeiten, die weißen Flecken innerhalb des eigenen politischen Weltbildes. Nicht, daß ich mir Feigheit vorwerfen müßte - doch aber eine Teilhabe an der in Ost wie in West verbreiteten Technik des Schönguckens der Verhältnisse. Mit vielen anderen nahm ich die Wirklichkeit zwar wahr, aber eben mit unterschiedlichen Formen von Selektion, in verträglicher Dosierung. Meine persönliche Wahrnehmungsweise reichte durchaus aus, um oppositionell zu werden. Es gab ein Gefühl für die richtige Haltung, die wir, insbesondere in der evangelischen Kirche und dort insbesondere in der Jugendarbeit hatten (die Beziehung zur Botschaft der Bibel und der Kontakt zu lebendigen Menschen war hilfreich), aber später, als wir 1989 aufstanden und uns 1990 befreit hatten, spürte ich, daß ein Agieren in der Politik, sei es in Kampf, Protest, Revolution oder in Neuaufbau der demokratischen Gesellschaft, einer größeren Kompetenz als der einer emotionalen oder auf Symptomkritik basierenden Antihaltung bedurfte. Ich hätte gern zu meinem guten Wollen auch ein gutes politisches Wissen gehabt. Ich hätte gern früher Hannah Arendt gelesen! In ihrem Buch 'Über die Revolution' sagt sie
„Denn wenn es wahr ist, daß alles Denken mit Andenken anhebt - dem andenkenden Nachhängen eines Wirklichen -‚ so ist nicht weniger wahr, daß kein Andenken gesichert sein kann, das nicht durch den Prozeß begrifflicher Klärung und Verdichtung gegangen ist, aufgrund deren es weiterwirken und sich entfalten kann.“
Hier ist sie, die Stufe, die mir bewußt wird, wenn ich zurückschaue, die Selbstbeschränkung, die Zurückhaltung, der 'blinde Fleck' - oder ist es einfach die Angst vor einem Erkennen, daß mich in einer Weise ergreift, daß es mich überführt, indem es mir das je aktuelle Manko meiner intellektuellen oder politischen Existenz aufweist. Jedenfalls hatte ich Hannah Arendt nicht gelesen, als ich sie gelesen haben sollte. Ich hatte also zwar eine Sehnsucht nach Freiheit, die kräftig war und gelegentlich sogar andere ansteckte - notwendig wäre aber auch ein Begriff von Freiheit gewesen, gerade wenn man in einem politischen System der Unfreiheit lebte. Daß Freiheit eben nicht nur ein Traum, sondern politisch real Grundlage jeder Gesellschaft sei, daß und wie Gerechtigkeit nicht nur ein Prinzip, sondern in der politischen Emanzipation des Einzelnen und in der ihm möglichen Partizipation konkret erfahrbar sein müsse - die Fakten des Politischen also zu erkennen und zu benennen - dies erschien mir oftmals weniger wichtig.
Man könnte es auch so sagen: In den Zeiten der Diktatur war die moralische Sicherheit allzu vieler Oppositioneller so groß, daß jene 'begriffliche Klärung und Verdichtung', von der Hannah Arendt sprach, als verzichtbar erschien. Verdichtete Emotionen und überlegene Moral der Unterdrückten können außerordentlich bewegend und 'erhebend' wirken - es kann auch eine politisch relevante Dynamik entstehen. Gleichwohl kann aber derartiges politische Romantik bleiben. Und anders etwa, als in unserem Nachbarland Polen, wo der 'romantische' Protest der Herzen und der Moral sehr früh eine Verbindung mit der intellektuellen Analyse einging, also auch das 'verführte Denken' erkannt und zusammen mit der deformierten Gesellschaft delegitimiert werden konnte, gab es in Deutschland Ost wie West ein Defizit an kognitiver Kompetenz gegenüber dem Realsozialismus. Hier wie dort wollte man außerdem keineswegs ein Antikommunist sein. Das war zwar ehrenwert, solange damit ein unaufgeklärter konservativer Antikommunismus abgewiesen wurde. Aber wenn die Rezeption der politischen Wirklichkeit des Ostens zunehmend zahmer, verständnisvoller, ja manchmal geradezu verstehenssüchtig wurde, so ist eben nicht nur ein moralisches, sondern auch ein intellektuelles Defizit die Folge. Derartige Defizite wenigstens rückschauend zu besichtigen, ist ein Gebot der politischen Vernunft - ein aufklärerisches Muß des politischen Denkens. Ich selber werde mich dabei befragen, ob ich nicht Möglichkeiten genug gehabt hätte, zur begrifflichen Klärung vorzudringen bzw. welchen Gewinn ich davon hatte, weitgehend in einem romantischen Protest zu bleiben. Meine linksprotestantischen und meist sozialdemokratischen Freunde im Westen sind zu fragen, ob nicht je länger je mehr ein 'Schöngucken' der Politikwelt des Ostens zu konstatieren sei. In der Nach-68er-Ära überlagerte eben die Wahrnehmung der Defizite der eigenen 'kapitalistischen' Politikwelt die Fähigkeit und den Willen, den Kommunismus im Kern wahrzunehmen und zu delegitimieren. Allzu vielen erschien es zunehmend reizvoll, im Osten eine gesellschaftliche 'Alternative' zu erkennen, die trotz mancher Fehler den Vorteil hatte, antikapitalistisch (und antifaschistisch) zu sein. In diesen Kreisen im Westen hatte man sowohl zunehmend die bruta facta der kommunistischen Politik als auch den sicheren Antikommunismus der westdeutschen Nachkriegs-SPD aus dem Wahrnehmungsfeld verdrängt. Je sicherer man nach '68 in einem oft rituellen Antifaschismus wurde, desto unmöglicher erschien ein 'Anti' gegenüber dem Kommunismus. Sogar in der wissenschaftlichen Analyse westlicher Forscher begegnet uns diese defizitäre Wahrnehmung. Wenn in großen politikwissenschaftlichen Arbeiten zur DDR stärker deren Selbstverständnis und die Ideologie als die massive real existierende Unterdrückung reflektiert und dabei ein in seiner Größenordnung historisch neuer Repressionsapparat wie das Ministerium für Staatssicherheit nicht oder kaum wahrgenommen wurde, dann soll das heute nicht vergessen, sondern aufgearbeitet werden. Und wenn eine der großen Gestalten der deutschen Nachkriegspolitik wie Egon Bahr trotz einer großen und öffnenden Politikidee - 'Wandel durch Annäherung' - und deren Erfolg im Helsinki-Prozeß in der späteren Phase des Kommunismus immer noch ausschließlich auf die störungsfreie Kommunikation mit den Mächtigen setzt, ganz gleich ob deren Uhren abgelaufen sind oder nicht, so haben wir das heute kritisch zu hinterfragen. Wir bemerken, daß progressive Haltungen und moderne Politikansätze relativ schnell altern können, und daß - wie in diesem Beispiel - ein öffnendes Politikelement ein oder zwei Jahrzehnte später in der Gefahr steht, Appeasement oder Affirmation des ungut Bestehenden zu sein.
Wie schön, daß es Minderheiten gab - Freimut Duve gehörte dazu -‚ die einen anderen Weg gingen. Deren Kommunikationsschwerpunkt waren die Unterdrückten. Es waren deren Politikerfahrungen und Leiden, es waren deren Negationen des Bestehenden und Visionen des Kommenden, die ihn stärker überzeugten und bewegten, als die der regierenden Verlautbarungsartisten. Warum all das Erinnern? Weil selektives Erinnern genau so schädlich ist, wie die selektive Wahrnehmung des Gegenwärtigen. Wehe, wir verschließen uns der Irrtumsgeschichte der Intellektuellen und der Politiker. Wir wären dazu verurteilt, die gleichen Fehler, dieselbe Romantik zu wiederholen. Derartiges Erinnern ist im Sinne Hannah Arendts. Das Entdecken und Besetzen des politischen Raumes ist bei ihr elementar verbunden mit der Besichtigung der Irrtümer der Individuen wie der Systeme. Übrigens wegen ihrer Diagnosen und Prognosen bezüglich der Demokratie, wegen der Bedrohtheit und Nicht-Sicherheit der demokratischen Systeme, setzt sie auf die Erinnerungsfähigkeit und -genauigkeit. Nicht ein rachsüchtiges Nachtreten ist der Grund für die entschlossene Aufarbeitung der Diktaturen. Vielmehr reagiert der so Agierende auf den 'Verlust der Wirklichkeit' und die 'Zerstörung der Politik', die das Ergebnis totalitärer Herrschaft sind. Unsere Erinnerungsfähigkeit, unsere Lernfähigkeit, auch unsere emotionale Ausstattung können zusammengenommen die Trümmerfelder der Gesellschaft und der beschädigten Individuen in Lebensräume der offenen Gesellschaft verwandeln. Aber es wäre zu wenig, würden wir uns bei der entschlossenen Aufarbeitung nur auf Hannah Arendt berufen. Es gibt einen wichtigeren Grund: Es ist das Schicksal der Unterdrückten der totalitären und autoritären Systeme, das wir als Anrufung wahrnehmen. Sie, die Toten der Stalin-Diktatur wie die Deformierten oder Gebrochenen der 'modernen Diktaturen' a la Honecker verpflichten uns zur wirklichen Wahrnehmung des einst nur partiell rezipierten. Ihre Leiden und die jahrzehntelange Zurückverwandlung des Bürgers in den Untertan benennen wir. Wir tun dies erkennend und wo erforderlich auch richtend.
Mit Hochmut oder Rachsucht hat diese Haltung nichts zu tun, vielmehr mit einer Geneigtheit des Herzens zu den Erniedrigten und Beleidigten der Diktaturen. Und mit einer intellektuellen und politischen Hoffnung, Irrtümern entrinnen zu können. Wir wissen, Demokratie ist menschenmöglich. Deshalb delegitimieren wir, was sich selber nie hat legitimieren können und dennoch so massiv in die Menschen- und Politikgeschichte hat einwirken können. Wenn ich heute neben Freimut Duve diese schöne Auszeichnung erhalte, so spüre ich, daß nicht nur mein Verständnis für und mein Handeln in der Politik, sondern auch ein Anliegen der ostdeutschen Demokratiebewegung anerkannt wird.
Ich freue mich darüber und danke Ihnen.
1997 erhielten Joachim Gauck und Freimut Duve den Hannah Arendt Preis für politisches Denken. Die Preisjury würdigte Joachim Gaucks dafür, „dass er die Aufregung um das Erbe der furchtbaren Stasi-Macht auf eine rationale Ebene gebracht hat und verhindert hat, dass die Vergangenheit, wie nach 1945, erst einmal aufs Eis gelegt wurde. Durch seine öffentlichen Auftritte hat Joachim Gauck einen gemeinsamen Platz des Erinnerns eröffnet, ohne den eine Republik nicht bestehen kann.“ Anlässlich der Wahl von Joachim Gauck zum Bundespräsidenten dokumentieren wir hier noch einmal die Rede der damaligen Laudatorin und Präsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Rita Süssmuth und die Dankesworte von Joachim Gauck.
Wir sind heute hier zusammengekommen, um mit Herrn Duve und Herrn Gauck zwei Personen zu ehren, die in der Haltung des aufrechten Gangs unabhängiges Denken und Handeln gelebt haben und damit zu öffentlichen Mahnern an diejenigen Grundsätze des Politischen geworden sind, auf die wir uns berufen, die aber im Alltäglichen immer in der Gefahr stehen unterzugehen. Mit ihrer vielfältigen Lebenserfahrung und daraus resultierenden unabhängigen Urteilskraft, die immer die Entwicklung in Deutschland mitreflektierte, stehen beide in den griechischen und römischen Traditionslinien einer republikanischen Haltung, die Hannah Arendt für unser heutiges Politikverständnis so fruchtbar gemacht hat.
Im Gegensatz zur Würde, die einem allein aus dem Menschsein selbst erwächst, bedarf die Ehre den Bezug der anderen, die diese dem Betreffenden zusprechen. Hannah Arendt selbst hat darauf hingewiesen, daß eine diesen Zuspruch kennzeichnende Laudatio eigentlich nur das bestätigen kann, was alle längst wissen, und zwar deswegen, weil es - wie hier heute abend - um Personen geht, die in der Öffentlichkeit stehen, also von jedermann gesehen werden. Aber gerade daran knüpft die heutige Ehrung an. Sie ist ein von anderen Bürgern erwiesenes Zeichen der Anerkennung und der Achtung, eine öffentliche Verdeutlichung Ihrer beider Ansehen und des Rufes, den Sie in der Bürgerschaft unserer Bundesrepublik erworben haben. Die Ehrung, die Sie heute erfahren, bezieht sich im Sinne Hannah Arendts auf Sie als ganze Person und nicht nur auf einzelne Worte oder Taten, und zwar deshalb, weil sie als Person mit der Ihnen jeweils eigenen Individualität das "Wagnis der Öffentlichkeit" auf sich genommen haben. Wagnis heißt, sich die eigene Meinung in Zustimmung und Ablehnung zurechnen zu lassen und dafür als ganze Person geradezustehen. Beide Preisträger haben mit dem, was sie sagten, ja nicht nur Zuspruch, sondern auch viel Ablehnung, darunter auch verletzende Bemerkungen ertragen müssen. Jeder, der sich in der Politik bewegt, weiß, wie schwierig es ist, in seinem Denken wie in seinen Entscheidungen sich nicht hinter jemand anderem, hinter einer Partei oder einer Organisation, zu verstecken, sondern eigene innere und äußere Standfestigkeit auch gegen Widerstände zu beweisen - und das heißt: ständig in der Bewährung zu stehen. Sich im Öffentlichen, in der Pluralität der Blicke der anderen zu bewegen, ist deshalb auch riskierte Freiheit. Sie wird nur durch das aufgewogen, was man Ihnen beiden zugleich auch anmerkt: Es ist die eigentümliche und ursprüngliche "Lust" - die auch Hannah Arendt auffiel - in der Öffentlichkeit als Person zu erscheinen und am öffentlichen Leben, am öffentlichen Diskurs aktiv teilzunehmen. Das Offenbar-Werden der eigenen Person - Hannah Arendt spricht von der Enthüllung des "wer einer ist" im öffentlichen Raum - kann aber dann auch zu der Haltung gelebter Humanität führen als dem "gültig Personenhaften, das einem Menschen, der es gewonnen hat, nie wieder verläßt" (Hannah Arendt). Dieses "Gültig Personenhafte", das wir an Ihnen beiden wahrnehmen, ist nicht zuletzt dem geschuldet, was dem berühmten Lessingschen Selbstdenken entspricht und Kant die "erweiterte Denkungsart" nannte. Es ist die Fähigkeit, sich in die Position des Gegenübers hineinzuversetzen und von daher verstehen zu suchen, bevor man sich die eigene Meinung, das eigene Urteil bildet. Auch diese für die Funktionsfähigkeit unseres Gemeinwesens so wichtige und zugleich doch so seltene Haltung ist etwas, was wir bei den Preisträgern immer wieder erleben und die es deshalb herauszuheben gilt. Diese Ehrung bezieht sich deswegen auch darauf, daß Sie beide im Öffentlichen mehr als andere dazu beigetragen haben, daß die zu verhandelnden Angelegenheiten klarer wurden. Hannah Arendt hat dieses, ein Wort von Karl Jaspers aufgreifend, die "Helle des Öffentlichen" genannt.
Hell wurde es, als Menschen 1989 Kerzen in das Fenster zum Zeichen des Widerstands und der Hoffnung stellten, und auch dann, als Menschen im wiedervereinigten Deutschland gegenüber rassistisch und ausländerfeindlich motivierter Gewalt Lichterketten bildeten. Es waren notwendige, symbolische Handlungen. Aber vor dem schnellen 'Verlöschen' kann diese Helle nur dann bewahrt werden, wenn sie sich zu Haltungen aufgrund von Einsichten und Prüfungen verdichten. Hell wird es deswegen vor allem da, wo nicht allein die Emotionalität des Augenblicks, erst recht nicht blinde Irrationalität oder vorurteilsgeprägte Meinungen vorherrschen, sondern wo kommunikative Vernunft waltet. Dazu gehört das, was heute nicht sehr oft anzutreffen ist: Sich in eigenständiger Weise kundig zu machen, den Dingen auf den Grund zu gehen, sie zu durchdenken, Maßstäbe heranzuziehen, sich mit anderen zu beraten, um auf diese Weise als Bürger an den öffentlichen Auseinandersetzung in gebotener Mündigkeit teilnehmen zu können. Es ist diese kommunikative Vernunft und die daraus erwachsende Urteilskraft, die die Preisträger auszeichnet. Beide sind Personen des öffentlichen Vernunftgebrauchs. Wir hören auf sie, weil sie uns etwas zu sagen haben, wir können sie achten, weil wir in ihren Urteilen ihre eigene ehrliche Auseinandersetzung vor dem Hintergrund ihrer nicht immer leichten Lebenserfahrungen spüren, und wir können sie anerkennen, weil sie, auf der ihnen individuell eigenen Weise, mit Leidenschaft am öffentlichen Leben teilnehmen und dabei doch die Geschicke von uns Deutschen im Auge haben. Bei beiden ist ein Nachdenken, eine Mobilisierung des Geistes zu spüren, der nicht im Glasperlenspiel verbleibt, sondern alltagspraktisch wird. Und das ist viel in einer Zeit, die sich an den Verlust tiefgründigen Denkens und daran gebildeter Urteile immer mehr gewöhnt, in der schubladenartige Einordnungen wie in das Rechts-Links-Schema dominieren anstelle des argumentativen Prüfens, in der häufig mediale Präsenz und die Orientierung am 'Skandalon' die politische, inhaltsbezogene Auseinandersetzungen zu ersetzen scheinen, in der oft die Parolen und das Plakative des Vordergründigen für das Ganze genommen wird. Demgegenüber beharren beide Preisträger auf Vernunft und auf das Sichvergewissern im pro und contra, sie lassen sich nicht vorschnell für eine Seite vereinnahmen, sie wollen, wie es Kant ausgedrückt hat, "sich ihres eigenen Verstandes ohne die Leitung eines anderen bedienen", von ihm "öffentlich Gebrauch machen". Auch dieser Ihnen beiden eigenen aufklärerischen Unabhängigkeit im Urteilen, zu der entsprechender Mut gehört, wie Kant wußte und Hannah Arendt nicht nur in der Eichmann-Kontroverse erfahren hat, gilt die heutige Ehrung.
Nach den Freiheitsrevolutionen von 1989 wissen wir endgültig, daß das rund einhundert Jahre dauernde Streben nach Verwirklichung der Geschichte und darin einbeschlossener objektiver Gesetze im Öffentlichen auf einem tiefen Vorurteil der Moderne über die Politik beruht. Wer allerdings nun glaubt, in der Politik handele es sich jetzt um nichts anderes als um Fragen der Herrschaft, um Interessenskämpfe, um die Verwaltung von Sachangelegenheiten, der hat sich ebenfalls getäuscht. Politik hat vielmehr, darauf hat Hannah Arendt immer nachdrücklich aufmerksam gemacht, zu tun mit dem Zusammen- und Miteinandersein von Menschen, die sich in der Sorge um die gemeinsamen Belange öffentlich besprechen und handeln. Politik entsteht also zwischen Menschen, konstituiert zuallererst einen Raum, in dem Menschen auftreten, die im kommunikativen Miteinander den "menschlichen Angelegenheiten eine ihnen sonst gar nicht zukommende Dauerhaftigkeit verleihen" (H.A.). Im Mittelpunkt des Politischen steht deshalb nicht der Kampf um den größten Anteil am wirtschaftlichen Ertrag, der Sachzwang der Experten oder der Bürokratien, wie man es heute in den Medien immer wieder vermittelt bekommt, auch nicht, wie es in der aristotelischen Tradition bestimmt wird, der von Natur aus politische Mensch, sondern die Sorge um die Welt, die die Menschen miteinander immer wieder neu bauen und die dadurch diese hält. Es war die Erfahrung mit den Diktaturen unseres Jahrhunderts, die aufzeigte, was an Menschenverachtung und Menschenvernichtung passiert, wenn die Welt brüchig und der Raum des Politischen der Gewalt geopfert wird. Die Ideologien der Apartheid, des Nationalsozialismus, des marxistisch-leninistischen Kommunismus, haben auf unterschiedliche Weise zweierlei Sorten von Menschen unterschieden und dadurch eine gemeinschaftliche Sorge um die Welt unmöglich gemacht. Die Zertrümmerung des Politischen hatte Kommunikationslosigkeit zur Folge, Freund-Feind-Einteilungen, Terror und Folter bis hin zur absoluten Weltlosigkeit der Konzentrationslager, in denen Menschenvernichtung zur alltäglichen Praxis wurde. Diese Grunderfahrungen mit der Zerstörung des politischen Raumes im 20. Jahrhundert waren es, die, wenn auch auf unterschiedliche Weise, das Leben von Herrn Duve wie Herrn Gauck prägten. Die Sorge um die Welt, die Sicherung des Raumes der Politik und die freie Kommunikation, welche das Handeln miteinander und damit Freiheit selbst ermöglicht, hat beide nicht mehr losgelassen. Sie hat ihr Engagement unter den unterschiedlichen Bedingungen der Demokratie und der Diktatur bestimmt, ihr Eintreten für Menschenrechte, für das freie Wort, für einen Umgang mit der Geschichte des eigenen Volkes, der im Rückblick auf obrigkeitsstaatliches Verhalten und geducktes Mitläufertum zu einem um so leidenschaftlicheren Einsatz für den Erhalt des politischen Raumes führt, in dem allein politische Freiheit unter den Bedingungen der Pluralität und damit der aufrechte Gang möglich ist.
Von Dürer gibt es einen berühmten Kupferstich, in dem eine Sensation zu seinen Lebzeiten dargestellt ist: Ein Kind mit einem Rumpf, aus dem zwei Oberkörper mit Köpfen wachsen. Dieses Bild könnte eine Allegorie Deutschlands in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sein. Der gemeinsame Staat, die gemeinsame Herkunft - und zugleich die vierzigjährige Trennung, die bis heute und wohl auch noch weit in die Zukunft wirkende unterschiedliche objektive Bedingungen und stark differente persönliche Erfahrungen, Prägungen wie subjektive Empfindungen zur Folge hatte. Die Sorge um das gemeinsame Deutschland, aber aus dem Erfahrungshintergrund unterschiedlicher Lebensverläufe in Demokratie und Diktatur, ist das, was die Auszuzeichnenden trennt und doch von uns als zusammengehörig betrachtet werden muß.
Freimut Duve war ein Kämpfer für die "sanfte Republik", er hat sich engagiert in den Auseinandersetzungen der westdeutschen Gesellschaft. Dabei hat er als streitbarer Journalist, Buchautor, Herausgeber und als Abgeordneter im Deutschen Bundestag nicht nur in den öffentlichen Auseinandersetzungen Stellung bezogen. Seine Positionen waren zunehmend von den Erfahrungen geprägt, die er in den politischen Auseinandersetzungen machte. Oberstes Gebot war die Einhaltung der zivilen Normen menschlichen Zusammenleben, die nicht nur die Polaritäten des Denkens und der Macht mit all den schwierigen Folgen überwindet, sondern auch zu aus Verantwortung geborener Einmischung führt, wo andere eher Halt machen. Sein Eintreten gegen den "Völkermord" im zerfallenen Jugoslawien ist dafür ein Beispiel.
Joachim Gauck ist durch seine Geburt auf die andere Seite Deutschlands geraten. Für ihn ist die Erfahrung der totalitären Diktatur von SED und Stasi lebensprägend gewesen. Als Pfarrer hat er zu tun gehabt mit den Folgen der Zerstörung des Politischen, die Menschen und ihre Lebenswege kaputt machten und Seelen schwer beschädigten. Aber er hat in der Freiheitsrevolution, bei der er zu den Gründern des Neuen Forums in Rostock gehörte, erfahren, daß aus Ohnmacht Macht im Sinne Hannah Arendts werden kann. Daß Demokratie ein kostbares Gut ist und durch tagtägliche Zivilcourage gesichert werden muß, ist für ihn eine Lebensmaxime geworden, die zugleich diejenige unserer Bürgerschaft von Ost- und Westdeutschen zusammen sein sollte. Gegenüber der "Furcht vor der Freiheit" (Fromm) und der traditionellen "Lust an der Ohnmacht" ist er für eine breite Teilnahme an der politischen Gestaltung eingetreten. Es ist diese Haltung, die ihn mahnen läßt, nicht einer "billigen, flachen Vergessensbereitschaft" und einer entsprechenden Schlußstrichmentalität anheimzufallen, sondern die Diktatur in ihrer menschenverachtenden Repression freizulegen. Denn eine in der Offenlegung des Verhalten in einer Diktatur sich gründende öffentliche Debatte um Schuld und Verstrickung löst zwar immer wieder Irritationen und Unruhe aus, bricht aber letztlich das öffentliche Beschweigen von Schuld auf, ermöglicht dadurch die politische Rehabilitierung der Opfer und ist die Voraussetzung für die Versöhnung, die allein in der freiheitlichen Demokratie geschehen kann.
Herr Duve wie Herr Gauck sind übrigens nicht aus einer bewußten frühzeitigen Entscheidung in die Politik gegangen, wie man es bei dem von Max Weber diagnostizierten "Berufspolitiker" heute so häufig findet. Es waren biographische Zufälle im Kontext der Zeitereignisse, die sie zur Politik hinführten - Erfahrungen der Apartheid in Südafrika und des Kolonialismus in Algerien bei Herrn Duve, die SED-Diktatur und dann die Freiheitsrevolution bei Herrn Gauck. Die Verletzungen der Würde des Menschen, dessen Erniedrigung und die Destruktion eines freiheitlichen, politischen Raumes - dieses waren letztlich die Ausgangspunkte des öffentlichen Engagements. Auch Hannah Arendt ist ja erst politisch geworden, als die nationalsozialistische Diktatur eine unpolitische Haltung existentiell unmöglich machte. Von daher finden wir, daß sich bei beiden das heutige Engagement im Öffentlichen in dem Ethos der "Liebe zur Welt" (Hannah Arendt) gründet, weil diese Welt die Zivilität menschlichen Zusammenlebens garantiert. Aus dieser Haltung heraus wenden sich beide gegen das Denken in verordnete Kategorien, gegen die so häufige Zuordnung in Rechts und Links, die sich nicht den Erfahrungen des Gegenüber zuwendet, den Gehalt guter Gedanken vorschnell verliert und Gefahr läuft, in der Zuspitzung zum Freund oder Feind letztlich den Menschen selbst preiszugeben. Beide sind geprägt durch die Sorge um die Grundlagen der politischen Gemeinschaft. Beide umtreibt die Frage einer bürgerlichen Republik, nämlich ob es gelingt, die Bindungskraft des Verfassungspatriotismus zu stärken und die zivile Ordnung, die sich in der Einhaltung der Regeln ausdrückt, im alltäglichen streitigen Miteinander des Öffentlichen zu wahren. Gerade weil demokratische Zivilität sich nicht verordnen läßt, sondern als Lebenskultur wie als Bürgerkultur wachsen muß, haben sich beide immer wieder in die politischen Belange eingemischt. Sie haben die Verantwortung des Intellektuellen auf sich genommen, die in der permanenten Förderung von Dialog und kommunikativ hergestellter Urteilsbildung im öffentlichen Raum besteht. Es sind die tausend kleinen Aufbrüche des Alltags, die bei beiden daraus resultieren und die zu dem großen Aufbruch der Vision des Hoffnungsprojekts einer zivilen Gesellschaft in Deutschland, in Europa, letztlich im Weltmaßstab, führen. Hannah Arendt hat dieses die Fähigkeit zur Natalität, zum Neuanfang genannt. Bei aller realistischen, ja auch skeptischen Einschätzung dessen, zu was die Menschen im Privaten wie im Öffentlichen fähig sind, resultiert aus diesem Neu-anfangen-können die optimistische Haltung, die dauerhaft auf die Vernunft und die Freiheit der Bürger setzt.
Ein Wort Bert Brechts aufgreifend hat Hannah Arendt von den 'Menschen in finsteren Zeiten' gesprochen, die ihr Denken und ihre Haltungen angesichts der Krise der Moderne, vor allem der Zerstörung des Raumes des Politischen und damit der Freiheit, in den Katastrophen und den moralischen Verwüstungen unseres Jahrhunderts, nicht aufgaben. Nun, unsere Gegenwart ist nicht mehr so finster, so dunkel wie die Zeit, die Hannah Arendt vor Augen stand. Aber sie ist immer noch in einem solchen Dämmerlicht, daß sie Personen wie diejenigen, die wir heute auszeichnen, braucht, die mit ihren Neuanfängen und ihrer unabhängigen Urteilskraft Helle in das Öffentliche bringen und damit die Gegenwart menschlicher machen
Dem Verein, der Freimut Duve und mir den diesjährigen Hannah-Arendt-Preis verleiht, gilt mein Dank für diese Auszeichnung, die mich von Herzen freut. Daß ich auch überrascht bin, mit einem Preis ausgezeichnet zu werden, der politisches Denken würdigt, will ich nicht verhehlen. Ich empfinde mich durchaus als Pragmatiker auf dem Feld des Politischen und gehöre keineswegs zu den Personen, die durch denkerische Leistungen anderen Menschen politische Wege gewiesen hätten. Beschämt muß ich rückschauend feststellen, daß ich allzu oft erst unmittelbar in einem politischen Problem, einer Herausforderung oder einer Notlage steckend, geradezu verspätet denkend und analysierend nach den Gründen für das Eingezwängtsein in den jeweiligen Situationen gesucht habe. In den unguten Politikzeiten des 'real existierenden Sozialismus' genügte oft ein schnelles In-Augenschein-nehmen der Umwelt oder eben einfach die bessere Moral, die die Unterdrückten gegenüber den Unterdrückern ins Feld führen können, um eine ausreichende Widerständigkeit zu erzeugen.
Wenn ich heute zurückschaue, bewegt mich eigentlich weniger die Qualität meiner politischen Einsichten von einst, sondern es bewegen mich vielmehr meine Irrtümer oder meine Ungenauigkeiten, die weißen Flecken innerhalb des eigenen politischen Weltbildes. Nicht, daß ich mir Feigheit vorwerfen müßte - doch aber eine Teilhabe an der in Ost wie in West verbreiteten Technik des Schönguckens der Verhältnisse. Mit vielen anderen nahm ich die Wirklichkeit zwar wahr, aber eben mit unterschiedlichen Formen von Selektion, in verträglicher Dosierung. Meine persönliche Wahrnehmungsweise reichte durchaus aus, um oppositionell zu werden. Es gab ein Gefühl für die richtige Haltung, die wir, insbesondere in der evangelischen Kirche und dort insbesondere in der Jugendarbeit hatten (die Beziehung zur Botschaft der Bibel und der Kontakt zu lebendigen Menschen war hilfreich), aber später, als wir 1989 aufstanden und uns 1990 befreit hatten, spürte ich, daß ein Agieren in der Politik, sei es in Kampf, Protest, Revolution oder in Neuaufbau der demokratischen Gesellschaft, einer größeren Kompetenz als der einer emotionalen oder auf Symptomkritik basierenden Antihaltung bedurfte. Ich hätte gern zu meinem guten Wollen auch ein gutes politisches Wissen gehabt. Ich hätte gern früher Hannah Arendt gelesen! In ihrem Buch 'Über die Revolution' sagt sie
„Denn wenn es wahr ist, daß alles Denken mit Andenken anhebt - dem andenkenden Nachhängen eines Wirklichen -‚ so ist nicht weniger wahr, daß kein Andenken gesichert sein kann, das nicht durch den Prozeß begrifflicher Klärung und Verdichtung gegangen ist, aufgrund deren es weiterwirken und sich entfalten kann.“
Hier ist sie, die Stufe, die mir bewußt wird, wenn ich zurückschaue, die Selbstbeschränkung, die Zurückhaltung, der 'blinde Fleck' - oder ist es einfach die Angst vor einem Erkennen, daß mich in einer Weise ergreift, daß es mich überführt, indem es mir das je aktuelle Manko meiner intellektuellen oder politischen Existenz aufweist. Jedenfalls hatte ich Hannah Arendt nicht gelesen, als ich sie gelesen haben sollte. Ich hatte also zwar eine Sehnsucht nach Freiheit, die kräftig war und gelegentlich sogar andere ansteckte - notwendig wäre aber auch ein Begriff von Freiheit gewesen, gerade wenn man in einem politischen System der Unfreiheit lebte. Daß Freiheit eben nicht nur ein Traum, sondern politisch real Grundlage jeder Gesellschaft sei, daß und wie Gerechtigkeit nicht nur ein Prinzip, sondern in der politischen Emanzipation des Einzelnen und in der ihm möglichen Partizipation konkret erfahrbar sein müsse - die Fakten des Politischen also zu erkennen und zu benennen - dies erschien mir oftmals weniger wichtig.
Man könnte es auch so sagen: In den Zeiten der Diktatur war die moralische Sicherheit allzu vieler Oppositioneller so groß, daß jene 'begriffliche Klärung und Verdichtung', von der Hannah Arendt sprach, als verzichtbar erschien. Verdichtete Emotionen und überlegene Moral der Unterdrückten können außerordentlich bewegend und 'erhebend' wirken - es kann auch eine politisch relevante Dynamik entstehen. Gleichwohl kann aber derartiges politische Romantik bleiben. Und anders etwa, als in unserem Nachbarland Polen, wo der 'romantische' Protest der Herzen und der Moral sehr früh eine Verbindung mit der intellektuellen Analyse einging, also auch das 'verführte Denken' erkannt und zusammen mit der deformierten Gesellschaft delegitimiert werden konnte, gab es in Deutschland Ost wie West ein Defizit an kognitiver Kompetenz gegenüber dem Realsozialismus. Hier wie dort wollte man außerdem keineswegs ein Antikommunist sein. Das war zwar ehrenwert, solange damit ein unaufgeklärter konservativer Antikommunismus abgewiesen wurde. Aber wenn die Rezeption der politischen Wirklichkeit des Ostens zunehmend zahmer, verständnisvoller, ja manchmal geradezu verstehenssüchtig wurde, so ist eben nicht nur ein moralisches, sondern auch ein intellektuelles Defizit die Folge. Derartige Defizite wenigstens rückschauend zu besichtigen, ist ein Gebot der politischen Vernunft - ein aufklärerisches Muß des politischen Denkens. Ich selber werde mich dabei befragen, ob ich nicht Möglichkeiten genug gehabt hätte, zur begrifflichen Klärung vorzudringen bzw. welchen Gewinn ich davon hatte, weitgehend in einem romantischen Protest zu bleiben. Meine linksprotestantischen und meist sozialdemokratischen Freunde im Westen sind zu fragen, ob nicht je länger je mehr ein 'Schöngucken' der Politikwelt des Ostens zu konstatieren sei. In der Nach-68er-Ära überlagerte eben die Wahrnehmung der Defizite der eigenen 'kapitalistischen' Politikwelt die Fähigkeit und den Willen, den Kommunismus im Kern wahrzunehmen und zu delegitimieren. Allzu vielen erschien es zunehmend reizvoll, im Osten eine gesellschaftliche 'Alternative' zu erkennen, die trotz mancher Fehler den Vorteil hatte, antikapitalistisch (und antifaschistisch) zu sein. In diesen Kreisen im Westen hatte man sowohl zunehmend die bruta facta der kommunistischen Politik als auch den sicheren Antikommunismus der westdeutschen Nachkriegs-SPD aus dem Wahrnehmungsfeld verdrängt. Je sicherer man nach '68 in einem oft rituellen Antifaschismus wurde, desto unmöglicher erschien ein 'Anti' gegenüber dem Kommunismus. Sogar in der wissenschaftlichen Analyse westlicher Forscher begegnet uns diese defizitäre Wahrnehmung. Wenn in großen politikwissenschaftlichen Arbeiten zur DDR stärker deren Selbstverständnis und die Ideologie als die massive real existierende Unterdrückung reflektiert und dabei ein in seiner Größenordnung historisch neuer Repressionsapparat wie das Ministerium für Staatssicherheit nicht oder kaum wahrgenommen wurde, dann soll das heute nicht vergessen, sondern aufgearbeitet werden. Und wenn eine der großen Gestalten der deutschen Nachkriegspolitik wie Egon Bahr trotz einer großen und öffnenden Politikidee - 'Wandel durch Annäherung' - und deren Erfolg im Helsinki-Prozeß in der späteren Phase des Kommunismus immer noch ausschließlich auf die störungsfreie Kommunikation mit den Mächtigen setzt, ganz gleich ob deren Uhren abgelaufen sind oder nicht, so haben wir das heute kritisch zu hinterfragen. Wir bemerken, daß progressive Haltungen und moderne Politikansätze relativ schnell altern können, und daß - wie in diesem Beispiel - ein öffnendes Politikelement ein oder zwei Jahrzehnte später in der Gefahr steht, Appeasement oder Affirmation des ungut Bestehenden zu sein.
Wie schön, daß es Minderheiten gab - Freimut Duve gehörte dazu -‚ die einen anderen Weg gingen. Deren Kommunikationsschwerpunkt waren die Unterdrückten. Es waren deren Politikerfahrungen und Leiden, es waren deren Negationen des Bestehenden und Visionen des Kommenden, die ihn stärker überzeugten und bewegten, als die der regierenden Verlautbarungsartisten. Warum all das Erinnern? Weil selektives Erinnern genau so schädlich ist, wie die selektive Wahrnehmung des Gegenwärtigen. Wehe, wir verschließen uns der Irrtumsgeschichte der Intellektuellen und der Politiker. Wir wären dazu verurteilt, die gleichen Fehler, dieselbe Romantik zu wiederholen. Derartiges Erinnern ist im Sinne Hannah Arendts. Das Entdecken und Besetzen des politischen Raumes ist bei ihr elementar verbunden mit der Besichtigung der Irrtümer der Individuen wie der Systeme. Übrigens wegen ihrer Diagnosen und Prognosen bezüglich der Demokratie, wegen der Bedrohtheit und Nicht-Sicherheit der demokratischen Systeme, setzt sie auf die Erinnerungsfähigkeit und -genauigkeit. Nicht ein rachsüchtiges Nachtreten ist der Grund für die entschlossene Aufarbeitung der Diktaturen. Vielmehr reagiert der so Agierende auf den 'Verlust der Wirklichkeit' und die 'Zerstörung der Politik', die das Ergebnis totalitärer Herrschaft sind. Unsere Erinnerungsfähigkeit, unsere Lernfähigkeit, auch unsere emotionale Ausstattung können zusammengenommen die Trümmerfelder der Gesellschaft und der beschädigten Individuen in Lebensräume der offenen Gesellschaft verwandeln. Aber es wäre zu wenig, würden wir uns bei der entschlossenen Aufarbeitung nur auf Hannah Arendt berufen. Es gibt einen wichtigeren Grund: Es ist das Schicksal der Unterdrückten der totalitären und autoritären Systeme, das wir als Anrufung wahrnehmen. Sie, die Toten der Stalin-Diktatur wie die Deformierten oder Gebrochenen der 'modernen Diktaturen' a la Honecker verpflichten uns zur wirklichen Wahrnehmung des einst nur partiell rezipierten. Ihre Leiden und die jahrzehntelange Zurückverwandlung des Bürgers in den Untertan benennen wir. Wir tun dies erkennend und wo erforderlich auch richtend.
Mit Hochmut oder Rachsucht hat diese Haltung nichts zu tun, vielmehr mit einer Geneigtheit des Herzens zu den Erniedrigten und Beleidigten der Diktaturen. Und mit einer intellektuellen und politischen Hoffnung, Irrtümern entrinnen zu können. Wir wissen, Demokratie ist menschenmöglich. Deshalb delegitimieren wir, was sich selber nie hat legitimieren können und dennoch so massiv in die Menschen- und Politikgeschichte hat einwirken können. Wenn ich heute neben Freimut Duve diese schöne Auszeichnung erhalte, so spüre ich, daß nicht nur mein Verständnis für und mein Handeln in der Politik, sondern auch ein Anliegen der ostdeutschen Demokratiebewegung anerkannt wird.
Ich freue mich darüber und danke Ihnen.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz