
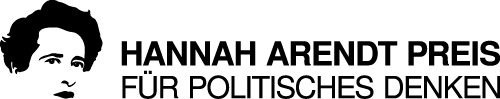

Vaira Vike-Freiberga, Psychologin und von 1999 –2007 lettische Staatspräsidentin

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Einleitung zu Vortrag und Podiumsdiskussion
m Namen des Vorstandes und der Jury des Hannah-Arendt- Preises begrüße ich Sie herzlich zur Auftaktveranstaltung der Vergabe des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«, der heute Abend an die Staatspräsidentin der Republik Lettland, Frau Professor Vike-Freiberga, vergeben wird. Es gehört zu der guten Tradition unseres Preises, die Preisträger nicht nur in wohlfeinen Worten festlich zu ehren, sondern sie selber ins öffentliche Licht zu stellen und sprechen zu lassen. Liebe und Freundschaft, so Hannah Arendt, gedeihen im Verborgenen, aber die »Entbergung« der eigenen Person, um es mit einem Terminus von Martin Heidegger auszudrücken, kann nur im öffentlichen Raum stattfinden. Nur in der Öffentlichkeit tritt die differentia specifica des Menschseins ins Bewusstsein. »Sprechen und Handeln«, so Hannah Arendt, sind die Tätigkeiten, in denen sich die Einzigartigkeit jedes Menschen darstellt. Es ist uns deshalb eine besondere Freude, dass Frau Vike-Freiberga in dem folgenden Festvortrag auf ihr Verhältnis zur Politik, auf die geschichtlichen Erfahrungen ihres Landes im 20. Jahrhundert und auf die Probleme einer gemeinsamen europäischen Identität eingehen wird.
Lassen Sie mich mit einigen einstimmenden Anmerkungen beginnen. Robert Schuman, einer der Begründer der Idee des vereinigten Europa, sagte 1963: »Wir müssen das geeinte Europa nicht nur im Interesse der freien Völker errichten, sondern auch, um die Völker Osteuropas in diese Gemeinschaft aufnehmen zu können, wenn sie, von den Zwängen, unter denen sie leiden, befreit, um ihren Beitritt und unsere moralische Unterstützung nachsuchen werden. Wir schulden ihnen das Vorbild des einigen, brüderlichen Europa. Jeder Schritt, den wir auf diesem Wege zurücklegen, wird für sie eine neue Chance darstellen. Sie brauchen unsere Hilfe bei der Umstellung, die sie zu bewerkstelligen haben. Unsere Pflicht ist es, bereit zu sein.« Bis diese programmatische Deklamation mit der Aufnahme der ostmitteleuropäischen Staaten in die EU Wirklichkeit wurde, vergingen bekanntlich noch 41 Jahre. Erst die Freiheitsrevolutionen von 1989/1990 schufen die Voraussetzungen, um eine Kongruenz zwischen dem von Schuman formulierten Versprechen und der von den Dissidenten Ostmitteleuropas verfolgten Vision einer »Rückkehr nach Europa« herzustellen. In der Forderung der Dissidenten nach einer »Rückkehr nach Europa« klang die feste und tiefe Überzeugung an, dass die ostmitteleuropäischen Länder genuiner Teil der europäischen Kulturgeschichte sind und ihr Platz selbstverständlich in einer erweiterten Europäischen Union sein wird. Die EU symbolisierte vom Osten aus gesehen Freiheit, Wohlstand und eine Vorstellung vom besseren Leben. Der Anschluss an den Westen, an eine europäische Identität, versprach von Warschau bis Sofia, von Prag bis Kiew individuelle Rechte, Freizügigkeit und freie Entfaltung. Geht man von der bereits vollzogenen Osterweiterung der EU aus, ist dieser Wunsch formal in Erfüllung gegangen. Die Länder Ostmitteleuropas sind jetzt Teil des gemeinsamen Wirtschaftsraums in Europa, die Kulturbeziehungen haben sich in viele Richtungen erweitert und intensiviert, der Wissenschaftsaustausch ist ein wichtiges Element der vielfältigen Verbindungen geworden. Dazu gehört wie selbstverständlich, dass zum Beispiel zwei lettische Studentinnen aus Riga an dieser Veranstaltung teilnehmen. Sie verbringen im Rahmen des europäischen Studierendenaustausches ein Semester an der Universität Bremen, so wie umgekehrt Studierende der Universität Bremen in Riga studieren. Bremen legt nicht zuletzt im Rahmen der langjährigen Städtepartnerschaft mit Riga großen Wert darauf, dass diese vielfältigen Projekte und Verbindungen gepflegt und ausgebaut werden. So positiv diese Bilanz ist, so muss man auf der anderen Seite doch feststellen, dass es um die symbolische Integration Ostmitteleuropas in das gemeinsame europäische Haus nicht gut bestellt ist. Es gibt zwischen Ost- und Westeuropa eine erstaunliche Asymmetrie in den Vorstellungen von einem gemeinsamen Europa. Während in Westeuropa die EU-Institutionen immer mehr zum Fokus öffentlicher Diskurse über Europa geworden sind, wird in vielen Ländern Ostmitteleuropas Europa auch als ein gemeinsamer öffentlicher Kulturraum verstanden, in dem es um den wechselseitigen Austausch von Ideen und Erfahrungen geht. »Europa«, so der polnische Philosoph Krzysztof Michalski, »das ist nicht nur ein politisches Gebilde, das ist eine Kultur von Institutionen, Ideen, Erwartungen, Gewohnheiten und Gefühlen, Stimmungen, Gerüchen, Erinnerungen und Aussichten – eine Kultur, auf deren Boden erst ein politisches Gebilde wachsen kann. Der eiserne Zaun, der mitten durch diese Kultur ging und sie zerschnitt, ist entfernt worden, das ist wahr – aber ob die auf beiden Seiten so verschiedenen Institutionen und Ideen wirklich zusammenwachsen und eine ausreichende, zuverlässige Grundlage für eine längerfristige politische Integration bereitstellen, das bleibt eine offene Frage.« Tatsächlich tun sich viele immer noch schwer damit, die Erfahrungen der Osteuropäer zu einem Bestandteil des gemeinsamen Erbes Europas zu machen. Ein solcher Schritt würde zum Beispiel voraussetzen, dass sich die Westeuropäer jenseits von Lippenbekenntnissen für die totalitären Erfahrungen der Ostmitteleuropäer wirklich interessieren. Zum Glück gibt es öffentliche Repräsentanten, die diesen Erfahrungen eine Stimme geben können. Frau Vike-Freiberga, die in ihrer eigenen Lebensgeschichte tief geprägt ist von der doppelten Diktaturerfahrung der ostmitteleuropäischen Länder, ist eine solche Stimme, die auch in Westeuropa noch stärker zum Klingen gebracht werden muss. Dazu möchten wir ihr jetzt die Gelegenheit geben.
Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel war der israelische Botschafter hier im Rathaus. Eine der Aussagen von Shimon Stein war: Die Shoah, die Vernichtung der Juden, gehört zur Identität Deutschlands wie Israels. Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang ein paar Worte zu den unsäglichen Äußerungen des iranischen Staatspräsidenten Mahmud Ahmadinedschad. Er bezeichnet den Holocaust als »Märchen« und fordert die Tilgung Israels von der Landkarte. Mit den Plänen zur atomaren Aufrüstung sind die Reden dieses Präsidenten gegen die Existenz des israelischen Staates eine akute Friedensgefährdung. Allein schon auf Grund unserer Geschichte und besonderen Verantwortung gegenüber Israel ist hier eine eindeutige Haltung der Bundesrepublik geboten. Wir können keine normalen Beziehungen mit einem Staat unterhalten, dessen Präsident den Genozid an den Juden leugnet und Israel vernichten will. Die Forderung, alle Menschen sollten ihr Denken und Handeln so einrichten, »dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe«, gehört zu den moralischen Grundfesten der Bundesrepublik. Ich bin sehr froh, dass im politischen und kulturellen Leben unserer Stadt das Erinnern fest verankert ist. Und gerade weil wir es immer wieder neu begründen müssen, bleibt es lebendig. Es gibt nicht nur ein kaltes Vergessen. Es gibt auch ein kaltes Erinnern. Niemand wusste das besser als Hannah Arendt. Von August 1949 bis März 1950 besuchte sie zum ersten Mal seit ihrer Flucht 1933 Deutschland. Sie schreibt danach: »In weniger als sechs Jahren zerstörte Deutschland das moralische Gefüge der westlichen Welt, und zwar durch Verbrechen, die niemand für möglich gehalten hätte. … Überall fällt einem auf, dass es keine Reaktion auf das Geschehene gibt. … Die Gleichgültigkeit, mit der die Deutschen sich durch die Trümmer bewegen, findet ihre genaue Entsprechung darin, dass niemand um die Toten trauert.« Hannah Arendt verkörpert das deutschjüdische Erbe, das uns anvertraut ist. Und zugleich steht sie mit ihrem Denken, wie viele der jüdischen Überlebenden, für die Folgerungen, die aus dem Zivilisationsbruch zwischen 1933 und 1945 zu ziehen sind. Schon von daher gehört die Verleihung des Hannah-ArendtPreises, die heute zum zehnten Mal stattfindet, auch zur bremischen Erinnerungskultur.
Die deutsche Jüdin Hannah Arendt hat überlebt. Nach der Vertreibung aus Deutschland wusste sie, dass sie Außenseiterin bleiben wird, dass sie in ihrem Anderssein nicht akzeptiert wird. Unsere heutige Preisträgerin, Frau Präsidentin Vike-Freiberga, musste auch als Kind die Heimat verlassen. Sie kennt die Erfahrung des Anders-Seins und des Exils. Und sie hat mit Hannah Arendt noch etwas gemeinsam: Sie ist wahrhaftig, offen, radikal demokratisch, historisch bewusst und immer auf der Suche nach Werten und Prinzipien, auf die sich eine menschenfreundliche Gesellschaft und dann auch ein menschenfreundliches Europa gründen muss. Ich kann die Jury nur beglückwünschen zu dieser Wahl. Frau Präsidentin Vike-Freiberga ist eine beeindruckende Preisträgerin. Marianne Birthler wird uns das gleich ausführlicher darlegen. In ihrem Buch Menschen in finsteren Zeiten zitiert Hannah Arendt die von ihr hoch geschätzte Rosa Luxemburg: »Die einzige Rettung« liegt »in der Schule des öffentlichen Lebens ... in der unumschränktesten, breitesten Demokratie und öffentlichen Meinungsäußerung.« »Die einzige Rettung liegt in der Schule des öffentlichen Lebens« – dieser Gedanke durchzieht Hannah Arendts gesamtes politisches Denken. Was Demokratie in diesem Sinne auszeichnet, ist für Hannah Arendt die Möglichkeit, dass die Menschen zu Bürgerinnen und Bürgern werden, dass sie sich an der Gestaltung der Welt beteiligen, dass sie handelnd und sprechend in ihr tätig sein können. Das Schlimmste dagegen, was einer Gesellschaft passieren kann, ist für Hannah Arendt das Verschwinden der Politik. Sie hat immer befürchtet, dass mehr und mehr Menschen in den Ländern der westlichen Welt »Freiheit von Politik« als eine der Grundfreiheiten begreifen, von dieser Freiheit Gebrauch machen und sich von der Welt und den Verpflichtungen in ihr zurückziehen. Sie weiß, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Politik als etwas erleben, das sie im Grunde nichts angeht und auf das sie keinen Einfluss haben, dass sich dann diese Menschen von der Politik und auch von der Demokratie abwenden. Aus Politikverdrossenheit kann schnell Demokratieverdrossenheit werden. Deshalb müssen wir Bürgermut fördern statt Konformismus, Dissidenten statt Mitläufer. Nur dann ermöglichen wir die »Schule des öffentlichen Lebens«, die »unumschränkteste, breiteste Demokratie und öffentliche Meinungsäußerung«. Bei der Dramatik der gesellschaftlichen Veränderungen und den Risiken, die daraus erwachsen, braucht die demokratische Gesellschaft die Talente und Fähigkeiten von allen ihren Mitgliedern. Je mehr Menschen ihrer Verantwortung zum Handeln, zum Tätigsein in der Welt gerecht werden, desto eher wird es gelingen, um Hannah Arendt noch einmal zu zitieren, »aus der Finsternis der Kreatur in die Helle des Menschlichen zu gelangen«. Sehr verehrte Frau Präsidentin Vike-Freiberga! Sie versuchen alles zu tun, um den Menschen Ihres Landes und Europas Wege zu zeigen, die in die »Helle des Menschlichen« führen. Ich möchte Ihnen noch einmal danken und Sie beglückwünschen als Preisträgerin des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«.
Die Auswahl der diesjährigen Preisträgerin wirft unvermeidlich die Frage nach Europa auf, seiner Vergangenheit und seiner Zukunft. Denn es war die Rückkehr der baltischen Staaten in das politische Europa, die den wundersamen Weg der Emigrantin Vike-Freiberga zur lettischen Präsidentin ermöglicht hat. Die Erweiterung der Europäischen Union um zehn neue Mitglieder wurde allerorts als historischer Brückenschlag gefeiert, der die aufgezwungene Spaltung Europas beendete. Aber mit diesem großen Sprung nach vorn wuchsen auch die inneren Unterschiede in der Union, und mit ihnen die internen Spannungen – nicht nur mit Blick auf die Verteilungskämpfe, wie sie dieser Tage im Gezerre um den Haushalt deutlich werden. Die mittelosteuropäischen Staaten haben in vieler Hinsicht auch eine andere geschichtliche Erfahrung und andere politische Orientierungen in die Gemeinschaft mitgebracht. Die Spaltung der Europäischen Union angesichts des Irak-Kriegs war eine erste Demonstration dieser Unterschiede, sehr zum Ärger nicht nur von Monsieur Chirac, der sich über die Unbotmäßigkeit der Neulinge echauffierte. Eine zweite Erfahrung der Ungleichzeitigkeit konnten wir zum 60. Jahrestag der Kapitulation Hitlerdeutschlands machen. Zwischen West- und Osteuropa gibt es eine Asymmetrie der öffentlichen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und sein Ende. Während bei uns die Singularität der nationalsozialistischen Verbrechen betont und der 8. Mai 1945 seit der durchschlagenden Rede Richard von Weizsäckers als »Tag der Befreiung« interpretiert wird, ist die politische Erinnerung in Mittelosteuropa durch die Doppelerfahrung von nationalsozialistischer und stalinistischer Herrschaft geprägt. Sie, Frau Präsidentin, haben diese Ambivalenz in einer Erklärung vom Januar 2005 präzise formuliert, und zwar ohne jede Spur einer Relativierung der nationalsozialistischen Untaten. Sie haben auch an die »lokalen Verbündeten« erinnert, die bei der Ausrottung der Juden in Lettland mit Hand anlegten und sich der faschistischen Besatzungsmacht anschlossen. Gleichzeitig haben Sie ausgesprochen, dass der Zusammenbruch des Deutschen Reichs »nicht zur Befreiung meines Landes geführt hat. Vielmehr wurden die baltischen Staaten einer erneuten brutalen Besatzung durch ein anderes totalitäres Regime, der Sowjetunion, unterworfen.« Sie nehmen damit den Totalitarismus-Begriff von Hannah Arendt auf, der von weiten Teilen der politischen und wissenschaftlichen Öffentlichkeit des Westens als eine Art theoretische Fortsetzung des Kalten Krieges verworfen worden war. Das galt vor allem für die Linke. Erst spät hat sich bei uns eine andere, explizit antitotalitäre Linke herauskristallisiert, die sich mit den antikommunistischen Freiheitsbestrebungen in Mittelosteuropa solidarisierte. Mit der doppelten Diktaturerfahrung der mittelosteuropäischen Länder ist auch ein geschärfter Sinn für eine Politik des Appeasements verbunden, die vor totalitären Gefahren die Augen verschließt. Das Münchner Abkommen von 1938, mit dem die Westmächte versuchten, dem Krieg mit Hitler aus dem Weg zu gehen, ist in Zentral- und Osteuropa sehr viel stärker präsent als bei uns – ebenso wie das Abkommen von Jalta, mit dem die westlichen Demokratien der Sowjetunion die Herrschaft über halb Europa zubilligten. Die andere historische Perspektive führt auch zu anderen außen- und sicherheitspolitischen Optionen. Man muss vermutlich auf diese Ungleichzeitigkeit historisch-politischer Erfahrungen zurückgehen, um das Votum Lettlands oder Polens für den Irak-Krieg und die Allianz mit den USA zu verstehen, auch wenn die Geschichte kein hinreichender Ratgeber für aktuelle politische Entscheidungen ist. Aber ohne Bewusstsein für die spezifischen Erfahrungen der mittelosteuropäischen Länder, die erst 1989/90 wieder als souveräne Nationen auf die Bühne der europäischen Politik zurückkehrten, wird sich keine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik entwickeln lassen. Das wird am Beispiel der Russland-Politik überdeutlich. Die Schröder’sche »Achse Paris-BerlinMoskau« ließ in Zentraleuropa und im Baltikum alle Alarmglocken läuten. Sie, Frau Präsidentin, sind als einziges baltisches Staatsoberhaupt der Einladung zur Feier des Sieges am 9. Mai dieses Jahres nach Moskau gefolgt, als Geste des Respekts und als Angebot zur Freundschaft. Gleichzeitig haben Sie die russische Regierung aufgefordert, Worte des Bedauerns über das Unrecht zu finden, das die sowjetische Okkupation über die Völker in der östlichen Hälfte Europas gebracht hat; und Sie zögern nicht, den Rückfall in autoritäre Herrschaftsmethoden zu kritisieren, der unter Präsident Putin eingesetzt hat. Sie insistieren damit auf einer Politik der Freiheit, die nicht der kleinen Münze pragmatischer Vorteile geopfert werden darf, wenn die Gemeinschaft der Demokratien sich nicht selbst aufgeben will. Politik ist eben mehr als das Aushandeln des kleinsten gemeinsamen Nenners zwischen unterschiedlichen Interessengruppen. Auch das kann man bei Hannah Arendt lernen. Otto Kallscheuer hat Hannah Arendt mit dem folgenden ebenso anrührenden wie prophetischen Satz zitiert: »Die einzige Hoffnung«, schrieb sie am 9. Juni 1961 an Karl Jaspers, »bleibt doch eine Föderation Europa, ganz gleich, wie klein dieses Europa erst einmal ist, eine »federation for increase«, wie es der Cromwell’sche Republikaner James Harrington so schön genannt hat, an die sich andere dann später gleichberechtigt anschließen können.« Wir sollten heute, angesichts des um sich greifenden Kleinmuts in Europa, diese Vision erneuern und weiterführen. Nicht ein europäischer Superstaat ist das Ziel, in dem die politische, kulturelle und soziale Vielfalt Europas möglichst eingeebnet wird, aber auch kein Rückfall in eine erweiterte Freihandelszone. Es geht um eine europäische Föderation, die Vielfalt und gemeinsame Handlungsfähigkeit verbindet. Für diese Idee von Europa hätte die Jury keine bessere Preisträgerin finden können.
Im Namen des Vereins und der internationalen Jury des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken darf ich Sie herzlich begrüßen. Es hat einen Wachwechsel an der Spitze der Bürgerschaft und an der Spitze dieser Stadt gegeben, und ich möchte dem Bürgermeister a. D. Henning Scherf, der uns durch all die Jahre als Vertreter der senatorischen Geberseite unterstützt hat, sehr herzlich im Namen des Vorstands, der Mitglieder, der Preisträgerinnen und Preisträger und der internationalen Jury des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken« danken. Henning Scherf hat auch in Zeiten, als die Förderung auf der Kippe stand, zu dem Preis gestanden. Das Besondere an der Zusammenarbeit mit ihm war unter anderem, dass er sich durch uns oder durch den einen oder die andere Preisträgerin auch zum Widerspruch anregen ließ, den er dann spontan, unter Nichtbeachtung seines Redemanuskripts vorgebracht hat. Manchmal waren dies dann kleine Sternstunden des politischen Diskurses in diesem ehrwürdigen Saal. Unser Dank geht auch an Bürgermeister Jens Böhrnsen, der die Stafette übernommen hat. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit. An dieser Stelle möchte ich auch der Heinrich Böll-Stiftung und ihrem Repräsentanten, Ralf Fücks, als der zweiten Geberseite herzlich danken. Für die Böll-Stiftung gilt erst recht, dass sie den Preis kritisch begleitet, dessen Unabhängigkeit jedoch stets unterstrichen hat. Hauptanlass des heutigen Abends ist, wie Sie wissen, die Würdigung unserer Preisträgerin. Deshalb lassen Sie mich nur kurz ins Spiel bringen, dass wir in diesen Tagen den 30. Todestag der Namenspatronin unseres Preises würdigen sowie den 10. Jahrestag der Stiftung des Preises begehen. Sehr verehrte Frau Vike-Freiberga, für Sie birgt der heutige Abend ein kleines Risiko. Denn wir haben ja in Kontakt mit Ihren Mitarbeitern und der Botschaft immer hervorgehoben, dass wir keine staatliche Organisation sind, sondern eine freie Initiative von WissenschaftlerInnen, PublizistInnen und KünstlerInnen, denen gemeinsam ist, dass sie das politische Nach-Denken im öffentlichen Raum fördern wolle und zwar auch und gerade das Nachdenken jenseits der schon beschrittenen Pfade. Und Sie mögen sich gefragt haben, welcher Couleur die Leute seien, die vom Staat und einer Partei gefördert werden und doch darauf beharren, dass sie was Besonderes sind. Wenn ich im Folgenden die Begründung der internationalen Jury für die Vergabe des Preises an Sie, verehrte Frau Vike-Freiberga vortrage, so blicke ich weniger auf ihr Amt als Staatspräsidentin, das Sie seit Jahren sehr erfolgreich innehaben, und ein bisschen mehr auf das, wodurch Sie dieses Amt lebendig machen. Und darum ging es auch in den Diskussionen der internationalen Jury. Ein gutes Stück Leben der Preisträgerin steht für die furchtbare und selbstzerstörerische Geschichte Europas im 20. Jahrhundert: Ihre Familie floh 1944 aus Ihrer Heimat und teilte für Jahre das Schicksal jener Flüchtlinge, von denen Hannah Arendt im mittleren Teil ihres Buches über die totale Herrschaft so luzide spricht: den Flüchtlingen, den Staatenlosen, die nirgendwo zu einer politischen Gemeinschaft, deren Schutz sie genießen, dazugehören. Die Nachwirkungen dieser Geschichte beschäftigen Europa immer noch, immer wieder und seit der Befreiung Mittel- und Osteuropas von der sowjetischen Herrschaft in einem neuen Lichte. Denn Lettland wie auch die anderen Ländern Mittel- und Osteuropas kritisieren immer wieder, dass die Erinnerungskultur Westeuropas – aus manchen Gründen – einäugig ist und dass die leidvollen Erfahrungen des Ostens Europas mit zu dieser Erinnerung gehören. Sie verlangen von uns, dass wir ihre Erfahrungen der Unterdrückung durch ein totalitäres Regime anerkennen, zumal es die Hälfte dieses Landes ja mit ihnen teilt. Und dies in voller Ansehung des Umstands, dass sich die totalitäre Sowjetunion einer großen Befreiungstat rühmen kann, nämlich der Teilhabe am alliierten Sieg über das nationalsozialistische Deutschland. Die paradoxe Gleichzeitigkeit von Befreiung und Unterdrückung in dieser geschichtlichen Erbschaft hat der Westen Europas in den vergangenen Jahrzehnten gerne verdrängt. In verblüffender Nähe zur Biografie von Hannah Arendt fand die Familie von Frau Vike-Freiberga nach Jahren der intermediären Existenz eine neue Dazugehörigkeit im nordamerikanischen Raum, in Kanada. Das politische Erbe der Freiheit in Kanada und den Vereinigten Staaten bringt Frau Vike-Freiberga seit vielen Jahren in den politischen Diskurs ein. Ihr Wirken, und das hört man in jeder ihrer Reden mit, steht für eine ideelle, politische und wirtschaftliche Einheit des westlichen politischen Raums. Immer spricht sie diesen Raum an als unseren gemeinsamen Raum, in dem wir denken und handeln. Und sie benennt seine Stützpfeiler: Freiheit und Menschenwürde, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, die Minderheitenrechte, Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern. Das heißt, Frau Vike-Freiberga artikuliert in ihrem Wirken sowohl die leidvolle Geschichte Europas, deren Erinnerungen sich gegenwärtig ineinanderschieben, mitunter auch aufeinanderprallen, als auch die politische Gemeinsamkeit des Westens, sein Erbe und seine Verpflichtung. Mit ihr wird es keine Debatte über europäische Identität gegen irgendeinen Teil des Westens, und seien es die Vereinigten Staaten, geben. Sehr wohl aber könnte man mit ihr über die Konflikte, die Einbrüche, die unterschiedlichen Erfahrungen innerhalb des Westens sprechen, und das heißt auch streiten. Ein weiteres Element, das die Jury hervorhob, ist ihr Wirken beim Aufbau des neuen Europa. Frau Vike-Freibergas Wirken steht für den politischen Aufbau eines geeinten Europa, in dem die Freiheitsliebe der Länder und Staaten Mittelund Osteuropas ein wichtiges Kapital, wenn nicht politisch gegenwärtig überhaupt das wichtigste Kapital ist. Es spricht mitunter eine freiheitsbeflügelte Frische aus ihren Reden, die man sich für manchen routinierten Politiker Westeuropas wünschen würde. Schließlich hat in der Debatte der Jury folgendes Moment eine Rolle gespielt: Es ist der politische und persönliche Mut als eine Tugend, über die wir seit der Antike immer wieder in neuem Gewande und gesättigt durch neue Erfahrungen belehrt werden. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Frau Vike-Freiberga in einer von manchen von uns bewunderten Art und Weise – und die Jury hob dies besonders hervor – die Pluralität Europas zum Anlass für offene Worte nimmt. Als nur ein Beispiel spreche ich Ihr Erscheinen im Mai 2005 in Moskau zur Feier des 50. Jahrestages des sowjetischen Sieges über das nationalsozialistische Deutschland an. Frau Vike-Freiberga hat in dieser sicher nicht einfachen Situation für Lettland, für die baltischen Staaten, für ganz Mittel- und Osteuropa gesprochen als eine Stimme, die darauf besteht, dass die Siegerseite die Geschichte der Unterdrückung nicht verdecken oder gar überlagern kann. Sie hat die mehr als sechzig Jahre politische Unterdrückung des Baltikums in einer Situation eingebracht, die ganz auf die glänzende Oberfläche staatlicher Siegesfeiern getrimmt war. Und sie hat mittelbar auch die andauernde Unterdrückung in Tschetschenien angesprochen als des vergessenen Landes, das noch immer in Brutalität und Anarchie zu versinken droht. Ein anderes Beispiel wäre ihre intervenierende Rolle im lettischen Sprachenstreit. Diesen Mut zur Freiheit, diese Bereitschaft zum kritischen Streitgespräch über die pluralen Perspektiven der historischen Erfahrung und der Gegenwart braucht es in Europa, braucht es im Westen – und braucht es im Umgang mit anderen politischen Kulturen dieser Welt. Frau Präsidentin, im Namen des Vorstandes und der Jury beglückwünsche ich Sie zum diesjährigen »Hannah-ArendtPreis für politisches Denken«.
Es ist eine große Freude für mich, aus Anlass dieser Preisverleihung das Wort an Sie zu richten! Ich darf Ihnen, liebe Frau Vike-Freiberga, zu der Ihnen heute zuteil werdenden Ehrung herzlich gratulieren. Die Vorbereitung auf diesen kleinen Beitrag ist mir nahe gegangen, denn es geht dabei um ein Thema, das auch mein Leben berührt. Mit dem Ende der kommunistischen Diktaturen in Europa waren endlich auch wieder die Stimmen der mittel- und osteuropäischen Länder im vielstimmigen europäischen Chor zu hören. Die Europäische Union hat davon profitiert: Sie ist mit dem Beitritt mehrerer dieser Länder nicht nur größer, sondern auch lebendiger und reicher geworden: an Menschen, an Kultur, an Landschaft, an Geschichte und Erfahrung. Deshalb spreche ich auch lieber von der Wiedervereinigung oder der Einheit Europas als von »Beitritt« oder »Osterweiterung«, technokratischen Begriffen, die das, was gesellschaftlich, politisch und kulturell mit diesem Ereignis verbunden ist, nicht annähernd wiedergeben. Das Wort »Beitritt« erinnert mich außerdem an manche Äußerungen von 1990, dem Jahr der Deutschen Einheit. Von »Osterweiterung der Bundesrepublik« war zwar nicht die Rede, es war aber so gemeint. Mit Rührung wurde von manchem Redner das »größer gewordene Deutschland« gefeiert. Das gab uns, den Ostdeutschen, zu denken. Wo eigentlich, fragten wir uns besorgt, hatten wir denn in den Jahren zuvor gelebt? Etwa nicht in Deutschland? Mit dem »Beitritt« war auch die Erwartung verbunden, dass »die alte Bundesrepublik« im Wesentlichen das bleiben könne, was sie war, nur eben größer. Verschiebungen des westdeutschen Koordinatensystems durch ostdeutsche Einflüsse wurden und werden mit Argwohn registriert, an Illustrationen und Anekdoten zu diesem Thema mangelt es nicht. Einiges scheint mir darauf hinzudeuten, dass die Gesellschaften der neuen EU-Mitglieder ähnliche Erfahrungen mit dem »alten Europa« machen. Für mich als Ostdeutsche hatte die Wiedervereinigung Europas noch eine zusätzliche Bedeutung, ich vermute sogar, dass ich aus diesem Grunde gebeten wurde, heute die Rolle der Laudatorin zu übernehmen. Ich musste auch nicht lange überlegen um zu antworten. Was für eine wunderbare Gelegenheit, öffentlich über die Zukunft der Vergangenheit in Europa zu sprechen und darüber, wie zwei Europäerinnen aus Ländern, die sich von Bremen aus gesehen jenseits des Eisernen Vorhangs befanden, darüber denken.Wir, die aus der DDR stammenden Deutschen, waren bis zum Mai vorigen Jahres die Einzigen in der EU, die Erfahrungen mit dem Leben in einer kommunistischen Diktatur gemacht hatten. Nun aber würden wir diesbezüglich keine Exoten mehr sein. Wir würden unsere Erinnerungen und Erfahrungen mit den Gesellschaften Mittel- und Osteuropas teilen können. Und wir würden sie gemeinsam Westeuropa mitteilen können. Uns verbindet, dass die Hoffnungen auf Freiheit, die die Menschen nach dem Ende des Krieges und der Befreiung vom Nationalsozialismus hatten, bitter enttäuscht wurden: Mehr als vier Jahrzehnte sollten bis zum Ende der kommunistischen Diktaturen noch vergehen. Vier Jahrzehnte der Unfreiheit, aber auch des Widerstands gegen Diktatur und Fremdherrschaft, der Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung. Und immer wieder blutig niedergeschlagene Aufstände. Rebellion und Opposition gab es von Anfang an – die antikommunistischen Freiheitsbewegungen zwischen 1917 und 1989/91 gehören zum Besten, was die europäische Freiheitsgeschichte aufzubieten hat. Ich weiß mich mit Ihnen, Frau Präsidentin, einig in der Hoffnung, dass die Erfahrungen unserer Länder mit der kommunistischen Herrschaft vom Westen endlich wahr- und ernst genommen werden mögen. Die Ära des Kommunismus war weder eine Randerscheinung noch eine Fußnote der europäischen Geschichte. In den von Krieg und Naziherrschaft geschwächten Nationen Mittelund Osteuropas hatten vier Jahrzehnte kommunistischer Diktatur verheerende Folgen. Für die Gesellschaften, für Wirtschaft und Kultur und für zahllose Menschen, die als politische Gegner verfolgt wurden oder ihr Leben einfach nur deswegen lassen mussten, weil sie den Machthabern im Wege waren. Das europäische Gedächtnis muss diese Erfahrungen und Erinnerungen einschließen – nicht nur, weil Europa den Bürgerinnen und Bürgern dieser Länder Respekt und Anerkennung schuldet, sondern um aller Europäer willen. Ein freies und demokratisches Europa kann es sich – um der Freiheit und der Demokratie selber willen – nicht leisten, diese Erinnerungswelten abzuspalten. Stabile Demokratien existieren und funktionieren auf der Grundlage einer kollektiven Identität. Dies gilt auch für Europa. Die europäische Demokratie braucht Menschen, die sich nicht nur als Ungarn, Niederländer, Letten oder Deutsche begreifen, sondern auch als Bürgerinnen und Bürger Europas. Dies entwickelt sich langsam. Man kann es befördern, aber nicht erzeugen. Ein afrikanisches Sprichwort scheint mir dazu zu passen: Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Für die Entwicklung einer europäischen Identität sind die Aneignung europäischer Geschichte und eine allmählich entstehende gemeinsame Geschichtskultur unerlässlich. Hierbei geht es um »geronnene« Geschichte, also nicht nur um eine Ansammlung präziser Erinnerungen, sondern auch um Deutungen und Bedeutungen. Mit welchen Begrifflichkeiten ein Ereignis, eine Epoche in das kollektive Gedächtnis eingeht, sagt viel aus, weil mit jedem Begriff auch ein Deutungsangebot transportiert wird. Es ist zum Beispiel durchaus von Belang, ob im Herbst 1989 in der DDR eine demokratische Revolution stattfand oder einfach nur eine »Wende« – wie Egon Krenz es ausdrückte.
Geronnene Geschichte, das ist Geschichtskultur. Dazu gehören nicht nur die Erkenntnisse und Codierungen der Historiker, sondern auch Gedenktage und Gedenkorte; die Straßen mit den Namen der Opfer und der Helden; die kollektiven Erfahrungen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden: Erfahrungen der Not und der Befreiung, der Demütigung und der Genugtuung; die Hymnen und die Mythen – ja, und auch die Tabus. Für die Europäische Union in ihrer heutigen Gestalt ist eine solche gemeinsame Geschichts- und Erinnerungskultur erst im Entstehen. Das Unglück, das Deutschland unter der Herrschaft der Nationalsozialisten über Europa gebracht hat, ist tief in das kollektive Gedächtnis aller europäischen Völker eingebrannt. Die westeuropäische Geschichtskultur ist durch diese Katastrophen und ihre Verarbeitung geprägt. Die Integration der westeuropäischen Länder beruht nicht zuletzt darauf, dass die Demokratien Europas Deutschland die Hand zur Verständigung und Versöhnung reichten. Ohne sichtbare Zeichen dafür, dass Deutschland seine Schuld bekannte und sich glaubwürdig damit auseinander setzte, wäre dies nicht möglich gewesen. Die in der DDR aufwachsende Nachkriegsgeneration, zu der ich gehöre, hatte an dieser Entwicklung wenig Anteil. Allenfalls Minderheiten entwickelten ein alternatives Geschichtsbild. Die DDR galt als die Heimstatt der antifaschistischen Widerstandskämpfer und der Opfer. Die Nazis, hieß es, lebten im Westen. Die DDR war damit exkulpiert – und deshalb bedurfte es offiziell weder der Versöhnung mit den östlichen Nachbarn noch einer besonderen Verantwortung gegenüber den Überlebenden des Holocaust. Das zionistische Israel gehörte nach SED-Lesart zum Lager des Klassengegners, auf der anderen Seite waren unsere östlichen Nachbarn per Dekret zu Brudervölkern geworden. Versöhnung konnte es so nicht geben. Sie setzt das Eingeständnis von Schuld, das Bewusstsein von Verantwortung und die freie Entscheidung voraus. Schuld jedoch gab es nur auf Seiten des imperialistischen Klassengegners, und an Verantwortung und Freiheit mangelt es in Diktaturen. Die so genannten Brudervölker lebten unversöhnt nebeneinander her. Erst jetzt, seit ihrer Befreiung vor 16 Jahren, sind die Völker des früheren Ostblocks wirklich in der Lage, als Freie und Gleiche aufeinander zuzugehen. Erst jetzt können sie miteinander und mit den westeuropäischen Ländern in das Gespräch über ihre Vergangenheit eintreten, können über gemeinsam erfahrenes Leid sprechen und über das Leid, das sie einander zugefügt haben. Den damit verbundenen Schmerz und mögliche Missverständnisse haben wir schon kennen gelernt, wir werden ihn auch künftig in Kauf nehmen müssen. Doch billiger ist Versöhnung nicht zu haben. Es hat mich sehr berührt, Frau Präsidentin, wie selbstbewusst und nachdenklich Sie in Ihrer Erklärung zum diesjährigen Europatag Russland die Hand zur Freundschaft gereicht haben. Ihre damit verbundene Erwartung an Russland, sich zu dem Unrecht der Unterwerfung Mittel- und Osteuropas zu bekennen, ist angemessen und verdient die Unterstützung der Länder der Europäischen Union. Ich sage dies im Bewusstsein dessen, dass es im Verhältnis zu Russland zwischen uns erhebliche und begründete Unterschiede gibt. Auch in Deutschland hat die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone die kommunistische Herrschaft mit äußerst harter Hand durchgesetzt. Haftkeller und Lager füllten sich mit Menschen, die der Errichtung einer neuen Diktatur tatsächlichen oder vermeintlichen Widerstand entgegensetzten. Zehntausende starben in den sowjetischen Speziallagern, andere wurden in die russischen Lager verschleppt. Die Opfer, die zu Zeiten der DDR schweigen mussten, dürfen nun reden. Doch ehrlicher Umgang mit der Geschichte heißt für uns Deutsche, das, was in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR durch die Russen geschah, auch immer im Zusammenhang mit dem Überfall Deutschlands auf seine Nachbarn und auf die Sowjetunion sehen zu müssen. Am 10. April dieses Jahres wurde in Weimar an die Befreiung der Konzentrationslager vor 60 Jahren erinnert. Lassen Sie mich zitieren, was Jorge Semprun, ehemaliger Häftling im nahe gelegenen KZ Buchenwald, bei dieser Gelegenheit sagte: »Der kürzlich erfolgte Beitritt von zehn neuen Ländern aus Mittel- und Osteuropa – dem anderen Europa, das im sowjetischen Totalitarismus gefangen war – kann kulturell und existenziell erst dann wirksam erfolgen, wenn wir unsere Erinnerungen miteinander geteilt und vereinigt haben werden. Hoffen wir, dass bei der nächsten Gedenkfeier in zehn Jahren, 2015, die Erfahrung des Gulag in unser kollektives europäisches Gedächtnis eingegliedert worden ist. Hoffen wir, dass neben die Bücher von Primo Levi, Imre Kertész oder David Rousset auch die ›Erzählungen aus Kolyma‹ von Warlam Schalamow gerückt wurden. Das würde zum einen bedeuten, dass wir nicht länger halbseitig gelähmt wären, zum anderen aber, dass Russland einen entscheidenden Schritt auf dem Weg in die Demokratisierung getan hätte.« Wenn wir über unsere Vergangenheit reden, geht es uns in Wahrheit um die Zukunft. Zuversicht und Freude über das Geschenk der Freiheit halten sich allerdings bei nicht wenigen Ostdeutschen in Grenzen. Dieser Miss-Mut scheint mir eine Spätfolge enttäuschter Erlösungsideen zu sein. Wie gerne wären wir doch nach Jahrzehnten der Fremdbestimmung und des Mangels im gelobten Land angekommen, dort, wo Milch und Honig fließt! Doch unsere Welt ist mit dem Ende der kommunistischen Herrschaft zwar besser geworden, aber nicht gut. Es zeigt sich, dass Freiheit und Demokratie keine sicheren Besitzstände sind, sondern gepflegt und geschützt werden müssen: vor Terrorismus, vor hypertrophem Sicherheitsdenken, vor Nationalismus und vor Korruption, diesem gesellschaftlichen Krebsgeschwür, das demokratische Strukturen schwächt und insbesondere in Ländern mit ungefestigten demokratischen Traditionen verheerende Wirkungen hat. Wir haben die Freiheit gewonnen, aber wir werden sie immer wieder gewinnen müssen. »Sag, wann haben diese Leiden endlich mal ein Ende?«, heißt es in dem Biermann-Lied »Große Ermutigung«. Die Antwort des Liedes: »Wenn die neuen Leiden kommen, haben sie ein Ende.« Angesichts neuer Herausforderungen und Bedrohungen erfährt das Bemühen um eine lebendige europäische Geschichtsund Erinnerungskultur eine weitere Begründung: In der Geschichte der europäischen Freiheitsbewegungen des 20. Jahrhunderts spiegeln sich die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit ebenso wie der Mut und die Beharrlichkeit, mit der sie darum gekämpft haben. Wenn Europa in dieser Geschichte sein wertvollstes Erbe sieht, dem gegenüber wir auch künftig verpflichtet sind, müssen wir uns um die freiheitliche Grundausstattung Europas wenig Sorgen machen. – Ich freue mich, dass der heute verliehene Preis diesem Anliegen Gewicht verleiht.
Mit großer Überraschung und großer Freude habe ich von der Entscheidung erfahren, den diesjährigen Hannah-ArendtPreis für politisches Denken an mich zu vergeben. Ich fühle mich äußerst geehrt, tief gerührt und dankbar darüber. Ich glaube, es ist in einem gewissen Sinne paradox, dass ich mit einem solchen Preis ausgezeichnet werde. Hannah Arendt hat die Überzeugung vertreten, dass »der Sinn von Politik Freiheit« ist und dass diese im aktiven Handeln zu erleben ist. Ich hingegen hatte der Politik die meiste Zeit meines Lebens bewusst den Rücken zugekehrt. Ich sah in ihr keinen Sinn, keinen Spielraum und keine Hoffnung in meiner Zukunft, da meine Heimat ihre Unabhängigkeit verloren hatte und ich in meiner damaligen Wahlheimat Kanada nie die politischen Möglichkeiten eines gebürtigen Staatsbürgers genießen würde. Deswegen habe ich die meiste Zeit meines Lebens der Wissenschaft, Forschung und Lehre gewidmet. Zwar war ich von Zeit zu Zeit mit Politik, Gestaltung und Administration konfrontiert, vorwiegend jedoch »nur« mit Denken und Kontemplation beschäftigt. Durch die Wiederbefreiung meines Landes habe ich das Glück mitzuerleben, wie Freiheit in politisches Handeln umgesetzt wird, und mitzuwirken an politischen Entscheidungen, deren Folgen nachhaltig sind und die sogar über die Grenzen meines Landes hinauswirken. Während meiner frühen Kindheit in Lettland wurde meine Heimat von fremden Mächten besetzt – zuerst 1940 aus dem Osten, von der Sowjetunion, dann 1941 aus dem Westen, vom nationalsozialistischen Deutschland, und schließlich, 1944 und 1945, abermals aus dem Osten. Krieg, Invasion, brutale Okkupation und unwürdige Unterjochung waren die Gegenstände der geflüsterten Gespräche der mich umgebenden Erwachsenen, aber auch nostalgische Erinnerungen an die verlorene Unabhängigkeit Lettlands. Es konnte keine Politik geben unter der Gestapo oder unter dem KGB. Die Leute in meiner Heimat versuchten, sich so unauffällig wie nur irgend möglich zu verhalten, in der Hoffnung zu überleben, ohne als Feinde oder als Kollaborateure des jeweiligen Systems gebrandmarkt zu werden. In beiden Fällen riskierten sie ihr Leben, sei es unter dem jeweils herrschenden System oder unter dem darauf folgenden. Schockiert und ungläubig verfolgten weite Teile der Bevölkerung, wie Zehntausende friedlicher Zivilisten verhaftet, deportiert, gefoltert oder ermordet wurden, wie mehr als einhundertzwanzigtausend Männer und Jungen von beiden Okkupationsmächten an die Front geschickt wurden, um ihnen als Kanonenfutter zu dienen. Während über unseren Köpfen die Bomben fielen, sehnte ich mich nach jenen Tagen, »da die Friedensglocken läuten«, wie ich die Worte eines Psalms in Erinnerung behalten hatte, den wir in der Kirche gesungen hatten. Als der Frieden dann jedoch kam, hatte mein Heimatland seine Unabhängigkeit und meine Nation ihre Freiheit verloren, ebenso wie das übrige Mittel- und Osteuropa. Die westliche Hälfte Europas konnte ihre Befreiung von fremder Besatzung und den Niedergang der nationalsozialistischen und faschistischen Regime feiern. Der Westen konnte ein neues Kapitel aufschlagen und den Wiederaufbau beginnen. Die andere Hälfte Europas blieb in der Gefangenschaft der kommunistischen Tyrannei und wurde als Gefangener gehalten hinter dem sehr treffend so bezeichneten Eisernen Vorhang.
Politik ist ein sozialer Prozess, in dem eine Nation die Freiheit nutzt, ihre eigenen gemeinsamen Ziele zu stecken, die Freiheit, ihre eigenen gemeinsamen Entscheidungen zu treffen und die Freiheit, von den Früchten dieser Entscheidungen zu leben. Das Recht, sich aktiv am politischen Prozess zu beteiligen, muss das unveräußerliche Gut eines jeden Bürgers eines freien, unabhängigen und demokratischen Staates sein. Ist ein Land durch eine fremde Macht okkupiert oder auch nur annektiert, so ist das Volk seiner politischen Urrechte beraubt. In einem Land, das von Fremden beherrscht wird, kann es keine wahre Politik geben, sondern lediglich ihre Imitation. Für diejenigen, die aus einem solchen Land fliehen, gibt es ebenfalls keine Möglichkeit, wahre Politik zu betreiben, weil sie ihr Land nicht mehr regieren oder zumindest beeinflussen oder verändern können durch ihr Lebenswerk. So schrieb der Dichter Rainis bereits nach der Revolution von 1905 in seinem Schweizer Exil: »Land, o Land, was ist ein Land, Wenn man keine Freiheit hat; Freiheit, Freiheit, was ist Freiheit, Ist man ohne eignes Land.« Als meine Eltern mit mir ins Exil gingen, taten sie dies aus Protest gegen die militärische Okkupation durch ein fremdes Land und gegen die Erniedrigung und Verfolgung von allem, was ihnen teuer war. Sie haben der sicheren Gefahr gegenüber der Hoffnung auf Sicherheit den Vorzug gegeben, weil sie ihre Hoffnung auf Freiheit höher schätzten als die Sicherheit der Unterdrückung. Als eine Konsequenz ihrer Entscheidung habe auch ich damals meine Heimat verloren, mein Erbe und meine politischen Urrechte als gebürtige Staatsbürgerin. Die lettische Nation und ihre Nachbarn haben dies alles verloren durch die Machtkämpfe zwischen den Tyrannen und den Großen jener Zeit, aber auch durch die Abkommen, die damals – über unsere Köpfe hinweg und hinter unserem Rücken – während der Konferenzen von Teheran und Jalta getroffen wurden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben die Flüchtlinge aus Osteuropa weniger über Politik diskutiert als sie im wahrsten Sinne des Wortes gelebt. Wir waren im politischen Exil. Wir sahen unser Dasein im Westen als eine lebende Anklage gegen den Kommunismus, als lebenden Protest gegen die widerrechtliche Besatzung unseres Landes. Wir hatten die Empfindung, durch unser Handeln und unser Leben an sich ein ungemein wichtiges politisches Statement zu machen. Es hat lange Zeit gedauert, bis wir begriffen, dass niemand wirklich daran interessiert war, unsere Botschaft zur Kenntnis zu nehmen. Hannah Arendt hat über die Freiheit geschrieben, die das Exil bietet – und auch über deren sehr hohen Preis. Da ich im Exil aufwuchs, begriff ich es als die Herausforderung meines Lebens, die Vorteile dieser Freiheit zu maximieren und ihren Preis zu minimieren. Dies stand auf dem Fond zu der Einstellung meiner Eltern und meiner ersten Lehrer, die es als moralische Pflicht empfanden, unsere lettische Identität zu bewahren, unabhängig davon, ob es dort andere Letten gab, mit denen man sich hätte austauschen können, und unabhängig davon, ob wir jemals nach Lettland zurückkehren würden. Es war ein Akt des Trotzes gegenüber jenen Mächten, die danach trachteten, alles spezifisch Lettische zu vernichten. Und für meine Eltern war es auch eine Frage des persönlichen Stolzes. Das Aufgeben der eigenen Identität käme einem Eingeständnis gleich, dass sie gegenüber anderen minderwertig sei, es hätte den Verrat an den Vorvätern wie auch am ureigensten Wesen bedeutet. Die Generation meiner Eltern erzog ihre Kinder patriotisch – in dem Sinne, ihr Heimatland von ganzem Herzen zu lieben und ihr ganzes Leben dem Wohle ihrer Nation zu widmen.
Das Europa, in dem meine Generation aufwuchs, wurde weder von Vernunft noch von Recht noch von Gerechtigkeit regiert. Es gab lediglich Armeen, brutale Gewalt, willkürliche Zerstörung, und Millionen von Menschen wurden willkürlich umhergetrieben wie abgerissene Blätter im Sturm. Und schon als kleines Kind begriff ich, was diese Welt zusammenhielt: erstens Waffengewalt, zweitens die Gewalt der Angst und Einschüchterung, und drittens der Überlebensinstinkt und das Anpassungsvermögen, die ein Teil unseres biologischen Erbes sind. Wenn er gezwungen ist, passt der Mensch sich an fast alles an. Denn wenn er es nicht tut, geht er zugrunde. Ein verstörender Aspekt einer Kultur, eines Kultes der Gewalt, ist ihre Fähigkeit, Menschen zu korrumpieren. Es ist verstörend, die Genugtuung zu sehen, die sich manche Menschen dadurch verschaffen können, indem sie Macht über andere haben. Es ist dermaßen verstörend, dass wir oftmals unsere Blicke abwenden und vorgeben, es nicht zu sehen. Die Schlägertypen auf dem Schulhof haben Spaß an dem, was sie tun. Sie verschaffen sich eine tatsächliche Befriedigung und Erregung dadurch, dass sie kleinere Kinder terrorisieren und schlagen. Die Männer, die ihre Frauen schlagen, genießen es, sich zu betrinken und ihre Frustrationen durch ihre Fäuste abzureagieren, ohne sich schuldig zu fühlen, denn wenn sie wieder nüchtern sind, pflegen sie zu behaupten, sich an nichts erinnern zu können. Es ist dies etwas vollkommen anderes als die Banalität des Bösen, die Hannah Arendt in Eichmann erkannte, aber auch dies ist furchtbar genug. Überall – im Alltag, an ganz einfachen Menschen – kann man die Keime sehen, die es jemandem erlauben, sich in einen Tyrannen zu verwandeln, wenn die Umstände es zulassen und der oder die Betreffende schlau genug ist, sie auszunutzen. Es ist ein verhängnisvoller Weg, wenn die sadistische Neigung, nicht nur anderen seinen Willen aufzuzwingen, sondern andere vorsätzlich zu quälen, dermaßen berauschend wird, dass sie zu einer profanen Sucht gerät. Dann wird die Macht um ihrer selbst willen benutzt, als eine Krücke für ein armseliges und unsicheres Ego, die klaffende, gähnende Leere der Seele eines Größenwahnsinnigen. Denken Sie in diesem Kontext auch an Nero oder Caligula, nicht nur an Hitler oder Stalin. Und schließlich gibt es da den perversen Durst nach Macht, der jene packt, die von Fanatismus und eigennützigen Ideologien ergriffen sind. Dies trifft wiederum auf Hitler zu, aber auch auf Torquemada und Savonarola, auf Osama bin Laden und die terroristischen Vereinigungen der heutigen Zeit. Was ich damit sagen will, ist, dass die Tyrannei weder zu einem bestimmten Ort noch zu einer bestimmten Zeit noch zu einem bestimmten Menschen gehört. Deren Möglichkeit und Risiko liegen tief in der menschlichen Seele. Das heißt, dass die Demokratie eine ganz zarte Blume ist, die wir immer aufmerksam beschützen und pflegen müssen, sonst ist sie in Gefahr. Merkwürdig in diesem Kontext ist auch, wie viele Intellektuelle, Philosophen, Schriftsteller und Dichter die schlimmsten Tyrannen unterstützen, bewundern und verteidigen. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Glücklicherweise gibt es auch viele Menschen, die zwar Macht über andere haben, dies jedoch aufgrund der Möglichkeit schätzen, Dinge auf eine Art und Weise tun zu können, von deren Richtigkeit sie überzeugt sind. Dies ist eine zielorientierte, instrumentelle Macht, die – im Idealfall – im Dienste übergeordneter Ziele oder Werte angewandt wird. In einer demokratischen Gesellschaft wird die Macht delegiert und somit legitimiert. Zudem ist sie über die gesamte Gesellschaft verteilt, sodass nirgendwo Anhäufungen oder Defizite von Macht entstehen – und auch keine großflächigen Ausgrenzungen. Solange Hierarchien existieren, werden sie durch weitreichende horizontale Netzwerke gestützt, innerhalb derer die Menschen in ihrem eigenen Kompetenzbereich volle Verantwortung tragen – mit dem kleinstmöglichen Eingriff von oben, der erforderlich ist, um ein allgemeines Funktionieren zu gewährleisten. In totalitären Systemen wiederum ist die Macht in den Händen eines Tyrannen konzentriert. Das Erstaunliche an solchen Systemen ist die Frage, wie sie es schaffen, so mächtig zu werden und sich oftmals auch noch für sehr lange Zeit an der Spitze zu halten. Ich denke, eine der möglichen Antworten liegt darin, dass viele Tyrannen wahrhafte Genies darin sind, Macht, Privilegien und Profite exakt in der richtigen Dosierung unter ihre Anhänger zu verteilen, dass diese – jeder auf seinem eigenen Gebiet – ihr ganz persönliches Interesse daran haben, den Tyrannen an der Macht zu halten. Nero und Caligula waren überaus grausam; nur wurde der Schaden, den sie anrichteten, weitgehend neutralisiert durch legale und Verwaltungsstrukturen eines gut geölten Imperiums, die ungeachtet der Idiotie des Herrschers weiterhin funktionierten. Hitler und Stalin haben neue Maßstäbe für Tyrannei gesetzt, weil sie höchste Sorgfalt darauf verwandten, jeglichen Hort der Menschlichkeit in der Gesellschaft, der sich auch nur als die geringste Behinderung ihrer Launen und Forderungen erweisen könnte, niederzumachen. Es gibt einen Spruch, der Stalin zugesprochen wird und der seine »Politik« auf den Punkt bringt: »Ist da ein Mensch, ist da ein Problem; kein Mensch – kein Problem.« Dieser bei der Durchsetzung des Willens eines Diktators so gut funktionierende Ansatz funktioniert überhaupt nicht, wenn er auf den Diktator selber angewandt wird. Es wäre viel zu einfach zu sagen: »Ihr hattet einen Hitler, da hattet ihr ein Problem; als ihr keinen Hitler mehr hattet, war auch das Problem vom Tisch.« Es mag im Nachkriegsdeutschland so ausgesehen haben, vor allem nach der Währungsreform und der immensen Hilfe durch den Marshall-Plan. Es war jedoch nicht der Tod Hitlers, der Deutschland von Wahnsinn und Tyrannei befreite. Es war die Niederlage in dem von Deutschland selber angezettelten Krieg, es war der Niedergang der NSDAP, es waren die Nürnberger Prozesse, es waren die weltweite Verurteilung und Diskreditierung der nationalsozialistischen Ideologie, des Fundaments, auf dem das »Dritte Reich« errichtet worden war. Umgeben von Rauch und Trümmern, frierend, hungernd, obdachlos, besiegt und erniedrigt, erkannten Millionen von Deutschen ihre Verirrungen, schlugen eine neue Seite im Geschichtsbuch auf, fingen noch einmal ganz von vorne an – und machten es besser als jemals zuvor. Im Gegensatz dazu gab es in der Sowjetunion, wo man vom Sieg der Alliierten über den Nationalsozialismus wie geblendet war, nichts als Triumph und Selbstzufriedenheit – und eine Verstärkung des Würgegriffs einer blutigen Tyrannei, die Hunderte Millionen von Menschen in ihrer Gewalt hielt. Ende der Achtzigerjahre wagten es einige lettische Intellektuelle, Auszüge aus Hannah Arendts Hauptwerk The Origins of Totalitarianism zu veröffentlichen, um die lettische Nation über das Wesen des Totalitarismus philosophisch aufzuklären und sein Freiheitsbewusstsein zu befördern. Die Übersetzung wanderte in Form von Kopien von Hand zu Hand, denn die Werke Hannah Arendts ebenso wie die Werke anderer westlicher Denker wurden in der Sowjetunion weder gewürdigt noch verlegt. Ich denke, eine derart effektive, schnelle und umfassende »Volksschule« demokratischer und philosophischer Ideen, wie es sie während jener Zeit im Baltikum gab, ist eine einzigartige Erscheinung.
I ndem sie den sowjetischen Totalitarismus auf gewaltlose Weise überwanden, haben Lettland, Estland und Litauen auch einen Wertesieg errungen. Unsere Völker standen für eben jene Werte ein, die der Europäischen Union seit ihren ersten Anfängen bewusst machten, dass es sich bei ihr um eine Wertegemeinschaft handelt. Bereits im ersten europäischen Integrationsvertrag, durch den im Jahre 1951 die »Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl« gegründet wurde, bekräftigten die Mitgliedsstaaten ihre Entschlossenheit, »an die Stelle der jahrhundertealten Rivalitäten einen Zusammenschluss ihrer wesentlichen Interessen zu setzen, durch die Errichtung einer wirtschaftlichen Gemeinschaft den ersten Grundstein für eine weitere und vertiefte Gemeinschaft unter den Völkern zu legen, die lange Zeit durch blutige Auseinandersetzungen entzweit waren, und die institutionellen Grundlagen zu schaffen, die einem nunmehr allen gemeinsamen Schicksal die Richtung weisen können«. Obgleich die neue Europäische Verfassung in Frankreich und den Niederlanden abgelehnt wurde, enthält deren erster Artikel eine umfassende Referenz auf mehrere Werte, die sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU gemeinsam sind: Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Die Gesellschaften der Mitgliedsstaaten werden charakterisiert durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern. Die mit der Wertefrage aufs Engste verbundene Frage einer gemeinsamen europäischen Identität hat eine mindestens dreißigjährige Geschichte. Auf der Kopenhagener Konferenz im Dezember 1973 tauchte zum ersten Mal die Frage einer gemeinsamen europäischen Identität auf der Tagesordnung auf; die Vorstellungen von einer solchen blieben jedoch auf einem sehr allgemeinen Niveau. Erst zehn Jahre später wurden politische Handlungsvorgaben formuliert, durch deren Umsetzung eine gemeinsame europäische Identität erst herausgebildet werden kann. Dabei wurde das »Bewusstsein eines gemeinsamen Kulturerbes« als wichtigster Bestandteil bei der Herausarbeitung dieser Identität betrachtet. In den Achtzigerjahren stand die Herausarbeitung einer gemeinsamen Identität mit der gemeinsamen Bildungspolitik der Europäischen Gemeinschaft im Zusammenhang. Seit den Neunzigerjahren wiederum begann man den Begriff einer gemeinsamen europäischen Identität anzuwenden, wenn von der Notwendigkeit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik die Rede war. Im Vertrag von Maastricht heißt es, die europäische Identität und Eigenart müsse in der weltpolitischen Arena zum Tragen kommen. Dies wurde auch am Vorabend der EU-Erweiterung im Jahre 1996 auf der Zwischenregierungskonferenz in Amsterdam betont. Seit den Neunzigerjahren wird dem Thema Identität immer größere Bedeutung beigemessen, was die Sorge hinsichtlich einer immer größer werdenden Europa-Skepsis widerspiegelt. Diese wird durch Meinungsumfragen verdeutlicht, die das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen zu Region, Staat und Europa zum Gegenstand haben. Die Idee einer gemeinsamen europäischen Identität hat sich gleichzeitig mit dem eigentlichen europäischen Integrationsprozess entwickelt. Zu Anfang dieses Integrationsprozesses, als die Europäische Gemeinschaft vom Wirtschaftsgedanken geprägt war, gab es bezüglich der Thematik einer gemeinsamen europäischen Identität lediglich ein rein wissenschaftliches Interesse. Heute hingegen, da die EU sich zu einer Gemeinschaft der Politiken entwickelt, bedarf die EU-Politik in immer höherem Maße der Unterstützung und Mitarbeit ihrer Bürger. Entscheidungen, die früher auf nationaler Ebene getroffen wurden, werden im Zuge der voranschreitenden Integration immer häufiger auf europäischer Ebene getroffen. Um eine tatkräftige politische Einheit zu werden – sowohl in der Innen- wie in der Außenpolitik –, benötigt Europa auf das Dringendste die Bereitschaft seiner Bürger, sich an den Integrationsprozessen zu beteiligen, indem sie die auf europäischer Ebene getroffenen Entscheidungen akzeptieren und unterstützen. Für das erfolgreiche Fortkommen des Projektes Europa bedarf es einer Identität, die umfassender ist als ein Verständnis hinsichtlich gemeinsamer Interessen. Eine gemeinsame Identität ist die Voraussetzung für eine wahrhaft solidarische und demokratische Gemeinschaft. Ohne Zweifel würde ein konstitutioneller Vertrag hierfür eine neue Etappe bedeuten. Heute sind wir gezwungen festzustellen, dass in Europa nicht alles wie am Schnürchen läuft. Frankreich und die Niederlande haben die neue Europäische Verfassung abgelehnt. Das ist bedauerlich, und es ist wichtig zu begreifen, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Das »Nein« Frankreichs und der Niederlande ist nicht allein mit einer Unzufriedenheit mit den nationalen Regierungen zu erklären. Viele Bürger Europas sind auch mit Europa unzufrieden. In Frankreich werden oft kritische Stimmen laut, die bemängeln, Europa folge dem angelsächsischen Wirtschaftsmodell. Und vielen von jenen, die mit »Nein« gestimmt haben, erscheint Europa als zu liberal. Das »Nein« der Niederlande hat seine Ursache in Fragen wie die potenzielle EU-Mitgliedschaft der Türkei, die Immigration und die Höhe des niederländischen Beitrags zum EU-Budget. Ohne Zweifel hat das niederländische Ergebnis des Referendums das französische »Nein« stark beeinflusst. Welche Schlussfolgerungen können wir aus diesen negativen Ergebnissen ziehen?
Wie Meinungsumfragen belegen, besteht ein sehr großer Unterschied zwischen den Gedanken der europäischen Bürger zur Integration und denjenigen der Politiker. Die Politiker in Brüssel wie in anderen europäischen Hauptstädten sind sich sehr bewusst darüber, dass Europa nötig ist, um Antworten auf die Herausforderungen der globalisierten Weltwirtschaft zu finden. Wenn die Abstimmung über die Europäische Verfassung in der Französischen Nationalversammlung stattgefunden hätte, dann hätten 85 Prozent der Abgeordneten dafür gestimmt. Wie kann dieser immense Unterschied der Wahrnehmung Europas zwischen den Politikern und den Wählern überwunden werden? Wie kann eine gemeinsame europäische Identität befördert werden, die auf gemeinsamen Werten gründet? Wie kann ein europäisches Selbstbewusstsein befördert werden, das die Europäer als eine politische Nation konsolidiert? Bronislav Geremek hat einmal gesagt: »We do have Europe, now we are in need of Europeans« (was übrigens die Paraphrase eines Ausspruchs von Massimo d’Azeglio zum italienischen Vereinigungsprozess aus dem Jahre 1870 ist: »Jetzt, da wir Italien erschaffen haben, müssen wir die Italiener erschaffen. …« Europa ist Teil unseres Alltags, es ist regelmäßig Thema der innenpolitischen Debatten – die internen Arbeitsmethoden der EU, die Verwirklichung ihrer Politik jedoch sind den Bürgern unverständlich geblieben. Die in den fünfzig Jahren seines Bestehens geschaffene Symbolik des europäischen Bündnisses ist überaus bescheiden: eine Fahne, eine Hymne und einige gegenständliche Zeichen – Pässe, Briefmarken und Hinweisschilder an Grenzübergängen. Das Manko an Symbolen steht für einen Mangel an einheitlicher politischer Konzeption. Es gibt eine unablässige Konfrontation zwischen verschiedenen kulturellen und politischen Identitäten. Derzeit divergiert das Verständnis darüber, was ein Staat ist. Es besteht ebenso ein gravierender Unterschied zwischen den jakobinischen Traditionen Frankreichs und den föderativen Traditionen Deutschlands wie zwischen dem britischen Parlamentarismus und dem französischen Präsidentialsystem. Gleichzeitig belegte im Juli 2004 eine Euro-Barometer-Umfrage über die Wahlen zum Europäischen Parlament, dass sich nichtsdestotrotz über zwei Drittel (nämlich 69 %) der Bürger als Europa zugehörig und fast ebenso viele (66 %) als EU-Bürger fühlen. Insgesamt zwei Drittel der Europäer –in den neuen Mitgliedstaaten mehr als in den alten – befürworten die Idee einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Eine noch größere Befürwortung durch die Bürger (nämlich 80 %) hat eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Vorläufig jedoch ist es so, dass auf diesen Gebieten Einstimmigkeit erreicht werden muss, damit Entscheidungen getroffen werden können. Die einstimmige Abstimmung erschwert das Treffen von Entscheidungen, und somit besteht das Risiko, dass die Politik nicht effektiv ist und nicht in der Lage, ausreichend schnell auf internationale Vorkommnisse zu reagieren. In den letzten sechzig Jahren hat Europa eine immense Aufgabe bewältigt. Es hat den Europäern eine in der europäischen Geschichte noch nie da gewesene lange Periode des Friedens und der Sicherheit beschert, es vermochte die ein halbes Jahrhundert währende Spaltung Europas zu überwinden, indem es Ost- und Westeuropa vereinte. Der »Bau Europas« ist dabei jedoch in erster Linie die Aufgabe von Politikern gewesen, und die europäischen Bürger haben sich im Stillen mit dieser Tatsache abgefunden. Im Hinblick auf die Aufgaben, die Europa heute zu bewältigen hat, ist deutlich, dass die bisherige Methode des »Baus Europas« – indem man ihn Politikern und Beamten überlässt – nicht mehr effektiv noch akzeptabel ist. Die gemeinsame Gestaltung einer europäischen Identität ist zu einem der wichtigsten Ziele der europäischen Politik avanciert, denn nur so vermag Europa diejenigen Aufgaben zu bewältigen, vor die seine Bürger es gestellt sehen.
I n der Geschichte der Europäischen Union gab es zahlreiche Krisen, und es ist charakteristisch für die Europäer, etwas pessimistisch in die Zukunft zu blicken. Im Jahre 1953 hat Harold MacMillan einmal gesagt: »Europa ist am Ende, es stirbt. Wäre ich jung, dann würde ich nach Amerika emigrieren.« Ich hingegen hätte es im Jahre 1998 so formuliert: »Europa steht vor einem neuen Anfang, es ersteht neu, und obwohl ich nicht mehr jung bin, kehre ich aus Amerika dorthin zurück.« Und auch heute möchte ich mit meiner vollen Überzeugung schließen, dass die bereits erweiterte Europäische Union kreative und effektive Antworten auf sämtliche Herausforderungen, die ihr bevorstehen, zu finden vermag. Angefangen beim Allerwichtigsten: unserem Glauben daran, dass wir mit vereinten Kräften das Haus Europa als unser gemeinsames Zuhause aufzubauen vermögen, und dass wir alle darin gemeinsam leben können – im Geiste der Gerechtigkeit, der Brüderlichkeit, der Solidarität und aller anderen Werte des europäischen Humanismus.
PODIUMSDISKUSSION
Wolfgang Eichwede:
Der Optimismus Ihrer Ausführungen, Frau Präsidentin, tut sehr wohl. Im Kern teile ich ihn, obwohl ich von meiner Biografie her einen völlig anderen Weg gegangen bin. Ich bin ganz und gar Westeuropäer; von meinem Lebensweg und in meinem Kopf bin ich ganz und gar Osteuropäer. Jedenfalls unter dem Gesichtspunkt meiner beruflichen Tätigkeit und auch meiner Interessen. Ich will mit Blick auf Europa von einer Erfahrung erzählen, die ich als kleines Kind gehabt habe. Das war damals um 1952. Zu diesem Zeitpunkt fuhren meine Eltern, meine Schwester und ich das erste Mal nach Frankreich. Nördlich von Straßburg, bei Wissembourg, fuhren wir über die Grenze. Da stand auf der deutschen Seite in Nierentisch-Form ein Schild »Sie kommen aus Europa – Sie bleiben in Europa« und auf der französischen Seite das gleiche Schild, in der gleichen Form, mit dem gleichen Bild – in französischer Sprache. Mein Vater, der während des Krieges Ingenieur war und Panzer gebaut hat (kein Soldat, aber als Techniker) und ein Anhänger des damaligen Systems war, war beim Anblick dieses Schildes tief bewegt. Ich habe ihn selten – wirklich selten – gerührt gesehen, aber als er dieses Schild sah, sah ich ihn gerührt. Und er sagte meiner Schwester und mir, dass das die Lehre seines Lebens sei: »Nicht an die Nation zunächst, sondern an Europa denken.« Er habe diesen Fehler, einen großen Fehler, in seinem Leben gemacht. Er habe das eine Zeit lang unbedacht getan und möchte daraus die Konsequenz ziehen. Das heißt, wir im westlichen Europa und insbesondere in der Bundesrepublik (hier noch stärker als im westlichen Europa) sind in einer Art von Erfolgsgeschichte aufgewachsen. Wir sind zu einer Teilnation in der Bundesrepublik, also einer bundesrepublikanischen Teilnation oder einer eigenen Gesellschaft gekommen, in einer doch taktischen Zurückstellung der Nation gegenüber Europa. Das geschah sowohl werte- als auch interessenbedingt. Es war für uns in diesem Rahmen eine außerordentliche Erfolgsgeschichte. Ausgehend von dieser persönlichen Erfahrung möchte ich zwei Aspekte betonen, die mir in der Diskussion über Europa von wirklich großer Bedeutung sind. 1989 kam dieses Europa in seinen zwei Teilen überhaupt erst nicht nur geografisch zusammen, sondern von der Botschaft, die dieser Kontinent hat. Im westlichen Teil haben die dort lebenden Völker oder Gesellschaften den Einigungsprozess nach dem Krieg organisiert. Das geschah durch die Politik, das geschah über die Ökonomie, das geschah im Rahmen des Kalten Krieges, das geschah aus Furcht, das geschah in Bedrohung, das geschah in einer Vernagelung zum Teil nach Osten und einer Öffnung nach Westen, aber letztendlich war es eine Entwicklung, die sehr stark über politische Zwänge, über die Ökonomie, über die hohe Politik gelaufen ist. Mit anderen Worten: Das westliche Europa hat ein Stück Einigungsgeschichte geschrieben. Das östliche Europa hat im gleichen Zeitraum, nicht nur heute, auch schon damals, ein Stück Freiheitsgeschichte geschrieben. Das begann mit den Aufständen Mitte der Fünfzigerjahre und zog sich bis zu den von Ihnen erwähnten Ereignissen in Ihrem eigenen Land und in anderen Ländern Ende der Achtzigerjahre in Osteuropa hin. Heute habe haben wir das Zusammenkommen der Einigungsgeschichte im Westen und der freiheitsgeschichtlichen Geschichte. Heute kommen diese beiden Linien zusammen und haben uns die Chancen gegeben, von denen Sie gesprochen haben. Da liegt wirklich ein Punkt, den wir, den Sie als Ostmitteleuropäer einerseits, aber auch wir andererseits, wenn wir diesen ganzen Kontinent Europa denken, deutlicher machen müssen. Dieser Kontinent hat nach dem Krieg aus seinem östlichen Teil wirklich viel zu lernen und er hat auch viel gelernt. Nicht nur haben hier Revolutionen stattgefunden, sondern diese Revolutionen haben in einer friedlichen Weise stattgefunden. Das ist ein Kapitel, das Sie in der europäischen Geschichte geschrieben haben, das absolut unikal ist. Und das aus meiner Sicht ein Stück über die Botschaft der französischen Revolution 200 Jahre zuvor hinauszeigt. Dass diese Revolutionen in einer zivilen Form, mit einer zivilen Option stattgefunden haben, das ist eine unglaubliche Leistung. Das ist eine Leistung, die Sie im Baltikum, die Sie in Prag, in Budapest, aber auch in Moskau geleistet haben. Und auch in Petersburg oder damals Leningrad, auch in Kiew. Dass sich das über Vorstellungen des Dialoges mit den politischen Mächten vollzog, die zu stürzen man nicht in der Lage war. Dass man zur Feder gegriffen hat und nicht zur Pistole. Das, glaube ich, ist ein – jenseits und über diese Frage der Freiheitsbotschaft hinaus – Aspekt, der in der europäischen Geschichte und in dem, was Sie als europäische Identität angesprochen haben, sehr, sehr viel stärker noch, als wir das bislang getan haben, zur Geltung gebracht oder in Erinnerung gerufen werden muss.
Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Ich will nur ein paar Bemerkungen dazu machen. Sie haben von europäischer Identität gesprochen. Ich würde lieber von Identitäten sprechen. Also von einer Vielzahl von Identifikationsmöglichkeiten. Ich glaube, dass über die Werte hinaus, die Sie angesprochen haben, zwei andere von genauso großer Bedeutung sind. Vielleicht sind es nicht nur Werte, sondern es sind Verhaltensmuster oder Prozeduren: Das eine ist tatsächlich die Bereitschaft, aus der Geschichte zu lernen. Dieses Europa hat ja nun keine idyllische Geschichte über die letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende. Und 1945 hätte niemand geglaubt, dass Berlin 1948 zu einem Symbol von Freiheit werden könnte, oder dass ein Bürgermeister – Ernst Reuter – eine Rede halten könnte, die dieses Berlin in der westlichen Welt neu verankert. Also: dass wir lernen oder dass wir bereit sind zu lernen und dass wir dabei auch wissen, dass dieses Lernen häufig in den Widersprüchen, häufig in Brüchen, häufig in Fragmenten oder nur in Segmenten sich vollzieht. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt zum Verständnis dessen, was sich in diesem Kontinent vollzieht, und es ist zum Zweiten die Bereitschaft Souveränität abzugeben. Das knüpft an meine Erzählung von meinem Vater an mit »Europa vor den Nationen«: Souveränität abzugeben. Dabei komme ich in ein großes Problem. Ich selbst rechne von den politischen Zusammenhängen, von der historischen Verantwortung, von der kulturellen Leistung Russland voll und ganz zu Europa. Gleichzeitig ist das heutige Russland nicht bereit, so viel Souveränität abzugeben, wie es abgeben müsste, wenn es in die Europäische Union hineinwollte. Wir haben hier also verschiedene Europa-Begriffe oder verschiedene Europa-Vorstellungen, die wir mit in den Blick nehmen müssen. Für uns aber, die wir versuchen, dieses EU-Europa institutionell zu organisieren, ist die Bereitschaft der Abgabe von Souveränität ein zentraler, ein wirklich wichtiger Gesichtspunkt. Aus dem Gesichtspunkt von Werten alleine würde Neuseeland ja aber auch dazugehören und würden auch die Vereinigten Staaten dazugehören – bei unterschiedlichen Profilierungen. Was dieses Europa aber nach dem Krieg auszeichnet und was seine Botschaft ist, dass es diesen Lernprozess hat, die Bereitschaft zu Souveränität, und dass es sich von hier aus auf Prozeduren verständigt; auf Regeln verständigt, wobei sich vieles auch erst im Laufe von Jahren an Gemeinsamkeiten herausbilden kann. Anfang der Fünfzigerjahre – und das ist die Schlussbemerkung – waren viele in der westdeutschen Gesellschaft noch gefangen in Wertvorstellungen des Deutschlands vor 1945. Sie haben sich aber bereits auf demokratische Regeln eingelassen und sind ein Stück über Interessen und über Regeln und über das Beachten von Regeln dann auch zu Demokraten geworden. Wenn wir dieses Europa – vielleicht auf der allgemeinen Ebene – in einer Pluralität von Identitäten sehen, dann hat dieses Europa auch weiterhin eine Riesenchance. Es hat eine ungeheure Leistung vollbracht; trotz der großen Schwierigkeiten, die wir im Augenblick haben, bin ich da optimistisch. Man muss nicht immer – ich sage das jetzt bezogen auf das eigene Land – über Jahre oder Jahrzehnte von Politikern mit so einem geringen Maß an Visionen regiert werden, wie wir das in den zurückliegenden Phasen wurden. Es kann auch sein, dass eines Tages die Politik doch manche Botschaften wieder aufnimmt, die wir im östlichen Europa in den zurückliegenden zwanzig Jahren gelernt haben. Mit einer zivilen Option und einer großen Hartnäckigkeit. Mit der Bereitschaft zum Dialog und dem Willen nicht aufzugeben.
Willfried Maier:
Was Sie ausgeführt haben, Frau Präsidentin, über den Widerspruch zwischen der hohen Bereitschaft der politischen Klasse für Europa zu optieren und der vergleichsweise verhaltenen Zustimmung in den Bevölkerungen, das habe ich auch ziemlich lebhaft in der eigenen Erfahrung wahrnehmen können. Ich war vier Jahre in Hamburg unter anderem Europabeauftragter. Es war ausgesprochen schwierig, selbst größere Ereignisse, wie zum Beispiel die Einführung des Euro, zu einem Thema zu machen, das debattiert wurde. Warum? Es war ja kein Thema, auf das die Leute mit Emphase warteten, dass nun endlich der Euro kommen sollte. Es war vielmehr umgekehrt so, dass ihnen eine Situation vorgegeben wurde, von der gesagt wurde: »Das ist alternativlos! Das muss kommen!« Und wenn Sie sagen, mit den bisherigen Methoden geht es in Europa nicht mehr weiter, dann muss man sagen: Es geht nicht mehr weiter mit der Methode »Ökonomismus«. Es geht nicht mehr weiter mit der Methode »Das, was als Nächstes kommen soll, ist alternativlos.« Wenn das weitergeht, dann entwickelt sich gegen ein Europa am linken und am rechten Rand unserer politischen Lagerwelt eine Abwehrreaktion. Wir haben das in der Wahrnehmung bei deutschen Rechtsradikalen so, dass sie im Wesentlichen aus antieuropäischen Gefühlen und Sentiments heraus operieren. Wir haben es aber jetzt selbst bei der neuen Linkspartei zum Teil so, dass da mit einem Rückgriff auf nationale Vergemeinschaftungsmodelle – nationale Solidaritätsmodelle – operiert wird. Und es scheint vielen Leuten so, dass es die einzige Möglichkeit ist, so oder so zu optieren, wenn ihnen die politische Klasse immer nur sagt: »Europa ist in dieser und jener Entscheidung völlig alternativlos.« In Frankreich ist das Gleiche passiert und in den Niederlanden mit der Ablehnung der Verfassung ebenso. Das heißt, dass wir uns daran gewöhnen müssen – wir Westeuropäer, dass wir ein Stück Abschied nehmen müssen von der Methode Monnet. Die bestand im immer nächsten Schritt, mit dem unabwendbar der einheitliche Markt herzustellen, das nächste Hindernis für die Marktvereinheitlichung zu beseitigen war, immer begleitet vom Kommentar: »… und die Politik kommt schon nach! – Die politische Einigung wird sich dann irgendwie schon ergeben!« Wir müssen begreifen, dass Europa nichts werden wird, wenn es zu Lasten der politischen Mitwirkungsrechte der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der europäischen Länder geht; wenn sie den Eindruck haben, ihre nationalen Entscheidungen laufen leer, weil sie zu einem beträchtlichen Teil schon in Europa stattfinden, und wenn sie gleichzeitig den Eindruck haben, was aber in Europa passiert, das wird in Brüssel entschieden. Und Vorgänge in Brüssel sind so was von Bevölkerungs- und Politik-fern! Vier Jahre saß ich in einem unwichtigen Gremium – im Ausschuss der Regionen –, auf den sich europäische Regionalpolitiker einmal richtig gefreut hatten! Eine Unsinnsveranstaltung. Da halten Leute Deklarationen gegeneinander ab, die aber nie miteinander streiten, bei denen Mehrheitsbildungen nie eine Rolle spielen und es eigentlich auch nicht um wirkliche Alternativen geht. Das ist ein Interessenabklärungs-Gremium. Was ja seine gute Berechtigung hat, aber eigentlich nur eine veränderte Form von Diplomatie ist, die aber nicht das ist, was sich im Parlament abspielt. Wenn wir aber darüber nachdenken müssen, wie können Leute – Menschen in Europa – Europäer werden, ohne ihre Bürgerrolle aufzugeben, dann glaube ich auch, dass es in einer Hinsicht das Thema der Identität sein muss, die Sie angesprochen haben. Wir müssen bestimmt mehr daran arbeiten, so etwas wie eine ganz spezifisch europäische Geschichte der Freiheit erzählen zu können, die wir mehr oder weniger miteinander auch teilen. Eine emphatische Geschichte, denn dieser Kontinent ist tatsächlich der einzige, von dem der Gedanke der unzertrennlichen Individualität, der unauflöslichen Individualität eines jeden Menschen ausgegangen ist und der zu der heutigen Gestalt der Menschenrechte weltweit geworden ist. Das ist eine europäische Erfindung! Zum ersten Mal ausformuliert vielleicht in der Stoa und dann im Christentum. Es ist eine Freiheitsgeschichte, die viele Rückschläge erlitten hat. Europa hat die Gefahren seiner Selbstzerstörung insbesondere im Nationalsozialismus, aber auch im totalitären Kommunismus erfahren und das gehört zur Freiheitsgeschichte dazu, dass man sich mit den Selbstgefährdungen innerhalb des eigenen Prozesses auseinander setzt. Aber es reicht nicht, wenn man einfach nur sagt: »Wir haben gemeinsame Werte.« Werte – das ist so etwas Statisches. Das ist, als ob man das aus dem Regal holen könnte und dann hat man es. Werte leben nur, wenn man sich darauf bezieht, in welcher Geschichte Werte geworden sind, in welcher Geschichte es eine Bindung und Bildung um diese Werte herum gegeben hat und aus welcher heraus sie gekommen sind. Sie müssen erzählt werden! Sie können nicht einfach sozusagen abgegriffen werden. Da fehlt noch eine ganze Menge an europäischer Identitätsbildung, die auf diese Weise geschehen muss. Das zweite Feld ist: Wir müssen stärker noch als bisher verstehen, dass Europa nur eine Sache werden kann, die sich auf der Grundlage von Selbstverwaltung von den Kommunen bis auf die europäische Ebene hin organisiert und es unterschiedliche Formen von bürgerschaftlichem Mitwirken an diesen verschiedenen Ebenen sein dürfen. Es gibt immer das Wort: Es gibt das Europa der Staaten, die Union der Staaten und es muss daran gearbeitet werden, dass es auch so etwas wie eine Union der Bürgerinnen und Bürger gibt und nicht nur einen Vereinigungsprozess zwischen den Staaten. Es muss die eine oder andere Entscheidung geben, an der Europäer insgesamt teilnehmen können. Zum Beispiel ist die Frage der EU-Verfassung richtig ärgerlich dadurch verhandelt worden, dass sie in nationalen Volksabstimmungen verhandelt worden ist. Hätte man da doch eine europaweite Volksabstimmung hinkriegen können – es wäre eine ganz andere Emphase! Es wäre eine Auseinandersetzung der verschiedenen Lager gewesen. Es hätten sich politische Lagerbildungen über ganz Europa hinweg ergeben, die nicht einfach nur die nationalen Probleme eines jeweiligen Landes in diese Entscheidung eingebracht hätten. Im Hinblick auf solche Fragen müssen Politikerinnen und Politiker mehr Fantasie entwickeln, sonst isolieren sie sich von ihren Bevölkerungen. Das ist das Schlimmste, was einem Politiker passieren kann. Europa ist natürlich letztlich eine Angelegenheit des Konsenses, der gefunden werden muss zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, und dieser Konsens kommt nicht wie aus der Pistole geschossen, er ist auch nicht anzuordnen. Wenn die Leute den Eindruck haben, wenn sie den Nationalstaat verlieren, geht ihnen die Möglichkeit der sozialen Sicherung und der demokratischen Beteiligung verloren, dann ist Europa geplatzt. Darum müssen wir – insbesondere in Deutschland – ein bisschen vorsichtig sein, in dem Erschrecken über die Geschichte der eigenen Nation (der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts) die Idee zu haben, man könnte sich einfach über den nationalen Anteil in der Organisation Europas hinwegsetzen. Das ist ganz sicher nicht der Fall! Das können auch wir nicht. Wir haben auch mit diesen Reaktionen zu rechnen. Darum glaube ich, dass Europa tatsächlich nur etwas wird auf der Grundlage einer Föderation. Von den Kommunen über die Regionen und aber auch einer Föderation der Nationen, die nötig ist, um europäische Bürgerlichkeit zu gewähren.
Vaira Vike-Freiberga:
Wenn wir mit dieser Frage der persönlichen Identität anfangen, denken Sie bitte jetzt an ihre eigene Identität. Wenn Sie sich fragen: »Wer bin ich?«, was kommt Ihnen als Antwort? Also ganz ehrlich, denken Sie daran. Wer bin ich denn? – Wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel gucke, wer ist denn das, der mich anschaut? Ich glaube, ein jeder Mensch hat eine persönliche, vielfältige Identität. Dazu gehört, wie man aussieht. Ist man jung oder alt, Mann oder Frau, groß oder klein, dick oder dünn. Alles das gehört dazu. Aber manche von diesen Parametern sind wichtiger als andere. Wir haben in der Geschichte Europas nicht sehr viel über den Unterschied zwischen den Dünnen und den Dicken gehört. Das war nicht so ein Thema. Aber der Unterschied zwischen Männern und Frauen, bitte sehr! Das ist doch immer noch ein Thema, auch heutzutage noch. Wir haben die Kommentare über Frau Merkel, die erste Frau als »Bundeskanzler« in Deutschland gelesen. Das war Geschichte! Das war etwas Neues. Ja, da schreiben wir 2005 und zum ersten Mal steht an Deutschlands Spitze eine Frau. Das ist doch ein Parameter der persönlichen Identität, mit dem wir noch nicht fertig sind, nirgends in der Welt. Natürlich auch nicht bei den Politikern. Da gibt es auch noch keine Gleichgütigkeit zwischen Frauen und Männern. Noch nicht! Gut, das also ist die persönliche Identität. Dazu kommt eine andere Stufe. Man könnte sie die Sozialisierung des Menschen nennen. Dabei findet man solche Parameter wie: »Bin ich reich oder arm?«, »Bin ich berühmt oder nicht?« und vielleicht »Bin ich Arzt oder Zahntechniker oder Straßenfeger?« Der Beruf gehört also auch dazu. Man ist Arzt und Frau und auch ein dünner Mensch oder ein kleiner Mensch und ein großartiger Mensch. Alles das kommt zusammen. Das ist eine Hierarchie. Das sind Stufen in der Identität. Und nun wächst ein Kind auf und hört in der Schule, dass es ein Deutscher ist oder ein Franzose. Es wusste vielleicht gar nicht, dass es ein Franzose ist – bis es andere Leute getroffen hat, die nicht Franzosen sind. Da muss eine Konfrontation von denselben und den anderen da sein, oder es wird in der Schule gelernt, dass es da solche Menschen gibt, die Franzosen heißen, und andere, die Deutsche heißen. Das ist ein Parameter, der wichtig ist, und ich glaube, die kleinen Kinder verstehen überhaupt nicht, was es bedeuten soll. Aber man sagt ihnen: »Das ist ein wichtiger Parameter.« Und der geht vom nationalen Staat aus. Wenn wir in der Geschichte zurückschauen, sehen wir, das ist eine Konstruktion. Es wurde aufgebaut, es kam nicht natürlich. Ich habe schon das Zitat von den Italienern gebracht. 1870 wurde Italien neu aufgebaut. Vorher gab es Neapel und Rom und Florenz und allerlei Städte. Da war kein Italien da. – Oder Spanien: Erst als Ferdinand und Isabella geheiratet haben, hatte man eine Vereinigung von diesen beiden Teilen Spaniens! Und auch heutzutage noch haben sie in Spanien elf verschiedene Sprachen und Regionen. Viele von ihnen sind nicht ganz zufrieden mit diesem spanischen Nationalstaat. Dasselbe ist in Frankreich geschehen, unter Ludwig XIV. und dann später unter der Revolution und Napoleon. Der französische Staat wurde durch das Zurückdrängen der Regionen aufgebaut! In Deutschland, das wissen Sie ganz genau, hat Bismarck Deutschland geschaffen. Vorher gab es eine Menge Fürstentümer. Der Staat ist nicht seit 2000 Jahren da! Es sind 100 Jahre oder 200 Jahre oder 20 Jahre. Er ist etwas, das so aufgebaut wurde. Man hat daran gearbeitet. Und wenn wir etwas noch Größeres aufbauen wollen, dann ist das nicht etwas ganz Neues. Das ist derselbe Prozess, den Spanien in seiner Integration durchlaufen hat, den Italien in seiner Integration durchlaufen hat, Deutschland hat es getan und Frankreich. Man baut dies auf in einem historischen Prozess. Und diese europäische Union ist wieder eine Stufe in diesem Prozess. Es geht also weiter, Schritt um Schritt.
Sie sprechen von Vertiefung. Die bisherigen Mitglieder sind nicht auf derselben Ebene, weder ökonomisch noch sonst. Sie müssen integriert werden, und das wird Zeit brauchen. Wie es getan wird, dazu, glaube ich, sind beide Kommentare stimmig. Man braucht die Identität. Sodass ein jeder Mensch sich sagt: »Ich bin so und so und ich bin ein Mann oder eine Frau und ein Deutscher und ein Europäer.« – Darin ist kein Widerspruch. Man kann sich in dieser Hierarchie als Europäer ansehen, als Identität. Ein Europäer, der deutsch ist oder ein Europäer, der französisch ist. Ganz, wie man auch sagen kann: »Ich bin ein Mensch ganz einfach ein Mensch. Ein Mitglied der Menschheit.« Das ist doch die nächste Stufe und hoffentlich haben wir die auch im Sinn. Die ist doch auch wichtig. Wir können sagen, dass die Europäische Union bisher eine technische ist. Sie ist eine praktische Sache. Sie ist administrativ, politisch, ein Finanzprozess und sie ist Brüssel und alles, was damit geschieht. Und wenn man sie eine Föderation nennen will oder etwas anderes: Wissen Sie, wenn man die Föderationen ansieht, sind sie alle sehr verschieden. Der Unterschied zwischen Kanada als Föderation und den Vereinigten Staaten ist sehr groß. Beide heißen Föderationen, aber das, was eine Provinz Kanadas tun kann gegen die zentrale nationale Regierung, und was ein Staat der USA tun darf gegen die Regierung in Washington, ist nicht dasselbe. Genauso wie bei einem Land wie Bremen, oder Hamburg oder Schleswig-Holstein und Bayern. Das sind nicht dieselben Beziehungen zwischen diesen Stufen. Das heißt, dass, wenn man Föderation sagt oder Union, so ist das sehr elastisch. Man kann vieles damit tun und mit demselben Wort verschiedene Mechanismen verstehen. Das ist nicht schlimm. Es gibt uns die Möglichkeit mit diesen Konzepten zu arbeiten, auf der konzeptuellen Ebene: Wie soll es heißen und was soll es bedeuten? Wirklich fundamental ist die Frage der Souveränität in all diesen Vereinigungen. Wie viel Verantwortlichkeit man hat, auf welcher Ebene man das Geld verschwendet (man selbst oder ein anderer). Was man der zentralen Regierung gibt, und was man selbst behält. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, und man hat schon viele davon probiert. Dieser Prozess geht weiter. Wenn Sie von Kerneuropa sprechen, dann möchten wir, als neue Mitglieder natürlich, nicht so gern ein Europa sehen, wo die Guten, die Alten und Richtigen auf einer Seite sind und die Neuankömmlinge und die nicht so Guten und nicht so Anpassungswilligen ein bisschen in der Ecke stehen. Wir möchten doch die Solidarität im wirklichen Leben.
Wolfgang Eichwede:
Noch einmal zu den Europa-Aspekten. Ich selbst hatte mir lange Zeit vorgestellt, dass ich eines Tages gemeinsam mit den Franzosen (das war noch das alte Europa, das kann man genauso auf die Polen oder die Letten ausdehnen) ein gemeinsames Parlament nicht nur nach Nationen haben und zusammen wählen würde. Tatsächlich war ich davon ausgegangen: »Wir werden Staaten überwinden.« Angedacht war nicht eine Föderation von Staaten, sondern: »Da bleibt die Kultur und da bleibt die Sprache und da bleiben regionale Zusammenhänge, und das wird nicht alles ein Supermonster. – Da wird die Bedeutung des Staates möglicherweise reduziert.« Insgeheim glaubte ich, wir kommen auf die Vereinigten Staaten von Europa zu. Das ist ganz offensichtlich nicht real. Das muss man einfach so sehen, und für meine Generation ist das ein beträchtlicher Umdenkungsprozess. Es wäre falsch, würde man es nicht sehen, dass Europa die emotionale Lücke gegenwärtig nicht füllen kann, die entstehen würde, wenn wir den Nationalstaat – wie ich mir das eigentlich gewünscht habe – aufgeben würden. Das muss ich einfach so sagen. Ich selbst würde das gerne tun. Ich finde den Nationalstaat, diese Geschichte dieses Europas eine sehr schwierige Angelegenheit. Ich finde andere Epochen Europas, in denen es weniger Nationen gegeben hat und größere, nicht imperiale Zusammenhänge, sondern kulturelle Zusammenhänge, finde ich nicht weniger attraktiv, aber ich muss einfach feststellen, das ist gegenwärtig nicht vorstellbar. Der zweite Punkt: Dieses Europa ist in seiner augenblicklichen Konstruktion institutionell überfordert. Es sind so unglaubliche Aufgaben, die wir uns selber gestellt haben. Das ist auch gut, aber die Institutionen werden nicht mit diesem Berg an Problemen fertig, und von dort her kommt eben dieses ständige Fragen und dieser Zweifel an Europa. Auch da muss man sehen, dass wir in manchen unserer Vorstellungen in den vorangegangenen Jahren vielleicht zu weit gegriffen haben. Der dritte Punkt: Es ist doch bezeichnend, wir haben die ganze Zeit über Europa gesprochen und kein einziges Mal die Vereinigten Staaten von Amerika erwähnt. Also, Sie haben es getan, gut, gut! Aber man muss sich noch mal vor Augen halten, dass Europa in den letzten Jahren schwierige Beziehungen zu den Vereinigten Staaten hat, und diese schwierigen Beziehungen lasten auch auf diesem Europa. Ich sehe hier ein wirkliches Dilemma. Auf der einen Seite wollen wir selbstständiger werden – auch den Vereinigten Staaten gegenüber. Wir wollen auf gleiche Augenhöhe kommen, wie es so schön heißt. Auf der anderen Seite werden wir das nur können, wenn wir die Konfliktzonen mit den Vereinigten Staaten reduzieren. Solange diese Konfliktebenen bestehen, wird es nicht zu einer einheitlichen Sprache in Europa kommen. Hier sehe ich ein zusätzliches Problem, damit wir uns jetzt nicht nur in den großen historischen Zusammenhängen bewegen, sondern auch in den aktuellen politischen Fragen, denn da haben wir wirklich viele aktuelle Fragen, die gegenwärtig in diesem Europa nicht gelöst sind.
Willfried Maier:
Zunächst noch einmal zum Thema Kerneuropa und Gesamteuropa. – Ich glaube, dieses Thema ist in Wirklichkeit seit der niederländischen und französischen Abstimmung vom Tisch. Die Krise ist in Kerneuropa angekommen und nicht in erster Linie ein Problem der neuen Randländer. Das heißt, der Bruch mit der bisherigen Erfolgswahrnehmung ist zuerst in Westeuropa entstanden. Insofern ist alles Reden von einem engeren Zusammengehen von Kerneuropa politisch ein bisschen gegenstandslos. Es ist eigentlich eine Fortsetzung des administrativen Denkens. Also des Denkens von den notwendigen Verwaltungs- und Administrationseinigungen, die in Brüssel getroffen und die möglicherweise bei den homogeneren oder schon homogener gewordenen westeuropäischen Gesellschaften schneller durchsetzbar sind. Das hat aber nichts mehr zu tun mit einem größeren politischen Willen zu Europa in Westeuropa. Es ist nicht mehr so, dass in Westeuropa der politische Wille größer ist. Dann aber noch einmal zu dem Thema der Identität oder der Identitäten. Natürlich gibt es in Europa verschiedene Identitäten. Aber wenn wir vom Europa der verschiedenen Identitäten sprechen, reden wir offenbar über etwas Gemeinsames. Wenn wir aber über etwas Gemeinsames reden, dann muss in diesem Verschiedenen ein Gemeinsames identifizierbar sein, sonst würde man gar nicht von einem gemeinsamen Europa sprechen. Das Problem ist, dass dieses Gemeinsame schwer herauszuarbeiten ist. Es ist aber notwendig, das zu tun, es ist auch politisch notwendig. Natürlich ist das keine Sache, die dann – wie im Gesangbuch – alle heruntersingen, sondern um die es Streit gibt, worin dieses Gemeinsame eigentlich besteht. Dass dazu ein Bewusstsein da sein und sich herausbilden wird, glaube ich schon. Die Frau Präsidentin hat davon gesprochen, dass die Nationalstaaten konstruiert worden sind. Nicht nur die Nationalstaaten sind konstruiert worden, auch das Nationalgefühl, das Nationalbewusstsein. Das ist eine Erfindung von Dichtern und Historikern, keineswegs etwas, was schon immer da war. Die Deutschen haben sich ja nicht als deutsche Nation so ohne weiteres gefühlt, die Franzosen auch nicht so ohne weiteres. Die Leute in der Provence haben sich doch nicht als Franzosen gefühlt über Jahrhunderte, sondern sind in eine gemeinsame Geschichtserzählung – zum Teil gewaltsam, zum Teil emphatisch – hineingewachsen. Und etwas viel weniger Dominantes als die nationalen Erinnerungskulturen, die da aufgebaut worden sind, wird auch im Bezug auf Europa nötig sein. Wir bekommen es zurückgespiegelt von den Nicht-Europäern, die uns zum Beispiel die Menschenrechte entgegenhalten: »Das ist aber eine europäische Erfindung, mit der Ihr hier interveniert.« Wir sagen dann gerne: »Das stimmt ja gar nicht.« Aber sie haben ja völlig Recht: Es ist eine Erfindung, die in Europa gemacht worden ist, wenn auch mit dem Anspruch auf universelle Geltung. Tatsächlich hatte die Idee der Menschenrechte eine bestimmte historische Genese. Und nicht nur das: Die Idee der Menschenrechte wirkt auf andere, traditionelle Gesellschaften auch zerstörend. Auf Gesellschaften beispielsweise, in der nicht das Individuum der Ausgangspunkt der Vergesellschaftung ist, die moralische Basis-Einheit gewissermaßen, sondern die Familie oder ein ClanZusammenhang. Diese gesellschaftlichen Akteure sind in Europa spätestens seit Herausbildung des frühen Nationalstaates aufgelöst worden. Die Freisetzung von Individualität hatte also einerseits geistesgeschichtliche Gründe, aber auch staatliche – oder durch wirksame Staatlichkeit organisierte – Gründe. Das ist etwas historisch Besonderes und trotzdem sagen wir: Es ist ein Menschheitsgut mit universellem Anspruch, und wir sagen das mit einem gewissen Recht. Obwohl wir genau wissen, dass damit andere Formen des menschlichen Zusammenlebens, die eine jahrhundertealte Geschichte haben, zu zerbröseln beginnen, weil sie in dieselbe Welt von Organisation hineingezogen werden. Gerade wegen dieser besonderen europäischen Geschichte, die einen universellen Anspruch – die Idee der Menschenrechte – hervorgebracht hat, ist es zugleich unverzichtbar und möglich, dass Europäer eine Wahrnehmung ihrer Gemeinsamkeiten und das Gefühl einer sich annähernden Geschichtserzählung untereinander ausbilden. Das zweite Element ist tatsächlich, dass dieses Europa ein Europa der Selbstregierung seiner Bürgerinnen und Bürger wird. Dazu werden noch viele Erfindungen gemacht werden müssen. Man kann nicht sagen: »Föderation ist gleich Föderation!«, sondern muss zusehen, wie etwa die überaus zentralstaatliche Tradition der Franzosen mit der britischen Geschichte der lokalen Selbstorganisation und der an den Ländern orientierten und kommunalen Selbstorganisation der Deutschen in ein institutionelles Verhältnis gebracht werden können, das die demokratischen Kräfte der europäischen Ebene nicht überfordert. Das ist sicherlich noch ein offenes Experiment. Ich glaube übrigens nicht, dass diese Kräfte in erster Linie vom europäischen Parlament und dessen stärkerer Gewichtung kommen werden. Ich glaube, es kommt durch gemeinsame politische Erfahrungen und Entscheidungen der Europäer. Also zum Beispiel die Entscheidung über die Verfassung als eine europäische zu organisieren, die Entscheidung über die Währungsunion als eine europäische zu organisieren, hätte viel mehr europäisches Bürgerbewusstsein geschaffen als alle Straßburger Parlaments- und Brüsseler Debatten, die doch nur von wenigen verfolgt werden. Kaum eine Zeitung berichtet darüber. Das Parlament wird kaum wahrgenommen. Und erst recht der Ausschuss der Regionen, auf den wir uns damals sozusagen als Europa der Regionen bezogen haben, wird gar nicht wahrgenommen. Man braucht große gemeinsame Entscheidungssituationen. Habermas hat nicht ganz zu Unrecht gesagt: Die damalige Auseinandersetzung in Europa um die Stellung zum Irakkrieg war trotz der Differenzen in Europa, war europäisch fördernder als gar keine Auseinandersetzung über die Frage. Auch dieser Streit hat sich leider stärker zwischen den Regierungen abgespielt als zwischen den europäischen Bürgerinnen und Bürgern, obwohl er nicht nur ein Streit zwischen den Regierungen war. In Großbritannien oder in Italien gingen auch die Leute auf die Straße und sagten: »Wir sind für eine Linie, die nicht mit der unserer nationalen Regierung übereinstimmt.« Solche Streits in Europa, über große gemeinsame Fragen, bei denen man sich über die Nationen hinweg über das FÜR und das WIDER streitet: Das bildet die europäische Geschichte der Zukunft – hoffentlich.
Die Diskussion endete mit einem Dankeswort der Preisträgerin, Vaira Vike-Freiberga.
Preisverleihungen, mögen sie noch so gut und erhebend verlaufen, sind doch für die meisten von uns einzelne und schnell vorbeihuschende Momente. Es fällt uns schwer, uns anschließend zu erinnern, was an ihnen – über die Ehrungen hinaus – irgendwie bedeutsam und denkwürdig war. Der zehnte Jahrestag der erstmaligen Verleihung des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken ist deshalb vielleicht eine gute Gelegenheit, diese Preisverleihung in einen weiteren politischen Horizont einzufügen – in einen Horizont, der über das Einmalige jeder einzelnen Preisverleihung hinausgeht. Das, was unsere Preisträgerinnen und Preisträger der vergangenen Jahre – die Namen im Anhang – untereinander und mit dem Namen unseres Preises verbindet, ist nicht etwas bloß Ideengeschichtliches. Sie sind auch, auf verschiedene Weisen, durch ihr Leben, ihr Denken, ihr Handeln, durch entscheidende Erfahrungen innerhalb der dramatischen Geschichte unserer Zeit geprägt. Vielleicht haben sie diese dann unerschrockener und radikaler als andere aufarbeiten und weitergeben können. Wie Sie wissen, wird der Name Hannah Arendts, die als deutschjüdische Emigrantin nach Amerika kam, meistens mit ihren entscheidenden Einsichten in das Wesen der totalitären Herrschaft, in ihre prägenden Elemente, verbunden. Manchmal wird es auch wahrgenommen, dass sie diese Einsicht, diesen Zugang dadurch errungen hat, dass sie dem Einbruch des Totalitären in unsere Geschichte gleichsam ungeschützt, ohne den Rückhalt der schon vorhandenen politischen Kategorien – wie etwa Diktatur oder Autoritarismus – begegnet ist. Dadurch tritt bei ihr, viel deutlicher als anderswo, das Totalitäre als etwas innerhalb der Geschichte der Moderne und als etwas grundlegend Neues zu Tage. Was fast durchgängig – aber gewiss nicht zufällig – ignoriert wird, ist, dass Arendt, in diesem begriffsoffenen Umgang mit dem Totalitären zugleich einen epochalen Neuzugang zu der politischen Wirklichkeit unserer Zeit hervorgebracht hat. Einen Neuzugang, den sie – neben einem einmaligen gedanklichen Erbe aus dem vortotalitären Deutschland – vor allem der Tatsache zu verdanken hat, dass sie sich – anders als die meisten europäischen Emigranten – intensiv auf das Besondere der amerikanischen revolutionären Erfahrung einließ, auf das, was in ihr einen verschütteten Raum des Politischen aufgemacht hat. Damit konnte sie auch – wie fast keiner außer ihr – ein neues Licht darauf werfen, was die »Amerikanische Neugründung der Freiheit« für die bedrohte politische Dimension der Moderne bedeutet hat. Was in dieser Beleuchtung lebendig wird, ist nicht eine von uns ferne – auch geschichtlich und kulturell ferne – Erfahrung des Politischen. Vielmehr jene Erfahrung, die wir, Erben nicht nur eines individuell-liberalen Rechtsschatzes, sondern auch eines republikanisch-christlichen (oder auch abrahamitischen) freiheitsversprechenden Bildungsschatzes, ein jedes Mal selber machen, wenn wir die Gelegenheit haben, nicht bloß als durch Gruppeninteressen zusammengebrachte Staatsuntertanen, sondern als »citizens« einer geschichtskonfrontierten politischen Nation zusammen handeln und sprechen zu können. Die Differenz dieser Politik- und Machterfahrung zu einem Politik- und Machtverständnis, das an eigenmächtige Souveränität und an Staatshandeln anknüpft (auch dort, wo ein eindeutiger »Volkswille« den Platz des Souveräns einnehmen soll), liegt dann auch in der ganzen Hintergründigkeit des arendtschen Verweises auf unser »ERBE OHNE TESTAMENT«.
Von hier aus möchte ich einen Bogen zu unserer ersten Preisträgerin schlagen. Sie, Agnes Heller, war lange Zeit auch eine in die Emigration gezwungene Frau, noch in der Zeit des KadarRegimes in Ungarn. Unsere ungarisch-jüdische Denkerin hat, nach den Schrecken der faschistischen Todeskommandos am Budapester Donauufer am Kriegsende, ihren letztlich entscheidenden politischen Anstoß in den Tagen des ungarischen Volksaufstandes und der Revolution des Jahres 1956 bekommen. Dieser hat sie dann mit zu ihrem heutigen Hannah-Arendt-Lehrstuhl an der »New School« in New York geführt. Hannah Arendt hat übrigens diese Revolution – mit guten Gründen – als die erste wirklich politische Freiheitsrevolution nach der Amerikanischen betrachtet. Es hat sich nun so gefügt, dass das Leben der Frau, die wir heute ehren wollen, auch von einem – viel zu langen – Exil geprägt ist. Frau Vaira Vike-Freiberga stünde aber nicht vor uns, wäre ihr Denken und Handeln nicht auch noch von einem anderen Ereignis geprägt und getragen. Antonia Grunenberg hat in ihrer Laudatio dieses Ereignis und sein Fortwirken im Denken und Handeln von Frau Vika-Freiberga schon bestens beleuchtet. Hier davon nur so viel: Man spricht oft vom Jahre 1989 als vom »Jahr des Wunders«, in dem scheinbar Unmögliches plötzlich möglich, ja wahr wurde. Wir sollten aber vielleicht von einem doppelten »Jahr des Wunders« sprechen, will sagen, auch vom »Jahr des Wunders« der baltischen Nationen im Jahre 1991. Von dort kam das entscheidende Signal, nicht nur für das Ende des Ausgreifens des sowjetischen Imperiums und der totalitären Momente, die in ihm überlebt haben, sondern auch für seinen entscheidenden Zusammenbruch. Unsere erste und unsere zehnte Preisträgerin symbolisieren so gewissermaßen auch die zwei Freiheitsereignisse, die den ersten großen Riss in der unheimlichen, freiheitsabweisenden imperialen Mauer und die endgültige Besiegelung ihrer Unhaltbarkeit bedeutet haben. Sie weisen zugleich nicht bloß auf etwas Vergangenes hin, sondern auch auf eine eigentümliche Macht, die in unseren politischen Nationen – und in dem, was durch sie übertragen wird – schlummert. Sie ist nicht jene Kommando- und Herrschaftsmacht, die man üblicherweise und fälschlich mit »politischer Macht« gleichsetzt, und die man dann »legitimieren« muss, um sie demokratiekonform und konsensfähig zu machen. (Zentrale Momente des arendtschen Denkens machen es uns möglich, diese uns angewöhnte Gleichsetzung aufzubrechen.) Sie ist eher eine belebende Macht, die einen Raum öffnet, in dem und durch den so etwas wie eine politisch-geschichtliche Entscheidung (die diesen Namen verdient) überhaupt möglich wird. Auf die Widerständigkeiten dieses strittigen Raumes, ihn zu einem rein selbstbezüglichen oder voll säkularisierten Raum zu machen, hat unser Preisträger des Jahres 2004, Ernst-Wolfgang Böckenförde, hingewiesen. (Im Sinne seines »Dictums«, dass die demokratische Verfassungsordnung auf Grundlagen beruht, die sie selber nicht hervorbringen kann.)
Es ist kein Zufall, dass der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken hier in Bremen in jenem Moment unserer jüngeren Geschichte ins Leben gerufen wurde, als es deutlich wurde, dass man dabei war, die Revolutionen in Ostmitteleuropa sozusagen zu den Akten zu legen. Ihre bezeugende und freiheitsversprechende Dimension sollte so zum Verschwinden gebracht werden. Sowohl in den weithin bestimmenden politischen wie auch akademischen Diskursen wurden sie als »nachholende Revolutionen« charakterisiert, die lediglich das nachgeholt hätten, was für den Westen bereits selbstverständlich war: liberale Marktwirtschaft und parlamentarische Demokratie. Diese Abwertung der geschichtlichen und politischen Erfahrung jener Nationen, die damals mit einem revolutionären Paukenschlag erneut in den Raum der demokratischen und republikanischen Auseinandersetzung getreten waren, trug maßgeblich dazu bei, die Potenzialitäten und Neuverortungen dieser Ereignisse zu verspielen. Damit ist nicht selten die Einstellung verbunden, die gewaltbesetzte »Vorgeschichte« des heutigen friedlichen europäischen Westens als etwas Abgeschlossenes zu betrachten, welches auf ein unbeschwertes »Nach-vorne-Schauen« einlädt – als ob sich mit der heutigen pragmatisch-professionellen Problembearbeitung und instrumentellen Problemlösung die Gefährdungen der Freiheit ein für alle Mal erledigt hätten. Übersehen wird dabei, dass in der arendtschen Beleuchtung des Totalitären eine ihrer ermöglichenden Dimensionen besonders klar zu Tage tritt. Diese Dimension ist keine andere als jene der Entpolitisierung, als jene des Bedeutungsverlustes der politischen Auseinandersetzung, als jene der Ohnmachtserfahrung der Bürger einer Nation. Das heißt: genau jene Unterhöhlung der Bedeutsamkeit des Politischen, die wir Tag für Tag erleben. Der Name Hannah Arendts steht für etwas anderes – nämlich für ein politisches Denken, welches zum einen der Neuheit und Eigenheit der totalitären Versuchung der Moderne Rechnung trägt, welches zum anderen das Wort »Wunder der Freiheit« ohne ängstliche Verlegenheit oder idealistischen Überschwang ausspricht. Darum stehen hier die Namen unserer Preisträgerinnen und Preisträger mit dem Namen unseres Preisgebers zusammen – nicht für Bezeugungen vergangener Geschichte, sondern für Bezeugungen jener Konfrontation mit der Geschichte, die uns auch heute noch Not tut.
Vaira Vike-Freiberga, Psychologin und von 1999 –2007 lettische Staatspräsidentin

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Einleitung zu Vortrag und Podiumsdiskussion
m Namen des Vorstandes und der Jury des Hannah-Arendt- Preises begrüße ich Sie herzlich zur Auftaktveranstaltung der Vergabe des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«, der heute Abend an die Staatspräsidentin der Republik Lettland, Frau Professor Vike-Freiberga, vergeben wird. Es gehört zu der guten Tradition unseres Preises, die Preisträger nicht nur in wohlfeinen Worten festlich zu ehren, sondern sie selber ins öffentliche Licht zu stellen und sprechen zu lassen. Liebe und Freundschaft, so Hannah Arendt, gedeihen im Verborgenen, aber die »Entbergung« der eigenen Person, um es mit einem Terminus von Martin Heidegger auszudrücken, kann nur im öffentlichen Raum stattfinden. Nur in der Öffentlichkeit tritt die differentia specifica des Menschseins ins Bewusstsein. »Sprechen und Handeln«, so Hannah Arendt, sind die Tätigkeiten, in denen sich die Einzigartigkeit jedes Menschen darstellt. Es ist uns deshalb eine besondere Freude, dass Frau Vike-Freiberga in dem folgenden Festvortrag auf ihr Verhältnis zur Politik, auf die geschichtlichen Erfahrungen ihres Landes im 20. Jahrhundert und auf die Probleme einer gemeinsamen europäischen Identität eingehen wird.
Lassen Sie mich mit einigen einstimmenden Anmerkungen beginnen. Robert Schuman, einer der Begründer der Idee des vereinigten Europa, sagte 1963: »Wir müssen das geeinte Europa nicht nur im Interesse der freien Völker errichten, sondern auch, um die Völker Osteuropas in diese Gemeinschaft aufnehmen zu können, wenn sie, von den Zwängen, unter denen sie leiden, befreit, um ihren Beitritt und unsere moralische Unterstützung nachsuchen werden. Wir schulden ihnen das Vorbild des einigen, brüderlichen Europa. Jeder Schritt, den wir auf diesem Wege zurücklegen, wird für sie eine neue Chance darstellen. Sie brauchen unsere Hilfe bei der Umstellung, die sie zu bewerkstelligen haben. Unsere Pflicht ist es, bereit zu sein.« Bis diese programmatische Deklamation mit der Aufnahme der ostmitteleuropäischen Staaten in die EU Wirklichkeit wurde, vergingen bekanntlich noch 41 Jahre. Erst die Freiheitsrevolutionen von 1989/1990 schufen die Voraussetzungen, um eine Kongruenz zwischen dem von Schuman formulierten Versprechen und der von den Dissidenten Ostmitteleuropas verfolgten Vision einer »Rückkehr nach Europa« herzustellen. In der Forderung der Dissidenten nach einer »Rückkehr nach Europa« klang die feste und tiefe Überzeugung an, dass die ostmitteleuropäischen Länder genuiner Teil der europäischen Kulturgeschichte sind und ihr Platz selbstverständlich in einer erweiterten Europäischen Union sein wird. Die EU symbolisierte vom Osten aus gesehen Freiheit, Wohlstand und eine Vorstellung vom besseren Leben. Der Anschluss an den Westen, an eine europäische Identität, versprach von Warschau bis Sofia, von Prag bis Kiew individuelle Rechte, Freizügigkeit und freie Entfaltung. Geht man von der bereits vollzogenen Osterweiterung der EU aus, ist dieser Wunsch formal in Erfüllung gegangen. Die Länder Ostmitteleuropas sind jetzt Teil des gemeinsamen Wirtschaftsraums in Europa, die Kulturbeziehungen haben sich in viele Richtungen erweitert und intensiviert, der Wissenschaftsaustausch ist ein wichtiges Element der vielfältigen Verbindungen geworden. Dazu gehört wie selbstverständlich, dass zum Beispiel zwei lettische Studentinnen aus Riga an dieser Veranstaltung teilnehmen. Sie verbringen im Rahmen des europäischen Studierendenaustausches ein Semester an der Universität Bremen, so wie umgekehrt Studierende der Universität Bremen in Riga studieren. Bremen legt nicht zuletzt im Rahmen der langjährigen Städtepartnerschaft mit Riga großen Wert darauf, dass diese vielfältigen Projekte und Verbindungen gepflegt und ausgebaut werden. So positiv diese Bilanz ist, so muss man auf der anderen Seite doch feststellen, dass es um die symbolische Integration Ostmitteleuropas in das gemeinsame europäische Haus nicht gut bestellt ist. Es gibt zwischen Ost- und Westeuropa eine erstaunliche Asymmetrie in den Vorstellungen von einem gemeinsamen Europa. Während in Westeuropa die EU-Institutionen immer mehr zum Fokus öffentlicher Diskurse über Europa geworden sind, wird in vielen Ländern Ostmitteleuropas Europa auch als ein gemeinsamer öffentlicher Kulturraum verstanden, in dem es um den wechselseitigen Austausch von Ideen und Erfahrungen geht. »Europa«, so der polnische Philosoph Krzysztof Michalski, »das ist nicht nur ein politisches Gebilde, das ist eine Kultur von Institutionen, Ideen, Erwartungen, Gewohnheiten und Gefühlen, Stimmungen, Gerüchen, Erinnerungen und Aussichten – eine Kultur, auf deren Boden erst ein politisches Gebilde wachsen kann. Der eiserne Zaun, der mitten durch diese Kultur ging und sie zerschnitt, ist entfernt worden, das ist wahr – aber ob die auf beiden Seiten so verschiedenen Institutionen und Ideen wirklich zusammenwachsen und eine ausreichende, zuverlässige Grundlage für eine längerfristige politische Integration bereitstellen, das bleibt eine offene Frage.« Tatsächlich tun sich viele immer noch schwer damit, die Erfahrungen der Osteuropäer zu einem Bestandteil des gemeinsamen Erbes Europas zu machen. Ein solcher Schritt würde zum Beispiel voraussetzen, dass sich die Westeuropäer jenseits von Lippenbekenntnissen für die totalitären Erfahrungen der Ostmitteleuropäer wirklich interessieren. Zum Glück gibt es öffentliche Repräsentanten, die diesen Erfahrungen eine Stimme geben können. Frau Vike-Freiberga, die in ihrer eigenen Lebensgeschichte tief geprägt ist von der doppelten Diktaturerfahrung der ostmitteleuropäischen Länder, ist eine solche Stimme, die auch in Westeuropa noch stärker zum Klingen gebracht werden muss. Dazu möchten wir ihr jetzt die Gelegenheit geben.
Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel war der israelische Botschafter hier im Rathaus. Eine der Aussagen von Shimon Stein war: Die Shoah, die Vernichtung der Juden, gehört zur Identität Deutschlands wie Israels. Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang ein paar Worte zu den unsäglichen Äußerungen des iranischen Staatspräsidenten Mahmud Ahmadinedschad. Er bezeichnet den Holocaust als »Märchen« und fordert die Tilgung Israels von der Landkarte. Mit den Plänen zur atomaren Aufrüstung sind die Reden dieses Präsidenten gegen die Existenz des israelischen Staates eine akute Friedensgefährdung. Allein schon auf Grund unserer Geschichte und besonderen Verantwortung gegenüber Israel ist hier eine eindeutige Haltung der Bundesrepublik geboten. Wir können keine normalen Beziehungen mit einem Staat unterhalten, dessen Präsident den Genozid an den Juden leugnet und Israel vernichten will. Die Forderung, alle Menschen sollten ihr Denken und Handeln so einrichten, »dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe«, gehört zu den moralischen Grundfesten der Bundesrepublik. Ich bin sehr froh, dass im politischen und kulturellen Leben unserer Stadt das Erinnern fest verankert ist. Und gerade weil wir es immer wieder neu begründen müssen, bleibt es lebendig. Es gibt nicht nur ein kaltes Vergessen. Es gibt auch ein kaltes Erinnern. Niemand wusste das besser als Hannah Arendt. Von August 1949 bis März 1950 besuchte sie zum ersten Mal seit ihrer Flucht 1933 Deutschland. Sie schreibt danach: »In weniger als sechs Jahren zerstörte Deutschland das moralische Gefüge der westlichen Welt, und zwar durch Verbrechen, die niemand für möglich gehalten hätte. … Überall fällt einem auf, dass es keine Reaktion auf das Geschehene gibt. … Die Gleichgültigkeit, mit der die Deutschen sich durch die Trümmer bewegen, findet ihre genaue Entsprechung darin, dass niemand um die Toten trauert.« Hannah Arendt verkörpert das deutschjüdische Erbe, das uns anvertraut ist. Und zugleich steht sie mit ihrem Denken, wie viele der jüdischen Überlebenden, für die Folgerungen, die aus dem Zivilisationsbruch zwischen 1933 und 1945 zu ziehen sind. Schon von daher gehört die Verleihung des Hannah-ArendtPreises, die heute zum zehnten Mal stattfindet, auch zur bremischen Erinnerungskultur.
Die deutsche Jüdin Hannah Arendt hat überlebt. Nach der Vertreibung aus Deutschland wusste sie, dass sie Außenseiterin bleiben wird, dass sie in ihrem Anderssein nicht akzeptiert wird. Unsere heutige Preisträgerin, Frau Präsidentin Vike-Freiberga, musste auch als Kind die Heimat verlassen. Sie kennt die Erfahrung des Anders-Seins und des Exils. Und sie hat mit Hannah Arendt noch etwas gemeinsam: Sie ist wahrhaftig, offen, radikal demokratisch, historisch bewusst und immer auf der Suche nach Werten und Prinzipien, auf die sich eine menschenfreundliche Gesellschaft und dann auch ein menschenfreundliches Europa gründen muss. Ich kann die Jury nur beglückwünschen zu dieser Wahl. Frau Präsidentin Vike-Freiberga ist eine beeindruckende Preisträgerin. Marianne Birthler wird uns das gleich ausführlicher darlegen. In ihrem Buch Menschen in finsteren Zeiten zitiert Hannah Arendt die von ihr hoch geschätzte Rosa Luxemburg: »Die einzige Rettung« liegt »in der Schule des öffentlichen Lebens ... in der unumschränktesten, breitesten Demokratie und öffentlichen Meinungsäußerung.« »Die einzige Rettung liegt in der Schule des öffentlichen Lebens« – dieser Gedanke durchzieht Hannah Arendts gesamtes politisches Denken. Was Demokratie in diesem Sinne auszeichnet, ist für Hannah Arendt die Möglichkeit, dass die Menschen zu Bürgerinnen und Bürgern werden, dass sie sich an der Gestaltung der Welt beteiligen, dass sie handelnd und sprechend in ihr tätig sein können. Das Schlimmste dagegen, was einer Gesellschaft passieren kann, ist für Hannah Arendt das Verschwinden der Politik. Sie hat immer befürchtet, dass mehr und mehr Menschen in den Ländern der westlichen Welt »Freiheit von Politik« als eine der Grundfreiheiten begreifen, von dieser Freiheit Gebrauch machen und sich von der Welt und den Verpflichtungen in ihr zurückziehen. Sie weiß, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Politik als etwas erleben, das sie im Grunde nichts angeht und auf das sie keinen Einfluss haben, dass sich dann diese Menschen von der Politik und auch von der Demokratie abwenden. Aus Politikverdrossenheit kann schnell Demokratieverdrossenheit werden. Deshalb müssen wir Bürgermut fördern statt Konformismus, Dissidenten statt Mitläufer. Nur dann ermöglichen wir die »Schule des öffentlichen Lebens«, die »unumschränkteste, breiteste Demokratie und öffentliche Meinungsäußerung«. Bei der Dramatik der gesellschaftlichen Veränderungen und den Risiken, die daraus erwachsen, braucht die demokratische Gesellschaft die Talente und Fähigkeiten von allen ihren Mitgliedern. Je mehr Menschen ihrer Verantwortung zum Handeln, zum Tätigsein in der Welt gerecht werden, desto eher wird es gelingen, um Hannah Arendt noch einmal zu zitieren, »aus der Finsternis der Kreatur in die Helle des Menschlichen zu gelangen«. Sehr verehrte Frau Präsidentin Vike-Freiberga! Sie versuchen alles zu tun, um den Menschen Ihres Landes und Europas Wege zu zeigen, die in die »Helle des Menschlichen« führen. Ich möchte Ihnen noch einmal danken und Sie beglückwünschen als Preisträgerin des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«.
Die Auswahl der diesjährigen Preisträgerin wirft unvermeidlich die Frage nach Europa auf, seiner Vergangenheit und seiner Zukunft. Denn es war die Rückkehr der baltischen Staaten in das politische Europa, die den wundersamen Weg der Emigrantin Vike-Freiberga zur lettischen Präsidentin ermöglicht hat. Die Erweiterung der Europäischen Union um zehn neue Mitglieder wurde allerorts als historischer Brückenschlag gefeiert, der die aufgezwungene Spaltung Europas beendete. Aber mit diesem großen Sprung nach vorn wuchsen auch die inneren Unterschiede in der Union, und mit ihnen die internen Spannungen – nicht nur mit Blick auf die Verteilungskämpfe, wie sie dieser Tage im Gezerre um den Haushalt deutlich werden. Die mittelosteuropäischen Staaten haben in vieler Hinsicht auch eine andere geschichtliche Erfahrung und andere politische Orientierungen in die Gemeinschaft mitgebracht. Die Spaltung der Europäischen Union angesichts des Irak-Kriegs war eine erste Demonstration dieser Unterschiede, sehr zum Ärger nicht nur von Monsieur Chirac, der sich über die Unbotmäßigkeit der Neulinge echauffierte. Eine zweite Erfahrung der Ungleichzeitigkeit konnten wir zum 60. Jahrestag der Kapitulation Hitlerdeutschlands machen. Zwischen West- und Osteuropa gibt es eine Asymmetrie der öffentlichen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und sein Ende. Während bei uns die Singularität der nationalsozialistischen Verbrechen betont und der 8. Mai 1945 seit der durchschlagenden Rede Richard von Weizsäckers als »Tag der Befreiung« interpretiert wird, ist die politische Erinnerung in Mittelosteuropa durch die Doppelerfahrung von nationalsozialistischer und stalinistischer Herrschaft geprägt. Sie, Frau Präsidentin, haben diese Ambivalenz in einer Erklärung vom Januar 2005 präzise formuliert, und zwar ohne jede Spur einer Relativierung der nationalsozialistischen Untaten. Sie haben auch an die »lokalen Verbündeten« erinnert, die bei der Ausrottung der Juden in Lettland mit Hand anlegten und sich der faschistischen Besatzungsmacht anschlossen. Gleichzeitig haben Sie ausgesprochen, dass der Zusammenbruch des Deutschen Reichs »nicht zur Befreiung meines Landes geführt hat. Vielmehr wurden die baltischen Staaten einer erneuten brutalen Besatzung durch ein anderes totalitäres Regime, der Sowjetunion, unterworfen.« Sie nehmen damit den Totalitarismus-Begriff von Hannah Arendt auf, der von weiten Teilen der politischen und wissenschaftlichen Öffentlichkeit des Westens als eine Art theoretische Fortsetzung des Kalten Krieges verworfen worden war. Das galt vor allem für die Linke. Erst spät hat sich bei uns eine andere, explizit antitotalitäre Linke herauskristallisiert, die sich mit den antikommunistischen Freiheitsbestrebungen in Mittelosteuropa solidarisierte. Mit der doppelten Diktaturerfahrung der mittelosteuropäischen Länder ist auch ein geschärfter Sinn für eine Politik des Appeasements verbunden, die vor totalitären Gefahren die Augen verschließt. Das Münchner Abkommen von 1938, mit dem die Westmächte versuchten, dem Krieg mit Hitler aus dem Weg zu gehen, ist in Zentral- und Osteuropa sehr viel stärker präsent als bei uns – ebenso wie das Abkommen von Jalta, mit dem die westlichen Demokratien der Sowjetunion die Herrschaft über halb Europa zubilligten. Die andere historische Perspektive führt auch zu anderen außen- und sicherheitspolitischen Optionen. Man muss vermutlich auf diese Ungleichzeitigkeit historisch-politischer Erfahrungen zurückgehen, um das Votum Lettlands oder Polens für den Irak-Krieg und die Allianz mit den USA zu verstehen, auch wenn die Geschichte kein hinreichender Ratgeber für aktuelle politische Entscheidungen ist. Aber ohne Bewusstsein für die spezifischen Erfahrungen der mittelosteuropäischen Länder, die erst 1989/90 wieder als souveräne Nationen auf die Bühne der europäischen Politik zurückkehrten, wird sich keine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik entwickeln lassen. Das wird am Beispiel der Russland-Politik überdeutlich. Die Schröder’sche »Achse Paris-BerlinMoskau« ließ in Zentraleuropa und im Baltikum alle Alarmglocken läuten. Sie, Frau Präsidentin, sind als einziges baltisches Staatsoberhaupt der Einladung zur Feier des Sieges am 9. Mai dieses Jahres nach Moskau gefolgt, als Geste des Respekts und als Angebot zur Freundschaft. Gleichzeitig haben Sie die russische Regierung aufgefordert, Worte des Bedauerns über das Unrecht zu finden, das die sowjetische Okkupation über die Völker in der östlichen Hälfte Europas gebracht hat; und Sie zögern nicht, den Rückfall in autoritäre Herrschaftsmethoden zu kritisieren, der unter Präsident Putin eingesetzt hat. Sie insistieren damit auf einer Politik der Freiheit, die nicht der kleinen Münze pragmatischer Vorteile geopfert werden darf, wenn die Gemeinschaft der Demokratien sich nicht selbst aufgeben will. Politik ist eben mehr als das Aushandeln des kleinsten gemeinsamen Nenners zwischen unterschiedlichen Interessengruppen. Auch das kann man bei Hannah Arendt lernen. Otto Kallscheuer hat Hannah Arendt mit dem folgenden ebenso anrührenden wie prophetischen Satz zitiert: »Die einzige Hoffnung«, schrieb sie am 9. Juni 1961 an Karl Jaspers, »bleibt doch eine Föderation Europa, ganz gleich, wie klein dieses Europa erst einmal ist, eine »federation for increase«, wie es der Cromwell’sche Republikaner James Harrington so schön genannt hat, an die sich andere dann später gleichberechtigt anschließen können.« Wir sollten heute, angesichts des um sich greifenden Kleinmuts in Europa, diese Vision erneuern und weiterführen. Nicht ein europäischer Superstaat ist das Ziel, in dem die politische, kulturelle und soziale Vielfalt Europas möglichst eingeebnet wird, aber auch kein Rückfall in eine erweiterte Freihandelszone. Es geht um eine europäische Föderation, die Vielfalt und gemeinsame Handlungsfähigkeit verbindet. Für diese Idee von Europa hätte die Jury keine bessere Preisträgerin finden können.
Im Namen des Vereins und der internationalen Jury des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken darf ich Sie herzlich begrüßen. Es hat einen Wachwechsel an der Spitze der Bürgerschaft und an der Spitze dieser Stadt gegeben, und ich möchte dem Bürgermeister a. D. Henning Scherf, der uns durch all die Jahre als Vertreter der senatorischen Geberseite unterstützt hat, sehr herzlich im Namen des Vorstands, der Mitglieder, der Preisträgerinnen und Preisträger und der internationalen Jury des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken« danken. Henning Scherf hat auch in Zeiten, als die Förderung auf der Kippe stand, zu dem Preis gestanden. Das Besondere an der Zusammenarbeit mit ihm war unter anderem, dass er sich durch uns oder durch den einen oder die andere Preisträgerin auch zum Widerspruch anregen ließ, den er dann spontan, unter Nichtbeachtung seines Redemanuskripts vorgebracht hat. Manchmal waren dies dann kleine Sternstunden des politischen Diskurses in diesem ehrwürdigen Saal. Unser Dank geht auch an Bürgermeister Jens Böhrnsen, der die Stafette übernommen hat. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit. An dieser Stelle möchte ich auch der Heinrich Böll-Stiftung und ihrem Repräsentanten, Ralf Fücks, als der zweiten Geberseite herzlich danken. Für die Böll-Stiftung gilt erst recht, dass sie den Preis kritisch begleitet, dessen Unabhängigkeit jedoch stets unterstrichen hat. Hauptanlass des heutigen Abends ist, wie Sie wissen, die Würdigung unserer Preisträgerin. Deshalb lassen Sie mich nur kurz ins Spiel bringen, dass wir in diesen Tagen den 30. Todestag der Namenspatronin unseres Preises würdigen sowie den 10. Jahrestag der Stiftung des Preises begehen. Sehr verehrte Frau Vike-Freiberga, für Sie birgt der heutige Abend ein kleines Risiko. Denn wir haben ja in Kontakt mit Ihren Mitarbeitern und der Botschaft immer hervorgehoben, dass wir keine staatliche Organisation sind, sondern eine freie Initiative von WissenschaftlerInnen, PublizistInnen und KünstlerInnen, denen gemeinsam ist, dass sie das politische Nach-Denken im öffentlichen Raum fördern wolle und zwar auch und gerade das Nachdenken jenseits der schon beschrittenen Pfade. Und Sie mögen sich gefragt haben, welcher Couleur die Leute seien, die vom Staat und einer Partei gefördert werden und doch darauf beharren, dass sie was Besonderes sind. Wenn ich im Folgenden die Begründung der internationalen Jury für die Vergabe des Preises an Sie, verehrte Frau Vike-Freiberga vortrage, so blicke ich weniger auf ihr Amt als Staatspräsidentin, das Sie seit Jahren sehr erfolgreich innehaben, und ein bisschen mehr auf das, wodurch Sie dieses Amt lebendig machen. Und darum ging es auch in den Diskussionen der internationalen Jury. Ein gutes Stück Leben der Preisträgerin steht für die furchtbare und selbstzerstörerische Geschichte Europas im 20. Jahrhundert: Ihre Familie floh 1944 aus Ihrer Heimat und teilte für Jahre das Schicksal jener Flüchtlinge, von denen Hannah Arendt im mittleren Teil ihres Buches über die totale Herrschaft so luzide spricht: den Flüchtlingen, den Staatenlosen, die nirgendwo zu einer politischen Gemeinschaft, deren Schutz sie genießen, dazugehören. Die Nachwirkungen dieser Geschichte beschäftigen Europa immer noch, immer wieder und seit der Befreiung Mittel- und Osteuropas von der sowjetischen Herrschaft in einem neuen Lichte. Denn Lettland wie auch die anderen Ländern Mittel- und Osteuropas kritisieren immer wieder, dass die Erinnerungskultur Westeuropas – aus manchen Gründen – einäugig ist und dass die leidvollen Erfahrungen des Ostens Europas mit zu dieser Erinnerung gehören. Sie verlangen von uns, dass wir ihre Erfahrungen der Unterdrückung durch ein totalitäres Regime anerkennen, zumal es die Hälfte dieses Landes ja mit ihnen teilt. Und dies in voller Ansehung des Umstands, dass sich die totalitäre Sowjetunion einer großen Befreiungstat rühmen kann, nämlich der Teilhabe am alliierten Sieg über das nationalsozialistische Deutschland. Die paradoxe Gleichzeitigkeit von Befreiung und Unterdrückung in dieser geschichtlichen Erbschaft hat der Westen Europas in den vergangenen Jahrzehnten gerne verdrängt. In verblüffender Nähe zur Biografie von Hannah Arendt fand die Familie von Frau Vike-Freiberga nach Jahren der intermediären Existenz eine neue Dazugehörigkeit im nordamerikanischen Raum, in Kanada. Das politische Erbe der Freiheit in Kanada und den Vereinigten Staaten bringt Frau Vike-Freiberga seit vielen Jahren in den politischen Diskurs ein. Ihr Wirken, und das hört man in jeder ihrer Reden mit, steht für eine ideelle, politische und wirtschaftliche Einheit des westlichen politischen Raums. Immer spricht sie diesen Raum an als unseren gemeinsamen Raum, in dem wir denken und handeln. Und sie benennt seine Stützpfeiler: Freiheit und Menschenwürde, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, die Minderheitenrechte, Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern. Das heißt, Frau Vike-Freiberga artikuliert in ihrem Wirken sowohl die leidvolle Geschichte Europas, deren Erinnerungen sich gegenwärtig ineinanderschieben, mitunter auch aufeinanderprallen, als auch die politische Gemeinsamkeit des Westens, sein Erbe und seine Verpflichtung. Mit ihr wird es keine Debatte über europäische Identität gegen irgendeinen Teil des Westens, und seien es die Vereinigten Staaten, geben. Sehr wohl aber könnte man mit ihr über die Konflikte, die Einbrüche, die unterschiedlichen Erfahrungen innerhalb des Westens sprechen, und das heißt auch streiten. Ein weiteres Element, das die Jury hervorhob, ist ihr Wirken beim Aufbau des neuen Europa. Frau Vike-Freibergas Wirken steht für den politischen Aufbau eines geeinten Europa, in dem die Freiheitsliebe der Länder und Staaten Mittelund Osteuropas ein wichtiges Kapital, wenn nicht politisch gegenwärtig überhaupt das wichtigste Kapital ist. Es spricht mitunter eine freiheitsbeflügelte Frische aus ihren Reden, die man sich für manchen routinierten Politiker Westeuropas wünschen würde. Schließlich hat in der Debatte der Jury folgendes Moment eine Rolle gespielt: Es ist der politische und persönliche Mut als eine Tugend, über die wir seit der Antike immer wieder in neuem Gewande und gesättigt durch neue Erfahrungen belehrt werden. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Frau Vike-Freiberga in einer von manchen von uns bewunderten Art und Weise – und die Jury hob dies besonders hervor – die Pluralität Europas zum Anlass für offene Worte nimmt. Als nur ein Beispiel spreche ich Ihr Erscheinen im Mai 2005 in Moskau zur Feier des 50. Jahrestages des sowjetischen Sieges über das nationalsozialistische Deutschland an. Frau Vike-Freiberga hat in dieser sicher nicht einfachen Situation für Lettland, für die baltischen Staaten, für ganz Mittel- und Osteuropa gesprochen als eine Stimme, die darauf besteht, dass die Siegerseite die Geschichte der Unterdrückung nicht verdecken oder gar überlagern kann. Sie hat die mehr als sechzig Jahre politische Unterdrückung des Baltikums in einer Situation eingebracht, die ganz auf die glänzende Oberfläche staatlicher Siegesfeiern getrimmt war. Und sie hat mittelbar auch die andauernde Unterdrückung in Tschetschenien angesprochen als des vergessenen Landes, das noch immer in Brutalität und Anarchie zu versinken droht. Ein anderes Beispiel wäre ihre intervenierende Rolle im lettischen Sprachenstreit. Diesen Mut zur Freiheit, diese Bereitschaft zum kritischen Streitgespräch über die pluralen Perspektiven der historischen Erfahrung und der Gegenwart braucht es in Europa, braucht es im Westen – und braucht es im Umgang mit anderen politischen Kulturen dieser Welt. Frau Präsidentin, im Namen des Vorstandes und der Jury beglückwünsche ich Sie zum diesjährigen »Hannah-ArendtPreis für politisches Denken«.
Es ist eine große Freude für mich, aus Anlass dieser Preisverleihung das Wort an Sie zu richten! Ich darf Ihnen, liebe Frau Vike-Freiberga, zu der Ihnen heute zuteil werdenden Ehrung herzlich gratulieren. Die Vorbereitung auf diesen kleinen Beitrag ist mir nahe gegangen, denn es geht dabei um ein Thema, das auch mein Leben berührt. Mit dem Ende der kommunistischen Diktaturen in Europa waren endlich auch wieder die Stimmen der mittel- und osteuropäischen Länder im vielstimmigen europäischen Chor zu hören. Die Europäische Union hat davon profitiert: Sie ist mit dem Beitritt mehrerer dieser Länder nicht nur größer, sondern auch lebendiger und reicher geworden: an Menschen, an Kultur, an Landschaft, an Geschichte und Erfahrung. Deshalb spreche ich auch lieber von der Wiedervereinigung oder der Einheit Europas als von »Beitritt« oder »Osterweiterung«, technokratischen Begriffen, die das, was gesellschaftlich, politisch und kulturell mit diesem Ereignis verbunden ist, nicht annähernd wiedergeben. Das Wort »Beitritt« erinnert mich außerdem an manche Äußerungen von 1990, dem Jahr der Deutschen Einheit. Von »Osterweiterung der Bundesrepublik« war zwar nicht die Rede, es war aber so gemeint. Mit Rührung wurde von manchem Redner das »größer gewordene Deutschland« gefeiert. Das gab uns, den Ostdeutschen, zu denken. Wo eigentlich, fragten wir uns besorgt, hatten wir denn in den Jahren zuvor gelebt? Etwa nicht in Deutschland? Mit dem »Beitritt« war auch die Erwartung verbunden, dass »die alte Bundesrepublik« im Wesentlichen das bleiben könne, was sie war, nur eben größer. Verschiebungen des westdeutschen Koordinatensystems durch ostdeutsche Einflüsse wurden und werden mit Argwohn registriert, an Illustrationen und Anekdoten zu diesem Thema mangelt es nicht. Einiges scheint mir darauf hinzudeuten, dass die Gesellschaften der neuen EU-Mitglieder ähnliche Erfahrungen mit dem »alten Europa« machen. Für mich als Ostdeutsche hatte die Wiedervereinigung Europas noch eine zusätzliche Bedeutung, ich vermute sogar, dass ich aus diesem Grunde gebeten wurde, heute die Rolle der Laudatorin zu übernehmen. Ich musste auch nicht lange überlegen um zu antworten. Was für eine wunderbare Gelegenheit, öffentlich über die Zukunft der Vergangenheit in Europa zu sprechen und darüber, wie zwei Europäerinnen aus Ländern, die sich von Bremen aus gesehen jenseits des Eisernen Vorhangs befanden, darüber denken.Wir, die aus der DDR stammenden Deutschen, waren bis zum Mai vorigen Jahres die Einzigen in der EU, die Erfahrungen mit dem Leben in einer kommunistischen Diktatur gemacht hatten. Nun aber würden wir diesbezüglich keine Exoten mehr sein. Wir würden unsere Erinnerungen und Erfahrungen mit den Gesellschaften Mittel- und Osteuropas teilen können. Und wir würden sie gemeinsam Westeuropa mitteilen können. Uns verbindet, dass die Hoffnungen auf Freiheit, die die Menschen nach dem Ende des Krieges und der Befreiung vom Nationalsozialismus hatten, bitter enttäuscht wurden: Mehr als vier Jahrzehnte sollten bis zum Ende der kommunistischen Diktaturen noch vergehen. Vier Jahrzehnte der Unfreiheit, aber auch des Widerstands gegen Diktatur und Fremdherrschaft, der Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung. Und immer wieder blutig niedergeschlagene Aufstände. Rebellion und Opposition gab es von Anfang an – die antikommunistischen Freiheitsbewegungen zwischen 1917 und 1989/91 gehören zum Besten, was die europäische Freiheitsgeschichte aufzubieten hat. Ich weiß mich mit Ihnen, Frau Präsidentin, einig in der Hoffnung, dass die Erfahrungen unserer Länder mit der kommunistischen Herrschaft vom Westen endlich wahr- und ernst genommen werden mögen. Die Ära des Kommunismus war weder eine Randerscheinung noch eine Fußnote der europäischen Geschichte. In den von Krieg und Naziherrschaft geschwächten Nationen Mittelund Osteuropas hatten vier Jahrzehnte kommunistischer Diktatur verheerende Folgen. Für die Gesellschaften, für Wirtschaft und Kultur und für zahllose Menschen, die als politische Gegner verfolgt wurden oder ihr Leben einfach nur deswegen lassen mussten, weil sie den Machthabern im Wege waren. Das europäische Gedächtnis muss diese Erfahrungen und Erinnerungen einschließen – nicht nur, weil Europa den Bürgerinnen und Bürgern dieser Länder Respekt und Anerkennung schuldet, sondern um aller Europäer willen. Ein freies und demokratisches Europa kann es sich – um der Freiheit und der Demokratie selber willen – nicht leisten, diese Erinnerungswelten abzuspalten. Stabile Demokratien existieren und funktionieren auf der Grundlage einer kollektiven Identität. Dies gilt auch für Europa. Die europäische Demokratie braucht Menschen, die sich nicht nur als Ungarn, Niederländer, Letten oder Deutsche begreifen, sondern auch als Bürgerinnen und Bürger Europas. Dies entwickelt sich langsam. Man kann es befördern, aber nicht erzeugen. Ein afrikanisches Sprichwort scheint mir dazu zu passen: Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Für die Entwicklung einer europäischen Identität sind die Aneignung europäischer Geschichte und eine allmählich entstehende gemeinsame Geschichtskultur unerlässlich. Hierbei geht es um »geronnene« Geschichte, also nicht nur um eine Ansammlung präziser Erinnerungen, sondern auch um Deutungen und Bedeutungen. Mit welchen Begrifflichkeiten ein Ereignis, eine Epoche in das kollektive Gedächtnis eingeht, sagt viel aus, weil mit jedem Begriff auch ein Deutungsangebot transportiert wird. Es ist zum Beispiel durchaus von Belang, ob im Herbst 1989 in der DDR eine demokratische Revolution stattfand oder einfach nur eine »Wende« – wie Egon Krenz es ausdrückte.
Geronnene Geschichte, das ist Geschichtskultur. Dazu gehören nicht nur die Erkenntnisse und Codierungen der Historiker, sondern auch Gedenktage und Gedenkorte; die Straßen mit den Namen der Opfer und der Helden; die kollektiven Erfahrungen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden: Erfahrungen der Not und der Befreiung, der Demütigung und der Genugtuung; die Hymnen und die Mythen – ja, und auch die Tabus. Für die Europäische Union in ihrer heutigen Gestalt ist eine solche gemeinsame Geschichts- und Erinnerungskultur erst im Entstehen. Das Unglück, das Deutschland unter der Herrschaft der Nationalsozialisten über Europa gebracht hat, ist tief in das kollektive Gedächtnis aller europäischen Völker eingebrannt. Die westeuropäische Geschichtskultur ist durch diese Katastrophen und ihre Verarbeitung geprägt. Die Integration der westeuropäischen Länder beruht nicht zuletzt darauf, dass die Demokratien Europas Deutschland die Hand zur Verständigung und Versöhnung reichten. Ohne sichtbare Zeichen dafür, dass Deutschland seine Schuld bekannte und sich glaubwürdig damit auseinander setzte, wäre dies nicht möglich gewesen. Die in der DDR aufwachsende Nachkriegsgeneration, zu der ich gehöre, hatte an dieser Entwicklung wenig Anteil. Allenfalls Minderheiten entwickelten ein alternatives Geschichtsbild. Die DDR galt als die Heimstatt der antifaschistischen Widerstandskämpfer und der Opfer. Die Nazis, hieß es, lebten im Westen. Die DDR war damit exkulpiert – und deshalb bedurfte es offiziell weder der Versöhnung mit den östlichen Nachbarn noch einer besonderen Verantwortung gegenüber den Überlebenden des Holocaust. Das zionistische Israel gehörte nach SED-Lesart zum Lager des Klassengegners, auf der anderen Seite waren unsere östlichen Nachbarn per Dekret zu Brudervölkern geworden. Versöhnung konnte es so nicht geben. Sie setzt das Eingeständnis von Schuld, das Bewusstsein von Verantwortung und die freie Entscheidung voraus. Schuld jedoch gab es nur auf Seiten des imperialistischen Klassengegners, und an Verantwortung und Freiheit mangelt es in Diktaturen. Die so genannten Brudervölker lebten unversöhnt nebeneinander her. Erst jetzt, seit ihrer Befreiung vor 16 Jahren, sind die Völker des früheren Ostblocks wirklich in der Lage, als Freie und Gleiche aufeinander zuzugehen. Erst jetzt können sie miteinander und mit den westeuropäischen Ländern in das Gespräch über ihre Vergangenheit eintreten, können über gemeinsam erfahrenes Leid sprechen und über das Leid, das sie einander zugefügt haben. Den damit verbundenen Schmerz und mögliche Missverständnisse haben wir schon kennen gelernt, wir werden ihn auch künftig in Kauf nehmen müssen. Doch billiger ist Versöhnung nicht zu haben. Es hat mich sehr berührt, Frau Präsidentin, wie selbstbewusst und nachdenklich Sie in Ihrer Erklärung zum diesjährigen Europatag Russland die Hand zur Freundschaft gereicht haben. Ihre damit verbundene Erwartung an Russland, sich zu dem Unrecht der Unterwerfung Mittel- und Osteuropas zu bekennen, ist angemessen und verdient die Unterstützung der Länder der Europäischen Union. Ich sage dies im Bewusstsein dessen, dass es im Verhältnis zu Russland zwischen uns erhebliche und begründete Unterschiede gibt. Auch in Deutschland hat die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone die kommunistische Herrschaft mit äußerst harter Hand durchgesetzt. Haftkeller und Lager füllten sich mit Menschen, die der Errichtung einer neuen Diktatur tatsächlichen oder vermeintlichen Widerstand entgegensetzten. Zehntausende starben in den sowjetischen Speziallagern, andere wurden in die russischen Lager verschleppt. Die Opfer, die zu Zeiten der DDR schweigen mussten, dürfen nun reden. Doch ehrlicher Umgang mit der Geschichte heißt für uns Deutsche, das, was in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR durch die Russen geschah, auch immer im Zusammenhang mit dem Überfall Deutschlands auf seine Nachbarn und auf die Sowjetunion sehen zu müssen. Am 10. April dieses Jahres wurde in Weimar an die Befreiung der Konzentrationslager vor 60 Jahren erinnert. Lassen Sie mich zitieren, was Jorge Semprun, ehemaliger Häftling im nahe gelegenen KZ Buchenwald, bei dieser Gelegenheit sagte: »Der kürzlich erfolgte Beitritt von zehn neuen Ländern aus Mittel- und Osteuropa – dem anderen Europa, das im sowjetischen Totalitarismus gefangen war – kann kulturell und existenziell erst dann wirksam erfolgen, wenn wir unsere Erinnerungen miteinander geteilt und vereinigt haben werden. Hoffen wir, dass bei der nächsten Gedenkfeier in zehn Jahren, 2015, die Erfahrung des Gulag in unser kollektives europäisches Gedächtnis eingegliedert worden ist. Hoffen wir, dass neben die Bücher von Primo Levi, Imre Kertész oder David Rousset auch die ›Erzählungen aus Kolyma‹ von Warlam Schalamow gerückt wurden. Das würde zum einen bedeuten, dass wir nicht länger halbseitig gelähmt wären, zum anderen aber, dass Russland einen entscheidenden Schritt auf dem Weg in die Demokratisierung getan hätte.« Wenn wir über unsere Vergangenheit reden, geht es uns in Wahrheit um die Zukunft. Zuversicht und Freude über das Geschenk der Freiheit halten sich allerdings bei nicht wenigen Ostdeutschen in Grenzen. Dieser Miss-Mut scheint mir eine Spätfolge enttäuschter Erlösungsideen zu sein. Wie gerne wären wir doch nach Jahrzehnten der Fremdbestimmung und des Mangels im gelobten Land angekommen, dort, wo Milch und Honig fließt! Doch unsere Welt ist mit dem Ende der kommunistischen Herrschaft zwar besser geworden, aber nicht gut. Es zeigt sich, dass Freiheit und Demokratie keine sicheren Besitzstände sind, sondern gepflegt und geschützt werden müssen: vor Terrorismus, vor hypertrophem Sicherheitsdenken, vor Nationalismus und vor Korruption, diesem gesellschaftlichen Krebsgeschwür, das demokratische Strukturen schwächt und insbesondere in Ländern mit ungefestigten demokratischen Traditionen verheerende Wirkungen hat. Wir haben die Freiheit gewonnen, aber wir werden sie immer wieder gewinnen müssen. »Sag, wann haben diese Leiden endlich mal ein Ende?«, heißt es in dem Biermann-Lied »Große Ermutigung«. Die Antwort des Liedes: »Wenn die neuen Leiden kommen, haben sie ein Ende.« Angesichts neuer Herausforderungen und Bedrohungen erfährt das Bemühen um eine lebendige europäische Geschichtsund Erinnerungskultur eine weitere Begründung: In der Geschichte der europäischen Freiheitsbewegungen des 20. Jahrhunderts spiegeln sich die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit ebenso wie der Mut und die Beharrlichkeit, mit der sie darum gekämpft haben. Wenn Europa in dieser Geschichte sein wertvollstes Erbe sieht, dem gegenüber wir auch künftig verpflichtet sind, müssen wir uns um die freiheitliche Grundausstattung Europas wenig Sorgen machen. – Ich freue mich, dass der heute verliehene Preis diesem Anliegen Gewicht verleiht.
Mit großer Überraschung und großer Freude habe ich von der Entscheidung erfahren, den diesjährigen Hannah-ArendtPreis für politisches Denken an mich zu vergeben. Ich fühle mich äußerst geehrt, tief gerührt und dankbar darüber. Ich glaube, es ist in einem gewissen Sinne paradox, dass ich mit einem solchen Preis ausgezeichnet werde. Hannah Arendt hat die Überzeugung vertreten, dass »der Sinn von Politik Freiheit« ist und dass diese im aktiven Handeln zu erleben ist. Ich hingegen hatte der Politik die meiste Zeit meines Lebens bewusst den Rücken zugekehrt. Ich sah in ihr keinen Sinn, keinen Spielraum und keine Hoffnung in meiner Zukunft, da meine Heimat ihre Unabhängigkeit verloren hatte und ich in meiner damaligen Wahlheimat Kanada nie die politischen Möglichkeiten eines gebürtigen Staatsbürgers genießen würde. Deswegen habe ich die meiste Zeit meines Lebens der Wissenschaft, Forschung und Lehre gewidmet. Zwar war ich von Zeit zu Zeit mit Politik, Gestaltung und Administration konfrontiert, vorwiegend jedoch »nur« mit Denken und Kontemplation beschäftigt. Durch die Wiederbefreiung meines Landes habe ich das Glück mitzuerleben, wie Freiheit in politisches Handeln umgesetzt wird, und mitzuwirken an politischen Entscheidungen, deren Folgen nachhaltig sind und die sogar über die Grenzen meines Landes hinauswirken. Während meiner frühen Kindheit in Lettland wurde meine Heimat von fremden Mächten besetzt – zuerst 1940 aus dem Osten, von der Sowjetunion, dann 1941 aus dem Westen, vom nationalsozialistischen Deutschland, und schließlich, 1944 und 1945, abermals aus dem Osten. Krieg, Invasion, brutale Okkupation und unwürdige Unterjochung waren die Gegenstände der geflüsterten Gespräche der mich umgebenden Erwachsenen, aber auch nostalgische Erinnerungen an die verlorene Unabhängigkeit Lettlands. Es konnte keine Politik geben unter der Gestapo oder unter dem KGB. Die Leute in meiner Heimat versuchten, sich so unauffällig wie nur irgend möglich zu verhalten, in der Hoffnung zu überleben, ohne als Feinde oder als Kollaborateure des jeweiligen Systems gebrandmarkt zu werden. In beiden Fällen riskierten sie ihr Leben, sei es unter dem jeweils herrschenden System oder unter dem darauf folgenden. Schockiert und ungläubig verfolgten weite Teile der Bevölkerung, wie Zehntausende friedlicher Zivilisten verhaftet, deportiert, gefoltert oder ermordet wurden, wie mehr als einhundertzwanzigtausend Männer und Jungen von beiden Okkupationsmächten an die Front geschickt wurden, um ihnen als Kanonenfutter zu dienen. Während über unseren Köpfen die Bomben fielen, sehnte ich mich nach jenen Tagen, »da die Friedensglocken läuten«, wie ich die Worte eines Psalms in Erinnerung behalten hatte, den wir in der Kirche gesungen hatten. Als der Frieden dann jedoch kam, hatte mein Heimatland seine Unabhängigkeit und meine Nation ihre Freiheit verloren, ebenso wie das übrige Mittel- und Osteuropa. Die westliche Hälfte Europas konnte ihre Befreiung von fremder Besatzung und den Niedergang der nationalsozialistischen und faschistischen Regime feiern. Der Westen konnte ein neues Kapitel aufschlagen und den Wiederaufbau beginnen. Die andere Hälfte Europas blieb in der Gefangenschaft der kommunistischen Tyrannei und wurde als Gefangener gehalten hinter dem sehr treffend so bezeichneten Eisernen Vorhang.
Politik ist ein sozialer Prozess, in dem eine Nation die Freiheit nutzt, ihre eigenen gemeinsamen Ziele zu stecken, die Freiheit, ihre eigenen gemeinsamen Entscheidungen zu treffen und die Freiheit, von den Früchten dieser Entscheidungen zu leben. Das Recht, sich aktiv am politischen Prozess zu beteiligen, muss das unveräußerliche Gut eines jeden Bürgers eines freien, unabhängigen und demokratischen Staates sein. Ist ein Land durch eine fremde Macht okkupiert oder auch nur annektiert, so ist das Volk seiner politischen Urrechte beraubt. In einem Land, das von Fremden beherrscht wird, kann es keine wahre Politik geben, sondern lediglich ihre Imitation. Für diejenigen, die aus einem solchen Land fliehen, gibt es ebenfalls keine Möglichkeit, wahre Politik zu betreiben, weil sie ihr Land nicht mehr regieren oder zumindest beeinflussen oder verändern können durch ihr Lebenswerk. So schrieb der Dichter Rainis bereits nach der Revolution von 1905 in seinem Schweizer Exil: »Land, o Land, was ist ein Land, Wenn man keine Freiheit hat; Freiheit, Freiheit, was ist Freiheit, Ist man ohne eignes Land.« Als meine Eltern mit mir ins Exil gingen, taten sie dies aus Protest gegen die militärische Okkupation durch ein fremdes Land und gegen die Erniedrigung und Verfolgung von allem, was ihnen teuer war. Sie haben der sicheren Gefahr gegenüber der Hoffnung auf Sicherheit den Vorzug gegeben, weil sie ihre Hoffnung auf Freiheit höher schätzten als die Sicherheit der Unterdrückung. Als eine Konsequenz ihrer Entscheidung habe auch ich damals meine Heimat verloren, mein Erbe und meine politischen Urrechte als gebürtige Staatsbürgerin. Die lettische Nation und ihre Nachbarn haben dies alles verloren durch die Machtkämpfe zwischen den Tyrannen und den Großen jener Zeit, aber auch durch die Abkommen, die damals – über unsere Köpfe hinweg und hinter unserem Rücken – während der Konferenzen von Teheran und Jalta getroffen wurden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben die Flüchtlinge aus Osteuropa weniger über Politik diskutiert als sie im wahrsten Sinne des Wortes gelebt. Wir waren im politischen Exil. Wir sahen unser Dasein im Westen als eine lebende Anklage gegen den Kommunismus, als lebenden Protest gegen die widerrechtliche Besatzung unseres Landes. Wir hatten die Empfindung, durch unser Handeln und unser Leben an sich ein ungemein wichtiges politisches Statement zu machen. Es hat lange Zeit gedauert, bis wir begriffen, dass niemand wirklich daran interessiert war, unsere Botschaft zur Kenntnis zu nehmen. Hannah Arendt hat über die Freiheit geschrieben, die das Exil bietet – und auch über deren sehr hohen Preis. Da ich im Exil aufwuchs, begriff ich es als die Herausforderung meines Lebens, die Vorteile dieser Freiheit zu maximieren und ihren Preis zu minimieren. Dies stand auf dem Fond zu der Einstellung meiner Eltern und meiner ersten Lehrer, die es als moralische Pflicht empfanden, unsere lettische Identität zu bewahren, unabhängig davon, ob es dort andere Letten gab, mit denen man sich hätte austauschen können, und unabhängig davon, ob wir jemals nach Lettland zurückkehren würden. Es war ein Akt des Trotzes gegenüber jenen Mächten, die danach trachteten, alles spezifisch Lettische zu vernichten. Und für meine Eltern war es auch eine Frage des persönlichen Stolzes. Das Aufgeben der eigenen Identität käme einem Eingeständnis gleich, dass sie gegenüber anderen minderwertig sei, es hätte den Verrat an den Vorvätern wie auch am ureigensten Wesen bedeutet. Die Generation meiner Eltern erzog ihre Kinder patriotisch – in dem Sinne, ihr Heimatland von ganzem Herzen zu lieben und ihr ganzes Leben dem Wohle ihrer Nation zu widmen.
Das Europa, in dem meine Generation aufwuchs, wurde weder von Vernunft noch von Recht noch von Gerechtigkeit regiert. Es gab lediglich Armeen, brutale Gewalt, willkürliche Zerstörung, und Millionen von Menschen wurden willkürlich umhergetrieben wie abgerissene Blätter im Sturm. Und schon als kleines Kind begriff ich, was diese Welt zusammenhielt: erstens Waffengewalt, zweitens die Gewalt der Angst und Einschüchterung, und drittens der Überlebensinstinkt und das Anpassungsvermögen, die ein Teil unseres biologischen Erbes sind. Wenn er gezwungen ist, passt der Mensch sich an fast alles an. Denn wenn er es nicht tut, geht er zugrunde. Ein verstörender Aspekt einer Kultur, eines Kultes der Gewalt, ist ihre Fähigkeit, Menschen zu korrumpieren. Es ist verstörend, die Genugtuung zu sehen, die sich manche Menschen dadurch verschaffen können, indem sie Macht über andere haben. Es ist dermaßen verstörend, dass wir oftmals unsere Blicke abwenden und vorgeben, es nicht zu sehen. Die Schlägertypen auf dem Schulhof haben Spaß an dem, was sie tun. Sie verschaffen sich eine tatsächliche Befriedigung und Erregung dadurch, dass sie kleinere Kinder terrorisieren und schlagen. Die Männer, die ihre Frauen schlagen, genießen es, sich zu betrinken und ihre Frustrationen durch ihre Fäuste abzureagieren, ohne sich schuldig zu fühlen, denn wenn sie wieder nüchtern sind, pflegen sie zu behaupten, sich an nichts erinnern zu können. Es ist dies etwas vollkommen anderes als die Banalität des Bösen, die Hannah Arendt in Eichmann erkannte, aber auch dies ist furchtbar genug. Überall – im Alltag, an ganz einfachen Menschen – kann man die Keime sehen, die es jemandem erlauben, sich in einen Tyrannen zu verwandeln, wenn die Umstände es zulassen und der oder die Betreffende schlau genug ist, sie auszunutzen. Es ist ein verhängnisvoller Weg, wenn die sadistische Neigung, nicht nur anderen seinen Willen aufzuzwingen, sondern andere vorsätzlich zu quälen, dermaßen berauschend wird, dass sie zu einer profanen Sucht gerät. Dann wird die Macht um ihrer selbst willen benutzt, als eine Krücke für ein armseliges und unsicheres Ego, die klaffende, gähnende Leere der Seele eines Größenwahnsinnigen. Denken Sie in diesem Kontext auch an Nero oder Caligula, nicht nur an Hitler oder Stalin. Und schließlich gibt es da den perversen Durst nach Macht, der jene packt, die von Fanatismus und eigennützigen Ideologien ergriffen sind. Dies trifft wiederum auf Hitler zu, aber auch auf Torquemada und Savonarola, auf Osama bin Laden und die terroristischen Vereinigungen der heutigen Zeit. Was ich damit sagen will, ist, dass die Tyrannei weder zu einem bestimmten Ort noch zu einer bestimmten Zeit noch zu einem bestimmten Menschen gehört. Deren Möglichkeit und Risiko liegen tief in der menschlichen Seele. Das heißt, dass die Demokratie eine ganz zarte Blume ist, die wir immer aufmerksam beschützen und pflegen müssen, sonst ist sie in Gefahr. Merkwürdig in diesem Kontext ist auch, wie viele Intellektuelle, Philosophen, Schriftsteller und Dichter die schlimmsten Tyrannen unterstützen, bewundern und verteidigen. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Glücklicherweise gibt es auch viele Menschen, die zwar Macht über andere haben, dies jedoch aufgrund der Möglichkeit schätzen, Dinge auf eine Art und Weise tun zu können, von deren Richtigkeit sie überzeugt sind. Dies ist eine zielorientierte, instrumentelle Macht, die – im Idealfall – im Dienste übergeordneter Ziele oder Werte angewandt wird. In einer demokratischen Gesellschaft wird die Macht delegiert und somit legitimiert. Zudem ist sie über die gesamte Gesellschaft verteilt, sodass nirgendwo Anhäufungen oder Defizite von Macht entstehen – und auch keine großflächigen Ausgrenzungen. Solange Hierarchien existieren, werden sie durch weitreichende horizontale Netzwerke gestützt, innerhalb derer die Menschen in ihrem eigenen Kompetenzbereich volle Verantwortung tragen – mit dem kleinstmöglichen Eingriff von oben, der erforderlich ist, um ein allgemeines Funktionieren zu gewährleisten. In totalitären Systemen wiederum ist die Macht in den Händen eines Tyrannen konzentriert. Das Erstaunliche an solchen Systemen ist die Frage, wie sie es schaffen, so mächtig zu werden und sich oftmals auch noch für sehr lange Zeit an der Spitze zu halten. Ich denke, eine der möglichen Antworten liegt darin, dass viele Tyrannen wahrhafte Genies darin sind, Macht, Privilegien und Profite exakt in der richtigen Dosierung unter ihre Anhänger zu verteilen, dass diese – jeder auf seinem eigenen Gebiet – ihr ganz persönliches Interesse daran haben, den Tyrannen an der Macht zu halten. Nero und Caligula waren überaus grausam; nur wurde der Schaden, den sie anrichteten, weitgehend neutralisiert durch legale und Verwaltungsstrukturen eines gut geölten Imperiums, die ungeachtet der Idiotie des Herrschers weiterhin funktionierten. Hitler und Stalin haben neue Maßstäbe für Tyrannei gesetzt, weil sie höchste Sorgfalt darauf verwandten, jeglichen Hort der Menschlichkeit in der Gesellschaft, der sich auch nur als die geringste Behinderung ihrer Launen und Forderungen erweisen könnte, niederzumachen. Es gibt einen Spruch, der Stalin zugesprochen wird und der seine »Politik« auf den Punkt bringt: »Ist da ein Mensch, ist da ein Problem; kein Mensch – kein Problem.« Dieser bei der Durchsetzung des Willens eines Diktators so gut funktionierende Ansatz funktioniert überhaupt nicht, wenn er auf den Diktator selber angewandt wird. Es wäre viel zu einfach zu sagen: »Ihr hattet einen Hitler, da hattet ihr ein Problem; als ihr keinen Hitler mehr hattet, war auch das Problem vom Tisch.« Es mag im Nachkriegsdeutschland so ausgesehen haben, vor allem nach der Währungsreform und der immensen Hilfe durch den Marshall-Plan. Es war jedoch nicht der Tod Hitlers, der Deutschland von Wahnsinn und Tyrannei befreite. Es war die Niederlage in dem von Deutschland selber angezettelten Krieg, es war der Niedergang der NSDAP, es waren die Nürnberger Prozesse, es waren die weltweite Verurteilung und Diskreditierung der nationalsozialistischen Ideologie, des Fundaments, auf dem das »Dritte Reich« errichtet worden war. Umgeben von Rauch und Trümmern, frierend, hungernd, obdachlos, besiegt und erniedrigt, erkannten Millionen von Deutschen ihre Verirrungen, schlugen eine neue Seite im Geschichtsbuch auf, fingen noch einmal ganz von vorne an – und machten es besser als jemals zuvor. Im Gegensatz dazu gab es in der Sowjetunion, wo man vom Sieg der Alliierten über den Nationalsozialismus wie geblendet war, nichts als Triumph und Selbstzufriedenheit – und eine Verstärkung des Würgegriffs einer blutigen Tyrannei, die Hunderte Millionen von Menschen in ihrer Gewalt hielt. Ende der Achtzigerjahre wagten es einige lettische Intellektuelle, Auszüge aus Hannah Arendts Hauptwerk The Origins of Totalitarianism zu veröffentlichen, um die lettische Nation über das Wesen des Totalitarismus philosophisch aufzuklären und sein Freiheitsbewusstsein zu befördern. Die Übersetzung wanderte in Form von Kopien von Hand zu Hand, denn die Werke Hannah Arendts ebenso wie die Werke anderer westlicher Denker wurden in der Sowjetunion weder gewürdigt noch verlegt. Ich denke, eine derart effektive, schnelle und umfassende »Volksschule« demokratischer und philosophischer Ideen, wie es sie während jener Zeit im Baltikum gab, ist eine einzigartige Erscheinung.
I ndem sie den sowjetischen Totalitarismus auf gewaltlose Weise überwanden, haben Lettland, Estland und Litauen auch einen Wertesieg errungen. Unsere Völker standen für eben jene Werte ein, die der Europäischen Union seit ihren ersten Anfängen bewusst machten, dass es sich bei ihr um eine Wertegemeinschaft handelt. Bereits im ersten europäischen Integrationsvertrag, durch den im Jahre 1951 die »Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl« gegründet wurde, bekräftigten die Mitgliedsstaaten ihre Entschlossenheit, »an die Stelle der jahrhundertealten Rivalitäten einen Zusammenschluss ihrer wesentlichen Interessen zu setzen, durch die Errichtung einer wirtschaftlichen Gemeinschaft den ersten Grundstein für eine weitere und vertiefte Gemeinschaft unter den Völkern zu legen, die lange Zeit durch blutige Auseinandersetzungen entzweit waren, und die institutionellen Grundlagen zu schaffen, die einem nunmehr allen gemeinsamen Schicksal die Richtung weisen können«. Obgleich die neue Europäische Verfassung in Frankreich und den Niederlanden abgelehnt wurde, enthält deren erster Artikel eine umfassende Referenz auf mehrere Werte, die sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU gemeinsam sind: Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Die Gesellschaften der Mitgliedsstaaten werden charakterisiert durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern. Die mit der Wertefrage aufs Engste verbundene Frage einer gemeinsamen europäischen Identität hat eine mindestens dreißigjährige Geschichte. Auf der Kopenhagener Konferenz im Dezember 1973 tauchte zum ersten Mal die Frage einer gemeinsamen europäischen Identität auf der Tagesordnung auf; die Vorstellungen von einer solchen blieben jedoch auf einem sehr allgemeinen Niveau. Erst zehn Jahre später wurden politische Handlungsvorgaben formuliert, durch deren Umsetzung eine gemeinsame europäische Identität erst herausgebildet werden kann. Dabei wurde das »Bewusstsein eines gemeinsamen Kulturerbes« als wichtigster Bestandteil bei der Herausarbeitung dieser Identität betrachtet. In den Achtzigerjahren stand die Herausarbeitung einer gemeinsamen Identität mit der gemeinsamen Bildungspolitik der Europäischen Gemeinschaft im Zusammenhang. Seit den Neunzigerjahren wiederum begann man den Begriff einer gemeinsamen europäischen Identität anzuwenden, wenn von der Notwendigkeit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik die Rede war. Im Vertrag von Maastricht heißt es, die europäische Identität und Eigenart müsse in der weltpolitischen Arena zum Tragen kommen. Dies wurde auch am Vorabend der EU-Erweiterung im Jahre 1996 auf der Zwischenregierungskonferenz in Amsterdam betont. Seit den Neunzigerjahren wird dem Thema Identität immer größere Bedeutung beigemessen, was die Sorge hinsichtlich einer immer größer werdenden Europa-Skepsis widerspiegelt. Diese wird durch Meinungsumfragen verdeutlicht, die das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen zu Region, Staat und Europa zum Gegenstand haben. Die Idee einer gemeinsamen europäischen Identität hat sich gleichzeitig mit dem eigentlichen europäischen Integrationsprozess entwickelt. Zu Anfang dieses Integrationsprozesses, als die Europäische Gemeinschaft vom Wirtschaftsgedanken geprägt war, gab es bezüglich der Thematik einer gemeinsamen europäischen Identität lediglich ein rein wissenschaftliches Interesse. Heute hingegen, da die EU sich zu einer Gemeinschaft der Politiken entwickelt, bedarf die EU-Politik in immer höherem Maße der Unterstützung und Mitarbeit ihrer Bürger. Entscheidungen, die früher auf nationaler Ebene getroffen wurden, werden im Zuge der voranschreitenden Integration immer häufiger auf europäischer Ebene getroffen. Um eine tatkräftige politische Einheit zu werden – sowohl in der Innen- wie in der Außenpolitik –, benötigt Europa auf das Dringendste die Bereitschaft seiner Bürger, sich an den Integrationsprozessen zu beteiligen, indem sie die auf europäischer Ebene getroffenen Entscheidungen akzeptieren und unterstützen. Für das erfolgreiche Fortkommen des Projektes Europa bedarf es einer Identität, die umfassender ist als ein Verständnis hinsichtlich gemeinsamer Interessen. Eine gemeinsame Identität ist die Voraussetzung für eine wahrhaft solidarische und demokratische Gemeinschaft. Ohne Zweifel würde ein konstitutioneller Vertrag hierfür eine neue Etappe bedeuten. Heute sind wir gezwungen festzustellen, dass in Europa nicht alles wie am Schnürchen läuft. Frankreich und die Niederlande haben die neue Europäische Verfassung abgelehnt. Das ist bedauerlich, und es ist wichtig zu begreifen, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Das »Nein« Frankreichs und der Niederlande ist nicht allein mit einer Unzufriedenheit mit den nationalen Regierungen zu erklären. Viele Bürger Europas sind auch mit Europa unzufrieden. In Frankreich werden oft kritische Stimmen laut, die bemängeln, Europa folge dem angelsächsischen Wirtschaftsmodell. Und vielen von jenen, die mit »Nein« gestimmt haben, erscheint Europa als zu liberal. Das »Nein« der Niederlande hat seine Ursache in Fragen wie die potenzielle EU-Mitgliedschaft der Türkei, die Immigration und die Höhe des niederländischen Beitrags zum EU-Budget. Ohne Zweifel hat das niederländische Ergebnis des Referendums das französische »Nein« stark beeinflusst. Welche Schlussfolgerungen können wir aus diesen negativen Ergebnissen ziehen?
Wie Meinungsumfragen belegen, besteht ein sehr großer Unterschied zwischen den Gedanken der europäischen Bürger zur Integration und denjenigen der Politiker. Die Politiker in Brüssel wie in anderen europäischen Hauptstädten sind sich sehr bewusst darüber, dass Europa nötig ist, um Antworten auf die Herausforderungen der globalisierten Weltwirtschaft zu finden. Wenn die Abstimmung über die Europäische Verfassung in der Französischen Nationalversammlung stattgefunden hätte, dann hätten 85 Prozent der Abgeordneten dafür gestimmt. Wie kann dieser immense Unterschied der Wahrnehmung Europas zwischen den Politikern und den Wählern überwunden werden? Wie kann eine gemeinsame europäische Identität befördert werden, die auf gemeinsamen Werten gründet? Wie kann ein europäisches Selbstbewusstsein befördert werden, das die Europäer als eine politische Nation konsolidiert? Bronislav Geremek hat einmal gesagt: »We do have Europe, now we are in need of Europeans« (was übrigens die Paraphrase eines Ausspruchs von Massimo d’Azeglio zum italienischen Vereinigungsprozess aus dem Jahre 1870 ist: »Jetzt, da wir Italien erschaffen haben, müssen wir die Italiener erschaffen. …« Europa ist Teil unseres Alltags, es ist regelmäßig Thema der innenpolitischen Debatten – die internen Arbeitsmethoden der EU, die Verwirklichung ihrer Politik jedoch sind den Bürgern unverständlich geblieben. Die in den fünfzig Jahren seines Bestehens geschaffene Symbolik des europäischen Bündnisses ist überaus bescheiden: eine Fahne, eine Hymne und einige gegenständliche Zeichen – Pässe, Briefmarken und Hinweisschilder an Grenzübergängen. Das Manko an Symbolen steht für einen Mangel an einheitlicher politischer Konzeption. Es gibt eine unablässige Konfrontation zwischen verschiedenen kulturellen und politischen Identitäten. Derzeit divergiert das Verständnis darüber, was ein Staat ist. Es besteht ebenso ein gravierender Unterschied zwischen den jakobinischen Traditionen Frankreichs und den föderativen Traditionen Deutschlands wie zwischen dem britischen Parlamentarismus und dem französischen Präsidentialsystem. Gleichzeitig belegte im Juli 2004 eine Euro-Barometer-Umfrage über die Wahlen zum Europäischen Parlament, dass sich nichtsdestotrotz über zwei Drittel (nämlich 69 %) der Bürger als Europa zugehörig und fast ebenso viele (66 %) als EU-Bürger fühlen. Insgesamt zwei Drittel der Europäer –in den neuen Mitgliedstaaten mehr als in den alten – befürworten die Idee einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Eine noch größere Befürwortung durch die Bürger (nämlich 80 %) hat eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Vorläufig jedoch ist es so, dass auf diesen Gebieten Einstimmigkeit erreicht werden muss, damit Entscheidungen getroffen werden können. Die einstimmige Abstimmung erschwert das Treffen von Entscheidungen, und somit besteht das Risiko, dass die Politik nicht effektiv ist und nicht in der Lage, ausreichend schnell auf internationale Vorkommnisse zu reagieren. In den letzten sechzig Jahren hat Europa eine immense Aufgabe bewältigt. Es hat den Europäern eine in der europäischen Geschichte noch nie da gewesene lange Periode des Friedens und der Sicherheit beschert, es vermochte die ein halbes Jahrhundert währende Spaltung Europas zu überwinden, indem es Ost- und Westeuropa vereinte. Der »Bau Europas« ist dabei jedoch in erster Linie die Aufgabe von Politikern gewesen, und die europäischen Bürger haben sich im Stillen mit dieser Tatsache abgefunden. Im Hinblick auf die Aufgaben, die Europa heute zu bewältigen hat, ist deutlich, dass die bisherige Methode des »Baus Europas« – indem man ihn Politikern und Beamten überlässt – nicht mehr effektiv noch akzeptabel ist. Die gemeinsame Gestaltung einer europäischen Identität ist zu einem der wichtigsten Ziele der europäischen Politik avanciert, denn nur so vermag Europa diejenigen Aufgaben zu bewältigen, vor die seine Bürger es gestellt sehen.
I n der Geschichte der Europäischen Union gab es zahlreiche Krisen, und es ist charakteristisch für die Europäer, etwas pessimistisch in die Zukunft zu blicken. Im Jahre 1953 hat Harold MacMillan einmal gesagt: »Europa ist am Ende, es stirbt. Wäre ich jung, dann würde ich nach Amerika emigrieren.« Ich hingegen hätte es im Jahre 1998 so formuliert: »Europa steht vor einem neuen Anfang, es ersteht neu, und obwohl ich nicht mehr jung bin, kehre ich aus Amerika dorthin zurück.« Und auch heute möchte ich mit meiner vollen Überzeugung schließen, dass die bereits erweiterte Europäische Union kreative und effektive Antworten auf sämtliche Herausforderungen, die ihr bevorstehen, zu finden vermag. Angefangen beim Allerwichtigsten: unserem Glauben daran, dass wir mit vereinten Kräften das Haus Europa als unser gemeinsames Zuhause aufzubauen vermögen, und dass wir alle darin gemeinsam leben können – im Geiste der Gerechtigkeit, der Brüderlichkeit, der Solidarität und aller anderen Werte des europäischen Humanismus.
PODIUMSDISKUSSION
Wolfgang Eichwede:
Der Optimismus Ihrer Ausführungen, Frau Präsidentin, tut sehr wohl. Im Kern teile ich ihn, obwohl ich von meiner Biografie her einen völlig anderen Weg gegangen bin. Ich bin ganz und gar Westeuropäer; von meinem Lebensweg und in meinem Kopf bin ich ganz und gar Osteuropäer. Jedenfalls unter dem Gesichtspunkt meiner beruflichen Tätigkeit und auch meiner Interessen. Ich will mit Blick auf Europa von einer Erfahrung erzählen, die ich als kleines Kind gehabt habe. Das war damals um 1952. Zu diesem Zeitpunkt fuhren meine Eltern, meine Schwester und ich das erste Mal nach Frankreich. Nördlich von Straßburg, bei Wissembourg, fuhren wir über die Grenze. Da stand auf der deutschen Seite in Nierentisch-Form ein Schild »Sie kommen aus Europa – Sie bleiben in Europa« und auf der französischen Seite das gleiche Schild, in der gleichen Form, mit dem gleichen Bild – in französischer Sprache. Mein Vater, der während des Krieges Ingenieur war und Panzer gebaut hat (kein Soldat, aber als Techniker) und ein Anhänger des damaligen Systems war, war beim Anblick dieses Schildes tief bewegt. Ich habe ihn selten – wirklich selten – gerührt gesehen, aber als er dieses Schild sah, sah ich ihn gerührt. Und er sagte meiner Schwester und mir, dass das die Lehre seines Lebens sei: »Nicht an die Nation zunächst, sondern an Europa denken.« Er habe diesen Fehler, einen großen Fehler, in seinem Leben gemacht. Er habe das eine Zeit lang unbedacht getan und möchte daraus die Konsequenz ziehen. Das heißt, wir im westlichen Europa und insbesondere in der Bundesrepublik (hier noch stärker als im westlichen Europa) sind in einer Art von Erfolgsgeschichte aufgewachsen. Wir sind zu einer Teilnation in der Bundesrepublik, also einer bundesrepublikanischen Teilnation oder einer eigenen Gesellschaft gekommen, in einer doch taktischen Zurückstellung der Nation gegenüber Europa. Das geschah sowohl werte- als auch interessenbedingt. Es war für uns in diesem Rahmen eine außerordentliche Erfolgsgeschichte. Ausgehend von dieser persönlichen Erfahrung möchte ich zwei Aspekte betonen, die mir in der Diskussion über Europa von wirklich großer Bedeutung sind. 1989 kam dieses Europa in seinen zwei Teilen überhaupt erst nicht nur geografisch zusammen, sondern von der Botschaft, die dieser Kontinent hat. Im westlichen Teil haben die dort lebenden Völker oder Gesellschaften den Einigungsprozess nach dem Krieg organisiert. Das geschah durch die Politik, das geschah über die Ökonomie, das geschah im Rahmen des Kalten Krieges, das geschah aus Furcht, das geschah in Bedrohung, das geschah in einer Vernagelung zum Teil nach Osten und einer Öffnung nach Westen, aber letztendlich war es eine Entwicklung, die sehr stark über politische Zwänge, über die Ökonomie, über die hohe Politik gelaufen ist. Mit anderen Worten: Das westliche Europa hat ein Stück Einigungsgeschichte geschrieben. Das östliche Europa hat im gleichen Zeitraum, nicht nur heute, auch schon damals, ein Stück Freiheitsgeschichte geschrieben. Das begann mit den Aufständen Mitte der Fünfzigerjahre und zog sich bis zu den von Ihnen erwähnten Ereignissen in Ihrem eigenen Land und in anderen Ländern Ende der Achtzigerjahre in Osteuropa hin. Heute habe haben wir das Zusammenkommen der Einigungsgeschichte im Westen und der freiheitsgeschichtlichen Geschichte. Heute kommen diese beiden Linien zusammen und haben uns die Chancen gegeben, von denen Sie gesprochen haben. Da liegt wirklich ein Punkt, den wir, den Sie als Ostmitteleuropäer einerseits, aber auch wir andererseits, wenn wir diesen ganzen Kontinent Europa denken, deutlicher machen müssen. Dieser Kontinent hat nach dem Krieg aus seinem östlichen Teil wirklich viel zu lernen und er hat auch viel gelernt. Nicht nur haben hier Revolutionen stattgefunden, sondern diese Revolutionen haben in einer friedlichen Weise stattgefunden. Das ist ein Kapitel, das Sie in der europäischen Geschichte geschrieben haben, das absolut unikal ist. Und das aus meiner Sicht ein Stück über die Botschaft der französischen Revolution 200 Jahre zuvor hinauszeigt. Dass diese Revolutionen in einer zivilen Form, mit einer zivilen Option stattgefunden haben, das ist eine unglaubliche Leistung. Das ist eine Leistung, die Sie im Baltikum, die Sie in Prag, in Budapest, aber auch in Moskau geleistet haben. Und auch in Petersburg oder damals Leningrad, auch in Kiew. Dass sich das über Vorstellungen des Dialoges mit den politischen Mächten vollzog, die zu stürzen man nicht in der Lage war. Dass man zur Feder gegriffen hat und nicht zur Pistole. Das, glaube ich, ist ein – jenseits und über diese Frage der Freiheitsbotschaft hinaus – Aspekt, der in der europäischen Geschichte und in dem, was Sie als europäische Identität angesprochen haben, sehr, sehr viel stärker noch, als wir das bislang getan haben, zur Geltung gebracht oder in Erinnerung gerufen werden muss.
Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Ich will nur ein paar Bemerkungen dazu machen. Sie haben von europäischer Identität gesprochen. Ich würde lieber von Identitäten sprechen. Also von einer Vielzahl von Identifikationsmöglichkeiten. Ich glaube, dass über die Werte hinaus, die Sie angesprochen haben, zwei andere von genauso großer Bedeutung sind. Vielleicht sind es nicht nur Werte, sondern es sind Verhaltensmuster oder Prozeduren: Das eine ist tatsächlich die Bereitschaft, aus der Geschichte zu lernen. Dieses Europa hat ja nun keine idyllische Geschichte über die letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende. Und 1945 hätte niemand geglaubt, dass Berlin 1948 zu einem Symbol von Freiheit werden könnte, oder dass ein Bürgermeister – Ernst Reuter – eine Rede halten könnte, die dieses Berlin in der westlichen Welt neu verankert. Also: dass wir lernen oder dass wir bereit sind zu lernen und dass wir dabei auch wissen, dass dieses Lernen häufig in den Widersprüchen, häufig in Brüchen, häufig in Fragmenten oder nur in Segmenten sich vollzieht. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt zum Verständnis dessen, was sich in diesem Kontinent vollzieht, und es ist zum Zweiten die Bereitschaft Souveränität abzugeben. Das knüpft an meine Erzählung von meinem Vater an mit »Europa vor den Nationen«: Souveränität abzugeben. Dabei komme ich in ein großes Problem. Ich selbst rechne von den politischen Zusammenhängen, von der historischen Verantwortung, von der kulturellen Leistung Russland voll und ganz zu Europa. Gleichzeitig ist das heutige Russland nicht bereit, so viel Souveränität abzugeben, wie es abgeben müsste, wenn es in die Europäische Union hineinwollte. Wir haben hier also verschiedene Europa-Begriffe oder verschiedene Europa-Vorstellungen, die wir mit in den Blick nehmen müssen. Für uns aber, die wir versuchen, dieses EU-Europa institutionell zu organisieren, ist die Bereitschaft der Abgabe von Souveränität ein zentraler, ein wirklich wichtiger Gesichtspunkt. Aus dem Gesichtspunkt von Werten alleine würde Neuseeland ja aber auch dazugehören und würden auch die Vereinigten Staaten dazugehören – bei unterschiedlichen Profilierungen. Was dieses Europa aber nach dem Krieg auszeichnet und was seine Botschaft ist, dass es diesen Lernprozess hat, die Bereitschaft zu Souveränität, und dass es sich von hier aus auf Prozeduren verständigt; auf Regeln verständigt, wobei sich vieles auch erst im Laufe von Jahren an Gemeinsamkeiten herausbilden kann. Anfang der Fünfzigerjahre – und das ist die Schlussbemerkung – waren viele in der westdeutschen Gesellschaft noch gefangen in Wertvorstellungen des Deutschlands vor 1945. Sie haben sich aber bereits auf demokratische Regeln eingelassen und sind ein Stück über Interessen und über Regeln und über das Beachten von Regeln dann auch zu Demokraten geworden. Wenn wir dieses Europa – vielleicht auf der allgemeinen Ebene – in einer Pluralität von Identitäten sehen, dann hat dieses Europa auch weiterhin eine Riesenchance. Es hat eine ungeheure Leistung vollbracht; trotz der großen Schwierigkeiten, die wir im Augenblick haben, bin ich da optimistisch. Man muss nicht immer – ich sage das jetzt bezogen auf das eigene Land – über Jahre oder Jahrzehnte von Politikern mit so einem geringen Maß an Visionen regiert werden, wie wir das in den zurückliegenden Phasen wurden. Es kann auch sein, dass eines Tages die Politik doch manche Botschaften wieder aufnimmt, die wir im östlichen Europa in den zurückliegenden zwanzig Jahren gelernt haben. Mit einer zivilen Option und einer großen Hartnäckigkeit. Mit der Bereitschaft zum Dialog und dem Willen nicht aufzugeben.
Willfried Maier:
Was Sie ausgeführt haben, Frau Präsidentin, über den Widerspruch zwischen der hohen Bereitschaft der politischen Klasse für Europa zu optieren und der vergleichsweise verhaltenen Zustimmung in den Bevölkerungen, das habe ich auch ziemlich lebhaft in der eigenen Erfahrung wahrnehmen können. Ich war vier Jahre in Hamburg unter anderem Europabeauftragter. Es war ausgesprochen schwierig, selbst größere Ereignisse, wie zum Beispiel die Einführung des Euro, zu einem Thema zu machen, das debattiert wurde. Warum? Es war ja kein Thema, auf das die Leute mit Emphase warteten, dass nun endlich der Euro kommen sollte. Es war vielmehr umgekehrt so, dass ihnen eine Situation vorgegeben wurde, von der gesagt wurde: »Das ist alternativlos! Das muss kommen!« Und wenn Sie sagen, mit den bisherigen Methoden geht es in Europa nicht mehr weiter, dann muss man sagen: Es geht nicht mehr weiter mit der Methode »Ökonomismus«. Es geht nicht mehr weiter mit der Methode »Das, was als Nächstes kommen soll, ist alternativlos.« Wenn das weitergeht, dann entwickelt sich gegen ein Europa am linken und am rechten Rand unserer politischen Lagerwelt eine Abwehrreaktion. Wir haben das in der Wahrnehmung bei deutschen Rechtsradikalen so, dass sie im Wesentlichen aus antieuropäischen Gefühlen und Sentiments heraus operieren. Wir haben es aber jetzt selbst bei der neuen Linkspartei zum Teil so, dass da mit einem Rückgriff auf nationale Vergemeinschaftungsmodelle – nationale Solidaritätsmodelle – operiert wird. Und es scheint vielen Leuten so, dass es die einzige Möglichkeit ist, so oder so zu optieren, wenn ihnen die politische Klasse immer nur sagt: »Europa ist in dieser und jener Entscheidung völlig alternativlos.« In Frankreich ist das Gleiche passiert und in den Niederlanden mit der Ablehnung der Verfassung ebenso. Das heißt, dass wir uns daran gewöhnen müssen – wir Westeuropäer, dass wir ein Stück Abschied nehmen müssen von der Methode Monnet. Die bestand im immer nächsten Schritt, mit dem unabwendbar der einheitliche Markt herzustellen, das nächste Hindernis für die Marktvereinheitlichung zu beseitigen war, immer begleitet vom Kommentar: »… und die Politik kommt schon nach! – Die politische Einigung wird sich dann irgendwie schon ergeben!« Wir müssen begreifen, dass Europa nichts werden wird, wenn es zu Lasten der politischen Mitwirkungsrechte der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der europäischen Länder geht; wenn sie den Eindruck haben, ihre nationalen Entscheidungen laufen leer, weil sie zu einem beträchtlichen Teil schon in Europa stattfinden, und wenn sie gleichzeitig den Eindruck haben, was aber in Europa passiert, das wird in Brüssel entschieden. Und Vorgänge in Brüssel sind so was von Bevölkerungs- und Politik-fern! Vier Jahre saß ich in einem unwichtigen Gremium – im Ausschuss der Regionen –, auf den sich europäische Regionalpolitiker einmal richtig gefreut hatten! Eine Unsinnsveranstaltung. Da halten Leute Deklarationen gegeneinander ab, die aber nie miteinander streiten, bei denen Mehrheitsbildungen nie eine Rolle spielen und es eigentlich auch nicht um wirkliche Alternativen geht. Das ist ein Interessenabklärungs-Gremium. Was ja seine gute Berechtigung hat, aber eigentlich nur eine veränderte Form von Diplomatie ist, die aber nicht das ist, was sich im Parlament abspielt. Wenn wir aber darüber nachdenken müssen, wie können Leute – Menschen in Europa – Europäer werden, ohne ihre Bürgerrolle aufzugeben, dann glaube ich auch, dass es in einer Hinsicht das Thema der Identität sein muss, die Sie angesprochen haben. Wir müssen bestimmt mehr daran arbeiten, so etwas wie eine ganz spezifisch europäische Geschichte der Freiheit erzählen zu können, die wir mehr oder weniger miteinander auch teilen. Eine emphatische Geschichte, denn dieser Kontinent ist tatsächlich der einzige, von dem der Gedanke der unzertrennlichen Individualität, der unauflöslichen Individualität eines jeden Menschen ausgegangen ist und der zu der heutigen Gestalt der Menschenrechte weltweit geworden ist. Das ist eine europäische Erfindung! Zum ersten Mal ausformuliert vielleicht in der Stoa und dann im Christentum. Es ist eine Freiheitsgeschichte, die viele Rückschläge erlitten hat. Europa hat die Gefahren seiner Selbstzerstörung insbesondere im Nationalsozialismus, aber auch im totalitären Kommunismus erfahren und das gehört zur Freiheitsgeschichte dazu, dass man sich mit den Selbstgefährdungen innerhalb des eigenen Prozesses auseinander setzt. Aber es reicht nicht, wenn man einfach nur sagt: »Wir haben gemeinsame Werte.« Werte – das ist so etwas Statisches. Das ist, als ob man das aus dem Regal holen könnte und dann hat man es. Werte leben nur, wenn man sich darauf bezieht, in welcher Geschichte Werte geworden sind, in welcher Geschichte es eine Bindung und Bildung um diese Werte herum gegeben hat und aus welcher heraus sie gekommen sind. Sie müssen erzählt werden! Sie können nicht einfach sozusagen abgegriffen werden. Da fehlt noch eine ganze Menge an europäischer Identitätsbildung, die auf diese Weise geschehen muss. Das zweite Feld ist: Wir müssen stärker noch als bisher verstehen, dass Europa nur eine Sache werden kann, die sich auf der Grundlage von Selbstverwaltung von den Kommunen bis auf die europäische Ebene hin organisiert und es unterschiedliche Formen von bürgerschaftlichem Mitwirken an diesen verschiedenen Ebenen sein dürfen. Es gibt immer das Wort: Es gibt das Europa der Staaten, die Union der Staaten und es muss daran gearbeitet werden, dass es auch so etwas wie eine Union der Bürgerinnen und Bürger gibt und nicht nur einen Vereinigungsprozess zwischen den Staaten. Es muss die eine oder andere Entscheidung geben, an der Europäer insgesamt teilnehmen können. Zum Beispiel ist die Frage der EU-Verfassung richtig ärgerlich dadurch verhandelt worden, dass sie in nationalen Volksabstimmungen verhandelt worden ist. Hätte man da doch eine europaweite Volksabstimmung hinkriegen können – es wäre eine ganz andere Emphase! Es wäre eine Auseinandersetzung der verschiedenen Lager gewesen. Es hätten sich politische Lagerbildungen über ganz Europa hinweg ergeben, die nicht einfach nur die nationalen Probleme eines jeweiligen Landes in diese Entscheidung eingebracht hätten. Im Hinblick auf solche Fragen müssen Politikerinnen und Politiker mehr Fantasie entwickeln, sonst isolieren sie sich von ihren Bevölkerungen. Das ist das Schlimmste, was einem Politiker passieren kann. Europa ist natürlich letztlich eine Angelegenheit des Konsenses, der gefunden werden muss zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, und dieser Konsens kommt nicht wie aus der Pistole geschossen, er ist auch nicht anzuordnen. Wenn die Leute den Eindruck haben, wenn sie den Nationalstaat verlieren, geht ihnen die Möglichkeit der sozialen Sicherung und der demokratischen Beteiligung verloren, dann ist Europa geplatzt. Darum müssen wir – insbesondere in Deutschland – ein bisschen vorsichtig sein, in dem Erschrecken über die Geschichte der eigenen Nation (der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts) die Idee zu haben, man könnte sich einfach über den nationalen Anteil in der Organisation Europas hinwegsetzen. Das ist ganz sicher nicht der Fall! Das können auch wir nicht. Wir haben auch mit diesen Reaktionen zu rechnen. Darum glaube ich, dass Europa tatsächlich nur etwas wird auf der Grundlage einer Föderation. Von den Kommunen über die Regionen und aber auch einer Föderation der Nationen, die nötig ist, um europäische Bürgerlichkeit zu gewähren.
Vaira Vike-Freiberga:
Wenn wir mit dieser Frage der persönlichen Identität anfangen, denken Sie bitte jetzt an ihre eigene Identität. Wenn Sie sich fragen: »Wer bin ich?«, was kommt Ihnen als Antwort? Also ganz ehrlich, denken Sie daran. Wer bin ich denn? – Wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel gucke, wer ist denn das, der mich anschaut? Ich glaube, ein jeder Mensch hat eine persönliche, vielfältige Identität. Dazu gehört, wie man aussieht. Ist man jung oder alt, Mann oder Frau, groß oder klein, dick oder dünn. Alles das gehört dazu. Aber manche von diesen Parametern sind wichtiger als andere. Wir haben in der Geschichte Europas nicht sehr viel über den Unterschied zwischen den Dünnen und den Dicken gehört. Das war nicht so ein Thema. Aber der Unterschied zwischen Männern und Frauen, bitte sehr! Das ist doch immer noch ein Thema, auch heutzutage noch. Wir haben die Kommentare über Frau Merkel, die erste Frau als »Bundeskanzler« in Deutschland gelesen. Das war Geschichte! Das war etwas Neues. Ja, da schreiben wir 2005 und zum ersten Mal steht an Deutschlands Spitze eine Frau. Das ist doch ein Parameter der persönlichen Identität, mit dem wir noch nicht fertig sind, nirgends in der Welt. Natürlich auch nicht bei den Politikern. Da gibt es auch noch keine Gleichgütigkeit zwischen Frauen und Männern. Noch nicht! Gut, das also ist die persönliche Identität. Dazu kommt eine andere Stufe. Man könnte sie die Sozialisierung des Menschen nennen. Dabei findet man solche Parameter wie: »Bin ich reich oder arm?«, »Bin ich berühmt oder nicht?« und vielleicht »Bin ich Arzt oder Zahntechniker oder Straßenfeger?« Der Beruf gehört also auch dazu. Man ist Arzt und Frau und auch ein dünner Mensch oder ein kleiner Mensch und ein großartiger Mensch. Alles das kommt zusammen. Das ist eine Hierarchie. Das sind Stufen in der Identität. Und nun wächst ein Kind auf und hört in der Schule, dass es ein Deutscher ist oder ein Franzose. Es wusste vielleicht gar nicht, dass es ein Franzose ist – bis es andere Leute getroffen hat, die nicht Franzosen sind. Da muss eine Konfrontation von denselben und den anderen da sein, oder es wird in der Schule gelernt, dass es da solche Menschen gibt, die Franzosen heißen, und andere, die Deutsche heißen. Das ist ein Parameter, der wichtig ist, und ich glaube, die kleinen Kinder verstehen überhaupt nicht, was es bedeuten soll. Aber man sagt ihnen: »Das ist ein wichtiger Parameter.« Und der geht vom nationalen Staat aus. Wenn wir in der Geschichte zurückschauen, sehen wir, das ist eine Konstruktion. Es wurde aufgebaut, es kam nicht natürlich. Ich habe schon das Zitat von den Italienern gebracht. 1870 wurde Italien neu aufgebaut. Vorher gab es Neapel und Rom und Florenz und allerlei Städte. Da war kein Italien da. – Oder Spanien: Erst als Ferdinand und Isabella geheiratet haben, hatte man eine Vereinigung von diesen beiden Teilen Spaniens! Und auch heutzutage noch haben sie in Spanien elf verschiedene Sprachen und Regionen. Viele von ihnen sind nicht ganz zufrieden mit diesem spanischen Nationalstaat. Dasselbe ist in Frankreich geschehen, unter Ludwig XIV. und dann später unter der Revolution und Napoleon. Der französische Staat wurde durch das Zurückdrängen der Regionen aufgebaut! In Deutschland, das wissen Sie ganz genau, hat Bismarck Deutschland geschaffen. Vorher gab es eine Menge Fürstentümer. Der Staat ist nicht seit 2000 Jahren da! Es sind 100 Jahre oder 200 Jahre oder 20 Jahre. Er ist etwas, das so aufgebaut wurde. Man hat daran gearbeitet. Und wenn wir etwas noch Größeres aufbauen wollen, dann ist das nicht etwas ganz Neues. Das ist derselbe Prozess, den Spanien in seiner Integration durchlaufen hat, den Italien in seiner Integration durchlaufen hat, Deutschland hat es getan und Frankreich. Man baut dies auf in einem historischen Prozess. Und diese europäische Union ist wieder eine Stufe in diesem Prozess. Es geht also weiter, Schritt um Schritt.
Sie sprechen von Vertiefung. Die bisherigen Mitglieder sind nicht auf derselben Ebene, weder ökonomisch noch sonst. Sie müssen integriert werden, und das wird Zeit brauchen. Wie es getan wird, dazu, glaube ich, sind beide Kommentare stimmig. Man braucht die Identität. Sodass ein jeder Mensch sich sagt: »Ich bin so und so und ich bin ein Mann oder eine Frau und ein Deutscher und ein Europäer.« – Darin ist kein Widerspruch. Man kann sich in dieser Hierarchie als Europäer ansehen, als Identität. Ein Europäer, der deutsch ist oder ein Europäer, der französisch ist. Ganz, wie man auch sagen kann: »Ich bin ein Mensch ganz einfach ein Mensch. Ein Mitglied der Menschheit.« Das ist doch die nächste Stufe und hoffentlich haben wir die auch im Sinn. Die ist doch auch wichtig. Wir können sagen, dass die Europäische Union bisher eine technische ist. Sie ist eine praktische Sache. Sie ist administrativ, politisch, ein Finanzprozess und sie ist Brüssel und alles, was damit geschieht. Und wenn man sie eine Föderation nennen will oder etwas anderes: Wissen Sie, wenn man die Föderationen ansieht, sind sie alle sehr verschieden. Der Unterschied zwischen Kanada als Föderation und den Vereinigten Staaten ist sehr groß. Beide heißen Föderationen, aber das, was eine Provinz Kanadas tun kann gegen die zentrale nationale Regierung, und was ein Staat der USA tun darf gegen die Regierung in Washington, ist nicht dasselbe. Genauso wie bei einem Land wie Bremen, oder Hamburg oder Schleswig-Holstein und Bayern. Das sind nicht dieselben Beziehungen zwischen diesen Stufen. Das heißt, dass, wenn man Föderation sagt oder Union, so ist das sehr elastisch. Man kann vieles damit tun und mit demselben Wort verschiedene Mechanismen verstehen. Das ist nicht schlimm. Es gibt uns die Möglichkeit mit diesen Konzepten zu arbeiten, auf der konzeptuellen Ebene: Wie soll es heißen und was soll es bedeuten? Wirklich fundamental ist die Frage der Souveränität in all diesen Vereinigungen. Wie viel Verantwortlichkeit man hat, auf welcher Ebene man das Geld verschwendet (man selbst oder ein anderer). Was man der zentralen Regierung gibt, und was man selbst behält. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, und man hat schon viele davon probiert. Dieser Prozess geht weiter. Wenn Sie von Kerneuropa sprechen, dann möchten wir, als neue Mitglieder natürlich, nicht so gern ein Europa sehen, wo die Guten, die Alten und Richtigen auf einer Seite sind und die Neuankömmlinge und die nicht so Guten und nicht so Anpassungswilligen ein bisschen in der Ecke stehen. Wir möchten doch die Solidarität im wirklichen Leben.
Wolfgang Eichwede:
Noch einmal zu den Europa-Aspekten. Ich selbst hatte mir lange Zeit vorgestellt, dass ich eines Tages gemeinsam mit den Franzosen (das war noch das alte Europa, das kann man genauso auf die Polen oder die Letten ausdehnen) ein gemeinsames Parlament nicht nur nach Nationen haben und zusammen wählen würde. Tatsächlich war ich davon ausgegangen: »Wir werden Staaten überwinden.« Angedacht war nicht eine Föderation von Staaten, sondern: »Da bleibt die Kultur und da bleibt die Sprache und da bleiben regionale Zusammenhänge, und das wird nicht alles ein Supermonster. – Da wird die Bedeutung des Staates möglicherweise reduziert.« Insgeheim glaubte ich, wir kommen auf die Vereinigten Staaten von Europa zu. Das ist ganz offensichtlich nicht real. Das muss man einfach so sehen, und für meine Generation ist das ein beträchtlicher Umdenkungsprozess. Es wäre falsch, würde man es nicht sehen, dass Europa die emotionale Lücke gegenwärtig nicht füllen kann, die entstehen würde, wenn wir den Nationalstaat – wie ich mir das eigentlich gewünscht habe – aufgeben würden. Das muss ich einfach so sagen. Ich selbst würde das gerne tun. Ich finde den Nationalstaat, diese Geschichte dieses Europas eine sehr schwierige Angelegenheit. Ich finde andere Epochen Europas, in denen es weniger Nationen gegeben hat und größere, nicht imperiale Zusammenhänge, sondern kulturelle Zusammenhänge, finde ich nicht weniger attraktiv, aber ich muss einfach feststellen, das ist gegenwärtig nicht vorstellbar. Der zweite Punkt: Dieses Europa ist in seiner augenblicklichen Konstruktion institutionell überfordert. Es sind so unglaubliche Aufgaben, die wir uns selber gestellt haben. Das ist auch gut, aber die Institutionen werden nicht mit diesem Berg an Problemen fertig, und von dort her kommt eben dieses ständige Fragen und dieser Zweifel an Europa. Auch da muss man sehen, dass wir in manchen unserer Vorstellungen in den vorangegangenen Jahren vielleicht zu weit gegriffen haben. Der dritte Punkt: Es ist doch bezeichnend, wir haben die ganze Zeit über Europa gesprochen und kein einziges Mal die Vereinigten Staaten von Amerika erwähnt. Also, Sie haben es getan, gut, gut! Aber man muss sich noch mal vor Augen halten, dass Europa in den letzten Jahren schwierige Beziehungen zu den Vereinigten Staaten hat, und diese schwierigen Beziehungen lasten auch auf diesem Europa. Ich sehe hier ein wirkliches Dilemma. Auf der einen Seite wollen wir selbstständiger werden – auch den Vereinigten Staaten gegenüber. Wir wollen auf gleiche Augenhöhe kommen, wie es so schön heißt. Auf der anderen Seite werden wir das nur können, wenn wir die Konfliktzonen mit den Vereinigten Staaten reduzieren. Solange diese Konfliktebenen bestehen, wird es nicht zu einer einheitlichen Sprache in Europa kommen. Hier sehe ich ein zusätzliches Problem, damit wir uns jetzt nicht nur in den großen historischen Zusammenhängen bewegen, sondern auch in den aktuellen politischen Fragen, denn da haben wir wirklich viele aktuelle Fragen, die gegenwärtig in diesem Europa nicht gelöst sind.
Willfried Maier:
Zunächst noch einmal zum Thema Kerneuropa und Gesamteuropa. – Ich glaube, dieses Thema ist in Wirklichkeit seit der niederländischen und französischen Abstimmung vom Tisch. Die Krise ist in Kerneuropa angekommen und nicht in erster Linie ein Problem der neuen Randländer. Das heißt, der Bruch mit der bisherigen Erfolgswahrnehmung ist zuerst in Westeuropa entstanden. Insofern ist alles Reden von einem engeren Zusammengehen von Kerneuropa politisch ein bisschen gegenstandslos. Es ist eigentlich eine Fortsetzung des administrativen Denkens. Also des Denkens von den notwendigen Verwaltungs- und Administrationseinigungen, die in Brüssel getroffen und die möglicherweise bei den homogeneren oder schon homogener gewordenen westeuropäischen Gesellschaften schneller durchsetzbar sind. Das hat aber nichts mehr zu tun mit einem größeren politischen Willen zu Europa in Westeuropa. Es ist nicht mehr so, dass in Westeuropa der politische Wille größer ist. Dann aber noch einmal zu dem Thema der Identität oder der Identitäten. Natürlich gibt es in Europa verschiedene Identitäten. Aber wenn wir vom Europa der verschiedenen Identitäten sprechen, reden wir offenbar über etwas Gemeinsames. Wenn wir aber über etwas Gemeinsames reden, dann muss in diesem Verschiedenen ein Gemeinsames identifizierbar sein, sonst würde man gar nicht von einem gemeinsamen Europa sprechen. Das Problem ist, dass dieses Gemeinsame schwer herauszuarbeiten ist. Es ist aber notwendig, das zu tun, es ist auch politisch notwendig. Natürlich ist das keine Sache, die dann – wie im Gesangbuch – alle heruntersingen, sondern um die es Streit gibt, worin dieses Gemeinsame eigentlich besteht. Dass dazu ein Bewusstsein da sein und sich herausbilden wird, glaube ich schon. Die Frau Präsidentin hat davon gesprochen, dass die Nationalstaaten konstruiert worden sind. Nicht nur die Nationalstaaten sind konstruiert worden, auch das Nationalgefühl, das Nationalbewusstsein. Das ist eine Erfindung von Dichtern und Historikern, keineswegs etwas, was schon immer da war. Die Deutschen haben sich ja nicht als deutsche Nation so ohne weiteres gefühlt, die Franzosen auch nicht so ohne weiteres. Die Leute in der Provence haben sich doch nicht als Franzosen gefühlt über Jahrhunderte, sondern sind in eine gemeinsame Geschichtserzählung – zum Teil gewaltsam, zum Teil emphatisch – hineingewachsen. Und etwas viel weniger Dominantes als die nationalen Erinnerungskulturen, die da aufgebaut worden sind, wird auch im Bezug auf Europa nötig sein. Wir bekommen es zurückgespiegelt von den Nicht-Europäern, die uns zum Beispiel die Menschenrechte entgegenhalten: »Das ist aber eine europäische Erfindung, mit der Ihr hier interveniert.« Wir sagen dann gerne: »Das stimmt ja gar nicht.« Aber sie haben ja völlig Recht: Es ist eine Erfindung, die in Europa gemacht worden ist, wenn auch mit dem Anspruch auf universelle Geltung. Tatsächlich hatte die Idee der Menschenrechte eine bestimmte historische Genese. Und nicht nur das: Die Idee der Menschenrechte wirkt auf andere, traditionelle Gesellschaften auch zerstörend. Auf Gesellschaften beispielsweise, in der nicht das Individuum der Ausgangspunkt der Vergesellschaftung ist, die moralische Basis-Einheit gewissermaßen, sondern die Familie oder ein ClanZusammenhang. Diese gesellschaftlichen Akteure sind in Europa spätestens seit Herausbildung des frühen Nationalstaates aufgelöst worden. Die Freisetzung von Individualität hatte also einerseits geistesgeschichtliche Gründe, aber auch staatliche – oder durch wirksame Staatlichkeit organisierte – Gründe. Das ist etwas historisch Besonderes und trotzdem sagen wir: Es ist ein Menschheitsgut mit universellem Anspruch, und wir sagen das mit einem gewissen Recht. Obwohl wir genau wissen, dass damit andere Formen des menschlichen Zusammenlebens, die eine jahrhundertealte Geschichte haben, zu zerbröseln beginnen, weil sie in dieselbe Welt von Organisation hineingezogen werden. Gerade wegen dieser besonderen europäischen Geschichte, die einen universellen Anspruch – die Idee der Menschenrechte – hervorgebracht hat, ist es zugleich unverzichtbar und möglich, dass Europäer eine Wahrnehmung ihrer Gemeinsamkeiten und das Gefühl einer sich annähernden Geschichtserzählung untereinander ausbilden. Das zweite Element ist tatsächlich, dass dieses Europa ein Europa der Selbstregierung seiner Bürgerinnen und Bürger wird. Dazu werden noch viele Erfindungen gemacht werden müssen. Man kann nicht sagen: »Föderation ist gleich Föderation!«, sondern muss zusehen, wie etwa die überaus zentralstaatliche Tradition der Franzosen mit der britischen Geschichte der lokalen Selbstorganisation und der an den Ländern orientierten und kommunalen Selbstorganisation der Deutschen in ein institutionelles Verhältnis gebracht werden können, das die demokratischen Kräfte der europäischen Ebene nicht überfordert. Das ist sicherlich noch ein offenes Experiment. Ich glaube übrigens nicht, dass diese Kräfte in erster Linie vom europäischen Parlament und dessen stärkerer Gewichtung kommen werden. Ich glaube, es kommt durch gemeinsame politische Erfahrungen und Entscheidungen der Europäer. Also zum Beispiel die Entscheidung über die Verfassung als eine europäische zu organisieren, die Entscheidung über die Währungsunion als eine europäische zu organisieren, hätte viel mehr europäisches Bürgerbewusstsein geschaffen als alle Straßburger Parlaments- und Brüsseler Debatten, die doch nur von wenigen verfolgt werden. Kaum eine Zeitung berichtet darüber. Das Parlament wird kaum wahrgenommen. Und erst recht der Ausschuss der Regionen, auf den wir uns damals sozusagen als Europa der Regionen bezogen haben, wird gar nicht wahrgenommen. Man braucht große gemeinsame Entscheidungssituationen. Habermas hat nicht ganz zu Unrecht gesagt: Die damalige Auseinandersetzung in Europa um die Stellung zum Irakkrieg war trotz der Differenzen in Europa, war europäisch fördernder als gar keine Auseinandersetzung über die Frage. Auch dieser Streit hat sich leider stärker zwischen den Regierungen abgespielt als zwischen den europäischen Bürgerinnen und Bürgern, obwohl er nicht nur ein Streit zwischen den Regierungen war. In Großbritannien oder in Italien gingen auch die Leute auf die Straße und sagten: »Wir sind für eine Linie, die nicht mit der unserer nationalen Regierung übereinstimmt.« Solche Streits in Europa, über große gemeinsame Fragen, bei denen man sich über die Nationen hinweg über das FÜR und das WIDER streitet: Das bildet die europäische Geschichte der Zukunft – hoffentlich.
Die Diskussion endete mit einem Dankeswort der Preisträgerin, Vaira Vike-Freiberga.
Preisverleihungen, mögen sie noch so gut und erhebend verlaufen, sind doch für die meisten von uns einzelne und schnell vorbeihuschende Momente. Es fällt uns schwer, uns anschließend zu erinnern, was an ihnen – über die Ehrungen hinaus – irgendwie bedeutsam und denkwürdig war. Der zehnte Jahrestag der erstmaligen Verleihung des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken ist deshalb vielleicht eine gute Gelegenheit, diese Preisverleihung in einen weiteren politischen Horizont einzufügen – in einen Horizont, der über das Einmalige jeder einzelnen Preisverleihung hinausgeht. Das, was unsere Preisträgerinnen und Preisträger der vergangenen Jahre – die Namen im Anhang – untereinander und mit dem Namen unseres Preises verbindet, ist nicht etwas bloß Ideengeschichtliches. Sie sind auch, auf verschiedene Weisen, durch ihr Leben, ihr Denken, ihr Handeln, durch entscheidende Erfahrungen innerhalb der dramatischen Geschichte unserer Zeit geprägt. Vielleicht haben sie diese dann unerschrockener und radikaler als andere aufarbeiten und weitergeben können. Wie Sie wissen, wird der Name Hannah Arendts, die als deutschjüdische Emigrantin nach Amerika kam, meistens mit ihren entscheidenden Einsichten in das Wesen der totalitären Herrschaft, in ihre prägenden Elemente, verbunden. Manchmal wird es auch wahrgenommen, dass sie diese Einsicht, diesen Zugang dadurch errungen hat, dass sie dem Einbruch des Totalitären in unsere Geschichte gleichsam ungeschützt, ohne den Rückhalt der schon vorhandenen politischen Kategorien – wie etwa Diktatur oder Autoritarismus – begegnet ist. Dadurch tritt bei ihr, viel deutlicher als anderswo, das Totalitäre als etwas innerhalb der Geschichte der Moderne und als etwas grundlegend Neues zu Tage. Was fast durchgängig – aber gewiss nicht zufällig – ignoriert wird, ist, dass Arendt, in diesem begriffsoffenen Umgang mit dem Totalitären zugleich einen epochalen Neuzugang zu der politischen Wirklichkeit unserer Zeit hervorgebracht hat. Einen Neuzugang, den sie – neben einem einmaligen gedanklichen Erbe aus dem vortotalitären Deutschland – vor allem der Tatsache zu verdanken hat, dass sie sich – anders als die meisten europäischen Emigranten – intensiv auf das Besondere der amerikanischen revolutionären Erfahrung einließ, auf das, was in ihr einen verschütteten Raum des Politischen aufgemacht hat. Damit konnte sie auch – wie fast keiner außer ihr – ein neues Licht darauf werfen, was die »Amerikanische Neugründung der Freiheit« für die bedrohte politische Dimension der Moderne bedeutet hat. Was in dieser Beleuchtung lebendig wird, ist nicht eine von uns ferne – auch geschichtlich und kulturell ferne – Erfahrung des Politischen. Vielmehr jene Erfahrung, die wir, Erben nicht nur eines individuell-liberalen Rechtsschatzes, sondern auch eines republikanisch-christlichen (oder auch abrahamitischen) freiheitsversprechenden Bildungsschatzes, ein jedes Mal selber machen, wenn wir die Gelegenheit haben, nicht bloß als durch Gruppeninteressen zusammengebrachte Staatsuntertanen, sondern als »citizens« einer geschichtskonfrontierten politischen Nation zusammen handeln und sprechen zu können. Die Differenz dieser Politik- und Machterfahrung zu einem Politik- und Machtverständnis, das an eigenmächtige Souveränität und an Staatshandeln anknüpft (auch dort, wo ein eindeutiger »Volkswille« den Platz des Souveräns einnehmen soll), liegt dann auch in der ganzen Hintergründigkeit des arendtschen Verweises auf unser »ERBE OHNE TESTAMENT«.
Von hier aus möchte ich einen Bogen zu unserer ersten Preisträgerin schlagen. Sie, Agnes Heller, war lange Zeit auch eine in die Emigration gezwungene Frau, noch in der Zeit des KadarRegimes in Ungarn. Unsere ungarisch-jüdische Denkerin hat, nach den Schrecken der faschistischen Todeskommandos am Budapester Donauufer am Kriegsende, ihren letztlich entscheidenden politischen Anstoß in den Tagen des ungarischen Volksaufstandes und der Revolution des Jahres 1956 bekommen. Dieser hat sie dann mit zu ihrem heutigen Hannah-Arendt-Lehrstuhl an der »New School« in New York geführt. Hannah Arendt hat übrigens diese Revolution – mit guten Gründen – als die erste wirklich politische Freiheitsrevolution nach der Amerikanischen betrachtet. Es hat sich nun so gefügt, dass das Leben der Frau, die wir heute ehren wollen, auch von einem – viel zu langen – Exil geprägt ist. Frau Vaira Vike-Freiberga stünde aber nicht vor uns, wäre ihr Denken und Handeln nicht auch noch von einem anderen Ereignis geprägt und getragen. Antonia Grunenberg hat in ihrer Laudatio dieses Ereignis und sein Fortwirken im Denken und Handeln von Frau Vika-Freiberga schon bestens beleuchtet. Hier davon nur so viel: Man spricht oft vom Jahre 1989 als vom »Jahr des Wunders«, in dem scheinbar Unmögliches plötzlich möglich, ja wahr wurde. Wir sollten aber vielleicht von einem doppelten »Jahr des Wunders« sprechen, will sagen, auch vom »Jahr des Wunders« der baltischen Nationen im Jahre 1991. Von dort kam das entscheidende Signal, nicht nur für das Ende des Ausgreifens des sowjetischen Imperiums und der totalitären Momente, die in ihm überlebt haben, sondern auch für seinen entscheidenden Zusammenbruch. Unsere erste und unsere zehnte Preisträgerin symbolisieren so gewissermaßen auch die zwei Freiheitsereignisse, die den ersten großen Riss in der unheimlichen, freiheitsabweisenden imperialen Mauer und die endgültige Besiegelung ihrer Unhaltbarkeit bedeutet haben. Sie weisen zugleich nicht bloß auf etwas Vergangenes hin, sondern auch auf eine eigentümliche Macht, die in unseren politischen Nationen – und in dem, was durch sie übertragen wird – schlummert. Sie ist nicht jene Kommando- und Herrschaftsmacht, die man üblicherweise und fälschlich mit »politischer Macht« gleichsetzt, und die man dann »legitimieren« muss, um sie demokratiekonform und konsensfähig zu machen. (Zentrale Momente des arendtschen Denkens machen es uns möglich, diese uns angewöhnte Gleichsetzung aufzubrechen.) Sie ist eher eine belebende Macht, die einen Raum öffnet, in dem und durch den so etwas wie eine politisch-geschichtliche Entscheidung (die diesen Namen verdient) überhaupt möglich wird. Auf die Widerständigkeiten dieses strittigen Raumes, ihn zu einem rein selbstbezüglichen oder voll säkularisierten Raum zu machen, hat unser Preisträger des Jahres 2004, Ernst-Wolfgang Böckenförde, hingewiesen. (Im Sinne seines »Dictums«, dass die demokratische Verfassungsordnung auf Grundlagen beruht, die sie selber nicht hervorbringen kann.)
Es ist kein Zufall, dass der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken hier in Bremen in jenem Moment unserer jüngeren Geschichte ins Leben gerufen wurde, als es deutlich wurde, dass man dabei war, die Revolutionen in Ostmitteleuropa sozusagen zu den Akten zu legen. Ihre bezeugende und freiheitsversprechende Dimension sollte so zum Verschwinden gebracht werden. Sowohl in den weithin bestimmenden politischen wie auch akademischen Diskursen wurden sie als »nachholende Revolutionen« charakterisiert, die lediglich das nachgeholt hätten, was für den Westen bereits selbstverständlich war: liberale Marktwirtschaft und parlamentarische Demokratie. Diese Abwertung der geschichtlichen und politischen Erfahrung jener Nationen, die damals mit einem revolutionären Paukenschlag erneut in den Raum der demokratischen und republikanischen Auseinandersetzung getreten waren, trug maßgeblich dazu bei, die Potenzialitäten und Neuverortungen dieser Ereignisse zu verspielen. Damit ist nicht selten die Einstellung verbunden, die gewaltbesetzte »Vorgeschichte« des heutigen friedlichen europäischen Westens als etwas Abgeschlossenes zu betrachten, welches auf ein unbeschwertes »Nach-vorne-Schauen« einlädt – als ob sich mit der heutigen pragmatisch-professionellen Problembearbeitung und instrumentellen Problemlösung die Gefährdungen der Freiheit ein für alle Mal erledigt hätten. Übersehen wird dabei, dass in der arendtschen Beleuchtung des Totalitären eine ihrer ermöglichenden Dimensionen besonders klar zu Tage tritt. Diese Dimension ist keine andere als jene der Entpolitisierung, als jene des Bedeutungsverlustes der politischen Auseinandersetzung, als jene der Ohnmachtserfahrung der Bürger einer Nation. Das heißt: genau jene Unterhöhlung der Bedeutsamkeit des Politischen, die wir Tag für Tag erleben. Der Name Hannah Arendts steht für etwas anderes – nämlich für ein politisches Denken, welches zum einen der Neuheit und Eigenheit der totalitären Versuchung der Moderne Rechnung trägt, welches zum anderen das Wort »Wunder der Freiheit« ohne ängstliche Verlegenheit oder idealistischen Überschwang ausspricht. Darum stehen hier die Namen unserer Preisträgerinnen und Preisträger mit dem Namen unseres Preisgebers zusammen – nicht für Bezeugungen vergangener Geschichte, sondern für Bezeugungen jener Konfrontation mit der Geschichte, die uns auch heute noch Not tut.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz