
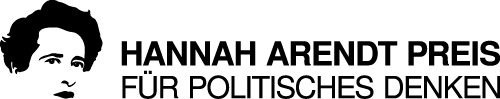

Julia Kristeva wurde 1941 in Bulgarien geboren, studierte
Romanistik und kam 1965 im Rahmen eines französischbulgarischen Austauschprogramms nach Paris. Sie blieb
dort und beendete ihre akademische Ausbildung mit einer
Habilitation (»Die Revolution der poetischen Sprache«).
1978 schloss Sie ihre psychoanalytische Ausbildung ab
und praktiziert seitdem als Therapeutin. Ihr Werk umfasst
Arbeiten zur heutigen Psychoanalyse, zur Kultur- und Religionsphilosophie und zum Zeitgeschehen. Seit Anfang der
1990er Jahre steht Hannah Arendt im Mittelpunkt ihres
politischen Denkens.
Auf Deutsch sind u.a. erschienen: Die Revolution der
poetischen Sprache (1978), Die neuen Leiden der Seele
(1989), Fremde sind wir uns selbst (2001), Hannah Arendt
– Das weibliche Genie (2002).

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Macht und Ereignis
Der besondere arendtsche Akzent dieser Preisverleihung
Lassen Sie mich mit einer kleinen Geschichte beginnen. Unsere Namensgeberin erzählt sie in ihrer Schrift Die ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus vom Jahre 1958. Sie könnte uns, hörten wir ihr gut genug zu, in das Zentrum der Sache einstimmen, um die es bei dieser Preisverleihung in einer besonderen Weise geht. Ein erster Hinweis auf diese Sache könnte die Frage sein: Welche Betonung, welche Herausstellung der arendtschen Zugänge zum Sinn des Politischen, zum Offenkundigen und Verborgenen unserer politischen Geschichte wäre, in diesem Arendt-Jahr 2007, die wohl dringlichste? Die dringlichste in Hinblick auf jene, uns alle betreffende Konstellation unserer Zeit, in der die Krise des Politischen, nicht nur in diesem Lande und nicht nur auf unserem Kontinent, sowohl offenkundig ist als auch – in den verschiedensten parteipolitischen, politikwissenschaftlichen, globalisierenden und antiglobalisierenden Diskursen – verdeckt wird. Und verdeckt auch, muss man leider sagen, von vielen Diskursen und Vorspiegelungen im Namen der moralisch vorgetragenen »Menschenrechte«. In der fraglichen, von Arendt erzählten Geschichte geht es um ein fast unscheinbares und doch weithin leuchtendes Ereignis. Es mag vor vielen Jahren und in einer anderen politischen Welt vorgefallen sein, doch sein Sinn ist gegenwärtig und geht uns heute noch genauso an. Es geschieht bei einer Dichterlesung in Moskau der Fünfzigerjahre, in denen sich erste Haarrisse in der noch intakten stalinistischen Macht zu zeigen begannen. Boris Pasternak sollte aus seinen Gedichten vorlesen. Jener Boris Pasternak, den die meisten außerhalb Russlands nur als den Romanautor von Doktor Schiwago kennen, wobei er vor allen Dingen jener Dichter war, der den poetischen Einbruch in die russische Welt des 20. Jahrhunderts, der von den tragischen und schon fast mythischen Gestalten von Anna Achmatova und Marina Zwetajewa angeführt wurde, auch weiterhin erfahrbar machte. »Pasternak«, erzählt Arendt – ich zitiere –, »hatte da einen Vorleseabend angekündigt, zu dem sich eine ungeheure Menschenmenge eingefunden hatte, wiewohl doch sein Name nach all den Jahren des Schweigens nur noch als Übersetzer von Shakespeare und Goethe bekannt war. Er las aus seinen Gedichten und es geschah, dass ihm beim Lesen eines alten Gedichts das Blatt aus der Hand glitt. … Da begann eine Stimme im Saal aus dem Gedächtnis weiterzusprechen. Von mehreren Ecken des Saales stiegen andere Stimmen auf, und im Chor endete die Rezitation des unterbrochenen Gedichts.« Wir kommen nun dem weiterwirkenden Sinn dieser »Moskauer Geschichte« Arendts näher, wenn wir versuchen, den Kontext zu verorten, in dem sie sie erzählt. Wie schon erwähnt erzählt uns Arendt dieses Ereignis im Rahmen ihrer Schrift über ein anderes politisch und geschichtlich gewiss gewichtigeres Ereignis: das jener Ungarischen Revolution von 1956, in der, in einer ungeplanten und davor unvorstellbaren Weise, die Furcht erregende Macht eines totalitären Staatsapparates, seine Befehls- und Waffengewalt, in wenigen Tagen oder gar Stunden zusammenbrach. Weniger durch die Aktionen gar nicht sehr zahlreicher aktiver Kämpfer, als durch eine Veränderung des »Aggregatszustandes« des sich versammelnden und sich plötzlich artikulierenden Volkes. Für Arendt war dies ein Schlüsselereignis innerhalb unserer, von der Macht des Totalitären und von den Einbrüchen des Politischen überschatteten neueren Geschichte.
Gerade in Bezug auf den bei dieser Preisverleihung an Julia Kristeva besonders hervorzuhebenden arendtschen Zugang zu unserer politischen Geschichtlichkeit sollten wir an diesem Punkt wahrnehmen: Viel zu oft – und fatal einseitig – wird das arendtsche Œuvre im Wesentlichen mit Beschreibungen und Analysen der »voranschreitenden«, »erfolgreichen« und ständig »drohenden« totalitären Prozesse und Mächte verbunden. In dieser – wohl symptomatischen – Fokussierung verschwindet genau das, was dem arendtschen Werk seine epochale Bedeutsamkeit verleiht. Das nämlich, was weit über die – generell liberal inspirierten – Totalitarismustheorien hinausgeht und auch nicht mit den – oft mit arendtschen Hinweisen vorgetragenen – Diskursen aufgeht, für die die »Zivilgesellschaft« eine in die rationale und moralische Moderne endlich »angekommene« Gesellschaft ist. Was in ihr verschwindet, ist die arendtsche Aufmerksamkeit für die plötzlich eintretende Ohnmacht dieser und wohl aller wesentlich gewaltgestützten Machtformen unserer Geschichtlichkeit, wenn jene – öffentliche – Wir-Weise in Erscheinung tritt, in der das, was im luziden arendtschen Verständnis die wahrhafte Macht – und keine »Gegenmacht« der gleichen Machtsorte – ausmacht. Mögen diese öffentlichen Wir-Weisen – an unsere latenten Freiheitsübertragungen anknüpfend – noch so vergänglich innerhalb unserer neutralisierten Zeitabläufe sein: Ohne sie könnten wir nicht einmal, wie Arendt es in ihrem Vom Leben des Geistes schreibt, jene »Sphären des Handelns« erfahren, durch die »Gemeinwesen, in denen das ›Wir‹ seine angemessene Gestalt für die Reise in die historische Zeit gefunden hat«, in die Welt kommen, und die in das determinierte, voll säkularisierte Kontinuum, in die »Abfolge der chronologischen Zeit einbrechen«.
Denn wie Paul Ricœur einmal schrieb, »die Auflösung der Macht« (das heißt der, die sich an die Gewalt assimiliert hat), »ist ein instruktiveres Phänomen hinsichtlich der Natur der Macht als die Ohnmacht, die aus der Ausübung der Macht resultiert.«
I n diesem Kontext ist Arendts »Moskauer Erzählung« eine Art Ouvertüre zum zentralen Thema des Essays, in dem Arendt die Ereignisse des »Ungarischen Oktobers« als ein Wiederhervortreten einer Freiheits-, ja einer Revolutionslatenz unserer westlichen Geschichtlichkeit wahrnimmt. Gegenüber dem zutiefst widerständigen, aber nicht bloß »oppositionellen« Chor des Moskauer Theaters, der wohl auch in einem dankenden und hoffnungsbestätigenden Ton das Pasternak-Gedicht – öffentlich – rezitierte, wurde die sonst allgegenwärtige totalitäre Macht radikal machtlos. Die Wahrheit – oder besser: das Wahrheitsgeschehen – in dieser Erzählung liegt offenbar nicht innerhalb der realpolitischen, moralpolitischen oder kulturpolischen Kategorien durch die wir, alltäglich, unsere politische Wirklichkeit theoretisch einordnen. Es fällt uns schwer, es in einer Weise wahrzunehmen, in der es auch unsere – wirklichkeitsgarantierenden – Kategorien affiziert, so dass wir im Geschehen der Erzählung nicht nur eine wohl anrührende, doch nicht wirklich relevante Einzelepisode erblicken. Es ist aber zu befürchten, dass unsere Bemühungen, an das arendtsche Denken anzuknüpfen – auch im Kontext dieser Preisverleihung –, ohne diese Schwierigkeit auf uns zu nehmen, hilflos oder idealistisch-utopisch bleiben. Die Frage nach der Art der Freiheitslatenz und seiner differierenden Zeitlichkeiten zeichnet auch die Nähe des arendtschen zum benjaminschen Denken aus. In ihrem großen Essay zu Walter Benjamin, wo die emblematische Gestalt des »Perlentauchers« den benjaminschen Umgang mit der Geschichte verkörpert, ist der »Schatz« (auch der »verlorene Schatz der Revolution«) nicht aus der Welt, er ist »nur versunken«. Wir können aber, um bei der Metapher zu bleiben, im Meer – das übrigens selber eine Metapher des Mütterlichen ist – nach ihm »tauchen«, ohne Gewissheit, doch mit dem Zutrauen, dass er uns eigentlich geschenkt und versprochen wurde. Es ist nicht schwer, in dieser Passage des Benjamin-Aufsatzes eine Metapher des jüdischchristlichen »Versprechens« innerhalb einer gewandelten, nicht mehr zwingend-offensichtlichen Konstellation wahrzunehmen. Wir können in diesen Zeilen auch eine andere Metapher herauslesen. Sie ist die des »eintauchenden« freudschen (und nachfreudschen) analytischen Erfahrungszugangs. Dieser liegt allerdings – wie auch die zur übertragungsoffenen politischen Erfahrung – nicht auf dem Trockenen der psychologischen oder politologischen Reflexionen. Es ist aber auch nicht so, dass das Bedeutsame dieser arendtschen Erzählung nur von der zentralen Thematik des Essays her beleuchtbar wäre. Umgekehrt ist auch die Hauptthematik des Essays von dieser »Ouvertüre« her gestimmt. Das heißt: Von einem, durch eine »Unterbrechung« zur Stimme gekommenen, politisch-poetischen und doch eigentümlich mächtigen »Wir« her, das keine »Oppositionsgruppe«, keine »Masse«, aber auch keine Gruppe eines »kulturellen Ausdrucks« ist. Das »Poetische« dabei ist keine im herkömmlichen Sinn »ästhetische« Kategorie. Vergessen wir nicht, dass im erweiterten politischen Verständnis Arendts das hellenische »Volk der Griechen« – in dem dann der ereignishafte Sprach- und Handlungsraum der Polis aufkommt – im Hören und Sagen der homerischen Dichtung entspringt, ebenso wie das jüdische Volk im »Höre Israel« und der Zusammenhang des Christentums in der »Frohen Botschaft« entspringt. Es ist so, als ob darin eine nicht-selbstreferentielle Art der Solidaritätsmacht gestiftet wäre, die mit unseren gewohnten – die differierenden Zeitlichkeiten einebnenden – Begriffen der »Interessens- oder Wertegemeinschaft« nicht zu fassen ist. Wohl auch deshalb, weil in der Natur der Letzteren nichts Angesprochenes und nichts Ansprechendes gedacht werden kann.
Damit kommen wir dem besonderen arendtschen Akzent dieser Preisverleihung näher. Wir haben für sie nicht von ungefähr als Motto einen Satz aus Arendts Denktagebüchern gewählt. Er heißt: »Nur von den Dichtern erwarten wir Wahrheit, nicht von den Philosophen, von denen wir Gedachtes erwarten.« – »Wahrheit« zielt hier, wie bei Arendt auch anderswo, auf ein Wahrheitsgeschehen, sei es der entbergenden oder der vertrauensbezeugenden Art. In der Sprache wohnt Dichtendes, können wir wohl im Sinne Arendts sagen, und nicht bloß Informationskommunizierendes, mag dies auch für viele Philosophen und Sozialwissenschaftler schwerer nachvollziehbar sein als für gewöhnliche Sterbliche. Dieser Akzent der diesjährigen Preisverleihung ist innig mit dem Werk unserer Preisträgerin verbunden. Dieses Werk ist von jener genuin arendtschen Wiedereröffnung jener konstitutiven Bezügen gekennzeichnet, die, mal in ereignishaften, mal in latenten Weisen, zwischen unserem Sprachwesen und der Macht des Verzeihen- und Versprechenkönnens walten. Es ist diese Macht, die für Arendt die Zeiträume des Politischen eröffnet. In Julia Kristevas Denken bekommen nun diese Bezüge – durch die unsere singulären Daseinsweisen mit unseren geschichtlichen Wir-Weisen verbunden sind – einen aktuellen politischen Sinn. Oder auch: einen widerständigen Sinn in der anfangs erwähnten, das Politische bedrohenden Konstellation. Er untergräbt die fast selbstverständlich gewordene funktionalistisch rationalisierende Festlegung, Identifizierung des politischen Sprechens und Handelns. Er untergräbt somit auch die dunkle, verdrängte »andere Seite« derselben Ausprägung. Diese kommt uns dann als die – mal offenere, mal untergründigere – paranoide Identifizierung des Politischen mit dem »letzten Entscheidungskampf« gegen die je aktuelle Verkörperung des An-Sich-Bösen vor. Durch beide Seiten werden die erwähnten Bezüge zwischen unseren Selbst- und Wir-Weisen und ihre – nicht bloß intellektuelle – Bearbeitbarkeit verdeckt und verleugnet. Nichtsdestoweniger gehören die an sie direkt anknüpfenden und weithin wirkenden Diskurse zu unserer politischen, intellektuellen und auch akademischen Wirklichkeit. In welchem Maße die geschichtliche Bedeutung des arendtschen Denkens von der Widerständigkeit gegenüber diesen Diskursen und ihren Praktiken gekennzeichnet ist, wird in der Arendt gewidmeten Literatur nur recht puktuell wahrgenommen. Desto wichtiger ist somit die Weise, in der sie in Kristevas Werk hervortritt. Sie tritt hervor, auch weil Julia Kristeva einen noch seltenen Beitrag dazu geleistet hat, die »Verwandtschaft« zwischen dem arendtschen Zugang zu unseren freiheits- und übertragungsoffenen politischen Zwischenräumen und den freudschen-nachfreudschen Zugängen zu dem, was – wie Kristeva sagt, eher »selten« – in der analytischen Situationen geschieht, denkbar zu machen. Beide Zugänge liegen sozusagen »diesseits« unserer gewohnten politikwissenschaftlichen und psychologischen Objektivierungen. Verschwindet die »Verwandtschaft«, werden sie erneut in die besagten Objektivierungen zurückgedrängt. Dies hilft uns wesentlich beim – wie die Arendt-Literatur es zeigt: gar nicht leichten – Nachvollzug des Arendtschen Verständnisses von unterbrochenen Handlungskontexten und Neugründungen. Die epochal angestoßene freudsche Erweiterung der denkerisch zugänglichen Erfahrung und Erfahrungszeitlichkeit hat ja auch ihre Parallelen in den phänomenologischen Durchbrüchen, die den direkten denkerischen Hintergrund Arendts bilden. Die analytische Erfahrungserweiterung »geschieht« in der übertragungsoffen werdenden ereignishaften Wiederverflüssigung der Fixierungen, die uns, alltäglich, sowohl vom Ängstigenden wie vom Zusprechenden abschirmen. Dadurch kommt die Macht ihrer Neubearbeitung zustande. Die »Moskauer Erzählung« Arendts zeigt uns, wie die Anknüpfbarkeit an das, was die Freiheitsdimension des Politischen trägt, mit dem Wirksamwerden des poetischen Wortes und seiner WirWeisen zu tun hat. Darin liegt der besondere arendtsche Akzent dieser Preisverleihung.
Ein Mädchen aus der Fremde. Julia Kristeva zitiert in ihrem Buch über Hannah Arendt einen Brief ihrer Heldin, des ersten unter ihren drei weiblichen Genies, an Martin Heidegger. »Ich habe mich nie als deutsche Frau gefühlt und seit langem aufgehört, mich als jüdische Frau zu fühlen. Ich fühle mich als das, was ich nun eben einmal bin, das Mädchen aus der Fremde.« Kristeva bemerkt gleich, dass es hier um ein Gedicht von Schiller geht, und in der Fußnote zitiert sie auch zwei Strophen des Gedichtes: Sie war nicht in dem Tal geboren,/ Man wusste nicht, woher sie kam;/ Und schnell war ihre Spur verloren,/ Sobald das Mädchen Abschied nahm.// Seligend war ihre Nähe,/ Und alle Herzen wurden weit;/ Doch eine Würde, eine Höhe/ Entfernte die Vertraulichkeit. Kristeva erwähnt noch, dass Heinrich Blücher gern seine Frau so bezeichnete, und dass Heidegger selbst ein Gedicht über dieses Thema für Hannah geschrieben hat. Danach erwähnt sie das Gedicht nicht mehr. Hat sie diese Strophen wegen der letzten zwei Verse zitiert, die in ihrer eigenen Prosaübersetzung – sa dignité majestueuse éloignait toute familiarité – noch härter klingen? Mag sein. Über Kristevas Leben weiß ich nicht viel mehr, als dass sie in Sliwen, Bulgarien, geboren ist und seit ihrem 24. Lebensjahr in Paris lebt und tätig ist. Eine Fremde unter den Franzosen. »Nirgendwo ist man fremder als in Frankreich« – schreibt sie; sie fügt aber fast gleich hinzu: »… dennoch, nirgendwo ist man besser Fremder als in Frankreich.« Das reicht aber. Sie selbst muss auch ein Mädchen aus der Fremde sein, dessen Würde und Höhe die Vertraulichkeit ebenso entfernen muss wie bei Arendt. Ein Fremder zu sein ist eine Last, eine Fremde zu sein ist bestimmt noch mehr eine Last, aber eben diese Last, wenn eine sie nicht loswerden kann und will, wird ihr zur Würde und Höhe des bios theoreticos verhelfen. Kristeva schreibt: Arendt erinnere uns daran, dass bios theoreticos grundsätzlich ein bios xenicos sei. Ein bios xenicos ist freilich nicht notwendig auch ein bios theoreticos. Ist aber eine »Fremdlingin« (Heidegger nennt Hannah im erwähnten Gedicht so) eine Theoretikerin, dann ist sie in dreifacher Weise ein xenos. Erstens eine Jüdin unter Deutschen, eine deutsche Jüdin in Amerika oder eben eine Bulgarin unter Franzosen. Zweitens: eine Frau unter Männern, ist erst recht fremd, wenn sie, heiße das wie auch immer, darauf beharrt, als Frau zu denken, sich an die Denkweise der Männer nicht anzupassen. Und drittens: als Denker unter Forschern; da bios theoreticos zu sein, heißt denken im heidegger-arendtschen Sinne, und nicht das Seiende erforschen, erkennen, damit der Mensch – nicht wir, die Menschen – maître et posesseur de la natur, das heißt reich und mächtig wird und in Sicherheit leben kann. Darum geht es eben. Um ein Leben, das eine ständige Neugeburt ist, sei es durch Liebe, oder durch Politik. Diese zwei Wörter, Liebe und Politik als Quellen der Neugeburt, verbinden miteinander Julia Kristeva und Hannah Arendt, diese außergewöhnlichen Mädchen aus der Ferne.
Denn jemand kann vielleicht darüber staunen, dass hier diesmal Julia Kristeva den »Hannah Arendt Preis für politisches Denken« übernimmt. Man könnte ja darüber staunen, sogar aus zweierlei Gründen. Man könnte einerseits sagen, dass Kristeva alles andere sei, nur keine ausgesprochene politische Denkerin. Andrerseits ist Kristeva nicht nur eine sehr bekannte Psychoanalytikerin von Beruf, sondern auch jemand, der zur Deutung der Psychoanalyse sehr viel Wichtiges beigetragen hat; und die Psychoanalyse bildet ihr den Ausgangspunkt bei der theoretischphilosophischen Analyse fast aller Erscheinungen, die sie interessieren, und ihr Interessenfeld ist wirklich vielschichtig und verzweigt; sie ist ein Mensch, und nichts Menschliches ist ihr fremd, auch das Fremdeste nicht. Arendt aber hat – und jetzt werde ich Kristeva zitieren – »die Psychoanalyse zeit ihres Lebens verachtet«. Dennoch hat Kristeva den ersten Teil ihrer Trilogie über »le génie féminin« Arendt gewidmet, und – auch unabhängig davon – das Staunen ist ganz und gar unbegründet. Einerseits ist Kristeva im Sinne Arendts doch eine echte politische Denkerin. Wie oft sie sich über die politischen Ereignisse unserer Zeit ausgesprochen hat, weiß ich nicht. Arendt scheint mir in dieser Hinsicht sicher aktiver gewesen zu sein. Hannah Arendt war aber nicht deshalb eine politische Denkerin, vielleicht die größte politische Denkerin des letzten Jahrhunderts, weil sie als politische Journalistin zeitweise ziemlich aktiv war. Sie war eine politische Denkerin, weil im Zentrum ihrer Erläuterung des Menschenlebens etwas stand, was sie Politik nannte; Politik nicht im Sinne, wie sie uns in unserer Zeit erscheint und meist aufgefasst wird, nämlich als Schlachtfeld der voreingenommenen, aneinander stoßenden Interessen, bei dem nichts anderes zählt als die Wohlfahrt und der Gewinn, der Fanatismus und die Herrschsucht, wo die öffentlichen Angelegenheiten vom Interesse und von der Macht gesteuert werden, sondern im Sinne der griechischen polis, in der die Menschen in der Gesellschaft von Gleichgesinnten auftraten, diese Gesellschaft genossen, zusammen handelten und vor der Öffentlichkeit erschienen, mit ihren Worten und Taten zum Gang der Welt beitrugen, und auf diese Weise ihre persönliche Identität erwarben und bezeugten und etwas vollständig Neues begannen. Gemeinsames Handeln und Denken gleich gesinnter Individuen, wobei ein jeder seine Individualität zustandebringen und aufzeigen will, wodurch auch etwas vollständig Neues in der Welt erscheint, die Geburt des Neuen, die ständige Erneuerung unserer Welten, das ist, was Arendt Politik, den wahren Gehalt der Politik nannte, und was im Zentrum ihres Interesses und ihrer Analysen stand. Die Geburt des Neuen durch das Handeln der Individuen, die während dieses Handelns außergewöhnlich werden, das bildet aber auch das Zentrum des Interesses von Julia Kristeva. Die zwei Fremden sprechen über dasselbe, was, wie Heidegger so oft betont, nicht das Gleiche ist, nämlich über den Beginn, über die Geburt des ständig Neuen, was in ihren Augen das Spezifikum der Menschen ist. Initium ergo ut esset, creatus est homo, zitiert Arendt 1929 Augustin in ihrer Dissertation über den Liebesbegriff bei Augustin. Bei Augustin ist das Neue in der Liebe geboren. Im Jahre 1929 wusste Arendt noch, dass auch die Liebe der Neubeginn des Individuums ist, nach 1933 steht im Zentrum ihres Interesses – aus wohl begreifbaren Gründen – ausschließlich der politische Raum als der Geburtsort des Neuen. Sei es aber wie auch immer, das Interesse für die Geburt des Neuen und die Überzeugung, dass ohne permanente Neugeburten kein echtes, das würdiges Menschenleben möglich ist, ist das Gemeinsame bei Arendt und Kristeva. Deshalb konnte Julia Kristeva trotz Arendts Verachtung der Psychoanalyse und, was noch wichtiger ist, trotz der Enge der arendtschen Sicht, nämlich dass sie sich die Geburt des Neuen ausschließlich in einem politischen Raum vorstellen konnte, für dessen Neuschaffung die Chancen in unserer Zeit nicht allzu groß sind, die Größe, die Genialität der politischen Denkerin verstehen und darstellen. Übrigens meint Kristeva, dass hinter Arendts Verachtung der Psychoanalyse ein falsches Bild der psychoanalytischen Einstellung stecke. In der Psychoanalyse sah sie nämlich »eine szientistische Reduktion des ›Lebens des Geistes‹ auf Gemeinplätze«. Hat Arendt vielleicht zu viel Freud und zu wenig Melanie Klein (das zweite weibliche Genie) und Lacan gelesen? Kristeva zeigt uns, dass Arendts Analysen von persönlichen Lebensgeschichten oft ganz nah zur Psychoanalyse standen. Als zum Beispiel Arendt über die Gefasstheit von Rahel Varnhagen spricht, bemerkt Kristeva: »Während dieser Begriff an Heideggers Entscheidung oder Entschlossenheit erinnert, stellt der psychologische Kontext, in dem Arendt mit ihrem ›Beispiel‹ Rahels steht, ihre Überlegung eher in die Nähe der Psychoanalyse als der Ontologie. Rahels Biografin führt eine eindringliche Analyse der Spaltung der hysterischen Persönlichkeit durch, so wie Analytikerinnen sie zur gleichen Zeit zu beschreiben beginnen – als ›Maskerade‹ nach Joan Riviere oder als ›Persönlichkeiten als ob‹ nach Helene Deutsch.«
mmer wieder wird also die Wiedergeburt in der Liebe und in der Politik, in der ständigen Befragung unseres Lebens betont. »Nicht mehr ewiges Glück noch Wiedererinnerung an das Sein Gottes in der Glückseligkeit des Liebenden, ist das Leben nun eine Frage. … Das Leben, das sich nicht befragt, das Leben in der Gewohnheit erscheint nunmehr nach biblischem Denken als ›wahre Sünde‹, mehr als irgendein Begehren. … Arendt beharrt auf dem Leben als Konflikt …« Der »psychische Raum des Fragens ist genussbringend, er garantiert das Überleben des Lebenden durch die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, aber nur insofern das Subjekt fähig ist, sich der Autorität oder auch einfach nur der Grenze des Anderen entgegenzustellen. Genuss der Liebe, gewiss, aber der Liebe als Konflikt: in einem Zustimmung und Verweigerung, Freude und Leid.« Kristeva schreibt diese Zeilen über Hannah Arendts Augustin-Interpretation. Könnte hier nicht im Text statt Liebe Auftritt des Individuums im öffentlichen Raum stehen: Auch die arendtsche Politik garantiert das Überleben des Lebenden durch die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen innerhalb eines Konflikts, der in einem Zustimmung und Verweigerung, Freude und Leid ist. Erinnert das, was Kristeva am Anfang ihres Buches Geschichten von der Liebe, im »Lob der Liebe« schreibt – »… was ist die Psychoanalyse anderes als eine endlose Suche nach Wiedergeburten vermittels der Liebeserfahrung, die immer wieder gemacht wird, um verschoben, wieder aufgenommen und, wenn schon nicht abreagiert, so doch gesammelt und eingesenkt zu werden in das künftige Leben des Analysanden als verheißungsvolle Voraussetzung für seine ständige Erneuerung, seinen Nicht-Tod?« –, erinnert das nicht an Hannahs Lob der polis, des Raumes, der alleine fähig war zu erreichen, dass es sich lohnte die Last des Lebens zu ertragen und auch im Schatten des persönlichen Todes zu leben? Die Liebe und die Politik sind so aufgefasst, wie Kristeva sagt: »Versöhnung mit der Erfahrung unseres eigenen Verlustes«. (»Der Skandal des Zeitlosen«) Keine Erlösung, keine Auferstehung, daran können die modernen Menschen nicht mehr glauben, sondern endlose Suche nach Wiedergeburten. Jeder Abschluss, das Erreichen des Zieles, ist, wie bekannt, der Tod selbst. Damit hängt aber auch Kristevas Kritik an der Enge der Einstellung der späten Arendt zusammen. Gewiss hat Arendt die Politik erotisiert, und Kristeva stellte die Liebe im arendtschen Sinne politisch dar. Kristeva weiß aber genau, dass die Ethik der Moderne die lästige und unvermeidliche Problematik des Gesetzes nicht umgehen kann, was Arendt im Zusammenhang ihrer erotisierten Politik zu vergessen schien; deshalb stand sie ganz verzweifelt in einer Welt, in die die Politik, so, wie sie in der polis und dann in der Moderne alleine in der amerikanischen Revolution war (vielleicht noch in der ungarischen von 1956), nicht mehr zurückkommen kann. Sie hat nicht den Versuch gemacht, der Problematik des siegreichen Gesetzes »dem Körper Sprache und Lust zu verleihen« – was Kristevas Meinung nach nur Frauen mit ihrem Wunsch nach Reproduktion neu formulieren könnten. »Damit das Denken des Todes erträglich wird: Die Häretik ist NichtTod, Liebe …« Kristeva kritisiert auch Arendts starre Gegenüberstellung von Privatem und Öffentlichem. Sie sagt einerseits: »Man kann die Kühnheit, mit der sie die der Ökonomie unterworfene ›Gesellschaft‹ kritisiert, nur begrüßen, nachdem das Gesellschaftliche in der Tat zum Gemeinplatz jeder Politik, von rechts wie von links, geworden ist. Außerdem ist die Versuchung groß, Hannah Arendts Plädoyer gegen das Gesellschaftliche in die Nähe der psychoanalytischen Unterscheidung zu rücken, die zwischen dem Bedürfnis einerseits, das das Subjekt an das Archaische und die mütterliche Abhängigkeit bindet (was Arendt ›Haushalt‹, ›Ökonomie‹ und vitalistische ›Gesellschaft‹ nennt), und dem Begehren andererseits, das die gefahrvolle Freiheit der Beziehungen zu anderen öffnet (was sie den ›Raum des Erscheinens‹ und der ›politischen Aktion‹ nennt), differenziert.« Sie will aber andererseits dennoch »die Grenze des arendtschen Plädoyers gegen eine von der Ökonomie überflutete und dadurch die Freiheit der polis verschlingende Gesellschaft hervorheben«. Sie kritisiert die zu enge Auffassung des Ökonomischen, des Weiteren Arendts Behandlung des Körpers und des psychischen Lebens und der Intimität, die sie alle notwendig unpolitisch und zum Allgemeinen angehörig sieht. Will Kristeva etwa sagen, dass es sich lohnt, auch in einer Welt zu leben, in der der polisartige politische Raum die Gesellschaft nicht in den Privathaushalt zurückdrängen kann, und die Chancen, dass einzig und allein die polisartige Politik die Welt gestaltet und sie permanent neu gebärt, sehr gering zu sein scheinen? Ich meine wohl. Auf dieser Weise hat sie sich aber Arendt nicht gegenübergestellt, sondern mit Hilfe der Psychoanalyse ihre ganz originelle Sicht erweitert.
Zum Fremden in uns offen bleiben
Guten Abend, bonsoir, Julia. Julia Kristeva wird es verstehen, wie schwierig es ist für einen Frankfurter, eine Woche nach der Niederlage nach Bremen zu kommen, aber ich tue es gern, weil es für dich, Julia, ist. Es gibt einen wunderschönen Begriff, den hat sie vorhin zitiert, »je me voyage«, das ist so die Definition praktisch dessen, was sie ist. Das ist zwar eine Heldin eines ihrer Romane, aber das ist sie selbst. »Ich bereise mich« – und ich nehme sie mal mit auf Reise. Julia Kristeva ist ja in Bulgarien geboren, 1941, und die Frage ist ja dann, wenn Sie sich vorstellen wollen, Julia Kristeva, ja, was sagen Sie denn? Bulgarin? Französin? Ich könnte sagen, willkommen, sie ist Europäerin, denn Bulgarien ist gerade beigetreten, das macht es mir einfacher zu sagen, sie ist Europäerin. Aber so einfach ist es nicht. Um das mal herauszubekommen, möchte ich einen Gedanken von Amin Maalouf, das ist ein … und schon fängt es wieder schwer an … Amin Maalouf, ja, was ist er? Ein in Libanon geborener Schriftsteller, das ist noch einfach, ist Franzose oder Libanese? Genau diese Frage, sagt er, Amin Maalouf, stelle man ihm immer: Ja, was bist du eigentlich? Bist du Libanese oder bist du Franzose? Und er sagt: sowohl als auch. Ja klar, du bist sowohl als auch, aber in der Tiefe deines Herzens – was bist du? Wenn du Schwierigkeiten hast oder wenn du dich identifizieren musst, was bist du? Und er sagt, ich bin weder noch. Ja, zur Hälfte bist du Franzose und zur Hälfte bist du Libanese. Nein, es gibt keine halbe Identität, es gibt keine Teilidentität so und eine Teilidentität so, ich bin ein Ganzes, und als Ganzes bin ich, und dann sagt er, ich zitiere ihn jetzt, ich zitiere auf Französisch und übersetze ihn gleich mit – also: »Ich werde immer unter Druck gesetzt, ich muss mich jetzt entscheiden, aber nicht nur unter Druck gesetzt von Fanatikern oder Xenophoben, sondern von Menschen wie Sie und ich, die immer die gleiche Frage stellen. Weil es eben diese Gewohnheit gibt, dass man immer wieder versucht, die Identität, und zwar diese bigotten Versuche, die Identität immer auf einen Kern zu reduzieren. Als gäbe es einen Kern der Identität – dagegen muss man protestieren, und ich sage mit Wut, ich habe keinen einen, eindeutigen Kern, sondern meine Identität ist multipel, ist mehrdeutig.«
Sie werden sagen, das ist eine Banalität, eigentlich könnte das jeder sagen, jeder Intellektuelle, jeder gut meinende Mensch, und am Stammtisch der Intellektuellen habe ich einen gefunden, einen absolut brillanten Menschen, der hat den Blitzableiter erfunden, gar nicht schlecht, der zählte zu den Erstunterzeichnern der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, also jemand, der Tocqueville sehr beeindruckt hat. Der hieß Benjamin Franklin und hat 1751 ein Pamphlet geschrieben über die pfälzischen Bauern, es ging um Identität, um das Sein. Und ich schwöre, ich bin zwar absolut laizistisch, aber ich schwöre bei allem, was ihr wollt, dass das, was ich jetzt vorlesen will, kein Scherz ist, sondern Realität, es wurde so geschrieben. Es ging um einen Streit, um die pfälzischen Bauern als deutsche Einwanderer in Amerika. Diese deutschen Einwanderer waren meistens Katholiken. Sie kamen aus der Pfalz, und sie waren anders als die anderen Einwanderer, die Anglikaner. Und zwar anders in einem ganz einfachen Sinn. Die Anglikaner arbeiten sieben Tage die Woche, oder sechs Tage die Woche, am siebenten Tag gehen sie zur Kirche, morgens, und dann bleiben sie praktisch zu Hause. Sie kennen das, es war lange Zeit zum Beispiel unmöglich, ein Fußballspiel oder Tennisspiel in Wimbledon am Sonntag durchzuführen. Die Katholiken, die pfälzischen Bauern, hatten eine andere Tradition. Sie arbeiteten sechs Tage die Woche und am siebenten Tag gingen sie auch in die Kirche, aber danach ging es ins Bieroder Weinzelt und dann ließ man die Sau raus. Und das hat die Anglikaner furchtbar gestört, die haben diese Zelte angezündet, das war ein richtiger Kulturkampf. Und daraufhin schrieb also dieser Benjamin Franklin über die ethnische Reinheit Amerikas, ich erfinde nichts: »Die Zahl ganz weißer Menschen in der Welt ist verhältnismäßig sehr klein. Ganz Afrika ist schwarz oder dunkel, und ganz Amerika, außer den Neuankömmlingen. Und in Europa haben die Spanier und Italiener, Franzosen, Russen und Schweden das, was wir gewöhnlich eine dunkle Hautfarbe nennen. So sind die Deutschen dunkel, mit Ausnahme alleine der Sachsen, die mit den Engländern die Hauptmasse der weißen Bevölkerung auf der Erdoberfläche ausmachen. Ich wollte, es wären ihrer mehr.« [Lachen im Publikum.] Ja, manchmal ist es nicht zum Lachen. Daraufhin antwortet Julia Kristeva in Fremde sind wir uns selbst: »Da ein neues gemeinschaftsstiftendes Band fehlt – eine Heilsreligion, die die Masse der Umherirrenden und Differenten in einen neuen Konsensus einbinden würde, einen anderen als den von mehr Geld und Gütern für alle –, sind wir das erste Mal in der Geschichte dazu gezwungen, mit anderen, von uns gänzlich verschiedenen zu leben und dabei auf unsere persönlichen Moralgesetze zu setzen, ohne dass irgendein unsere Besonderheiten umschließendes Ganzes diese transzendieren könnte. Eine paradoxe Gemeinschaft ist im Entstehen, eine Gemeinschaft von Fremden, die einander in dem Maße akzeptieren, wie sie sich selbst als Fremde erkennen. Die multinationale Gesellschaft wäre somit das Resultat eines extremen Individualismus, der sich aber seiner Schwierigkeiten und Grenzen bewusst ist – der nur Irreduzible kennt, die bereit sind, sich wechselseitig in ihrer Schwäche zu helfen, einer Schwäche, deren anderer Name unsere radikale Fremdheit ist.« Dies ist die Herausforderung, der sich Julia Kristeva gestellt hat. Nun gibt es aber einen Lackmus-Test, um zu wissen, ob dies stimmt und worin die Schwierigkeiten liegen. Es ist ein Moment der Hölle, es ist ein Moment, in dem man nicht mehr weiß, wo man ist und wie man ist. Sie werden es nie erraten, was dieser Lackmus-Test ist. Vielleicht errät sie es, wenn ich ein Datum sage: 17. November 1993. Le 17. novembre 1993. Ich bin zuvor durch diese Hölle gegangen am 8. Juli 1982. Sie wissen immer noch nicht, was dieser Lackmus-Test ist. Am 8. Juli 1982 spielte Frankreich gegen Deutschland und wurde im Halbfinale der Weltmeisterschaft ungerechterweise dann von Deutschland nach Hause geschickt nach dem Elfmeterschießen, in Sevilla. Es war furchtbar. An diesem Tag, und das muss man sehen, warum war ich Franzose? Vielleicht weil an dem Tag der Fußball, den ich als Kind gelebt habe, also das, was man als Kind hat, die Identität doch mehr prägt. Und das ist jetzt meine Frage an Julia Kristeva, der 17. November 1993. Sie hat sich herumgetrieben als kleines Kind mit ihrem Vater auf Fußballplätzen in Bulgarien. Und am 17. November 1993 hat Bulgarien Frankreich in die Wüste geschickt in der Weltmeisterschaftsqualifikation. Ich weiß nicht, ob sie da zugeschaut hat. Hat sie zugeschaut, weil sie sehr oft Fußball schaut, würde ich gern wissen, ob sie traurig oder glücklich war an diesem Tag. Es war ihre Kindheit und es war ihre Realität, denn seit 1965 lebt sie ja, wie wir wissen, in Frankreich.
Lassen wir die Reise von Julia Kristeva einfach mal Revue passieren. Sie ist eine Intellektuelle, sie hat politische Theorien besetzt, sie hat die Freiheit versucht auf allen Ebenen, ging nach China, schrieb ein Buch nachher, Die Chinesin, gehörte einer Gruppe an, »telle quelle« in Frankreich, in der sie versucht hat, in der man etwas Verrücktes versucht hat, nämlich: Gibt es im Maoismus, gibt es in dem, was in China entsteht, doch so etwas wie eine Transzendierung der Freiheit, die wir uns wünschen? Nach der Reise in China war sie, muss man sagen, ein bisschen enttäuscht. So schien es doch nicht zu sein mit der Kulturrevolution. Aber dieser Wunsch, politisch immer weiter zu denken, sich zu entwickeln, das hat sie oder war sie dann, hat die verschiedensten politischen Theorien, und sie hat keine Angst gehabt, wenn der Präsident Jacques Chirac sie gefragt hat, ob sie einen Bericht machen könnte über Behinderung, weil sie meint, behinderte Menschen sind in unserer Demokratie nicht …, dann hat sie es gemacht. Sie hat keine Angst im Laufe der Zeit gehabt, sich mit allen zu konfrontieren, sie hat einen Frauenstandpunkt gehabt, hat aber keine Angst gehabt – also Angst in dem Sinn von intellektueller Herausforderung – sich mit den Feministinnen auseinander zu setzen. Sie hat Stellung bezogen zum Migrationsprozess, zur politischen Theorie, hat zur Psychoanalyse gefunden, das heißt den Weg zu sich selbst, sich mit sich selbst auseinander zu setzen. Die Psychoanalyse hat sie dazu gebracht, nicht nur Psychoanalytikerin zu werden, sondern wirklich die Psychoanalyse in der Bedeutung des Gesellschaftlichen auch mit zu benutzen. Und sie suchte immer in ihrer Interpretation der Literatur und der Menschen, ob sie Simone de Beauvoir oder Paul Celan beschrieben hat, in diesem Moment der Literatur Sexualität, Emotion, Poesie zu finden. Dann hat sie am Ende eine Trilogie geschrieben, Genie des Wahnsinns, drei Frauen – Hannah Arendt, Melanie Klein und Colette. Und ich glaube, Hannah Arendt steht für die politische Philosophie, Melanie Klein steht für die Psychoanalyse und Colette für die Lust, für den Spaß, für Sexualität im weitesten Sinne. Und in dieser Auseinandersetzung kommt dann, dass wir uns fragen sollen: Ja aber, wo steht sie, und ist es nicht vermessen und grandios zugleich? Dieses feminine Genie, das sie beschreibt, in drei Werken und drei Frauen. Dass sie eigentlich uns sagt und wir es akzeptieren und wir staunen, dass jemand die Kraft, die Chuzpe und die Stärke hat zu sagen, ich bin das, diese drei Frauen bin ich auch, oder ich will es sein, ich will diesen Weg gehen. Und das finde ich eine der, wenn Sie wollen, tollsten intellektuellen Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, und das ist für mich Julia Kristeva. Und wenn man sie dann fragt, oder wenn sie selbst beschreiben soll, was ihr Denken ist, ich zitiere: »Je ne me sens pas d’humeur conclusive, pas encore: les épreuves m’ont appris à vivre dans l’ouvert. – Ich verspüre nicht das Bedürfnis, zu beenden, zu beschließen, noch nicht: Die Herausforderungen haben mich gelehrt, dass ich offen bleiben muss.« Und dann kommentiert sie weiter: »Celui qui n’a pas d’épreuves ou, plutôt, qui les dénie se contente en réalité d’une identité jalousement gardée. – Der, der nicht mit Herausforderungen konfrontiert war oder sie verneint, der hat eine verschlossene Identität.« – »Il conserve ainsi ses limites, ses principes, ses protections qui lui servent d’antidépresseurs. – Er behält das, was er verschließt, ein Antidepressivum, aber er kann sich der Welt nicht öffnen.« – »Au contraire, l’épreuve peut nous offrir l’occasion de ›faire nos preuves‹, – die Prüfung kann uns die Gelegenheit geben, uns zu beweisen, zu beweisen, was wir können und was wir wollen«. Die Prüfung, l’épreuve, »met à mal les frontières et nos défenses et ne nous laisse pas beaucoup de choix ; soit on se déprime, soit on met en question valeurs et certitudes. J’essaie, dans ma vie et dans ma pensée, de me tenir dans ce questionnement. – Diese Prüfung geht an die Grenzen unserer Möglichkeiten. Entweder können wir diese Herausforderung nicht meistern, oder wir sind in der Lage, unsere Sicherheiten, unsere Werte zu hinterfragen.« Und dann resümiert sie ihr Denken: »Un projet sans programme, un état de surprise permanente face aux phénomènes, aux discours, au sens et au non-sens, qui me libèrent de ce qui a eu lieu ainsi que de mes jugements antérieurs, et qui m’incitent à une sorte de dépassement. Je vis avec ce désir de sortir de moi.« Das heißt, sie sagt ganz einfach: »Ich habe ein Projekt ohne Programm, das mich einschließen, beschließen wird. Ich will – sie hat ja Hannah Arendt vorhin zitiert – un état de surprise, die Überraschung, in der Lage zu sein, die Überraschung des Seins auch aufzugreifen, und diese Überraschung, das Akzeptieren der Überraschung, ist ein Moment der Befreiung, der Befreiung des Denkens.« Und sie endet, indem sie sagt, »ich lebe mit diesem Wunsch, mit diesem Bedürfnis, aus mir herauszukommen, aus mir herauszugehen«. Das ist, glaube ich, das, was Hannah Arendt – sehen Sie, ich wusste es, irgendwann würde dieses auch passieren – was Julia Kristeva uns sagt. Und dann, politisch steht sie dazu – und das ist selten für Leute unserer Generation, dass man immer noch dazu steht – ja, sagt sie, man hat das Recht zu revoltieren. Ja, sagt sie, Revolten gehören dazu, und sie, ich zitiere sie auch hier wieder, weil ich sehe, es sind auch viele Eltern hier, und das, was ich hier zitiere, bereitet uns allen Schwierigkeiten, wenn wir Ja zu dem sagen, und das sagen wir meistens, weil wir ja von der richtigen Generation sind, ja, aber das ist doch nicht so einfach, also: »Oui, on a raison de se révolter. – Ja, man hat das Recht, es ist richtig zu revoltieren.« „Et ce n’est pas simplement un bon mot de flatter. – Es ist nicht nur so gesagt, um zu gefallen.« »La révolte constitue notre intégrité psychique. – Die Revolte strukturiert unsere psychische Integrität.« Unsere psychische, »la vie psychique, le psychisme comme vie«. Es ist im Innern unserer Psyche. Und jetzt kommt es, Eltern aufpassen: »Si l’enfant ne se révolte pas contre le père ou la mère, si l’adolescent ne crée pas une réalité rebelle contre ses parents, contre l’école et contre l’État, il est tout simplement mort. – Wenn das Kind sich nicht gegen den Vater oder die Mutter auflehnt, wenn der Jugendliche keine aufsässige Wirklichkeit gegen seine Familienmitglieder schafft, gegen die Schule und gegen den Staat, ist er ganz einfach gestorben.« Jaa!? Wie viele adoleszente Kinder haben wir, und leiden wir oder leiden wir nicht unter dieser Revolte, und sind wir in der Lage, diese Revolte auszuhalten? Dies ist eine, meiner Meinung nach, wichtige Frage. »Il se prive l’enfant de la possibilité d’innovation et de création, il devient un robot. – Ein Kind, das nicht gegen seine Eltern revoltiert, ein Kind, das nicht gegen die Schule revoltiert, ein Kind, das nicht gegen den Staat revoltiert, wird zum Roboter.« Wollen wir das? »Cette grande question générale … brulant. – Diese große Frage ist von einer brennenden Aktualität«, für uns Eltern auf alle Fälle. Was ich damit zeigen will, wenn sie dann über Sartre in ihren Vorlesungen spricht, über Simone de Beauvoir, ist sie nicht blind, und wenn sie zum Beispiel den Prozess beschreibt, als Sartre seinen Nobelpreis abgelehnt hat, mit welcher antibürgerlichen Haltung, dass er gleichzeitig aber den Kommunismus akzeptiert hat, den Totalitarismus akzeptiert hat – also dass diese antibürgerliche Attitüde einherging mit einer bürgerlichen Blindheit und so weiter. Sie entzaubert den ganzen Zauber des Lebens, und trotzdem ist man immer wieder verzaubert von dieser Suche nach einem Nicht-, nicht nur nach einem nicht-korrekten Denken, sondern von der Suche nach einem Denken, das auch aufsteht und Nein zu dem, was in der Welt geschieht, sagen kann.
Zum Schluss möchte ich wiederum sie zitieren, und zwar aus dem Buch über Hannah Arendt, das sie geschrieben hat. Und zwar, weil es ja ganz spannend ist, sie versucht aus dem Feminismus diese Antimütterlichkeit zu entreißen. Sie sagt, eine Frau, das, was eine Frau auch schafft, definiert, ist eben Leben zu schaffen. Und sie analysiert, und das ist sehr interessant, was bei Hannah Arendt, obwohl Hannah Arendt selbst nicht Mutter war, trotzdem sehr früh diese auch als menschliche Gabe definiert hat. Und so endet ihr Buch über Hannah Arendt: »Eine volle erfahrene Natalität umfasst notwendigerweise geboren werden, Leben geben, die Singularität einer jeden Geburt bejahen, ständig im Leben des Geistes wiedergeboren werden. Ein Geist, der ist, weil er in der Pluralität der anderen neu beginnt und nur unter dieser Bedingung als ein lebendiges Denken wirkt, das jede andere Tätigkeit überschreibt. Doch das Wunder« – nicht von Bern – »verwirklicht sich sogar in einem einzigen Ausschnitt dieser vollen Erfahrung, die es durch das Versprechen rechtfertigt, das sie öffnet, und durch das Verzeihen, das sie markiert. Arendt hat das geteilt, denn sie war unbestritten eine der seltenen Personen unserer Zeit, die jene Glückseligkeit verwirklichte, in der Leben Denken heißt. Schrieb sie doch, obwohl ihr die Wonnen des Denkens unaussprechlich waren, die einzige denkbare Metapher für das Leben des Geistes ist die Empfindung des Lebendigseins. Hannah Arendt lädt uns ein, ohne allzu große Illusionen, unter dem Zeichen eines sich überkreuzenden Verzeihens und Versprechens, ein politisches Handeln, das einer Geburt gleicht und Schutz vor Fremdheit bietet, zu denken und in der Gegenwart zu leben.« Das ist auch Julia Kristeva.
Zunächst möchte ich der Jury des Hannah-Arendt-Preises, dem Senat des Landes Bremen und der Heinrich-Böll-Stiftung sehr herzlich für die Ehre danken, mir den diesjährigen Hannah-ArendtPreis für politisches Denken zu verleihen – in diesem Jahr, in dem sich der Geburtstag der Philosophin zum hundertsten Male jährt. Ich möchte gern glauben, dass Sie durch mich hindurch jene rätselhafte Kraft des arendtschen Werkes willkommen heißen, die ein so genanntes breites Publikum zu berühren in der Lage ist; ein Publikum, das ich – im Sinne Arendts – ein »Publikum der Meinungen« nennen würde. Können wir heute als Mittler wirken zwischen der Existenz dieser Frau, die sich auf eine Weise als »exponiert« wahrnahm, dass sie, wie sie es ausdrückte, zu einem »Treffpunkt und einer konkreten Objektivierung des Lebens« werden konnte; und eben dieser »Meinungswelt« die, heute, am Beginn des dritten Jahrtausends, mehr denn je darauf bedacht ist, die Fäden des Politikvertrages, der die Männer und Frauen regiert, in Schwingung zu versetzen. Um die Autorität dessen, was uns (ver-)bindet mit der Unberechenbarkeit jedes Einzelnen von uns ebenso zu versöhnen wie die Pluralität der Welt mit dem auf das Urteilen hin ausgelegten Leben des Geistes. Diese Gedanken stehen hinter meinen heutigen Dankesworten.
Möchte ich dies gern glauben, weil ich auf meine Weise auch »ein Mädchen aus der Fremde« bin (so wie sich Arendt, das Gedicht Schillers aufnehmend, selbst bezeichnete)? Dass mir von meinen Ursprüngen auf dem Balkan her eine Mischung aus Juden- und Christentum übertragen wurde, die auch am arendtschen Denkhorizont erscheint? Dass »ich mich selbst bereise« in der europäischen Kultur, wie es die Heldin meines letzten Romans Meurtre à Byzance (»Mord in Byzanz«) ausdrückt? Dass ich, auf meine Weise, die Fremdheit und die Melancholie der globalisierten Welt, aber auch die von ihr hervorgerufene Freude erlebe? Möchte ich dies gern glauben, weil ich, Sprach- und Literaturtheoretikerin, die zugleich Psychoanalytikerin ist, versuche, die ecceitas (die Diesheit) des quid (des konkreten Dieses) auszuloten? Diese personale Eigenheit im Denken, ohne die uns, so Arendt, nur die »Banalität des Bösen« und der »Terror« bliebe. Aber auch das arendtsche »Versprechen« und »Verzeihen«, deren moderne Version nichts anderes ist als die psychoanalytische Deutung, wenn sie uns gestattet, wiedergeboren zu werden? Wobei die Psychoanalyse Hannah Arendt stets opak blieb, obschon das Leben und das Werk der Philosophin jene in vielfältigen und ungewohnten Weisen herausfordern. Möchte ich dies gern glauben, weil sich meine Kindheit und Jugend in einem totalitären Land abspielten, und ich sehr rasch das größte Misstrauen gegenüber totalitären Latenzen gewisser Befreiungsbewegungen selbst innerhalb unserer Demokratien, bis hin zum Feminismus, empfunden habe? Und dass ich die Befürchtung nicht loswerde, dass irgendein neuer Totalitarismus hinter der Maske der monotheistischen Fundamentalismen aufkeimt? Aus all diesen Gründen hat sich mir der Name Hannah Arendts unmittelbar aufgedrängt, als ich mich mit meiner Trilogie Das weibliche Genie vom Massenfeminismus absetzen wollte und begann, eine Eloge auf die weibliche Schöpfungskraft anzustimmen. Dies ist nicht der Ort, um im Detail auf meine Begegnung mit Arendt einzugehen oder auf die Reflexionsgänge, die sie mir eröffnet hat. Dies habe ich in dem Band getan, den ich ihr gewidmet habe. Diese Gänge erweitern sich immer mehr. Wenn ich aber ein einzelnes Charakteristikum hervorheben sollte, um den Einschlag zu beschreiben, den ihr Werk bei mir verursacht hat – und um ihn anlässlich der Verleihung dieses Preises, der ihren Namen trägt, an diejenigen weiterzugeben, die sie entdecken oder wiederentdecken – dann würde ich ihn folgendermaßen benennen: eine unwiderstehliche Fähigkeit zum Überleben. Das französische Wort »survie« meint das, was dem Tode entkommt und legt gleichzeitig ein Vermögen nahe, über und jenseits des Todes zu leben; aber auch über und jenseits des biologischen Lebensprozesses (zoe) selbst. Denn für Arendt ist dieses »Über-leben« in dem Glück, so ihr Wort dafür, zu denken und zu urteilen verwurzelt. Dies scheint mir tatsächlich der rote Faden zu sein, der sich durch das Leben und das Werk dieser Frau hindurchzieht. Dieser Frau, die während einer der tragischsten Phasen der Menschheitsgeschichte, jene der Shoah, lebte. Sie hielt sich davon fern, eine Doktrin oder gar ein System des Wissens zu verkünden (eine »Verfehlung«, die ihr pflichtschuldig vorgeworfen wurde!). Vielmehr erfand sie ein Denken in Bewegung, das seine Wurzeln in der Erfahrung hat. Es schöpft aus einer sensiblen, dem Narrativen ähnelnden Einbildungskraft, zögert nicht zu urteilen, und vor allen Dingen erreicht es sein Ziel: nämlich zu überraschen. Ist dies nicht die beste, wenn nicht die einzige Art und Weise, den philosophischen Gestus selbst zu rehabilitieren – ihn, der seit den Griechen ein Überraschtsein, ein »thaumazein«, ein Erstaunen war? Diesen Gestus am offenen Herzen der Verzweiflung unserer modernen Welt zu rehabilitieren, die, so Arendt, den »Faden der Tradition zerschnitten« hat? Aber auch: durch die Erneuerung der Spannung, der Aufmerksamkeit und der Debatte ein politisches Interesse und ein unmittelbares Handeln hic et nunc zu provozieren? Tatsächlich durchzieht eine ständige Spannung, wie wiederholt festgestellt wurde, alle Vorstöße Arendts innerhalb dieses von Heidegger ererbten Abbaues der Metaphysik, den sie auf ihre Weise weitertreibt. Zunächst überraschen uns ihre Vorstöße mit ihren Ambiguitäten, und später dann mit der Eröffnung dieser von mir hervorgehobenen Erfahrung des Erstaunens: Des Erstaunens der Autorin selber, die ihre Freude am Denken nicht verhehlt, und das gleichfalls zum Erstaunen des Lesers wird. Und – es gelingt ihm, die Klemmen sowohl der Subjektivität als auch der Politik zu lockern. Und das effektiver, als es die politiktheoretische Metasprache der Philosophen und professionellen Politologen vermag. Ich für meinen Teil bin überzeugt, dass es keine anderen Mittel gibt, um jenen Kräften des Todes entgegenzutreten, die heutzutage unter den Masken des religiösen Extremismus oder der Automatisierung der Gattung im Vormarsch sind, als eben diese Fähigkeit des Überlebens, welche aus dem Glück zu denken und zu urteilen herrührt. Um Sie davon zu überzeugen, will ich vier aktuelle Themen anführen, auf die Hannah Arendts Werk ein erhellendes Licht wirft: Weil das Erscheinen in der Welt zugleich das Denken und das Urteilen strukturiert, wird nur die Meinung die Gewalt besiegen können. Aber die Politik der Meinungen kann nur dann ein (mögliches) Gegenmittel gegen die kalkülhafte Politik sein, wenn sie die urteilende Scharfsichtigkeit (phronesis) der das, »was geschieht«, teilenden und erzählenden Zuschauer versammelt. Indem ich mit meiner Meinung »meine Offenbarung riskiere«, durch mein Erscheinen in der Einzigartigkeit meiner Meinung, mache ich aus dem politischen Raum einen Ort der Selbstanalyse, einen Ort sich fortsetzender Wiedergeburt – einer jeden Subjektivität. Durch erfundene Geschichten stoße ich wahre Geschichten an, und wir schaffen zusammen die Zeit des Politischen am Schnittpunkt des Vergangenen und des Zukünftigen. Wenn die Noblesse des Politischen in dieser Fähigkeit beruht, erneuernde Besonderheiten zu offenbaren, uns jeden von uns zu offenbaren, so könnte es doch nicht existieren ohne jene Referenzpunkte und Grundlegungen, die ihm die Triade Autorität – Religion – Tradition in früheren Zeiten verschaffte und die im Zuge der Säkularisierung geschwächt worden sind. Nichtsdestotrotz: Wir, die wir weder Traditionsnostalgiker noch angesichts der Risiken einer »irreparablen« Säkularisierung in Schreckstarre verfallene Zensoren sind, sind wir fähig zu einer Wiedergründung? Dies ist die metaphysische Frage, die unterhalb der Entpolitisierung unserer Zeit verspannt ist. Diese Wiedergründung ist nicht zu vollbringen in Form einer Wiederbelebung der gleichen Autorität, der gleichen Religionen und der gleichen Traditionen aus der Vergangenheit. Sondern durch deren »ewige Wiederkehr« im urteilenden Denken, das in der Pflicht steht, das in ihnen Ungedachte ans Licht zu bringen. Und während es uns Schutz in der alten Gründung bietet, modifiziert es diese durch die neuen Entdeckungen, die unseren pluralen Leben Sinn wiedergeben können, und durch die die Gründung eine Erhöhung erfährt. Schließlich macht Arendt auf eine ganz ungewöhnliche Weise die Frage der Verantwortung der Aufklärung für die neuen Formen des Antisemitismus auf. Diese Kühnheit führt sie zu einem weiteren Spannungsverhältnis: ihre Schreckensanalyse der europäischen Genealogie der Shoah entwickelt sie eben mit Hilfe des kontinuierlich aufklärerischen europäischen Erbes selbst. Und sie lädt uns ein anzuerkennen, dass die »Kämpfe für die Freiheit« in Europa und Israel »identisch« sind. Heute vielleicht mehr denn je, angesichts der neuen Formen des Totalitarismus.
I. In der Welt erscheinen
Inspiriert durch Heidegger – jedoch ihr eigenes Denken behauptend – wagt Arendt, überlebend, im Angesicht der Geschichte des Nihilisimus eine Rekonstruktion, die die Niederlage der Vernunft transformiert: Dabei sucht sie weder Zuflucht bei einem »Denken, das die Wahrheit des Seins denkt« (Heidegger), noch gibt sie sich zufrieden mit dem bloßen Wissen um die Bedeutungen (Merleau-Ponty). Vielmehr geht es darum, ein anderes Denken vorzubringen, das ein Denken der Welt ist: von der Welt herkommend, auf die Welt bezogen, die Welt konstituierend. »Es scheint mir« (»dokei moi«, nimmt Arendt das griechische Wort auf ), sage ich mit meinem Erscheinen, mit meinem Hineingeborenwerden in die plurale Welt. Am Anfang stünde also ein: »Es scheint mir«? Am Anfang wäre also die Einbildungskraft? Man ginge fehl, hielte man dieses »Scheinen«, diese »Einbildung« für einen inkonsistenten und leicht manipulierbaren Impressionismus. Ich erzeuge die Welt mit, wenn ich, mich ihr präsentierend, »es scheint mir« sage. Das heißt nicht, dass ich nur für die Blicke der anderen oder auf sie hin existiere. Die Blicke der anderen sind lediglich die phänomenale Bedingung meines Erscheinens, wie die Bühne, auf der ich gesehen werde. Die Geborenwerdend-Erscheinende, die ich bin, ist nur in dieser Wechselbeziehung der Verschiedenen, die die Welt bevölkern, ein Zuschauer. »Es gibt in dieser Welt nichts und niemanden, dessen bloßes Sein nicht einen Zuschauer voraussetzte.« Arendt erlaubt uns, den Sinn dieses modernen Phänomens der »Politik der Meinungen« besser zu verstehen. Gehen wir ihren Erörterungen noch etwas weiter nach. Die Welt bietet sich denen, die sie bevölkern, an, um sie zu Handelnden und Benennbaren zu machen. Und die Meinung, so wie Arendt sie denkt, ist gewissermaßen der »Unterbau« dieser Weltlichkeit, dieser Öffentlichkeit, dieser Morgendämmerung des Politischen. Konkret: Mit dieser für die Welt und jeden Einzelnen in ihr konstitutiven Pluralität greift Hannah Arendt auf zentrale politische Probleme unserer Tage vor, auf die klimatische und allgemein ökologische Interdependenz wie auch auf die sich ökonomisch wie informationell diversifizierende Globalisierung. Doch meine eigene Arbeit führt mich zu den Konsequenzen ihrer Reflexion über die Politik der Meinung unter heutigen Bedingungen. Nicht dass Arendt nicht mit großer Sorgfalt die Simulation, den bloßen Anschein, das Inauthentische und ganz besonders die Hochstapelei der Authentizität zurückgewiesen hätte. Doch warnte sie uns vor: Die Fähigkeit, mit den Erscheinungen zu spielen, ist integraler Bestandteil politischer Virtuosität – Spielregeln, wohlgemerkt, immer vorausgesetzt ... In der von Arendt vorgeschlagenen Entmystifizierung der politischen Tradition und der vorgeblich »wahren« Politik gibt es Sein konsequenterweise nur bei dem, der sich in die Epiphanie des inter homini esse begibt. Und diese Behauptung einer Realität, die rein phänomenaler Natur ist, hat nichts Zynisches oder Demagogisches an sich. Arendt beruft sich auf sie, um den politischen Raum von den Inhabern der »Wahrheit« und anderer »Werte« zu befreien, welche den Interaktionen von uns – uns verschiedenen Handelnden und Zuschauern – ansonsten zugrunde liegen. Ich sehe darin eine Einladung, den Wahrheitsanspruch einer gewissen politischen Klasse, wenn nicht gar der politischen Tradition selbst zurückzuweisen. Jenen Anspruch, vorgebracht von den Professionals einer ideologischen Tugendhaftigkeit, käme sie von der Rechten oder der Linken, vom Religiösen oder dem Atheistischen. Und nichts weiter als den elementaren politischen Mut dagegenzuhalten – welcher darin liegt, die Angst zu bezähmen, mit und vor all denen, die den öffentlichen Raum »bevölkern«, zu sprechen und zu handeln, und der so die »Öffentlichkeit« konstituiert. Und mithin die Erneuerung und Öffnung (wie es das deutsche Wort »Öffentlichkeit« nahe legt) dieser immer schon politischen Welt. Ihr »Held« par excellence ist der Citoyen, und zwar in dem Maße, in dem er »sich entschlossen hat, keine Furcht zu zeigen«. Eben keine Furcht zu haben, mit den anderen zu erscheinen. Aber diese Meinungen der Erscheinenden – wenn der Zuschauer zum Handelnden wird – können in der heutigen Welt des Spektakels nur dann einen Sinn haben, wenn wir es schaffen, als unverwechselbare menschliche »Jemande« oder »Wers« hervorzutreten.
II. Arendts »Wer« und die Psychoanalyse
»Wer sind wir?« in Opposition zum »Was sind wir?«: Dies ist die Unruhe, die wie ein Bindestrich zwischen der politischen und der philosophischen Inspiration Arendts arbeitet; zwischen ihrer Konfrontation mit der Metaphysik und ihrer Wette, gegen die politische Tradition anzudenken. Eine Unruhe, die darüber hinaus nach der zeitgenössischen Psychoanalyse verlangt. »Wer sind wir?« Anders gesagt: Die »Politik der Meinung« – in dem innovativen Sinn, dem Arendt diesen Wörtern gibt – kann nur ein Gegenmittel gegen die Politik des Spektakels (die uns heutzutage als eine Politik der Meinung verkauft wird), wie auch gegen die nostalgischen Anrufungen eines »Erwachens der Völker« sein, wenn sie ein inter-esse schöpferischer Singularitäten ist, eine Wiederbelebung der »Wers«. Weil es von Anfang an und immer »politisch« im arendtschen Wortsinne ist, zeigt sich das »Wer« zuvörderst der Menge der anderen und ihrer Gedächtnisse, weniger dem Protagonisten selber. Oder vielmehr: Das »Wer«, meine Einzigartigkeit und Eigenheit, mein Wesen, offenbart sich nur der Verschiedenartigkeit der Gedächtnisse, ihrer Zeitlichkeit. Im Werk von Duns Scotus findet die Autorin der Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft das Geschick der innovativen Singularität wieder und vertieft ihre Neubewertung der Ontotheologie: Sie bringt eine christliche Archäologie der modernen subjektiven Freiheit zum Vorschein mit dem, was sie an Gnade und an Risiko in sich birgt. Entscheidend ist der Nachdruck, den der »Doctor subtilis« auf die singuläre »Diesheit« (ecceitas) legt. Aber auch seine Zurückweisung des Primats des Intellekts über den Willen und die unerhörte Freiheit, die er jeder einzelnen Person beimisst. Und weil die Wurzeln des Intellekts tief in die Intuition reichen, verwandelt sich der Wille am Ende in die Liebe. Und letzthin schafft die »Glückseligkeit« des schottischen Mönchs die Verbindung zwischen Denken und sinnlich mitgetragenem Handeln, nach der Arendt schon im griechischen Heroismus suchte. Dies sind nur einige der Elemente christlicher Subjektivität, welche nach Arendt den Weg zur politischen Freiheit eröffneten. Die junge Arendt, Studentin von Karl Jaspers, verlautbart in ihrer Doktorarbeit über den »Liebesbegriff bei Augustinus«, verteidigt am 28. November 1928, dass das Subjekt des Politischen ein liebendes Subjekt ist. Die Psychoanalyse würde dies unterstreichen und auf die »wahre Konstellation der Liebe«, wie Arendt es nennt, bei Augustinus abheben: Liebe, Begehren (mit den beiden Varianten appetitus und libido), Nächstenliebe und Lüsternheit. Arendt bringt vor, dass die tragende Welle dieser Multiplizität das Begehren ist. Und an dieser Stelle, so Arendt, entsteht die Möglichkeit für das menschliche Dasein, sein eigenes Sein in Frage zu stellen: zwischen dem »noch nicht« und dem »nicht mehr« werde »Ich« mir selber zur Frage (Quaestio mihi factus sum). Es gibt daher keine verborgene Wahrheit, auch nicht des Unbewussten, die – ad infinitum betrieben – der »freien Assoziation« (in der Sprache der Analytikerin) oder die den Vielen im politischen Raum (wie es Arendt ausdrücken würde) nicht zugänglich wäre. Und formulierte die Psychoanalyse Freuds nicht ein neuartiges Transzendenzverhältnis? Eines, das das Dasein des begehrenden Subjekts in die Ereignisse einschreibt und das Handeln und das Gedächtnis in die Erzählungen des inter-esse der liebend-leidenden Übertragungen und Gegenübertragungen hineinlegt? So verstanden ist die analytische Erfahrung eminent politisch im arendtschen Sinne eines Offenbarwerdens dieses Sprachwesens, das in eins fällt mit dem Erscheinen seines Diskurses. Für Arendt geschieht dies in der Pluralität der öffentlichen Bezüge, für die Analytikerin bereits in dem dualen Bezug mit seiner Übertragung und Gegenübertragung. Und rührt der tiefere Grund für die Feindseligkeit, welche die Psychoanalyse hervorruft – neben und mehr noch als die Widerstände gegen und die Abwehr des Sexuellen – nicht von dieser Wiederaneignung und Wieder- (be)gründung der Ontotheologie her, die ihrer Theorie wie ihrer Praxis innewohnen? Und formuliert wiederum Hannah Arendt nicht eine im Grunde psychoanalytische Konzeption des sprechenden Subjekts, das sich konstituiert als ein »Ereignis« in der Zeit (Vergangenheit, Gedächtnis), und mitnichten eine psychologische Diagnose der Dispositionen, Gaben und Temperamente?
III. Wiedergründung als Wiederkehr
Entschiedenermaßen ist Hannah Arendt die Aufständigste und Aufstehendste von allen. Unermüdlich verkehrt sie ihre Melancholie und die Sackgassen der Moderne in eine Bleibe, eine Öffnung, eine Wiedergeburt, in eine andauernde, durch ihre Nietzscheund Heideggerlektüre neubesehene und modulierte augustinische Gebürtlichkeit. Es gibt bei ihr keine Gebrauchsanleitung für diese neue Welt und die neue Politik: nur die Atembewegung der Verbindungen, geschaffen aus überraschenden »Wers« – und das ist enorm. Denn dieses Wiederbeginnen ist nur möglich, wenn es die Autorität selbst wiedergründet, was nur geschehen kann über eine Reinterpretation, eine Wiedererfindung. Eine Wiederkehr und eine Wiederaneignung der Autorität-Religion-Tradition – nicht um sie wiederherzustellen (Machiavelli und Robespierre verwechselten das »Gründen« mit einem »Machen« und endeten in der Tyrannei), sondern um in ihrem eigentlichen Nucleus, der Autorität nämlich, ihren Sinn zu reinitialisieren, und dies im gegenwärtigen Raum der neuen »Öffentlichkeit der Meinungen«. So ist meine Lesart der testamentartigen Zeilen Hannah Arendts aus »Vom Leben des Geistes«: »Historisch gesehen ist eigentlich die Tausende von Jahren alte römische Dreieinigkeit von Religion, Amtsmacht [Autorität, d.Ü.] und Tradition zusammengebrochen. Der Verlust dieser Dreieinigkeit zerstört nicht die Vergangenheit, und die Demontage selber ist nicht destruktiv; sie zieht nur die Konsequenzen aus einem Verlust, der eine Tatsache ist und als solche nicht mehr Bestandteil der ›Ideengeschichte‹, sondern unserer politischen Geschichte, der Geschichte unserer Welt.« In der Welt der Psychoanalyse liefe dieses »die Konsequenzen ziehen« aus dem Verlust dieser Triade Autorität-Religion-Tradition auf ein Neudenken des vorpolitischen und vorkulturellen Sinnes des Bedürfnisses zu glauben hinaus, das wir uns vorschnell ausgetrieben haben. Ein Bedürfnis zu glauben, welches unabdingbar ist bei der Herausbildung einer psychischen Identität, die über die primäre Identifikation mit dem liebenden »Vater der persönlichen Vorzeit« als eines idealen, meine Idealität stützenden Anderen abläuft. Wir können diesen Verlust an der Krise in unseren Vorstädten ablesen, an der Krise der Heranwachsenden: Sie haben dieses Bedürfnis, an eine Idealität zu glauben, doch wir sind eine Zivilisation, die es versäumt, ihnen dies zu ermöglichen.
IV. Aufgeklärt gegen die Aufklärung
Im Lichte dieser paradoxen Konvergenz von Freud und Arendt – beide schreiben, wenn auch auf unterschiedliche Weisen, das Verborgene in das Erscheinende, das Verdrängte in das Verbotene ein (bei Arendt: das Individuum und die Autorität in das Politische oder das inter-esse) – möchte ich nun zum Abschluss eine letzte arendtsche Spannung ansprechen: Ihre Kritik der Säkularisierung, die bei ihr aber einhergeht mit der Verweigerung eines Transzendentalismus. Arendts Stigmatisierung der Säkularisierung zielt auf die Reduzierung menschlicher Differenzen in der Allgemeinheit des »zoon politikon« ab, welches zum gattungsmäßigen »Menschen« im, wie ich sagen muss, reduktiven Verständnis der »Menschenrechte« geworden ist. Denn diese Reduzierung »vergisst« mehr oder minder absichtlich den Reichtum an Körpern, Begehren und Sprachen, der insbesondere in der französischen Aufklärung aufgeblüht ist. Und auch wenn darüber hinaus für Arendt ein bestimmter moderner Atheismus zum Niedergang des Ethischen beigetragen hat, so verwirft sie nicht einfach die Aufklärung im Ganzen. Das totalitäre Phänomen ist einzigartig und keines seiner älteren Elemente – stamme es aus dem Mittelalter oder dem 18. Jahrhundert – könne als »totalitär« bezeichnet werden. Und ebenso grenzt sie ihre politische Untersuchung sorgfältig von jedweder religiösen Positionierung ab, indem sie die politische Inanspruchnahme eines »Göttlichen« eben dem von ihr bekämpften, bösartigen Nihilismus zuordnet: »Diejenigen, die aus den schrecklichen Ereignissen unserer Zeit schließen, dass wir aus politischen Gründen zu Religion und Glauben zurückzukehren haben, scheinen mir zu zeigen, dass ihnen genauso viel Gottesglauben fehlt wie ihren Gegnern.« Dreißig Jahre nach ihrem Tode kommen zu den Gefahren, denen Hannah Arendt sich gegenübersah – die, indem sie zugenommen haben, diese Wiedergründung der politischen Autorität fraglicher erscheinen lassen – neue Tragödien hinzu: Ich denke an die Tragödie des 11. Septembers, an das inzwischen eingestandene Scheitern der unilateralen militärischen Erwiderung, die vorgab, sich an die Stelle einer – möglichen oder unmöglichen – konzertierten, pluralen Antwort der weltweiten »Meinungen« zu setzen. Und an die infolgedessen entstandene neue Bedrohung, die schwer auf Israel und der Welt lastet. Arendt hat sie vorausgeahnt in ihren Warnungen, die arabische Welt nicht zu unterschätzen. Und während sie den Staat Israel als einziges Heilmittel gegen die Weltlosigkeit des jüdischen Volkes, als Rückkehr in die »Welt« und in die »Politik« – von der die Geschichte es beraubt hatte – bedingungslos unterstützte, sparte sie nicht mit Kritik an diesem Staat: »Sie flüchteten sich nach Palästina, so wie jemand wünschen mag, sich auf den Mond zu flüchten, wo ihm die böse Welt nichts mehr anhaben kann.« Obwohl viele ihrer Analysen und Vorstöße uns heute prophetischer denn je erscheinen, konnte Arendt doch nicht die Verhärtung des islamischen Fundamentalismus und die Ohnmacht der Politik, darauf zu antworten, vorhersehen. Und auch nicht die Ohnmacht gegenüber der apolitia, das heißt, der Indifferenz, welche die Scheinwelt des Spektakels, wie auch die des puritanischen Sekuritarismus, diese neuen Opiate der Völker, hervorbringt. Nichtsdestoweniger führt uns diese neue Form des totalitären Fundamentalismus – mit der Verwüstung des Denkens, die ihn
charakterisiert und die er aufzwingen will, und mit seiner Verachtung für das menschliche Leben, das er mit kühlem Vorsatz auf etwas zu Eliminierendes, Überflüssiges reduziert – zurück auf essenzielle Ängste und lädt uns ein, Arendts hellsichtige Diagnose wieder aufzunehmen. In diesem Zusammenhang konfrontiert uns dramatischer als je zuvor der aktuelle Zustand der Welt in einer beispiellosen Schwere mit der schwarzen Sonne des Skeptizismus, deren Schatten unsere Philosophin der politischen Natalität nicht verschont hat. Wiederholt hat sie sich gefragt, ob die Politik »überhaupt noch einen Sinn hat?« Dennoch habe ich anfangs Arendts »Vitalität des Urteilens« begrüßt als eine des »Über-Lebens«. Ich verstehe darunter keinesfalls ein humanistisches Verarzten der modernen Verwundungen: der Isolation, der Verzweiflung, der persönlichen und/oder politischen Zerstörung. Ich glaube, Arendt ist nicht lediglich eine Denkerin des Abbaus oder der Dekonstruktion. Ich nehme ihre Freude wahr, zu denken, dass die Wiedergründung möglich ist: eine Wiedergründung seiner/meiner selbst, die eines Volkes, die des politischen Zeitraumes. Dies verlangt eine Liebe für das Vergangene und das Zukünftige. Und eine außergewöhnliche Fähigkeit zur Wiedergeburt, von der ein anderes weibliches Genie, Colette, sagte: »Wiedergeboren zu werden hat meine Kräfte niemals überstiegen.« Genau diese Haltung nimmt Arendt an, wenn sie sich den Satz Tocquevilles zu eigen macht: »Eine neue Welt braucht eine neue Politik.« Wenn Arendt die Tradition des Politischen abbaut, dann nicht aus Leichtfertigkeit, sondern nur um sie besser wiederbegründen zu können auf der Partizipation jeder Subjektivität in der pluralen Welt. Ich zitiere: »Die Politik handelt von dem Zusammen- und Miteinandersein der Verschiedenen.« Können wir aus dem politischen Raum ein Zusammenund Miteinandersein der verschiedenen Eigenheiten und Einzigartigkeiten machen? Oder: »Der Ruin der Politik ... entsteht aus der Entwicklung der politischen Körper aus der Familie.« Das heißt, wenn er nicht aus dem Respekt vor den verschiedenen Familien entwickelt wird. Oder: »Politik entsteht in dem Zwischen-denMenschen, also durchaus außerhalb des Menschen. Es gibt daher keine eigentlich politische Substanz.« Denn es gibt nur ein politisches Denken in dieser Pluralität der freudigen einzelnen Denken. Oder schließlich: »Freiheit gibt es nur in dem eigentümlichen Zwischenbereich der Politik.« Bedeutet dies, dass für unsere politische Denkerin diese so verstandene Politik – als das Glück zwischen Einzelnen denken, innerhalb eines wieder zu erfindenden gemeinschaftlichen Bandes – den Platz des Göttlichen einnimmt? Oder, wie ich denke, mäandern das Göttliche wie das heideggersche Sein (und dies ist die Revolution Heideggers) in der beunruhigenden Meinungshaftigkeit des »Wer«, der ich bin? Das Göttliche ebenso wie das Sein partizipieren immanent an der Öffentlichkeit der singulären Daseine – oder besser gesagt: sie inkarnieren sich in dieser grundsätzlich liebend-leidenden Erzählung, die verschiedene Männer und Frauen um den pluralen Sinn ihres Handelns weben. Wäre die arendtsche Politik also die erste Politik der Inkarnation? Sie zitierte gern Jesus von Nazareth, den sie immer für politischer als Paulus hielt, da es für Jesus von Beginn an eine Pluralität gibt: so, wenn er sich auf den Schöpfungsbericht bezieht in dem es heißt: »Und er schuf sie als Mann und Weib.« (Gen.1,27)
I m Lichte der neuen Bedrohungen in Gestalt der Automatisierung der Gattung und der religiösen Fundamentalismen eröffnen sich von unserer Neulektüre Arendts her zweierlei Möglichkeiten: Erstens, entweder wird das Wuchern der Entpolitisierung die Rückkehr des Religiösen beschleunigen und den politischen Raum auf unabsehbar lange Zeit in Ohnmacht verfallen lassen – oder, zweitens, die im Gange befindliche Programmierung des Überflüssigmachens des menschlichen Lebens und die Instrumentalisierung des Todestriebes durch die Integrismen wird ein kraftvolles Aufleben des inter-esses und eine Reinitiierung der innovativen Subjektivität, des Erscheinens der Einzelnen in der Welt, hervorrufen. Rein logisch gesprochen benötigt diese zweite Möglichkeit keine Rückkehr zu, sondern ein Wiedergründen der Autorität des Politischen, das wir vom Greco-Judeo-Christentum ererbt haben, und welche der Welt das Verlangen nach einer »gemeinsamen Welt«, die sich aus einer Vielzahl von »Wer’s« konstituiert und die Arendt das »Zentrum der Politik« nennt, vermacht hat. Es liegt an uns, diese Erbschaft zu reinterpretieren. Nur eine »neue«, in diesem Sinne erhellte Politik wird den Ruin der Welt vermeiden können.
Unmittelbar: In Anbetracht der Tatsache,
■ dass eine vielfältige Überflüssigmachung des menschlichen Lebens weiterhin ein radikales Übel darstellt, das praktiziert und toleriert wird;
■ dass das Recht jeder Person, in der Pluralität der politischen Bindungen in Erscheinung zu treten, heute noch an zahlreichen Orten unserer globalisierten Erde bedroht ist;
■ dass es meistens Frauen sind, die zum Opfer dieser Zerstörung des politischen Raumes und der Negation des Menschenwesens werden, bis hin zu ihrem Recht zu leben;
in Anbetracht dessen denke ich, dass die Wiedergründung der politischen Welt, wie Hannah Arendts Werk sie vorschlägt, uns dazu einlädt, die Sorge um das einzelne Schicksal eines Mannes oder einer Frau, fern jeder Hierarchie, bis ans Herz der Demokratie der Meinungen – deren Schema sich heute abzeichnet – vorzulassen. Daher bin ich darauf bedacht, diejenigen zu würdigen, die sich um das einzelne menschliche Schicksal und sein Recht, in der pluralen Welt zu erscheinen, sorgen. Um erträgliche, bewohnbare politische Räume mitzuerrichten. Folglich leite ich das Preisgeld des Hannah-Arendt-Preises 2006 an die NGO Humani-Terra (www.humani-terra.org) mit Sitz in Marseille weiter, um sie in ihrer vorbildlichen Arbeit im Krankenhaus von Herat in Afghanistan zu unterstützen. Sie arbeiten dort insbesondere mit afghanischen Frauen, die kein anderes Mittel finden, ihren Protest gegen die mannigfaltigen Ungerechtigkeiten und Gewaltsamkeiten auszudrücken, als die Selbstverbrennung. Dieser Preis möge zur medizinischen und psychologischen Hilfe und der Begleitung der Versehrten beitragen. In der Hoffnung auf eine Fortsetzung dieses Zusammenwirkens wünsche ich mir, dass es durch den »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken« möglich ist, ein Mehr an Aufmerksamkeit auf das Los dieser Frauen zu lenken, um die internationale politische Solidarität zu fördern: mit ihnen wie auch mit anderen Opfern von Politiken, Ideologien oder Glaubenslehren, die das »Überflüssigmachen menschlichen Lebens« zum Programm haben oder tolerieren.
Wir liegen mit dieser Veranstaltung nahe am 100. Geburtstag Hannah Arendts, die am 14. Oktober 1906 geboren wurde. In ihrem Lebensweg durchmaß sie entscheidende Stationen ihres Jahrhunderts: Sie war ihrer Herkunft nach eine deutsche Jüdin, wurde als Studentin geprägt durch die Existenzphilosophie Heideggers und Jaspers, wurde von der Gestapo verhaftet, musste vor den Nazis fliehen und erfuhr, was es bedeutet, staatenlos zu sein. Im amerikanischen Exil wurde sie als Publizistin und Theoretikerin weltweit bekannt. Deutschland besuchte sie nach dem Krieg als amerikanische Staatsbürgerin wieder. Es waren vor allem zwei Schriften, die ihr zu Weltruhm verholfen haben: ihre umfassende Analyse des Totalitarismus (Ursprünge totalitärer Herrschaft) sowie ihre gleichermaßen berühmte und umstrittene Schrift Eichmann in Jerusalem – Bericht über die Banalität des Bösen, die 1963 aus ihren Prozessberichten für den New Yorker hervorging. Lange Zeit war sie wegen dieser beiden Analysen weder in Israel noch bei der europäischen Linken wohl gelitten. Hannah Arendt und Israel verbindet ein hoch kompliziertes Verhältnis. Für sie war Israel der Garant für die jüdische politische Existenz; zugleich kritisierte sie nationalistische Tendenzen, die sie im zionistischen Projekt angelegt sah. Am Fall Eichmann beschrieb sie den bürokratischen Mechanismus des Holocausts, ohne emotionale Regungen zu zeigen, ja »ohne ausreichende Liebe zum jüdischen Volk«, wie ihr der Historiker Gershom Scholem aus Jerusalem vorwarf, als er ihr die Freundschaft aufkündigte. Heute, da in Israel selbst unterschiedliche Lesarten zur Gründungsgeschichte des Staates im Konflikt liegen und das Konzept des Zionismus kontrovers verhandelt wird, ist auch eine gelassenere Rezeption von Hannah Arendt möglich – einschließlich einer kritischen Sicht auf ihr Eichmann-Buch, das die ideologische Überzeugungstäterschaft Eichmanns und die Rolle des Terrors hinter dem banalen Funktionieren einer Vernichtungsbürokratie verblassen lässt. Einem Großteil der europäischen Linken wiederum war ihre Totalitarismus-Theorie suspekt. Das ging bis zum Vorwurf, sie liefere mit ihrer Fundamentalkritik des sowjetischen Systems geistige Munition für den Kalten Krieg. Die Fellow Traveller der Sowjetunion führten gern Thomas Manns verballhorntes Zitat vom »Antikommunismus als Grundtorheit unseres Jahrhunderts« gegen Hannah Arendt ins Feld, und mit dem Schreckwort Antikommunismus ließen sich auch viele Liberale ins Bockshorn jagen. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetwelt brauchte es durchaus intellektuellen Mut, darauf zu insistieren, dass das 20. Jahrhundert vom Kampf zwischen liberaler Demokratie und totalitären Bewegungen geprägt war. Dieser Konflikt ist historisch keineswegs erledigt, und wer Arendts Analyse des Nationalsozialismus und Bolschewismus als radikal antibürgerliche Bewegungen heute liest, kommt kaum umhin, mit Julia Kristeva beunruhigende Parallelen zum radikalen Islamismus zu ziehen – auch wenn man sich davor hüten muss, zum Gefangenen historischer Analogien zu werden. Ich bin Julia Kristeva dankbar, dass sie daran erinnerte, dass Israel heute der Gefahr eines religiös-politischen Fanatismus ausgesetzt ist, der die Existenzberechtigung des jüdischen Staates offen in Frage stellt. Bei aller notwendigen Kritik an der israelischen Besatzungspolitik gilt auch heute der Satz Hannah Arendts, dass Israels Freiheit auch unsere Freiheit ist. Dabei geht es nicht um einen »clash of civilisations« zwischen der islamischen Welt und dem Westen. Die Konfliktlinie mit dem radikalen Islamismus zieht sich mitten durch die islamisch geprägten Gesellschaften, und es sind vor allem Muslime, die der Gewalt der Extremisten zum Opfer fallen. Es ist nicht nur die fortwährende Aussagekraft ihrer Untersuchungen zum Totalitarismus, auf der die Aktualität Hannah Arendts gründet. Was heute an ihr fasziniert, ist vor allem ihr »Republikanismus«, ihr spezifisches Verständnis von Politik als einer Sphäre der Freiheit und ihr Plädoyer für das, was wir heute als »aktive Bürgergesellschaft« bezeichnen. Es geht in der Tradition von Hannah Arendt um den Dissens als Ausgangspunkt des Politischen und um den streitbaren öffentlichen Diskurs als sein Lebenselixier. Wer Begründungen gegen ein Verständnis von Politik als Exekution von »Sachzwängen« sucht, wird bei ihr fündig. Das von allen Regierungen weidlich strapazierte »TINA-Prinzip« – There Is No Alternative – markiert im arendtschen Sinn das Ende der Politik. Für Hannah Arendt beginnt Politik damit, dass jemand aufsteht und öffentlich seine Meinung vertritt – im Wissen, dass er (oder sie) auch irren kann. Die öffentliche Rede ist, wie Julia Kristeva sagt, der erste und grundlegende Akt der Zivilcourage. In der Politik geht es um begründete Meinungen, nicht um absolute Wahrheiten. Und es geht um das gemeinsame Handeln, in dem das politische Gemeinwesen – die Republik – erst entsteht. Arendt sah politische Institutionen nur als demokratisch an, wenn sie sich auf die kommunikative Macht der Öffentlichkeit stützen. Diese Öffentlichkeit zu hintergehen und zu manipulieren, wie es bei der Begründung des IrakKriegs durch das Weiße Haus geschah, legt deshalb die Axt an die Wurzel der Demokratie. Dass Frau Kristeva das Preisgeld einer Initiative spendet, die sich der medizinischen und sozialen Betreuung afghanischer Frauen widmet, die keinen anderen Ausweg als die Selbstverbrennung mehr sehen, ist nicht nur eine großzügige humanitäre Geste. Sie erinnert uns zugleich daran, worum es in Afghanistan geht: um ein Mindestmaß an Selbstbestimmung und Rechtssicherheit vor allem für Mädchen und Frauen. Und sie erinnert uns daran, dass in vielen Ländern der Welt Frauen die grundlegenden Menschenrechte vorenthalten werden. Für Hannah Arendt war das »Recht, Rechte zu haben« fundamental als Schutz vor Willkür und Gewalt. Dieses Recht für alle Menschen zu gewährleisten, ist immer noch eine ungelöste Aufgabe.
An der Diskussion beteiligten sich außer Lorenz Böllinger noch Bettina Schmitz, Ute Vorkoeper und Adrienne Goehler mit vorbereiteten Beiträgen. Ausschließlich Platzgründe waren für die Festschrift-Redaktion des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken maßgeblich für die Kürzung auf den Abdruck eines Beitrages. Die gesamte Diskussion ist dokumentiert auf der Website der Heinrich-Böll-Stiftung Bremen: www.boell-bremen.de
Lorenz Böllinger
Hallo, Frau Kristeva, ich freue mich sehr, Sie heute hier zu treffen. Es tut mir sehr leid, dass ich gestern aufgrund eines familiären Problems nicht anwesend sein konnte. Ich habe aber Ihren Artikel gelesen und beziehe mich nun darauf. Er hat geradezu eine Flut von Eindrücken, Gedanken und Reflektionen, sozusagen von freien Assoziationen in mir hervorgerufen. Doch zunächst einige Worte zu meiner Person: In erster Linie bin ich Jurist, ich lehre Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bremen. In Zweitqualifikation bin ich Psychologe und Psychoanalytiker, auch Mitglied der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Und so wie Sie Brücken bauen möchten, wenn ich das richtig verstehe, zwischen der Psychoanalyse, Philosophie und Politikwissenschaft, versuche ich Brücken zu bauen zwischen der Rechtswissenschaft, Kriminologie und der Psychoanalyse. Soweit zu meiner Person. Ich habe meinen Beitrag nicht sehr genau strukturiert, es sind, wie gesagt, eher freie Assoziationen mit einigen eingebauten Fragen.
Einführung
Julia Kristeva zufolge gründet sich Hannah Arendts »Denken in Bewegung« in Ereignissen und in der Erfahrung. Es gelingt ihm, die Sackgassen der Subjektivität wie auch der Politik zu öffnen – und das effektiver als es die politiktheoretische Metasprache der Philosophen und professionellen Politologen vermag – indem es auf überraschende Weise die Aufmerksamkeit, die Spannungen und die Debatte wiedererweckt, um so den »Kräften des Todes« entgegentreten zu können. Auf eine frappierend moderne Art vertrat Arendt eine grundlegende Theorie der sozialen und individuellen Realität, in der diese sich über einen dynamischen, in der Erfahrung der Interaktionen zwischen Individuen, Gruppen, Ethnien, Nationen et cetera gegründeten Prozess herstellt. Hierauf baut Kristeva in den vier Themen ihres Vortrages auf. Zunächst arbeitet sie Arendts Position heraus, der zufolge »Denken und Urteilen, die Meinung allein die Gewalt besiegen« könne und dass die Meinungen der Zuschauer und nicht die Wahrheit die unverzichtbare Basis der Macht sind. Ich glaube, dies wird im Kontext von Kristevas erweitertem Blickfeld auf die menschliche Entwicklung verständlicher. Mit ihrem »semiotischen« Zugang werden Zeichen und Bilder, körperliche und affektuale Kommunikation zu Vorläufern der Symbole und der Sprache. Es scheint evident, dass diese Entwicklung nur in einem kontinuierlichen Interaktionsprozess stattfinden kann, in dem nicht nur die MutterKind-Dyade, sondern ebenso der familiäre Kontext und insbesondere der Vater eine wichtige vorödipale Rolle spielen. Wenn die Intersubjektivität in diesem erweiterten Umfang gesehen wird, dann erst sind wir in der Lage, der Pluralität, die für unsere Welt und uns Individuen konstitutiv ist, Rechnung zu tragen. Und dies besser, als es bei anderen zeitgenössischen psychoanalytischen Zugängen der Fall ist. Mit ihrem zweiten Punkt will Kristeva, so denke ich, uns über den Bedarf an diesem oben erwähnten »Denken in Bewegung« bei Individuen und Gesellschaften aufklären. Es ist die Voraussetzung einer »kontinuierlichen Wieder-geburt« und einer »Wieder-gründung«, die wesentlich sind, so Kristeva, um die im Zuge der Säkularisierung entstandene Leere kompensieren, und um Stagnation, Fundamentalismus und Totalitarismus vermeiden zu können. Wie auch immer, dies scheint mir etwas abstrakt und idealistisch zu sein, und sollte substanziell gefüllt werden mit Hilfe psychoanalytischer Modelle des Selbst und der zwischenmenschlichen Bezüge, ebenso wie mit Hilfe eines psychosozialen Blickwinkels auf die Bedingungen der jeweiligen individuellen und gesellschaftlichen Reflexionsmöglichkeiten. Im theoretischen Zentrum ihres dritten Teils steht die arendtsche Triade aus Autorität, Religion und Tradition, welche nach ihrer Schwächung durch die Säkularisierung nunmehr »neu-gemacht« werden soll. Mit dieser Position liefe sie allerdings Gefahr, so Kristeva, als eine repressive Konservative missverstanden zu werden, also ganz im Gegensatz zu dem, was sie eigentlich eröffnen möchte. Auf diese drei Thematiken möchte ich meinen Kommentar fokussieren.
Psychoanalyse und Konstruktivismus
Kristevas Plädoyer für eine »Entmystifizierung der politischen Tradition« und die Befreiung des politischen Feldes von den Wächtern der »Wahrheit« scheint mir deckungsgleich zu sein mit dem zeitgenössischen epistemologischen Ansatz des Konstruktivismus. Das Konzept der Relativität und Konstruiertheit der Wahrnehmung, des Urteilens, der »Wahrheit« und der »sozialen Realität« auf Grundlage der Sozialstruktur und der Interessen sind gewiss ein weiterer Schritt, ein weiteres Niveau der Aufklärung. In diesem Zusammenhang macht Arendts Frage »Wer sind wir?« im Gegensatz zu der Frage »Was sind wir?« absolut Sinn. Neben Begriffen wie Ereignis, Erfahrung, Beziehung und Interaktion impliziert diese auch das »liebende Prinzip, das die Welt regiert«, wie Kristeva Arendt interpretiert. Oder, in psychoanalytischer Terminologie: libidinöse Kathexis und Sexualisierung. Wie auch immer, klingt die Annahme eines »Lebens als Liebe« nicht etwas idealistisch, utopisch oder sogar religiös? Meint Kristeva damit etwas Ähnliches wie Freud mit seinem »Lebenstrieb«? Was ist dann mit dem »Todestrieb«? Wo werden Aggression und Destruktivität in dieser Vorstellung angesiedelt? Eine andere Frage: Fasst man, mit Arendt, das individuelle »Subjekt als ein Ereignis und mitnichten als eine psychologische Diagnose der Dispositionen«, so deckt sich das sicherlich mit der Psychoanalyse, die Subjektivität und Identität als ein vorläufiges Ergebnis eines dynamischen Interaktions- und Sedimentationsprozesses zwischen ego und alter, zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Individuum und Gesellschaft, begreift – strukturiert durch bestimmte typische Lebensverläufe, Lebensereignisse, Zufälligkeiten, durch soziale Strukturen und Bereiche. Aber ist dies nicht eine ziemlich abstrakte und idealistische Aussage angesichts der höchst substanziellen sozialen Interessen und Kräfte, die die Ereignisse, Lebensverläufe und Interaktionen überwölben? Wenn Kristeva sagt, Arendt verkehre »unermüdlich ihre Melancholie und die Sackgassen der Moderne in eine Öffnung, eine Wieder-Geburt« – heißt das nicht, dass eine Zerstörung externer und interner Strukturen stattfinden muss? Meint sie dies, wenn sie von der »Erotisierung des Mörders der Mutter« spricht? Andererseits sagt sie, Arendt befürworte eine Erneuerung der »greco-judeo-christlichen Trinität aus Autorität, Religion und Tradition« – zwar nicht in dem Sinne, sie wieder herzustellen, sondern vielmehr um ihren Sinn zu re-initialisieren in ihrem eigentlichen nucleus, der Autorität nämlich. Meint sie dies metaphorisch im Sinne klarer, stabiler Räume – Räume für Intersubjektivität, für Spiel und für Ereignisse – oder meint sie das eher im Sinne fester und idealisierbarer Mutter- und Vaterfiguren? Mir hat sie nicht recht plausibel machen können, warum es so etwas geben sollte wie ein absolutes »Bedürfnis zu glauben, welches unabdingbar ist bei der Herausbildung einer psychischen Identität, die über die primäre Identifikation mit dem liebenden Vater der persönlichen Vorzeit abläuft«. Birgt das nicht die Gefahr, die Übertragung, Idealisierung, Personalisierung und die Regression zu perpetuieren? Und hat Arendt nicht einen viel moderneren, sagen wir habermasschen »Verfassungspatriotismus« im Sinn, der die genannte Trinität beinhaltet und umfasst? Er verbindet grundlegende individuelle, (nicht externalisierte und personalisierte) menschliche Werte (wie z. B. aus dem Christentum), mit Methoden und Procederes der Koexistenz und der Konfliktlösung, mit kritischem Abwägen und Selbstreflexion im Sinne des Konstruktivismus. Wäre damit nicht dem Aufklärungszweck besser gedient, den Kristeva zu Beginn ihrer Rede anführt: »... die Fäden des Politikvertrages, der die Männer und Frauen regiert, in Schwingung zu versetzen?« »Um die Autorität dessen, was uns (ver)bindet mit der Unberechenbarkeit jedes Einzelnen von uns ebenso zu versöhnen wie die Pluralität der Welt mit dem auf das Urteilen hin ausgelegte Leben des Geistes«? Vielleicht meint sie eben dies, wenn sie formuliert: »Die Fähigkeit, mit den Erscheinungen zu spielen, ist integraler Bestandteil politischer Virtuosität – Spielregeln, wohlgemerkt, immer vorausgesetzt.« Für mich bleibt es unklar, ob Kristeva sich Arendts Sicht anschließt, wenn diese sagt, »der Totalitarismus ist eher ein Produkt des modernen Atheismus denn ein sozio-historischer Prozess«. Ihn als einen zu bekämpfenden »bösartigen Nihilismus« zu etikettieren, könnte sich als eine gefährliche Aussage herausstellen, angesichts des heutigen wie auch des früheren religiösen Totalitarismus. Auch steht diese Aussage im Widerspruch zu ihrer berechtigten Warnung vor dem »hinter der Maske des Fundamentalismus aufkeimenden Totalitarismus«. Ist eine aufgeklärte, selbstreflexive Philosophie mit der Möglichkeit des endlosen, sophistischen Fragens, ist die Aufklärung nicht weniger gefährlich als ein religiöser Glauben, und diesem deswegen vorzuziehen? Dabei könnte die Psychoanalyse eine unverzichtbare Rolle bei der Aufdeckung der unbewussten Übertragungen bei der Konstruktion der »Wahrheit« und der sozialen Realität spielen. Meiner Meinung nach brauchen wir den Prozess der Selbst- und Interaktionsreflexion, diese Dekonstruktion der Prozesse der Wahrnehmung, des Theoretisierens und Wahrheitfindens mit Hilfe der psychoanalytischen Begrifflichkeit (v. a.: Übertragung, Spaltung, Verleugnung, Projektion, projektive Identifizierung). Libidinöse Kathexis kann es geben – einen Glauben, sich selbst, den Anderen, den Fremden, ethnische Subkulturen oder die gesellschaftlichen Interaktionsmechanismen wirklich zu verstehen. Obschon Hannah Arendt der Psychoanalyse offensichtlich skeptisch gegenüberstand, denke ich, dass wir genau dort ihre Methode und Inhalte wiederfinden können. Die Interaktion des »Wer«, der nur deshalb die Macht usurpieren und destruktive Gewalt ausüben kann, weil er unbewusst ermächtigt wird durch jene, die ihn, im Zuge eines dialektischen gegenseitigen Prozesses der Projektion, Externalisierung, Spaltung und Verleugnung unterdrücken – ein Prozess, den wir einen pathologischen kollektiven Borderline-Zustand nennen könnten.
Julia Kristeva
Vielen Dank, Professor Böllinger. Ich begrüße Ihren Beitrag sehr, der zum Teil meinen Ansichten sehr nahe, aber teilweise auch kritisch ist. Ich bin sehr froh, auf diese Kritik eingehen zu können, denn ich nehme an, dass sie von einigen anderen Leuten geteilt wird. Sie haben am Anfang gesagt, zumindest habe ich Sie so verstanden, dass Sie bei mir einen Versuch ausfindig gemacht haben, Hannah Arendt in eine psychoanalytische Begrifflichkeit zu übersetzen. Ich werde niemals versuchen, das zu tun, denn ich denke, dass es unmöglich ist. Doch ich habe versucht zu zeigen, dass es einige Entsprechungen zwischen ihrem Denken und dem Reich der Psychoanalyse gibt. Arendts Denkweise ist, wenn auch kein System, doch ziemlich autonom und in sich geschlossen, und meiner Meinung nach ist es nicht ratsam, etwas zu tun, was bei amerikanischen Wissenschaftlern sehr verbreitet ist, nämlich zu behaupten, dies ist äquivalent zu jenem. Es gibt keine Äquivalenzen. Man kann sagen, dass es einige Ähnlichkeiten gibt, einige Resonanzen, doch niemals Äquivalenzen, ganz besonders nicht mit der Psychoanalyse. Wie Sie wissen, hasste Arendt die Psychoanalyse. Sie betrachtete sie als eine scheußliche Doktrin – ich denke, das war ein Missverständnis, aber nichtsdestotrotz war das ihre Meinung...
Lorenz Böllinger
Oder möglicherweise war es ein Widerstand …
Julia Kristeva
Ja, vor allem Widerstand! In meinem Buch habe ich einige persönliche Gründe für diesen Widerstand zitiert, die mit ihrer Kindheit zusammenhängen, ihrem Verhältnis zum Vater und Großvater, zur Mutter et cetera. Doch wir können hier nicht ihre Analyse machen, denn sie hat uns nicht darum gebeten, und es wäre sehr übergriffig. Aber vor allem denke ich, dass, mehr als es Widerstand war, ihr vielleicht einige Informationen gefehlt haben; in Anbetracht der amerikanischen Psychoanalyse sah sie in der Analyse eine Generalisierung von Symptomen am Werk, so wie beispielsweise die Medizin Organe generalisiert oder für einen Arzt jeder dasselbe Herz hat, so hat jeder denselben ÖdipusKomplex – daher ist sie nicht in der Lage, die Besonderheit des Einzelnen zu erklären. Ich stimme aber mit Ihnen in einem grundsätzlichen Punkt bezüglich einiger Verbindungen zwischen Hannah Arendt und der psychoanalytischen Forschung überein, der damit zusammen hängt, dass das Individuum für sie immer in einer Interaktion ist, im inter-esse ist, und diese Interaktion ist ein Feld der Ereignisse. Es gibt also psychische Realitäten und kollektive Realitäten, und diese logische Tatsache der Konstruktion des Individuums hat einige Konsequenzen für die historische Zeit, die eine Zeit der Ereignisse ist, mit Zäsuren, Revolutionen, Krisen et cetera. Ich stimme Ihnen mit Nachdruck zu, dass die heutige psychoanalytische Bewegung nicht die Chance ergreift zu zeigen, wie sehr unser Verständnis des »Menschen im inter-esse« sich im Sozialen auswirken könnte. Obschon es auch ein schwieriges Unternehmen wäre, in unserer Gesellschaft der Show und des Spektakels. Die Psychoanalytiker haben sich sehr stark von der politischen Bühne zurückgezogen, und wenn sie sich einmischen, dann in einer unverständlichen Sprache, die zu technisch ist, zu subjektiv und die gesellschaftliche Probleme meidet. Da zeichnen sie lieber ein lustiges Porträt dieser und jener politischen Figur. Und das ist in gewisser Weise etwas sehr Kriminelles für künftige Psychoanalytiker, die sich in diese Szenerie werden einmischen müssen. Was ich mache – quasi vis-à-vis mit dem, was Sie mit Kriminellen tun – ist zu versuchen, einige psychoanalytische Ansichten in ein anderes Feld der Ausgrenzung zu übertragen, der Ausgrenzung von Behinderten. Als Präsidentin des Conseil national handicap (Nationaler Rat der Behinderten, d. Ü.) ist das eine sehr schwierige Aufgabe, denn in der Öffentlichkeit, im Fernsehen oder Radio, können wir nicht in einer psychoanalytischen Sprache sprechen. Wir müssen sozialer und pragmatischer sein und in einer psychologischeren Art mit Familien oder Sozialarbeitern sprechen, und auch auf ihre Bedürfnisse nach materieller oder finanzieller Unterstützung et cetera eingehen, auch um Gewalt gegen Behinderte und deren Ausgrenzung zu verhindern. In diesem Sinne kommt es hin und wieder vor, dass ich nicht psychoanalytisch spreche – denn die psychoanalytische Sprache würde in Bezug auf behinderte Menschen von verletztem Narzissmus, von Kastration oder von ihrer Todesangst sprechen. Das lässt sich sehr schwer auf die öffentliche Bühne bringen. Wir müssen also eine Umgestaltung vornehmen, eine sehr feinfühlige Strategie entwickeln, um uns in der Öffentlichkeit zu äußern. Doch nun noch einmal zum Politischen. Sie haben über mein Interesse an Hannah Arendts Begriff der Meinung gesprochen – mit seiner Meinung auf der politischen Bühne in Erscheinung zu treten. Und Sie haben gesagt, und Sie haben Recht damit, dass es etwas mit dem Teilen von Affekten zu tun hat, von Empfindungen, Angst, Freude et cetera. Das ist etwas sehr Wichtiges für mich: Es reicht bis hin zu dem, was wir vorhin über das Semiotische gesagt haben und über die Aspekte der Persönlichkeit, die nicht explizit auf der Ebene der Sprache ausgedrückt werden, sondern dem Verhalten inhärent sind. Lassen Sie mich eine Sache ansprechen, die mir in den Sinn kam, während ich Ihnen zugehört habe. In der modernen Politik haben wir ein neues Phänomen; Sie haben es hier in Deutschland, wir in Frankreich haben es – weibliche Führungspersonen in der Politik, Präsidentin, Premierministerin et cetera. Jenseits positiver Aspekte dieser weiblichen Figuren in der politischen Landschaft, wie ihrer Kompetenz und der Tatsache, dass sie die Geschäfte auf eine pragmatischere Weise leiten, gibt es eine zusätzliche Eigenschaft, die mir auffällt. Ich denke hier an Ségolène Royal, an die Tatsache, dass sie durch ihr Verhalten, ihre Ansprache, ihr Lächeln und ihre Gestik, durch die Art, wie sie ihre Botschaft zum Ausdruck bringt, zwei Arten von Subtexten transportiert. Sie haben das angesprochen. Der eine ist mit der Nation verknüpft, denn es gibt Körper und Sprachen, die zu einer nationalen Gemeinschaftlichkeit gehören, die hier nicht derart unterdrückt wird wie im technokratisch-männlichen Diskurs von Politikern. Und obwohl es kein nationalistischer Diskurs ist, gibt es eine auf die Nation bezogene, unterbewusste Botschaft, die beim Publikum ein Wohlsein auslöst. Die Leute sehen ihre nationale Identität gespiegelt in diesen Frauen, die sich, sagen wir, mütterlich verhalten – nicht direkt mütterlich im Sinne von »sich kümmern um«, sondern indem sie auf ihre Weise ein Spiegel dessen sind, was der gemeinschaftliche Körper, was die Tradition, was das Image ist. Ebenso ist da ein Subtext, der mit der religiösen Tradition zusammenhängt, und der Begeisterung und Glaubwürdigkeit verheißt – ich glaube daran, dass in diesem Land etwas Gutes passieren wird, und ich lasse dich darauf vertrauen, dass du daran teilhaben wirst. Das ist auch eine Art von sub-lingualer Botschaft, die eine populäre, aber nicht populistische Einigung hervorbringt. Und das könnte gefährlich sein.
Lorenz Böllinger
Das ist im habermasschen Konzept nicht enthalten …
Julia Kristeva
Nein. Zu Habermas werde ich noch kommen, denn als gute Freunde teilen wir uns ein Appartement in den Vereinigten Staaten, aber das ist alles, was wir teilen. Abgesehen von Freundschaft. Nun komme ich zu den Punkten, an denen größere Unstimmigkeiten zwischen Ihnen und mir bestehen und die einer Klärung meinerseits bedürfen. Wenn ich sage, dass Hannah Arendt eine Wiedergründung der Triade aus Autorität, Tradition und Religion versucht, so ist das eine Kurzformel von mir. Sie hat das nirgendwo explizit so gesagt, aber ich denke, es zieht sich durch ihr gesamtes Werk, von Vita activa bis hin zu ihrer Trilogie. Doch für mich ist das auch eine Diskussion mit Philosophen wie Ricoeur, der die Bedeutung von Hannah Arendts Interesse an Autorität, Religion und Tradition erkannt hat und dachte, dass es zwei Einstellungen dazu gibt: Entweder die, die primär die Position von Claude Lefort ist, dessen anti-kirchlicher Einstellung zur Tradition Sie nahe stehen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, und die auch – dialektischer vielleicht als bei ihm – die meine ist. Claude Lefort sagt im Wesentlichen, dass wir uns wegen der Auflösung, der Verbindungen zu Tradition, Autorität und Religion mit einer Leere konfrontiert sehen. Auf welcher Basis können wir nationale oder politische Gemeinschaften bilden? Wir haben keine Basis, denn früher war die Basis das Christentum, der Judaismus oder der Islam et cetera. Für viele Leute, wie für uns, existiert eine solche Basis nicht; andererseits führt uns die multikulturelle Gesellschaft vor Augen, dass es zwar etliche Religionen gibt, jedoch keinen gemeinsamen Hintergrund. Es gibt also eine Leere. Leforts Antwort darauf ist, dass wir auch keine solche Grundlage brauchen. Auf unbestimmte Zeit können wir uns mit vorübergehenden Übereinkünften behelfen. Heute haben wir ein Gesetz, diskutieren dieses Gesetz, und übermorgen werden wir ein anderes Gesetz haben und dieses diskutieren und eine andere Übereinkunft treffen und so weiter. Es gibt also vorübergehende demokratische Übereinkünfte in einer Debatte. Das ist die eine Ansicht. Ricoeur hingegen sagt, das ist unmöglich, zu riskant und zu schwierig – die Leute folgen uns nicht, sie glauben nicht an die Politik. Sie sagen, diese Übereinkünfte sind plump und unbefriedigend, und in diesem Fall werden die Übereinkünfte auch nicht wirklich befolgt. Wir müssen also die Tradition erneuern. Und hier komme ich und sage, man kann die Tradition, die Autorität und die Religion nicht als solche wieder aufnehmen. Das ist es nicht, was Hannah Arendt sagt. Sie nimmt diese Triade ernst, doch sie interpretiert sie, sie ist unterwegs, sie schlägt keine neue Art von Religion vor, keine neue Art von Tradition oder Autorität; sie sagt hingegen, in einer Art foucaultschen Herangehensweise, dass wir als Einziges die Archäologie dieser Tradition ernst nehmen und sie Tag für Tag, Schritt für Schritt neu interpretieren müssen. Vom jeweiligen Standpunkt aus, von der Rechtswissenschaft oder der Philosophie, der Anthropologie oder der Psychoanalyse müssen wir versuchen herauszufinden, was sie bedeutet und wie wir sie an diese oder jene konkrete Situation anpassen können. Ich denke, das ist die einzige Position, die wir akzeptieren können, und ich will erklären, warum ich das denke: Anders können wir nicht weitergehen in der modernen Welt des dritten Jahrtausends, denn wir haben heute eine neue Situation, die sich von der Zeit vom Ende der Französischen Revolution bis zum 11. September 2001 unterscheidet. Heute leben wir in einer anderen Zeit, und wir müssen dieser neuen Situation Rechnung tragen, die zum einen durch den Aufstieg der Fundamentalismen charakterisiert ist, zum anderen durch die Entwicklung neuer Kommunikationsmittel, durch die Gesellschaft des Spektakels und so weiter. In diesem Zusammenhang ist meine Haltung, die auch die Ihre ist, zu sagen, dass, nachdem wir die Verbindungen zu Tradition, Autorität und Religion gelöst haben, nun die Menschenrechte der einzige Ersatz sind, was aber nicht ausreichend ist. Ich bin eine Anhängerin der Menschenrechte, vollkommen. Deshalb war auch gestern die Menschenrechtsorganisation anwesend, denn ich denke, sie leisten die einzige praktische Hilfe. Aber wir sind Philosophen, wir sind Denker, und auch wir müssen diesen Menschen helfen. Wir können uns nicht darauf zurückziehen zu sagen, wir sind Philosophen und denken in der Universität, und bitte, NGOs, geht ihr doch nach Afghanistan, das ist eure Sache. Es ist an uns, eine Art neues Denken zu entwickeln, das diesen Menschen hilft, die sich in ihrem Handeln einer neuen Menschlichkeit stellen.
Wir haben, von den Griechen und dem Christentum bis zur heutigen Philosophie und den Humanwissenschaften, eine lange Tradition der Interpretation. Diese Intelligibilität müssen wir sowohl auf die Erfahrungen in unserer eigenen Kultur wie, diese in ihrer Andersheit ernstnehmend, auf die fremden Mentalitäten richten. Es geht darum, in dieser Konfrontation und Interaktion den Sinn unserer Universalität zu erweitern und komplexer zu machen, ohne den Anspruch auf individuelle Freiheit und den Respekt vor dem einzelnen Menschenleben, hier insbesondere der afghanischen Frauen, preiszugeben. Eine neue Menschlichkeit also, die schon einmal da war und deren uralte Bedeutungen – vom Standpunkt der Aufklärungsphilosophie aus gesehen, der wir alle angehören – nun wieder auf die vorderste Bühne kommen. Welche sind diese uralten Bedeutungen?
Sie haben gesagt, dass Sie an die Menschenrechte glauben – mir ist aufgefallen, dass Sie das Wort »glauben« sehr häufig verwenden. Was heißt das – glauben? Sie haben dieses Wort benutzt, das Wort gehört zur religiösen Tradition. Es bedeutet, wir haben einen Glauben. Und hier war Ihnen Habermas, entschuldigen Sie, einen Schritt voraus, als er einen Pfad eingeschlagen hat, der uns nach wie vor offen steht. Ich bin jedoch mit seinem Schritt auch nicht einverstanden. Er hat Ratzinger getroffen, bevor dieser Papst wurde; im Wesentlichen sagte Habermas, dass wir, weil wir keine universelle moralische Grundlage haben, Glaube und Vernunft miteinander aussöhnen müssen. Wenn ich Habermas richtig verstanden habe – Ratzinger jedenfalls war mit ihm sehr einverstanden – so müssen seiner Ansicht nach diejenigen, die sich zur Vernunft bekennen, mit denen, die sich zum Glauben bekennen, eine Art Gentleman’s Agreement treffen, die Spaltung als solche aber aufrechterhalten. Das ist nicht meine Meinung. Ich sage, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts und vielleicht auch schon davor, Menschen wie Hannah Arendt, Heidegger, Freud und einige andere, versucht haben, diese Spaltung zwischen Glauben und Vernunft neu zu denken. Freud ist weder Glauben noch einfach Vernunft im Sinne des Rationalismus. Nehmen wir die Angst, den Glauben, Enthusiasmus, Borderline-Persönlichkeiten, Gewalt: All diese Dinge, die nicht auf eine simple Art rationalisiert werden können. Man muss andere Vorstellungen einführen, was wir mit dem Erweitern psychoanalytischer Konzepte versuchen, wobei wir bis an die Irrationalität heranreichen, und sie in eine Rationalität, die einen größeren Spielraum bietet, integrieren. Bitte, sagen wir zur öffentlichen Meinung, bitte nehmt dieses Öffnen der menschlichen Vernunft seitens der Tradition des 18. und 19. Jahrhunderts ernst. Das geschieht auch in der kreativen modernen Kunst: In ihren Installationen und abstrakten Gemälden präsentiert sie keinen Glauben an einen Gottvater oder etwas Jenseitiges, sondern es gibt den Versuch, eine andere Art zu denken, zu leben und so weiter aufzubauen, mit Leiden und mit Enthusiasmus. Dass da etwas Anderes unterwegs ist, das haben wir zu interpretieren und der Öffentlichkeit zu überbringen. Ich will das an dieser Stelle nicht lange ausführen, denn es wäre sehr kompliziert, und ich habe schon ganze Bücher darüber geschrieben. Doch auf zwei Dinge möchte ich hinweisen, denn Sie haben etwas gesagt, das ich zwar verstehe, aber nicht teile. Sie haben gesagt, dass es gefährlich sein könnte, sich auf Tradition, Autorität oder Religion zu beziehen. Ich denke, wir müssen dieses Risiko eingehen, ohne ihm zu erliegen. Ich versuche, den unbewussten Nutzen zu deuten, den wir aus der Autorität oder dem Glauben ziehen können, um nur von diesen beiden zu sprechen. Als es vor einiger Zeit die Aufstände in den französischen Vorstädten gab, habe ich in einem Magazin namens Marianne einen Artikel darüber und über die Krise der Adoleszenz geschrieben. Sie haben etwas bemerkt, was in Übersee und vielleicht auch in Europa nicht verstanden wurde: Dass die so genannten beurres, die arabischen Jugendlichen der zweiten Generation, die französische Gesellschaft nicht vom Standpunkt irgendeiner Religion aus zurückweisen. Das sind keine religiösen Unruhen. Es ist auch kein Aufstand einer Gemeinschaft; es geht nicht um arabische Community gegen schwarze Community oder so etwas. Sie wollten anerkannt werden. Sie wollten die Werte der Republik teilen. Sie sagten, dass sie nicht als vollwertige Bürger anerkannt werden. Sie haben Symbole der Republik angegriffen – Schulen, öffentliche Verkehrsmittel, die Polizei. Einige von ihnen, weil sie gewalttätig sind, aber andere, weil sie denken, dass sie nicht anerkannt werden. Meiner Meinung nach ist das etwas sehr Symptomatisches nicht nur für diese Jugendlichen in den Vororten, sondern für alle Jugendlichen – sogar für die wohlhabendsten unter ihnen, die nicht an den Krawallen beteiligt sein werden, aber magersüchtig oder zu borderline-Persönlichkeiten werden oder psychosomatische Probleme bekommen. Warum? Weil die Adoleszenz die Phase ist, die ein Ideal braucht. Die die Anerkennung durch eine ideale Instanz braucht, die ich, mit Freud, den idealen Vater der persönlichen Vorzeit nenne. Das ist aus einem sehr kurzen Absatz seiner Schrift »Das Ich und das Es«. Es hat mich sehr überrascht, dass in der Psychoanalyse bis dahin keine Notiz davon genommen wurde. In meinem Buch Geschichten von der Liebe, das ich in den Achtzigerjahren geschrieben habe, bin ich ausführlich darauf eingegangen, und mittlerweile diskutieren wir in der Psychoanalytischen Gesellschaft sehr viel darüber – mit André Green zum Beispiel und anderen. Freud hat diese Figur des idealen Vaters entdeckt, und er hat sie noch vor dem ödipalen Vater eingesetzt. Der ödipale Vater ist der Vater des Verbots, er macht die Gesetze. Er sagt, bitte rühre deine Mutter nicht an, das ist verboten, ich sage, was gut und was schlecht ist, und du wirst mir Folge leisten. Nun gut, wunderbar, wir brauchen diesen Vater, doch Freud sagte noch mehr: Vor diesem Vater ist noch ein anderer Vater, eben der ideale »Vater der persönlichen Vorzeit«. Dieser ist ein liebender Vater, und mit ihm identifizierst du – männliches oder weibliches Subjekt – dich imaginär, symbolisch, denn er erkennt dich an, er sagt: Gut, mein Sohn, meine Tochter. Und diese veränderte symbolische Verbindung ermöglicht es dir, dich von deiner Mutter zu distanzieren und dich aus der Abhängigkeit vom Uterus, vom Körper, vom Mütterlichen, heraus zu begeben. Das ist der Beginn der Autonomisierung. Und diesen idealen, liebenden Vater haben einige Religionen oder Älteres imaginiert und verehrt. Religionen tun einiges, tun viele falsche Dinge, wie zum Beispiel die Inquisition, aber es funktioniert, denn sie antworten damit auf gewisse innerpsychische Bedürfnisse. Und ich denke, dass dieses Bedürfnis essentiell für die Errichtung eines lebendigen psychischen Apparates ist: Kinder zeigen dieses Bedürfnis, an die Rede der Eltern zu glauben; um dann später, natürlich, gegen sie zu protestieren. Die Kinder in unserer Gesellschaft brauchen diesen liebenden Vater, jedoch haben Väter nicht viel Zeit, zu Hause zu sein; sie meinen aber, die Rolle des Vaters des Verbots und des Gesetzes bekleiden zu müssen et cetera. Obschon, wie wir wissen, die väterliche Funktion heutzutage eine Veränderung erfährt, da neue Formen der Väterlichkeit aufkommen und junge Väter andere Vorstellungen über Väterlichkeit haben, ist es doch wichtig, diesem Bedürfnis nach dem liebenden Vater Beachtung zu schenken, auch in unserem Bildungssystem. Gerät zum Beispiel ein Jugendlicher in eine Krise und fühlt sich wie in einem leeren Raum, weil niemand sein Bedürfnis nach einem Ideal erkennt, dann können wir uns fragen: Gibt es da einen Sozialarbeiter oder einen Lehrer, der ein solches Ideal dem Kind anbieten kann, der ihm sagt: »Ich glaube an dich, du kannst das schaffen«? Wie Sie sehen, besteht meine Herangehensweise in einer Archäologie der Autorität und der Religion: nicht um diese zu wiederholen, sondern um dem psychologischen Bedürfnis, das ich entdeckt habe, in neuen Formen, in neuen Einstellungen Rechnung tragen zu können. Ich werde nie fordern: gebt dieser Jugend eine neue Religion; sondern, dass wir die Menschenrechte zu etwas machen müssen, an das man glauben kann. Und dazu müssen sie von jemandem vermittelt werden, der respektvoll mit den Leuten spricht, so wie es der ideale Vater macht. Wer von uns ist dazu in der Lage? Das ist von größter Bedeutsamkeit im sozialen Bereich, denn oft verhalten wir uns wie Technokraten und schreiben anderen vor, was zu tun ist; wir handeln nicht im inter-esse, um mit Hannah Arendt zu sprechen. Soweit zu diesem Aspekt des Glaubens.
I ch schreibe gerade ein Buch über die Heilige Theresia von Avila, und ich denke, ich werde eine Menge Leute, Leute wie Sie zum Beispiel, damit schockieren, die sagen werden, Kristeva ist bigott geworden, eine Erzkatholikin, was absolut nicht der Fall ist. Ich habe versucht, einige Aspekte dieser Kultur, deren Erben wir sind, zu verstehen, um herauszubekommen, wie man Menschen dazu bringen kann, der Versuchung des Fundamentalismus zu widerstehen. Dazu müssen wir den Nutzen und die Fallen unserer Tradition verstehen. Ich habe darüber in Italien gesprochen, und mein Herausgeber sagte, das sei sehr interessant, damit sollten wir uns mal genauer befassen. Das Ergebnis ist ein Buch, das vor ein paar Tagen in Italien erschienen ist. Es enthält einige Artikel von mir und ein Interview mit dem Titel Bisogno di credere, »Das Bedürfnis zu glauben«. Um deutlich zu machen, warum ich das erwähne, möchte ich einen kleinen Exkurs in die Religionsgeschichte machen: Im Allgemeinen gehen wir, die wir an Religionsgeschichte, Judaismus und Christentum interessiert sind, davon aus, dass Glauben und Christentum zusammenhängen, heißt es doch: credo quia absurdum. Man kann glauben, dass es die Auferstehung gibt, dass die Jungfrau Maria jungfräulich war und so weiter. Man muss es sogar glauben. Im Judaismus dagegen gibt es keinen solchen Glauben, er ist rationaler, denn es geht um die Geschichte des Volkes Israel. Das ist in gewissem Sinne wahr, aber es ist nicht vollkommen wahr. Wenn man sagt, Schm’a Jisrael, hör’ mir zu – man kann niemandem zuhören, wenn man ihm nicht glaubt. Wenn man zuhört, muss man glauben. Wenn Kinder ihrem Lehrer nicht zuhören, so gilt das als Verhaltensauffälligkeit; sie können sich nicht konzentrieren und nicht den Sinn dessen erfassen, was gesagt wird, sie hören nicht zu. Aber das ist deswegen so, weil sie nicht an das Wort, den Satz, an die Botschaft glauben, die ihnen übermittelt werden soll. Sie vertrauen nicht. Glaube und Vertrauen gehen Hand in Hand. Mit diesem Beispiel möchte ich verdeutlichen, dass es ein anthropologisches Bedürfnis gibt zu glauben, das vorreligiös ist. Und vorpolitisch. An diese Phänomene müssen wir mithilfe der Anthropologie, mithilfe der Religionswissenschaft herankommen. Und damit die Menschenrechte erweitern, ohne sie zu verwerfen. Wir müssen in die Menschenrechte etwas wie ein Vermächtnis der Tradition einfügen, dass, ich wiederhole, neu interpretiert werden muss. Sie haben sich auf ein Zitat von Hannah Arendt bezogen, dass ich vorgetragen habe, in dem es um Atheismus und Nihilismus geht. Wie Sie wissen werden, gab es in den USA, genauer gesagt an der Universität von Notre Dame, die politikgeschichtlich-transzendentale Schule, die von Waldemar Gurian und Eric Voegelin geleitet wurde. Die beiden waren amerikanische Juden russischer Herkunft und sind zum Christentum konvertiert. Als Hannah Arendt ihr Buch über Imperialismus und Antisemitismus veröffentlicht hatte, luden sie sie an die Universität von Notre Dame zu einer Diskussionsveranstaltung ein. Sie meinten dabei festzustellen, dass Arendts Kritik an der Säkularisierung in dieselbe Richtung ging wie ihre eigenen Ansichten – mit der expliziten Aussage nämlich, dass die Shoah, der Holocaust, weniger die Folge eines sozio-politischen Prozesses seien, als vielmehr Produkte der Aufklärung. Zwar hat Arendt in der Tat nie geleugnet, dass ein bestimmter Atheismus zum Niedergang der Ethik beigetragen hat. Aber sie insistiert darauf, dass das totalitäre Phänomen einzigartig ist, und dass kein vorhergehendes Ereignis, sei es aus dem Mittelalter oder dem 18. Jahrhundert, als »totalitär« bezeichnet werden könne. Und ebenso grenzt sie ihre philosophische Untersuchung sorgfältig von jedweder religiösen Positionierung ab, indem sie die politische Inanspruchnahme eines »Göttlichen« eben dem von ihr bekämpften, bösartigen Nihilismus zuordnet. In diesem Sinne sind Sie, wenn Sie die Religion als Antwort auf ein politisches Problem nutzen wollen, ein Nihilist. Einfach weil die Religion eine andere Bedeutung hat, und keine politische. Gestern habe ich zitiert, was sie gesagt hat, und ich zitiere es noch einmal: »Diejenigen, die aus den schrecklichen Ereignissen unserer Zeit schließen, dass wir aus politischen Gründen zu Religion und Glauben zurückzukehren haben, scheinen mir zu zeigen, dass ihnen genauso viel Gottesglauben fehlt wie ihren Gegnern.« Religion kann also kein Ersatz für politischen Sinn sein.
Nun noch eine Antwort auf das, was Sie über das Individuum gesagt haben und über die Gefahren, die in einer Überschätzung des Individuums liegen könnten. In der Perspektive Arendts ist das quid, das »Wer«, dem Individuum selbst niemals verfügbar. Sichtbar und offenkundig ist es für die Anderen. Das heißt, Individuum ist man nicht für sich selbst. Anders bei Heidegger, bei dem gerade das Eigene für sich virtuos sein kann, während das Mitsein zum Banalen gewendet wird. Bei Arendt wissen die Anderen, wer du bist. Das quid, die ecceitas, ist eine Botschaft, die sich in der Meinung der Anderen materialisiert. Der Andere ist der Besitzer deiner Identität im Sinne von Übertragung und Gegenübertragung; der Patient weiß nicht, wer er selber ist – der Analytiker weiß es in der Interaktion. Es gibt also weder in Hannah Arendts Szenario noch im psychoanalytischen Denken einen Egozentrismus. Wenn Sie sagen, die multiple Realität müsse konstruiert werden durch die Affekte, Interpretationen und so weiter, denke ich, dass sie in Arendts Verständnis des inter-esse schon enthalten ist, und das ist auch die psychoanalytische Auffassung. Als Psychoanalytiker wissen wir zudem, wie konflikthaft das inter-esse ist, was auch Arendt immer sehr betont hat. Sie bezieht sich auf Augustinus, um das quid als ein liebendes Individuum einzuführen, was wiederum der Freudschen Vorstellung entspricht – das Individuum ist von Beginn an ein liebendes. Ist es das nicht, heißt das, dass es ihm nicht gelungen ist, in der Dreiecksbeziehung von Vater–Mutter–Kind zu sein. Die jüdische Bibel schildert mit Nachdruck diese Konfliktivität in der Abfolge der Generationen, mit der ganzen Bedeutung, die der Zeugung, den Familien und Clans beigemessen wird. Augustinus reflektiert diese konflikthafte generationelle Abfolge in der Welt zwischen Geburt und Tod – was Arendt aufgreift: In dieser Welt, zwischen der Geburt und dem Tode, und nicht nur für die Liebe Gottes, der nicht auf dieser Erde weilt. Auch Freud nimmt diese »jüdische Abfolge« ernst und versucht diese, neben seinen Erkenntnissen über das Seelenleben aus den Analysen, in die Kultur der Aufklärung, der er sich verpflichtet fühlt, einzufügen. Von Hegels Herr-Knecht-Dialektik hat Freud – mehr im- als explizit – das gewaltsame Grundmuster dieser Konflikte aus Liebe und Hass ererbt. Auf der Ebene der Hysterie bekommen wir es damit zu tun: mit dem dialektischen quid zwischen dem sadistischen und dem masochistischen Begehren. Doch Sie haben sehr deutlich und richtigerweise darauf hingewiesen, dass die moderne Psychoanalyse nun auch die Borderline-Symptome, die Entsymbolisierung, die Selbstzerstörung und darüber hinaus einige psychosomatische Erkrankungen, die nicht symbolisiert werden können, eingeführt hat. Wir müssen diese neuen Erscheinungsformen der Gewalt deuten und diese Deutungen der öffentlichen Sphäre wieder zur Verfügung stellen. Denn das soziale Band funktioniert nicht automatisch. Das müssen wir verständlich machen. Die Marginalisierten, seien es behinderte Menschen, seien es bestimmte sexuelle Vorlieben, die nicht so genannt konventionell oder modern sind, oder seien es Kriminelle – sie gehören zur Menschheit, sie sind Teil des menschlichen Prozesses, oder des Liebesprozesses. Und ohne ihn zu banalisieren, muss er gedeutet werden.
IN ANDERE ERFAHRUNGSWELTEN HINEINDENKEN
Frau Professor Kristeva, meine Damen und Herren, ich bin nicht der Bürgermeister der freien Hansestadt Bremen, ich bin Senator für Bau, Umwelt und Verkehr und vertrete den Bürgermeister hier, der sehr gerne heute Abend persönlich hier gewesen wäre, aber er versucht auch, unsere Freiheit ein Stück weit heute zu vertreten – die Föderalismusreform Teil zwei hat ihren Auftakt heute im Bundesrat gestartet, und das ist im besonderen bremischen Interesse, dass wir uns auch deutlich artikulieren, positionieren und Meinung und Stimmung machen. Nun ist sehr viel heute von Bildern die Rede gewesen, und ich habe die Reden mit großem Respekt und großer Anerkennung gehört, und ich muss sagen, es war ein Vergnügen, so viel Intellektualität und so viel Wissen kompakt in unserer schönen oberen Rathaushalle genießen zu dürfen. Wenn man vom politischen Denken redet, redet man zumindest in Deutschland relativ selten von Politikern. Wenn Politiker mit Denken in Verbindung gebracht werden, sind das häufig QuerDenker, komisch eigentlich, so dass die Frage sich für mich zumindest stellt, auch nach dem heutigen Abend, wie kommt das eigentlich, was macht politisches Denken aus? Politisches Denken hat ganz offensichtlich etwas mit Orientierung zu tun, oder Orientierung in Frage zu stellen, und sowohl Hannah Arendt als auch Sie, Frau Professor Kristeva, haben beides jeweils in ihrer Zeit und mit ihrer Sprache sehr deutlich auch artikuliert. In Frage stellen heißt auch, Positionen und sich verändernde gesellschaftliche Realitäten aufnehmen und verarbeiten und einbringen, und Politiker, die, so wie ich, aktuell politisch zu handeln haben, wandeln im Wesentlichen auf den Pfaden derer, die mal politisch irgendwelche Orientierung gegeben haben. Möglicherweise ist das eine Begründung. Wir brauchen politisches Denken, wir brauchen auch politisch queres Denken, und das hat insbesondere dann einen Reiz, eine Herausforderung und gibt extrem viele Impulse, wenn das auch ein Denken ist, das in vielfacher Hinsicht übergreifend ist. Es ist die Rede davon gewesen, von Ihrem Weg von Bulgarien nach Paris, aus dem Totalitarismus hinaus hinein in ein Land mit viel Freiheit und Lebensbejahung, aber trotzdem mit viel Fremdheit. Fremdheit empfindet man möglicherweise auch, wenn man im eigenen Land sich bewegt, es muss nicht immer nur etwas mit unterschiedlichen Erinnerungen, Kulturen und gesellschaftlichen Werten, die man vermittelt bekommen hat, zu tun haben, es kann einfach auch etwas mit dem Raum zu tun haben, mit der Umgebung, in der Mann oder Frau sich bewegt. Fremd kann man auch sein, das ist das nächste Stichwort, das heute Abend auch schon gefallen ist, durchaus auch im Diskurs zu eigenen Kindern, also über Generationen hinweg, weil scheinbar am gleichen Standort, am gleichen Ort, man trotzdem eine komplett andere Erfahrung mit sich bringt, einen komplett anderen Hintergrund mit sich bringt und eine andere Lebensrealität wahrnimmt. Wenn die Kinder, die heute geboren werden, sich in zwanzig Jahren die europäische Landkarte anschauen, haben diese einen komplett anderen Blick auf Bulgarien als wir alle, die hier im Raum sind – das ist ein Land in der Mitte Europas, und es ist nicht ein Land, das irgendwo hinter irgendeinem Eisernen Vorhang eigentlich völlig unbekannt und fremd ist. Auch das ist ein Bild, das sich neu vermittelt. Ralf Fücks hat eben die besondere Situation des Staates Israel angesprochen. Da haben wir in Zentraleuropa allabendlich um 20 Uhr, wenn wir die Tagesschau anschauen, eben einen anderen Blick auf Fremdheit, auf Bedrohung, auf das tägliche Leben im Umgang mit Gewalt und Bedrohung, die man erfahren kann, und deswegen auch naturgemäß eine andere Übersetzung und eine andere Vorstellung, wie man damit umzugehen hat. Und da braucht es Menschen, die denken, die nachdenken, die quer denken, die Erfahrungen haben, die auch springen, die sich auch auseinander setzen mit anderen Biografien, Lebensbiografien, mit anderen Frauen, versuchen, sich in diese Erfahrungswelten hineinzudenken, und auch in deren Zeitabläufe, in deren zeitliche Restriktionen und Wirklichkeiten hineinzudenken, und das haben Sie in vorbildlicher Weise getan, und insoweit ist es mir eine besondere Freude, heute bei so vielen guten Laudatoren, gemeinsam mit Ralf Fücks, Ihnen nun auch den Preis überreichen zu dürfen.
Vielen Dank.
Julia Kristeva wurde 1941 in Bulgarien geboren, studierte
Romanistik und kam 1965 im Rahmen eines französischbulgarischen Austauschprogramms nach Paris. Sie blieb
dort und beendete ihre akademische Ausbildung mit einer
Habilitation (»Die Revolution der poetischen Sprache«).
1978 schloss Sie ihre psychoanalytische Ausbildung ab
und praktiziert seitdem als Therapeutin. Ihr Werk umfasst
Arbeiten zur heutigen Psychoanalyse, zur Kultur- und Religionsphilosophie und zum Zeitgeschehen. Seit Anfang der
1990er Jahre steht Hannah Arendt im Mittelpunkt ihres
politischen Denkens.
Auf Deutsch sind u.a. erschienen: Die Revolution der
poetischen Sprache (1978), Die neuen Leiden der Seele
(1989), Fremde sind wir uns selbst (2001), Hannah Arendt
– Das weibliche Genie (2002).

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Macht und Ereignis
Der besondere arendtsche Akzent dieser Preisverleihung
Lassen Sie mich mit einer kleinen Geschichte beginnen. Unsere Namensgeberin erzählt sie in ihrer Schrift Die ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus vom Jahre 1958. Sie könnte uns, hörten wir ihr gut genug zu, in das Zentrum der Sache einstimmen, um die es bei dieser Preisverleihung in einer besonderen Weise geht. Ein erster Hinweis auf diese Sache könnte die Frage sein: Welche Betonung, welche Herausstellung der arendtschen Zugänge zum Sinn des Politischen, zum Offenkundigen und Verborgenen unserer politischen Geschichte wäre, in diesem Arendt-Jahr 2007, die wohl dringlichste? Die dringlichste in Hinblick auf jene, uns alle betreffende Konstellation unserer Zeit, in der die Krise des Politischen, nicht nur in diesem Lande und nicht nur auf unserem Kontinent, sowohl offenkundig ist als auch – in den verschiedensten parteipolitischen, politikwissenschaftlichen, globalisierenden und antiglobalisierenden Diskursen – verdeckt wird. Und verdeckt auch, muss man leider sagen, von vielen Diskursen und Vorspiegelungen im Namen der moralisch vorgetragenen »Menschenrechte«. In der fraglichen, von Arendt erzählten Geschichte geht es um ein fast unscheinbares und doch weithin leuchtendes Ereignis. Es mag vor vielen Jahren und in einer anderen politischen Welt vorgefallen sein, doch sein Sinn ist gegenwärtig und geht uns heute noch genauso an. Es geschieht bei einer Dichterlesung in Moskau der Fünfzigerjahre, in denen sich erste Haarrisse in der noch intakten stalinistischen Macht zu zeigen begannen. Boris Pasternak sollte aus seinen Gedichten vorlesen. Jener Boris Pasternak, den die meisten außerhalb Russlands nur als den Romanautor von Doktor Schiwago kennen, wobei er vor allen Dingen jener Dichter war, der den poetischen Einbruch in die russische Welt des 20. Jahrhunderts, der von den tragischen und schon fast mythischen Gestalten von Anna Achmatova und Marina Zwetajewa angeführt wurde, auch weiterhin erfahrbar machte. »Pasternak«, erzählt Arendt – ich zitiere –, »hatte da einen Vorleseabend angekündigt, zu dem sich eine ungeheure Menschenmenge eingefunden hatte, wiewohl doch sein Name nach all den Jahren des Schweigens nur noch als Übersetzer von Shakespeare und Goethe bekannt war. Er las aus seinen Gedichten und es geschah, dass ihm beim Lesen eines alten Gedichts das Blatt aus der Hand glitt. … Da begann eine Stimme im Saal aus dem Gedächtnis weiterzusprechen. Von mehreren Ecken des Saales stiegen andere Stimmen auf, und im Chor endete die Rezitation des unterbrochenen Gedichts.« Wir kommen nun dem weiterwirkenden Sinn dieser »Moskauer Geschichte« Arendts näher, wenn wir versuchen, den Kontext zu verorten, in dem sie sie erzählt. Wie schon erwähnt erzählt uns Arendt dieses Ereignis im Rahmen ihrer Schrift über ein anderes politisch und geschichtlich gewiss gewichtigeres Ereignis: das jener Ungarischen Revolution von 1956, in der, in einer ungeplanten und davor unvorstellbaren Weise, die Furcht erregende Macht eines totalitären Staatsapparates, seine Befehls- und Waffengewalt, in wenigen Tagen oder gar Stunden zusammenbrach. Weniger durch die Aktionen gar nicht sehr zahlreicher aktiver Kämpfer, als durch eine Veränderung des »Aggregatszustandes« des sich versammelnden und sich plötzlich artikulierenden Volkes. Für Arendt war dies ein Schlüsselereignis innerhalb unserer, von der Macht des Totalitären und von den Einbrüchen des Politischen überschatteten neueren Geschichte.
Gerade in Bezug auf den bei dieser Preisverleihung an Julia Kristeva besonders hervorzuhebenden arendtschen Zugang zu unserer politischen Geschichtlichkeit sollten wir an diesem Punkt wahrnehmen: Viel zu oft – und fatal einseitig – wird das arendtsche Œuvre im Wesentlichen mit Beschreibungen und Analysen der »voranschreitenden«, »erfolgreichen« und ständig »drohenden« totalitären Prozesse und Mächte verbunden. In dieser – wohl symptomatischen – Fokussierung verschwindet genau das, was dem arendtschen Werk seine epochale Bedeutsamkeit verleiht. Das nämlich, was weit über die – generell liberal inspirierten – Totalitarismustheorien hinausgeht und auch nicht mit den – oft mit arendtschen Hinweisen vorgetragenen – Diskursen aufgeht, für die die »Zivilgesellschaft« eine in die rationale und moralische Moderne endlich »angekommene« Gesellschaft ist. Was in ihr verschwindet, ist die arendtsche Aufmerksamkeit für die plötzlich eintretende Ohnmacht dieser und wohl aller wesentlich gewaltgestützten Machtformen unserer Geschichtlichkeit, wenn jene – öffentliche – Wir-Weise in Erscheinung tritt, in der das, was im luziden arendtschen Verständnis die wahrhafte Macht – und keine »Gegenmacht« der gleichen Machtsorte – ausmacht. Mögen diese öffentlichen Wir-Weisen – an unsere latenten Freiheitsübertragungen anknüpfend – noch so vergänglich innerhalb unserer neutralisierten Zeitabläufe sein: Ohne sie könnten wir nicht einmal, wie Arendt es in ihrem Vom Leben des Geistes schreibt, jene »Sphären des Handelns« erfahren, durch die »Gemeinwesen, in denen das ›Wir‹ seine angemessene Gestalt für die Reise in die historische Zeit gefunden hat«, in die Welt kommen, und die in das determinierte, voll säkularisierte Kontinuum, in die »Abfolge der chronologischen Zeit einbrechen«.
Denn wie Paul Ricœur einmal schrieb, »die Auflösung der Macht« (das heißt der, die sich an die Gewalt assimiliert hat), »ist ein instruktiveres Phänomen hinsichtlich der Natur der Macht als die Ohnmacht, die aus der Ausübung der Macht resultiert.«
I n diesem Kontext ist Arendts »Moskauer Erzählung« eine Art Ouvertüre zum zentralen Thema des Essays, in dem Arendt die Ereignisse des »Ungarischen Oktobers« als ein Wiederhervortreten einer Freiheits-, ja einer Revolutionslatenz unserer westlichen Geschichtlichkeit wahrnimmt. Gegenüber dem zutiefst widerständigen, aber nicht bloß »oppositionellen« Chor des Moskauer Theaters, der wohl auch in einem dankenden und hoffnungsbestätigenden Ton das Pasternak-Gedicht – öffentlich – rezitierte, wurde die sonst allgegenwärtige totalitäre Macht radikal machtlos. Die Wahrheit – oder besser: das Wahrheitsgeschehen – in dieser Erzählung liegt offenbar nicht innerhalb der realpolitischen, moralpolitischen oder kulturpolischen Kategorien durch die wir, alltäglich, unsere politische Wirklichkeit theoretisch einordnen. Es fällt uns schwer, es in einer Weise wahrzunehmen, in der es auch unsere – wirklichkeitsgarantierenden – Kategorien affiziert, so dass wir im Geschehen der Erzählung nicht nur eine wohl anrührende, doch nicht wirklich relevante Einzelepisode erblicken. Es ist aber zu befürchten, dass unsere Bemühungen, an das arendtsche Denken anzuknüpfen – auch im Kontext dieser Preisverleihung –, ohne diese Schwierigkeit auf uns zu nehmen, hilflos oder idealistisch-utopisch bleiben. Die Frage nach der Art der Freiheitslatenz und seiner differierenden Zeitlichkeiten zeichnet auch die Nähe des arendtschen zum benjaminschen Denken aus. In ihrem großen Essay zu Walter Benjamin, wo die emblematische Gestalt des »Perlentauchers« den benjaminschen Umgang mit der Geschichte verkörpert, ist der »Schatz« (auch der »verlorene Schatz der Revolution«) nicht aus der Welt, er ist »nur versunken«. Wir können aber, um bei der Metapher zu bleiben, im Meer – das übrigens selber eine Metapher des Mütterlichen ist – nach ihm »tauchen«, ohne Gewissheit, doch mit dem Zutrauen, dass er uns eigentlich geschenkt und versprochen wurde. Es ist nicht schwer, in dieser Passage des Benjamin-Aufsatzes eine Metapher des jüdischchristlichen »Versprechens« innerhalb einer gewandelten, nicht mehr zwingend-offensichtlichen Konstellation wahrzunehmen. Wir können in diesen Zeilen auch eine andere Metapher herauslesen. Sie ist die des »eintauchenden« freudschen (und nachfreudschen) analytischen Erfahrungszugangs. Dieser liegt allerdings – wie auch die zur übertragungsoffenen politischen Erfahrung – nicht auf dem Trockenen der psychologischen oder politologischen Reflexionen. Es ist aber auch nicht so, dass das Bedeutsame dieser arendtschen Erzählung nur von der zentralen Thematik des Essays her beleuchtbar wäre. Umgekehrt ist auch die Hauptthematik des Essays von dieser »Ouvertüre« her gestimmt. Das heißt: Von einem, durch eine »Unterbrechung« zur Stimme gekommenen, politisch-poetischen und doch eigentümlich mächtigen »Wir« her, das keine »Oppositionsgruppe«, keine »Masse«, aber auch keine Gruppe eines »kulturellen Ausdrucks« ist. Das »Poetische« dabei ist keine im herkömmlichen Sinn »ästhetische« Kategorie. Vergessen wir nicht, dass im erweiterten politischen Verständnis Arendts das hellenische »Volk der Griechen« – in dem dann der ereignishafte Sprach- und Handlungsraum der Polis aufkommt – im Hören und Sagen der homerischen Dichtung entspringt, ebenso wie das jüdische Volk im »Höre Israel« und der Zusammenhang des Christentums in der »Frohen Botschaft« entspringt. Es ist so, als ob darin eine nicht-selbstreferentielle Art der Solidaritätsmacht gestiftet wäre, die mit unseren gewohnten – die differierenden Zeitlichkeiten einebnenden – Begriffen der »Interessens- oder Wertegemeinschaft« nicht zu fassen ist. Wohl auch deshalb, weil in der Natur der Letzteren nichts Angesprochenes und nichts Ansprechendes gedacht werden kann.
Damit kommen wir dem besonderen arendtschen Akzent dieser Preisverleihung näher. Wir haben für sie nicht von ungefähr als Motto einen Satz aus Arendts Denktagebüchern gewählt. Er heißt: »Nur von den Dichtern erwarten wir Wahrheit, nicht von den Philosophen, von denen wir Gedachtes erwarten.« – »Wahrheit« zielt hier, wie bei Arendt auch anderswo, auf ein Wahrheitsgeschehen, sei es der entbergenden oder der vertrauensbezeugenden Art. In der Sprache wohnt Dichtendes, können wir wohl im Sinne Arendts sagen, und nicht bloß Informationskommunizierendes, mag dies auch für viele Philosophen und Sozialwissenschaftler schwerer nachvollziehbar sein als für gewöhnliche Sterbliche. Dieser Akzent der diesjährigen Preisverleihung ist innig mit dem Werk unserer Preisträgerin verbunden. Dieses Werk ist von jener genuin arendtschen Wiedereröffnung jener konstitutiven Bezügen gekennzeichnet, die, mal in ereignishaften, mal in latenten Weisen, zwischen unserem Sprachwesen und der Macht des Verzeihen- und Versprechenkönnens walten. Es ist diese Macht, die für Arendt die Zeiträume des Politischen eröffnet. In Julia Kristevas Denken bekommen nun diese Bezüge – durch die unsere singulären Daseinsweisen mit unseren geschichtlichen Wir-Weisen verbunden sind – einen aktuellen politischen Sinn. Oder auch: einen widerständigen Sinn in der anfangs erwähnten, das Politische bedrohenden Konstellation. Er untergräbt die fast selbstverständlich gewordene funktionalistisch rationalisierende Festlegung, Identifizierung des politischen Sprechens und Handelns. Er untergräbt somit auch die dunkle, verdrängte »andere Seite« derselben Ausprägung. Diese kommt uns dann als die – mal offenere, mal untergründigere – paranoide Identifizierung des Politischen mit dem »letzten Entscheidungskampf« gegen die je aktuelle Verkörperung des An-Sich-Bösen vor. Durch beide Seiten werden die erwähnten Bezüge zwischen unseren Selbst- und Wir-Weisen und ihre – nicht bloß intellektuelle – Bearbeitbarkeit verdeckt und verleugnet. Nichtsdestoweniger gehören die an sie direkt anknüpfenden und weithin wirkenden Diskurse zu unserer politischen, intellektuellen und auch akademischen Wirklichkeit. In welchem Maße die geschichtliche Bedeutung des arendtschen Denkens von der Widerständigkeit gegenüber diesen Diskursen und ihren Praktiken gekennzeichnet ist, wird in der Arendt gewidmeten Literatur nur recht puktuell wahrgenommen. Desto wichtiger ist somit die Weise, in der sie in Kristevas Werk hervortritt. Sie tritt hervor, auch weil Julia Kristeva einen noch seltenen Beitrag dazu geleistet hat, die »Verwandtschaft« zwischen dem arendtschen Zugang zu unseren freiheits- und übertragungsoffenen politischen Zwischenräumen und den freudschen-nachfreudschen Zugängen zu dem, was – wie Kristeva sagt, eher »selten« – in der analytischen Situationen geschieht, denkbar zu machen. Beide Zugänge liegen sozusagen »diesseits« unserer gewohnten politikwissenschaftlichen und psychologischen Objektivierungen. Verschwindet die »Verwandtschaft«, werden sie erneut in die besagten Objektivierungen zurückgedrängt. Dies hilft uns wesentlich beim – wie die Arendt-Literatur es zeigt: gar nicht leichten – Nachvollzug des Arendtschen Verständnisses von unterbrochenen Handlungskontexten und Neugründungen. Die epochal angestoßene freudsche Erweiterung der denkerisch zugänglichen Erfahrung und Erfahrungszeitlichkeit hat ja auch ihre Parallelen in den phänomenologischen Durchbrüchen, die den direkten denkerischen Hintergrund Arendts bilden. Die analytische Erfahrungserweiterung »geschieht« in der übertragungsoffen werdenden ereignishaften Wiederverflüssigung der Fixierungen, die uns, alltäglich, sowohl vom Ängstigenden wie vom Zusprechenden abschirmen. Dadurch kommt die Macht ihrer Neubearbeitung zustande. Die »Moskauer Erzählung« Arendts zeigt uns, wie die Anknüpfbarkeit an das, was die Freiheitsdimension des Politischen trägt, mit dem Wirksamwerden des poetischen Wortes und seiner WirWeisen zu tun hat. Darin liegt der besondere arendtsche Akzent dieser Preisverleihung.
Ein Mädchen aus der Fremde. Julia Kristeva zitiert in ihrem Buch über Hannah Arendt einen Brief ihrer Heldin, des ersten unter ihren drei weiblichen Genies, an Martin Heidegger. »Ich habe mich nie als deutsche Frau gefühlt und seit langem aufgehört, mich als jüdische Frau zu fühlen. Ich fühle mich als das, was ich nun eben einmal bin, das Mädchen aus der Fremde.« Kristeva bemerkt gleich, dass es hier um ein Gedicht von Schiller geht, und in der Fußnote zitiert sie auch zwei Strophen des Gedichtes: Sie war nicht in dem Tal geboren,/ Man wusste nicht, woher sie kam;/ Und schnell war ihre Spur verloren,/ Sobald das Mädchen Abschied nahm.// Seligend war ihre Nähe,/ Und alle Herzen wurden weit;/ Doch eine Würde, eine Höhe/ Entfernte die Vertraulichkeit. Kristeva erwähnt noch, dass Heinrich Blücher gern seine Frau so bezeichnete, und dass Heidegger selbst ein Gedicht über dieses Thema für Hannah geschrieben hat. Danach erwähnt sie das Gedicht nicht mehr. Hat sie diese Strophen wegen der letzten zwei Verse zitiert, die in ihrer eigenen Prosaübersetzung – sa dignité majestueuse éloignait toute familiarité – noch härter klingen? Mag sein. Über Kristevas Leben weiß ich nicht viel mehr, als dass sie in Sliwen, Bulgarien, geboren ist und seit ihrem 24. Lebensjahr in Paris lebt und tätig ist. Eine Fremde unter den Franzosen. »Nirgendwo ist man fremder als in Frankreich« – schreibt sie; sie fügt aber fast gleich hinzu: »… dennoch, nirgendwo ist man besser Fremder als in Frankreich.« Das reicht aber. Sie selbst muss auch ein Mädchen aus der Fremde sein, dessen Würde und Höhe die Vertraulichkeit ebenso entfernen muss wie bei Arendt. Ein Fremder zu sein ist eine Last, eine Fremde zu sein ist bestimmt noch mehr eine Last, aber eben diese Last, wenn eine sie nicht loswerden kann und will, wird ihr zur Würde und Höhe des bios theoreticos verhelfen. Kristeva schreibt: Arendt erinnere uns daran, dass bios theoreticos grundsätzlich ein bios xenicos sei. Ein bios xenicos ist freilich nicht notwendig auch ein bios theoreticos. Ist aber eine »Fremdlingin« (Heidegger nennt Hannah im erwähnten Gedicht so) eine Theoretikerin, dann ist sie in dreifacher Weise ein xenos. Erstens eine Jüdin unter Deutschen, eine deutsche Jüdin in Amerika oder eben eine Bulgarin unter Franzosen. Zweitens: eine Frau unter Männern, ist erst recht fremd, wenn sie, heiße das wie auch immer, darauf beharrt, als Frau zu denken, sich an die Denkweise der Männer nicht anzupassen. Und drittens: als Denker unter Forschern; da bios theoreticos zu sein, heißt denken im heidegger-arendtschen Sinne, und nicht das Seiende erforschen, erkennen, damit der Mensch – nicht wir, die Menschen – maître et posesseur de la natur, das heißt reich und mächtig wird und in Sicherheit leben kann. Darum geht es eben. Um ein Leben, das eine ständige Neugeburt ist, sei es durch Liebe, oder durch Politik. Diese zwei Wörter, Liebe und Politik als Quellen der Neugeburt, verbinden miteinander Julia Kristeva und Hannah Arendt, diese außergewöhnlichen Mädchen aus der Ferne.
Denn jemand kann vielleicht darüber staunen, dass hier diesmal Julia Kristeva den »Hannah Arendt Preis für politisches Denken« übernimmt. Man könnte ja darüber staunen, sogar aus zweierlei Gründen. Man könnte einerseits sagen, dass Kristeva alles andere sei, nur keine ausgesprochene politische Denkerin. Andrerseits ist Kristeva nicht nur eine sehr bekannte Psychoanalytikerin von Beruf, sondern auch jemand, der zur Deutung der Psychoanalyse sehr viel Wichtiges beigetragen hat; und die Psychoanalyse bildet ihr den Ausgangspunkt bei der theoretischphilosophischen Analyse fast aller Erscheinungen, die sie interessieren, und ihr Interessenfeld ist wirklich vielschichtig und verzweigt; sie ist ein Mensch, und nichts Menschliches ist ihr fremd, auch das Fremdeste nicht. Arendt aber hat – und jetzt werde ich Kristeva zitieren – »die Psychoanalyse zeit ihres Lebens verachtet«. Dennoch hat Kristeva den ersten Teil ihrer Trilogie über »le génie féminin« Arendt gewidmet, und – auch unabhängig davon – das Staunen ist ganz und gar unbegründet. Einerseits ist Kristeva im Sinne Arendts doch eine echte politische Denkerin. Wie oft sie sich über die politischen Ereignisse unserer Zeit ausgesprochen hat, weiß ich nicht. Arendt scheint mir in dieser Hinsicht sicher aktiver gewesen zu sein. Hannah Arendt war aber nicht deshalb eine politische Denkerin, vielleicht die größte politische Denkerin des letzten Jahrhunderts, weil sie als politische Journalistin zeitweise ziemlich aktiv war. Sie war eine politische Denkerin, weil im Zentrum ihrer Erläuterung des Menschenlebens etwas stand, was sie Politik nannte; Politik nicht im Sinne, wie sie uns in unserer Zeit erscheint und meist aufgefasst wird, nämlich als Schlachtfeld der voreingenommenen, aneinander stoßenden Interessen, bei dem nichts anderes zählt als die Wohlfahrt und der Gewinn, der Fanatismus und die Herrschsucht, wo die öffentlichen Angelegenheiten vom Interesse und von der Macht gesteuert werden, sondern im Sinne der griechischen polis, in der die Menschen in der Gesellschaft von Gleichgesinnten auftraten, diese Gesellschaft genossen, zusammen handelten und vor der Öffentlichkeit erschienen, mit ihren Worten und Taten zum Gang der Welt beitrugen, und auf diese Weise ihre persönliche Identität erwarben und bezeugten und etwas vollständig Neues begannen. Gemeinsames Handeln und Denken gleich gesinnter Individuen, wobei ein jeder seine Individualität zustandebringen und aufzeigen will, wodurch auch etwas vollständig Neues in der Welt erscheint, die Geburt des Neuen, die ständige Erneuerung unserer Welten, das ist, was Arendt Politik, den wahren Gehalt der Politik nannte, und was im Zentrum ihres Interesses und ihrer Analysen stand. Die Geburt des Neuen durch das Handeln der Individuen, die während dieses Handelns außergewöhnlich werden, das bildet aber auch das Zentrum des Interesses von Julia Kristeva. Die zwei Fremden sprechen über dasselbe, was, wie Heidegger so oft betont, nicht das Gleiche ist, nämlich über den Beginn, über die Geburt des ständig Neuen, was in ihren Augen das Spezifikum der Menschen ist. Initium ergo ut esset, creatus est homo, zitiert Arendt 1929 Augustin in ihrer Dissertation über den Liebesbegriff bei Augustin. Bei Augustin ist das Neue in der Liebe geboren. Im Jahre 1929 wusste Arendt noch, dass auch die Liebe der Neubeginn des Individuums ist, nach 1933 steht im Zentrum ihres Interesses – aus wohl begreifbaren Gründen – ausschließlich der politische Raum als der Geburtsort des Neuen. Sei es aber wie auch immer, das Interesse für die Geburt des Neuen und die Überzeugung, dass ohne permanente Neugeburten kein echtes, das würdiges Menschenleben möglich ist, ist das Gemeinsame bei Arendt und Kristeva. Deshalb konnte Julia Kristeva trotz Arendts Verachtung der Psychoanalyse und, was noch wichtiger ist, trotz der Enge der arendtschen Sicht, nämlich dass sie sich die Geburt des Neuen ausschließlich in einem politischen Raum vorstellen konnte, für dessen Neuschaffung die Chancen in unserer Zeit nicht allzu groß sind, die Größe, die Genialität der politischen Denkerin verstehen und darstellen. Übrigens meint Kristeva, dass hinter Arendts Verachtung der Psychoanalyse ein falsches Bild der psychoanalytischen Einstellung stecke. In der Psychoanalyse sah sie nämlich »eine szientistische Reduktion des ›Lebens des Geistes‹ auf Gemeinplätze«. Hat Arendt vielleicht zu viel Freud und zu wenig Melanie Klein (das zweite weibliche Genie) und Lacan gelesen? Kristeva zeigt uns, dass Arendts Analysen von persönlichen Lebensgeschichten oft ganz nah zur Psychoanalyse standen. Als zum Beispiel Arendt über die Gefasstheit von Rahel Varnhagen spricht, bemerkt Kristeva: »Während dieser Begriff an Heideggers Entscheidung oder Entschlossenheit erinnert, stellt der psychologische Kontext, in dem Arendt mit ihrem ›Beispiel‹ Rahels steht, ihre Überlegung eher in die Nähe der Psychoanalyse als der Ontologie. Rahels Biografin führt eine eindringliche Analyse der Spaltung der hysterischen Persönlichkeit durch, so wie Analytikerinnen sie zur gleichen Zeit zu beschreiben beginnen – als ›Maskerade‹ nach Joan Riviere oder als ›Persönlichkeiten als ob‹ nach Helene Deutsch.«
mmer wieder wird also die Wiedergeburt in der Liebe und in der Politik, in der ständigen Befragung unseres Lebens betont. »Nicht mehr ewiges Glück noch Wiedererinnerung an das Sein Gottes in der Glückseligkeit des Liebenden, ist das Leben nun eine Frage. … Das Leben, das sich nicht befragt, das Leben in der Gewohnheit erscheint nunmehr nach biblischem Denken als ›wahre Sünde‹, mehr als irgendein Begehren. … Arendt beharrt auf dem Leben als Konflikt …« Der »psychische Raum des Fragens ist genussbringend, er garantiert das Überleben des Lebenden durch die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, aber nur insofern das Subjekt fähig ist, sich der Autorität oder auch einfach nur der Grenze des Anderen entgegenzustellen. Genuss der Liebe, gewiss, aber der Liebe als Konflikt: in einem Zustimmung und Verweigerung, Freude und Leid.« Kristeva schreibt diese Zeilen über Hannah Arendts Augustin-Interpretation. Könnte hier nicht im Text statt Liebe Auftritt des Individuums im öffentlichen Raum stehen: Auch die arendtsche Politik garantiert das Überleben des Lebenden durch die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen innerhalb eines Konflikts, der in einem Zustimmung und Verweigerung, Freude und Leid ist. Erinnert das, was Kristeva am Anfang ihres Buches Geschichten von der Liebe, im »Lob der Liebe« schreibt – »… was ist die Psychoanalyse anderes als eine endlose Suche nach Wiedergeburten vermittels der Liebeserfahrung, die immer wieder gemacht wird, um verschoben, wieder aufgenommen und, wenn schon nicht abreagiert, so doch gesammelt und eingesenkt zu werden in das künftige Leben des Analysanden als verheißungsvolle Voraussetzung für seine ständige Erneuerung, seinen Nicht-Tod?« –, erinnert das nicht an Hannahs Lob der polis, des Raumes, der alleine fähig war zu erreichen, dass es sich lohnte die Last des Lebens zu ertragen und auch im Schatten des persönlichen Todes zu leben? Die Liebe und die Politik sind so aufgefasst, wie Kristeva sagt: »Versöhnung mit der Erfahrung unseres eigenen Verlustes«. (»Der Skandal des Zeitlosen«) Keine Erlösung, keine Auferstehung, daran können die modernen Menschen nicht mehr glauben, sondern endlose Suche nach Wiedergeburten. Jeder Abschluss, das Erreichen des Zieles, ist, wie bekannt, der Tod selbst. Damit hängt aber auch Kristevas Kritik an der Enge der Einstellung der späten Arendt zusammen. Gewiss hat Arendt die Politik erotisiert, und Kristeva stellte die Liebe im arendtschen Sinne politisch dar. Kristeva weiß aber genau, dass die Ethik der Moderne die lästige und unvermeidliche Problematik des Gesetzes nicht umgehen kann, was Arendt im Zusammenhang ihrer erotisierten Politik zu vergessen schien; deshalb stand sie ganz verzweifelt in einer Welt, in die die Politik, so, wie sie in der polis und dann in der Moderne alleine in der amerikanischen Revolution war (vielleicht noch in der ungarischen von 1956), nicht mehr zurückkommen kann. Sie hat nicht den Versuch gemacht, der Problematik des siegreichen Gesetzes »dem Körper Sprache und Lust zu verleihen« – was Kristevas Meinung nach nur Frauen mit ihrem Wunsch nach Reproduktion neu formulieren könnten. »Damit das Denken des Todes erträglich wird: Die Häretik ist NichtTod, Liebe …« Kristeva kritisiert auch Arendts starre Gegenüberstellung von Privatem und Öffentlichem. Sie sagt einerseits: »Man kann die Kühnheit, mit der sie die der Ökonomie unterworfene ›Gesellschaft‹ kritisiert, nur begrüßen, nachdem das Gesellschaftliche in der Tat zum Gemeinplatz jeder Politik, von rechts wie von links, geworden ist. Außerdem ist die Versuchung groß, Hannah Arendts Plädoyer gegen das Gesellschaftliche in die Nähe der psychoanalytischen Unterscheidung zu rücken, die zwischen dem Bedürfnis einerseits, das das Subjekt an das Archaische und die mütterliche Abhängigkeit bindet (was Arendt ›Haushalt‹, ›Ökonomie‹ und vitalistische ›Gesellschaft‹ nennt), und dem Begehren andererseits, das die gefahrvolle Freiheit der Beziehungen zu anderen öffnet (was sie den ›Raum des Erscheinens‹ und der ›politischen Aktion‹ nennt), differenziert.« Sie will aber andererseits dennoch »die Grenze des arendtschen Plädoyers gegen eine von der Ökonomie überflutete und dadurch die Freiheit der polis verschlingende Gesellschaft hervorheben«. Sie kritisiert die zu enge Auffassung des Ökonomischen, des Weiteren Arendts Behandlung des Körpers und des psychischen Lebens und der Intimität, die sie alle notwendig unpolitisch und zum Allgemeinen angehörig sieht. Will Kristeva etwa sagen, dass es sich lohnt, auch in einer Welt zu leben, in der der polisartige politische Raum die Gesellschaft nicht in den Privathaushalt zurückdrängen kann, und die Chancen, dass einzig und allein die polisartige Politik die Welt gestaltet und sie permanent neu gebärt, sehr gering zu sein scheinen? Ich meine wohl. Auf dieser Weise hat sie sich aber Arendt nicht gegenübergestellt, sondern mit Hilfe der Psychoanalyse ihre ganz originelle Sicht erweitert.
Zum Fremden in uns offen bleiben
Guten Abend, bonsoir, Julia. Julia Kristeva wird es verstehen, wie schwierig es ist für einen Frankfurter, eine Woche nach der Niederlage nach Bremen zu kommen, aber ich tue es gern, weil es für dich, Julia, ist. Es gibt einen wunderschönen Begriff, den hat sie vorhin zitiert, »je me voyage«, das ist so die Definition praktisch dessen, was sie ist. Das ist zwar eine Heldin eines ihrer Romane, aber das ist sie selbst. »Ich bereise mich« – und ich nehme sie mal mit auf Reise. Julia Kristeva ist ja in Bulgarien geboren, 1941, und die Frage ist ja dann, wenn Sie sich vorstellen wollen, Julia Kristeva, ja, was sagen Sie denn? Bulgarin? Französin? Ich könnte sagen, willkommen, sie ist Europäerin, denn Bulgarien ist gerade beigetreten, das macht es mir einfacher zu sagen, sie ist Europäerin. Aber so einfach ist es nicht. Um das mal herauszubekommen, möchte ich einen Gedanken von Amin Maalouf, das ist ein … und schon fängt es wieder schwer an … Amin Maalouf, ja, was ist er? Ein in Libanon geborener Schriftsteller, das ist noch einfach, ist Franzose oder Libanese? Genau diese Frage, sagt er, Amin Maalouf, stelle man ihm immer: Ja, was bist du eigentlich? Bist du Libanese oder bist du Franzose? Und er sagt: sowohl als auch. Ja klar, du bist sowohl als auch, aber in der Tiefe deines Herzens – was bist du? Wenn du Schwierigkeiten hast oder wenn du dich identifizieren musst, was bist du? Und er sagt, ich bin weder noch. Ja, zur Hälfte bist du Franzose und zur Hälfte bist du Libanese. Nein, es gibt keine halbe Identität, es gibt keine Teilidentität so und eine Teilidentität so, ich bin ein Ganzes, und als Ganzes bin ich, und dann sagt er, ich zitiere ihn jetzt, ich zitiere auf Französisch und übersetze ihn gleich mit – also: »Ich werde immer unter Druck gesetzt, ich muss mich jetzt entscheiden, aber nicht nur unter Druck gesetzt von Fanatikern oder Xenophoben, sondern von Menschen wie Sie und ich, die immer die gleiche Frage stellen. Weil es eben diese Gewohnheit gibt, dass man immer wieder versucht, die Identität, und zwar diese bigotten Versuche, die Identität immer auf einen Kern zu reduzieren. Als gäbe es einen Kern der Identität – dagegen muss man protestieren, und ich sage mit Wut, ich habe keinen einen, eindeutigen Kern, sondern meine Identität ist multipel, ist mehrdeutig.«
Sie werden sagen, das ist eine Banalität, eigentlich könnte das jeder sagen, jeder Intellektuelle, jeder gut meinende Mensch, und am Stammtisch der Intellektuellen habe ich einen gefunden, einen absolut brillanten Menschen, der hat den Blitzableiter erfunden, gar nicht schlecht, der zählte zu den Erstunterzeichnern der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, also jemand, der Tocqueville sehr beeindruckt hat. Der hieß Benjamin Franklin und hat 1751 ein Pamphlet geschrieben über die pfälzischen Bauern, es ging um Identität, um das Sein. Und ich schwöre, ich bin zwar absolut laizistisch, aber ich schwöre bei allem, was ihr wollt, dass das, was ich jetzt vorlesen will, kein Scherz ist, sondern Realität, es wurde so geschrieben. Es ging um einen Streit, um die pfälzischen Bauern als deutsche Einwanderer in Amerika. Diese deutschen Einwanderer waren meistens Katholiken. Sie kamen aus der Pfalz, und sie waren anders als die anderen Einwanderer, die Anglikaner. Und zwar anders in einem ganz einfachen Sinn. Die Anglikaner arbeiten sieben Tage die Woche, oder sechs Tage die Woche, am siebenten Tag gehen sie zur Kirche, morgens, und dann bleiben sie praktisch zu Hause. Sie kennen das, es war lange Zeit zum Beispiel unmöglich, ein Fußballspiel oder Tennisspiel in Wimbledon am Sonntag durchzuführen. Die Katholiken, die pfälzischen Bauern, hatten eine andere Tradition. Sie arbeiteten sechs Tage die Woche und am siebenten Tag gingen sie auch in die Kirche, aber danach ging es ins Bieroder Weinzelt und dann ließ man die Sau raus. Und das hat die Anglikaner furchtbar gestört, die haben diese Zelte angezündet, das war ein richtiger Kulturkampf. Und daraufhin schrieb also dieser Benjamin Franklin über die ethnische Reinheit Amerikas, ich erfinde nichts: »Die Zahl ganz weißer Menschen in der Welt ist verhältnismäßig sehr klein. Ganz Afrika ist schwarz oder dunkel, und ganz Amerika, außer den Neuankömmlingen. Und in Europa haben die Spanier und Italiener, Franzosen, Russen und Schweden das, was wir gewöhnlich eine dunkle Hautfarbe nennen. So sind die Deutschen dunkel, mit Ausnahme alleine der Sachsen, die mit den Engländern die Hauptmasse der weißen Bevölkerung auf der Erdoberfläche ausmachen. Ich wollte, es wären ihrer mehr.« [Lachen im Publikum.] Ja, manchmal ist es nicht zum Lachen. Daraufhin antwortet Julia Kristeva in Fremde sind wir uns selbst: »Da ein neues gemeinschaftsstiftendes Band fehlt – eine Heilsreligion, die die Masse der Umherirrenden und Differenten in einen neuen Konsensus einbinden würde, einen anderen als den von mehr Geld und Gütern für alle –, sind wir das erste Mal in der Geschichte dazu gezwungen, mit anderen, von uns gänzlich verschiedenen zu leben und dabei auf unsere persönlichen Moralgesetze zu setzen, ohne dass irgendein unsere Besonderheiten umschließendes Ganzes diese transzendieren könnte. Eine paradoxe Gemeinschaft ist im Entstehen, eine Gemeinschaft von Fremden, die einander in dem Maße akzeptieren, wie sie sich selbst als Fremde erkennen. Die multinationale Gesellschaft wäre somit das Resultat eines extremen Individualismus, der sich aber seiner Schwierigkeiten und Grenzen bewusst ist – der nur Irreduzible kennt, die bereit sind, sich wechselseitig in ihrer Schwäche zu helfen, einer Schwäche, deren anderer Name unsere radikale Fremdheit ist.« Dies ist die Herausforderung, der sich Julia Kristeva gestellt hat. Nun gibt es aber einen Lackmus-Test, um zu wissen, ob dies stimmt und worin die Schwierigkeiten liegen. Es ist ein Moment der Hölle, es ist ein Moment, in dem man nicht mehr weiß, wo man ist und wie man ist. Sie werden es nie erraten, was dieser Lackmus-Test ist. Vielleicht errät sie es, wenn ich ein Datum sage: 17. November 1993. Le 17. novembre 1993. Ich bin zuvor durch diese Hölle gegangen am 8. Juli 1982. Sie wissen immer noch nicht, was dieser Lackmus-Test ist. Am 8. Juli 1982 spielte Frankreich gegen Deutschland und wurde im Halbfinale der Weltmeisterschaft ungerechterweise dann von Deutschland nach Hause geschickt nach dem Elfmeterschießen, in Sevilla. Es war furchtbar. An diesem Tag, und das muss man sehen, warum war ich Franzose? Vielleicht weil an dem Tag der Fußball, den ich als Kind gelebt habe, also das, was man als Kind hat, die Identität doch mehr prägt. Und das ist jetzt meine Frage an Julia Kristeva, der 17. November 1993. Sie hat sich herumgetrieben als kleines Kind mit ihrem Vater auf Fußballplätzen in Bulgarien. Und am 17. November 1993 hat Bulgarien Frankreich in die Wüste geschickt in der Weltmeisterschaftsqualifikation. Ich weiß nicht, ob sie da zugeschaut hat. Hat sie zugeschaut, weil sie sehr oft Fußball schaut, würde ich gern wissen, ob sie traurig oder glücklich war an diesem Tag. Es war ihre Kindheit und es war ihre Realität, denn seit 1965 lebt sie ja, wie wir wissen, in Frankreich.
Lassen wir die Reise von Julia Kristeva einfach mal Revue passieren. Sie ist eine Intellektuelle, sie hat politische Theorien besetzt, sie hat die Freiheit versucht auf allen Ebenen, ging nach China, schrieb ein Buch nachher, Die Chinesin, gehörte einer Gruppe an, »telle quelle« in Frankreich, in der sie versucht hat, in der man etwas Verrücktes versucht hat, nämlich: Gibt es im Maoismus, gibt es in dem, was in China entsteht, doch so etwas wie eine Transzendierung der Freiheit, die wir uns wünschen? Nach der Reise in China war sie, muss man sagen, ein bisschen enttäuscht. So schien es doch nicht zu sein mit der Kulturrevolution. Aber dieser Wunsch, politisch immer weiter zu denken, sich zu entwickeln, das hat sie oder war sie dann, hat die verschiedensten politischen Theorien, und sie hat keine Angst gehabt, wenn der Präsident Jacques Chirac sie gefragt hat, ob sie einen Bericht machen könnte über Behinderung, weil sie meint, behinderte Menschen sind in unserer Demokratie nicht …, dann hat sie es gemacht. Sie hat keine Angst im Laufe der Zeit gehabt, sich mit allen zu konfrontieren, sie hat einen Frauenstandpunkt gehabt, hat aber keine Angst gehabt – also Angst in dem Sinn von intellektueller Herausforderung – sich mit den Feministinnen auseinander zu setzen. Sie hat Stellung bezogen zum Migrationsprozess, zur politischen Theorie, hat zur Psychoanalyse gefunden, das heißt den Weg zu sich selbst, sich mit sich selbst auseinander zu setzen. Die Psychoanalyse hat sie dazu gebracht, nicht nur Psychoanalytikerin zu werden, sondern wirklich die Psychoanalyse in der Bedeutung des Gesellschaftlichen auch mit zu benutzen. Und sie suchte immer in ihrer Interpretation der Literatur und der Menschen, ob sie Simone de Beauvoir oder Paul Celan beschrieben hat, in diesem Moment der Literatur Sexualität, Emotion, Poesie zu finden. Dann hat sie am Ende eine Trilogie geschrieben, Genie des Wahnsinns, drei Frauen – Hannah Arendt, Melanie Klein und Colette. Und ich glaube, Hannah Arendt steht für die politische Philosophie, Melanie Klein steht für die Psychoanalyse und Colette für die Lust, für den Spaß, für Sexualität im weitesten Sinne. Und in dieser Auseinandersetzung kommt dann, dass wir uns fragen sollen: Ja aber, wo steht sie, und ist es nicht vermessen und grandios zugleich? Dieses feminine Genie, das sie beschreibt, in drei Werken und drei Frauen. Dass sie eigentlich uns sagt und wir es akzeptieren und wir staunen, dass jemand die Kraft, die Chuzpe und die Stärke hat zu sagen, ich bin das, diese drei Frauen bin ich auch, oder ich will es sein, ich will diesen Weg gehen. Und das finde ich eine der, wenn Sie wollen, tollsten intellektuellen Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, und das ist für mich Julia Kristeva. Und wenn man sie dann fragt, oder wenn sie selbst beschreiben soll, was ihr Denken ist, ich zitiere: »Je ne me sens pas d’humeur conclusive, pas encore: les épreuves m’ont appris à vivre dans l’ouvert. – Ich verspüre nicht das Bedürfnis, zu beenden, zu beschließen, noch nicht: Die Herausforderungen haben mich gelehrt, dass ich offen bleiben muss.« Und dann kommentiert sie weiter: »Celui qui n’a pas d’épreuves ou, plutôt, qui les dénie se contente en réalité d’une identité jalousement gardée. – Der, der nicht mit Herausforderungen konfrontiert war oder sie verneint, der hat eine verschlossene Identität.« – »Il conserve ainsi ses limites, ses principes, ses protections qui lui servent d’antidépresseurs. – Er behält das, was er verschließt, ein Antidepressivum, aber er kann sich der Welt nicht öffnen.« – »Au contraire, l’épreuve peut nous offrir l’occasion de ›faire nos preuves‹, – die Prüfung kann uns die Gelegenheit geben, uns zu beweisen, zu beweisen, was wir können und was wir wollen«. Die Prüfung, l’épreuve, »met à mal les frontières et nos défenses et ne nous laisse pas beaucoup de choix ; soit on se déprime, soit on met en question valeurs et certitudes. J’essaie, dans ma vie et dans ma pensée, de me tenir dans ce questionnement. – Diese Prüfung geht an die Grenzen unserer Möglichkeiten. Entweder können wir diese Herausforderung nicht meistern, oder wir sind in der Lage, unsere Sicherheiten, unsere Werte zu hinterfragen.« Und dann resümiert sie ihr Denken: »Un projet sans programme, un état de surprise permanente face aux phénomènes, aux discours, au sens et au non-sens, qui me libèrent de ce qui a eu lieu ainsi que de mes jugements antérieurs, et qui m’incitent à une sorte de dépassement. Je vis avec ce désir de sortir de moi.« Das heißt, sie sagt ganz einfach: »Ich habe ein Projekt ohne Programm, das mich einschließen, beschließen wird. Ich will – sie hat ja Hannah Arendt vorhin zitiert – un état de surprise, die Überraschung, in der Lage zu sein, die Überraschung des Seins auch aufzugreifen, und diese Überraschung, das Akzeptieren der Überraschung, ist ein Moment der Befreiung, der Befreiung des Denkens.« Und sie endet, indem sie sagt, »ich lebe mit diesem Wunsch, mit diesem Bedürfnis, aus mir herauszukommen, aus mir herauszugehen«. Das ist, glaube ich, das, was Hannah Arendt – sehen Sie, ich wusste es, irgendwann würde dieses auch passieren – was Julia Kristeva uns sagt. Und dann, politisch steht sie dazu – und das ist selten für Leute unserer Generation, dass man immer noch dazu steht – ja, sagt sie, man hat das Recht zu revoltieren. Ja, sagt sie, Revolten gehören dazu, und sie, ich zitiere sie auch hier wieder, weil ich sehe, es sind auch viele Eltern hier, und das, was ich hier zitiere, bereitet uns allen Schwierigkeiten, wenn wir Ja zu dem sagen, und das sagen wir meistens, weil wir ja von der richtigen Generation sind, ja, aber das ist doch nicht so einfach, also: »Oui, on a raison de se révolter. – Ja, man hat das Recht, es ist richtig zu revoltieren.« „Et ce n’est pas simplement un bon mot de flatter. – Es ist nicht nur so gesagt, um zu gefallen.« »La révolte constitue notre intégrité psychique. – Die Revolte strukturiert unsere psychische Integrität.« Unsere psychische, »la vie psychique, le psychisme comme vie«. Es ist im Innern unserer Psyche. Und jetzt kommt es, Eltern aufpassen: »Si l’enfant ne se révolte pas contre le père ou la mère, si l’adolescent ne crée pas une réalité rebelle contre ses parents, contre l’école et contre l’État, il est tout simplement mort. – Wenn das Kind sich nicht gegen den Vater oder die Mutter auflehnt, wenn der Jugendliche keine aufsässige Wirklichkeit gegen seine Familienmitglieder schafft, gegen die Schule und gegen den Staat, ist er ganz einfach gestorben.« Jaa!? Wie viele adoleszente Kinder haben wir, und leiden wir oder leiden wir nicht unter dieser Revolte, und sind wir in der Lage, diese Revolte auszuhalten? Dies ist eine, meiner Meinung nach, wichtige Frage. »Il se prive l’enfant de la possibilité d’innovation et de création, il devient un robot. – Ein Kind, das nicht gegen seine Eltern revoltiert, ein Kind, das nicht gegen die Schule revoltiert, ein Kind, das nicht gegen den Staat revoltiert, wird zum Roboter.« Wollen wir das? »Cette grande question générale … brulant. – Diese große Frage ist von einer brennenden Aktualität«, für uns Eltern auf alle Fälle. Was ich damit zeigen will, wenn sie dann über Sartre in ihren Vorlesungen spricht, über Simone de Beauvoir, ist sie nicht blind, und wenn sie zum Beispiel den Prozess beschreibt, als Sartre seinen Nobelpreis abgelehnt hat, mit welcher antibürgerlichen Haltung, dass er gleichzeitig aber den Kommunismus akzeptiert hat, den Totalitarismus akzeptiert hat – also dass diese antibürgerliche Attitüde einherging mit einer bürgerlichen Blindheit und so weiter. Sie entzaubert den ganzen Zauber des Lebens, und trotzdem ist man immer wieder verzaubert von dieser Suche nach einem Nicht-, nicht nur nach einem nicht-korrekten Denken, sondern von der Suche nach einem Denken, das auch aufsteht und Nein zu dem, was in der Welt geschieht, sagen kann.
Zum Schluss möchte ich wiederum sie zitieren, und zwar aus dem Buch über Hannah Arendt, das sie geschrieben hat. Und zwar, weil es ja ganz spannend ist, sie versucht aus dem Feminismus diese Antimütterlichkeit zu entreißen. Sie sagt, eine Frau, das, was eine Frau auch schafft, definiert, ist eben Leben zu schaffen. Und sie analysiert, und das ist sehr interessant, was bei Hannah Arendt, obwohl Hannah Arendt selbst nicht Mutter war, trotzdem sehr früh diese auch als menschliche Gabe definiert hat. Und so endet ihr Buch über Hannah Arendt: »Eine volle erfahrene Natalität umfasst notwendigerweise geboren werden, Leben geben, die Singularität einer jeden Geburt bejahen, ständig im Leben des Geistes wiedergeboren werden. Ein Geist, der ist, weil er in der Pluralität der anderen neu beginnt und nur unter dieser Bedingung als ein lebendiges Denken wirkt, das jede andere Tätigkeit überschreibt. Doch das Wunder« – nicht von Bern – »verwirklicht sich sogar in einem einzigen Ausschnitt dieser vollen Erfahrung, die es durch das Versprechen rechtfertigt, das sie öffnet, und durch das Verzeihen, das sie markiert. Arendt hat das geteilt, denn sie war unbestritten eine der seltenen Personen unserer Zeit, die jene Glückseligkeit verwirklichte, in der Leben Denken heißt. Schrieb sie doch, obwohl ihr die Wonnen des Denkens unaussprechlich waren, die einzige denkbare Metapher für das Leben des Geistes ist die Empfindung des Lebendigseins. Hannah Arendt lädt uns ein, ohne allzu große Illusionen, unter dem Zeichen eines sich überkreuzenden Verzeihens und Versprechens, ein politisches Handeln, das einer Geburt gleicht und Schutz vor Fremdheit bietet, zu denken und in der Gegenwart zu leben.« Das ist auch Julia Kristeva.
Zunächst möchte ich der Jury des Hannah-Arendt-Preises, dem Senat des Landes Bremen und der Heinrich-Böll-Stiftung sehr herzlich für die Ehre danken, mir den diesjährigen Hannah-ArendtPreis für politisches Denken zu verleihen – in diesem Jahr, in dem sich der Geburtstag der Philosophin zum hundertsten Male jährt. Ich möchte gern glauben, dass Sie durch mich hindurch jene rätselhafte Kraft des arendtschen Werkes willkommen heißen, die ein so genanntes breites Publikum zu berühren in der Lage ist; ein Publikum, das ich – im Sinne Arendts – ein »Publikum der Meinungen« nennen würde. Können wir heute als Mittler wirken zwischen der Existenz dieser Frau, die sich auf eine Weise als »exponiert« wahrnahm, dass sie, wie sie es ausdrückte, zu einem »Treffpunkt und einer konkreten Objektivierung des Lebens« werden konnte; und eben dieser »Meinungswelt« die, heute, am Beginn des dritten Jahrtausends, mehr denn je darauf bedacht ist, die Fäden des Politikvertrages, der die Männer und Frauen regiert, in Schwingung zu versetzen. Um die Autorität dessen, was uns (ver-)bindet mit der Unberechenbarkeit jedes Einzelnen von uns ebenso zu versöhnen wie die Pluralität der Welt mit dem auf das Urteilen hin ausgelegten Leben des Geistes. Diese Gedanken stehen hinter meinen heutigen Dankesworten.
Möchte ich dies gern glauben, weil ich auf meine Weise auch »ein Mädchen aus der Fremde« bin (so wie sich Arendt, das Gedicht Schillers aufnehmend, selbst bezeichnete)? Dass mir von meinen Ursprüngen auf dem Balkan her eine Mischung aus Juden- und Christentum übertragen wurde, die auch am arendtschen Denkhorizont erscheint? Dass »ich mich selbst bereise« in der europäischen Kultur, wie es die Heldin meines letzten Romans Meurtre à Byzance (»Mord in Byzanz«) ausdrückt? Dass ich, auf meine Weise, die Fremdheit und die Melancholie der globalisierten Welt, aber auch die von ihr hervorgerufene Freude erlebe? Möchte ich dies gern glauben, weil ich, Sprach- und Literaturtheoretikerin, die zugleich Psychoanalytikerin ist, versuche, die ecceitas (die Diesheit) des quid (des konkreten Dieses) auszuloten? Diese personale Eigenheit im Denken, ohne die uns, so Arendt, nur die »Banalität des Bösen« und der »Terror« bliebe. Aber auch das arendtsche »Versprechen« und »Verzeihen«, deren moderne Version nichts anderes ist als die psychoanalytische Deutung, wenn sie uns gestattet, wiedergeboren zu werden? Wobei die Psychoanalyse Hannah Arendt stets opak blieb, obschon das Leben und das Werk der Philosophin jene in vielfältigen und ungewohnten Weisen herausfordern. Möchte ich dies gern glauben, weil sich meine Kindheit und Jugend in einem totalitären Land abspielten, und ich sehr rasch das größte Misstrauen gegenüber totalitären Latenzen gewisser Befreiungsbewegungen selbst innerhalb unserer Demokratien, bis hin zum Feminismus, empfunden habe? Und dass ich die Befürchtung nicht loswerde, dass irgendein neuer Totalitarismus hinter der Maske der monotheistischen Fundamentalismen aufkeimt? Aus all diesen Gründen hat sich mir der Name Hannah Arendts unmittelbar aufgedrängt, als ich mich mit meiner Trilogie Das weibliche Genie vom Massenfeminismus absetzen wollte und begann, eine Eloge auf die weibliche Schöpfungskraft anzustimmen. Dies ist nicht der Ort, um im Detail auf meine Begegnung mit Arendt einzugehen oder auf die Reflexionsgänge, die sie mir eröffnet hat. Dies habe ich in dem Band getan, den ich ihr gewidmet habe. Diese Gänge erweitern sich immer mehr. Wenn ich aber ein einzelnes Charakteristikum hervorheben sollte, um den Einschlag zu beschreiben, den ihr Werk bei mir verursacht hat – und um ihn anlässlich der Verleihung dieses Preises, der ihren Namen trägt, an diejenigen weiterzugeben, die sie entdecken oder wiederentdecken – dann würde ich ihn folgendermaßen benennen: eine unwiderstehliche Fähigkeit zum Überleben. Das französische Wort »survie« meint das, was dem Tode entkommt und legt gleichzeitig ein Vermögen nahe, über und jenseits des Todes zu leben; aber auch über und jenseits des biologischen Lebensprozesses (zoe) selbst. Denn für Arendt ist dieses »Über-leben« in dem Glück, so ihr Wort dafür, zu denken und zu urteilen verwurzelt. Dies scheint mir tatsächlich der rote Faden zu sein, der sich durch das Leben und das Werk dieser Frau hindurchzieht. Dieser Frau, die während einer der tragischsten Phasen der Menschheitsgeschichte, jene der Shoah, lebte. Sie hielt sich davon fern, eine Doktrin oder gar ein System des Wissens zu verkünden (eine »Verfehlung«, die ihr pflichtschuldig vorgeworfen wurde!). Vielmehr erfand sie ein Denken in Bewegung, das seine Wurzeln in der Erfahrung hat. Es schöpft aus einer sensiblen, dem Narrativen ähnelnden Einbildungskraft, zögert nicht zu urteilen, und vor allen Dingen erreicht es sein Ziel: nämlich zu überraschen. Ist dies nicht die beste, wenn nicht die einzige Art und Weise, den philosophischen Gestus selbst zu rehabilitieren – ihn, der seit den Griechen ein Überraschtsein, ein »thaumazein«, ein Erstaunen war? Diesen Gestus am offenen Herzen der Verzweiflung unserer modernen Welt zu rehabilitieren, die, so Arendt, den »Faden der Tradition zerschnitten« hat? Aber auch: durch die Erneuerung der Spannung, der Aufmerksamkeit und der Debatte ein politisches Interesse und ein unmittelbares Handeln hic et nunc zu provozieren? Tatsächlich durchzieht eine ständige Spannung, wie wiederholt festgestellt wurde, alle Vorstöße Arendts innerhalb dieses von Heidegger ererbten Abbaues der Metaphysik, den sie auf ihre Weise weitertreibt. Zunächst überraschen uns ihre Vorstöße mit ihren Ambiguitäten, und später dann mit der Eröffnung dieser von mir hervorgehobenen Erfahrung des Erstaunens: Des Erstaunens der Autorin selber, die ihre Freude am Denken nicht verhehlt, und das gleichfalls zum Erstaunen des Lesers wird. Und – es gelingt ihm, die Klemmen sowohl der Subjektivität als auch der Politik zu lockern. Und das effektiver, als es die politiktheoretische Metasprache der Philosophen und professionellen Politologen vermag. Ich für meinen Teil bin überzeugt, dass es keine anderen Mittel gibt, um jenen Kräften des Todes entgegenzutreten, die heutzutage unter den Masken des religiösen Extremismus oder der Automatisierung der Gattung im Vormarsch sind, als eben diese Fähigkeit des Überlebens, welche aus dem Glück zu denken und zu urteilen herrührt. Um Sie davon zu überzeugen, will ich vier aktuelle Themen anführen, auf die Hannah Arendts Werk ein erhellendes Licht wirft: Weil das Erscheinen in der Welt zugleich das Denken und das Urteilen strukturiert, wird nur die Meinung die Gewalt besiegen können. Aber die Politik der Meinungen kann nur dann ein (mögliches) Gegenmittel gegen die kalkülhafte Politik sein, wenn sie die urteilende Scharfsichtigkeit (phronesis) der das, »was geschieht«, teilenden und erzählenden Zuschauer versammelt. Indem ich mit meiner Meinung »meine Offenbarung riskiere«, durch mein Erscheinen in der Einzigartigkeit meiner Meinung, mache ich aus dem politischen Raum einen Ort der Selbstanalyse, einen Ort sich fortsetzender Wiedergeburt – einer jeden Subjektivität. Durch erfundene Geschichten stoße ich wahre Geschichten an, und wir schaffen zusammen die Zeit des Politischen am Schnittpunkt des Vergangenen und des Zukünftigen. Wenn die Noblesse des Politischen in dieser Fähigkeit beruht, erneuernde Besonderheiten zu offenbaren, uns jeden von uns zu offenbaren, so könnte es doch nicht existieren ohne jene Referenzpunkte und Grundlegungen, die ihm die Triade Autorität – Religion – Tradition in früheren Zeiten verschaffte und die im Zuge der Säkularisierung geschwächt worden sind. Nichtsdestotrotz: Wir, die wir weder Traditionsnostalgiker noch angesichts der Risiken einer »irreparablen« Säkularisierung in Schreckstarre verfallene Zensoren sind, sind wir fähig zu einer Wiedergründung? Dies ist die metaphysische Frage, die unterhalb der Entpolitisierung unserer Zeit verspannt ist. Diese Wiedergründung ist nicht zu vollbringen in Form einer Wiederbelebung der gleichen Autorität, der gleichen Religionen und der gleichen Traditionen aus der Vergangenheit. Sondern durch deren »ewige Wiederkehr« im urteilenden Denken, das in der Pflicht steht, das in ihnen Ungedachte ans Licht zu bringen. Und während es uns Schutz in der alten Gründung bietet, modifiziert es diese durch die neuen Entdeckungen, die unseren pluralen Leben Sinn wiedergeben können, und durch die die Gründung eine Erhöhung erfährt. Schließlich macht Arendt auf eine ganz ungewöhnliche Weise die Frage der Verantwortung der Aufklärung für die neuen Formen des Antisemitismus auf. Diese Kühnheit führt sie zu einem weiteren Spannungsverhältnis: ihre Schreckensanalyse der europäischen Genealogie der Shoah entwickelt sie eben mit Hilfe des kontinuierlich aufklärerischen europäischen Erbes selbst. Und sie lädt uns ein anzuerkennen, dass die »Kämpfe für die Freiheit« in Europa und Israel »identisch« sind. Heute vielleicht mehr denn je, angesichts der neuen Formen des Totalitarismus.
I. In der Welt erscheinen
Inspiriert durch Heidegger – jedoch ihr eigenes Denken behauptend – wagt Arendt, überlebend, im Angesicht der Geschichte des Nihilisimus eine Rekonstruktion, die die Niederlage der Vernunft transformiert: Dabei sucht sie weder Zuflucht bei einem »Denken, das die Wahrheit des Seins denkt« (Heidegger), noch gibt sie sich zufrieden mit dem bloßen Wissen um die Bedeutungen (Merleau-Ponty). Vielmehr geht es darum, ein anderes Denken vorzubringen, das ein Denken der Welt ist: von der Welt herkommend, auf die Welt bezogen, die Welt konstituierend. »Es scheint mir« (»dokei moi«, nimmt Arendt das griechische Wort auf ), sage ich mit meinem Erscheinen, mit meinem Hineingeborenwerden in die plurale Welt. Am Anfang stünde also ein: »Es scheint mir«? Am Anfang wäre also die Einbildungskraft? Man ginge fehl, hielte man dieses »Scheinen«, diese »Einbildung« für einen inkonsistenten und leicht manipulierbaren Impressionismus. Ich erzeuge die Welt mit, wenn ich, mich ihr präsentierend, »es scheint mir« sage. Das heißt nicht, dass ich nur für die Blicke der anderen oder auf sie hin existiere. Die Blicke der anderen sind lediglich die phänomenale Bedingung meines Erscheinens, wie die Bühne, auf der ich gesehen werde. Die Geborenwerdend-Erscheinende, die ich bin, ist nur in dieser Wechselbeziehung der Verschiedenen, die die Welt bevölkern, ein Zuschauer. »Es gibt in dieser Welt nichts und niemanden, dessen bloßes Sein nicht einen Zuschauer voraussetzte.« Arendt erlaubt uns, den Sinn dieses modernen Phänomens der »Politik der Meinungen« besser zu verstehen. Gehen wir ihren Erörterungen noch etwas weiter nach. Die Welt bietet sich denen, die sie bevölkern, an, um sie zu Handelnden und Benennbaren zu machen. Und die Meinung, so wie Arendt sie denkt, ist gewissermaßen der »Unterbau« dieser Weltlichkeit, dieser Öffentlichkeit, dieser Morgendämmerung des Politischen. Konkret: Mit dieser für die Welt und jeden Einzelnen in ihr konstitutiven Pluralität greift Hannah Arendt auf zentrale politische Probleme unserer Tage vor, auf die klimatische und allgemein ökologische Interdependenz wie auch auf die sich ökonomisch wie informationell diversifizierende Globalisierung. Doch meine eigene Arbeit führt mich zu den Konsequenzen ihrer Reflexion über die Politik der Meinung unter heutigen Bedingungen. Nicht dass Arendt nicht mit großer Sorgfalt die Simulation, den bloßen Anschein, das Inauthentische und ganz besonders die Hochstapelei der Authentizität zurückgewiesen hätte. Doch warnte sie uns vor: Die Fähigkeit, mit den Erscheinungen zu spielen, ist integraler Bestandteil politischer Virtuosität – Spielregeln, wohlgemerkt, immer vorausgesetzt ... In der von Arendt vorgeschlagenen Entmystifizierung der politischen Tradition und der vorgeblich »wahren« Politik gibt es Sein konsequenterweise nur bei dem, der sich in die Epiphanie des inter homini esse begibt. Und diese Behauptung einer Realität, die rein phänomenaler Natur ist, hat nichts Zynisches oder Demagogisches an sich. Arendt beruft sich auf sie, um den politischen Raum von den Inhabern der »Wahrheit« und anderer »Werte« zu befreien, welche den Interaktionen von uns – uns verschiedenen Handelnden und Zuschauern – ansonsten zugrunde liegen. Ich sehe darin eine Einladung, den Wahrheitsanspruch einer gewissen politischen Klasse, wenn nicht gar der politischen Tradition selbst zurückzuweisen. Jenen Anspruch, vorgebracht von den Professionals einer ideologischen Tugendhaftigkeit, käme sie von der Rechten oder der Linken, vom Religiösen oder dem Atheistischen. Und nichts weiter als den elementaren politischen Mut dagegenzuhalten – welcher darin liegt, die Angst zu bezähmen, mit und vor all denen, die den öffentlichen Raum »bevölkern«, zu sprechen und zu handeln, und der so die »Öffentlichkeit« konstituiert. Und mithin die Erneuerung und Öffnung (wie es das deutsche Wort »Öffentlichkeit« nahe legt) dieser immer schon politischen Welt. Ihr »Held« par excellence ist der Citoyen, und zwar in dem Maße, in dem er »sich entschlossen hat, keine Furcht zu zeigen«. Eben keine Furcht zu haben, mit den anderen zu erscheinen. Aber diese Meinungen der Erscheinenden – wenn der Zuschauer zum Handelnden wird – können in der heutigen Welt des Spektakels nur dann einen Sinn haben, wenn wir es schaffen, als unverwechselbare menschliche »Jemande« oder »Wers« hervorzutreten.
II. Arendts »Wer« und die Psychoanalyse
»Wer sind wir?« in Opposition zum »Was sind wir?«: Dies ist die Unruhe, die wie ein Bindestrich zwischen der politischen und der philosophischen Inspiration Arendts arbeitet; zwischen ihrer Konfrontation mit der Metaphysik und ihrer Wette, gegen die politische Tradition anzudenken. Eine Unruhe, die darüber hinaus nach der zeitgenössischen Psychoanalyse verlangt. »Wer sind wir?« Anders gesagt: Die »Politik der Meinung« – in dem innovativen Sinn, dem Arendt diesen Wörtern gibt – kann nur ein Gegenmittel gegen die Politik des Spektakels (die uns heutzutage als eine Politik der Meinung verkauft wird), wie auch gegen die nostalgischen Anrufungen eines »Erwachens der Völker« sein, wenn sie ein inter-esse schöpferischer Singularitäten ist, eine Wiederbelebung der »Wers«. Weil es von Anfang an und immer »politisch« im arendtschen Wortsinne ist, zeigt sich das »Wer« zuvörderst der Menge der anderen und ihrer Gedächtnisse, weniger dem Protagonisten selber. Oder vielmehr: Das »Wer«, meine Einzigartigkeit und Eigenheit, mein Wesen, offenbart sich nur der Verschiedenartigkeit der Gedächtnisse, ihrer Zeitlichkeit. Im Werk von Duns Scotus findet die Autorin der Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft das Geschick der innovativen Singularität wieder und vertieft ihre Neubewertung der Ontotheologie: Sie bringt eine christliche Archäologie der modernen subjektiven Freiheit zum Vorschein mit dem, was sie an Gnade und an Risiko in sich birgt. Entscheidend ist der Nachdruck, den der »Doctor subtilis« auf die singuläre »Diesheit« (ecceitas) legt. Aber auch seine Zurückweisung des Primats des Intellekts über den Willen und die unerhörte Freiheit, die er jeder einzelnen Person beimisst. Und weil die Wurzeln des Intellekts tief in die Intuition reichen, verwandelt sich der Wille am Ende in die Liebe. Und letzthin schafft die »Glückseligkeit« des schottischen Mönchs die Verbindung zwischen Denken und sinnlich mitgetragenem Handeln, nach der Arendt schon im griechischen Heroismus suchte. Dies sind nur einige der Elemente christlicher Subjektivität, welche nach Arendt den Weg zur politischen Freiheit eröffneten. Die junge Arendt, Studentin von Karl Jaspers, verlautbart in ihrer Doktorarbeit über den »Liebesbegriff bei Augustinus«, verteidigt am 28. November 1928, dass das Subjekt des Politischen ein liebendes Subjekt ist. Die Psychoanalyse würde dies unterstreichen und auf die »wahre Konstellation der Liebe«, wie Arendt es nennt, bei Augustinus abheben: Liebe, Begehren (mit den beiden Varianten appetitus und libido), Nächstenliebe und Lüsternheit. Arendt bringt vor, dass die tragende Welle dieser Multiplizität das Begehren ist. Und an dieser Stelle, so Arendt, entsteht die Möglichkeit für das menschliche Dasein, sein eigenes Sein in Frage zu stellen: zwischen dem »noch nicht« und dem »nicht mehr« werde »Ich« mir selber zur Frage (Quaestio mihi factus sum). Es gibt daher keine verborgene Wahrheit, auch nicht des Unbewussten, die – ad infinitum betrieben – der »freien Assoziation« (in der Sprache der Analytikerin) oder die den Vielen im politischen Raum (wie es Arendt ausdrücken würde) nicht zugänglich wäre. Und formulierte die Psychoanalyse Freuds nicht ein neuartiges Transzendenzverhältnis? Eines, das das Dasein des begehrenden Subjekts in die Ereignisse einschreibt und das Handeln und das Gedächtnis in die Erzählungen des inter-esse der liebend-leidenden Übertragungen und Gegenübertragungen hineinlegt? So verstanden ist die analytische Erfahrung eminent politisch im arendtschen Sinne eines Offenbarwerdens dieses Sprachwesens, das in eins fällt mit dem Erscheinen seines Diskurses. Für Arendt geschieht dies in der Pluralität der öffentlichen Bezüge, für die Analytikerin bereits in dem dualen Bezug mit seiner Übertragung und Gegenübertragung. Und rührt der tiefere Grund für die Feindseligkeit, welche die Psychoanalyse hervorruft – neben und mehr noch als die Widerstände gegen und die Abwehr des Sexuellen – nicht von dieser Wiederaneignung und Wieder- (be)gründung der Ontotheologie her, die ihrer Theorie wie ihrer Praxis innewohnen? Und formuliert wiederum Hannah Arendt nicht eine im Grunde psychoanalytische Konzeption des sprechenden Subjekts, das sich konstituiert als ein »Ereignis« in der Zeit (Vergangenheit, Gedächtnis), und mitnichten eine psychologische Diagnose der Dispositionen, Gaben und Temperamente?
III. Wiedergründung als Wiederkehr
Entschiedenermaßen ist Hannah Arendt die Aufständigste und Aufstehendste von allen. Unermüdlich verkehrt sie ihre Melancholie und die Sackgassen der Moderne in eine Bleibe, eine Öffnung, eine Wiedergeburt, in eine andauernde, durch ihre Nietzscheund Heideggerlektüre neubesehene und modulierte augustinische Gebürtlichkeit. Es gibt bei ihr keine Gebrauchsanleitung für diese neue Welt und die neue Politik: nur die Atembewegung der Verbindungen, geschaffen aus überraschenden »Wers« – und das ist enorm. Denn dieses Wiederbeginnen ist nur möglich, wenn es die Autorität selbst wiedergründet, was nur geschehen kann über eine Reinterpretation, eine Wiedererfindung. Eine Wiederkehr und eine Wiederaneignung der Autorität-Religion-Tradition – nicht um sie wiederherzustellen (Machiavelli und Robespierre verwechselten das »Gründen« mit einem »Machen« und endeten in der Tyrannei), sondern um in ihrem eigentlichen Nucleus, der Autorität nämlich, ihren Sinn zu reinitialisieren, und dies im gegenwärtigen Raum der neuen »Öffentlichkeit der Meinungen«. So ist meine Lesart der testamentartigen Zeilen Hannah Arendts aus »Vom Leben des Geistes«: »Historisch gesehen ist eigentlich die Tausende von Jahren alte römische Dreieinigkeit von Religion, Amtsmacht [Autorität, d.Ü.] und Tradition zusammengebrochen. Der Verlust dieser Dreieinigkeit zerstört nicht die Vergangenheit, und die Demontage selber ist nicht destruktiv; sie zieht nur die Konsequenzen aus einem Verlust, der eine Tatsache ist und als solche nicht mehr Bestandteil der ›Ideengeschichte‹, sondern unserer politischen Geschichte, der Geschichte unserer Welt.« In der Welt der Psychoanalyse liefe dieses »die Konsequenzen ziehen« aus dem Verlust dieser Triade Autorität-Religion-Tradition auf ein Neudenken des vorpolitischen und vorkulturellen Sinnes des Bedürfnisses zu glauben hinaus, das wir uns vorschnell ausgetrieben haben. Ein Bedürfnis zu glauben, welches unabdingbar ist bei der Herausbildung einer psychischen Identität, die über die primäre Identifikation mit dem liebenden »Vater der persönlichen Vorzeit« als eines idealen, meine Idealität stützenden Anderen abläuft. Wir können diesen Verlust an der Krise in unseren Vorstädten ablesen, an der Krise der Heranwachsenden: Sie haben dieses Bedürfnis, an eine Idealität zu glauben, doch wir sind eine Zivilisation, die es versäumt, ihnen dies zu ermöglichen.
IV. Aufgeklärt gegen die Aufklärung
Im Lichte dieser paradoxen Konvergenz von Freud und Arendt – beide schreiben, wenn auch auf unterschiedliche Weisen, das Verborgene in das Erscheinende, das Verdrängte in das Verbotene ein (bei Arendt: das Individuum und die Autorität in das Politische oder das inter-esse) – möchte ich nun zum Abschluss eine letzte arendtsche Spannung ansprechen: Ihre Kritik der Säkularisierung, die bei ihr aber einhergeht mit der Verweigerung eines Transzendentalismus. Arendts Stigmatisierung der Säkularisierung zielt auf die Reduzierung menschlicher Differenzen in der Allgemeinheit des »zoon politikon« ab, welches zum gattungsmäßigen »Menschen« im, wie ich sagen muss, reduktiven Verständnis der »Menschenrechte« geworden ist. Denn diese Reduzierung »vergisst« mehr oder minder absichtlich den Reichtum an Körpern, Begehren und Sprachen, der insbesondere in der französischen Aufklärung aufgeblüht ist. Und auch wenn darüber hinaus für Arendt ein bestimmter moderner Atheismus zum Niedergang des Ethischen beigetragen hat, so verwirft sie nicht einfach die Aufklärung im Ganzen. Das totalitäre Phänomen ist einzigartig und keines seiner älteren Elemente – stamme es aus dem Mittelalter oder dem 18. Jahrhundert – könne als »totalitär« bezeichnet werden. Und ebenso grenzt sie ihre politische Untersuchung sorgfältig von jedweder religiösen Positionierung ab, indem sie die politische Inanspruchnahme eines »Göttlichen« eben dem von ihr bekämpften, bösartigen Nihilismus zuordnet: »Diejenigen, die aus den schrecklichen Ereignissen unserer Zeit schließen, dass wir aus politischen Gründen zu Religion und Glauben zurückzukehren haben, scheinen mir zu zeigen, dass ihnen genauso viel Gottesglauben fehlt wie ihren Gegnern.« Dreißig Jahre nach ihrem Tode kommen zu den Gefahren, denen Hannah Arendt sich gegenübersah – die, indem sie zugenommen haben, diese Wiedergründung der politischen Autorität fraglicher erscheinen lassen – neue Tragödien hinzu: Ich denke an die Tragödie des 11. Septembers, an das inzwischen eingestandene Scheitern der unilateralen militärischen Erwiderung, die vorgab, sich an die Stelle einer – möglichen oder unmöglichen – konzertierten, pluralen Antwort der weltweiten »Meinungen« zu setzen. Und an die infolgedessen entstandene neue Bedrohung, die schwer auf Israel und der Welt lastet. Arendt hat sie vorausgeahnt in ihren Warnungen, die arabische Welt nicht zu unterschätzen. Und während sie den Staat Israel als einziges Heilmittel gegen die Weltlosigkeit des jüdischen Volkes, als Rückkehr in die »Welt« und in die »Politik« – von der die Geschichte es beraubt hatte – bedingungslos unterstützte, sparte sie nicht mit Kritik an diesem Staat: »Sie flüchteten sich nach Palästina, so wie jemand wünschen mag, sich auf den Mond zu flüchten, wo ihm die böse Welt nichts mehr anhaben kann.« Obwohl viele ihrer Analysen und Vorstöße uns heute prophetischer denn je erscheinen, konnte Arendt doch nicht die Verhärtung des islamischen Fundamentalismus und die Ohnmacht der Politik, darauf zu antworten, vorhersehen. Und auch nicht die Ohnmacht gegenüber der apolitia, das heißt, der Indifferenz, welche die Scheinwelt des Spektakels, wie auch die des puritanischen Sekuritarismus, diese neuen Opiate der Völker, hervorbringt. Nichtsdestoweniger führt uns diese neue Form des totalitären Fundamentalismus – mit der Verwüstung des Denkens, die ihn
charakterisiert und die er aufzwingen will, und mit seiner Verachtung für das menschliche Leben, das er mit kühlem Vorsatz auf etwas zu Eliminierendes, Überflüssiges reduziert – zurück auf essenzielle Ängste und lädt uns ein, Arendts hellsichtige Diagnose wieder aufzunehmen. In diesem Zusammenhang konfrontiert uns dramatischer als je zuvor der aktuelle Zustand der Welt in einer beispiellosen Schwere mit der schwarzen Sonne des Skeptizismus, deren Schatten unsere Philosophin der politischen Natalität nicht verschont hat. Wiederholt hat sie sich gefragt, ob die Politik »überhaupt noch einen Sinn hat?« Dennoch habe ich anfangs Arendts »Vitalität des Urteilens« begrüßt als eine des »Über-Lebens«. Ich verstehe darunter keinesfalls ein humanistisches Verarzten der modernen Verwundungen: der Isolation, der Verzweiflung, der persönlichen und/oder politischen Zerstörung. Ich glaube, Arendt ist nicht lediglich eine Denkerin des Abbaus oder der Dekonstruktion. Ich nehme ihre Freude wahr, zu denken, dass die Wiedergründung möglich ist: eine Wiedergründung seiner/meiner selbst, die eines Volkes, die des politischen Zeitraumes. Dies verlangt eine Liebe für das Vergangene und das Zukünftige. Und eine außergewöhnliche Fähigkeit zur Wiedergeburt, von der ein anderes weibliches Genie, Colette, sagte: »Wiedergeboren zu werden hat meine Kräfte niemals überstiegen.« Genau diese Haltung nimmt Arendt an, wenn sie sich den Satz Tocquevilles zu eigen macht: »Eine neue Welt braucht eine neue Politik.« Wenn Arendt die Tradition des Politischen abbaut, dann nicht aus Leichtfertigkeit, sondern nur um sie besser wiederbegründen zu können auf der Partizipation jeder Subjektivität in der pluralen Welt. Ich zitiere: »Die Politik handelt von dem Zusammen- und Miteinandersein der Verschiedenen.« Können wir aus dem politischen Raum ein Zusammenund Miteinandersein der verschiedenen Eigenheiten und Einzigartigkeiten machen? Oder: »Der Ruin der Politik ... entsteht aus der Entwicklung der politischen Körper aus der Familie.« Das heißt, wenn er nicht aus dem Respekt vor den verschiedenen Familien entwickelt wird. Oder: »Politik entsteht in dem Zwischen-denMenschen, also durchaus außerhalb des Menschen. Es gibt daher keine eigentlich politische Substanz.« Denn es gibt nur ein politisches Denken in dieser Pluralität der freudigen einzelnen Denken. Oder schließlich: »Freiheit gibt es nur in dem eigentümlichen Zwischenbereich der Politik.« Bedeutet dies, dass für unsere politische Denkerin diese so verstandene Politik – als das Glück zwischen Einzelnen denken, innerhalb eines wieder zu erfindenden gemeinschaftlichen Bandes – den Platz des Göttlichen einnimmt? Oder, wie ich denke, mäandern das Göttliche wie das heideggersche Sein (und dies ist die Revolution Heideggers) in der beunruhigenden Meinungshaftigkeit des »Wer«, der ich bin? Das Göttliche ebenso wie das Sein partizipieren immanent an der Öffentlichkeit der singulären Daseine – oder besser gesagt: sie inkarnieren sich in dieser grundsätzlich liebend-leidenden Erzählung, die verschiedene Männer und Frauen um den pluralen Sinn ihres Handelns weben. Wäre die arendtsche Politik also die erste Politik der Inkarnation? Sie zitierte gern Jesus von Nazareth, den sie immer für politischer als Paulus hielt, da es für Jesus von Beginn an eine Pluralität gibt: so, wenn er sich auf den Schöpfungsbericht bezieht in dem es heißt: »Und er schuf sie als Mann und Weib.« (Gen.1,27)
I m Lichte der neuen Bedrohungen in Gestalt der Automatisierung der Gattung und der religiösen Fundamentalismen eröffnen sich von unserer Neulektüre Arendts her zweierlei Möglichkeiten: Erstens, entweder wird das Wuchern der Entpolitisierung die Rückkehr des Religiösen beschleunigen und den politischen Raum auf unabsehbar lange Zeit in Ohnmacht verfallen lassen – oder, zweitens, die im Gange befindliche Programmierung des Überflüssigmachens des menschlichen Lebens und die Instrumentalisierung des Todestriebes durch die Integrismen wird ein kraftvolles Aufleben des inter-esses und eine Reinitiierung der innovativen Subjektivität, des Erscheinens der Einzelnen in der Welt, hervorrufen. Rein logisch gesprochen benötigt diese zweite Möglichkeit keine Rückkehr zu, sondern ein Wiedergründen der Autorität des Politischen, das wir vom Greco-Judeo-Christentum ererbt haben, und welche der Welt das Verlangen nach einer »gemeinsamen Welt«, die sich aus einer Vielzahl von »Wer’s« konstituiert und die Arendt das »Zentrum der Politik« nennt, vermacht hat. Es liegt an uns, diese Erbschaft zu reinterpretieren. Nur eine »neue«, in diesem Sinne erhellte Politik wird den Ruin der Welt vermeiden können.
Unmittelbar: In Anbetracht der Tatsache,
■ dass eine vielfältige Überflüssigmachung des menschlichen Lebens weiterhin ein radikales Übel darstellt, das praktiziert und toleriert wird;
■ dass das Recht jeder Person, in der Pluralität der politischen Bindungen in Erscheinung zu treten, heute noch an zahlreichen Orten unserer globalisierten Erde bedroht ist;
■ dass es meistens Frauen sind, die zum Opfer dieser Zerstörung des politischen Raumes und der Negation des Menschenwesens werden, bis hin zu ihrem Recht zu leben;
in Anbetracht dessen denke ich, dass die Wiedergründung der politischen Welt, wie Hannah Arendts Werk sie vorschlägt, uns dazu einlädt, die Sorge um das einzelne Schicksal eines Mannes oder einer Frau, fern jeder Hierarchie, bis ans Herz der Demokratie der Meinungen – deren Schema sich heute abzeichnet – vorzulassen. Daher bin ich darauf bedacht, diejenigen zu würdigen, die sich um das einzelne menschliche Schicksal und sein Recht, in der pluralen Welt zu erscheinen, sorgen. Um erträgliche, bewohnbare politische Räume mitzuerrichten. Folglich leite ich das Preisgeld des Hannah-Arendt-Preises 2006 an die NGO Humani-Terra (www.humani-terra.org) mit Sitz in Marseille weiter, um sie in ihrer vorbildlichen Arbeit im Krankenhaus von Herat in Afghanistan zu unterstützen. Sie arbeiten dort insbesondere mit afghanischen Frauen, die kein anderes Mittel finden, ihren Protest gegen die mannigfaltigen Ungerechtigkeiten und Gewaltsamkeiten auszudrücken, als die Selbstverbrennung. Dieser Preis möge zur medizinischen und psychologischen Hilfe und der Begleitung der Versehrten beitragen. In der Hoffnung auf eine Fortsetzung dieses Zusammenwirkens wünsche ich mir, dass es durch den »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken« möglich ist, ein Mehr an Aufmerksamkeit auf das Los dieser Frauen zu lenken, um die internationale politische Solidarität zu fördern: mit ihnen wie auch mit anderen Opfern von Politiken, Ideologien oder Glaubenslehren, die das »Überflüssigmachen menschlichen Lebens« zum Programm haben oder tolerieren.
Wir liegen mit dieser Veranstaltung nahe am 100. Geburtstag Hannah Arendts, die am 14. Oktober 1906 geboren wurde. In ihrem Lebensweg durchmaß sie entscheidende Stationen ihres Jahrhunderts: Sie war ihrer Herkunft nach eine deutsche Jüdin, wurde als Studentin geprägt durch die Existenzphilosophie Heideggers und Jaspers, wurde von der Gestapo verhaftet, musste vor den Nazis fliehen und erfuhr, was es bedeutet, staatenlos zu sein. Im amerikanischen Exil wurde sie als Publizistin und Theoretikerin weltweit bekannt. Deutschland besuchte sie nach dem Krieg als amerikanische Staatsbürgerin wieder. Es waren vor allem zwei Schriften, die ihr zu Weltruhm verholfen haben: ihre umfassende Analyse des Totalitarismus (Ursprünge totalitärer Herrschaft) sowie ihre gleichermaßen berühmte und umstrittene Schrift Eichmann in Jerusalem – Bericht über die Banalität des Bösen, die 1963 aus ihren Prozessberichten für den New Yorker hervorging. Lange Zeit war sie wegen dieser beiden Analysen weder in Israel noch bei der europäischen Linken wohl gelitten. Hannah Arendt und Israel verbindet ein hoch kompliziertes Verhältnis. Für sie war Israel der Garant für die jüdische politische Existenz; zugleich kritisierte sie nationalistische Tendenzen, die sie im zionistischen Projekt angelegt sah. Am Fall Eichmann beschrieb sie den bürokratischen Mechanismus des Holocausts, ohne emotionale Regungen zu zeigen, ja »ohne ausreichende Liebe zum jüdischen Volk«, wie ihr der Historiker Gershom Scholem aus Jerusalem vorwarf, als er ihr die Freundschaft aufkündigte. Heute, da in Israel selbst unterschiedliche Lesarten zur Gründungsgeschichte des Staates im Konflikt liegen und das Konzept des Zionismus kontrovers verhandelt wird, ist auch eine gelassenere Rezeption von Hannah Arendt möglich – einschließlich einer kritischen Sicht auf ihr Eichmann-Buch, das die ideologische Überzeugungstäterschaft Eichmanns und die Rolle des Terrors hinter dem banalen Funktionieren einer Vernichtungsbürokratie verblassen lässt. Einem Großteil der europäischen Linken wiederum war ihre Totalitarismus-Theorie suspekt. Das ging bis zum Vorwurf, sie liefere mit ihrer Fundamentalkritik des sowjetischen Systems geistige Munition für den Kalten Krieg. Die Fellow Traveller der Sowjetunion führten gern Thomas Manns verballhorntes Zitat vom »Antikommunismus als Grundtorheit unseres Jahrhunderts« gegen Hannah Arendt ins Feld, und mit dem Schreckwort Antikommunismus ließen sich auch viele Liberale ins Bockshorn jagen. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetwelt brauchte es durchaus intellektuellen Mut, darauf zu insistieren, dass das 20. Jahrhundert vom Kampf zwischen liberaler Demokratie und totalitären Bewegungen geprägt war. Dieser Konflikt ist historisch keineswegs erledigt, und wer Arendts Analyse des Nationalsozialismus und Bolschewismus als radikal antibürgerliche Bewegungen heute liest, kommt kaum umhin, mit Julia Kristeva beunruhigende Parallelen zum radikalen Islamismus zu ziehen – auch wenn man sich davor hüten muss, zum Gefangenen historischer Analogien zu werden. Ich bin Julia Kristeva dankbar, dass sie daran erinnerte, dass Israel heute der Gefahr eines religiös-politischen Fanatismus ausgesetzt ist, der die Existenzberechtigung des jüdischen Staates offen in Frage stellt. Bei aller notwendigen Kritik an der israelischen Besatzungspolitik gilt auch heute der Satz Hannah Arendts, dass Israels Freiheit auch unsere Freiheit ist. Dabei geht es nicht um einen »clash of civilisations« zwischen der islamischen Welt und dem Westen. Die Konfliktlinie mit dem radikalen Islamismus zieht sich mitten durch die islamisch geprägten Gesellschaften, und es sind vor allem Muslime, die der Gewalt der Extremisten zum Opfer fallen. Es ist nicht nur die fortwährende Aussagekraft ihrer Untersuchungen zum Totalitarismus, auf der die Aktualität Hannah Arendts gründet. Was heute an ihr fasziniert, ist vor allem ihr »Republikanismus«, ihr spezifisches Verständnis von Politik als einer Sphäre der Freiheit und ihr Plädoyer für das, was wir heute als »aktive Bürgergesellschaft« bezeichnen. Es geht in der Tradition von Hannah Arendt um den Dissens als Ausgangspunkt des Politischen und um den streitbaren öffentlichen Diskurs als sein Lebenselixier. Wer Begründungen gegen ein Verständnis von Politik als Exekution von »Sachzwängen« sucht, wird bei ihr fündig. Das von allen Regierungen weidlich strapazierte »TINA-Prinzip« – There Is No Alternative – markiert im arendtschen Sinn das Ende der Politik. Für Hannah Arendt beginnt Politik damit, dass jemand aufsteht und öffentlich seine Meinung vertritt – im Wissen, dass er (oder sie) auch irren kann. Die öffentliche Rede ist, wie Julia Kristeva sagt, der erste und grundlegende Akt der Zivilcourage. In der Politik geht es um begründete Meinungen, nicht um absolute Wahrheiten. Und es geht um das gemeinsame Handeln, in dem das politische Gemeinwesen – die Republik – erst entsteht. Arendt sah politische Institutionen nur als demokratisch an, wenn sie sich auf die kommunikative Macht der Öffentlichkeit stützen. Diese Öffentlichkeit zu hintergehen und zu manipulieren, wie es bei der Begründung des IrakKriegs durch das Weiße Haus geschah, legt deshalb die Axt an die Wurzel der Demokratie. Dass Frau Kristeva das Preisgeld einer Initiative spendet, die sich der medizinischen und sozialen Betreuung afghanischer Frauen widmet, die keinen anderen Ausweg als die Selbstverbrennung mehr sehen, ist nicht nur eine großzügige humanitäre Geste. Sie erinnert uns zugleich daran, worum es in Afghanistan geht: um ein Mindestmaß an Selbstbestimmung und Rechtssicherheit vor allem für Mädchen und Frauen. Und sie erinnert uns daran, dass in vielen Ländern der Welt Frauen die grundlegenden Menschenrechte vorenthalten werden. Für Hannah Arendt war das »Recht, Rechte zu haben« fundamental als Schutz vor Willkür und Gewalt. Dieses Recht für alle Menschen zu gewährleisten, ist immer noch eine ungelöste Aufgabe.
An der Diskussion beteiligten sich außer Lorenz Böllinger noch Bettina Schmitz, Ute Vorkoeper und Adrienne Goehler mit vorbereiteten Beiträgen. Ausschließlich Platzgründe waren für die Festschrift-Redaktion des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken maßgeblich für die Kürzung auf den Abdruck eines Beitrages. Die gesamte Diskussion ist dokumentiert auf der Website der Heinrich-Böll-Stiftung Bremen: www.boell-bremen.de
Lorenz Böllinger
Hallo, Frau Kristeva, ich freue mich sehr, Sie heute hier zu treffen. Es tut mir sehr leid, dass ich gestern aufgrund eines familiären Problems nicht anwesend sein konnte. Ich habe aber Ihren Artikel gelesen und beziehe mich nun darauf. Er hat geradezu eine Flut von Eindrücken, Gedanken und Reflektionen, sozusagen von freien Assoziationen in mir hervorgerufen. Doch zunächst einige Worte zu meiner Person: In erster Linie bin ich Jurist, ich lehre Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bremen. In Zweitqualifikation bin ich Psychologe und Psychoanalytiker, auch Mitglied der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Und so wie Sie Brücken bauen möchten, wenn ich das richtig verstehe, zwischen der Psychoanalyse, Philosophie und Politikwissenschaft, versuche ich Brücken zu bauen zwischen der Rechtswissenschaft, Kriminologie und der Psychoanalyse. Soweit zu meiner Person. Ich habe meinen Beitrag nicht sehr genau strukturiert, es sind, wie gesagt, eher freie Assoziationen mit einigen eingebauten Fragen.
Einführung
Julia Kristeva zufolge gründet sich Hannah Arendts »Denken in Bewegung« in Ereignissen und in der Erfahrung. Es gelingt ihm, die Sackgassen der Subjektivität wie auch der Politik zu öffnen – und das effektiver als es die politiktheoretische Metasprache der Philosophen und professionellen Politologen vermag – indem es auf überraschende Weise die Aufmerksamkeit, die Spannungen und die Debatte wiedererweckt, um so den »Kräften des Todes« entgegentreten zu können. Auf eine frappierend moderne Art vertrat Arendt eine grundlegende Theorie der sozialen und individuellen Realität, in der diese sich über einen dynamischen, in der Erfahrung der Interaktionen zwischen Individuen, Gruppen, Ethnien, Nationen et cetera gegründeten Prozess herstellt. Hierauf baut Kristeva in den vier Themen ihres Vortrages auf. Zunächst arbeitet sie Arendts Position heraus, der zufolge »Denken und Urteilen, die Meinung allein die Gewalt besiegen« könne und dass die Meinungen der Zuschauer und nicht die Wahrheit die unverzichtbare Basis der Macht sind. Ich glaube, dies wird im Kontext von Kristevas erweitertem Blickfeld auf die menschliche Entwicklung verständlicher. Mit ihrem »semiotischen« Zugang werden Zeichen und Bilder, körperliche und affektuale Kommunikation zu Vorläufern der Symbole und der Sprache. Es scheint evident, dass diese Entwicklung nur in einem kontinuierlichen Interaktionsprozess stattfinden kann, in dem nicht nur die MutterKind-Dyade, sondern ebenso der familiäre Kontext und insbesondere der Vater eine wichtige vorödipale Rolle spielen. Wenn die Intersubjektivität in diesem erweiterten Umfang gesehen wird, dann erst sind wir in der Lage, der Pluralität, die für unsere Welt und uns Individuen konstitutiv ist, Rechnung zu tragen. Und dies besser, als es bei anderen zeitgenössischen psychoanalytischen Zugängen der Fall ist. Mit ihrem zweiten Punkt will Kristeva, so denke ich, uns über den Bedarf an diesem oben erwähnten »Denken in Bewegung« bei Individuen und Gesellschaften aufklären. Es ist die Voraussetzung einer »kontinuierlichen Wieder-geburt« und einer »Wieder-gründung«, die wesentlich sind, so Kristeva, um die im Zuge der Säkularisierung entstandene Leere kompensieren, und um Stagnation, Fundamentalismus und Totalitarismus vermeiden zu können. Wie auch immer, dies scheint mir etwas abstrakt und idealistisch zu sein, und sollte substanziell gefüllt werden mit Hilfe psychoanalytischer Modelle des Selbst und der zwischenmenschlichen Bezüge, ebenso wie mit Hilfe eines psychosozialen Blickwinkels auf die Bedingungen der jeweiligen individuellen und gesellschaftlichen Reflexionsmöglichkeiten. Im theoretischen Zentrum ihres dritten Teils steht die arendtsche Triade aus Autorität, Religion und Tradition, welche nach ihrer Schwächung durch die Säkularisierung nunmehr »neu-gemacht« werden soll. Mit dieser Position liefe sie allerdings Gefahr, so Kristeva, als eine repressive Konservative missverstanden zu werden, also ganz im Gegensatz zu dem, was sie eigentlich eröffnen möchte. Auf diese drei Thematiken möchte ich meinen Kommentar fokussieren.
Psychoanalyse und Konstruktivismus
Kristevas Plädoyer für eine »Entmystifizierung der politischen Tradition« und die Befreiung des politischen Feldes von den Wächtern der »Wahrheit« scheint mir deckungsgleich zu sein mit dem zeitgenössischen epistemologischen Ansatz des Konstruktivismus. Das Konzept der Relativität und Konstruiertheit der Wahrnehmung, des Urteilens, der »Wahrheit« und der »sozialen Realität« auf Grundlage der Sozialstruktur und der Interessen sind gewiss ein weiterer Schritt, ein weiteres Niveau der Aufklärung. In diesem Zusammenhang macht Arendts Frage »Wer sind wir?« im Gegensatz zu der Frage »Was sind wir?« absolut Sinn. Neben Begriffen wie Ereignis, Erfahrung, Beziehung und Interaktion impliziert diese auch das »liebende Prinzip, das die Welt regiert«, wie Kristeva Arendt interpretiert. Oder, in psychoanalytischer Terminologie: libidinöse Kathexis und Sexualisierung. Wie auch immer, klingt die Annahme eines »Lebens als Liebe« nicht etwas idealistisch, utopisch oder sogar religiös? Meint Kristeva damit etwas Ähnliches wie Freud mit seinem »Lebenstrieb«? Was ist dann mit dem »Todestrieb«? Wo werden Aggression und Destruktivität in dieser Vorstellung angesiedelt? Eine andere Frage: Fasst man, mit Arendt, das individuelle »Subjekt als ein Ereignis und mitnichten als eine psychologische Diagnose der Dispositionen«, so deckt sich das sicherlich mit der Psychoanalyse, die Subjektivität und Identität als ein vorläufiges Ergebnis eines dynamischen Interaktions- und Sedimentationsprozesses zwischen ego und alter, zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Individuum und Gesellschaft, begreift – strukturiert durch bestimmte typische Lebensverläufe, Lebensereignisse, Zufälligkeiten, durch soziale Strukturen und Bereiche. Aber ist dies nicht eine ziemlich abstrakte und idealistische Aussage angesichts der höchst substanziellen sozialen Interessen und Kräfte, die die Ereignisse, Lebensverläufe und Interaktionen überwölben? Wenn Kristeva sagt, Arendt verkehre »unermüdlich ihre Melancholie und die Sackgassen der Moderne in eine Öffnung, eine Wieder-Geburt« – heißt das nicht, dass eine Zerstörung externer und interner Strukturen stattfinden muss? Meint sie dies, wenn sie von der »Erotisierung des Mörders der Mutter« spricht? Andererseits sagt sie, Arendt befürworte eine Erneuerung der »greco-judeo-christlichen Trinität aus Autorität, Religion und Tradition« – zwar nicht in dem Sinne, sie wieder herzustellen, sondern vielmehr um ihren Sinn zu re-initialisieren in ihrem eigentlichen nucleus, der Autorität nämlich. Meint sie dies metaphorisch im Sinne klarer, stabiler Räume – Räume für Intersubjektivität, für Spiel und für Ereignisse – oder meint sie das eher im Sinne fester und idealisierbarer Mutter- und Vaterfiguren? Mir hat sie nicht recht plausibel machen können, warum es so etwas geben sollte wie ein absolutes »Bedürfnis zu glauben, welches unabdingbar ist bei der Herausbildung einer psychischen Identität, die über die primäre Identifikation mit dem liebenden Vater der persönlichen Vorzeit abläuft«. Birgt das nicht die Gefahr, die Übertragung, Idealisierung, Personalisierung und die Regression zu perpetuieren? Und hat Arendt nicht einen viel moderneren, sagen wir habermasschen »Verfassungspatriotismus« im Sinn, der die genannte Trinität beinhaltet und umfasst? Er verbindet grundlegende individuelle, (nicht externalisierte und personalisierte) menschliche Werte (wie z. B. aus dem Christentum), mit Methoden und Procederes der Koexistenz und der Konfliktlösung, mit kritischem Abwägen und Selbstreflexion im Sinne des Konstruktivismus. Wäre damit nicht dem Aufklärungszweck besser gedient, den Kristeva zu Beginn ihrer Rede anführt: »... die Fäden des Politikvertrages, der die Männer und Frauen regiert, in Schwingung zu versetzen?« »Um die Autorität dessen, was uns (ver)bindet mit der Unberechenbarkeit jedes Einzelnen von uns ebenso zu versöhnen wie die Pluralität der Welt mit dem auf das Urteilen hin ausgelegte Leben des Geistes«? Vielleicht meint sie eben dies, wenn sie formuliert: »Die Fähigkeit, mit den Erscheinungen zu spielen, ist integraler Bestandteil politischer Virtuosität – Spielregeln, wohlgemerkt, immer vorausgesetzt.« Für mich bleibt es unklar, ob Kristeva sich Arendts Sicht anschließt, wenn diese sagt, »der Totalitarismus ist eher ein Produkt des modernen Atheismus denn ein sozio-historischer Prozess«. Ihn als einen zu bekämpfenden »bösartigen Nihilismus« zu etikettieren, könnte sich als eine gefährliche Aussage herausstellen, angesichts des heutigen wie auch des früheren religiösen Totalitarismus. Auch steht diese Aussage im Widerspruch zu ihrer berechtigten Warnung vor dem »hinter der Maske des Fundamentalismus aufkeimenden Totalitarismus«. Ist eine aufgeklärte, selbstreflexive Philosophie mit der Möglichkeit des endlosen, sophistischen Fragens, ist die Aufklärung nicht weniger gefährlich als ein religiöser Glauben, und diesem deswegen vorzuziehen? Dabei könnte die Psychoanalyse eine unverzichtbare Rolle bei der Aufdeckung der unbewussten Übertragungen bei der Konstruktion der »Wahrheit« und der sozialen Realität spielen. Meiner Meinung nach brauchen wir den Prozess der Selbst- und Interaktionsreflexion, diese Dekonstruktion der Prozesse der Wahrnehmung, des Theoretisierens und Wahrheitfindens mit Hilfe der psychoanalytischen Begrifflichkeit (v. a.: Übertragung, Spaltung, Verleugnung, Projektion, projektive Identifizierung). Libidinöse Kathexis kann es geben – einen Glauben, sich selbst, den Anderen, den Fremden, ethnische Subkulturen oder die gesellschaftlichen Interaktionsmechanismen wirklich zu verstehen. Obschon Hannah Arendt der Psychoanalyse offensichtlich skeptisch gegenüberstand, denke ich, dass wir genau dort ihre Methode und Inhalte wiederfinden können. Die Interaktion des »Wer«, der nur deshalb die Macht usurpieren und destruktive Gewalt ausüben kann, weil er unbewusst ermächtigt wird durch jene, die ihn, im Zuge eines dialektischen gegenseitigen Prozesses der Projektion, Externalisierung, Spaltung und Verleugnung unterdrücken – ein Prozess, den wir einen pathologischen kollektiven Borderline-Zustand nennen könnten.
Julia Kristeva
Vielen Dank, Professor Böllinger. Ich begrüße Ihren Beitrag sehr, der zum Teil meinen Ansichten sehr nahe, aber teilweise auch kritisch ist. Ich bin sehr froh, auf diese Kritik eingehen zu können, denn ich nehme an, dass sie von einigen anderen Leuten geteilt wird. Sie haben am Anfang gesagt, zumindest habe ich Sie so verstanden, dass Sie bei mir einen Versuch ausfindig gemacht haben, Hannah Arendt in eine psychoanalytische Begrifflichkeit zu übersetzen. Ich werde niemals versuchen, das zu tun, denn ich denke, dass es unmöglich ist. Doch ich habe versucht zu zeigen, dass es einige Entsprechungen zwischen ihrem Denken und dem Reich der Psychoanalyse gibt. Arendts Denkweise ist, wenn auch kein System, doch ziemlich autonom und in sich geschlossen, und meiner Meinung nach ist es nicht ratsam, etwas zu tun, was bei amerikanischen Wissenschaftlern sehr verbreitet ist, nämlich zu behaupten, dies ist äquivalent zu jenem. Es gibt keine Äquivalenzen. Man kann sagen, dass es einige Ähnlichkeiten gibt, einige Resonanzen, doch niemals Äquivalenzen, ganz besonders nicht mit der Psychoanalyse. Wie Sie wissen, hasste Arendt die Psychoanalyse. Sie betrachtete sie als eine scheußliche Doktrin – ich denke, das war ein Missverständnis, aber nichtsdestotrotz war das ihre Meinung...
Lorenz Böllinger
Oder möglicherweise war es ein Widerstand …
Julia Kristeva
Ja, vor allem Widerstand! In meinem Buch habe ich einige persönliche Gründe für diesen Widerstand zitiert, die mit ihrer Kindheit zusammenhängen, ihrem Verhältnis zum Vater und Großvater, zur Mutter et cetera. Doch wir können hier nicht ihre Analyse machen, denn sie hat uns nicht darum gebeten, und es wäre sehr übergriffig. Aber vor allem denke ich, dass, mehr als es Widerstand war, ihr vielleicht einige Informationen gefehlt haben; in Anbetracht der amerikanischen Psychoanalyse sah sie in der Analyse eine Generalisierung von Symptomen am Werk, so wie beispielsweise die Medizin Organe generalisiert oder für einen Arzt jeder dasselbe Herz hat, so hat jeder denselben ÖdipusKomplex – daher ist sie nicht in der Lage, die Besonderheit des Einzelnen zu erklären. Ich stimme aber mit Ihnen in einem grundsätzlichen Punkt bezüglich einiger Verbindungen zwischen Hannah Arendt und der psychoanalytischen Forschung überein, der damit zusammen hängt, dass das Individuum für sie immer in einer Interaktion ist, im inter-esse ist, und diese Interaktion ist ein Feld der Ereignisse. Es gibt also psychische Realitäten und kollektive Realitäten, und diese logische Tatsache der Konstruktion des Individuums hat einige Konsequenzen für die historische Zeit, die eine Zeit der Ereignisse ist, mit Zäsuren, Revolutionen, Krisen et cetera. Ich stimme Ihnen mit Nachdruck zu, dass die heutige psychoanalytische Bewegung nicht die Chance ergreift zu zeigen, wie sehr unser Verständnis des »Menschen im inter-esse« sich im Sozialen auswirken könnte. Obschon es auch ein schwieriges Unternehmen wäre, in unserer Gesellschaft der Show und des Spektakels. Die Psychoanalytiker haben sich sehr stark von der politischen Bühne zurückgezogen, und wenn sie sich einmischen, dann in einer unverständlichen Sprache, die zu technisch ist, zu subjektiv und die gesellschaftliche Probleme meidet. Da zeichnen sie lieber ein lustiges Porträt dieser und jener politischen Figur. Und das ist in gewisser Weise etwas sehr Kriminelles für künftige Psychoanalytiker, die sich in diese Szenerie werden einmischen müssen. Was ich mache – quasi vis-à-vis mit dem, was Sie mit Kriminellen tun – ist zu versuchen, einige psychoanalytische Ansichten in ein anderes Feld der Ausgrenzung zu übertragen, der Ausgrenzung von Behinderten. Als Präsidentin des Conseil national handicap (Nationaler Rat der Behinderten, d. Ü.) ist das eine sehr schwierige Aufgabe, denn in der Öffentlichkeit, im Fernsehen oder Radio, können wir nicht in einer psychoanalytischen Sprache sprechen. Wir müssen sozialer und pragmatischer sein und in einer psychologischeren Art mit Familien oder Sozialarbeitern sprechen, und auch auf ihre Bedürfnisse nach materieller oder finanzieller Unterstützung et cetera eingehen, auch um Gewalt gegen Behinderte und deren Ausgrenzung zu verhindern. In diesem Sinne kommt es hin und wieder vor, dass ich nicht psychoanalytisch spreche – denn die psychoanalytische Sprache würde in Bezug auf behinderte Menschen von verletztem Narzissmus, von Kastration oder von ihrer Todesangst sprechen. Das lässt sich sehr schwer auf die öffentliche Bühne bringen. Wir müssen also eine Umgestaltung vornehmen, eine sehr feinfühlige Strategie entwickeln, um uns in der Öffentlichkeit zu äußern. Doch nun noch einmal zum Politischen. Sie haben über mein Interesse an Hannah Arendts Begriff der Meinung gesprochen – mit seiner Meinung auf der politischen Bühne in Erscheinung zu treten. Und Sie haben gesagt, und Sie haben Recht damit, dass es etwas mit dem Teilen von Affekten zu tun hat, von Empfindungen, Angst, Freude et cetera. Das ist etwas sehr Wichtiges für mich: Es reicht bis hin zu dem, was wir vorhin über das Semiotische gesagt haben und über die Aspekte der Persönlichkeit, die nicht explizit auf der Ebene der Sprache ausgedrückt werden, sondern dem Verhalten inhärent sind. Lassen Sie mich eine Sache ansprechen, die mir in den Sinn kam, während ich Ihnen zugehört habe. In der modernen Politik haben wir ein neues Phänomen; Sie haben es hier in Deutschland, wir in Frankreich haben es – weibliche Führungspersonen in der Politik, Präsidentin, Premierministerin et cetera. Jenseits positiver Aspekte dieser weiblichen Figuren in der politischen Landschaft, wie ihrer Kompetenz und der Tatsache, dass sie die Geschäfte auf eine pragmatischere Weise leiten, gibt es eine zusätzliche Eigenschaft, die mir auffällt. Ich denke hier an Ségolène Royal, an die Tatsache, dass sie durch ihr Verhalten, ihre Ansprache, ihr Lächeln und ihre Gestik, durch die Art, wie sie ihre Botschaft zum Ausdruck bringt, zwei Arten von Subtexten transportiert. Sie haben das angesprochen. Der eine ist mit der Nation verknüpft, denn es gibt Körper und Sprachen, die zu einer nationalen Gemeinschaftlichkeit gehören, die hier nicht derart unterdrückt wird wie im technokratisch-männlichen Diskurs von Politikern. Und obwohl es kein nationalistischer Diskurs ist, gibt es eine auf die Nation bezogene, unterbewusste Botschaft, die beim Publikum ein Wohlsein auslöst. Die Leute sehen ihre nationale Identität gespiegelt in diesen Frauen, die sich, sagen wir, mütterlich verhalten – nicht direkt mütterlich im Sinne von »sich kümmern um«, sondern indem sie auf ihre Weise ein Spiegel dessen sind, was der gemeinschaftliche Körper, was die Tradition, was das Image ist. Ebenso ist da ein Subtext, der mit der religiösen Tradition zusammenhängt, und der Begeisterung und Glaubwürdigkeit verheißt – ich glaube daran, dass in diesem Land etwas Gutes passieren wird, und ich lasse dich darauf vertrauen, dass du daran teilhaben wirst. Das ist auch eine Art von sub-lingualer Botschaft, die eine populäre, aber nicht populistische Einigung hervorbringt. Und das könnte gefährlich sein.
Lorenz Böllinger
Das ist im habermasschen Konzept nicht enthalten …
Julia Kristeva
Nein. Zu Habermas werde ich noch kommen, denn als gute Freunde teilen wir uns ein Appartement in den Vereinigten Staaten, aber das ist alles, was wir teilen. Abgesehen von Freundschaft. Nun komme ich zu den Punkten, an denen größere Unstimmigkeiten zwischen Ihnen und mir bestehen und die einer Klärung meinerseits bedürfen. Wenn ich sage, dass Hannah Arendt eine Wiedergründung der Triade aus Autorität, Tradition und Religion versucht, so ist das eine Kurzformel von mir. Sie hat das nirgendwo explizit so gesagt, aber ich denke, es zieht sich durch ihr gesamtes Werk, von Vita activa bis hin zu ihrer Trilogie. Doch für mich ist das auch eine Diskussion mit Philosophen wie Ricoeur, der die Bedeutung von Hannah Arendts Interesse an Autorität, Religion und Tradition erkannt hat und dachte, dass es zwei Einstellungen dazu gibt: Entweder die, die primär die Position von Claude Lefort ist, dessen anti-kirchlicher Einstellung zur Tradition Sie nahe stehen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, und die auch – dialektischer vielleicht als bei ihm – die meine ist. Claude Lefort sagt im Wesentlichen, dass wir uns wegen der Auflösung, der Verbindungen zu Tradition, Autorität und Religion mit einer Leere konfrontiert sehen. Auf welcher Basis können wir nationale oder politische Gemeinschaften bilden? Wir haben keine Basis, denn früher war die Basis das Christentum, der Judaismus oder der Islam et cetera. Für viele Leute, wie für uns, existiert eine solche Basis nicht; andererseits führt uns die multikulturelle Gesellschaft vor Augen, dass es zwar etliche Religionen gibt, jedoch keinen gemeinsamen Hintergrund. Es gibt also eine Leere. Leforts Antwort darauf ist, dass wir auch keine solche Grundlage brauchen. Auf unbestimmte Zeit können wir uns mit vorübergehenden Übereinkünften behelfen. Heute haben wir ein Gesetz, diskutieren dieses Gesetz, und übermorgen werden wir ein anderes Gesetz haben und dieses diskutieren und eine andere Übereinkunft treffen und so weiter. Es gibt also vorübergehende demokratische Übereinkünfte in einer Debatte. Das ist die eine Ansicht. Ricoeur hingegen sagt, das ist unmöglich, zu riskant und zu schwierig – die Leute folgen uns nicht, sie glauben nicht an die Politik. Sie sagen, diese Übereinkünfte sind plump und unbefriedigend, und in diesem Fall werden die Übereinkünfte auch nicht wirklich befolgt. Wir müssen also die Tradition erneuern. Und hier komme ich und sage, man kann die Tradition, die Autorität und die Religion nicht als solche wieder aufnehmen. Das ist es nicht, was Hannah Arendt sagt. Sie nimmt diese Triade ernst, doch sie interpretiert sie, sie ist unterwegs, sie schlägt keine neue Art von Religion vor, keine neue Art von Tradition oder Autorität; sie sagt hingegen, in einer Art foucaultschen Herangehensweise, dass wir als Einziges die Archäologie dieser Tradition ernst nehmen und sie Tag für Tag, Schritt für Schritt neu interpretieren müssen. Vom jeweiligen Standpunkt aus, von der Rechtswissenschaft oder der Philosophie, der Anthropologie oder der Psychoanalyse müssen wir versuchen herauszufinden, was sie bedeutet und wie wir sie an diese oder jene konkrete Situation anpassen können. Ich denke, das ist die einzige Position, die wir akzeptieren können, und ich will erklären, warum ich das denke: Anders können wir nicht weitergehen in der modernen Welt des dritten Jahrtausends, denn wir haben heute eine neue Situation, die sich von der Zeit vom Ende der Französischen Revolution bis zum 11. September 2001 unterscheidet. Heute leben wir in einer anderen Zeit, und wir müssen dieser neuen Situation Rechnung tragen, die zum einen durch den Aufstieg der Fundamentalismen charakterisiert ist, zum anderen durch die Entwicklung neuer Kommunikationsmittel, durch die Gesellschaft des Spektakels und so weiter. In diesem Zusammenhang ist meine Haltung, die auch die Ihre ist, zu sagen, dass, nachdem wir die Verbindungen zu Tradition, Autorität und Religion gelöst haben, nun die Menschenrechte der einzige Ersatz sind, was aber nicht ausreichend ist. Ich bin eine Anhängerin der Menschenrechte, vollkommen. Deshalb war auch gestern die Menschenrechtsorganisation anwesend, denn ich denke, sie leisten die einzige praktische Hilfe. Aber wir sind Philosophen, wir sind Denker, und auch wir müssen diesen Menschen helfen. Wir können uns nicht darauf zurückziehen zu sagen, wir sind Philosophen und denken in der Universität, und bitte, NGOs, geht ihr doch nach Afghanistan, das ist eure Sache. Es ist an uns, eine Art neues Denken zu entwickeln, das diesen Menschen hilft, die sich in ihrem Handeln einer neuen Menschlichkeit stellen.
Wir haben, von den Griechen und dem Christentum bis zur heutigen Philosophie und den Humanwissenschaften, eine lange Tradition der Interpretation. Diese Intelligibilität müssen wir sowohl auf die Erfahrungen in unserer eigenen Kultur wie, diese in ihrer Andersheit ernstnehmend, auf die fremden Mentalitäten richten. Es geht darum, in dieser Konfrontation und Interaktion den Sinn unserer Universalität zu erweitern und komplexer zu machen, ohne den Anspruch auf individuelle Freiheit und den Respekt vor dem einzelnen Menschenleben, hier insbesondere der afghanischen Frauen, preiszugeben. Eine neue Menschlichkeit also, die schon einmal da war und deren uralte Bedeutungen – vom Standpunkt der Aufklärungsphilosophie aus gesehen, der wir alle angehören – nun wieder auf die vorderste Bühne kommen. Welche sind diese uralten Bedeutungen?
Sie haben gesagt, dass Sie an die Menschenrechte glauben – mir ist aufgefallen, dass Sie das Wort »glauben« sehr häufig verwenden. Was heißt das – glauben? Sie haben dieses Wort benutzt, das Wort gehört zur religiösen Tradition. Es bedeutet, wir haben einen Glauben. Und hier war Ihnen Habermas, entschuldigen Sie, einen Schritt voraus, als er einen Pfad eingeschlagen hat, der uns nach wie vor offen steht. Ich bin jedoch mit seinem Schritt auch nicht einverstanden. Er hat Ratzinger getroffen, bevor dieser Papst wurde; im Wesentlichen sagte Habermas, dass wir, weil wir keine universelle moralische Grundlage haben, Glaube und Vernunft miteinander aussöhnen müssen. Wenn ich Habermas richtig verstanden habe – Ratzinger jedenfalls war mit ihm sehr einverstanden – so müssen seiner Ansicht nach diejenigen, die sich zur Vernunft bekennen, mit denen, die sich zum Glauben bekennen, eine Art Gentleman’s Agreement treffen, die Spaltung als solche aber aufrechterhalten. Das ist nicht meine Meinung. Ich sage, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts und vielleicht auch schon davor, Menschen wie Hannah Arendt, Heidegger, Freud und einige andere, versucht haben, diese Spaltung zwischen Glauben und Vernunft neu zu denken. Freud ist weder Glauben noch einfach Vernunft im Sinne des Rationalismus. Nehmen wir die Angst, den Glauben, Enthusiasmus, Borderline-Persönlichkeiten, Gewalt: All diese Dinge, die nicht auf eine simple Art rationalisiert werden können. Man muss andere Vorstellungen einführen, was wir mit dem Erweitern psychoanalytischer Konzepte versuchen, wobei wir bis an die Irrationalität heranreichen, und sie in eine Rationalität, die einen größeren Spielraum bietet, integrieren. Bitte, sagen wir zur öffentlichen Meinung, bitte nehmt dieses Öffnen der menschlichen Vernunft seitens der Tradition des 18. und 19. Jahrhunderts ernst. Das geschieht auch in der kreativen modernen Kunst: In ihren Installationen und abstrakten Gemälden präsentiert sie keinen Glauben an einen Gottvater oder etwas Jenseitiges, sondern es gibt den Versuch, eine andere Art zu denken, zu leben und so weiter aufzubauen, mit Leiden und mit Enthusiasmus. Dass da etwas Anderes unterwegs ist, das haben wir zu interpretieren und der Öffentlichkeit zu überbringen. Ich will das an dieser Stelle nicht lange ausführen, denn es wäre sehr kompliziert, und ich habe schon ganze Bücher darüber geschrieben. Doch auf zwei Dinge möchte ich hinweisen, denn Sie haben etwas gesagt, das ich zwar verstehe, aber nicht teile. Sie haben gesagt, dass es gefährlich sein könnte, sich auf Tradition, Autorität oder Religion zu beziehen. Ich denke, wir müssen dieses Risiko eingehen, ohne ihm zu erliegen. Ich versuche, den unbewussten Nutzen zu deuten, den wir aus der Autorität oder dem Glauben ziehen können, um nur von diesen beiden zu sprechen. Als es vor einiger Zeit die Aufstände in den französischen Vorstädten gab, habe ich in einem Magazin namens Marianne einen Artikel darüber und über die Krise der Adoleszenz geschrieben. Sie haben etwas bemerkt, was in Übersee und vielleicht auch in Europa nicht verstanden wurde: Dass die so genannten beurres, die arabischen Jugendlichen der zweiten Generation, die französische Gesellschaft nicht vom Standpunkt irgendeiner Religion aus zurückweisen. Das sind keine religiösen Unruhen. Es ist auch kein Aufstand einer Gemeinschaft; es geht nicht um arabische Community gegen schwarze Community oder so etwas. Sie wollten anerkannt werden. Sie wollten die Werte der Republik teilen. Sie sagten, dass sie nicht als vollwertige Bürger anerkannt werden. Sie haben Symbole der Republik angegriffen – Schulen, öffentliche Verkehrsmittel, die Polizei. Einige von ihnen, weil sie gewalttätig sind, aber andere, weil sie denken, dass sie nicht anerkannt werden. Meiner Meinung nach ist das etwas sehr Symptomatisches nicht nur für diese Jugendlichen in den Vororten, sondern für alle Jugendlichen – sogar für die wohlhabendsten unter ihnen, die nicht an den Krawallen beteiligt sein werden, aber magersüchtig oder zu borderline-Persönlichkeiten werden oder psychosomatische Probleme bekommen. Warum? Weil die Adoleszenz die Phase ist, die ein Ideal braucht. Die die Anerkennung durch eine ideale Instanz braucht, die ich, mit Freud, den idealen Vater der persönlichen Vorzeit nenne. Das ist aus einem sehr kurzen Absatz seiner Schrift »Das Ich und das Es«. Es hat mich sehr überrascht, dass in der Psychoanalyse bis dahin keine Notiz davon genommen wurde. In meinem Buch Geschichten von der Liebe, das ich in den Achtzigerjahren geschrieben habe, bin ich ausführlich darauf eingegangen, und mittlerweile diskutieren wir in der Psychoanalytischen Gesellschaft sehr viel darüber – mit André Green zum Beispiel und anderen. Freud hat diese Figur des idealen Vaters entdeckt, und er hat sie noch vor dem ödipalen Vater eingesetzt. Der ödipale Vater ist der Vater des Verbots, er macht die Gesetze. Er sagt, bitte rühre deine Mutter nicht an, das ist verboten, ich sage, was gut und was schlecht ist, und du wirst mir Folge leisten. Nun gut, wunderbar, wir brauchen diesen Vater, doch Freud sagte noch mehr: Vor diesem Vater ist noch ein anderer Vater, eben der ideale »Vater der persönlichen Vorzeit«. Dieser ist ein liebender Vater, und mit ihm identifizierst du – männliches oder weibliches Subjekt – dich imaginär, symbolisch, denn er erkennt dich an, er sagt: Gut, mein Sohn, meine Tochter. Und diese veränderte symbolische Verbindung ermöglicht es dir, dich von deiner Mutter zu distanzieren und dich aus der Abhängigkeit vom Uterus, vom Körper, vom Mütterlichen, heraus zu begeben. Das ist der Beginn der Autonomisierung. Und diesen idealen, liebenden Vater haben einige Religionen oder Älteres imaginiert und verehrt. Religionen tun einiges, tun viele falsche Dinge, wie zum Beispiel die Inquisition, aber es funktioniert, denn sie antworten damit auf gewisse innerpsychische Bedürfnisse. Und ich denke, dass dieses Bedürfnis essentiell für die Errichtung eines lebendigen psychischen Apparates ist: Kinder zeigen dieses Bedürfnis, an die Rede der Eltern zu glauben; um dann später, natürlich, gegen sie zu protestieren. Die Kinder in unserer Gesellschaft brauchen diesen liebenden Vater, jedoch haben Väter nicht viel Zeit, zu Hause zu sein; sie meinen aber, die Rolle des Vaters des Verbots und des Gesetzes bekleiden zu müssen et cetera. Obschon, wie wir wissen, die väterliche Funktion heutzutage eine Veränderung erfährt, da neue Formen der Väterlichkeit aufkommen und junge Väter andere Vorstellungen über Väterlichkeit haben, ist es doch wichtig, diesem Bedürfnis nach dem liebenden Vater Beachtung zu schenken, auch in unserem Bildungssystem. Gerät zum Beispiel ein Jugendlicher in eine Krise und fühlt sich wie in einem leeren Raum, weil niemand sein Bedürfnis nach einem Ideal erkennt, dann können wir uns fragen: Gibt es da einen Sozialarbeiter oder einen Lehrer, der ein solches Ideal dem Kind anbieten kann, der ihm sagt: »Ich glaube an dich, du kannst das schaffen«? Wie Sie sehen, besteht meine Herangehensweise in einer Archäologie der Autorität und der Religion: nicht um diese zu wiederholen, sondern um dem psychologischen Bedürfnis, das ich entdeckt habe, in neuen Formen, in neuen Einstellungen Rechnung tragen zu können. Ich werde nie fordern: gebt dieser Jugend eine neue Religion; sondern, dass wir die Menschenrechte zu etwas machen müssen, an das man glauben kann. Und dazu müssen sie von jemandem vermittelt werden, der respektvoll mit den Leuten spricht, so wie es der ideale Vater macht. Wer von uns ist dazu in der Lage? Das ist von größter Bedeutsamkeit im sozialen Bereich, denn oft verhalten wir uns wie Technokraten und schreiben anderen vor, was zu tun ist; wir handeln nicht im inter-esse, um mit Hannah Arendt zu sprechen. Soweit zu diesem Aspekt des Glaubens.
I ch schreibe gerade ein Buch über die Heilige Theresia von Avila, und ich denke, ich werde eine Menge Leute, Leute wie Sie zum Beispiel, damit schockieren, die sagen werden, Kristeva ist bigott geworden, eine Erzkatholikin, was absolut nicht der Fall ist. Ich habe versucht, einige Aspekte dieser Kultur, deren Erben wir sind, zu verstehen, um herauszubekommen, wie man Menschen dazu bringen kann, der Versuchung des Fundamentalismus zu widerstehen. Dazu müssen wir den Nutzen und die Fallen unserer Tradition verstehen. Ich habe darüber in Italien gesprochen, und mein Herausgeber sagte, das sei sehr interessant, damit sollten wir uns mal genauer befassen. Das Ergebnis ist ein Buch, das vor ein paar Tagen in Italien erschienen ist. Es enthält einige Artikel von mir und ein Interview mit dem Titel Bisogno di credere, »Das Bedürfnis zu glauben«. Um deutlich zu machen, warum ich das erwähne, möchte ich einen kleinen Exkurs in die Religionsgeschichte machen: Im Allgemeinen gehen wir, die wir an Religionsgeschichte, Judaismus und Christentum interessiert sind, davon aus, dass Glauben und Christentum zusammenhängen, heißt es doch: credo quia absurdum. Man kann glauben, dass es die Auferstehung gibt, dass die Jungfrau Maria jungfräulich war und so weiter. Man muss es sogar glauben. Im Judaismus dagegen gibt es keinen solchen Glauben, er ist rationaler, denn es geht um die Geschichte des Volkes Israel. Das ist in gewissem Sinne wahr, aber es ist nicht vollkommen wahr. Wenn man sagt, Schm’a Jisrael, hör’ mir zu – man kann niemandem zuhören, wenn man ihm nicht glaubt. Wenn man zuhört, muss man glauben. Wenn Kinder ihrem Lehrer nicht zuhören, so gilt das als Verhaltensauffälligkeit; sie können sich nicht konzentrieren und nicht den Sinn dessen erfassen, was gesagt wird, sie hören nicht zu. Aber das ist deswegen so, weil sie nicht an das Wort, den Satz, an die Botschaft glauben, die ihnen übermittelt werden soll. Sie vertrauen nicht. Glaube und Vertrauen gehen Hand in Hand. Mit diesem Beispiel möchte ich verdeutlichen, dass es ein anthropologisches Bedürfnis gibt zu glauben, das vorreligiös ist. Und vorpolitisch. An diese Phänomene müssen wir mithilfe der Anthropologie, mithilfe der Religionswissenschaft herankommen. Und damit die Menschenrechte erweitern, ohne sie zu verwerfen. Wir müssen in die Menschenrechte etwas wie ein Vermächtnis der Tradition einfügen, dass, ich wiederhole, neu interpretiert werden muss. Sie haben sich auf ein Zitat von Hannah Arendt bezogen, dass ich vorgetragen habe, in dem es um Atheismus und Nihilismus geht. Wie Sie wissen werden, gab es in den USA, genauer gesagt an der Universität von Notre Dame, die politikgeschichtlich-transzendentale Schule, die von Waldemar Gurian und Eric Voegelin geleitet wurde. Die beiden waren amerikanische Juden russischer Herkunft und sind zum Christentum konvertiert. Als Hannah Arendt ihr Buch über Imperialismus und Antisemitismus veröffentlicht hatte, luden sie sie an die Universität von Notre Dame zu einer Diskussionsveranstaltung ein. Sie meinten dabei festzustellen, dass Arendts Kritik an der Säkularisierung in dieselbe Richtung ging wie ihre eigenen Ansichten – mit der expliziten Aussage nämlich, dass die Shoah, der Holocaust, weniger die Folge eines sozio-politischen Prozesses seien, als vielmehr Produkte der Aufklärung. Zwar hat Arendt in der Tat nie geleugnet, dass ein bestimmter Atheismus zum Niedergang der Ethik beigetragen hat. Aber sie insistiert darauf, dass das totalitäre Phänomen einzigartig ist, und dass kein vorhergehendes Ereignis, sei es aus dem Mittelalter oder dem 18. Jahrhundert, als »totalitär« bezeichnet werden könne. Und ebenso grenzt sie ihre philosophische Untersuchung sorgfältig von jedweder religiösen Positionierung ab, indem sie die politische Inanspruchnahme eines »Göttlichen« eben dem von ihr bekämpften, bösartigen Nihilismus zuordnet. In diesem Sinne sind Sie, wenn Sie die Religion als Antwort auf ein politisches Problem nutzen wollen, ein Nihilist. Einfach weil die Religion eine andere Bedeutung hat, und keine politische. Gestern habe ich zitiert, was sie gesagt hat, und ich zitiere es noch einmal: »Diejenigen, die aus den schrecklichen Ereignissen unserer Zeit schließen, dass wir aus politischen Gründen zu Religion und Glauben zurückzukehren haben, scheinen mir zu zeigen, dass ihnen genauso viel Gottesglauben fehlt wie ihren Gegnern.« Religion kann also kein Ersatz für politischen Sinn sein.
Nun noch eine Antwort auf das, was Sie über das Individuum gesagt haben und über die Gefahren, die in einer Überschätzung des Individuums liegen könnten. In der Perspektive Arendts ist das quid, das »Wer«, dem Individuum selbst niemals verfügbar. Sichtbar und offenkundig ist es für die Anderen. Das heißt, Individuum ist man nicht für sich selbst. Anders bei Heidegger, bei dem gerade das Eigene für sich virtuos sein kann, während das Mitsein zum Banalen gewendet wird. Bei Arendt wissen die Anderen, wer du bist. Das quid, die ecceitas, ist eine Botschaft, die sich in der Meinung der Anderen materialisiert. Der Andere ist der Besitzer deiner Identität im Sinne von Übertragung und Gegenübertragung; der Patient weiß nicht, wer er selber ist – der Analytiker weiß es in der Interaktion. Es gibt also weder in Hannah Arendts Szenario noch im psychoanalytischen Denken einen Egozentrismus. Wenn Sie sagen, die multiple Realität müsse konstruiert werden durch die Affekte, Interpretationen und so weiter, denke ich, dass sie in Arendts Verständnis des inter-esse schon enthalten ist, und das ist auch die psychoanalytische Auffassung. Als Psychoanalytiker wissen wir zudem, wie konflikthaft das inter-esse ist, was auch Arendt immer sehr betont hat. Sie bezieht sich auf Augustinus, um das quid als ein liebendes Individuum einzuführen, was wiederum der Freudschen Vorstellung entspricht – das Individuum ist von Beginn an ein liebendes. Ist es das nicht, heißt das, dass es ihm nicht gelungen ist, in der Dreiecksbeziehung von Vater–Mutter–Kind zu sein. Die jüdische Bibel schildert mit Nachdruck diese Konfliktivität in der Abfolge der Generationen, mit der ganzen Bedeutung, die der Zeugung, den Familien und Clans beigemessen wird. Augustinus reflektiert diese konflikthafte generationelle Abfolge in der Welt zwischen Geburt und Tod – was Arendt aufgreift: In dieser Welt, zwischen der Geburt und dem Tode, und nicht nur für die Liebe Gottes, der nicht auf dieser Erde weilt. Auch Freud nimmt diese »jüdische Abfolge« ernst und versucht diese, neben seinen Erkenntnissen über das Seelenleben aus den Analysen, in die Kultur der Aufklärung, der er sich verpflichtet fühlt, einzufügen. Von Hegels Herr-Knecht-Dialektik hat Freud – mehr im- als explizit – das gewaltsame Grundmuster dieser Konflikte aus Liebe und Hass ererbt. Auf der Ebene der Hysterie bekommen wir es damit zu tun: mit dem dialektischen quid zwischen dem sadistischen und dem masochistischen Begehren. Doch Sie haben sehr deutlich und richtigerweise darauf hingewiesen, dass die moderne Psychoanalyse nun auch die Borderline-Symptome, die Entsymbolisierung, die Selbstzerstörung und darüber hinaus einige psychosomatische Erkrankungen, die nicht symbolisiert werden können, eingeführt hat. Wir müssen diese neuen Erscheinungsformen der Gewalt deuten und diese Deutungen der öffentlichen Sphäre wieder zur Verfügung stellen. Denn das soziale Band funktioniert nicht automatisch. Das müssen wir verständlich machen. Die Marginalisierten, seien es behinderte Menschen, seien es bestimmte sexuelle Vorlieben, die nicht so genannt konventionell oder modern sind, oder seien es Kriminelle – sie gehören zur Menschheit, sie sind Teil des menschlichen Prozesses, oder des Liebesprozesses. Und ohne ihn zu banalisieren, muss er gedeutet werden.
IN ANDERE ERFAHRUNGSWELTEN HINEINDENKEN
Frau Professor Kristeva, meine Damen und Herren, ich bin nicht der Bürgermeister der freien Hansestadt Bremen, ich bin Senator für Bau, Umwelt und Verkehr und vertrete den Bürgermeister hier, der sehr gerne heute Abend persönlich hier gewesen wäre, aber er versucht auch, unsere Freiheit ein Stück weit heute zu vertreten – die Föderalismusreform Teil zwei hat ihren Auftakt heute im Bundesrat gestartet, und das ist im besonderen bremischen Interesse, dass wir uns auch deutlich artikulieren, positionieren und Meinung und Stimmung machen. Nun ist sehr viel heute von Bildern die Rede gewesen, und ich habe die Reden mit großem Respekt und großer Anerkennung gehört, und ich muss sagen, es war ein Vergnügen, so viel Intellektualität und so viel Wissen kompakt in unserer schönen oberen Rathaushalle genießen zu dürfen. Wenn man vom politischen Denken redet, redet man zumindest in Deutschland relativ selten von Politikern. Wenn Politiker mit Denken in Verbindung gebracht werden, sind das häufig QuerDenker, komisch eigentlich, so dass die Frage sich für mich zumindest stellt, auch nach dem heutigen Abend, wie kommt das eigentlich, was macht politisches Denken aus? Politisches Denken hat ganz offensichtlich etwas mit Orientierung zu tun, oder Orientierung in Frage zu stellen, und sowohl Hannah Arendt als auch Sie, Frau Professor Kristeva, haben beides jeweils in ihrer Zeit und mit ihrer Sprache sehr deutlich auch artikuliert. In Frage stellen heißt auch, Positionen und sich verändernde gesellschaftliche Realitäten aufnehmen und verarbeiten und einbringen, und Politiker, die, so wie ich, aktuell politisch zu handeln haben, wandeln im Wesentlichen auf den Pfaden derer, die mal politisch irgendwelche Orientierung gegeben haben. Möglicherweise ist das eine Begründung. Wir brauchen politisches Denken, wir brauchen auch politisch queres Denken, und das hat insbesondere dann einen Reiz, eine Herausforderung und gibt extrem viele Impulse, wenn das auch ein Denken ist, das in vielfacher Hinsicht übergreifend ist. Es ist die Rede davon gewesen, von Ihrem Weg von Bulgarien nach Paris, aus dem Totalitarismus hinaus hinein in ein Land mit viel Freiheit und Lebensbejahung, aber trotzdem mit viel Fremdheit. Fremdheit empfindet man möglicherweise auch, wenn man im eigenen Land sich bewegt, es muss nicht immer nur etwas mit unterschiedlichen Erinnerungen, Kulturen und gesellschaftlichen Werten, die man vermittelt bekommen hat, zu tun haben, es kann einfach auch etwas mit dem Raum zu tun haben, mit der Umgebung, in der Mann oder Frau sich bewegt. Fremd kann man auch sein, das ist das nächste Stichwort, das heute Abend auch schon gefallen ist, durchaus auch im Diskurs zu eigenen Kindern, also über Generationen hinweg, weil scheinbar am gleichen Standort, am gleichen Ort, man trotzdem eine komplett andere Erfahrung mit sich bringt, einen komplett anderen Hintergrund mit sich bringt und eine andere Lebensrealität wahrnimmt. Wenn die Kinder, die heute geboren werden, sich in zwanzig Jahren die europäische Landkarte anschauen, haben diese einen komplett anderen Blick auf Bulgarien als wir alle, die hier im Raum sind – das ist ein Land in der Mitte Europas, und es ist nicht ein Land, das irgendwo hinter irgendeinem Eisernen Vorhang eigentlich völlig unbekannt und fremd ist. Auch das ist ein Bild, das sich neu vermittelt. Ralf Fücks hat eben die besondere Situation des Staates Israel angesprochen. Da haben wir in Zentraleuropa allabendlich um 20 Uhr, wenn wir die Tagesschau anschauen, eben einen anderen Blick auf Fremdheit, auf Bedrohung, auf das tägliche Leben im Umgang mit Gewalt und Bedrohung, die man erfahren kann, und deswegen auch naturgemäß eine andere Übersetzung und eine andere Vorstellung, wie man damit umzugehen hat. Und da braucht es Menschen, die denken, die nachdenken, die quer denken, die Erfahrungen haben, die auch springen, die sich auch auseinander setzen mit anderen Biografien, Lebensbiografien, mit anderen Frauen, versuchen, sich in diese Erfahrungswelten hineinzudenken, und auch in deren Zeitabläufe, in deren zeitliche Restriktionen und Wirklichkeiten hineinzudenken, und das haben Sie in vorbildlicher Weise getan, und insoweit ist es mir eine besondere Freude, heute bei so vielen guten Laudatoren, gemeinsam mit Ralf Fücks, Ihnen nun auch den Preis überreichen zu dürfen.
Vielen Dank.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz