
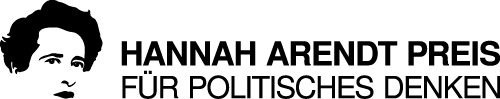

Victor Zaslavsky (†), Ingenieur und Soziologe, lehrte Politische Soziologie in Rom

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Kreative Erinnerung
Die Einleitungen waren so gut, dass mir eigentlich wenig Positives zu sagen bleibt außer Wiederholungen. Allerdings kommt auch einiges Kritisches, was noch nicht gesagt wurde. Was ich vermisst habe, ist, dass man von Ihren anderen Büchern nicht gesprochen hat. Immerhin sind beim Wagenbach-Verlag In geschlossener Gesellschaft, die Beschreibung des sowjetischen Alltags, und die Sammlung Das russische Imperium unter Gorbatschow erschienen, das sind wertvolle Beiträge zum Verständnis des nachstalinistischen Russlands. Das Wichtigste, ich sage es noch einmal, ist, dass Ihr Buch im Unterricht im Westen und im Osten vorgestellt und verwendet werden sollte. Im Osten, damit meine ich auch die so genannten Neuen Bundesländer, die nach 18 Jahren nicht mehr so neu sind, da habe ich schlimme Erfahrungen gemacht. Vor ein paar Jahren sprach ich in Potsdam, es waren fast nur ehemalige SED-Mitglieder dabei, und sie wussten eigentlich nichts. Sie wussten etwas von der DDR, die gar nicht so schlimm gewesen ist im Vergleich mit anderen. Es hat keine Prozesse gegeben wie in Prag oder in Budapest, keinen Gulag, es hat nur – ich sage absichtlich nur – Gefängnisse gegeben. Und sie wussten nichts von so etwas wie Katyn. Das hatte etwas Tragisches, und es ist nun besonders schön – ich muss es wiederholen –, dass heute ein russischer Wissenschaftler das gesagt hat. Vorgestern haben in Paris Libération und Le Monde lange Besprechungen gebracht – das war im Sinne dessen, was Frau Linnert eben gesagt hat – über das Buch eines türkischen Professors, Taner Akçam, Le génocide arménien et la question de la responsabilité turque, also: Der armenische Völkermord und die Frage der türkischen Verantwortlichkeit – das ist jemand, der fragt wie Sie, was war eigentlich deren wirkliche Schuld? Warum ist er nun in einer schwierigen Lage? Weil er dargestellt hat, wie die Jungtürken, darunter Atatürk, der abbrechen wollte, für den Massenmord mit verantwortlich waren. Und genauso kann ich Putin verstehen. Er war ja immerhin in Dresden der Überwacher der Stasi, der Mann, der dann in den Geheimdiensten geblieben ist und der es sich leisten konnte, dem Pipeline-Projekt von Russland bis hierher, das noch nicht gebaut ist, mit dem Exkanzler Herrn Schröder einen Generalsekretär zu geben, den er als Stasimann in Dresden gekannt hatte. Deswegen finde ich, dass Putin, ich sage nicht, gut ist, aber verständlich. Etwas erstaunt war ich über das, was Sie über Gorbatschow schreiben, aber Sie haben Recht, nur: er hat doch viel getan – ich war im Kriegsmuseum in Minsk, da erklärte mir die Direktorin, dass es unter Chruschtschow plötzlich den Stalin-Hitler-Pakt gab, unter Gorbatschow das Geheimprotokoll. Allerdings steht im Geheimprotokoll natürlich Katyn nicht drin. Aber da gab es Fortschritte. Wo ich nicht ganz einverstanden sein kann, ist, dass man im Westen so wenig darüber sprach. Ich darf mich selbst zitieren, mein erstes Deutschlandbuch 1953, L’Allemagne de l’Occident 1945–1952, darin spreche ich über Katyn, wegen des Prozesses, und sagte auch, dass eben das beim Nürnberger Prozess unterdrückt worden war, weil der sowjetische Richter einfach nicht gewollt hat, dass man über Katyn spricht. Allerdings, fügte ich damals hinzu, und das muss noch heute teilweise wahr bleiben, das wurde von Ihnen schon gesagt, kein Deutscher darf sich seiner nationalsozialistischen Vergangenheit deshalb gerechtfertigt fühlen, weil auch die Russen barbarisch verfahren sind. Und das war damals eine Befürchtung der Alliierten, denn es gab einige Deutsche, die sich freuten, wie sich die ehemaligen Sieger untereinander des Massenmordes beschuldigten. Es ist schon über Katyn geschrieben worden vor ein paar Jahren in dem großen Schwarzbuch des Kommunismus – zuerst auf Französisch 1997 erschienen, dann bei Piper 1998 –, worin ein Pole, Andrzej Paczkowski, über Katyn geschrieben hat in Verbindung mit dem Massenterror, der dann 1944, 1947 in Polen stattgefunden hat. Hier übrigens eine Randbemerkung: In Deutschland ist man auch nicht immer gewillt, sich an alles zu erinnern. Ich werde einige stören, wenn ich sage, immerhin gehört Herbert Wehner auch zu den Komintern-Unterwürfigen, der auch denunziert hat, der auch eine Kaderliste aufgestellt hat, mit der dann Menschen hingerichtet wurden. Onkel Herberts Vergangenheit ist jedoch im Bundestag fast immer untergegangen. Ich glaube aber auch, es stimmt, dass die kommunistischen Historiker all das immer verneint haben. Und nicht nur die kommunistischen. Ich darf mir – Eigenlob! – zwei positive Dinge zurechnen: Im Mémorial de Caen, ein wunderbares Museum über die Kriegsgeschichte, habe ich vehement protestiert, weil nach 1945 nichts Negatives über die Sowjetunion dringestanden hat. Jetzt hat sich das verändert, nicht nur mein Einfluss, es steht jetzt auch drin, was geschehen ist in den Prozessen, mit den Massenmorden und so weiter. Und dann, bitte, sehen Sie sich das Deutsch-französische Geschichtsbuch an, das so gelobt wird, aber nicht von mir – im ersten Band steht so gut wie nichts über das, was im Osten geschehen ist, was unter Stalin geschehen ist, über Mao steht überhaupt nichts drin, und über Stalin steht furchtbar wenig drin. Und das ist einer der Vorteile Ihres Buches, dass es einen in die Lage versetzt, darüber sprechen zu können. Man kann sich kaum noch vorstellen, was kommunistische Historiker in Frankreich, mehr als in Deutschland, alles geschrieben, verleugnet haben. Beim Krawtschenko-Prozess wurde Margarete Buber-Neumann, die ja in sowjetischen Lagern, dann in Ravensbrück gelitten hatte (und deren Gatte, ein deutscher KP-Führer, von Stalin ermordet worden war), beschimpft, sie lüge und so weiter, und dann zitiere ich nur einen Artikel von 1950 in den Cahiers du communisme, von drei großen Historikern unterschrieben, Bruhat, Soboul, Agulhon: »Maurice Thorez, (charismatischer Generalsekretär der KPF) ist Historiker, weil er ein Politiker der Arbeiterklasse ist. Als Politiker der Arbeiterklasse zeigt er den Weg, weil er Historiker ist. Dank Maurice Thorez können wir unsere wissenschaftliche Konzeption der Geschichte der Bourgeois-Geschichte entgegenstellen. Weil unser Generalsekretär aus der Arbeiterklasse kommt, sind wir gute Historiker.« Nur, füge ich noch hinzu, vielleicht ist es auch in Ihrem Sinne, habe ich immer geschrieben, dass die Verneiner von dem, was in der Sowjetunion war, ich denke an eine Deportierte, die danach sagt, es gibt keine Gefängnisse in der Sowjetunion, und die Gefangenen werden wunderbar behandelt, dass die schuldiger sind als die, die eben nachher Auschwitz verneint haben, denn sie haben verhindert, dass man sich um die kümmert, die noch lebten. Es ging nicht nur um eine Beschimpfung der Toten, es ging auch um eine Verhinderung, um das Schicksal der noch Lebenden, der in Gefängnissen oder im Gulag Lebenden, dass man sich um sie kümmert.
Aber, nun kommt’s: Ich habe Schwierigkeiten mit Ihrem zentralen Thema. Warum? Weil es mich an jemanden erinnert, den ich nicht gern habe – er heißt Ernst Nolte. Und Ihre These ist nicht ganz unähnlich mit den Thesen von Nolte im Historikerstreit. Die letzte gute Beschreibung von dem, was er geschrieben hat und was die Querele war, ist in dem Buch von Hans-Ulrich Wehler, im letzten Band seiner Geschichte der deutschen Gesellschaft, wo er nochmals betont, was Nolte damals, 1986, alles geschrieben hat. Das Dritte Reich habe gegen eine asiatische Gefahr gekämpft, warum diese asiatische Gefahr so schlimm war, dabei kommt dieses furchtbare Wort Prius vor – denn die Vernichtung der Kulaken war zeitlich früher, war sie eine Ursache für Hitler? In einem Artikel von 1986 bejaht er dies, was Sie nie gesagt haben, aber er gebraucht auch das Wort Klassenvernichtung. Das Wort Klassenvernichtung steht bei Nolte, die Frage lautet nun, was ist denn eigentlich eine Klassenvernichtung? Zunächst finde ich, im Gegensatz zu Ihnen, die Definition der Vereinten Nationen, was Völkermord ist, unwahrscheinlich vage und beinahe unbrauchbar. Die Definition von 1948, also: Völkermord, Tötung von Mitgliedern einer Gruppe, Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden von Mitgliedern der Gruppe, vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind, gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Das entspricht relativ wenig dem Begriff des Völkermords, wie Sie ihn zu Recht gebrauchen, aber stellt die Frage, was will man eigentlich vernichten? Und hier bin ich wirklich nicht ganz einverstanden. Es stimmt für die Schriften von Lenin am Anfang, es stimmt für die Vernichtung der Kulaken in den ersten Jahren, aber wie ist es weiter? Ich kenne eigentlich nur einen Völkermord im Sinne, wie Sie sagen, einer Klasse, das ist der Selbstgenozid Kambodschas, wo eine Million Menschen getötet wurden, nur weil sie lesen und schreiben konnten, nur weil sie Intellektuelle waren, damit man von Null in der Gesellschaft neu anfangen kann, und das hat einen Massenmord an einer bis anderthalb Millionen Menschen gebracht. Aber unter Stalins Verantwortung in der Ukraine beim Holodomor, beim Massenmord durch Hunger, war es völlig gleichgültig, welche Ukrainer massenhaft starben, es starben ungefähr zwei Millionen, und so weiter. Und wenn man zum Beispiel den Chruschtschow-Bericht liest, dass 70 Prozent der Mitglieder des Zentralkomitees des XVII. Kongresses ermordet wurden, welche Völker deportiert worden waren, ganze Völker, Wolgadeutsche, Tschetschenen und so weiter, dann sehe ich wirklich, was alles ermordet worden ist von Stalin – die eigenen Genossen in der Partei, massenhaft, auch die, die emporsteigen wollten. Es gibt einen wunderbaren Film, »Soleil trompeur« (Die Sonne, die uns täuscht), in dem ein Oberst glaubt, er stünde in der Gnade Stalins, doch wird er rücksichtslos verprügelt, dann ermordet, Frau und Kinder werden deportiert, wie die Frauen und Kinder bei Katyn deportiert worden sind. Da bin ich auch bei einem Sonderfall, das ist der Fall Polen. Zu Recht wird im Schwarzbuch des Kommunismus darauf hingewiesen, dass Polen für sein Martyrium keinen Stalin brauchte. Der Gründungstag der deutschen Demokratie ist für mich das Hambacher Fest gewesen, und das Hambacher Fest hat sein Lied – das große Lied des Hambacher Fests war: Vor des Zaren finsterem Angesicht/ Beugt der freiheitsliebende Pole sich nicht. Es war ein Massenmord an Polen in Polen geschehen, ein unabhängiges Polen gab es nicht, wie später eine Frau wie Marie Curie, zukünftige Nobelpreisträgerin, in ihren Erinnerungen schreibt – in der Schule in Polen durfte sie kein Polnisch sprechen. Das Russisch war obligatorisch mit der Absicht, das Polnische auszumerzen. Also, Polen ist wirklich das Land, das am meisten gelitten hat, und ich glaube, der schlimmste Satz, der in Deutschland ausgesprochen wurde, ist von einer deutschen Frau, die behauptet zu sein, was sie nicht ist, sie heißt Erika Steinbach, und sie sagte: Die Polen haben auch gelitten. Dieses »auch gelitten« ist eine Provokation. Es trifft sich auch, dass Ihr Bundespräsident genauer sagen sollte, wo er geboren ist – aber er hat es gesagt, nämlich in einem Dorf, das polnisch war, doch der Geburtsschein kommt aus dem ersten Jahr der Germanisierung. Ich darf erinnern, im Februar 1933 sagt Hitler seinen Generälen und Ministern, wenn sie einmal die politische Macht haben, neue Exportmöglichkeiten erkämpfen, besser gesagt, neuen Lebensraum im Osten erobern und ihn rücksichtslos germanisieren. Hier ging es also, und ich glaube auf beiden Seiten, um nicht weniger als die Elite auszurotten, damit sie das Volk nicht beeinflussen kann, nicht aber um Kommunisten daraus zu machen. Wir wissen heute, dass Hitler nicht nur die Juden im Visier hatte, sondern nach den Juden wären die Polen drangekommen, darüber gibt es genügend Dokumente. Die am meisten gelitten haben, sind – Sie haben darauf angespielt – die Weißrussen. Ich war in Minsk und in Hatyn, also im anderen Katyn, sie haben ein Viertel der Bevölkerung verloren; es gibt zu Recht in Riga das Museum der Besatzungen – Plural –, denn sie wurden von beiden Seiten ausgeplündert, weggeschickt, in die Armee gezwungen, so dass sich zum Beispiel Litauer gegenüberstanden, die einen in der deutschen Armee, die anderen in der sowjetischen Armee – und für Minsk kommt natürlich noch der heutige Diktator plus Tschernobyl dazu, das ist wirklich viel für ein Volk. Ich glaube, es gibt in diesem Sinne auch andere Ausrottungen. Was ist für Sie der 11. September? Für mich ist er auch der 11. September 1973 in Santiago de Chile. Und die Zahl der Ermordeten in Argentinien und in Chile, sorgfältig ausgewählte Intellektuelle, auch in einer Kategorie des Volkes, also ein Klassenmord, hat viel, viel mehr Tote gezeitigt als das furchtbare Attentat in New York. Die Morde sind vollbracht worden mit Zustimmung und Ermunterung von Henry Kissinger, von dem ich nie gewusst habe, warum er den Friedensnobelpreis bekommen hat. Das war für mich so etwas wie eine Klassensäuberung, damit man Argentinien oder Chile besser beherrschen kann. Sie haben völlig Recht, dass man sich in dieser Hinsicht auch erinnern sollte. Ich hatte neulich die Ehre, zum Volkstrauertag auf Schloss Ehrenbreitstein für das deutsche Heer zu sprechen und die Trauerrede zu halten, eben weil ich Franzose bin, und da wird ein Text verlesen, der von Ihrem Bundespräsidenten auch immer verlesen wird: Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg und so weiter, wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Und ich glaube, man könnte jetzt wirklich noch mit Ihrem Buch hinzufügen, weil sie einer Klasse zugeschrieben wurden. Das fände ich auch völlig richtig, denn man kann darüber diskutieren, das müsste drin sein. Übrigens, Randbemerkung: Seit zwei Jahren steht noch etwas anderes Schönes drin: Wir gedenken heute auch derer, die bei uns Opfer durch Hass und Gewalt gegen Fremde geworden sind. Das ist ein sehr schöner Text, wie er in Russland nie formuliert werden wird, in der Türkei wahrscheinlich auch nicht.
Deswegen glaube ich sehr an eine kreative Erinnerung, und diese gibt es in Polen, wenn Sie das Denkmal sehen am Getto – nicht nur das große Denkmal, sondern jetzt das kleine Denkmal in Warschau – mit dem Kniefall von Willy Brandt. Und dieses Denkmal nehme ich immer als Beispiel für das, was eine kreative Erinnerung ist. Willy Brandt war gewiss an nichts mitschuldig – mit 19 Jahren floh er aus Deutschland als verfolgter Jungsozialist, als Kanzler der Bundesrepublik trug er auf seinen Schultern die Last der Vergangenheit. Nicht die Schuld der Vergangenheit, die Last der Vergangenheit und die Verantwortung für die Vergangenheit. Ich glaube kaum, dass es möglich sein wird, in Russland in absehbarer Zeit so jemanden zu haben. Es bleibt aber bei dem Willy-Brandt-Argument – da sollte auch Herr Steinmeier mehr daran denken und auch Frau Merkel und Herr Sarkozy –, dass die Beziehungen mit Russland in Polen, in Litauen, in Lettland, in Estland noch zu Recht von Angst geprägt sind. Und wenn wir zu 27 eine gemeinsame Außenpolitik machen wollen, muss diese Angst ein Teil unserer Außenpolitik sein. Es trifft sich, dass heute an die Türkei die Bedingung gestellt wird, die nicht an Putin gestellt wird. Die 27 haben der Türkei gesagt, eine der Bedingungen des Eintritts der Türkei ist die Anerkennung des Massenmords an Armeniern. Man könnte nach Moskau sagen, die Bedingung für freundschaftliche gute Beziehungen ist ein Blick auf die Vergangenheit. Und ein Zugeständnis zur Vergangenheit. In diesem Sinne finde ich, dass Sie in Ihrem Buch mit historischer und soziologischer Schärfe auch eine Grundlage, eine moralische Grundlage der Politik hervorgehoben haben, im Sinne einer Vergangenheit, die da sein soll, damit man eine Zukunft bedenken kann. Hier darf ich sagen, was mir in Deutschland sehr vorgeworfen wird, in Frankreich übrigens auch. Als der Bundespräsident im Februar 2005 vor der Knesset sprach, sagte er, die Konsequenz der nationalsozialistischen Vergangenheit sei, dass jeder Deutsche sich überall um die Würde des Menschen kümmern sollte. Ich habe dann in meinem Artikel beigefügt: Und er wusste, dass die Palästinenser auch Menschen sind. So darf ich Ihnen nun danken mit nicht gänzlichem Einverständnis mit der Grundthese, was natürlich wichtig ist, das heißt, dass es ein Zeichen der Ausrottung einer Klasse sein sollte – ich glaube, es war teilweise das, aber das Leiden der Polen muss umfassend gesehen werden, und Katyn ist ein Beispiel dafür, was Polen wirklich erlitten hat. Ich danke Ihnen für das, was Sie geleistet haben.
Das Massaker von Katyn, neu betrachtet
Einen so angesehenen Preis wie den »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken« zu erhalten, gehört zu den überraschendsten und glücklichsten Ereignissen meines Lebens als Wissenschaftler. Angesichts der Reihe herausragender Namen früherer Preisträger muss ich erst noch davon überzeugt werden, dass meine Klassensäuberung diese Auszeichnung verdient. Ich bin indes sehr erfreut, dass die Bundeszentrale für politische Bildung eine Sonderausgabe meines Buchs beim Wagenbach-Verlag in Auftrag gegeben hat, die an Schulbibliotheken, Lehrer und junge Menschen verteilt werden soll. Als historisch ausgerichteter Soziologe habe ich mir drei wesentliche Ziele gesetzt: erstens die historischen Einzelheiten und einige eindeutige und maßgebliche Dokumente vorzustellen, die die historischen Fakten belegen und die Täter des Massakers von Katyn unzweifelhaft identifizieren; zweitens das schwierigste und wichtigste Problem der Interpretation dieses Ereignisses in einen weitaus größeren Zusammenhang totalitärer Strategien und Methoden dessen zu stellen, was ich als »Klassensäuberung« bezeichne; und drittens schließlich zu erklären, wie eine derart massive Verfälschung über ein halbes Jahrhundert als »offizielle Version« der Geschichte Bestand haben konnte, verbreitet durch Wissenschaftler, Politiker und Lehrbücher, nicht nur im Ostblock, sondern auch im Westen.
Zu Beginn möchte ich erklären, was mich dazu veranlasste, mich mit dem Massaker von Katyn zu beschäftigen, und wie es in der Sowjetunion vor ihrem Untergang wahrgenommen wurde. Der Fall Katyn war in der Sowjetunion sowohl als eines der entsetzlichsten Verbrechen der Nazis bekannt als auch als Versuch von Goebbels’ Propagandaapparat, zwischen Russland und Polen Zwietracht zu säen. Unmittelbar nach der Befreiung der Gegend um Katyn errichtete die sowjetische Regierung ihre eigene Untersuchungskommission, bestehend aus Sowjetbürgern und angeführt vom Chefchirurgen der sowjetischen Armee, Nikolai Burdenko. Der Name der Kommission war zugleich ihr Zweck: »Spezialkommission zur Feststellung und Untersuchung der Umstände, die zur Erschießung der kriegsgefangenen polnischen Offiziere durch die faschistischen deutschen Eindringlinge im Wald von Katyn geführt haben«. Die vorhersehbaren Ergebnisse der Burdenko-Kommission wurden weithin bekannt gemacht, jedweden Zweifeln an ihrer Wahrhaftigkeit wurde mit Entrüstung begegnet. Die schlichte Tatsache, dass die Polen durch deutsche Kugeln getötet wurden, schien unwiderlegbarer Beweis zu sein. Während der größte Teil der sowjetischen Bevölkerung die offizielle Propaganda hinnahm, gab es zwei Gruppen, die sie anzweifelten. Viele russische Intellektuelle stellten diese Darstellung infrage, da sie sich darüber im Klaren waren, dass nicht nur das Nazi-Regime, sondern auch das stalinistische Regime zu einem Verbrechen dieses Ausmaßes fähig war. Die Tatsache, dass die sowjetische Regierung die Gegend um Katyn nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer »verbotenen Zone« erklärte und internationale Untersuchungen verweigerte, nährte ihren Verdacht. Dies wurde weithin als Indiz für die sowjetische Verstrickung in den Fall betrachtet. Studierende an den großen sowjetischen Universitäten bildeten einen weiteren Teil der sowjetischen Bevölkerung, der bereit war, die offizielle Propaganda infrage zu stellen. Hier kann meine persönliche Erfahrung dienlich sein. Ich gehöre einer Generation an, die als »Generation 1956« bekannt ist und diejenigen jungen Menschen umfasst, die 1956 zwischen 15 und 24 Jahre alt waren und deren politisches Erwachen in der Phase der Entstalinisierung begann. In jenen euphorischen Jahren begannen unsere Kommilitonen aus Polen, über das Massaker von Katyn zu sprechen. Sie hatten, wie die überwältigende Mehrheit der polnischen Bevölkerung, nie daran gezweifelt, dass die polnischen Offiziere von den Sowjets erschossen worden waren. Im Frühjahr 1956, kurze Zeit nach Chruschtschows so genannter Geheimrede auf dem 20. Parteitag der KPdSU, bestätigte er all die Gerüchte um den großen Terror und versprach weitere Enthüllungen. Eines Tages traf ich zusammen mit einigen Kommilitonen einen Militärverteidiger, der an der Arbeit der Burdenko-Kommission beteiligt gewesen war. Er erzählte uns, dass Spezialkommandos des sowjetischen Geheimdienstes die Polen ermordet hatten. Ich erinnere mich noch genau an seine Worte: »Das haben unsere getan.« Er erklärte uns auch, woher er das wusste: Die Leichen hatten noch immer Eheringe an den Fingern und Goldzähne. Während die SS den Befehl erhalten hatte, alles Gold von den Opfern zu entfernen, hatten die Spezialkommandos des NKWD keine solchen Anweisungen. Später diskutierten wir, warum dieser Anwalt, der ein Jahrzehnt lang geschwiegen hatte, plötzlich über die Arbeit der Kommission sprach und uns diese grauenvollen Details anvertraute. In diesem Klima, das neuerdings herrschte, in dem die Verbrechen des stalinistischen Regimes angeprangert wurden, sprachen die Menschen mit einer bislang unbekannten Offenheit über die Vergangenheit, und beinahe tagtäglich gab es neue Enthüllungen. Höchstwahrscheinlich war der Anwalt überzeugt, dass die Wahrheit über Katyn ohnehin bald auf die eine oder andere Art ans Licht kommen würde. Es schien der richtige Moment zu sein, um den Fall abzuschließen und ein neues Kapitel zu eröffnen. Die Massengräber von Katyn hätten dann der langen Liste von Verbrechen und Gräueltaten von Beria, seinen Komplizen und Stalin selbst hinzugefügt werden können. Dann marschierten die sowjetischen Truppen in Ungarn ein, und der Kurs der Entstalinisierung wurde gestoppt. Monate und Jahre vergingen, das Thema Katyn kam nie mehr zur Sprache. Erst in den letzten Jahren der Sowjetunion – während Gorbatschows Perestroika – wurde ein Teil des Archivmaterials über den Fall Katyn russischen und polnischen Historikern zugänglich gemacht. Die entscheidenden Dokumente kamen jedoch erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zum Vorschein.
I ch möchte an dieser Stelle nur zwei Dokumente erwähnen, die unter dem Aspekt, die Tatsachen und die Verantwortlichen zu ermitteln, ausreichend sind, um den Fall Katyn abzuschließen: den Brief an das Politbüro vom 2. März 1940, unterschrieben von Beria und Chruschtschow, und den Beschluss des Politbüros vom 5. März 1940. Der erste Brief ist ein entsetzliches Dokument, in dem Chruschtschow als Erster Sekretär der Kommunistischen Partei der Ukraine zusammen mit Beria die Deportation von fast 60 000 Angehörigen der polnischen Offiziere in abgelegene Regionen der Sowjetunion empfahl. Als einer von Stalins engsten Genossen trug auch Chruschtschow Verantwortung für das Massaker von Katyn und für weitere Verbrechen dieser Zeit. Man kann sicher davon ausgehen, dass es zahlreiche weitere Unterlagen gab, die Chruschtschows persönliche Verantwortung für die Klassensäuberung in Ostpolen belegen würden. Das verdeutlicht, warum in der Blütezeit von Chruschtschows Entstalinisierung der Fall Katyn niemals erwähnt wurde. Das zweite Dokument ist der Befehl des Politbüros vom 5. März 1940 an die Organe der NKWD, die Fälle der 25 700 polnischen Kriegsgefangenen (14 700 Gefangene der Lager von Kozielsk, Starobielsk und Ostaschkow und 11 000 weitere aus den Gefängnissen der westlichen Ukraine und des westlichen Weißrusslands) mit »speziellen Verfahren« zu bearbeiten, nämlich »ohne Vorladungen, Angaben von Beschuldigungen, Voruntersuchungen und ohne Anklage zu erheben« und sie zur Todesstrafe durch Erschießung zu verurteilen. In der Zeit des »Großen Terrors« 1937–38, als innerhalb von 14 Monaten etwa 800 000 Menschen zum Tode verurteilt wurden und etwa 350 000 bei Verhören starben, pflegten die Mitglieder des Politbüros zwei oder drei Unterschriften auf Anordnungen zu setzen, die die Erschießung von zigtausend Mitgliedern aus der Basis ihrer eigenen Partei zur Folge hatten, oder auf Befugnisse, die die Geheimpolizei ermächtigte, Hunderttausende einfacher sowjetischer Bürger zu erschießen. Der Fall der polnischen Kriegsgefangenen, Bürger eines anderen Staates, erforderte die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Politbüros, wobei die Anwesenden die Verantwortung wie in einem »Blutpakt« miteinander teilten. Die erste Seite von Berias vorläufigem Beschluss trägt die Unterschriften von J. W. Stalin, K. J. Woroschilow, W. M. Molotow und A. H. Mikojan. Zwei weitere Mitglieder, M. I. Kalinin und L. M. Kaganowitsch waren bei dem Treffen nicht anwesend, gaben jedoch später ihre Einwilligung. Warum taten diese sieben Männer das? Ein Historiker, der heute nach den Gründen für die Hinrichtung der polnischen Offiziere sucht, kann sich nicht mit psychologischen Erklärungen und der Berücksichtigung der nationalen Sicherheit zufriedengeben. Das Argument, dass kriminelle Methoden im Interesse der Sicherheit der Sowjetunion toleriert werden mussten, kann so nicht stehen gelassen werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Erschießung der polnischen Offiziere mit der Deportation ihrer Angehörigen – Frauen, Kinder und Alte – nach Kasachstan einherging, für einen Zeitraum von zehn Jahren (was für viele den sicheren Tod bedeutete) sowie mit der Konfiszierung ihres Eigentums. Dies zeigt, dass die nationale Sicherheit nur ein Aspekt für die Beschlüsse des Politbüros der KPdSU war, und nicht einmal der wichtigste. Wie Hannah Arendt scharfsinnig bemerkt hat: Totaler Terror, das Wesen totalitärer Herrschaft, »macht ihn zu einem unvergleichlichen Instrument, die Bewegung des Natur- oder des Geschichtsprozesses zu beschleunigen. ... Praktisch heißt dies, dass Terror die Todesurteile, welche die Natur angeblich über ›minderwertige Rassen‹ und ›lebensunfähige Individuen‹ oder die Geschichte über ›absterbende Klassen‹ und ›dekadente Völker‹ gesprochen hat, auf der Stelle vollstreckt, ohne den langsameren und unsicheren Vernichtungsprozess von Natur und Geschichte selbst abzuwarten.« Als Mitglieder der stalinistischen Führung den Befehl erteilten Tausende von Offizieren zu töten und Hunderttausende Bewohner Ostpolens zu deportieren, waren sie mit den rechtlichen Normen und Vorgehensweisen vertraut. Sie wussten, dass ihre Taten ihrer eigenen Verfassung und ihren eigenen Gesetzen zuwiderliefen. Dennoch betrachteten sie sich selbst nicht als Kriminelle, sondern vielmehr als Wohltäter der Menschheit, da sie doch lediglich den Lauf der Geschichte auf dem fortschreitenden Weg hin zu einer »perfekten Gesellschaft« beschleunigten. Die Geschichte hatte diese Gruppen bereits zum »sozialen Aussterben« verurteilt; die sowjetische Führung musste bloß ihren Teil dazu beitragen, um diese geschichtliche Entwicklung auf rationelle und systematische Weise zu beschleunigen.
Wenn wir darüber hinaus unseren Blick erweitern und untersuchen, was während der 20 Monate sowjetischer Besatzung in Ostpolen passiert ist, können wir mühelos erkennen, dass hinsichtlich des Ausmaßes an Unterdrückung der allgemeinen hilflosen Bevölkerung die Ermordung der polnischen Offiziere nur die Spitze des Eisbergs war. Russische Historiker, die mit der »Memorial Society« zusammenarbeiten, haben eine wichtige Untersuchung über die von den Polen erfahrene Unterdrückung veröffentlicht. Das Ausmaß und die Stärke der Unterdrückung können dadurch erklärt werden, dass der Kampf gegen »Klassenfeinde«, die Zerschlagung der »nationalistischen Konterrevolution«, die »Liquidierung der Kulaken-Klasse« und die Säuberung der Gebiete entlang der Staatsgrenze von »unzuverlässigen Elementen« – Operationen des stalinistischen Terrors, die sich in der Sowjetunion über mindestens 20 Jahre erstreckten – in Ostpolen auf eine Zeitspanne von weniger als zwei Jahren komprimiert waren. In nur 20 Monaten wurden mehr als 400 000 Menschen inhaftiert, deportiert oder erschossen. 1940 erfassten drei aufeinander folgende Deportationen das sowjetisch besetzte Ostpolen. Die Deportationen waren bis ins letzte Detail geplant. Jede Operation wurde im Laufe einer einzigen Nacht ausgeführt, so dass sich die Nachricht nicht verbreiten und die Betroffenen nicht fliehen oder sich verstecken konnten. Zusammen mit Tausenden von NKWDAgenten und Milizionären kamen Kommunisten und Mitglieder von regionalen kommunistischen Jugendorganisationen wie auch so genannte »lokale Aktivisten« bei der Identifizierung, Überwachung und Festnahme der Zielgruppen zum Einsatz. So berichtete der NKWD-Hauptverantwortliche für die Deportation aus einer der Regionen mit Befriedigung, dass von den annähernd 70 000 gelisteten Personen es nicht eine einzige geschafft hat zu entkommen. Ein wichtiger, zu diesem Erfolg beitragender Moment lag in der »besonders erfreulichen Tatsache«, dass die polnischen Kommunisten der Region mit großer persönlicher Hingabe ihrer Aufgabe nachgingen und auf die Hilfe von 15 000 »lokalen Aktivisten« zählen konnten. Sie waren außerdem ohne Frage motiviert durch die Tatsache, dass sie sich den Besitz der Deportierten aneignen konnten. Das Schicksal der Deportierten war schrecklich. In einem Bericht aus Sibirien nach Moskau heißt es: »Die hohe Sterblichkeit resultiert aus der Tatsache, dass die Deportierten das sibirische Klima nicht gewöhnt sind; die meisten haben keine geeignete Kleidung und kein festes Schuhwerk, was zu Fällen von Grippe und Erkältung mit tödlichem Ausgang führte. Die hohe Sterblichkeit wird auch durch eine unzureichende Ernährung verschärft, unter der vor allem Kinder und Ältere leiden.« 1941 wurden die Deportationen aus Ostpolen intensiviert, und diese Strategie beschränkte sich nicht länger allein auf Polen. Die Gebiete von Lettland, Estland, Litauen, Bessarabien und der nördlichen Bukowina, die unterdessen von der Sowjetunion annektiert worden waren, waren nun ebenfalls von Deportationen betroffen. Die letzte Deportation auf polnischem Gebiet begann in der Nacht des 20. Juni 1941, konnte aber aufgrund des Kriegsbeginns mit Deutschland nicht vollendet werden. Der Angriff der Deutschen auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 setzte den sowjetischen Deportationen ein Ende; jedoch nur, um den Weg für das Naziregime freizumachen, seinen Entwurf einer »vollkommenen Gesellschaft« zu verwirklichen, die auf die totale Vernichtung der Juden, Kommunisten, polnischen Intellektuellen und anderer abzielte. Vergleichende Untersuchungen über die Deportationen aus den von der Sowjetunion besetzten Gebieten nach dem Molotow-Ribbentrop-Pakt stehen noch am Anfang, sind aber von entscheidender Bedeutung, um die Wirkungsweise des totalitären sowjetischen Staates verstehen zu können. Eine vergleichende Analyse ermöglicht es mit großer Klarheit und einer Fülle von Daten, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar war, das gesamte Vorhaben der Führung der stalinistischen KPdSU zu erläutern.
Was für eine Art Vorfall war nun genau das Massaker von Katyn an den polnischen Kriegsgefangenen mitsamt den massiven Deportationen der wehrlosen Bevölkerung? Wie sollten diese Unterdrückungen von der Sozialwissenschaft eingeordnet, analysiert, verglichen werden? Es hat Ansätze gegeben, sie als Völkermord zu klassifizieren. Doch das Massaker von Katyn, auch wenn man es im größeren Zusammenhang des Schicksals Ostpolens unter sowjetischer Besatzung sieht, passt nicht zur Definition von Völkermord, wie sie von Raphael Lemkin eingeführt und von den Vereinten Nationen erweitert und kodifiziert wurde. Die ethnische Herkunft der Opfer spielte bei ihrer Auswahl keine besondere Rolle. Wir müssen uns mit den Tätern dieser Verbrechen befassen und begreifen, dass die Beteiligung der Polen selbst an der Organisation und Durchführung der Deportationen ihrer eigenen Landsleute massiv war. Also kann es kein Völkermord sein. Vielmehr war es ein Beispiel für »Klassizid«, um den Begriff von Michael Mann zu verwenden, oder, noch besser, für Klassensäuberung. Wie Hannah Arendt uns erinnert: »Die Einführung des Begriffs vom ›objektiven Gegner‹ ist für das Funktionieren totalitärer Regime wichtiger als die ideologisch festgelegte Bestimmung, wer der Gegner jeweils ist.« ... »Ihre Auswahl ist niemals vollkommen zufällig, ... Sie müssen als glaubhafte Gegner erscheinen.« Das Konzept des »objektiven Gegners« ist ein bezeichnendes Merkmal der totalitären Ideologie und der totalitären Geisteshaltung, die sie hervorrief. Sowohl die Anführer als auch die Basis der Bewegung teilten die Vorstellung einer von »Volksfeinden« bevölkerten Welt. Nikolai Semaschko, ein alter Bolschewik, der jahrelang sowjetischer Gesundheitsminister war, forderte einen klassenbasierten Ansatz in der Medizin: »Ein sowjetischer Arzt sollte einen klassenbasierten Ansatz haben. Einen Kulaken zu behandeln sollte nicht seine oberste Priorität sein.« Wanda Bartoszewicz, loyales Mitglied der Kommunistischen Partei Polens und der Komintern, die die Säuberungsaktionen des großen Terrors überlebte, wurde Ende 1941 in die Lager der polnischen Kriegsgefangenen geschickt, um über deren Gesinnungen zu berichten. Sie kehrte mit folgender Empfehlung zurück: »99 Prozent der Leute sind aus Gefängnissen, Lagern und dem Exil Entlassene«, schrieb sie. »Alle sind unverbesserliche Feinde der Sowjetunion und bereit, sich für das zu rächen, was ihnen angetan wurde. Nichts kann die Menschen, unter denen ich mich hier befinde, ändern; alles, was man tun kann, ist sie zu eliminieren.« Die »objektiven Gegner« sind Ungeziefer und sollten entsprechend behandelt werden. Das Konzept individueller Schuld existiert nicht. Massenterror, der auf der Idee beruht, die Gesellschaft von fremden und schädlichen Elementen zu säubern, von Parasiten (d.h. von denen, die zu einer Ethnie oder sozialen Klasse gehören, die als Feind angesehen wird), bildet den gemeinsamen Nenner der Nazi- und Sowjetregime. Von Anfang an haben beide Systeme das Ziel verfolgt, nicht nur ihre politischen Gegner zu eliminieren, sondern ganze gesellschaftliche Gruppierungen, verdammt durch ihre bloße Existenz: »objektive Gegner« und »Volksfeinde«. Die große Erkenntnis Hannah Arendts war genau das: Trotz aller offensichtlichen Unterschiede zwischen den totalitären Ideologien des Nazismus und des Stalinismus hinsichtlich ihrer Ursprünge, ihrer jeweiligen Strategien und ihrer Visionen von einer zukünftigen perfekten Gesellschaft gibt es eine Analyseebene, die Ähnlichkeiten und gemeinsame Merkmale hervortreten lässt, die noch bedeutsamer sind als die Unterschiede. Das ist es, was uns erlaubt, uns mit vergleichenden Studien über gänzlich verschiedene totalitäre Systeme zu beschäftigen. Heute ist die Institutionsanalyse, also die gründliche Erforschung der gesellschaftlichen Einrichtungen und der Politik totalitärer Systeme – ihrer regierenden Parteien, Einparteienstaat-Systeme, militärisch-industriellen Komplexe, repressiven Instrumente, der Zensur, Propagandaapparate und Konzentrationslager – die am weitesten entwickelte und am weitesten verbreitete Methode der vergleichenden Erforschung totalitärer Systeme. Die Politik der Klassensäuberung ist der Zwilling einer anderen, sehr viel älteren Politik der ethnischen Säuberung. Sie beide bilden die gemeinsame Charakteristik der politischen Linien von Hitlers und Stalins Regimes.
Die Morde von Katyn waren perfekt geplant und organisiert. Dasselbe gilt für das Verwischen der Spuren und das Fälschen der historischen Aufzeichnungen. Hierin liegt eine weitere Lektion des Massakers von Katyn, die das Problem einer »offiziellen Version« von Geschichte betrifft. Das Massaker von Katyn zu vertuschen und die Schuld den Nazis zuzuschreiben, wurde für Stalin zu einer regelrechten Obsession. Als zum Beispiel am 1. August 1944 in Warschau der polnische Aufstand gegen die deutsche Besatzung begann, waren die Sowjets nur wenige Kilometer entfernt, am östlichen Ufer der Weichsel. Als Anfang August ein Abgeordneter der polnischen Exilregierung nach Moskau reiste, um die Hilfe der Sowjets zu suchen, legte Stalin seine Bedingungen dar. Eine davon war, dass die sowjetischen Truppen nur dann in die Kampfhandlungen eingreifen würden, wenn die polnische Exilregierung in London öffentlich erklären würde, dass das Massaker an den polnischen Offizieren bei Katyn nicht von den Sowjets, sondern vielmehr von den Nazis begangen worden war. Stalin musste bestimmt gewusst haben, dass diese Bedingung absolut inakzeptabel sein würde, und vermutlich hat er sie nur gestellt, um seinen Gesprächspartner zu demütigen. Die stalinistische Propaganda betrieb eine breite Kampagne von Verfälschung und Täuschung, die vom Zutun westlicher Politiker und Historiker profitierte. Die Sowjets versuchten, die Schuld am Massaker den Deutschen zuzuschreiben. Nachdem sie bei den Nürnberger Prozessen mit ihrem Versuch gescheitert waren, die Nazis als die Schuldigen an Katyn hinzustellen, entwarfen sie ihre eigene »offizielle Version« der Geschehnisse, die im Ausland durch ihren gewaltigen Propagandaapparat verbreitet wurde sowie durch die Mobilisierung ihrer Anhänger und Sympathisanten im Westen, insbesondere in den kommunistischen Parteien. Eines der bemerkenswertesten Dokumente, das die Methoden veranschaulicht, mit denen die sowjetische Version der Ereignisse aufrechterhalten wurde, ist der Brief aus dem Jahre 1959 des Vorsitzenden des KGB, Alexander Schelepin, an Chruschtschow, in dem er um Erlaubnis bittet, etwa 22 000 Personalakten polnischer Kriegsgefangener vernichten zu dürfen, die nach Maßgabe des Beschlusses des Politbüros vom 5. März 1940 erschossen worden waren. Die Begründung des KGB-Vorsitzenden verdient eine genauere Betrachtung. Ich möchte einen Auszug aus dem Brief zitieren: »Sämtliche Unterlagen zu den 21 857 Fällen werden in einem versiegelten Raum aufbewahrt. Die Dokumente über die Vorgänge sind von keinerlei entscheidendem Interesse für die sowjetischen Organe, noch haben sie historischen Wert. Es ist unwahrscheinlich, dass sie für unsere polnischen Freunde wirklich von Interesse sind. Unvorhersehbare Umstände könnten jedoch zu einer Aufdeckung der Operation führen – mit allen unwillkommenen Konsequenzen für unser Land. Insbesondere was die im Wald von Katyn Erschossenen betrifft, gibt es eine offizielle Version der Geschehnisse.« Diese, so schreibt der KGB-Vorsitzende, ist 1944 von der Burdenko-Kommission festgelegt worden. Nach den Beschlüssen dieser Kommission wurden alle diese Polen von den deutschen Besatzern liquidiert. Diese Beschlüsse der Kommission, so Schelepin weiter, »sind fest im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit verankert«. Die beste Möglichkeit, diese offizielle Version zu erhalten, war, nach Schelepin, die kompromittierenden Unterlagen zu vernichten. Seine Empfehlung wurde vom Politbüro unterstützt, und so wurden die Dokumente über die Vergehen gegen die polnischen Gefangenen vernichtet. Der Brief des KGB-Vorsitzenden ist ein Paradebeispiel für die totalitäre Haltung gegenüber der historischen Wirklichkeit. George Orwell hat das mit beeindruckendem Scharfsinn erfasst: »Die von totalitären Staaten organisierten Lügen sind nicht, wie oft behauptet wird, vorübergehende Hilfsmittel wie etwa die Kriegslist bei militärischen Operationen. Es sind integrierende Bestandteile des Totalitarismus, etwas, was weiter bestehen wird, auch wenn Konzentrationslager und Geheimpolizei sich nicht mehr als notwendig erweisen würden. ... Totalitarismus benötigt eine unausgesetzte Abänderung der Vergangenheit und führt auf die Dauer zur Skepsis an einer objektiven Wahrheit.« Die Tricks und Kniffe der sowjetischen Regierung, die internationale öffentliche Meinung irrezuleiten, ihre Desinformationskampagnen, diplomatischen Proteste und wirtschaftlicher Druck sind im Großen und Ganzen nur allzu effektiv gewesen. Die Mitschuld und moralische Apathie vieler westlicher Staatsmänner und Intellektueller sollte ebenfalls nicht vergessen werden, ebenso wenig wie der fehlgeleitete Pragmatismus einiger westlicher Regierungen, die, um einer Supermacht gefällig zu sein, die sowjetische offizielle Version übernahmen und davon absahen, nach der Wahrheit zu suchen. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion wurden viele Historiker, die die sowjetische Darstellung zurückwiesen, verdächtigt, wenn nicht gar offen beschuldigt, die Verbrechen der Nazis herunterzuspielen oder gar zu leugnen. Warum also ist es heute, 70 Jahre nach den grauenvollen Ereignissen, notwendig, die Geschichte des Massakers von Katyn zu erzählen und wiederzuerzählen? Warum müssen wir die historischen Umstände, die Ursachen und Folgen untersuchen? An dieser Stelle möchte ich noch einmal Hannah Arendt zitieren, die in Menschen in finsteren Zeiten schrieb: »Sofern es überhaupt ein ›Bewältigen‹ der Vergangenheit gibt, besteht es in dem Nacherzählen dessen, was sich ereignet hat; aber auch dies Nacherzählen, das Geschichte formt, löst keine Probleme und beschwichtigt kein Leiden, es bewältigt nichts endgültig. Vielmehr regt es, solange der Sinn des Geschehens lebendig bleibt – und dies kann durch sehr lange Zeiträume der Fall sein – zu immer wiederholendem Erzählen an.« Im Fall von Katyn gibt es besonders zwingende Gründe, warum die Erinnerung daran wachgehalten werden muss. Zunächst vereinigt Katyn vieles, was für eine lange Zeit aus dem europäischen Bewusstsein verdrängt oder gelöscht worden ist. Jegliche Untersuchung des Massakers an den polnischen Offizieren müsste der Frage der geplanten Aufteilung Europas zwischen den beiden totalitären Regimes als Folge der geheimen Zusatzprotokolle des Molotow-Ribbentrop-Paktes nachgehen. Damit könnten die Historiker die beträchtliche Annäherung dieser Systeme zwischen 1937 und 1941 nicht länger ausklammern. Die enge deutschsowjetische Zusammenarbeit dieser Zeit war keinesfalls ein Zufall, sondern lag vielmehr in ihrem Kampf gegen einen gemeinsamen Feind begründet, in ihrem gemeinsamen Interesse an einer Aufteilung Europas und, wie Jewgenij Gnedin, ein enger Mitarbeiter des Außenministers Maxim Litwinow, sagte, in den »strukturellen Ähnlichkeiten« der jeweiligen Systeme Stalins und Hitlers. Die Unterlagen über den Fall von Katyn machen nur allzu deutlich, was das für strukturelle Ähnlichkeiten waren. Sie liefern konkrete Beweise für die grundlegende Verbindung der Regime von Hitler und Stalin, ihrer Funktionsweisen und Ideologien. Beide Systeme waren radikal, intolerant und »revolutionär«; beide befürworteten nicht nur die Anwendung von Gewalt, um eine »neue Gesellschaft« zu schaffen und den gemeinsamen Feind zu vernichten, sondern glorifizierten sie förmlich; beide vollzogen praktisch einen kompletten Bruch mit jedem juristischen Prinzip des internationalen Rechts und lehnten das Prinzip von individueller Schuld und Verantwortung ab. Wenn auch die diametral entgegengesetzten Ursprünge der nationalsozialistischen und der marxistisch-leninistischen Ideologie einen möglichen Ausgangspunkt für eine Konfrontation zwischen Nazismus und Stalinismus bildeten, so lag eine Allianz im Kampf gegen den gemeinsamen Feind – die Liberaldemokratie und die Sozialdemokratie – ebenfalls vollkommen im Bereich des Möglichen.
Die heutige Relevanz Katyns für die vergleichende Forschung zu Ereignissen wie Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen, Massenmorden, die euphemistisch als humanitäre Krisen bezeichnet werden, ist nicht zu bestreiten. Eines der typischen Merkmale verschiedener humanitärer Krisen ist eine massive Anstrengung seitens der Mörder, die historische Wahrheit zu verschleiern, die Opfer verantwortlich zu machen und die Zeugen zu verfolgen. Deshalb sollten Historiker, die heute versuchen, aus der Erfahrung von Katyn eine nützliche Lehre zu ziehen, über das tragische Schicksal einiger Mitglieder der internationalen medizinischen Kommission nachdenken, die schon 1943 ein klares Schuldurteil gegen die Sowjets gefällt hatten und später massivem politischem Druck und Repressionen ausgesetzt waren. Darüber hinaus stehen die Historiker heute vor der dringlichen Aufgabe zu erklären, warum demokratische Regierungen wie die von Großbritannien sowie große Teile der westlichen Öffentlichkeit, insbesondere westliche Historiker, im Angesicht der zynischen Lügen und Verfälschungen der Sowjetunion in Bezug auf den Fall Katyn ein halbes Jahrhundert lang peinliches Stillschweigen bewahrt haben. Ebenfalls notwendig ist es, die Beweggründe für das Verhalten des großen Reformers Gorbatschow zu verstehen, der sich hartnäckig weigerte, das entscheidende Beweisstück öffentlich zu machen, sogar bis zu dem Punkt, an dem seine eigene Regierung und seine eigene politische Zukunft auf dem Spiel standen. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass gerade Gorbatschow, der mehr als alle anderen dafür tat, den Zusammenbruch des sowjetischen Systems und die friedliche Auflösung der Sowjetunion zu erreichen, es versäumte, die Existenz der Originaldokumente des Molotow-Ribbentrop-Paktes und der Befehle zur Hinrichtung der polnischen Offiziere zu bestätigen. Gorbatschow war ein Mann des Parteiapparats; er brach niemals völlig mit den Regeln, den Verhaltensweisen und der Geisteshaltung eines Führers der KPdSU. Er hoffte, die führende Rolle der Kommunistischen Partei erhalten zu können und ihr zugleich demokratische Züge zu verleihen, die der Ideologie, den Traditionen, der Struktur und Organisation der Partei zutiefst fremd waren. Gorbatschow gelang es nie völlig, seine enge Verbindung zur marxistisch-leninistischen Ideologie zu lösen. Der widersprüchliche Charakter der Entstalinisierung, die von Chruschtschow eingeleitet und später von Gorbatschow fortgeführt wurde, führte zu einem eklatanten Widerspruch zwischen der Beurteilung des stalinistischen Vermächtnisses und Stalins Außenpolitik. Wie russische Historiker betont haben: »Millionen Opfer des Stalinismus erlebten einerseits die Verurteilung der politischen Praxis des Stalinismus und waren andererseits Zeugen der Wertschätzung von Stalins Leistung als marxistischer Staatsmann, der das Land in eine ›leuchtende kommunistische Zukunft‹ führte, erlebten also eine Idealisierung des totalitären stalinschen Systems.« Im heutigen Russland spiegelt sich dieser Widerspruch nicht nur in den neuen Geschichtslehrbüchern an den Schulen und Universitäten, sondern auch in der Arbeit seriöser Historiker wider. So bezog sich das maßgebliche russische Journal für Zeitgeschichte jüngst in seiner Einleitung zur Veröffentlichung wichtiger Dokumente – Protokolle von Stalins Treffen mit polnischen Stellvertretern in den Jahren 1943–44 – indirekt auf das Massaker von Katyn: »Die Hoffnungen, konstruktive sowjetisch-polnische Beziehungen erhalten zu können, schwanden, als die UdSSR ihre diplomatischen Beziehungen zur polnischen Exilregierung abbrach, da sie die polnische Reaktion auf die deutsche Information, nach der die Sowjets für das Massaker von Katyn verantwortlich seien, als beispiellose antisowjetische Kampagne auffasste.« Die Frage, ob die Informationen zum Massaker von Katyn wahr waren oder nicht, wird völlig vermieden, während die künstliche Entrüstung über »eine beispiellose anti-sowjetische Kampagne« als geschichtliche Rechtfertigung für Stalins Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur rechtmäßigen polnischen Regierung präsentiert wird.
Schließlich bedarf es deshalb weiterer Forschung zum Fall von Katyn, weil immer neue Informationen zur Vorbereitung und Ausführung des Massakers auftauchen. Am allerwichtigsten aber ist, dass für Tausende Verwandte, Freunde und Nachkommen der Opfer, die nie etwas über das Schicksal ihrer Lieben erfahren haben, das Massaker von Katyn längst nicht Geschichte ist, sondern Teil ihres täglichen Lebens. Die Opfer von Katyn wurden in nicht gekennzeichneten Massengräbern begraben und ihre Familien so jeder Möglichkeit beraubt, wenigstens ihre Gräber besuchen zu können. 1989 leitete die militärische Generalstaatsanwaltschaft eine Untersuchung des Massakers von Katyn ein, bezeichnet als Völkermord, ein Verbrechen, für das es keine Verjährungsfrist gibt. 2004, kurz vorm 65. Jahrestag des Massakers, stoppte der Militärgerichtshof der Russischen Föderation die Untersuchung mit der Begründung, dass das Massaker von Katyn nicht als Völkermord klassifiziert werden könne und die Handlungen des NKWD gegen polnische Bürger im Einklang mit dem damaligen Strafrecht gestanden hätten. Darüber hinaus erklärte der Militärgerichtshof, dass 36 von 183 Aktenbänden, die im Laufe der Untersuchungen gesammelt wurden, »Staatsgeheimnisse« enthielten und weitere 80 Informationen vertraulicher und geheimer Natur. Es wurden den Historikern von vornherein nur 67 der 183 Aktenbände, die von den militärischen Anklägern zusammengetragen wurden, zugänglich gemacht. Das russische Militärgericht erklärte jedoch, dass es in Erwägung ziehen würde, sich im Rahmen des russischen Föderationsrechts mit den Opfern von Katyn hinsichtlich der Rehabilitierung von Opfern politischer Verfolgung zu befassen. Die Entscheidung des Militärgerichtshofs, Dokumente zum Fall Katyn als »geheim« zu klassifizieren, verstärkte das öffentliche Misstrauen sowohl in Russland als auch international, dass hier in altbewährter Manier die Verbrechen des sowjetischen Regimes reingewaschen werden sollten. Das Gesetz der russischen Föderation zur Rehabilitierung der Opfer von politischer Verfolgung bedingt, dass das Verfahren zum Fall Katyn nicht geschlossen werden kann, ohne die Namen der Verantwortlichen zu ermitteln und öffentlich zu machen, sowohl die von den Anstiftern als auch von den Organisatoren und Tätern auf allen Ebenen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden die Organisatoren und diejenigen, die deren Befehle ausführten, identifiziert. Trotzdem ist – während westliche Staaten damit fortfahren, die Verbrechen der Nazis zu ermitteln und zu bestrafen – in Russland nicht ein einziger Mörder einem Richter vorgeführt, noch ist eine polizeiliche Ermittlung überhaupt in die Wege geleitet worden. Verwandte und Nachkommen der Opfer des Massakers von Katyn haben einen Rechtsstreit zur Rehabilitierung der Opfer begonnen. Sie werden von der »Memorial Society« unterstützt, einer Gesellschaft russischer und ausländischer Historiker, die sich mit der sowjetischen Geschichte, insbesondere mit deren verborgenen Seiten, beschäftigt. Im Januar 2006 erhielt die Witwe eines 1940 bei Katyn erschossenen Offiziers, die die offizielle Rehabilitierung ihres Mannes gefordert hatte, von der Staatsanwaltschaft die folgende Abfuhr: Weder ihr Ehemann noch die anderen Offiziere könnten rehabilitiert werden, weil »das Rehabilitationsgesetz nur für die Opfer staatlicher Repression gilt. Während des Ermittlungsverfahrens stellte sich jedoch heraus, dass selbst der Paragraph des russischen Strafgesetzbuches von 1926, der angewandt wurde, um polnische Offiziere zu verurteilen, nicht ermittelt werden konnte, weil alle relevanten Dokumente zerstört worden waren.« Das ist nichts als bürokratische Verachtung und ein Hohn auf die Gerechtigkeit. Der russische Oberste Gerichtshof hat kürzlich unter dem Druck der orthodoxen Kirche Zar Nikolaus II. und seine Familie rehabilitiert, die 1918 erschossen worden waren, ohne sich auf die Paragraphen des Strafgesetzbuches zu beziehen, anhand derer sie verurteilt worden waren. Als aber im Mai 2008 Verwandte der Opfer versuchten, die Entscheidung anzufechten, die Untersuchungen zu Katyn einzustellen, lehnte der Moskauer Gerichtshof es mit der Begründung ab, den Fall zu überdenken, dass das Material Staatsgeheimnisse enthalte. Nun legt die »Memorial Society« beim Internationalen Gerichtshof in Straßburg Berufung ein. Der Rechtsstreit geht weiter, während die Generation, die die Ereignisse durchlebt hat, von der Bildfläche verschwindet. Wie der Vorsitzende der »Memorial Society«, Arseni Roginski, zu Recht betont, hängen sowohl Russlands Gegenwart als auch Zukunft davon ab, die Vergangenheit zu bewältigen, das heißt, es bedarf einer ehrlichen und umfassenden Analyse des sowjetischen Massenterrors. Diese Schlussfolgerung sollte auf ganz Europa (und darüber hinaus) ausgedehnt werden. Deutsche Übersetzung von Ute Szczepanski.
Wir blicken inzwischen auf eine ansehnliche Reihe von Preisträgerinnen und Preisträgern zurück, von denen ich Ihnen nur einige der letzten Jahre ins Gedächtnis rufe: Jelena Bonner (2000), Ernst-Wolfgang Böckenförde (2004), Julia Kristeva (2006), Tony Judt (2007). Der Preis wird von einer internationalen Jury vergeben. In Anlehnung an eine Tradition, für die Hannah Arendt als herausragende öffentliche Intellektuelle steht, sucht die Jury nach Preisträgerinnen und Preisträgern, die mit dem, wofür sie stehen, jenes Aufmerken wachrufen, von dem die öffentliche politische Debatte zehrt – jenes Unerwartete, das innehalten lässt, das Staunen hervorruft und natürlich auch Widerspruch. Die Jury hat mit Victor Zaslavsky eine Persönlichkeit gewählt, die diese Aufmerksamkeit hervorruft für den Bericht über ein Verbrechen und seine Vertuschung. Victor Zaslavskys Buch über Das Massaker von Katyn erzählt eine Geschichte, die den Eingeweihten seit vielen Jahrzehnten bekannt ist: der Mord an über zwanzigtausend polnischen Offizieren und Soldaten im Wald von Katyn und an anderen Orten durch russische Sicherheitskräfte. In Polen gibt es seit dem letzten Jahr einen Film des berühmten Regisseurs Andrzej Wajda, dessen Vater dem Verbrechen zum Opfer fiel, über Katyn, nach einem Buch von Andrzej Mularczyk. Das Besondere an Victor Zaslavskys Geschichte ist aber, dass er aus der russischen Perspektive erzählt. Im Zentrum seines Buches steht die Frage, warum die sowjetische Propaganda, wonach der Massenmord an den polnischen Offizieren eine Schandtat der deutschen Nationalsozialisten und ihrer Armeen war, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem XX. Parteitag und selbst noch unter den Präsidenten nach Gorbatschow aufrechterhalten wurde. Zaslavsky folgt den Spuren dieser Lüge. Das Besondere an seiner Geschichte ist nicht nur die Erzählung der Fakten, also des Verbrechens und seiner Vertuschung, sondern auch die Infragestellung der nationalen Geschichtspolitik Russlands, deren Administratoren an einer gründlichen Aufarbeitung der Verbrechen unter der Sowjetherrschaft nicht interessiert zu sein scheinen. Zaslavskys Erzählung weist auf einen weiteren Kontext hin. Katyn lag lange in einem toten Winkel der europäischen Geschichte, ein Massenmord, geschehen im Nirgendwo eines Irgendwo in Russland. Und doch ist das Verbrechen ein zentrales Ereignis der jüngeren europäischen Geschichte. Das Verbrechen wäre vermutlich nicht geschehen, wenn es nicht vorher den Hitler-StalinPakt samt dem anhängenden Geheimprotokoll über die Aufteilung Polens zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion gegeben hätte. Das Ereignis berührt also die sowjetische, die polnische und die deutsche Geschichte – nicht zu vergessen die der damaligen Westalliierten, die, obwohl sie Polen Schutz versprochen hatten, das Verbrechen aus taktischen Gründen totgeschwiegen haben und dieses Schweigen nie offiziell zurückgenommen haben. Insofern deckt Zaslavskys Erzählung eine europäische Schandtat auf, an der viele mittelbar und unmittelbar beteiligt waren. Aus einer politischen Perspektive betrachtet, gehören das Ereignis und seine Nachgeschichte zu jenen herausragenden Akten der Zerstörung und Selbstzerstörung, durch die die europäischen Länder in den Jahren zwischen 1933 und 1945 gegangen sind. In ihrem Bericht über den Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961 prägte Hannah Arendt das Wort von der »Totalität des moralischen Zusammenbruchs«, den die Nationalsozialisten in allen Ländern Europas verursacht hätten. Katyn steht in einem erweiterten Sinne ebenfalls für einen moralischen Zusammenbruch des Westens und seine Folgen, die bis heute andauern. Daher kann die Erinnerung an Katyn auch kein nationales Eigentum sein, wenngleich Polen bis heute das Land ist, in dem am meisten daran gedacht wird. Katyn verweist darauf, dass in Europa nationale Erinnerungen nur ein Teil der Erinnerung sein können. Die Erinnerung an Katyn gehört allen, ebenso wie die Erinnerung an andere Massenmorde in der Sowjetunion oder in Deutschland, in Tschechien oder Italien oder Spanien. Es gibt kein europäisches Land, das nicht in diesen Strudel der Verbrechen, inszeniert von den zwei totalitären Supermächten und ihren Helfern, gerissen worden wäre. Und es gibt kein Land, in dem nicht die Bilder der nationalen Identität mit der Erinnerung an stattgefundene oder begangene Verbrechen kollidieren. Europäische Erinnerung kann vor diesem Hintergrund nur heißen, alle Geschichten ohne Rücksichtnahme auf nationale Glorie zu erzählen, auch die bedrückenden, die nie hätten geschehen dürfen. Victor Zaslavskys Buch handelt vom gewalttätigen Verschweigen dieser Erinnerungserzählungen. Oder um es anders auszudrücken: Sein Buch erzählt von der Aneignung der Erzählungen der Völker durch totale Herrschaftssysteme und organisierte Propagandalügen. Diese Erzählungen fallen offensichtlich nach dem Ende der totalen Herrschaft nicht von selbst zurück in den Bereich der Wahrheit, sondern sie wollen ausgegraben werden. Das hat Victor Zaslavsky am Beispiel Katyn gemacht. Die Jury hat Victor Zaslavsky den diesjährigen Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken verliehen, weil er nicht nur ein mutiges Buch geschrieben hat, sondern auch der europäischen Erinnerungskultur damit einen großen Dienst erwiesen hat, indem er eine fragmentierte Geschichte fortschreibt, sie vervollständigt, so wie es viele andere in der Zukunft weiterhin tun müssen ... So weit die Begründung der Jury. Wie immer wieder an dieser Stelle möchten wir den Geldgebern herzlich danken: der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bremer Senat, die die Preisvergabe seit nunmehr 14 Jahren tragen und festliche Abende wie diesen auch in krisenhaften Zeiten wie den unseren ermöglichen. Großer Dank gilt an dieser Stelle wie immer der Jury und dem Kreis der Kollegen und Kolleginnen aus Vorstand und Mitgliederversammlung. Stellvertretend nenne ich Peter Rüdel und Eva Senghaas.
Lassen sie mich noch ein Wort hinzufügen. Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken hatte seinerzeit etliche Mit-Gründer. Einer der wichtigsten Ideengeber war über die Jahre Zoltan Szankay, der Anfang des Jahres plötzlich verstorben ist. Zoltan Szankay hat erheblich zur Erkennbarkeit dieses Preises in der deutschen Preislandschaft beigetragen. Er hat stets hartnäckig und manchmal stur eingefordert, dass der Preis nicht im Ritual erstarren dürfe, nicht einfach nur Zeichen der Anerkennung für eine Leistung sein solle, dass in jeder Preisvergabe die Auseinandersetzung um das Politische sichtbar werden müsste. Das Desiderat der Erneuerung, der Überraschung, des Ungewohnten aufrechtzuerhalten, darin liegt, denke ich, eine angemessene Form des Andenkens an Zoltan Szankay.
Victor Zaslavsky (†), Ingenieur und Soziologe, lehrte Politische Soziologie in Rom

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Das Massaker von Katyn, neu betrachtet
Einen so angesehenen Preis wie den »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken« zu erhalten, gehört zu den überraschendsten und glücklichsten Ereignissen meines Lebens als Wissenschaftler. Angesichts der Reihe herausragender Namen früherer Preisträger muss ich erst noch davon überzeugt werden, dass meine Klassensäuberung diese Auszeichnung verdient. Ich bin indes sehr erfreut, dass die Bundeszentrale für politische Bildung eine Sonderausgabe meines Buchs beim Wagenbach-Verlag in Auftrag gegeben hat, die an Schulbibliotheken, Lehrer und junge Menschen verteilt werden soll. Als historisch ausgerichteter Soziologe habe ich mir drei wesentliche Ziele gesetzt: erstens die historischen Einzelheiten und einige eindeutige und maßgebliche Dokumente vorzustellen, die die historischen Fakten belegen und die Täter des Massakers von Katyn unzweifelhaft identifizieren; zweitens das schwierigste und wichtigste Problem der Interpretation dieses Ereignisses in einen weitaus größeren Zusammenhang totalitärer Strategien und Methoden dessen zu stellen, was ich als »Klassensäuberung« bezeichne; und drittens schließlich zu erklären, wie eine derart massive Verfälschung über ein halbes Jahrhundert als »offizielle Version« der Geschichte Bestand haben konnte, verbreitet durch Wissenschaftler, Politiker und Lehrbücher, nicht nur im Ostblock, sondern auch im Westen.
Zu Beginn möchte ich erklären, was mich dazu veranlasste, mich mit dem Massaker von Katyn zu beschäftigen, und wie es in der Sowjetunion vor ihrem Untergang wahrgenommen wurde. Der Fall Katyn war in der Sowjetunion sowohl als eines der entsetzlichsten Verbrechen der Nazis bekannt als auch als Versuch von Goebbels’ Propagandaapparat, zwischen Russland und Polen Zwietracht zu säen. Unmittelbar nach der Befreiung der Gegend um Katyn errichtete die sowjetische Regierung ihre eigene Untersuchungskommission, bestehend aus Sowjetbürgern und angeführt vom Chefchirurgen der sowjetischen Armee, Nikolai Burdenko. Der Name der Kommission war zugleich ihr Zweck: »Spezialkommission zur Feststellung und Untersuchung der Umstände, die zur Erschießung der kriegsgefangenen polnischen Offiziere durch die faschistischen deutschen Eindringlinge im Wald von Katyn geführt haben«. Die vorhersehbaren Ergebnisse der Burdenko-Kommission wurden weithin bekannt gemacht, jedweden Zweifeln an ihrer Wahrhaftigkeit wurde mit Entrüstung begegnet. Die schlichte Tatsache, dass die Polen durch deutsche Kugeln getötet wurden, schien unwiderlegbarer Beweis zu sein. Während der größte Teil der sowjetischen Bevölkerung die offizielle Propaganda hinnahm, gab es zwei Gruppen, die sie anzweifelten. Viele russische Intellektuelle stellten diese Darstellung infrage, da sie sich darüber im Klaren waren, dass nicht nur das Nazi-Regime, sondern auch das stalinistische Regime zu einem Verbrechen dieses Ausmaßes fähig war. Die Tatsache, dass die sowjetische Regierung die Gegend um Katyn nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer »verbotenen Zone« erklärte und internationale Untersuchungen verweigerte, nährte ihren Verdacht. Dies wurde weithin als Indiz für die sowjetische Verstrickung in den Fall betrachtet. Studierende an den großen sowjetischen Universitäten bildeten einen weiteren Teil der sowjetischen Bevölkerung, der bereit war, die offizielle Propaganda infrage zu stellen. Hier kann meine persönliche Erfahrung dienlich sein. Ich gehöre einer Generation an, die als »Generation 1956« bekannt ist und diejenigen jungen Menschen umfasst, die 1956 zwischen 15 und 24 Jahre alt waren und deren politisches Erwachen in der Phase der Entstalinisierung begann. In jenen euphorischen Jahren begannen unsere Kommilitonen aus Polen, über das Massaker von Katyn zu sprechen. Sie hatten, wie die überwältigende Mehrheit der polnischen Bevölkerung, nie daran gezweifelt, dass die polnischen Offiziere von den Sowjets erschossen worden waren. Im Frühjahr 1956, kurze Zeit nach Chruschtschows so genannter Geheimrede auf dem 20. Parteitag der KPdSU, bestätigte er all die Gerüchte um den großen Terror und versprach weitere Enthüllungen. Eines Tages traf ich zusammen mit einigen Kommilitonen einen Militärverteidiger, der an der Arbeit der Burdenko-Kommission beteiligt gewesen war. Er erzählte uns, dass Spezialkommandos des sowjetischen Geheimdienstes die Polen ermordet hatten. Ich erinnere mich noch genau an seine Worte: »Das haben unsere getan.« Er erklärte uns auch, woher er das wusste: Die Leichen hatten noch immer Eheringe an den Fingern und Goldzähne. Während die SS den Befehl erhalten hatte, alles Gold von den Opfern zu entfernen, hatten die Spezialkommandos des NKWD keine solchen Anweisungen. Später diskutierten wir, warum dieser Anwalt, der ein Jahrzehnt lang geschwiegen hatte, plötzlich über die Arbeit der Kommission sprach und uns diese grauenvollen Details anvertraute. In diesem Klima, das neuerdings herrschte, in dem die Verbrechen des stalinistischen Regimes angeprangert wurden, sprachen die Menschen mit einer bislang unbekannten Offenheit über die Vergangenheit, und beinahe tagtäglich gab es neue Enthüllungen. Höchstwahrscheinlich war der Anwalt überzeugt, dass die Wahrheit über Katyn ohnehin bald auf die eine oder andere Art ans Licht kommen würde. Es schien der richtige Moment zu sein, um den Fall abzuschließen und ein neues Kapitel zu eröffnen. Die Massengräber von Katyn hätten dann der langen Liste von Verbrechen und Gräueltaten von Beria, seinen Komplizen und Stalin selbst hinzugefügt werden können. Dann marschierten die sowjetischen Truppen in Ungarn ein, und der Kurs der Entstalinisierung wurde gestoppt. Monate und Jahre vergingen, das Thema Katyn kam nie mehr zur Sprache. Erst in den letzten Jahren der Sowjetunion – während Gorbatschows Perestroika – wurde ein Teil des Archivmaterials über den Fall Katyn russischen und polnischen Historikern zugänglich gemacht. Die entscheidenden Dokumente kamen jedoch erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zum Vorschein.
I ch möchte an dieser Stelle nur zwei Dokumente erwähnen, die unter dem Aspekt, die Tatsachen und die Verantwortlichen zu ermitteln, ausreichend sind, um den Fall Katyn abzuschließen: den Brief an das Politbüro vom 2. März 1940, unterschrieben von Beria und Chruschtschow, und den Beschluss des Politbüros vom 5. März 1940. Der erste Brief ist ein entsetzliches Dokument, in dem Chruschtschow als Erster Sekretär der Kommunistischen Partei der Ukraine zusammen mit Beria die Deportation von fast 60 000 Angehörigen der polnischen Offiziere in abgelegene Regionen der Sowjetunion empfahl. Als einer von Stalins engsten Genossen trug auch Chruschtschow Verantwortung für das Massaker von Katyn und für weitere Verbrechen dieser Zeit. Man kann sicher davon ausgehen, dass es zahlreiche weitere Unterlagen gab, die Chruschtschows persönliche Verantwortung für die Klassensäuberung in Ostpolen belegen würden. Das verdeutlicht, warum in der Blütezeit von Chruschtschows Entstalinisierung der Fall Katyn niemals erwähnt wurde. Das zweite Dokument ist der Befehl des Politbüros vom 5. März 1940 an die Organe der NKWD, die Fälle der 25 700 polnischen Kriegsgefangenen (14 700 Gefangene der Lager von Kozielsk, Starobielsk und Ostaschkow und 11 000 weitere aus den Gefängnissen der westlichen Ukraine und des westlichen Weißrusslands) mit »speziellen Verfahren« zu bearbeiten, nämlich »ohne Vorladungen, Angaben von Beschuldigungen, Voruntersuchungen und ohne Anklage zu erheben« und sie zur Todesstrafe durch Erschießung zu verurteilen. In der Zeit des »Großen Terrors« 1937–38, als innerhalb von 14 Monaten etwa 800 000 Menschen zum Tode verurteilt wurden und etwa 350 000 bei Verhören starben, pflegten die Mitglieder des Politbüros zwei oder drei Unterschriften auf Anordnungen zu setzen, die die Erschießung von zigtausend Mitgliedern aus der Basis ihrer eigenen Partei zur Folge hatten, oder auf Befugnisse, die die Geheimpolizei ermächtigte, Hunderttausende einfacher sowjetischer Bürger zu erschießen. Der Fall der polnischen Kriegsgefangenen, Bürger eines anderen Staates, erforderte die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Politbüros, wobei die Anwesenden die Verantwortung wie in einem »Blutpakt« miteinander teilten. Die erste Seite von Berias vorläufigem Beschluss trägt die Unterschriften von J. W. Stalin, K. J. Woroschilow, W. M. Molotow und A. H. Mikojan. Zwei weitere Mitglieder, M. I. Kalinin und L. M. Kaganowitsch waren bei dem Treffen nicht anwesend, gaben jedoch später ihre Einwilligung. Warum taten diese sieben Männer das? Ein Historiker, der heute nach den Gründen für die Hinrichtung der polnischen Offiziere sucht, kann sich nicht mit psychologischen Erklärungen und der Berücksichtigung der nationalen Sicherheit zufriedengeben. Das Argument, dass kriminelle Methoden im Interesse der Sicherheit der Sowjetunion toleriert werden mussten, kann so nicht stehen gelassen werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Erschießung der polnischen Offiziere mit der Deportation ihrer Angehörigen – Frauen, Kinder und Alte – nach Kasachstan einherging, für einen Zeitraum von zehn Jahren (was für viele den sicheren Tod bedeutete) sowie mit der Konfiszierung ihres Eigentums. Dies zeigt, dass die nationale Sicherheit nur ein Aspekt für die Beschlüsse des Politbüros der KPdSU war, und nicht einmal der wichtigste. Wie Hannah Arendt scharfsinnig bemerkt hat: Totaler Terror, das Wesen totalitärer Herrschaft, »macht ihn zu einem unvergleichlichen Instrument, die Bewegung des Natur- oder des Geschichtsprozesses zu beschleunigen. ... Praktisch heißt dies, dass Terror die Todesurteile, welche die Natur angeblich über ›minderwertige Rassen‹ und ›lebensunfähige Individuen‹ oder die Geschichte über ›absterbende Klassen‹ und ›dekadente Völker‹ gesprochen hat, auf der Stelle vollstreckt, ohne den langsameren und unsicheren Vernichtungsprozess von Natur und Geschichte selbst abzuwarten.« Als Mitglieder der stalinistischen Führung den Befehl erteilten Tausende von Offizieren zu töten und Hunderttausende Bewohner Ostpolens zu deportieren, waren sie mit den rechtlichen Normen und Vorgehensweisen vertraut. Sie wussten, dass ihre Taten ihrer eigenen Verfassung und ihren eigenen Gesetzen zuwiderliefen. Dennoch betrachteten sie sich selbst nicht als Kriminelle, sondern vielmehr als Wohltäter der Menschheit, da sie doch lediglich den Lauf der Geschichte auf dem fortschreitenden Weg hin zu einer »perfekten Gesellschaft« beschleunigten. Die Geschichte hatte diese Gruppen bereits zum »sozialen Aussterben« verurteilt; die sowjetische Führung musste bloß ihren Teil dazu beitragen, um diese geschichtliche Entwicklung auf rationelle und systematische Weise zu beschleunigen.
Wenn wir darüber hinaus unseren Blick erweitern und untersuchen, was während der 20 Monate sowjetischer Besatzung in Ostpolen passiert ist, können wir mühelos erkennen, dass hinsichtlich des Ausmaßes an Unterdrückung der allgemeinen hilflosen Bevölkerung die Ermordung der polnischen Offiziere nur die Spitze des Eisbergs war. Russische Historiker, die mit der »Memorial Society« zusammenarbeiten, haben eine wichtige Untersuchung über die von den Polen erfahrene Unterdrückung veröffentlicht. Das Ausmaß und die Stärke der Unterdrückung können dadurch erklärt werden, dass der Kampf gegen »Klassenfeinde«, die Zerschlagung der »nationalistischen Konterrevolution«, die »Liquidierung der Kulaken-Klasse« und die Säuberung der Gebiete entlang der Staatsgrenze von »unzuverlässigen Elementen« – Operationen des stalinistischen Terrors, die sich in der Sowjetunion über mindestens 20 Jahre erstreckten – in Ostpolen auf eine Zeitspanne von weniger als zwei Jahren komprimiert waren. In nur 20 Monaten wurden mehr als 400 000 Menschen inhaftiert, deportiert oder erschossen. 1940 erfassten drei aufeinander folgende Deportationen das sowjetisch besetzte Ostpolen. Die Deportationen waren bis ins letzte Detail geplant. Jede Operation wurde im Laufe einer einzigen Nacht ausgeführt, so dass sich die Nachricht nicht verbreiten und die Betroffenen nicht fliehen oder sich verstecken konnten. Zusammen mit Tausenden von NKWDAgenten und Milizionären kamen Kommunisten und Mitglieder von regionalen kommunistischen Jugendorganisationen wie auch so genannte »lokale Aktivisten« bei der Identifizierung, Überwachung und Festnahme der Zielgruppen zum Einsatz. So berichtete der NKWD-Hauptverantwortliche für die Deportation aus einer der Regionen mit Befriedigung, dass von den annähernd 70 000 gelisteten Personen es nicht eine einzige geschafft hat zu entkommen. Ein wichtiger, zu diesem Erfolg beitragender Moment lag in der »besonders erfreulichen Tatsache«, dass die polnischen Kommunisten der Region mit großer persönlicher Hingabe ihrer Aufgabe nachgingen und auf die Hilfe von 15 000 »lokalen Aktivisten« zählen konnten. Sie waren außerdem ohne Frage motiviert durch die Tatsache, dass sie sich den Besitz der Deportierten aneignen konnten. Das Schicksal der Deportierten war schrecklich. In einem Bericht aus Sibirien nach Moskau heißt es: »Die hohe Sterblichkeit resultiert aus der Tatsache, dass die Deportierten das sibirische Klima nicht gewöhnt sind; die meisten haben keine geeignete Kleidung und kein festes Schuhwerk, was zu Fällen von Grippe und Erkältung mit tödlichem Ausgang führte. Die hohe Sterblichkeit wird auch durch eine unzureichende Ernährung verschärft, unter der vor allem Kinder und Ältere leiden.« 1941 wurden die Deportationen aus Ostpolen intensiviert, und diese Strategie beschränkte sich nicht länger allein auf Polen. Die Gebiete von Lettland, Estland, Litauen, Bessarabien und der nördlichen Bukowina, die unterdessen von der Sowjetunion annektiert worden waren, waren nun ebenfalls von Deportationen betroffen. Die letzte Deportation auf polnischem Gebiet begann in der Nacht des 20. Juni 1941, konnte aber aufgrund des Kriegsbeginns mit Deutschland nicht vollendet werden. Der Angriff der Deutschen auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 setzte den sowjetischen Deportationen ein Ende; jedoch nur, um den Weg für das Naziregime freizumachen, seinen Entwurf einer »vollkommenen Gesellschaft« zu verwirklichen, die auf die totale Vernichtung der Juden, Kommunisten, polnischen Intellektuellen und anderer abzielte. Vergleichende Untersuchungen über die Deportationen aus den von der Sowjetunion besetzten Gebieten nach dem Molotow-Ribbentrop-Pakt stehen noch am Anfang, sind aber von entscheidender Bedeutung, um die Wirkungsweise des totalitären sowjetischen Staates verstehen zu können. Eine vergleichende Analyse ermöglicht es mit großer Klarheit und einer Fülle von Daten, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar war, das gesamte Vorhaben der Führung der stalinistischen KPdSU zu erläutern.
Was für eine Art Vorfall war nun genau das Massaker von Katyn an den polnischen Kriegsgefangenen mitsamt den massiven Deportationen der wehrlosen Bevölkerung? Wie sollten diese Unterdrückungen von der Sozialwissenschaft eingeordnet, analysiert, verglichen werden? Es hat Ansätze gegeben, sie als Völkermord zu klassifizieren. Doch das Massaker von Katyn, auch wenn man es im größeren Zusammenhang des Schicksals Ostpolens unter sowjetischer Besatzung sieht, passt nicht zur Definition von Völkermord, wie sie von Raphael Lemkin eingeführt und von den Vereinten Nationen erweitert und kodifiziert wurde. Die ethnische Herkunft der Opfer spielte bei ihrer Auswahl keine besondere Rolle. Wir müssen uns mit den Tätern dieser Verbrechen befassen und begreifen, dass die Beteiligung der Polen selbst an der Organisation und Durchführung der Deportationen ihrer eigenen Landsleute massiv war. Also kann es kein Völkermord sein. Vielmehr war es ein Beispiel für »Klassizid«, um den Begriff von Michael Mann zu verwenden, oder, noch besser, für Klassensäuberung. Wie Hannah Arendt uns erinnert: »Die Einführung des Begriffs vom ›objektiven Gegner‹ ist für das Funktionieren totalitärer Regime wichtiger als die ideologisch festgelegte Bestimmung, wer der Gegner jeweils ist.« ... »Ihre Auswahl ist niemals vollkommen zufällig, ... Sie müssen als glaubhafte Gegner erscheinen.« Das Konzept des »objektiven Gegners« ist ein bezeichnendes Merkmal der totalitären Ideologie und der totalitären Geisteshaltung, die sie hervorrief. Sowohl die Anführer als auch die Basis der Bewegung teilten die Vorstellung einer von »Volksfeinden« bevölkerten Welt. Nikolai Semaschko, ein alter Bolschewik, der jahrelang sowjetischer Gesundheitsminister war, forderte einen klassenbasierten Ansatz in der Medizin: »Ein sowjetischer Arzt sollte einen klassenbasierten Ansatz haben. Einen Kulaken zu behandeln sollte nicht seine oberste Priorität sein.« Wanda Bartoszewicz, loyales Mitglied der Kommunistischen Partei Polens und der Komintern, die die Säuberungsaktionen des großen Terrors überlebte, wurde Ende 1941 in die Lager der polnischen Kriegsgefangenen geschickt, um über deren Gesinnungen zu berichten. Sie kehrte mit folgender Empfehlung zurück: »99 Prozent der Leute sind aus Gefängnissen, Lagern und dem Exil Entlassene«, schrieb sie. »Alle sind unverbesserliche Feinde der Sowjetunion und bereit, sich für das zu rächen, was ihnen angetan wurde. Nichts kann die Menschen, unter denen ich mich hier befinde, ändern; alles, was man tun kann, ist sie zu eliminieren.« Die »objektiven Gegner« sind Ungeziefer und sollten entsprechend behandelt werden. Das Konzept individueller Schuld existiert nicht. Massenterror, der auf der Idee beruht, die Gesellschaft von fremden und schädlichen Elementen zu säubern, von Parasiten (d.h. von denen, die zu einer Ethnie oder sozialen Klasse gehören, die als Feind angesehen wird), bildet den gemeinsamen Nenner der Nazi- und Sowjetregime. Von Anfang an haben beide Systeme das Ziel verfolgt, nicht nur ihre politischen Gegner zu eliminieren, sondern ganze gesellschaftliche Gruppierungen, verdammt durch ihre bloße Existenz: »objektive Gegner« und »Volksfeinde«. Die große Erkenntnis Hannah Arendts war genau das: Trotz aller offensichtlichen Unterschiede zwischen den totalitären Ideologien des Nazismus und des Stalinismus hinsichtlich ihrer Ursprünge, ihrer jeweiligen Strategien und ihrer Visionen von einer zukünftigen perfekten Gesellschaft gibt es eine Analyseebene, die Ähnlichkeiten und gemeinsame Merkmale hervortreten lässt, die noch bedeutsamer sind als die Unterschiede. Das ist es, was uns erlaubt, uns mit vergleichenden Studien über gänzlich verschiedene totalitäre Systeme zu beschäftigen. Heute ist die Institutionsanalyse, also die gründliche Erforschung der gesellschaftlichen Einrichtungen und der Politik totalitärer Systeme – ihrer regierenden Parteien, Einparteienstaat-Systeme, militärisch-industriellen Komplexe, repressiven Instrumente, der Zensur, Propagandaapparate und Konzentrationslager – die am weitesten entwickelte und am weitesten verbreitete Methode der vergleichenden Erforschung totalitärer Systeme. Die Politik der Klassensäuberung ist der Zwilling einer anderen, sehr viel älteren Politik der ethnischen Säuberung. Sie beide bilden die gemeinsame Charakteristik der politischen Linien von Hitlers und Stalins Regimes.
Die Morde von Katyn waren perfekt geplant und organisiert. Dasselbe gilt für das Verwischen der Spuren und das Fälschen der historischen Aufzeichnungen. Hierin liegt eine weitere Lektion des Massakers von Katyn, die das Problem einer »offiziellen Version« von Geschichte betrifft. Das Massaker von Katyn zu vertuschen und die Schuld den Nazis zuzuschreiben, wurde für Stalin zu einer regelrechten Obsession. Als zum Beispiel am 1. August 1944 in Warschau der polnische Aufstand gegen die deutsche Besatzung begann, waren die Sowjets nur wenige Kilometer entfernt, am östlichen Ufer der Weichsel. Als Anfang August ein Abgeordneter der polnischen Exilregierung nach Moskau reiste, um die Hilfe der Sowjets zu suchen, legte Stalin seine Bedingungen dar. Eine davon war, dass die sowjetischen Truppen nur dann in die Kampfhandlungen eingreifen würden, wenn die polnische Exilregierung in London öffentlich erklären würde, dass das Massaker an den polnischen Offizieren bei Katyn nicht von den Sowjets, sondern vielmehr von den Nazis begangen worden war. Stalin musste bestimmt gewusst haben, dass diese Bedingung absolut inakzeptabel sein würde, und vermutlich hat er sie nur gestellt, um seinen Gesprächspartner zu demütigen. Die stalinistische Propaganda betrieb eine breite Kampagne von Verfälschung und Täuschung, die vom Zutun westlicher Politiker und Historiker profitierte. Die Sowjets versuchten, die Schuld am Massaker den Deutschen zuzuschreiben. Nachdem sie bei den Nürnberger Prozessen mit ihrem Versuch gescheitert waren, die Nazis als die Schuldigen an Katyn hinzustellen, entwarfen sie ihre eigene »offizielle Version« der Geschehnisse, die im Ausland durch ihren gewaltigen Propagandaapparat verbreitet wurde sowie durch die Mobilisierung ihrer Anhänger und Sympathisanten im Westen, insbesondere in den kommunistischen Parteien. Eines der bemerkenswertesten Dokumente, das die Methoden veranschaulicht, mit denen die sowjetische Version der Ereignisse aufrechterhalten wurde, ist der Brief aus dem Jahre 1959 des Vorsitzenden des KGB, Alexander Schelepin, an Chruschtschow, in dem er um Erlaubnis bittet, etwa 22 000 Personalakten polnischer Kriegsgefangener vernichten zu dürfen, die nach Maßgabe des Beschlusses des Politbüros vom 5. März 1940 erschossen worden waren. Die Begründung des KGB-Vorsitzenden verdient eine genauere Betrachtung. Ich möchte einen Auszug aus dem Brief zitieren: »Sämtliche Unterlagen zu den 21 857 Fällen werden in einem versiegelten Raum aufbewahrt. Die Dokumente über die Vorgänge sind von keinerlei entscheidendem Interesse für die sowjetischen Organe, noch haben sie historischen Wert. Es ist unwahrscheinlich, dass sie für unsere polnischen Freunde wirklich von Interesse sind. Unvorhersehbare Umstände könnten jedoch zu einer Aufdeckung der Operation führen – mit allen unwillkommenen Konsequenzen für unser Land. Insbesondere was die im Wald von Katyn Erschossenen betrifft, gibt es eine offizielle Version der Geschehnisse.« Diese, so schreibt der KGB-Vorsitzende, ist 1944 von der Burdenko-Kommission festgelegt worden. Nach den Beschlüssen dieser Kommission wurden alle diese Polen von den deutschen Besatzern liquidiert. Diese Beschlüsse der Kommission, so Schelepin weiter, »sind fest im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit verankert«. Die beste Möglichkeit, diese offizielle Version zu erhalten, war, nach Schelepin, die kompromittierenden Unterlagen zu vernichten. Seine Empfehlung wurde vom Politbüro unterstützt, und so wurden die Dokumente über die Vergehen gegen die polnischen Gefangenen vernichtet. Der Brief des KGB-Vorsitzenden ist ein Paradebeispiel für die totalitäre Haltung gegenüber der historischen Wirklichkeit. George Orwell hat das mit beeindruckendem Scharfsinn erfasst: »Die von totalitären Staaten organisierten Lügen sind nicht, wie oft behauptet wird, vorübergehende Hilfsmittel wie etwa die Kriegslist bei militärischen Operationen. Es sind integrierende Bestandteile des Totalitarismus, etwas, was weiter bestehen wird, auch wenn Konzentrationslager und Geheimpolizei sich nicht mehr als notwendig erweisen würden. ... Totalitarismus benötigt eine unausgesetzte Abänderung der Vergangenheit und führt auf die Dauer zur Skepsis an einer objektiven Wahrheit.« Die Tricks und Kniffe der sowjetischen Regierung, die internationale öffentliche Meinung irrezuleiten, ihre Desinformationskampagnen, diplomatischen Proteste und wirtschaftlicher Druck sind im Großen und Ganzen nur allzu effektiv gewesen. Die Mitschuld und moralische Apathie vieler westlicher Staatsmänner und Intellektueller sollte ebenfalls nicht vergessen werden, ebenso wenig wie der fehlgeleitete Pragmatismus einiger westlicher Regierungen, die, um einer Supermacht gefällig zu sein, die sowjetische offizielle Version übernahmen und davon absahen, nach der Wahrheit zu suchen. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion wurden viele Historiker, die die sowjetische Darstellung zurückwiesen, verdächtigt, wenn nicht gar offen beschuldigt, die Verbrechen der Nazis herunterzuspielen oder gar zu leugnen. Warum also ist es heute, 70 Jahre nach den grauenvollen Ereignissen, notwendig, die Geschichte des Massakers von Katyn zu erzählen und wiederzuerzählen? Warum müssen wir die historischen Umstände, die Ursachen und Folgen untersuchen? An dieser Stelle möchte ich noch einmal Hannah Arendt zitieren, die in Menschen in finsteren Zeiten schrieb: »Sofern es überhaupt ein ›Bewältigen‹ der Vergangenheit gibt, besteht es in dem Nacherzählen dessen, was sich ereignet hat; aber auch dies Nacherzählen, das Geschichte formt, löst keine Probleme und beschwichtigt kein Leiden, es bewältigt nichts endgültig. Vielmehr regt es, solange der Sinn des Geschehens lebendig bleibt – und dies kann durch sehr lange Zeiträume der Fall sein – zu immer wiederholendem Erzählen an.« Im Fall von Katyn gibt es besonders zwingende Gründe, warum die Erinnerung daran wachgehalten werden muss. Zunächst vereinigt Katyn vieles, was für eine lange Zeit aus dem europäischen Bewusstsein verdrängt oder gelöscht worden ist. Jegliche Untersuchung des Massakers an den polnischen Offizieren müsste der Frage der geplanten Aufteilung Europas zwischen den beiden totalitären Regimes als Folge der geheimen Zusatzprotokolle des Molotow-Ribbentrop-Paktes nachgehen. Damit könnten die Historiker die beträchtliche Annäherung dieser Systeme zwischen 1937 und 1941 nicht länger ausklammern. Die enge deutschsowjetische Zusammenarbeit dieser Zeit war keinesfalls ein Zufall, sondern lag vielmehr in ihrem Kampf gegen einen gemeinsamen Feind begründet, in ihrem gemeinsamen Interesse an einer Aufteilung Europas und, wie Jewgenij Gnedin, ein enger Mitarbeiter des Außenministers Maxim Litwinow, sagte, in den »strukturellen Ähnlichkeiten« der jeweiligen Systeme Stalins und Hitlers. Die Unterlagen über den Fall von Katyn machen nur allzu deutlich, was das für strukturelle Ähnlichkeiten waren. Sie liefern konkrete Beweise für die grundlegende Verbindung der Regime von Hitler und Stalin, ihrer Funktionsweisen und Ideologien. Beide Systeme waren radikal, intolerant und »revolutionär«; beide befürworteten nicht nur die Anwendung von Gewalt, um eine »neue Gesellschaft« zu schaffen und den gemeinsamen Feind zu vernichten, sondern glorifizierten sie förmlich; beide vollzogen praktisch einen kompletten Bruch mit jedem juristischen Prinzip des internationalen Rechts und lehnten das Prinzip von individueller Schuld und Verantwortung ab. Wenn auch die diametral entgegengesetzten Ursprünge der nationalsozialistischen und der marxistisch-leninistischen Ideologie einen möglichen Ausgangspunkt für eine Konfrontation zwischen Nazismus und Stalinismus bildeten, so lag eine Allianz im Kampf gegen den gemeinsamen Feind – die Liberaldemokratie und die Sozialdemokratie – ebenfalls vollkommen im Bereich des Möglichen.
Die heutige Relevanz Katyns für die vergleichende Forschung zu Ereignissen wie Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen, Massenmorden, die euphemistisch als humanitäre Krisen bezeichnet werden, ist nicht zu bestreiten. Eines der typischen Merkmale verschiedener humanitärer Krisen ist eine massive Anstrengung seitens der Mörder, die historische Wahrheit zu verschleiern, die Opfer verantwortlich zu machen und die Zeugen zu verfolgen. Deshalb sollten Historiker, die heute versuchen, aus der Erfahrung von Katyn eine nützliche Lehre zu ziehen, über das tragische Schicksal einiger Mitglieder der internationalen medizinischen Kommission nachdenken, die schon 1943 ein klares Schuldurteil gegen die Sowjets gefällt hatten und später massivem politischem Druck und Repressionen ausgesetzt waren. Darüber hinaus stehen die Historiker heute vor der dringlichen Aufgabe zu erklären, warum demokratische Regierungen wie die von Großbritannien sowie große Teile der westlichen Öffentlichkeit, insbesondere westliche Historiker, im Angesicht der zynischen Lügen und Verfälschungen der Sowjetunion in Bezug auf den Fall Katyn ein halbes Jahrhundert lang peinliches Stillschweigen bewahrt haben. Ebenfalls notwendig ist es, die Beweggründe für das Verhalten des großen Reformers Gorbatschow zu verstehen, der sich hartnäckig weigerte, das entscheidende Beweisstück öffentlich zu machen, sogar bis zu dem Punkt, an dem seine eigene Regierung und seine eigene politische Zukunft auf dem Spiel standen. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass gerade Gorbatschow, der mehr als alle anderen dafür tat, den Zusammenbruch des sowjetischen Systems und die friedliche Auflösung der Sowjetunion zu erreichen, es versäumte, die Existenz der Originaldokumente des Molotow-Ribbentrop-Paktes und der Befehle zur Hinrichtung der polnischen Offiziere zu bestätigen. Gorbatschow war ein Mann des Parteiapparats; er brach niemals völlig mit den Regeln, den Verhaltensweisen und der Geisteshaltung eines Führers der KPdSU. Er hoffte, die führende Rolle der Kommunistischen Partei erhalten zu können und ihr zugleich demokratische Züge zu verleihen, die der Ideologie, den Traditionen, der Struktur und Organisation der Partei zutiefst fremd waren. Gorbatschow gelang es nie völlig, seine enge Verbindung zur marxistisch-leninistischen Ideologie zu lösen. Der widersprüchliche Charakter der Entstalinisierung, die von Chruschtschow eingeleitet und später von Gorbatschow fortgeführt wurde, führte zu einem eklatanten Widerspruch zwischen der Beurteilung des stalinistischen Vermächtnisses und Stalins Außenpolitik. Wie russische Historiker betont haben: »Millionen Opfer des Stalinismus erlebten einerseits die Verurteilung der politischen Praxis des Stalinismus und waren andererseits Zeugen der Wertschätzung von Stalins Leistung als marxistischer Staatsmann, der das Land in eine ›leuchtende kommunistische Zukunft‹ führte, erlebten also eine Idealisierung des totalitären stalinschen Systems.« Im heutigen Russland spiegelt sich dieser Widerspruch nicht nur in den neuen Geschichtslehrbüchern an den Schulen und Universitäten, sondern auch in der Arbeit seriöser Historiker wider. So bezog sich das maßgebliche russische Journal für Zeitgeschichte jüngst in seiner Einleitung zur Veröffentlichung wichtiger Dokumente – Protokolle von Stalins Treffen mit polnischen Stellvertretern in den Jahren 1943–44 – indirekt auf das Massaker von Katyn: »Die Hoffnungen, konstruktive sowjetisch-polnische Beziehungen erhalten zu können, schwanden, als die UdSSR ihre diplomatischen Beziehungen zur polnischen Exilregierung abbrach, da sie die polnische Reaktion auf die deutsche Information, nach der die Sowjets für das Massaker von Katyn verantwortlich seien, als beispiellose antisowjetische Kampagne auffasste.« Die Frage, ob die Informationen zum Massaker von Katyn wahr waren oder nicht, wird völlig vermieden, während die künstliche Entrüstung über »eine beispiellose anti-sowjetische Kampagne« als geschichtliche Rechtfertigung für Stalins Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur rechtmäßigen polnischen Regierung präsentiert wird.
Schließlich bedarf es deshalb weiterer Forschung zum Fall von Katyn, weil immer neue Informationen zur Vorbereitung und Ausführung des Massakers auftauchen. Am allerwichtigsten aber ist, dass für Tausende Verwandte, Freunde und Nachkommen der Opfer, die nie etwas über das Schicksal ihrer Lieben erfahren haben, das Massaker von Katyn längst nicht Geschichte ist, sondern Teil ihres täglichen Lebens. Die Opfer von Katyn wurden in nicht gekennzeichneten Massengräbern begraben und ihre Familien so jeder Möglichkeit beraubt, wenigstens ihre Gräber besuchen zu können. 1989 leitete die militärische Generalstaatsanwaltschaft eine Untersuchung des Massakers von Katyn ein, bezeichnet als Völkermord, ein Verbrechen, für das es keine Verjährungsfrist gibt. 2004, kurz vorm 65. Jahrestag des Massakers, stoppte der Militärgerichtshof der Russischen Föderation die Untersuchung mit der Begründung, dass das Massaker von Katyn nicht als Völkermord klassifiziert werden könne und die Handlungen des NKWD gegen polnische Bürger im Einklang mit dem damaligen Strafrecht gestanden hätten. Darüber hinaus erklärte der Militärgerichtshof, dass 36 von 183 Aktenbänden, die im Laufe der Untersuchungen gesammelt wurden, »Staatsgeheimnisse« enthielten und weitere 80 Informationen vertraulicher und geheimer Natur. Es wurden den Historikern von vornherein nur 67 der 183 Aktenbände, die von den militärischen Anklägern zusammengetragen wurden, zugänglich gemacht. Das russische Militärgericht erklärte jedoch, dass es in Erwägung ziehen würde, sich im Rahmen des russischen Föderationsrechts mit den Opfern von Katyn hinsichtlich der Rehabilitierung von Opfern politischer Verfolgung zu befassen. Die Entscheidung des Militärgerichtshofs, Dokumente zum Fall Katyn als »geheim« zu klassifizieren, verstärkte das öffentliche Misstrauen sowohl in Russland als auch international, dass hier in altbewährter Manier die Verbrechen des sowjetischen Regimes reingewaschen werden sollten. Das Gesetz der russischen Föderation zur Rehabilitierung der Opfer von politischer Verfolgung bedingt, dass das Verfahren zum Fall Katyn nicht geschlossen werden kann, ohne die Namen der Verantwortlichen zu ermitteln und öffentlich zu machen, sowohl die von den Anstiftern als auch von den Organisatoren und Tätern auf allen Ebenen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden die Organisatoren und diejenigen, die deren Befehle ausführten, identifiziert. Trotzdem ist – während westliche Staaten damit fortfahren, die Verbrechen der Nazis zu ermitteln und zu bestrafen – in Russland nicht ein einziger Mörder einem Richter vorgeführt, noch ist eine polizeiliche Ermittlung überhaupt in die Wege geleitet worden. Verwandte und Nachkommen der Opfer des Massakers von Katyn haben einen Rechtsstreit zur Rehabilitierung der Opfer begonnen. Sie werden von der »Memorial Society« unterstützt, einer Gesellschaft russischer und ausländischer Historiker, die sich mit der sowjetischen Geschichte, insbesondere mit deren verborgenen Seiten, beschäftigt. Im Januar 2006 erhielt die Witwe eines 1940 bei Katyn erschossenen Offiziers, die die offizielle Rehabilitierung ihres Mannes gefordert hatte, von der Staatsanwaltschaft die folgende Abfuhr: Weder ihr Ehemann noch die anderen Offiziere könnten rehabilitiert werden, weil »das Rehabilitationsgesetz nur für die Opfer staatlicher Repression gilt. Während des Ermittlungsverfahrens stellte sich jedoch heraus, dass selbst der Paragraph des russischen Strafgesetzbuches von 1926, der angewandt wurde, um polnische Offiziere zu verurteilen, nicht ermittelt werden konnte, weil alle relevanten Dokumente zerstört worden waren.« Das ist nichts als bürokratische Verachtung und ein Hohn auf die Gerechtigkeit. Der russische Oberste Gerichtshof hat kürzlich unter dem Druck der orthodoxen Kirche Zar Nikolaus II. und seine Familie rehabilitiert, die 1918 erschossen worden waren, ohne sich auf die Paragraphen des Strafgesetzbuches zu beziehen, anhand derer sie verurteilt worden waren. Als aber im Mai 2008 Verwandte der Opfer versuchten, die Entscheidung anzufechten, die Untersuchungen zu Katyn einzustellen, lehnte der Moskauer Gerichtshof es mit der Begründung ab, den Fall zu überdenken, dass das Material Staatsgeheimnisse enthalte. Nun legt die »Memorial Society« beim Internationalen Gerichtshof in Straßburg Berufung ein. Der Rechtsstreit geht weiter, während die Generation, die die Ereignisse durchlebt hat, von der Bildfläche verschwindet. Wie der Vorsitzende der »Memorial Society«, Arseni Roginski, zu Recht betont, hängen sowohl Russlands Gegenwart als auch Zukunft davon ab, die Vergangenheit zu bewältigen, das heißt, es bedarf einer ehrlichen und umfassenden Analyse des sowjetischen Massenterrors. Diese Schlussfolgerung sollte auf ganz Europa (und darüber hinaus) ausgedehnt werden. Deutsche Übersetzung von Ute Szczepanski.
Wir blicken inzwischen auf eine ansehnliche Reihe von Preisträgerinnen und Preisträgern zurück, von denen ich Ihnen nur einige der letzten Jahre ins Gedächtnis rufe: Jelena Bonner (2000), Ernst-Wolfgang Böckenförde (2004), Julia Kristeva (2006), Tony Judt (2007). Der Preis wird von einer internationalen Jury vergeben. In Anlehnung an eine Tradition, für die Hannah Arendt als herausragende öffentliche Intellektuelle steht, sucht die Jury nach Preisträgerinnen und Preisträgern, die mit dem, wofür sie stehen, jenes Aufmerken wachrufen, von dem die öffentliche politische Debatte zehrt – jenes Unerwartete, das innehalten lässt, das Staunen hervorruft und natürlich auch Widerspruch. Die Jury hat mit Victor Zaslavsky eine Persönlichkeit gewählt, die diese Aufmerksamkeit hervorruft für den Bericht über ein Verbrechen und seine Vertuschung. Victor Zaslavskys Buch über Das Massaker von Katyn erzählt eine Geschichte, die den Eingeweihten seit vielen Jahrzehnten bekannt ist: der Mord an über zwanzigtausend polnischen Offizieren und Soldaten im Wald von Katyn und an anderen Orten durch russische Sicherheitskräfte. In Polen gibt es seit dem letzten Jahr einen Film des berühmten Regisseurs Andrzej Wajda, dessen Vater dem Verbrechen zum Opfer fiel, über Katyn, nach einem Buch von Andrzej Mularczyk. Das Besondere an Victor Zaslavskys Geschichte ist aber, dass er aus der russischen Perspektive erzählt. Im Zentrum seines Buches steht die Frage, warum die sowjetische Propaganda, wonach der Massenmord an den polnischen Offizieren eine Schandtat der deutschen Nationalsozialisten und ihrer Armeen war, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem XX. Parteitag und selbst noch unter den Präsidenten nach Gorbatschow aufrechterhalten wurde. Zaslavsky folgt den Spuren dieser Lüge. Das Besondere an seiner Geschichte ist nicht nur die Erzählung der Fakten, also des Verbrechens und seiner Vertuschung, sondern auch die Infragestellung der nationalen Geschichtspolitik Russlands, deren Administratoren an einer gründlichen Aufarbeitung der Verbrechen unter der Sowjetherrschaft nicht interessiert zu sein scheinen. Zaslavskys Erzählung weist auf einen weiteren Kontext hin. Katyn lag lange in einem toten Winkel der europäischen Geschichte, ein Massenmord, geschehen im Nirgendwo eines Irgendwo in Russland. Und doch ist das Verbrechen ein zentrales Ereignis der jüngeren europäischen Geschichte. Das Verbrechen wäre vermutlich nicht geschehen, wenn es nicht vorher den Hitler-StalinPakt samt dem anhängenden Geheimprotokoll über die Aufteilung Polens zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion gegeben hätte. Das Ereignis berührt also die sowjetische, die polnische und die deutsche Geschichte – nicht zu vergessen die der damaligen Westalliierten, die, obwohl sie Polen Schutz versprochen hatten, das Verbrechen aus taktischen Gründen totgeschwiegen haben und dieses Schweigen nie offiziell zurückgenommen haben. Insofern deckt Zaslavskys Erzählung eine europäische Schandtat auf, an der viele mittelbar und unmittelbar beteiligt waren. Aus einer politischen Perspektive betrachtet, gehören das Ereignis und seine Nachgeschichte zu jenen herausragenden Akten der Zerstörung und Selbstzerstörung, durch die die europäischen Länder in den Jahren zwischen 1933 und 1945 gegangen sind. In ihrem Bericht über den Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961 prägte Hannah Arendt das Wort von der »Totalität des moralischen Zusammenbruchs«, den die Nationalsozialisten in allen Ländern Europas verursacht hätten. Katyn steht in einem erweiterten Sinne ebenfalls für einen moralischen Zusammenbruch des Westens und seine Folgen, die bis heute andauern. Daher kann die Erinnerung an Katyn auch kein nationales Eigentum sein, wenngleich Polen bis heute das Land ist, in dem am meisten daran gedacht wird. Katyn verweist darauf, dass in Europa nationale Erinnerungen nur ein Teil der Erinnerung sein können. Die Erinnerung an Katyn gehört allen, ebenso wie die Erinnerung an andere Massenmorde in der Sowjetunion oder in Deutschland, in Tschechien oder Italien oder Spanien. Es gibt kein europäisches Land, das nicht in diesen Strudel der Verbrechen, inszeniert von den zwei totalitären Supermächten und ihren Helfern, gerissen worden wäre. Und es gibt kein Land, in dem nicht die Bilder der nationalen Identität mit der Erinnerung an stattgefundene oder begangene Verbrechen kollidieren. Europäische Erinnerung kann vor diesem Hintergrund nur heißen, alle Geschichten ohne Rücksichtnahme auf nationale Glorie zu erzählen, auch die bedrückenden, die nie hätten geschehen dürfen. Victor Zaslavskys Buch handelt vom gewalttätigen Verschweigen dieser Erinnerungserzählungen. Oder um es anders auszudrücken: Sein Buch erzählt von der Aneignung der Erzählungen der Völker durch totale Herrschaftssysteme und organisierte Propagandalügen. Diese Erzählungen fallen offensichtlich nach dem Ende der totalen Herrschaft nicht von selbst zurück in den Bereich der Wahrheit, sondern sie wollen ausgegraben werden. Das hat Victor Zaslavsky am Beispiel Katyn gemacht. Die Jury hat Victor Zaslavsky den diesjährigen Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken verliehen, weil er nicht nur ein mutiges Buch geschrieben hat, sondern auch der europäischen Erinnerungskultur damit einen großen Dienst erwiesen hat, indem er eine fragmentierte Geschichte fortschreibt, sie vervollständigt, so wie es viele andere in der Zukunft weiterhin tun müssen ... So weit die Begründung der Jury. Wie immer wieder an dieser Stelle möchten wir den Geldgebern herzlich danken: der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bremer Senat, die die Preisvergabe seit nunmehr 14 Jahren tragen und festliche Abende wie diesen auch in krisenhaften Zeiten wie den unseren ermöglichen. Großer Dank gilt an dieser Stelle wie immer der Jury und dem Kreis der Kollegen und Kolleginnen aus Vorstand und Mitgliederversammlung. Stellvertretend nenne ich Peter Rüdel und Eva Senghaas.
Lassen sie mich noch ein Wort hinzufügen. Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken hatte seinerzeit etliche Mit-Gründer. Einer der wichtigsten Ideengeber war über die Jahre Zoltan Szankay, der Anfang des Jahres plötzlich verstorben ist. Zoltan Szankay hat erheblich zur Erkennbarkeit dieses Preises in der deutschen Preislandschaft beigetragen. Er hat stets hartnäckig und manchmal stur eingefordert, dass der Preis nicht im Ritual erstarren dürfe, nicht einfach nur Zeichen der Anerkennung für eine Leistung sein solle, dass in jeder Preisvergabe die Auseinandersetzung um das Politische sichtbar werden müsste. Das Desiderat der Erneuerung, der Überraschung, des Ungewohnten aufrechtzuerhalten, darin liegt, denke ich, eine angemessene Form des Andenkens an Zoltan Szankay.
Kreative Erinnerung
Die Einleitungen waren so gut, dass mir eigentlich wenig Positives zu sagen bleibt außer Wiederholungen. Allerdings kommt auch einiges Kritisches, was noch nicht gesagt wurde. Was ich vermisst habe, ist, dass man von Ihren anderen Büchern nicht gesprochen hat. Immerhin sind beim Wagenbach-Verlag In geschlossener Gesellschaft, die Beschreibung des sowjetischen Alltags, und die Sammlung Das russische Imperium unter Gorbatschow erschienen, das sind wertvolle Beiträge zum Verständnis des nachstalinistischen Russlands. Das Wichtigste, ich sage es noch einmal, ist, dass Ihr Buch im Unterricht im Westen und im Osten vorgestellt und verwendet werden sollte. Im Osten, damit meine ich auch die so genannten Neuen Bundesländer, die nach 18 Jahren nicht mehr so neu sind, da habe ich schlimme Erfahrungen gemacht. Vor ein paar Jahren sprach ich in Potsdam, es waren fast nur ehemalige SED-Mitglieder dabei, und sie wussten eigentlich nichts. Sie wussten etwas von der DDR, die gar nicht so schlimm gewesen ist im Vergleich mit anderen. Es hat keine Prozesse gegeben wie in Prag oder in Budapest, keinen Gulag, es hat nur – ich sage absichtlich nur – Gefängnisse gegeben. Und sie wussten nichts von so etwas wie Katyn. Das hatte etwas Tragisches, und es ist nun besonders schön – ich muss es wiederholen –, dass heute ein russischer Wissenschaftler das gesagt hat. Vorgestern haben in Paris Libération und Le Monde lange Besprechungen gebracht – das war im Sinne dessen, was Frau Linnert eben gesagt hat – über das Buch eines türkischen Professors, Taner Akçam, Le génocide arménien et la question de la responsabilité turque, also: Der armenische Völkermord und die Frage der türkischen Verantwortlichkeit – das ist jemand, der fragt wie Sie, was war eigentlich deren wirkliche Schuld? Warum ist er nun in einer schwierigen Lage? Weil er dargestellt hat, wie die Jungtürken, darunter Atatürk, der abbrechen wollte, für den Massenmord mit verantwortlich waren. Und genauso kann ich Putin verstehen. Er war ja immerhin in Dresden der Überwacher der Stasi, der Mann, der dann in den Geheimdiensten geblieben ist und der es sich leisten konnte, dem Pipeline-Projekt von Russland bis hierher, das noch nicht gebaut ist, mit dem Exkanzler Herrn Schröder einen Generalsekretär zu geben, den er als Stasimann in Dresden gekannt hatte. Deswegen finde ich, dass Putin, ich sage nicht, gut ist, aber verständlich. Etwas erstaunt war ich über das, was Sie über Gorbatschow schreiben, aber Sie haben Recht, nur: er hat doch viel getan – ich war im Kriegsmuseum in Minsk, da erklärte mir die Direktorin, dass es unter Chruschtschow plötzlich den Stalin-Hitler-Pakt gab, unter Gorbatschow das Geheimprotokoll. Allerdings steht im Geheimprotokoll natürlich Katyn nicht drin. Aber da gab es Fortschritte. Wo ich nicht ganz einverstanden sein kann, ist, dass man im Westen so wenig darüber sprach. Ich darf mich selbst zitieren, mein erstes Deutschlandbuch 1953, L’Allemagne de l’Occident 1945–1952, darin spreche ich über Katyn, wegen des Prozesses, und sagte auch, dass eben das beim Nürnberger Prozess unterdrückt worden war, weil der sowjetische Richter einfach nicht gewollt hat, dass man über Katyn spricht. Allerdings, fügte ich damals hinzu, und das muss noch heute teilweise wahr bleiben, das wurde von Ihnen schon gesagt, kein Deutscher darf sich seiner nationalsozialistischen Vergangenheit deshalb gerechtfertigt fühlen, weil auch die Russen barbarisch verfahren sind. Und das war damals eine Befürchtung der Alliierten, denn es gab einige Deutsche, die sich freuten, wie sich die ehemaligen Sieger untereinander des Massenmordes beschuldigten. Es ist schon über Katyn geschrieben worden vor ein paar Jahren in dem großen Schwarzbuch des Kommunismus – zuerst auf Französisch 1997 erschienen, dann bei Piper 1998 –, worin ein Pole, Andrzej Paczkowski, über Katyn geschrieben hat in Verbindung mit dem Massenterror, der dann 1944, 1947 in Polen stattgefunden hat. Hier übrigens eine Randbemerkung: In Deutschland ist man auch nicht immer gewillt, sich an alles zu erinnern. Ich werde einige stören, wenn ich sage, immerhin gehört Herbert Wehner auch zu den Komintern-Unterwürfigen, der auch denunziert hat, der auch eine Kaderliste aufgestellt hat, mit der dann Menschen hingerichtet wurden. Onkel Herberts Vergangenheit ist jedoch im Bundestag fast immer untergegangen. Ich glaube aber auch, es stimmt, dass die kommunistischen Historiker all das immer verneint haben. Und nicht nur die kommunistischen. Ich darf mir – Eigenlob! – zwei positive Dinge zurechnen: Im Mémorial de Caen, ein wunderbares Museum über die Kriegsgeschichte, habe ich vehement protestiert, weil nach 1945 nichts Negatives über die Sowjetunion dringestanden hat. Jetzt hat sich das verändert, nicht nur mein Einfluss, es steht jetzt auch drin, was geschehen ist in den Prozessen, mit den Massenmorden und so weiter. Und dann, bitte, sehen Sie sich das Deutsch-französische Geschichtsbuch an, das so gelobt wird, aber nicht von mir – im ersten Band steht so gut wie nichts über das, was im Osten geschehen ist, was unter Stalin geschehen ist, über Mao steht überhaupt nichts drin, und über Stalin steht furchtbar wenig drin. Und das ist einer der Vorteile Ihres Buches, dass es einen in die Lage versetzt, darüber sprechen zu können. Man kann sich kaum noch vorstellen, was kommunistische Historiker in Frankreich, mehr als in Deutschland, alles geschrieben, verleugnet haben. Beim Krawtschenko-Prozess wurde Margarete Buber-Neumann, die ja in sowjetischen Lagern, dann in Ravensbrück gelitten hatte (und deren Gatte, ein deutscher KP-Führer, von Stalin ermordet worden war), beschimpft, sie lüge und so weiter, und dann zitiere ich nur einen Artikel von 1950 in den Cahiers du communisme, von drei großen Historikern unterschrieben, Bruhat, Soboul, Agulhon: »Maurice Thorez, (charismatischer Generalsekretär der KPF) ist Historiker, weil er ein Politiker der Arbeiterklasse ist. Als Politiker der Arbeiterklasse zeigt er den Weg, weil er Historiker ist. Dank Maurice Thorez können wir unsere wissenschaftliche Konzeption der Geschichte der Bourgeois-Geschichte entgegenstellen. Weil unser Generalsekretär aus der Arbeiterklasse kommt, sind wir gute Historiker.« Nur, füge ich noch hinzu, vielleicht ist es auch in Ihrem Sinne, habe ich immer geschrieben, dass die Verneiner von dem, was in der Sowjetunion war, ich denke an eine Deportierte, die danach sagt, es gibt keine Gefängnisse in der Sowjetunion, und die Gefangenen werden wunderbar behandelt, dass die schuldiger sind als die, die eben nachher Auschwitz verneint haben, denn sie haben verhindert, dass man sich um die kümmert, die noch lebten. Es ging nicht nur um eine Beschimpfung der Toten, es ging auch um eine Verhinderung, um das Schicksal der noch Lebenden, der in Gefängnissen oder im Gulag Lebenden, dass man sich um sie kümmert.
Aber, nun kommt’s: Ich habe Schwierigkeiten mit Ihrem zentralen Thema. Warum? Weil es mich an jemanden erinnert, den ich nicht gern habe – er heißt Ernst Nolte. Und Ihre These ist nicht ganz unähnlich mit den Thesen von Nolte im Historikerstreit. Die letzte gute Beschreibung von dem, was er geschrieben hat und was die Querele war, ist in dem Buch von Hans-Ulrich Wehler, im letzten Band seiner Geschichte der deutschen Gesellschaft, wo er nochmals betont, was Nolte damals, 1986, alles geschrieben hat. Das Dritte Reich habe gegen eine asiatische Gefahr gekämpft, warum diese asiatische Gefahr so schlimm war, dabei kommt dieses furchtbare Wort Prius vor – denn die Vernichtung der Kulaken war zeitlich früher, war sie eine Ursache für Hitler? In einem Artikel von 1986 bejaht er dies, was Sie nie gesagt haben, aber er gebraucht auch das Wort Klassenvernichtung. Das Wort Klassenvernichtung steht bei Nolte, die Frage lautet nun, was ist denn eigentlich eine Klassenvernichtung? Zunächst finde ich, im Gegensatz zu Ihnen, die Definition der Vereinten Nationen, was Völkermord ist, unwahrscheinlich vage und beinahe unbrauchbar. Die Definition von 1948, also: Völkermord, Tötung von Mitgliedern einer Gruppe, Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden von Mitgliedern der Gruppe, vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind, gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Das entspricht relativ wenig dem Begriff des Völkermords, wie Sie ihn zu Recht gebrauchen, aber stellt die Frage, was will man eigentlich vernichten? Und hier bin ich wirklich nicht ganz einverstanden. Es stimmt für die Schriften von Lenin am Anfang, es stimmt für die Vernichtung der Kulaken in den ersten Jahren, aber wie ist es weiter? Ich kenne eigentlich nur einen Völkermord im Sinne, wie Sie sagen, einer Klasse, das ist der Selbstgenozid Kambodschas, wo eine Million Menschen getötet wurden, nur weil sie lesen und schreiben konnten, nur weil sie Intellektuelle waren, damit man von Null in der Gesellschaft neu anfangen kann, und das hat einen Massenmord an einer bis anderthalb Millionen Menschen gebracht. Aber unter Stalins Verantwortung in der Ukraine beim Holodomor, beim Massenmord durch Hunger, war es völlig gleichgültig, welche Ukrainer massenhaft starben, es starben ungefähr zwei Millionen, und so weiter. Und wenn man zum Beispiel den Chruschtschow-Bericht liest, dass 70 Prozent der Mitglieder des Zentralkomitees des XVII. Kongresses ermordet wurden, welche Völker deportiert worden waren, ganze Völker, Wolgadeutsche, Tschetschenen und so weiter, dann sehe ich wirklich, was alles ermordet worden ist von Stalin – die eigenen Genossen in der Partei, massenhaft, auch die, die emporsteigen wollten. Es gibt einen wunderbaren Film, »Soleil trompeur« (Die Sonne, die uns täuscht), in dem ein Oberst glaubt, er stünde in der Gnade Stalins, doch wird er rücksichtslos verprügelt, dann ermordet, Frau und Kinder werden deportiert, wie die Frauen und Kinder bei Katyn deportiert worden sind. Da bin ich auch bei einem Sonderfall, das ist der Fall Polen. Zu Recht wird im Schwarzbuch des Kommunismus darauf hingewiesen, dass Polen für sein Martyrium keinen Stalin brauchte. Der Gründungstag der deutschen Demokratie ist für mich das Hambacher Fest gewesen, und das Hambacher Fest hat sein Lied – das große Lied des Hambacher Fests war: Vor des Zaren finsterem Angesicht/ Beugt der freiheitsliebende Pole sich nicht. Es war ein Massenmord an Polen in Polen geschehen, ein unabhängiges Polen gab es nicht, wie später eine Frau wie Marie Curie, zukünftige Nobelpreisträgerin, in ihren Erinnerungen schreibt – in der Schule in Polen durfte sie kein Polnisch sprechen. Das Russisch war obligatorisch mit der Absicht, das Polnische auszumerzen. Also, Polen ist wirklich das Land, das am meisten gelitten hat, und ich glaube, der schlimmste Satz, der in Deutschland ausgesprochen wurde, ist von einer deutschen Frau, die behauptet zu sein, was sie nicht ist, sie heißt Erika Steinbach, und sie sagte: Die Polen haben auch gelitten. Dieses »auch gelitten« ist eine Provokation. Es trifft sich auch, dass Ihr Bundespräsident genauer sagen sollte, wo er geboren ist – aber er hat es gesagt, nämlich in einem Dorf, das polnisch war, doch der Geburtsschein kommt aus dem ersten Jahr der Germanisierung. Ich darf erinnern, im Februar 1933 sagt Hitler seinen Generälen und Ministern, wenn sie einmal die politische Macht haben, neue Exportmöglichkeiten erkämpfen, besser gesagt, neuen Lebensraum im Osten erobern und ihn rücksichtslos germanisieren. Hier ging es also, und ich glaube auf beiden Seiten, um nicht weniger als die Elite auszurotten, damit sie das Volk nicht beeinflussen kann, nicht aber um Kommunisten daraus zu machen. Wir wissen heute, dass Hitler nicht nur die Juden im Visier hatte, sondern nach den Juden wären die Polen drangekommen, darüber gibt es genügend Dokumente. Die am meisten gelitten haben, sind – Sie haben darauf angespielt – die Weißrussen. Ich war in Minsk und in Hatyn, also im anderen Katyn, sie haben ein Viertel der Bevölkerung verloren; es gibt zu Recht in Riga das Museum der Besatzungen – Plural –, denn sie wurden von beiden Seiten ausgeplündert, weggeschickt, in die Armee gezwungen, so dass sich zum Beispiel Litauer gegenüberstanden, die einen in der deutschen Armee, die anderen in der sowjetischen Armee – und für Minsk kommt natürlich noch der heutige Diktator plus Tschernobyl dazu, das ist wirklich viel für ein Volk. Ich glaube, es gibt in diesem Sinne auch andere Ausrottungen. Was ist für Sie der 11. September? Für mich ist er auch der 11. September 1973 in Santiago de Chile. Und die Zahl der Ermordeten in Argentinien und in Chile, sorgfältig ausgewählte Intellektuelle, auch in einer Kategorie des Volkes, also ein Klassenmord, hat viel, viel mehr Tote gezeitigt als das furchtbare Attentat in New York. Die Morde sind vollbracht worden mit Zustimmung und Ermunterung von Henry Kissinger, von dem ich nie gewusst habe, warum er den Friedensnobelpreis bekommen hat. Das war für mich so etwas wie eine Klassensäuberung, damit man Argentinien oder Chile besser beherrschen kann. Sie haben völlig Recht, dass man sich in dieser Hinsicht auch erinnern sollte. Ich hatte neulich die Ehre, zum Volkstrauertag auf Schloss Ehrenbreitstein für das deutsche Heer zu sprechen und die Trauerrede zu halten, eben weil ich Franzose bin, und da wird ein Text verlesen, der von Ihrem Bundespräsidenten auch immer verlesen wird: Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg und so weiter, wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Und ich glaube, man könnte jetzt wirklich noch mit Ihrem Buch hinzufügen, weil sie einer Klasse zugeschrieben wurden. Das fände ich auch völlig richtig, denn man kann darüber diskutieren, das müsste drin sein. Übrigens, Randbemerkung: Seit zwei Jahren steht noch etwas anderes Schönes drin: Wir gedenken heute auch derer, die bei uns Opfer durch Hass und Gewalt gegen Fremde geworden sind. Das ist ein sehr schöner Text, wie er in Russland nie formuliert werden wird, in der Türkei wahrscheinlich auch nicht.
Deswegen glaube ich sehr an eine kreative Erinnerung, und diese gibt es in Polen, wenn Sie das Denkmal sehen am Getto – nicht nur das große Denkmal, sondern jetzt das kleine Denkmal in Warschau – mit dem Kniefall von Willy Brandt. Und dieses Denkmal nehme ich immer als Beispiel für das, was eine kreative Erinnerung ist. Willy Brandt war gewiss an nichts mitschuldig – mit 19 Jahren floh er aus Deutschland als verfolgter Jungsozialist, als Kanzler der Bundesrepublik trug er auf seinen Schultern die Last der Vergangenheit. Nicht die Schuld der Vergangenheit, die Last der Vergangenheit und die Verantwortung für die Vergangenheit. Ich glaube kaum, dass es möglich sein wird, in Russland in absehbarer Zeit so jemanden zu haben. Es bleibt aber bei dem Willy-Brandt-Argument – da sollte auch Herr Steinmeier mehr daran denken und auch Frau Merkel und Herr Sarkozy –, dass die Beziehungen mit Russland in Polen, in Litauen, in Lettland, in Estland noch zu Recht von Angst geprägt sind. Und wenn wir zu 27 eine gemeinsame Außenpolitik machen wollen, muss diese Angst ein Teil unserer Außenpolitik sein. Es trifft sich, dass heute an die Türkei die Bedingung gestellt wird, die nicht an Putin gestellt wird. Die 27 haben der Türkei gesagt, eine der Bedingungen des Eintritts der Türkei ist die Anerkennung des Massenmords an Armeniern. Man könnte nach Moskau sagen, die Bedingung für freundschaftliche gute Beziehungen ist ein Blick auf die Vergangenheit. Und ein Zugeständnis zur Vergangenheit. In diesem Sinne finde ich, dass Sie in Ihrem Buch mit historischer und soziologischer Schärfe auch eine Grundlage, eine moralische Grundlage der Politik hervorgehoben haben, im Sinne einer Vergangenheit, die da sein soll, damit man eine Zukunft bedenken kann. Hier darf ich sagen, was mir in Deutschland sehr vorgeworfen wird, in Frankreich übrigens auch. Als der Bundespräsident im Februar 2005 vor der Knesset sprach, sagte er, die Konsequenz der nationalsozialistischen Vergangenheit sei, dass jeder Deutsche sich überall um die Würde des Menschen kümmern sollte. Ich habe dann in meinem Artikel beigefügt: Und er wusste, dass die Palästinenser auch Menschen sind. So darf ich Ihnen nun danken mit nicht gänzlichem Einverständnis mit der Grundthese, was natürlich wichtig ist, das heißt, dass es ein Zeichen der Ausrottung einer Klasse sein sollte – ich glaube, es war teilweise das, aber das Leiden der Polen muss umfassend gesehen werden, und Katyn ist ein Beispiel dafür, was Polen wirklich erlitten hat. Ich danke Ihnen für das, was Sie geleistet haben.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz