
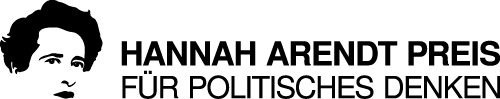

Kurt Flasch, Philosophiehistoriker, spezialisiert auf die Spätantike und das Mittelalter und Autor zahlreicher Bücher

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Kurt Flaschs Schule der Skepsis
Philologische Kritik als politische Tugend
Victrix causa diis placuit sed victa Catoni.
»Den Göttern gefiel die siegreiche Sache, aber Cato (dem Älteren) gefällt die unterlegene.«
Das zitierte Motto stand bekanntlich säuberlich getippt auf dem Titelblatt einer ungeschriebenen Abhandlung: »Das Leben des Geistes – Bd. III – Das Urteilen«, welche die Schutzpatronin dieses Preises hatte schreiben wollen. Man fand die (bis auf Titel und Motto) leere Typoskriptseite nach Hannah Arendts Tode noch in ihrer Schreibmaschine. Voilà: Es gibt wohl keine bessere Begründung dafür, daß wir – die Jury eines sich nach der republikanischen Heiligen Hannah Arendt nennenden Preises für politisches Denken – den Alt- und Mittelalterhistoriker der Philosophie Kurt Flasch als diesjährigen Preisträger vorgeschlagen haben. Das zitierte antike Motto könnte fast von ihm selber stammen. Jedenfalls kommt er in einem seiner letzten Werke de facto darauf zurück – eher beiläufig, wie selbstverständlich.
Auf Seite 45 eines Werkes mit dem Titel Meister Eckhart. Die Geburt der Deutschen Mystik aus dem Geist der arabischen Philosophie (2006) erläutert uns Kurt Flasch ein Siegesmonument aus dem Anfang des . Jahrhunderts. Es handelt sich um ein berühmtes Bild des Thomas von Aquino, das in einem Gotteshaus seines Ordens, nämlich in der Dominikanerkirche Santa Caterina in Pisa, zu sehen ist. Wir sehen auf diesem Gemälde den magister (also Professor) Thomas im Zentrum aller Weisheit. In der Tat sollte er schon bald – nach seiner Heiligsprechung – zu jenem doctor angelicus und »Lehrer der Kirche« werden, über den noch vor 130 Jahren ein päpstliches Rundschreiben kündete, in den Lehren dieses heiligen Thomas sei das nec plus ultra menschlichen Nachdenkens erreicht worden: ein »Gipfel, wie ihn die menschliche Intelligenz niemals zu denken vermocht hatte«. Und übrigens: vor elf Jahren hat ein anderer Papst diese These ausdrücklich bekräftigt. Dieser Thomas von Aquino also sitzt im Zentrum des Bildes; seine Gestalt ist größer als alle anderen dargestellten Wahrheitslehrer. Magister Thomas sitzt zwischen Platon und Aristoteles. Vor sich auf seinem Schoße hält er, zum Betrachter hin aufgeschlagen, eine seiner philosophischen Summen, so daß wir ihre Anfangszeilen lesen können. Von Moses, Paulus und den vier Evangelisten inspiriert (wir sehen sie über ihm im Bilde) triumphiert Thomas über den arabischen Aristoteles-Kommentator Ibn Ruschd/Averroes, welcher sich geschlagen zu seinen Füßen duckt. Das im Buche des magister Thomas konzentrierte geistige Licht seiner Philosophie geht aus vom über seinem Haupte erscheinenden Worte Gottes (es geht nämlich aus dem Munde des sprechenden Christus hervor) – und es strahlt direkt auf die unten auf dem Bilde versammelten Theologen aller Orden und Richtungen. Es sind ja (worauf Flasch in seiner ideenpolitischen Lektüre hinweist) keineswegs nur Dominikaner im schwarz-weißen Habit, welche da über des Thomas‘ Summa contra gentiles disputieren, sondern auch Rot- und Braunberockte, alle möglichen Ordens- und Weltpriester. Ihrer aller Köpfe scheinen durch die Strahlen des Lichts der Vernunft mit dem doctor ecclesiae als Umschaltstelle göttlicher Weisheit verdrahtet. Was also das Triumphbild des divus Thomas statuiert oder vorwegnimmt (und es sollte dann später noch andere, drastischere Varianten geben, die diesen Kurs bekräftigen), das ist der Siegeszug des sogenannten Thomismus: Über Jahrhunderte war er die vorherrschende kirchliche Software der philosophischen Interpretation der christlichen Verkündigung; in verschiedenen seinen Varianten und diversen updates (wie »Spätscholastik«, »Kasuistik« oder »Neothomismus«, etc.) triumphierte der kanonisierte Thomismus über alle konkurrierenden metaphysischen Angebote als doctrina christiana. Und nun endlich Kurt Flasch: »Das Bild von Pisa zeigt die siegreiche Partei«, kommentiert er. Bei anderen Vordenkern der Dominikaner – des neuen intellektuellen, innerstädtisch aktiven und schon bald an den Universitäten hegemonialen Interventionsordens –, nämlich bei Albert (dem Großen), bei Dietrich von Freiberg und bei Meister Eckhart, zeige sich »ein anderes Bild der Präsenz des Averroes« – und mit ihm bestimmter metaphysischer Thesen, auf die wir hier natürlich nicht eingehen können. »Das Bild zeigt die siegreiche Partei, dem Historiker gefällt die res victa. Verloren haben in diesem Prozess Albert, Dietrich und Eckhart« – nota bene: Dietrich von Freiberg, dessen Werk und Bedeutung für die Philosophiegeschichte ja Kurt Flasch praktisch erst wiederentdeckt hat; und Meister Eckhart, dessen Neuinterpretation er nun sein Buch widmet. Weiter im Text: »Dieser Vorgang ist aus den Quellen zu analysieren.«
Rekapitulieren wir. Erstens: Dem Historiker des philosophischen Denkens gefällt die unterlegene Sache, die res victa der Innovatoren (Albert), streitbaren Dialektiker (Dietrich), welche mitunter gar in den Ruch der Häresie gerieten (Eckhart). Und zweitens: die Bedeutung dieses Siegs/dieser Niederlage »ist aus den Quellen zu analysieren«. In diesen beiden Sätzen haben wir – nein, nicht den ganzen Flasch, aber sehr wohl die politische Widerständigkeit seines historischen Sinns und seines philologischen Berufsethos. Darin ist Flasch übrigens durchaus ein Renaissancemensch oder (in diesem Sinne) ein Humanist. An der Wende zur Neuzeit waren schließlich die humanistischen Philologen die Softwarespezialisten bei der Handhabung eines neuen Mediums der Verkündigung und der Aufklärung, dessen neue hardware Druckerpresse und Flugschrift, die Bücher und das Buch der Bücher, die »Gutenberg Galaxis« begründeten. (Dass Flasch selber aus der GutenbergStadt Mainz kommt, hat zwar nichts zu besagen, aber è ben trovato: das passt ins Bild.) Gerade im textuellen Kosmos von Verkündigung und Überlieferung stellt sich ja die Frage der Kritik: Welcher Text ist überhaupt verlässlich? »Rechne mit Täuschungen!« – so lautet die erste Regula ad directionem ingenii des Philologen Kurt Flasch, auch für heutige Zeiten »geistiger Mobilmachung«. Wenn »Beweise« für die unmittelbar bevorstehende Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen per Video- oder Internetkopie aus den Dossiers der Sicherheitsberater und Generalstäbe in die TV-Prime Time kommen (und manchmal auch umgekehrt), dann besteht Flasch darauf: »Du hast ein Recht darauf unsicher zu sein, vielleicht sogar die sauer werdende Pflicht, diese Unsicherheit auszuhalten. Nachher sagen immer viele: Das haben wir nicht gewußt.« – I am not convinced, sagte einmal ein deutscher Außenminister. Leider gebrauchte er bei anderer Gelegenheit, um sich und andere von der Notwendigkeit einer anderen militärischen Intervention zu überzeugen, das falsche Argument, die moralische Overkill-Rhetorik »Auschwitz« (mit welcher schon Heiner Geißler die Debatten des deutschen Bundestags um Nachrüstung und Frieden bereichert hatte). Politisches Urteilen braucht Quellenkritik. Die dafür unabdingbaren Tugenden einer medialen Skepsis – welche Überlieferung ist verlässlich? welche Übersetzung passt zum Kontext? welcher traduttore ist ein traditore? – pflegen nun seriöse Philologen schon ex professio, und dies seit über einem halben Jahrtausend: Welche ideologischen Effekte haben, welche politischen Affekte bewirken diese Transkription oder jene Übersetzung der Heiligen Texte, der Vulgata, der Septuaginta, überhaupt des biblischen Kanon? Ist nun diese oder jene Version eines angeblichen Traktats des Philosophen verlässlich? (Mit dem Philosophen par excellence war natürlich Aristoteles gemeint – und indirekt häufig auch seine arabischen Überlieferer, Verwerter, Kommentatoren: Ibn Sina, Ibn Ruschd). Und sind die vorgelegten historischen Dokumente überhaupt echt – oder handelt es sich um Fälschungen? Etwa die famose »Konstantinische Schenkung«, mit welcher der Bischof von Rom seine weltliche Souveränität im Kirchenstaat legitimierte? Ein Lorenzo Valla (welcher die Donatio Constantini enttarnte), ein Erasmus von Rotterdam, oder später ein Isaak Casaubon waren doch zugleich Philologen und politische Denker. Und in etwas anderer Hinsicht gilt dies sogar für (neu)platonische Philosophen und Philologen, wie den Florentiner Marsilio Ficino oder den Juristen, Mathematiker und Kirchenpolitiker Nikolaus aus Kues an der Mosel. Letzterer ist auch einer von Flaschs denkerischen Helden. Politisch war der Cusaner wohl kein Held – eher ein Epimetheus: seinen Dialog zur interreligiösen Toleranz schrieb er schließlich post factum, nachdem Konstantinopel bereits von Sultan Mehmed II. erobert war.
Ich schaue auf die Uhr – und habe gerade mal drei Sätze unseres Preisträgers vorgelesen, mir eine Erläuterung und zwei Randbemerkungen erlaubt und doch bereits die Hälfte meiner Redezeit verbraucht! Und dies, ohne bisher überhaupt darauf eingehen zu können: — dass Flasch zwar Hannah Arendts catonische »Rückforderung« der Geschichte praktiziert – er tut dies en détail seiner philosophischen Forschung, und dabei moniert der Herr Professor einen jeden, der hier ohne Belege operiert, mit falschen Zitaten oder ohne präzise Kontextualisierung (wie zuletzt Papst Benedikt in seiner Regensburger Rede); — und dass Flasch gewiss auch Hannah Arendts anti-teleologische Kritik an jeder Geschichtsphilosophie des (automatischen oder strukturellen) Fortschritts teilt; — aber dass Flaschs eigenes Verständnis von Philosophie wie auch seine professionelle Praxis dieser Disziplin dem Philosophieren von Hannah Arendt gänzlich entgegengesetzt ist. Im Gegensatz zur kämpferischen Existentialistin Hannah Arendt ist Kurt Flasch ein zwar skeptischer, doch selbstbewusster Historist. Der heilige Augustinus etwa ist für beide ein lebenslanger Diskussionspartner und Stein des Anstoßes; doch mit seinen Texten gehen sie auf entgegengesetzte Weise um. Wo Arendt, bis in die Exzerpte ihrer Denktagebücher hinein, bis in ihre Vorlesungen zum »Leben des Geistes«, bei Augustin als der großen philosophischen Liebe ihres Lebens aktualisierbare, lebbare, evidente Sätze sucht (und findet), da widerlegt, dekonstruiert – besser noch: da zerstört Kurt Flasch jede Möglichkeit heutigen Wiedererkennens von Augustins Stimme, dessen Sprache er selber doch – und dies wiederholt – in heutiges, flüssig lesbares Deutsch gebracht hat. Lesen Sie nur Was ist Zeit? (22004), also den Flasch’schen Kommentar zum XI. Buch der Confessiones des Bischofs von Hippo. Was die republikanische Existentialistin und den skeptischen Historisten freilich dennoch – abseits dieses schwerlich vermittelbaren Kontrasts – verbindet, das ist die beständig, gewisserma- ßen »selbstverständlich« kämpferische Gestalt ihres Philosophierens: Der Kampf der Interpretationen ist weder für Arendt noch für Flasch ein »Ausnahmezustand«, eher schon die Regel – und natürlich misstrauen beide der Rede vom »letzten Gefecht«. Ob nun im republikanischen Agon zwischen Bürgern oder ihren Wortführern um die (jeweils) heute angemessene Politik des Gemeinwesens oder beim argumentativen Wettstreit mittelalterlicher Magister um die Erkennbarkeit Gottes und der Welt – der Streit als Form von Recherche, opponendo per modum inquisitionis (Dietrich von Freiberg), ist für Kurt Flasch wie für Hannah Arendt nicht das Gegenteil von Wahrheit, sondern ihre Existenzform. Dann aber ist auch die Wahrheit nicht die eine, die ewige, welche aller empirischen Vielfalt, allem Werden und Vergehen zugrundeliegt, sondern Wahrheit selber ist endlich und zeitlich und vielfältig. Auch darum darf Politik sich nicht als Durchsetzung einer (der definitiven) Wahrheit verstehen. Das Politische bewährt sich vielmehr durch das Immer-wieder-Urteilen: »Ist die Urteilskraft ein Vermögen, das sich mit der Vergangenheit befasst, so ist der Historiker der Mensch, der sie erkundet und, indem er sie erzählt, über sie zu Gericht sitzt« – schrieb Hannah Arendt in einem ihrer letzten Texte, welcher ins eingangs erwähnte Cato-Zitat mündet. »Wenn das so ist, können wir unsere menschliche Würde von der Pseudogottheit der Neuzeit, Geschichte mit Namen, zurückfordern, gewissermaßen zurückgewinnen.« Der historische Philosoph Kurt Flasch sitzt freilich eher zu Gericht über diejenigen, welche meinen, auf einer unzureichenden Indizienbasis urteilen zu können – und der kritische Philologe plädiert in solchen Fällen auf Revision.
Der bremische Hannah-Arendt-Preis erinnert mit seiner Namensgeberin daran, dass »der Sinn der Politik Freiheit (ist)«. Diese Freiheit ist freilich nie einfach gegeben, man muss sich die Urteilsfreiheit immer wieder nehmen, zurückfordern, erkämpfen. Kurt Flasch hat sich diese Freiheit im Denken gerade dort genommen, wo niemand anders sie suchen würde: in der mittelalterlichen Philosophie. Doch ist Philosophiegeschichte à la Flasch gerade kein Ruheplatz für schöne Seelen, zeitlose Probleme und Klassikerzitate. Noch seine Standardwerke zum Heiligen Augustinus, zu Dietrich von Freiberg, zu Meister Eckhart oder Nikolaus von Kues sind zugleich ideenpolitische Streitschriften – und sie wurden und werden immer wieder von ihm selbst überholt, revidiert, emendiert. Von Flasch behandelte »Klassiker« kommen nicht mehr zur Ruhe: Allein vier völlig verschiedene Bücher (1973, 20083, 2001, 2004) hat er Nikolaus von Kues gewidmet – und keines möchte man missen! Wenn nämlich Kurt Flasch philosophische Klassiker liest – aber das, liebe Mitbürger der respublica litterarum, müssen Sie schon selber nachlesen – so zelebriert er sie nicht, sondern führt uns ein in ihre »Kampfplätze«. Auf ihren Gemeinplätzen, ihren loci communes, durch die Topoi ihrer Argumente und Beweisgründe lernen wir, die politischen und religiösen Parteien, die philosophischen wie kulturellen Konflikte ihrer Zeit zu verstehen – und zu kritisieren. Alles verstehen heißt gerade nicht, alles zu verzeihen: Wie war es möglich, dass sich nahezu die Gesamtheit der bedeutendsten deutschen Denker beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs in die »Geistige Mobilmachung« des Kaiserreichs einspannen ließ? Kurt Flasch hat diese Frage nicht gelöst – aber er hat sie, eindringlich, in einer viel zu wenig bedachten Monographie gestellt. Freilich ist Kurt Flasch weit davon entfernt, das philosophische Ringen um den Ort der Wahrheit im Leben auf ideologische oder Interessenkämpfe zu reduzieren. Mit dem deutschen Kardinal Nikolaus von Kues hörte er »die Wahrheit auf den Gassen schreien«; Giovanni Boccaccios Erzählungen nach dem schwarzen Tod von Florenz übersetzte er neu, um auf den dramatischen Geschmack des Lebens, Liebens, Sterbens zu kommen; in den vernünftigen Argumenten des vermeintlich »deutschen Mystikers« magister Eckhart entdeckt er Traditionslinien der arabischen Philosophie. Eines seiner faszinierendsten Werke ist Flaschs Kommentar zur in dreißig Kerkerjahren entstandenen »philosophischen Poesie« eines revolutionären Mönchs, des ebenso sehr platonisch-eleatischen wie sensualistischen Weltendenkers Tommaso Campanella (1568– 1639).
Die offenen Grenzen, die umstrittenen Grenzziehungen und unweigerlichen Überlappungen von Vernunft und Offenbarung – zwischen Philosophie und Religion, zwischen Glaubensgewissheit und Wissenschaft – mussten Kurt Flasch zum Thema werden: im Verlaufe der Geschichte des lateinischen Okzidents, aber auch noch in jüngster Zeit. Denn Flasch ist wohl der deutsche Wissenschaftler, welcher die eindringlichsten und streitfreudigsten Kommentare sowohl zur päpstlichen Enzyklika Johannes Pauls II. Fides et ratio verfasst hat als auch zur »Regensburger Rede« Papst Ratzingers. Er hat beide Kirchenmonarchen als Denker ernstgenommen, und daher widersprach er in beiden Fällen einem allzu idyllischen römischen Bilde der providentiell prästabilisierten Harmonie von christlicher Religion und westlicher Vernunft – doch das betroffene Schweigen einiger deutscher Theologen zu Papst Benedikts philosophischen faux pas schrie in seinen Augen zum Himmel. In der Tat, bei magister Flasch lernen wir, ein Bewusstsein der religiösen und kulturellen Vielfalt der Traditionen des politischen und philosophischen »Westens« zu entwickeln. Schon die Kenntnis der Einflüsse »muslimischer« Philosophen in der »Aufklärungs«- Tradition des Mittelalters könnte uns davor bewahren, die im 21. Jahrhundert bevorstehenden zivilisatorischen Herausforderungen und Konflikte als eine bloße Verteidigung des Westens (von Freiheit, Vernunft, Christentum) gegen »den Islam», »den Fernen Osten«, die Barbaren und Fundamentalisten misszuverstehen. Die kritische Vernunft ist keine Festung Europa. Lieber Kurt Flasch – Ihr philosophisches Abendland ist weder ein dorischer Tempel noch eine gotische Kathedrale, sondern ein umstrittener Ort der Begegnungen von Athen und Jerusalem, zwischen Rom und Byzanz, zwischen Bagdad und Toledo – mit ziemlich mobilen Grenzen zwischen Aufklärung und Offenbarung, zwischen Orient und Okzident, zwischen Eigenem und Fremden. Ihr streitbares, weil denkendes Traditionsbewusstsein können wir heute, gerade im politischen Westen, verdammt gut gebrauchen. Denn auch vor Fälschungen der Aufklärung sei gewarnt. Gerade haben sich im Minarett-Streit unter den Schweizer Eidgenossen ausgerechnet die schlechtesten Argumente Voltaires durchgesetzt – und zwar mit plebiszitären Methoden, in einer Art Karikatur der rousseauschen Volksherrschaft. Die verbotenen Minarette sahen auf dem Plakat aus wie Raketen. Wo die Angst obsiegt, unterliegt die Neugier. Und die Chancen schwinden für zivilen Konflikt, für bürgerlichen Streit.
Denken heißt immer Entscheiden
Wenn ein so bedeutender Kenner der spätantiken und mittelalterlichen Philosophie mit einem Preis geehrt wird, der den Namen Hannah Arendts trägt, dann ist das gelinde gesagt, überraschend. Dem Nachdenkenden wird möglicherweise bald ein Licht darüber aufgehen, was und inwiefern Hannah Arendts politische Ethik mit Kurt Flaschs Geschichte des mittelalterlichen Denkens zu tun hat, überhaupt mit seinem Denken, oder auch nicht! Jedenfalls werde ich nicht damit anfangen, das arendtsche Element entdecken zu wollen. Ich begäbe mich damit nämlich in die Hände eines Vorurteils oder schlimmer noch: in die Falle einer unangemessenen Aktualisierung von Flaschs Denken. Und das ist – so glaube ich aus seinem Werk folgern zu dürfen – ein a priori zum Scheitern verurteilter Versuch jeder Erkenntnis geistesgeschichtlicher Zusammenhänge. Zunächst ist zu akzentuieren, dass die beiden großen philosophiegeschichtlichen Werke Kurt Flaschs, nach seiner Dissertation über Thomas von Aquins Ordo-Begriff, nämlich über Augustin und über die mittelalterliche Philosophie, nicht etwa wie üblich den Titel tragen »Geschichte der Philosophie« oder »Augustins Philosophie«, sondern charakteristischerweise an die Stelle von Philosophie den Begriff »Denken« setzen: Augustin. Einführung in sein Denken (1980) und Das philosophische Denken im Mittelalter (1986). Das ist nicht selbstverständlich! Durchweg alle relevanten Philosophiegeschichten und Übersichten – von Wilhelm Windelband über Heinz Heimsoeth zu Johann Hirschberger und Karl Vorländer bis hin zu Rüdiger Bubner und Wolfgang Röth verwenden den Begriff »Philosophie« im Sinne von »Systemangebot«. Mit Flaschs Abweichung von dieser terminologisch eingeübten Praxis ist implizit angedeutet, dass es nicht um die Darstellung von Systemen geht, sondern um die Beobachtung von Denkprozessen, und das bedeutet als Konsequenz auch: Das Denken Augustins und das Denken im Mittelalter sollen nicht als eine in sich notwendige quasi geistesteleologische Entwicklung betrachtet werden, sondern als ein kontingentes Ereignis. Mit der Kategorie »Ereignis« bin ich der Spezifik von Flaschs eigenem Denken einen Schritt näher gekommen: Denn seine spezifische Ansicht, das Denken der Philosophie sei nicht deduktiv aus einem ersten Prinzip ableitbar, sondern entstehe überraschend aus jeweils unvorhersehbaren historischen Anstößen, hat notwendigerweise zur Folge, dass jede philosophische Station des Mittelalters bei ihm mit dem Introitus »Die geschichtliche Situation« beginnt. Man könnte das für eigentlich selbstverständlich halten, aber es stellt doch, wie gesagt, eine sehr dezidierte Abweichung von der Kontinuitätsannahme beim philosophischen Begriff dar, weg von dem, was Kant »eine philosophierende Geschichte der Philosophie« nannte oder Windelband als Ablaufsgeschichte von Problemen und Begriffen verstand. Vielmehr ist es der Zeitpunkt und die Zeit selbst, die für Kurt Flasch beim philosophischen Denken den Ausschlag geben, durchaus im Sinne des von ihm ansonsten eher distanziert gesehenen Hegel, nämlich seine »Zeit in Gedanken zu fassen«. Zwei Titel verweisen besonders auf eine für Flasch charakteristische Perspektivierung, die sich aus der Betonung von Diskontinuitäten ergibt, nämlich das Agonale zwischen den Denkern: Es sind die Titel Kampfplätze der Philosophie. Große Kontroversen von Augustin bis Voltaire (2008) sowie Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg. Ein Versuch (2000).
Ich brauche nicht zu erklären, warum die Idee von der Philosophie als ein Kampfplatz so sympathisch ist. Denn wo es um den höchsten Einsatz geht, kann man auch verlieren. Und so ist der erste Blick darauf, wie die einstige Zentralfigur der mittelalterlichen Philosophie, Thomas von Aquin, in Flaschs philosophiegeschichtlicher Darstellung von 1980 erscheint, sofort ein Eye-Opener: Man begreift Thomas als Intellektuellen, der mit anderen Intellektuellen konkurriert. Denn im Unterschied zu früheren Philosophiegeschichten – etwa von Johannes Hirschberger, dessen Assistent der junge Flasch gewesen ist und dem er bei aller späteren Differenz in einem entscheidenden, sozusagen systematischen Punkt gefolgt ist: der Betonung der platonischen Tradition, sei es bei Augustin, sei es im Hochmittelalter – im Unterschied zu Hirschberger also gibt Flasch keinen großen Raum der Summa theologica, die auch zu meinem Kölner Studienbeginn noch als die Quintessenz des großen »Aquinaten«, wie man damals sagte, angesehen worden ist. Stattdessen sucht Flasch Thomas’ Gedanken dort auf, wo sie ihm wirklich originell erscheinen, nämlich wo dieser der sinnlichen Erkenntnis ein grö- ßeres Gewicht einräumt: Originalität also, nicht Systemgedanke! Und ganz bestimmt nicht die These von einer Art »christlichem Humanismus«, unter welchem Titel viele Ausleger von Thomas’ unterschiedlichen Ethiken aus Stoa, Platon, Aristoteles, Augustin und Seneca diese synthetisieren. Thomas, so Flasch, hat den Gedanken von der Kraft des reinen Denkens entwertet, indem er zwischen Substanz und »Daseinsakt«, wie Flasch das nennt, unterschied und das alles im Dienste einer philosophischen Verteidigung der christlichen Religion, indem Thomas die aristotelische Wissenschaftslehre kritisch auf die Theologie anwandte. Das setzte die Kenntnis der Kritik von Averroes an dem anderen großen arabischen Denker Avicenna voraus, nämlich die Frage nach der Unterscheidbarkeit von Substanz und Akzidenz. Welch ein lebhafter Schauplatz der Argumente! Und Flaschs Darstellung dessen liest sich wie ein Drama.
Hier breche ich ab und sage: Indem Flasch die Geschichte der Philosophie beziehungsweise der Theologie als intellektuelle Entscheidungssituation begreift, die so oder so entschieden werden kann, ergibt sich notwendig der Blick auf etwas Neues: erstens auf den dezisionistischen Charakter des Denkens und zweitens auf seinen argumentativen Modus. Dann rücken plötzlich Namen nach vorne sowie neben solche, die in traditionellen Philosophiegeschichten allein als Klassiker stilisiert werden. Dabei fallen in Flaschs Darstellung neben dem Kriterium der Originalität des Denkens auch das Kriterium des Epochalen der geschichtlichen Situation zusammen: Ob Abaelards Häretik, ob die Herausforderung der christlichen Theologie durch die arabische AristotelesRezeption, ob Meister Eckharts Destabilisierung der Metaphysik, ob Ockhams »Messer der Kritik«, ob Petrarcas Ruf nach der wahren Philosophie und schließlich Machiavellis Realismus – alle diese Namen, denen Flaschs besondere theoretische Neugier und Sympathie gehört, haben diese Neugier und Sympathie nicht einfach deshalb, weil Flasch mit ihrem Denken übereinstimmte, sondern deshalb, weil die Kühnheit ihres Denkens den Denker fesselt. Dabei ist eine Unterscheidung notwendig, um die Flasch’sche Antenne für Originalität nicht misszuverstehen: Flasch romantisiert seine Helden nicht als Outsider im Sinne des modernen Existentialismus. Er präsentiert sie in aller Kühle und Fremdartigkeit. Auch das ist nicht selbstverständlich, sondern ein Zeichen von Flaschs enormem intellektuellen Takt. Ja, Takt: Takt gegen- über eben jener Fremdheit, die fasziniert, ohne dass man sie in unsere aktuellen Denkkategorien zerrt, was Beeinflussung nicht ausschließt. Diese Denker haben allerdings mit Flasch etwas Entscheidendes gemeinsam: Sie synthetisieren nicht, sie bringen das vorhandene System nicht noch mehr zur Harmonie, sondern sie sprengen es. Flaschs Beschreibungen solcher Sprengvorgänge sind die Höhepunkte seiner Bücher. Es lohnt sich, genau hinzuschauen, wie er die schon genannten Abaelard, Averroes, Meister Eckhart, Wilhelm von Ockham, Petrarca und Machiavelli als agonale Denkimpulse charakterisiert. Im Unterschied zu gängigen Terminologisierungen ihres Denkens sind sie zunächst für Flasch alle »Intellektuelle«. Abaelard wird einerseits – wie es übrigens inzwischen auch die generelle Lesart ist – als einer der »bedeutendsten Denker des Mittelalters« vorgeführt. Aber eben mit den charakteristischen Strichen von Flaschs auf den Punkt kommender Zeichnung: »Er suchte den Streit«, aber war kein einseitiger Revolutionär. Seine intellektuelle Beweglichkeit war eingebettet in die Diskurse seiner Epoche. Abaelard wird vorgestellt als der Entdecker einer »unüberspringbaren Subjektivität«, einer Individualität, die als »Abaelard und Heloise«-Legende dem Bildungsbürgertum seit Anfang des 19. Jahrhunderts zu anheimig wird. Denn das genau ist nicht Flaschs Interesse, sondern der theoretische Begründungsakt von Abaelards Individualitätsidee: sein Zweifel an der Realität des Allgemeinen zugunsten der »einzig realen Individuen«. Ich habe noch nie den berühmten Universalienstreit zwischen sogenannten Realisten und sogenannten Nominalisten so anschaulich aus einer historischen Entscheidungssituation heraus dargestellt gelesen. Dabei ist es wiederum typisch, wie Flasch Abaelards Plädoyer für den Individualismus getrennt hält von dem, was man psychologischen Nominalismus nennt. Ohne dies hier weiter zu erklären, ist nur zu unterstreichen, dass Abaelards Sprachtheorie eine Rolle spielt. Und Sprache, nicht bloß Sprachtheorie, ist nun als das weitere Apriori des Denkens von Kurt Flasch selbst zu emphatisieren, worauf ich zum Schluss zu sprechen kommen werde.
Einen historischen Sprung vom frühen 12. ins frühe 14. Jahrhundert machend, blicke ich auf das Bild, das uns Flasch von dem Denker gibt, den er nicht nur nachdrücklich im Werk Das philosophische Denken im Mittelalter behandelt, sondern dem er neben Augustin ein eigenes Buch gewidmet hat: Meister Eckhart. Die Geburt der deutschen Mystik aus dem Geist der arabischen Philosophie (2006). Da es mir nicht um eine ideengeschichtliche Erinnerung anhand Flaschs geht, sondern um Flaschs eigenen Wahrnehmungsstil, möchte ich Sie nur ermuntern, seine Schilderung von Eckharts Pariser Attacke auf Thomas von Aquins aristotelische Identifizierung von Sein und Erkennen zu lesen, Seite 464 folgende im Werk Das philosophische Denken im Mittelalter: Sie bekommen dann eine Vorstellung vom scharfsinnigen Sprung Eckharts aus der vorgegebenen Denkbahn der ontologischen Theologie. Aber auch von der energetischen Anteilnahme Flaschs an diesen Sprüngen innerhalb der Vorgeschichte der neuzeitlichen Subjektivität. Eine ähnliche Demonstrationsfigur für den Sprung innerhalb des »Argumentationsstandards«, ein für Flaschs Terminologie charakteristischer Begriff, ist des Oxforder Philosophieprofessors Wilhelm von Ockhams Häresie, der, um dem Prozess der Kurie gegen ihn 1328 zu entgehen, nach München floh und eine neue Wirklichkeitskonzeption und individuelle Freiheitserfahrung formuliert hat. Das Originelle an seinem Denken war, dass er den Versuch, Theologie als Philosophie auszugeben, als unhaltbar zurückwies und dagegen die voluntaristische These stellte, Glauben hieße, zuzustimmen ohne Evidenz zu haben, nämlich aufgrund des »Befehls des Willens«. Ich glaube, die besondere Sympathie Flaschs für Ockhams Einfall liegt in dessen Misstrauen gegenüber der Ansicht, wo es theoretische Wörter gäbe, gäbe es auch die entsprechenden Realien. Das ist ja eine sehr aktuelle Problematik. Oder besser: Diese hat sich mit Hilfe des deutschen Idealismus, der ja auch das Denken gegenüber der Realität überschätzte, bis heute in Varianten in Deutschland erhalten. Und Flasch ist, trotz seiner Sympathie für die platonische Tradition, eben ein Erbe des Realismus, sagen wir: ein praktizierender Realist, das heißt ein skeptischer Beobachter von intellektuellen Positionen. Aber er ist es aufgrund von semantischer Hellhörigkeit – nicht als ein Verfechter irgendeiner Realismus-Theorie. Klar jedenfalls wird hier, wenn man es nicht vorher schon wusste: Metaphysikkritik aus sprachanalytischem Instinkt ist das Mindeste, was man über Flaschs eigene Position sagen kann und sagen darf. Von daher auch sein so lebhaftes Interesse für die beiden italienischen Gestalten, die unmittelbar in die Neuzeit führen und dem gebildeten Laien am ehesten bekannt sind: Petrarca und Machiavelli. Nichts könnte für Flasch gerufener kommen als Petrarcas Satz »Vor allem liebe ich die Philosophie, nicht allerdings die geschwätzige, schulmäßige, windige, sondern die wahre«. Auch bei Petrarca der Einwand an die Adresse der zeitgenössischen Philosophen, sich nicht mit bloßen Termini zu begnügen, sondern zu den Sachen zu kommen. Und diese Fähigkeit war bei den Zeitgenossen Petrarcas ebenso wenig zu finden, wie sie Kurt Flasch als Historiker des philosophischen Denkens zweifellos auch bei einigen zentralen Philosophen unserer Epoche vermisst. Wer war der größte Realist, nicht geschwätzig, nicht windig, unter den Denkern nach Petrarca? Zweifellos Machiavelli, der nicht umsonst, ähnlich wie Hobbes, den moralistischen Nachkriegsphilosophien in Deutschland – trotz seiner Ehrenrettung durch Hegel – Anathema blieb, unverstanden blieb nämlich seine konkrete Analyse der Welt. Eric Voegelin wurde noch vor vierzig Jahren wegen seines Plädoyers für Machiavellis Realismus von seinem Münchner Lehrstuhl weggeekelt nach Stanford. – Flaschs ebenso beredte Advokatur für Machiavelli als einem Denker, der »seine Zeit in Gedanken fasste«, wird nicht mehr von solchem Verdacht begleitet, nachdem der Florentiner Autor des Principe nicht mehr für die faschistische Adaption seines Werks verantwortlich gemacht wird. Abermals erkennt Flasch, dass Entfernung von der Universitätsphilosophie die Originalität eines Denkers eher stärkt als schwächt: Indem Machiavelli spätmittelalterliche Vorstellungen fernhielt von seiner Erfahrung des neuen Jahrhunderts, indem er nämlich die Machtlosigkeit der Moral zur Verbesserung des menschlichen Lebens zum Ausgangspunkt seiner Macht- und Staatstheorie nahm, umso tiefer drang er ein in die nicht mehr von spirituellen Instanzen geprägte Wirklichkeit, die sich nicht mehr theologisieren ließ: Es ist die phrasenlose historisch-politische Analyse der Gegenwart, der Flasch in Machiavellis Werk applaudiert. In diesem Sinne auch der ungewöhnlich provokative Abschluss von Flaschs Geschichte des mittelalterlichen Denkens: seine kompromisslose Kritik der zentralen Identifikationsfigur des deutschen protestantischen und akademischen Geistes, nämlich an Martin Luther als Intellektuellem. Dieser habe das Argumentationsniveau seiner unmittelbaren intellektuellen Gesprächspartner nicht erreicht. Eine solche Abrechnung mit Luther als einem letztlich reaktionären, intellektuell anspruchslosen Geist muss viele akademische Kollegen – und nicht bloß sie – verletzen und provozieren. So etwas konnte man bisher in dieser Schärfe und mit aktuellen Implikationen nur bei Nietzsche lesen!
Nichts zeichnet den Intellektuellen Flasch so sehr aus wie die Verweigerung gegenüber einer die Widersprüche auflösenden Harmonisierung, einer Pazifizierung des Geistes. Solche Harmonisierung hat meist zwei Varianten, besonders in der deutschen Geisteswissenschaft und Hermeneutik: Entweder wird das Denken eines Philosophen in die Bahnen generell akzeptierbarer Diskurse gelenkt, seien sie nun teleologische, idealistische oder geschichtsphilosophische, oder solches Denken wird aktualisiert nach den Grundsätzen eines »hermeneutischen Verstehens«, das unser sentimentalisches Bedürfnis nach mentaler Wiederkehr des Eigenen befriedigt. Es gibt in der deutschen akademischen Tradition wenig Sinn für den Skandal des nicht im System Unterbringbaren. Man kann den Mangel für solch einen Sinn Biedersinn oder Frömmelei oder – mit Nietzsche – die »Verlogenheit des Systematikers« nennen. Beispielhaft hierfür ist einerseits die Sinnhuberei traditioneller Hermeneutik, etwa die Identifizierung der Poesie mit möglichst philosophisch ausgewiesenen Motiven, siehe die Hölderlin- oder Rilke-Forschung. Oder aber der besondere Fall der altphilologischen Tragödieninterpretation im Namen hegelscher, geschichtsphilosophischer oder zeitgenössischer Soziologie sowie Psychoanalyse. In beiden Fällen läuft es auf die harmonisierende Welterklärung hinaus. Wie sehr Kurt Flasch sich dieser Tendenzen der deutschen (und auch amerikanischen) Universität bewusst ist, zeigt die leitmotivisch immer wiederholte Ironie beziehungsweise Skepsis a) gegenüber der nachkantischen idealistischen Philosophie überhaupt und b) gegenüber ideengeschichtlicher Einebnung des historischen Gedankensplitters. Nun gibt es unter den Flasch’schen Inszenierungen verschiedener Denkdramen zwei Figuren, die zweifellos schon deshalb herausragen, weil ihnen jeweils ein Werk gewidmet ist, Meister Eckhart und Augustin von Hippo: der Erfinder der deutschen Mystik aus arabischen Motiven und der platonische Präzeptor der christlichen Theologie über Luther hinaus bis zu Karl Barth. Ich habe schon aus Zeitgründen nicht vor, Flaschs Verständnis dieser beiden Großintellektuellen des frühen europäischen Denkens zu referieren. Am Beispiel von Flaschs größerer Beziehungsfigur, Augustin, ist aber zu erkennen, erstens inwiefern sich Flasch von hedonistischer Lektüre freihält, der sich aufdrängenden Allusion moderner Subjekt- oder Zeitphilosophie nachzugeben, ganz besonders nicht der geschichtsphilosophischen, die im Falle Augustins weitverbreitet ist. Zweitens inwiefern die »berühmte Unruhe des Herzens« aus dem ersten Kapitel der Konfessionen, sich im Scharfsinn dialektischer Denkimpulse bewegt, nicht im Poesiealbum des nachhegelschen traurigen Bewusstseins. Zunächst: Ich habe mich gefragt, warum Flasch dem frühmittelalterlichen Vater der christlichen Theologie oder dem definitiven Erfinder der abendländischen Religion eine solche Konzentration, im Sinne philologisch-historischer Akribie als auch logisch-argumentativer Denkschritte gewidmet hat. Die halbe Antwort: Es war nicht die Identifikation des Christen Flasch mit Augustins Lehre, deren Endziel in all ihrer institutionell autoritären Gewalt ohnehin Flaschs intellektuellem Temperament zuwiderläuft, wie pragmatisch er auch gerade diesen Aspekt des späten Augustin bestimmt. Die ganze Antwort lautet: Es ist die Anteilhabe Augustins an einem Typus, dessen Anziehungskraft für Flasch schon an verschiedenen Beispielen, von Abaelard bis Machiavelli, deutlich wurde. Auch Augustin war der Repräsentant einer historischen und geistesgeschichtlichen Umbruchszeit am Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus zwischen dem letzten Aufflackern noblen Heidentums in Gestalt Julian Apostatas und den Goten- und Vandalenstürmen. Aber Augustins Erscheinung darin war von viel größerer Konsequenz als die Erscheinungen der oben genannten intellektuellen Elite des Hoch- und Spätmittelalters. Sie war eine welthistorische.
Das Bild dieser welthistorischen Epoche und dieses welthistorischen Mannes zu entwerfen, war gewissermaßen das Masterpiece des Künstlers Flasch nach seinen brillanten kleineren Porträts. Zum anderen fällt Augustin aus der Reihe des Häretiker typs besonders heraus, weil er ja nicht einfach einmal gegen eine herrschende Konvention aufstand (wie Abaelard oder Meister Eckhart), sondern weil in ihm drei extrem polare Positionen miteinander wechselten oder aufeinander stießen: der Manichäer, der neuplatonische Intellektuelle und der institutionengeleitete katholische Theologe und Kirchenpolitiker. Vom Wechsel seiner autobiografisch berühmt gewordenen hedonistisch-sündigen Jugend in Karthago zur Ikone spirituell geleiteter Abstinenz und dem Sinnlichkeitsverbot in Italien ganz zu schweigen. Diese Polarität in einem Geist ist es, was Flasch faszinierte. Von den Confessiones, die neben De Civitate Dei das sind, was der Gebildete von Augustin weiß, macht Flasch charakteristischerweise kein großes Aufheben. Er ist ganz auf die intellektuelle Bewegung Augustins konzentriert. Das zeigt sich besonders an zwei Themen: dem Kommentar von Augustins Zeitanalyse innerhalb von Flaschs großem Werk über Augustin sowie dem Kommentar von Augustins »Gnaden«-Lehre. Ich hatte angedeutet, dass Flasch sich zu Beginn seines großen Augustin-Buchs von 1980 von der existentialistischen Augustin-Deutung distanziert, und das impliziert auch die Zeitthematik. Nichtsdestotrotz hat er nicht nur dreizehn Jahre später dem XI. Buch der Confessiones, in dem Augustin eine spezifische Analyse des Zeitphänomens vornimmt, einen ausführlichen historisch-philosophischen Kommentar gewidmet und dabei Augustins Zeittheorie im Kontext von Zeittheorien des 20. Jahrhunderts – nämlich Bergsson, Yorck von Wartenburg, Husserl, Heidegger, Wittgenstein und Russell – diskutiert. Vielmehr hat er auch im großen Augustin-Buch eine knappe Charakteristik, nein eine rasante, selbstbewusste Überprüfung der scharfsinnigen Zeitanalyse Augustins verfasst, die Flasch auf dem Höhepunkt seines diagnostischen Vermögens zeigt. Man sollte dazu wissen, dass Augustins Demonstration des Zeitflusses als eine Abfolge einander in ihrer jeweiligen Präsenz auslöschender Zeitpunkte zu einem zentralen Thema der modernen Literatur von Goethe über Giacomo Leopardi bis zu Charles Baudelaire werden wird: Es ist das Thema des je schon verlorenen und verschwundenen Augenblicks, das im Werk der genannten Dichter zum Leitmotiv einer Rhetorik existentieller Trauer wird. Dabei spielt Augustin gar keine Rolle! Denn er selbst musste als Anwalt der Ewigkeit aus seiner eigenen Minimalisierung der Zeit im Zeitpunkt, ja in der Aufhebung des ontologischen Status von Zeit überhaupt, keinen der modernen Poetenreaktion vergleichbaren Schluss ziehen. Flasch zeigt lakonisch, dass sich Edmund Husserl, der Autor einer Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, für den Begriff seiner »Jetzt-Punkte« nicht, wie er meinte, auf Augustins Zeitanalyse stützen kann. Flasch macht klar, dass die von Husserl bei Augustin vermutete deskriptive Psychologie beziehungsweise der erkenntnistheoretische Ansatz nicht existiert, das heißt dass es in Augustins Text kein Wort gibt zum Verhältnis von subjektivem Zeitbewusstsein und objektiver Zeit. Sie sehen: Es wird sehr kompliziert. Aber ohne das geht es nicht, will man wissen, wer der Preisträger ist. Ich habe das Thema der augustinischen Zeitanalyse sowie seiner modernen Deutung und Flaschs Reaktion deshalb erwähnt, weil Augustins Zeittext zu den am meisten kommentierten Texten Augustins überhaupt gehört. Natürlich mit der Tendenz, ihr etwas für unser Heute zu entlocken. Flasch stellt sich dem in den Weg. Aber eben differenziert: Partiell gibt er Husserl Recht, indem er konstatiert, dass Augustin nicht um metaphysischer oder theologischer Thesen willen blind gegenüber dem Phänomen von Zeiterfahrung sei. Aber Flasch besteht auf der großen Differenz: unsere Zeitlichkeitsimmanenz und Augustins Ewigkeitspathos. Wie Flasch den einzelnen augustinischen Denkschritten unser Zeitbewusstsein betreffend, folgt, ist selbst ein eindrucksvoller Beitrag zur modernen Zeitphänomenologie.
Der andere Text Augustins, an den sich, wie mir scheint, Flaschs spezifische geistige Affinität zeigt, ist für den modernen Leser der am meisten skandalöse: nämlich die »Gnaden«- Lehre Augustins. Zeigt sich am Beispiel der Zeitdiagnostik vor allem Flaschs eigene analytische Leidenschaft, so am Beispiel der »Gnaden«-Lehre seine von Bildern bewegte Einbildungskraft. Und gleichzeitig eine unkompromisslerische, fast stoische Wahrnehmungsfähigkeit von nicht, wie der aktuelle Akademiker sagen würde, »anschlussfähigen« Denkmotiven! Flasch nennt sein Buch über Augustins »Gnaden«-Lehre Logik des Schreckens (erschienen erstmals 1990, mit Nachwort verbessert herausgegeben 1995). Ohne auf Augustins berühmt-berüchtigten Text De diversis quaestionibus ad Simplicianum von 397 hier näher einzugehen, ist nur eines zu wissen: In ihm wird via einer neuen Lektüre der alttestamentarischen Geschichte vom armen Esau und glücklichen Jakob sowie des Römerbriefs von Paulus von Augustin gnadenlos deklariert, dass Gott den Menschen als solchen nicht liebe, nur wenigen die Gnade der Erlösung vom Höllenfeuer gewähre, und dies ohne jede Begründung, das heißt ohne Rechtfertigung, etwa im guten Werk der also Ausgewählten. Es gibt, so scheint es, keine Gerechtigkeit Gottes. Er ist der Vollstrecker nicht vermittelbarer Willensentschlüsse gegen alle unsere humanitären Vorstellungen.Entgegen den kompromisslerischen Erklärungen unter Augustins Auslegern beharrt Flasch auf dieser Brutalität, ja dem quasi nihilistischen Angebot des Textes. Er spricht vom »metaphysischen Grauen«, das dieser vermittle. Er besteht gegen die Ideenhistoriker, die den Skandal der »Gnaden«-Lehre umgehen wollen, auf dem »Schauder der Vormoderne« in Augustins archaisierender Theorie. Er beschreibt sie mit Worten, die den Sadismus der göttlichen Auswählung herausstellen. Offengestanden: Die Zumutung, dass der Mensch niederknie, um seine blutige Hinrichtung betend zu erwarten, erinnert an die perverse Ästhetik des Schreckens, wie sie in des Erfinders grauenhafter Bilder, nämlich in Lautréamonts Gesänge des Maldoror (1870) vorgeführt wird. Auch dort erscheint ein furchtbares Gottwesen und sein menschliches Opfer. Man könnte auch an Goyas einschlägig kannibalistisches Ungeheuer denken. Aber Augustin ist – auch wenn er einer frühhistorischen Dekadenzzeit entstammt und er zweifellos eine starke emotionelle und imaginative Begabung besaß – kein moderner ästhetizistischer Dichter und Künstler, sondern ein frühmittelalterlicher Theologe, Philosoph und Kirchenvater. Wenn Flasch Augustins skandalöse Auffassung von der göttlichen Gnade nicht unserem Freiheitsbedürfnis und unserer Empfindsamkeit vermittelt, sondern sie einerseits auf ihre Widersprü- che überprüft, vor allem die Vernachlässigung des Menschen durch Augustins Gott, sie andererseits radikal historisch präsentiert, dann kommt darin eine paradoxe Geisteshaltung zum Vorschein, die Flasch selbst als Affinität zum »Reiz der Nichtmoderne« zu erkennen gibt, die ich nun zum Abschluss mit Blick auf das eigentlich Moderne von Flaschs Denken zu verstehen suche.
Dabei muss ich nun doch auf seine, wie soll ich sagen, poetische Autobiografie mit dem Titel Über die Brücke. Mainzer Kindheit 1930–1949 zu sprechen kommen, die mich, selbst Rheinländer und Messdiener, wenn auch niederfränkisch, nicht moselfränkisch, ungemein gefesselt hat in ihrer mit epochenfotografischen Dokumenten ausgestatteter Anschaulichkeit. Nicht zuletzt das sprechende Gesicht der Kasteller Großmutter, deren feines Lächeln sich dem Witz des Enkels offenbar mitgeteilt hat, der schon als Messdiener über verschiedene Argumentationsmöglichkeiten des Menschen ins Sinnieren verfiel, ja schon in scholastischer Manier aus der Tatsache verschiedener Heiligenkörper im Himmel auf dessen Raumdimension schloss, die von der zeitgenössischen Theologie gerade verneint wurde. Ich will mich auf das politische Motiv in diesen Erinnerungen beschränken, um von dort aus Flaschs Einschätzung einer deutschen, nach dem Ersten Weltkrieg aufgetretenen Intelligenz zu markieren, die auf das Deutschland des 20. Jahrhunderts nicht nur in der ersten Hälfte große Konsequenzen hatte. Eine Einschätzung, die ihn selbst als zeitgenössischen Intellektuellen vor allen akademischen Meriten erkennbar macht. Offenbar wird, wie sehr der junge Flasch sowohl den politischen Terror des Regimes wie auch das trostlose Verhalten so vieler in diesem Regime wahrnahm, hierin unterstützt von dem regimegegnerischen Vater im Schoß einer altmodischen, großen, rheinisch-katholischen Familie und unterstützt von einigen groß- artigen Lehrern. Vor allem aber schon das jugendliche Wissen um die Kontinuitäten zwischen Drittem Reich und Bundesrepublikmentalität, nicht bloß in ihrer politischen Kriminalität, sondern in ihrer sozialpsychologischen Spießigkeit. Das sei gesagt, nicht um das Ethos eines antinazistischen bürgerlich-katholischen Elternhauses im Rheinland der Vierzigerjahre herauszustellen, sondern um Kurt Flaschs aktuelle, freimütige, unverkniffene Intellektualität als Gelehrten noch näher zu fokussieren: Denn sie war, wie wir gesehen haben, nicht darauf aus, geistige Phänomene in Ausrichtung einer wie auch immer gearteten Korrektheit zu bringen. Das haben ein Großteil von Flaschs gleichaltrigen Kollegen immer versucht, darunter die berühmtesten Namen der Nachkriegsuniversität. Der Zusammenhang mit Flaschs politischen Jugendmotiven ergibt sich aus der Tatsache, dass die Mehrheit der sich politisch artikulierenden Intelligenz der Flasch’schen Generation und Jüngerer aus einem nationalsozialistischen, zumindest rechtskonservativ nationalistischen Milieu kam. Ihre Tendenz zum teleologisch harmonisierenden Vorgehen, ihre häufig linkskonformistische Denkweise, nicht zu reden von einem nichts mehr kostenden antifaschistischen Gestus, lassen sich als Reaktion aus dieser Herkunft erklären. Umgekehrt wird Kurt Flaschs souveräner, für diese Kreise wahrscheinlich unverständlicher Denkstil, vormoderne Denkformen in ihrer authentischen Motivation zu erfassen, auch erklärbar daraus, dass er zu keiner Kompensation der angedeuteten Art gezwungen war. Das zeigt sich, wie gesagt, schon in Flaschs »coolem« Umgang mit der autoritären Seite Augustins, deren Pragmatik er sogar etwas abgewinnt, weil sich darin Augustins Kritik am bloß kontemplativen Ideal seiner Frühschriften zeigt und weil Theorie als Funktion der Institution behandelt ist, sozusagen eine No-Nonsens-Haltung. Ebenso aufschlussreich ist, wie Flasch die meist akademischen Wortführer beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs und ihre fundamentalistische Begründung des Krieges gegen die beiden westeuropäischen Nationen beschreibt. Gemeinhin werden die Texte und Reden, die Flasch nennt, die von Rudolf Eucken, Ernst Troelsch, Friedrich Meinecke und nicht zuletzt Max Scheler als die »Ideen von 1914« unter quasi protofaschistischen oder präfaschistischen Verdacht gestellt, wobei man natürlich noch aggressivere Wortmeldungen, etwa von Ernst Jünger oder dem jungen Thomas Mann hinzufügen könnte, ganz abgesehen von den definitiv rechtsradikalen Autoren der konservativen »Revolution«, deren Motive unmittelbar in der nationalsozialistischen Ideologie aufgingen. Flasch, der sich, wie gesagt, abgesehen von den beiden Intellektuellen Borchardt und Hugo Ball nur auf die genannten Weltkriegsprofessoren konzentriert, verweigert sich der ideologiekritischen Perspektive einer zensierenden Einordnung in eine angeblich notwendige negative Entwicklung zum Faschismus. Er nennt diese Professorenautoren charakteristischerweise auch »Intellektuelle«, so wie er seine mittelalterlichen Philosophen »Intellektuelle« nannte. Er spricht von einer »geistigen Mobilmachung«, zwar kritisch, aber nicht in polemischer Absicht. Er versteht diese den Krieg begründende Mobilmachung nicht von der Zukunft her, sondern von ihrer geistigen Vergangenheit sowie ihrer unmittelbaren Gegenwart. Hierin steht Flaschs methodische Originalität und philosophische Intellektualität im Kreis der westdeutschen Nachkriegshistorie – sieht man von Reinhard Koselleck ab – singulär da: Er erinnert an eine heute nicht mehr vermittelbare vergangene Gegenwart, etwa die eines Georg Simmel, der im November 1914 vor Straßburger Studenten das Erlebnis der »Mobilmachung« als eine »Offenbarung der Philosophie des Lebens« charakterisierte. Lebensphilosophie also. Flasch verurteilt sie aber nicht politisch, sondern begreift sie in ihren theoretischen Impulsen. Am sprechendsten wird dieser neue Blick auf die abgestrafte deutsche Generation von 1914 am Beispiel der Kriegsbücher Max Schelers, der bedeutendste in Flaschs Reihe. Schelers phänomenologische Bestimmung des Krieges unter einer »Wert«-Kategorie, nämlich der der »Macht«, wird von Flasch ohne moralisierende Beigabe kritisch theoretisch benannt. Dabei ahnt man, dass auch er, wie Max Scheler, von Nietzsches Moral-Genealogie angeregt ist. Diese Objektivität ist umso beeindruckender, als Schelers Denkfehler knallhart und kristallinscharf aufgedeckt sind. Wo Schelers phänomenologischer Blick Flasch beeindruckt, ist, wo Scheler, neukantianischen Einflüssen entzogen, Denken als »Tat« versteht, also dem Ordnungsmotiv Augustins nahe kommt, vor allem, wo er sich abstrakten Diskussionen der Vorkriegszeit entzieht. Sagen wir es so: Flaschs Kritik an Schelers anti-utilitaristischer Kriegsethik lautet anders, als sie heute dem Mainstream der universitären Intelligenz selbstverständlich wäre. Und das, so vermute ich, entspringt nicht bloß Flaschs strengem unparteiischen Forscherblick allein, sondern umgekehrt einer Anteilnahme: der Anteilnahme jedenfalls an Schelers dynamischem Prinzip, dem Prinzip des Wagnisses. Das ist ja genau das, was auch die Agonalität des Denkens ausmacht, weshalb Flasch die großen Kontroversen der Philosophiegeschichte als »Kampfplätze« bezeichnet hat. Die epochengerechte Einschätzung der philosophischen Motivation dieser Geister lässt Flasch ihre reaktionäre Kulturkritik, auch innerhalb der evangelischen Religionsphilosophie und besonders bei Ernst Troeltsch, nicht übersehen. Sein wirklich intellektueller Respekt und seine Sympathie gelten ohnehin dem das italienische Paradigma suchenden Rudolf Borchardt und dem anarchistischen Dadaisten Hugo Ball. Dessen Kritik der deutschen Intelligenz von 1919, nicht zuletzt Balls Polemik gegen Martin Luther als Verhinderer einer aufgeklärten romanischen Welt in Deutschland, scheint ganz nach Flaschs Gusto, auch wenn er die »geisteswissenschaftliche Etikettierung« als Grundfehler nicht nur an Ball, sondern auch an den übrigen Denkern von 1914 kritisiert. Im Zusammenhang von Flaschs Distanz zu idealistischen Systemen ist auch seine Aufmerksamkeit gegenüber Kurt Rieslers Philosophie der Unübersichtlichkeit bemerkenswert.
Und Hannah Arendt? Wie entfernt scheint sie, obwohl die Schülerin Martin Heideggers, von Schelers Kriegsethik, ein Konzept, das sie expressis verbis ausgeschlossen hat? Dass Hannah Arendt das philosophische Konzept einer »Vita contemplativa« von der »Vita activa« her kritisiert, während Kurt Flasch letztere in der »Vita contemplativa« selbst implementiert findet, würde einen interessanten Disput zwischen beiden ergeben. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will in den letzten Sätzen meiner Laudatio keinen künstlichen Anschluss an den Namen Hannah Arendts herstellen. Er wurde mir bei der Lektüre von Flaschs Werk vielmehr von Beginn an evident, auch wenn in ihm der Name der Autorin von The human condition (1958) an keiner Stelle erwähnt ist, obwohl sie bei der Erläuterung des Wortes »Vita activa« von dessen antik-frühmittelalterlicher Bedeutung und Differenz ausgeht. Ich sehe den Zusammenhang auch nicht in dem Umstand, dass Hannah Arendt in Rücksicht auf Augustins Frage, wer er selbst denn sei, diese Frage als unbeantwortbar bezeichnet hat. Vielmehr sehe ich zwei Eigenschaften, die beide Denker trotz aller offensichtlicher Differenz verbindet: Erstens im Verständnis des »Urteil«-Begriffs, der Hannah Arendt im Anschluss an Kant so nachdrücklich beschäftigte, kommt etwas zum Vorschein, das auch bei Flaschs Verständnis denkerischer Prozesse charakteristisch ist: Es gibt keine diskursive Letztbegründbarkeit, Denken heißt immer Entscheiden, heißt zu wissen, was auf dem Spiele steht. Zweitens: Dieses Apriori, das bei Flaschs Darstellung seiner wagemutig kreativen Gedankenhelden immer wieder hervorsticht, ist formuliert in einer Sprache ohne terminologischen Jargon. Das ist nicht einfach nur die Eigentümlichkeit eines brillanten Stils. Darin äußert sich vielmehr gerade die Selbstüberprüfung des Denkens in seiner semantischen Evidenz. Schließlich – und das betrifft Flaschs kulturell gesättigte Intellektualität allein – scheint mir für ihren Ausdruck die fachliche und private Nähe zur italienischen Kultur entscheidend geworden zu sein. Flaschs Übersetzung von Bocaccios Decamerone und sein Kommentar dazu sowie seine Übersetzung von Dantes Göttlicher Komödie, dem fünften und sechsundzwanzigsten Gesang der Hölle, belegen dies vielsprechend. Von daher die passionierte Stellungnahme ohne Rücksicht auf gängige akademische Ansichten, ohne Rücksicht darauf, sich Gegner zu machen, ob sie Gadamer oder Löwith oder wie auch immer heißen. Das impliziert andererseits auch ein Lob, wo man es nicht erwartet, wie im Fall der aktuellen Übersetzung der Ilias durch Raoul Schrott. Grüßen wir also den Preisträger des Hannah-Arendt-Preises, Professor Kurt Flasch, als den ungewöhnlichen Gelehrten und Intellektuellen.
»Die Vergangenheit vergangen sein lassen«
Jeder, der einen Preis bekommt, wird sich so artig wie möglich bedanken. Ich muss es doppelt tun. Denn die Jury hat sich um mich zweifach verdient gemacht. Erstens hat sie mir gleich anfangs mit auffallender Energie erklärt: Der Hannah-Arendt-Preis ist ein politischer Preis. Ich hörte die Befürchtung heraus, es könnte zu akademisch zugehen. Es klang, als sei jemand besorgt, ich könnte als Augustinus-Spezialist die feierliche Gelegenheit missbrauchen, um ein Hühnchen zu rupfen mit Hannah Arendts Dissertation über den Liebesbegriff bei Augustin. Diese Taktlosigkeit war mir tatsächlich zuzutrauen. Aber die Jury hat mich bewahrt vor dieser seelischen Rohheit. Dabei hatte ich noch ganz andere Versuchungen zu überstehen: Herausfordernd war der Meinungsstreit zwischen Hannah Arendt und Karl Jaspers: Sie fand Heideggers Platonauslegung »großartig«, er (im Brief vom 12.4.56, S. 321) nannte sie »lächerlich«. Will denn gar niemand wissen, wer da Recht hatte? Da hätte ich meinen Senf gerne dazugegeben, aber nein, der Hannah-Arendt-Preis – ich war gewarnt – ist ein politischer Preis. Damit komme ich zu einem zweiten, einem gewichtigeren Kompliment an die Jury: Sie hat in meinen Arbeiten als Historiker des Denkens das Politische erkannt. Sie hat das historistische Mimikry eines Spezialisten für abgelebte Zeiten durchschaut. Denn schließlich hat ihr Preisträger sich vorwiegend als Spezialist für Spätantike und Mittelalter betätigt, als Taktschläger des langsamen Geistes, bedeckt vom Bibliotheksstaub uralter Bücher. Auf die politische Pauke gehauen habe ich selten. Manchmal schon, wenn es unbedingt sein musste. Bei der Doppelbeschlussund Nachrüstungsdebatte stand und stehe ich heute noch klar auf Seiten der Gegner von Helmut Schmidt und las in der FAZ, wir Friedensfreunde seien von »winselnder Harmlosigkeit«. Da war sie wieder, die »Immer-feste-druff«-Rhetorik von 1914. Da war sie wieder, die Kritik an Friedensfreunden als dogmatischen, weltfremden Pazifisten. Ich war als Mann vom Fach betroffen; ich wusste es besser: Kants Friedensschrift ist an Realismus schwer zu übertreffen, Erasmus hat nicht gewinselt und war nicht arglos; er hielt fest, als er erklärte, nur Unerfahrenen scheine der Krieg gut: »Dulce bellum inexpertis.« Und dann war da ja auch noch Dante: Er hat die Arbeit am »Paradiso« unterbrochen und in strengster Argumentation, ganz ohne zu winseln, sein Jahrhundert in die Schranken gefordert und scholastisch dafür argumentiert, Friede sei der oberste, und zwar der einzige oberste Wert. – Da hatte der Vergangenheitsspezialist etwas Politisches klarzustellen. Lagen die Gegenstände meiner Arbeit auch oft in der Vergangenheit, das Auge, das sie wahrnahm, lebt mit scharfem Kontrast-Bewusstsein in der Gegenwart. Alles historische Wissen beginnt in der Gegenwart, vergisst dies nur manchmal. Und was war das für eine Gegenwart! 1930 geboren, wurde ich als Kind einer politisch unzuverlässigen Familie angeleitet zur schärfsten Beobachtung von Nazigewalt, Kriegsvorbereitung und -verlauf, von Judenschicksal, Duckmäusertum und kriegsfördernder Rhetorik. Dabei entstand zwischen zwölf und fünfzehn mein Bewusstsein. Die Politik blieb immer präsent. Sie war das Schicksal. Politik und Gegenwartsbewusstsein motivierten meine Monographie über die deutschen Intellektuellen im Ersten Weltkrieg. 1992 erschien mein anti-revisionistischer Artikel in der FAZ mit dem Titel: »War die SA ein Trachtenverein?« Als die Deutschen anfingen, sich als Opfer des Krieges zu beklagen, beschrieb ich öffentlich meine Motive: Warum ich, der ich ihn nur zu gut kannte, vom Bombenkrieg geschwiegen habe. Das waren Randarbeiten, von aufkommendem Brandgeruch provoziert und ohnmächtig verhallt. Ich habe Recherchen zum Begriff der Euthanasie getrieben und eine »Plauderei über Euthanasie« gedruckt; der unbedachte Gebrauch dieser Vokabel läuft ungestört weiter. Solche kleinen Erfolglosigkeiten raubten mir weder Heiterkeit noch Kampflust: Sie betrafen Nebenschauplätze; mein Impuls war umfassender: Ich wollte, ich musste mir nicht nur einen Vers machen – auf Krieg, auf Nazizeit, auf das, was danach kam. Ich wollte wissen, wie es zugegangen ist an den Umbruchstellen der deutschen, der europäischen Geschichte. Ich nenne nur einige Themen: Die Geschichte des Christentums, seine dogmatische Fixierung im vierten Jahrhundert. Seine Umdeutung durch Augustinus. Dessen zwiespältige Erbschaft, wirksam bis heute. Die Pluriformität des langen Mittelalters. Aufklärerische Elemente darin durch Präsenz des antiken Vernunftkonzepts und griechisch-arabischer Wissenschaft. Wie die denkende Menschheit schweren Abschied nahm von der Scholastik. Die Philosophie des Quattrocento. Überhaupt Florenz. Dann die genaue Position Luthers, und sein Konflikt mit Erasmus. Langer Umgang mit Leibniz und Lessing, auch Voltaire. Als Historiker habe ich mich lange mit Bismarck befasst: Seine deutsche Blut- und Eisen-Einheit, die Ausstoßung des alten Kaiserzentrums aus seinem Reich war ein europäisches Unglück, dessen Ausbruch er durch geniale Politik um Jahrzehnte verschieben konnte. Der Erste Weltkrieg. Heute wundere ich mich kaum, dass niemand aufschreit, wenn die sich für gesittet haltende Welt von uns ausgerechnet Polizisten und Soldaten fordert, nicht Krankenschwestern, Verfassungsrechtler oder Ärzte, nein, sie wollen Polizisten und Soldaten. Der Hannah-Arendt-Preis ist, wie mir eingeschärft wurde, ein politischer Preis. Nun, politisch ist das Studium der Vergangenheit, wenn es quellennah bleibt und Aufmerksamkeit einschließt auf den gegenwärtigen Umgang mit der Vergangenheit. Dazu einige ruhigere Überlegungen, auch um die Einschränkungen zu begründen, die dazugehören.
Was wir »Vergangenheit« nennen, ist selbst ein Konstrukt, ein politisch-kulturelles Produkt. – Vergangenheitsspezialisten sprechen zwar von ihren »Quellen« und meinen Chroniken, Urkunden und Briefe, aber niemand darf glauben, diese »Quellen« flössen friedlich, ungebrochen, unbearbeitet in unsere Gegenwart ein. Rückblickendes Selbstverständnis, kollektives wie individuelles, wird gemacht, nicht einfach vorgefunden. Das beginnt schon bei individuellen Lebenserinnerungen. Wir würden Ereignisse nicht behalten haben, hätten wir sie nicht behalten wollen, und wir würden sie nicht behalten wollen, wären sie uns nichts wert und zu nichts dienlich. Erinnerungen, erst recht Autobiographien sind auch ein individualpolitisches Produkt. Selbst steinerne Monumente der Vergangenheit – antike Ruinen und mittelalterliche Burgen – existieren nur noch, wo man glaubte Gründe zu haben, sie zu erhalten. Urkunden und Chroniken wurden aufgeschrieben, um sie zu nutzen zur Erhaltung und Erweiterung eines Vermögens, einer Stadt oder eines Klosters. Nationalgeschichtliche Erinnerungen nehmen gern die Form gro- ßer Erzählungen an in der Art Rankes, der in der Weltgeschichte den Mantel Gottes wehen sah; sie lief ihm in geheimer Teleologie auf die preußische Gegenwart zu. Ob man alte Dokumente aufbewahrt und Leute ausbildet, die sie lesen können, oder ob man ein Stadtarchiv auch mal eben einstürzen lässt, das alles sind politische Vorgänge. Da wird allemal etwas gewollt oder nicht gewollt. Politische, quasi-juristische Streitigkeiten führten seit dem 17. und 18. Jahrhundert zur Entstehung der historischen Wissenschaften. Schon die Polemiken der Reformationszeit hatten große Urkundensammlungen hervorgebracht; jede Seite brachte Dokumente und beanspruchte die Auslegungshoheit. So entstand historisches Wissen als gelehrt-politische Konstruktion. Individuen, Institutionen und Nationen erzeugen von sich kompakte Vergangenheitsbilder. Das Schöne an ihnen ist, sie sind überlistbar. Mit Dokumenten in der Hand lassen sie sich kritisieren und korrigieren. Die Vorgänge, die sie vermelden, wurden auch von anderen gesehen, und zwar anders: Deren Stimmen sind aufzufinden. Konflikterzeugende andere Quellen sind zu suchen und zur Sprache zu bringen. Skepsis ist angebracht, aber kein prinzipieller Skeptizismus. Der politisch und philosophisch querdenkende Bearbeiter der Geschichte hat eine Chance. Daher haben wir wechselnde und unter sich uneinige Darstellungen der Reformation, der bismarckschen Reichseinheit und ihrer Folgen. Nietzsche hatte seinen Kampf mit der protestantisch-deutschen Historikerzunft. Sie feierte Luther als Befreier, vergaß aber hinzuzusagen, wie rasch Obrigkeiten aller Art, Superintendenten, Stadtregierungen und Territorialherren, in die entstandene Lücke drängten. Nietzsche schrieb am 5. Oktober 1879 an Peter Gast, er sei immer weniger imstande, ehrlich etwas Verehrendes über Luther zu sagen. Und dies sei die Wirkung einer mächtigen Materialsammlung, auf die Jakob Burckhardt ihn aufmerksam gemacht habe, das Buch des Katholiken Johannes Janssen (Geschichte des deutschen Volkes, Band II, Freiburg 1877). Er sah: Man muss etwas tiefer ins Mittelalter hinabsteigen und über Deutschland hinaus blicken, um die deutsche Reformation zu bewerten. Handwerksregeln historischer Arbeit sind zu respektieren. Punkt für Punkt, Text neben Text sind sie nebeneinander zu legen: Luthers Verwerfung der Bauernaufstände als Teufelswerk vergleichen mit Machiavellis sozialgeschichtlicher Analyse der Bauernunruhen in der Valdichiana, ebenso Luthers Diskussion mit Erasmus über den freien Willen, präzise, kleinteilig, pedantisch. Für Belehrungsresistente entsteht dadurch der Anschein einer, wie sie sagen, »bloß historischen« Betrachtung. Aber anders ist es nicht zu machen.
Ich wende mich einem zweiten Zusammenhang von Politik und geschichtlicher Orientierung zu und gebe zu bedenken: Individuen und Institutionen, Feuerwehrvereine und Städte, Nationen und Kirchen reißen die Vergangenheit an sich. Sie legitimieren sich als ihr Ergebnis. Ihnen muss der selbstdenkende Historiker oft die Vergangenheit entreißen; er muss das mit Dokumenten machen. In diesem Sinn habe ich meine Diskussion mit Josef Ratzinger am Jahrtausendende im Grand Amphitheatre der Sorbonne geführt und maßvolle Kritik an seiner Regensburger Rede geübt, mit dem Ziel: Die Vergangenheit, sogar die des christlichen Denkens, dem ideenpolitischen Missbrauch zu entziehen, das Mittelalter gegen eine überholte Historiographie zu verteidigen, die Legitimität der Neuzeit begreiflich zu machen und auch unserem Kant ein Minimum von Genauigkeit zu gönnen. Ich hätte ihm auch sagen können, der Herr solle das Vergangene vergangen sein lassen. Das Vergangene vergangen sein lassen, heißt nicht, es zu vergessen, sondern sich dagegen zu stellen, wenn das Gewesene für modische Geschmäcke oder aktuelle Zwecke zurechtgemacht wird. Es soll als Vergangenes gegenwärtig sein. Nur so begünstigt es Freiheit. Das muss ich erklären. Hier gähnt auf beiden Seiten der Abgrund: Die einen lassen die Zeit der Verbrechen zusammenschrumpfen auf zwölf oder vierzig Jahre, und nennen diesen Zeitblock in schonender Umschreibung »die Vergangenheit«. Wenn sie raten, wir sollten die »Vergangenheit« vergangen sein lassen, dann wünschen sie, wir sollten sie auf sich beruhen lassen und nicht länger danach fragen. Die Vergangenheit beginnt aber nicht 1933 oder 1949, sondern etwa bei den Neandertalern. Sie auf ein paar Jahre zusammenschnurren zu lassen, ist sprachlich und gedanklich unerträglich. Verbunden mit der unsäglichen Metapher, jemand sei in die Vergangenheit »verstrickt« gewesen, wird die Redensart zum politischen Skandal. Diese eingeengte Bedeutung des Wortes »Vergangenheit«, die Adorno in der berühmten Rede über Vergangenheitsbewältigung noch durchgehen ließ, ist schlicht falsch und politisch verdächtig. Das Wort »Vergangenheit« bezieht sich auf unsere ganze Geschichte, nicht nur auf die deutsche, sondern auf die Vergangenheit in offener Breite. Das sind ein paar mehr als zwölf oder vierzig Jahre. Aber noch einmal: Vorsicht! Das sprachlich-politische Gelände ist vermint. Lassen sie es uns noch ein bisschen besichtigen. Hat uns doch schon mancher Politiker ermahnt, wir sollten die deutsche Geschichte nicht auf 1933 bis 1945 einengen. Sie sei weiter und größer, zu ihr gehörten auch Bach und die Heilige Elisabeth, die Staufer, Albrecht Dürer und Richard Wagner. Solche Herren evozieren statt der neueren Unglücks- und Verbrechenshistorie die Vergangenheit als Ruhmestempel. Sie berauben die lange Vergangenheit ihrer Vielfalt, ihrer Spannungen und Exzesse, ihrer Befremdlichkeit. Uns nehmen sie die Freiheit, der Geschichte wertend und wählend gegenüber zu treten. Sie lieben die völlig falsche Metapher der »Wurzel«, als seien wir verwurzelt in der Tradition, wie sie sagen. Der Mensch hat keine Wurzeln. Hätte Gott uns verwurzelt gewollt, hätte er Bäume machen müssen. So aber gab er uns Beine, um hinzugehen und zurückzutreten. Wer uns erklärt, wir hätten »Wurzeln« in der Vergangenheit, versetzt uns, statt zu detaillierter Analyse anzuhalten, in die Walhalla seiner Leitkultur: Geht es um deutsche Geschichte, verschwinden deren überregionale Bezüge – alter Orient, Perser, Araber und Juden; verschwiegen bleiben die ungeheuren Schäden, die uns schon der vornazistische Nationalismus eingebrockt hat. Hier lauern auf beiden Seiten Gefahren. Es hilft nur, den Begriff »Vergangenheit« so weit, so langfristig und international zu halten und sich von ihr Rechenschaft zu geben, so gerecht, so hart und so genau wie möglich. Dann tauchen die zwölf oder vierzig Jahre darin schon nicht unter. Wie werden wir also reagieren, wenn uns jemand zuruft, wir sollten die Vergangenheit vergangen sein lassen? Die Formel ist zum Erschrecken vieldeutig. Sie diente dem Vertuschen, dem Wegsehen, dem Ablenken. Welche Kunst des Wegsehens müssen unsere im Land gebliebenen Lehrer, Philosophen, Theologen, Regisseure, Historiker und Schriftsteller zwölf oder vierzig Jahre eingeübt und beherrscht haben, um ihren Staat anerkennungswürdig zu finden und in ihm ihr Handwerk durchhalten zu können. Wirkte die Scheuklappentechnik nicht noch lange nach? Was hat Heidegger an rassistischem Gebrüll überhören müssen, um an die große Wende glauben und die schönen Hände Hitlers bewundern zu können? Und doch sollten wir sehr wohl das Vergangene vergangen sein lassen. Wir sollten es der Aneignungswut entziehen. Es soll sperrig bleiben und Andersheit behalten dürfen. Die GuidoKnopp-History präpariert es zum raschen Konsum. Dagegen mein Lob der Pedanterie, der Aufruf zum Lesen dicker, alter Bücher, das Vergangene genau zu nehmen, es in seiner vergangenen Welt zu belassen. Die historisch-politische, aber auch die individualhistorische Aufgabe gegenüber der Vergangenheit besteht darin, sie so lange zu studieren, bis sie uns fremd anschaut. Größer noch als die Gefahr des Vertuschens der Nazi- und der DDR-Zeit ist die ständige Überformung des Gewesenen, das Überwältigen der Vergangenheit, ihr rasches Vernaschen, ihre zweckvolle Verwendung. Das Gewesene wird zum starren, aber schnell ausgewechselten Bild; es verliert den Charakter von Prozess, von Widerspruch, von Sperrigkeit, also: von Geschichte. Die fortrasende Geschichtslosigkeit delektiert sich an ihm, eignet es sich an zur Herrschaft oder Zier, lernt aber nichts. Eine Furie wütet bei uns, sie bringt das Vergangene als Vergangenes zum Verschwinden. Das kann man mit leiblichen Augen sehen. Viele alte Gebäude werden verputzt, man sagt, um den Stein vor Verfall zu schützen. Solche Denkmalschützer herrschen über das Vergangene, sie halten es zum raschen Konsum verfügbar. Nichts darf alt aussehen, weder Menschen noch Dinge. Alles wird angetüncht, alles Verwertbare geschminkt. Sie streichen Dome an, unterwerfen sich der chemischen Industrie und rühmen sich ihrer Sorge um das Vergangene. Sie geben gotischen Kirchen eine Einheitsfarbe oder tönen sie geschmäcklerisch ab, den alten Stein sehen wir nie. An alten Bauten und alten Büchern tobt sich heute eine dritte Welle der Zerstörung aus. Was Bombenkrieg und die schonungslose Plattmacherei der Wirtschaftswunderzeit zurückgelassen haben, übertünchen heute betuliche Restaurateure mit langweiliger Korrektheit: Das Alte muss proper, »gepflegt«, ordentlich und assimilierbar aussehen. Das Raue, das Schiefe und Abgeblätterte der alten Dinge verschwindet.
Ich schließe mit folgender Überlegung: Die deutsche, die europäische Vergangenheit bedarf ständiger Revision. Ihre kritische Durchsicht ist Aufgabe der Wenigen, die Muse und Methode haben. Sie haben daran ein Leben lang zu tun, sich Rechenschaft zu geben von einer langen Geschichte, von Denkart und Erziehung, von Philosophie und Kunst, Dichtung und Religion. Mit Distanz die Vergangenheit erforschen und aus der Vergangenheit mit Distanz auf die Gegenwart blicken – aber damit solche Gratwanderungen wahr sind und für andere nützlich, müssen sie genau erfolgen, mit strengem philologisch-historischem Beweisanspruch. Drei Elemente gehören zusammen: altmodische Philologie, philosophische Reflexion und politische Wachheit. Dazu die Abgrenzung nach beiden Seiten: Hier verkürzen Konservative die Vergangenheit auf bayrischen Barock, deutsche Leitkultur oder ornamenta ecclesiae. Dort glaubt mancher Nicht-Konservative, er stehe schon links, weil er kein Latein kann. Dagegen hilft nur der politische Sinn und die konkrete Arbeit am geschichtlichen Stoff. Dann wird das Studium der Vergangenheit zum gegenwärtigen Politikum. Davon wäre lange zu reden, aufs Detail kommt es an, aber Details dauern etwas länger. Doch für heute respektiere ich das Zeremoniell und höre jetzt auf, nicht ohne zuvor noch einmal Stiftung und Jury gedankt zu haben für diesen angesehenen Preis.
Dieses Jahr darf ich zum dritten Mal an der Verleihung des HannahArendt-Preises mitwirken. Bisher fand dieses festliche Ereignis immer im Bremer Rathaus statt. Dieses Jahr sind wir zum ersten Mal in den Festsaal der Bremischen Bürgerschaft geladen. Ich bedanke mich bei Christian Weber für diese Gastfreundschaft. Der Hannah-Arendt-Preis ist ein Preis für politisches Denken, er ist ein akademischer Preis und ein öffentlicher Preis. Von daher freut es mich besonders, dass wir dieses Jahr im Haus des Parlaments, der gewählten politischen Vertretung in Bremen, sind. Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken wurde 1994 ins Leben gerufen und 1995 zum ersten Mal verliehen. Den Preis stiften der Senat der Freien Hansestadt Bremen gemeinsam mit der Heinrich Böll Stiftung. Die Preisträ- ger werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt, auf die kein Einfluss genommen wird, und anschließend gemeinsam von den Preisgebern Senat und Heinrich-Böll-Stiftung verliehen. Diese Form der Preisvergabe an sich ist bereits ein Ausdruck für politisches Denken, das sich nicht instrumentalisieren lässt. Hannah Arendt wird in diesem Preis als herausragende Denkerin des 20. Jahrhunderts gewürdigt, die uns ein Vorbild in ihrer Unabhängigkeit von Ideologien und vorgegebenen Denkstrukturen ist. Dieser Preis ist auch Ausdruck des Versuchs, politisches Denken jenseits von Parteipolitik selbst zum Gegenstand des Diskurses einer interessierten Öffentlichkeit zu machen. Der allgemeinen »Politikverdrossenheit«, die in den Medien beklagt wird, wollen wir mit diesem Preis den Wert von Politik, die auf Denken beruht und des Denkens, das auf sein Umfeld rekurriert, entgegensetzen. Kurt Flasch hat in seinen sehr kenntnisreichen und lebhaften Schriften über die mittelalterliche Philosophie – aber auch über die Intellektuellen in der Zeit des Ersten Weltkriegs (Die geistige Mobilmachung) – gezeigt, dass es niemals das beschauliche, ruhige Denken abseits jeder Politik gegeben hat. Das Buch Kampfplätze der Philosophie trägt diesen Ansatz bereits im Titel. Kurt Flasch hat in seinem philosophiehistorischen Schriften – vor allem über mittelalterliche Philosophen – nachvollziehbar gemacht, welche grundsätzliche Konflikte immer wieder Anlass zu Auseinandersetzungen in den verschiedenen Zeitabschnitten bieten konnten. Indem wir verfolgen können, welche Kontroversen jeweils vor dem Hintergrund der vorherrschenden gesellschaftlichen Konventionen, der verfügbaren Erkenntnisse, dem Rahmen der dadurch gesetzten Tabus, geführt wurden, können wir in den Auseinandersetzungen, die jeweilig herangezogenen Kriterien und Maßstäbe entdecken. Wie Antonia Grunenberg es beschrieben hat, sind die Schriften von Kurt Flasch historische Abhandlungen über aktuelle Probleme. Heutige politische Dilemmata zeigen die philosophischen Grundprobleme, die uns seit der Antike begleiten. Es geht um die alten Polaritäten des politisches Denkens: Ethik und Macht, Verantwortung und Freiheit. Der Streit über die gültige, die richtige Bewertung der Welt fand stets im Kontext der jeweiligen Ideenwelt und der machtpolitischen Auseinandersetzung statt. Es gab nie die Philosophie als Denken im luftleeren Raum. Der aus dem zeitlichen Abstand als geradlinige geistesgeschichtliche Entwicklung, gar als Fortschritt »geschönte« und idealisierte Weg von der Spätantike und Mittelalter über die Aufklärung bis in die Gegenwart, wird in Kurt Flaschs Werk hinterfragt. Hier finden wir den Ansatz von Hannah Arendts Denken abseits der LinksRechts-Polarisierung des akademischen Denkens. Damit wird auch die Meinung in Frage gestellt, dass Werte absolut gesetzt werden können und universelle Allgemeingültigkeit besitzen. Der Ansatz weist auf die Relativität des eigenen Denkgebäudes hin, die uns in diesem Denkansatz gewahr wird. Dies ist ein politisches Denken, das sich bewusst ist, dass es eine Begrenztheit der eigenen Denkprozesse gibt. Denken findet statt vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Kontextes, der eigenen Geschichte und der eigenen Lebenswelt. Es ist geprägt von dem eigenen Geschlecht und Alter, sozialer Situation und Umfeld. Auf diese Art der Annäherung finden wir in aktuellen Konflikten, aktuellen politischen Auseinandersetzungen möglicherweise einen kritischen Zugang zu den dahinterliegenden Bedingtheiten.
Der Senat, ich als Bürgermeisterin kommen von der anderen Seite des politischen Denkens. Nicht von der Philosophie, dem intellektuellen Diskurs, sondern von den praktischen Anforderungen, für das Miteinander der Menschen in einem Bundesland. Für das Miteinander der Länder in Deutschland Lösungswege vorzuschlagen, zu überzeugen, durchzusetzen oder auch zu unterliegen. Alltäglich werde ich als Finanzministerin mit Setzungen konfrontiert, bei denen die jeweiligen Denkzusammenhänge im Blick gehalten werden müssen: — Leistung muss sich wieder lohnen. — Anreize für den Mittelstand. — Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen versus Reichtum ist Gotteslästerung. Dieser Preis ist ein Preis wider den Hochmut, wider den Eurozentrismus. Eine Rückbesinnung auf den Kern von Wissenschaft, nämlich Neugier, und das gibt es nur, wenn man nicht per se die eigenen Erkenntnisse für den Nabel der Welt hält. Danke Ihnen, Herr Flasch, für Ihr Werk und der Jury für die Wahl, die eine tröstliche Übereinstimmung im Denken ahnen lässt
Meine Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich in der Bremischen Bürgerschaft begrüßen. Allen voran Frau Bürgermeisterin Linnert, Herrn Prof. Bohrer, Herrn Fücks vom Vorstand der Heinrich Böll Stiftung, die Mitglieder der Jury und natürlich den diesjährigen Preisträger, Herrn Prof. Kurt Flasch. Es ist bisher eher die Ausnahme, dass uns Philosophen besuchen. Deshalb, verehrter Herr Prof. Flasch und Ihnen allen, ein besonderes Willkommen zur ersten Hannah-Arendt-Preisverleihung im Haus der Bremischen Bürgerschaft. Die Politik – das wissen wir, die darin verstrickt sind – steht vor allem im Spannungsdreieck mit den Wählern und den Medien. Aber Philosophie? Nun: Ich denke, sie lebt wie die demokratisch organisierte Politik von der Kraft der Vernunft und vom Diskurs. Etwas, bei dem jeder mitreden und jede sich einmischen kann, unabhängig von Herkunft, Weltanschauung oder gesellschaftlicher Stellung. Und schließlich ist der Hannah-Arendt-Preis ja ein Preis für politisches Denken. Ich konnte im Zusammenhang mit unserem heutigen Preisträger lesen: Philosophie beschränkt sich nicht auf Streben nach Wahrheit und Weisheit. Sie ist auch ein Kampf, ein Streit, ein Konflikt. Als Politiker weiß ich damit etwas anzufangen. Philosophen geraten vielleicht in diese Niederungen, wenn sie sich von einer Schule trennen und sich einer anderen anschließen – oder sich die eigene erdenken. Ich habe heute Morgen im Nordwestradio Herrn Prof. Flasch in einem Gespräch gehört und von seinen Schwierigkeiten mit der Frankfurter Schule erfahren. Da war er, der Streit!
Meine Damen und Herren, auch dieses Haus hat – wenn Sie so wollen – eine Philosophie, die sich insbesondere hier im Festsaal bemerkbar macht. Sie lautet: Licht als Baumaterial. Der Architekt dieses in seiner Entstehungszeit höchst umstrittenen Parlamentsgebäudes, Wassily Luckhardt, setzte auf das Licht als Quelle der Sinne und der Erkenntnis. Er ging mit Glas oder Beton ohne Pathos um, beschränkte sich auf das Notwendigste. Weiße Wände und Pfeiler, die »schwebende Decke« ebenfalls weiß. Luckhardt hat scharfe Kontraste bewusst vermieden. Als der Bundestagsabgeordnete und spätere Berliner Senator für Kunst, Adolf Arndt, 1960 einen Vortrag zum Thema »Demokratie als Bauherr« hielt, stieß er damit eine der interessantesten Architekturdebatten der Nachkriegszeit in Deutschland an: »Sollte es nicht einen Zusammenhang geben zwischen dem Öffentlichkeitsprinzip der Demokratie und einer äußeren wie inneren Durchsichtigkeit und Zugänglichkeit ihrer öffentlichen Bauwerke?« Es geht hier um den Transparenz-Gedanken. Luckhardts Haus der Bürgerschaft kann als eine frühe Verwirklichung dieses Konzepts angesehen werden. Sie werden sagen: Symbolik! Ja, aber Symbole sagen sehr viel über den Zustand einer verfassungsrechtlich verankerten Institution aus. Parlamentarismus, das wissen wir, lässt sich auch über Einlasskontrollen, Bannmeilen und Absperrgitter regeln. Sie befinden sich hier jedenfalls in einem offenen Haus. Mehr noch: Wenn Sie rausschauen, über den Weihnachtsmarkt hinweg, sehen Sie, wie Legislative und Exekutive, Kaufmannschaft
und Bürgerhäuser hier dicht und ungehindert nebeneinander stehen. Das ist das klassische Grundverständnis von Stadtgesellschaft. Oder, wenn wir griechisch und philosophisch bleiben wollen, der Polis. Keine deutsche Länderhauptstadt verfügt über eine vergleichbare demokratische Mitte. Ungeachtet dieser Symbolik müssen wir im Alltag allerdings feststellen, dass die Transparenz und die Einladung zum Mitmachen und Mitgestalten viele Bürgerinnen und Bürger nicht mehr erreichen. Dafür gibt es viele Ursachen, auf die ich hier nicht eingehen will. Nur eines: Verantwortlich dafür sind nicht allein die vermeintliche Entrücktheit und Unfähigkeit der Politikerinnen und Politiker. Ich sage, gerade auch mit Blick auf schwindende Wahlbeteiligungen und unser neues, komplexeres Wahlrecht in Bremen: Wir müssen intensiver denn je um die Menschen und ihre Interessen werben und daran arbeiten, Vertrauen wiederzugewinnen. Wir müssen also handeln, nicht nur, weil nach Hannah Arendt im Handeln Freiheit entsteht. Wir müssen auch deswegen handeln, um Freiheit nicht unter die Räder kommen zu lassen. Wir stehen vor der Situation, dass einerseits das Ansehen der Politiker in der Bevölkerung beständig gesunken und eine Mehrheit vom Politikbetrieb enttäuscht ist. Andererseits erfordern teilweise dramatische gesellschaftliche Veränderungen eine zunehmende politische Gestaltungskraft. Wandel und Fortschritt können wir nicht aufhalten. Aber wir können einen guten Ruf und Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern wiedererlangen – mit Arbeit, die überzeugt, die jeder nachvollziehen und am Ende sogar akzeptieren kann. Womit wir bei der Sprache wären und der Kunst, uns verständlich zu machen. Wir haben heute eine Persönlichkeit unter uns, deren Sprache geradezu bewundert wird: Prof. Kurt Flasch. Damit will ich enden. Ich bin überzeugt, dass der heutige Abend ein ganz besonderer auch für unser Haus sein wird. Und ich würde Sie gerne bei einer der nächsten HannahArendt-Preisverleihungen wieder hier am Platz der Volksvertretung begrüßen dürfen.
Meine Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich in der Bremischen Bürgerschaft begrüßen. Allen voran Frau Bürgermeisterin Linnert, Herrn Prof. Bohrer, Herrn Fücks vom Vorstand der Heinrich Böll Stiftung, die Mitglieder der Jury und natürlich den diesjährigen Preisträger, Herrn Prof. Kurt Flasch. Es ist bisher eher die Ausnahme, dass uns Philosophen besuchen. Deshalb, verehrter Herr Prof. Flasch und Ihnen allen, ein besonderes Willkommen zur ersten Hannah-Arendt-Preisverleihung im Haus der Bremischen Bürgerschaft. Die Politik – das wissen wir, die darin verstrickt sind – steht vor allem im Spannungsdreieck mit den Wählern und den Medien. Aber Philosophie? Nun: Ich denke, sie lebt wie die demokratisch organisierte Politik von der Kraft der Vernunft und vom Diskurs. Etwas, bei dem jeder mitreden und jede sich einmischen kann, unabhängig von Herkunft, Weltanschauung oder gesellschaftlicher Stellung. Und schließlich ist der Hannah-Arendt-Preis ja ein Preis für politisches Denken. Ich konnte im Zusammenhang mit unserem heutigen Preisträger lesen: Philosophie beschränkt sich nicht auf Streben nach Wahrheit und Weisheit. Sie ist auch ein Kampf, ein Streit, ein Konflikt. Als Politiker weiß ich damit etwas anzufangen. Philosophen geraten vielleicht in diese Niederungen, wenn sie sich von einer Schule trennen und sich einer anderen anschließen – oder sich die eigene erdenken. Ich habe heute Morgen im Nordwestradio Herrn Prof. Flasch in einem Gespräch gehört und von seinen Schwierigkeiten mit der Frankfurter Schule erfahren. Da war er, der Streit!
Meine Damen und Herren, auch dieses Haus hat – wenn Sie so wollen – eine Philosophie, die sich insbesondere hier im Festsaal bemerkbar macht. Sie lautet: Licht als Baumaterial. Der Architekt dieses in seiner Entstehungszeit höchst umstrittenen Parlamentsgebäudes, Wassily Luckhardt, setzte auf das Licht als Quelle der Sinne und der Erkenntnis. Er ging mit Glas oder Beton ohne Pathos um, beschränkte sich auf das Notwendigste. Weiße Wände und Pfeiler, die »schwebende Decke« ebenfalls weiß. Luckhardt hat scharfe Kontraste bewusst vermieden. Als der Bundestagsabgeordnete und spätere Berliner Senator für Kunst, Adolf Arndt, 1960 einen Vortrag zum Thema »Demokratie als Bauherr« hielt, stieß er damit eine der interessantesten Architekturdebatten der Nachkriegszeit in Deutschland an: »Sollte es nicht einen Zusammenhang geben zwischen dem Öffentlichkeitsprinzip der Demokratie und einer äußeren wie inneren Durchsichtigkeit und Zugänglichkeit ihrer öffentlichen Bauwerke?« Es geht hier um den Transparenz-Gedanken. Luckhardts Haus der Bürgerschaft kann als eine frühe Verwirklichung dieses Konzepts angesehen werden. Sie werden sagen: Symbolik! Ja, aber Symbole sagen sehr viel über den Zustand einer verfassungsrechtlich verankerten Institution aus. Parlamentarismus, das wissen wir, lässt sich auch über Einlasskontrollen, Bannmeilen und Absperrgitter regeln. Sie befinden sich hier jedenfalls in einem offenen Haus. Mehr noch: Wenn Sie rausschauen, über den Weihnachtsmarkt hinweg, sehen Sie, wie Legislative und Exekutive, Kaufmannschaft
und Bürgerhäuser hier dicht und ungehindert nebeneinander stehen. Das ist das klassische Grundverständnis von Stadtgesellschaft. Oder, wenn wir griechisch und philosophisch bleiben wollen, der Polis. Keine deutsche Länderhauptstadt verfügt über eine vergleichbare demokratische Mitte. Ungeachtet dieser Symbolik müssen wir im Alltag allerdings feststellen, dass die Transparenz und die Einladung zum Mitmachen und Mitgestalten viele Bürgerinnen und Bürger nicht mehr erreichen. Dafür gibt es viele Ursachen, auf die ich hier nicht eingehen will. Nur eines: Verantwortlich dafür sind nicht allein die vermeintliche Entrücktheit und Unfähigkeit der Politikerinnen und Politiker. Ich sage, gerade auch mit Blick auf schwindende Wahlbeteiligungen und unser neues, komplexeres Wahlrecht in Bremen: Wir müssen intensiver denn je um die Menschen und ihre Interessen werben und daran arbeiten, Vertrauen wiederzugewinnen. Wir müssen also handeln, nicht nur, weil nach Hannah Arendt im Handeln Freiheit entsteht. Wir müssen auch deswegen handeln, um Freiheit nicht unter die Räder kommen zu lassen. Wir stehen vor der Situation, dass einerseits das Ansehen der Politiker in der Bevölkerung beständig gesunken und eine Mehrheit vom Politikbetrieb enttäuscht ist. Andererseits erfordern teilweise dramatische gesellschaftliche Veränderungen eine zunehmende politische Gestaltungskraft. Wandel und Fortschritt können wir nicht aufhalten. Aber wir können einen guten Ruf und Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern wiedererlangen – mit Arbeit, die überzeugt, die jeder nachvollziehen und am Ende sogar akzeptieren kann. Womit wir bei der Sprache wären und der Kunst, uns verständlich zu machen. Wir haben heute eine Persönlichkeit unter uns, deren Sprache geradezu bewundert wird: Prof. Kurt Flasch. Damit will ich enden. Ich bin überzeugt, dass der heutige Abend ein ganz besonderer auch für unser Haus sein wird. Und ich würde Sie gerne bei einer der nächsten HannahArendt-Preisverleihungen wieder hier am Platz der Volksvertretung begrüßen dürfen.
Kurt Flasch, Philosophiehistoriker, spezialisiert auf die Spätantike und das Mittelalter und Autor zahlreicher Bücher

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Kurt Flaschs Schule der Skepsis
Philologische Kritik als politische Tugend
Victrix causa diis placuit sed victa Catoni.
»Den Göttern gefiel die siegreiche Sache, aber Cato (dem Älteren) gefällt die unterlegene.«
Das zitierte Motto stand bekanntlich säuberlich getippt auf dem Titelblatt einer ungeschriebenen Abhandlung: »Das Leben des Geistes – Bd. III – Das Urteilen«, welche die Schutzpatronin dieses Preises hatte schreiben wollen. Man fand die (bis auf Titel und Motto) leere Typoskriptseite nach Hannah Arendts Tode noch in ihrer Schreibmaschine. Voilà: Es gibt wohl keine bessere Begründung dafür, daß wir – die Jury eines sich nach der republikanischen Heiligen Hannah Arendt nennenden Preises für politisches Denken – den Alt- und Mittelalterhistoriker der Philosophie Kurt Flasch als diesjährigen Preisträger vorgeschlagen haben. Das zitierte antike Motto könnte fast von ihm selber stammen. Jedenfalls kommt er in einem seiner letzten Werke de facto darauf zurück – eher beiläufig, wie selbstverständlich.
Auf Seite 45 eines Werkes mit dem Titel Meister Eckhart. Die Geburt der Deutschen Mystik aus dem Geist der arabischen Philosophie (2006) erläutert uns Kurt Flasch ein Siegesmonument aus dem Anfang des . Jahrhunderts. Es handelt sich um ein berühmtes Bild des Thomas von Aquino, das in einem Gotteshaus seines Ordens, nämlich in der Dominikanerkirche Santa Caterina in Pisa, zu sehen ist. Wir sehen auf diesem Gemälde den magister (also Professor) Thomas im Zentrum aller Weisheit. In der Tat sollte er schon bald – nach seiner Heiligsprechung – zu jenem doctor angelicus und »Lehrer der Kirche« werden, über den noch vor 130 Jahren ein päpstliches Rundschreiben kündete, in den Lehren dieses heiligen Thomas sei das nec plus ultra menschlichen Nachdenkens erreicht worden: ein »Gipfel, wie ihn die menschliche Intelligenz niemals zu denken vermocht hatte«. Und übrigens: vor elf Jahren hat ein anderer Papst diese These ausdrücklich bekräftigt. Dieser Thomas von Aquino also sitzt im Zentrum des Bildes; seine Gestalt ist größer als alle anderen dargestellten Wahrheitslehrer. Magister Thomas sitzt zwischen Platon und Aristoteles. Vor sich auf seinem Schoße hält er, zum Betrachter hin aufgeschlagen, eine seiner philosophischen Summen, so daß wir ihre Anfangszeilen lesen können. Von Moses, Paulus und den vier Evangelisten inspiriert (wir sehen sie über ihm im Bilde) triumphiert Thomas über den arabischen Aristoteles-Kommentator Ibn Ruschd/Averroes, welcher sich geschlagen zu seinen Füßen duckt. Das im Buche des magister Thomas konzentrierte geistige Licht seiner Philosophie geht aus vom über seinem Haupte erscheinenden Worte Gottes (es geht nämlich aus dem Munde des sprechenden Christus hervor) – und es strahlt direkt auf die unten auf dem Bilde versammelten Theologen aller Orden und Richtungen. Es sind ja (worauf Flasch in seiner ideenpolitischen Lektüre hinweist) keineswegs nur Dominikaner im schwarz-weißen Habit, welche da über des Thomas‘ Summa contra gentiles disputieren, sondern auch Rot- und Braunberockte, alle möglichen Ordens- und Weltpriester. Ihrer aller Köpfe scheinen durch die Strahlen des Lichts der Vernunft mit dem doctor ecclesiae als Umschaltstelle göttlicher Weisheit verdrahtet. Was also das Triumphbild des divus Thomas statuiert oder vorwegnimmt (und es sollte dann später noch andere, drastischere Varianten geben, die diesen Kurs bekräftigen), das ist der Siegeszug des sogenannten Thomismus: Über Jahrhunderte war er die vorherrschende kirchliche Software der philosophischen Interpretation der christlichen Verkündigung; in verschiedenen seinen Varianten und diversen updates (wie »Spätscholastik«, »Kasuistik« oder »Neothomismus«, etc.) triumphierte der kanonisierte Thomismus über alle konkurrierenden metaphysischen Angebote als doctrina christiana. Und nun endlich Kurt Flasch: »Das Bild von Pisa zeigt die siegreiche Partei«, kommentiert er. Bei anderen Vordenkern der Dominikaner – des neuen intellektuellen, innerstädtisch aktiven und schon bald an den Universitäten hegemonialen Interventionsordens –, nämlich bei Albert (dem Großen), bei Dietrich von Freiberg und bei Meister Eckhart, zeige sich »ein anderes Bild der Präsenz des Averroes« – und mit ihm bestimmter metaphysischer Thesen, auf die wir hier natürlich nicht eingehen können. »Das Bild zeigt die siegreiche Partei, dem Historiker gefällt die res victa. Verloren haben in diesem Prozess Albert, Dietrich und Eckhart« – nota bene: Dietrich von Freiberg, dessen Werk und Bedeutung für die Philosophiegeschichte ja Kurt Flasch praktisch erst wiederentdeckt hat; und Meister Eckhart, dessen Neuinterpretation er nun sein Buch widmet. Weiter im Text: »Dieser Vorgang ist aus den Quellen zu analysieren.«
Rekapitulieren wir. Erstens: Dem Historiker des philosophischen Denkens gefällt die unterlegene Sache, die res victa der Innovatoren (Albert), streitbaren Dialektiker (Dietrich), welche mitunter gar in den Ruch der Häresie gerieten (Eckhart). Und zweitens: die Bedeutung dieses Siegs/dieser Niederlage »ist aus den Quellen zu analysieren«. In diesen beiden Sätzen haben wir – nein, nicht den ganzen Flasch, aber sehr wohl die politische Widerständigkeit seines historischen Sinns und seines philologischen Berufsethos. Darin ist Flasch übrigens durchaus ein Renaissancemensch oder (in diesem Sinne) ein Humanist. An der Wende zur Neuzeit waren schließlich die humanistischen Philologen die Softwarespezialisten bei der Handhabung eines neuen Mediums der Verkündigung und der Aufklärung, dessen neue hardware Druckerpresse und Flugschrift, die Bücher und das Buch der Bücher, die »Gutenberg Galaxis« begründeten. (Dass Flasch selber aus der GutenbergStadt Mainz kommt, hat zwar nichts zu besagen, aber è ben trovato: das passt ins Bild.) Gerade im textuellen Kosmos von Verkündigung und Überlieferung stellt sich ja die Frage der Kritik: Welcher Text ist überhaupt verlässlich? »Rechne mit Täuschungen!« – so lautet die erste Regula ad directionem ingenii des Philologen Kurt Flasch, auch für heutige Zeiten »geistiger Mobilmachung«. Wenn »Beweise« für die unmittelbar bevorstehende Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen per Video- oder Internetkopie aus den Dossiers der Sicherheitsberater und Generalstäbe in die TV-Prime Time kommen (und manchmal auch umgekehrt), dann besteht Flasch darauf: »Du hast ein Recht darauf unsicher zu sein, vielleicht sogar die sauer werdende Pflicht, diese Unsicherheit auszuhalten. Nachher sagen immer viele: Das haben wir nicht gewußt.« – I am not convinced, sagte einmal ein deutscher Außenminister. Leider gebrauchte er bei anderer Gelegenheit, um sich und andere von der Notwendigkeit einer anderen militärischen Intervention zu überzeugen, das falsche Argument, die moralische Overkill-Rhetorik »Auschwitz« (mit welcher schon Heiner Geißler die Debatten des deutschen Bundestags um Nachrüstung und Frieden bereichert hatte). Politisches Urteilen braucht Quellenkritik. Die dafür unabdingbaren Tugenden einer medialen Skepsis – welche Überlieferung ist verlässlich? welche Übersetzung passt zum Kontext? welcher traduttore ist ein traditore? – pflegen nun seriöse Philologen schon ex professio, und dies seit über einem halben Jahrtausend: Welche ideologischen Effekte haben, welche politischen Affekte bewirken diese Transkription oder jene Übersetzung der Heiligen Texte, der Vulgata, der Septuaginta, überhaupt des biblischen Kanon? Ist nun diese oder jene Version eines angeblichen Traktats des Philosophen verlässlich? (Mit dem Philosophen par excellence war natürlich Aristoteles gemeint – und indirekt häufig auch seine arabischen Überlieferer, Verwerter, Kommentatoren: Ibn Sina, Ibn Ruschd). Und sind die vorgelegten historischen Dokumente überhaupt echt – oder handelt es sich um Fälschungen? Etwa die famose »Konstantinische Schenkung«, mit welcher der Bischof von Rom seine weltliche Souveränität im Kirchenstaat legitimierte? Ein Lorenzo Valla (welcher die Donatio Constantini enttarnte), ein Erasmus von Rotterdam, oder später ein Isaak Casaubon waren doch zugleich Philologen und politische Denker. Und in etwas anderer Hinsicht gilt dies sogar für (neu)platonische Philosophen und Philologen, wie den Florentiner Marsilio Ficino oder den Juristen, Mathematiker und Kirchenpolitiker Nikolaus aus Kues an der Mosel. Letzterer ist auch einer von Flaschs denkerischen Helden. Politisch war der Cusaner wohl kein Held – eher ein Epimetheus: seinen Dialog zur interreligiösen Toleranz schrieb er schließlich post factum, nachdem Konstantinopel bereits von Sultan Mehmed II. erobert war.
Ich schaue auf die Uhr – und habe gerade mal drei Sätze unseres Preisträgers vorgelesen, mir eine Erläuterung und zwei Randbemerkungen erlaubt und doch bereits die Hälfte meiner Redezeit verbraucht! Und dies, ohne bisher überhaupt darauf eingehen zu können: — dass Flasch zwar Hannah Arendts catonische »Rückforderung« der Geschichte praktiziert – er tut dies en détail seiner philosophischen Forschung, und dabei moniert der Herr Professor einen jeden, der hier ohne Belege operiert, mit falschen Zitaten oder ohne präzise Kontextualisierung (wie zuletzt Papst Benedikt in seiner Regensburger Rede); — und dass Flasch gewiss auch Hannah Arendts anti-teleologische Kritik an jeder Geschichtsphilosophie des (automatischen oder strukturellen) Fortschritts teilt; — aber dass Flaschs eigenes Verständnis von Philosophie wie auch seine professionelle Praxis dieser Disziplin dem Philosophieren von Hannah Arendt gänzlich entgegengesetzt ist. Im Gegensatz zur kämpferischen Existentialistin Hannah Arendt ist Kurt Flasch ein zwar skeptischer, doch selbstbewusster Historist. Der heilige Augustinus etwa ist für beide ein lebenslanger Diskussionspartner und Stein des Anstoßes; doch mit seinen Texten gehen sie auf entgegengesetzte Weise um. Wo Arendt, bis in die Exzerpte ihrer Denktagebücher hinein, bis in ihre Vorlesungen zum »Leben des Geistes«, bei Augustin als der großen philosophischen Liebe ihres Lebens aktualisierbare, lebbare, evidente Sätze sucht (und findet), da widerlegt, dekonstruiert – besser noch: da zerstört Kurt Flasch jede Möglichkeit heutigen Wiedererkennens von Augustins Stimme, dessen Sprache er selber doch – und dies wiederholt – in heutiges, flüssig lesbares Deutsch gebracht hat. Lesen Sie nur Was ist Zeit? (22004), also den Flasch’schen Kommentar zum XI. Buch der Confessiones des Bischofs von Hippo. Was die republikanische Existentialistin und den skeptischen Historisten freilich dennoch – abseits dieses schwerlich vermittelbaren Kontrasts – verbindet, das ist die beständig, gewisserma- ßen »selbstverständlich« kämpferische Gestalt ihres Philosophierens: Der Kampf der Interpretationen ist weder für Arendt noch für Flasch ein »Ausnahmezustand«, eher schon die Regel – und natürlich misstrauen beide der Rede vom »letzten Gefecht«. Ob nun im republikanischen Agon zwischen Bürgern oder ihren Wortführern um die (jeweils) heute angemessene Politik des Gemeinwesens oder beim argumentativen Wettstreit mittelalterlicher Magister um die Erkennbarkeit Gottes und der Welt – der Streit als Form von Recherche, opponendo per modum inquisitionis (Dietrich von Freiberg), ist für Kurt Flasch wie für Hannah Arendt nicht das Gegenteil von Wahrheit, sondern ihre Existenzform. Dann aber ist auch die Wahrheit nicht die eine, die ewige, welche aller empirischen Vielfalt, allem Werden und Vergehen zugrundeliegt, sondern Wahrheit selber ist endlich und zeitlich und vielfältig. Auch darum darf Politik sich nicht als Durchsetzung einer (der definitiven) Wahrheit verstehen. Das Politische bewährt sich vielmehr durch das Immer-wieder-Urteilen: »Ist die Urteilskraft ein Vermögen, das sich mit der Vergangenheit befasst, so ist der Historiker der Mensch, der sie erkundet und, indem er sie erzählt, über sie zu Gericht sitzt« – schrieb Hannah Arendt in einem ihrer letzten Texte, welcher ins eingangs erwähnte Cato-Zitat mündet. »Wenn das so ist, können wir unsere menschliche Würde von der Pseudogottheit der Neuzeit, Geschichte mit Namen, zurückfordern, gewissermaßen zurückgewinnen.« Der historische Philosoph Kurt Flasch sitzt freilich eher zu Gericht über diejenigen, welche meinen, auf einer unzureichenden Indizienbasis urteilen zu können – und der kritische Philologe plädiert in solchen Fällen auf Revision.
Der bremische Hannah-Arendt-Preis erinnert mit seiner Namensgeberin daran, dass »der Sinn der Politik Freiheit (ist)«. Diese Freiheit ist freilich nie einfach gegeben, man muss sich die Urteilsfreiheit immer wieder nehmen, zurückfordern, erkämpfen. Kurt Flasch hat sich diese Freiheit im Denken gerade dort genommen, wo niemand anders sie suchen würde: in der mittelalterlichen Philosophie. Doch ist Philosophiegeschichte à la Flasch gerade kein Ruheplatz für schöne Seelen, zeitlose Probleme und Klassikerzitate. Noch seine Standardwerke zum Heiligen Augustinus, zu Dietrich von Freiberg, zu Meister Eckhart oder Nikolaus von Kues sind zugleich ideenpolitische Streitschriften – und sie wurden und werden immer wieder von ihm selbst überholt, revidiert, emendiert. Von Flasch behandelte »Klassiker« kommen nicht mehr zur Ruhe: Allein vier völlig verschiedene Bücher (1973, 20083, 2001, 2004) hat er Nikolaus von Kues gewidmet – und keines möchte man missen! Wenn nämlich Kurt Flasch philosophische Klassiker liest – aber das, liebe Mitbürger der respublica litterarum, müssen Sie schon selber nachlesen – so zelebriert er sie nicht, sondern führt uns ein in ihre »Kampfplätze«. Auf ihren Gemeinplätzen, ihren loci communes, durch die Topoi ihrer Argumente und Beweisgründe lernen wir, die politischen und religiösen Parteien, die philosophischen wie kulturellen Konflikte ihrer Zeit zu verstehen – und zu kritisieren. Alles verstehen heißt gerade nicht, alles zu verzeihen: Wie war es möglich, dass sich nahezu die Gesamtheit der bedeutendsten deutschen Denker beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs in die »Geistige Mobilmachung« des Kaiserreichs einspannen ließ? Kurt Flasch hat diese Frage nicht gelöst – aber er hat sie, eindringlich, in einer viel zu wenig bedachten Monographie gestellt. Freilich ist Kurt Flasch weit davon entfernt, das philosophische Ringen um den Ort der Wahrheit im Leben auf ideologische oder Interessenkämpfe zu reduzieren. Mit dem deutschen Kardinal Nikolaus von Kues hörte er »die Wahrheit auf den Gassen schreien«; Giovanni Boccaccios Erzählungen nach dem schwarzen Tod von Florenz übersetzte er neu, um auf den dramatischen Geschmack des Lebens, Liebens, Sterbens zu kommen; in den vernünftigen Argumenten des vermeintlich »deutschen Mystikers« magister Eckhart entdeckt er Traditionslinien der arabischen Philosophie. Eines seiner faszinierendsten Werke ist Flaschs Kommentar zur in dreißig Kerkerjahren entstandenen »philosophischen Poesie« eines revolutionären Mönchs, des ebenso sehr platonisch-eleatischen wie sensualistischen Weltendenkers Tommaso Campanella (1568– 1639).
Die offenen Grenzen, die umstrittenen Grenzziehungen und unweigerlichen Überlappungen von Vernunft und Offenbarung – zwischen Philosophie und Religion, zwischen Glaubensgewissheit und Wissenschaft – mussten Kurt Flasch zum Thema werden: im Verlaufe der Geschichte des lateinischen Okzidents, aber auch noch in jüngster Zeit. Denn Flasch ist wohl der deutsche Wissenschaftler, welcher die eindringlichsten und streitfreudigsten Kommentare sowohl zur päpstlichen Enzyklika Johannes Pauls II. Fides et ratio verfasst hat als auch zur »Regensburger Rede« Papst Ratzingers. Er hat beide Kirchenmonarchen als Denker ernstgenommen, und daher widersprach er in beiden Fällen einem allzu idyllischen römischen Bilde der providentiell prästabilisierten Harmonie von christlicher Religion und westlicher Vernunft – doch das betroffene Schweigen einiger deutscher Theologen zu Papst Benedikts philosophischen faux pas schrie in seinen Augen zum Himmel. In der Tat, bei magister Flasch lernen wir, ein Bewusstsein der religiösen und kulturellen Vielfalt der Traditionen des politischen und philosophischen »Westens« zu entwickeln. Schon die Kenntnis der Einflüsse »muslimischer« Philosophen in der »Aufklärungs«- Tradition des Mittelalters könnte uns davor bewahren, die im 21. Jahrhundert bevorstehenden zivilisatorischen Herausforderungen und Konflikte als eine bloße Verteidigung des Westens (von Freiheit, Vernunft, Christentum) gegen »den Islam», »den Fernen Osten«, die Barbaren und Fundamentalisten misszuverstehen. Die kritische Vernunft ist keine Festung Europa. Lieber Kurt Flasch – Ihr philosophisches Abendland ist weder ein dorischer Tempel noch eine gotische Kathedrale, sondern ein umstrittener Ort der Begegnungen von Athen und Jerusalem, zwischen Rom und Byzanz, zwischen Bagdad und Toledo – mit ziemlich mobilen Grenzen zwischen Aufklärung und Offenbarung, zwischen Orient und Okzident, zwischen Eigenem und Fremden. Ihr streitbares, weil denkendes Traditionsbewusstsein können wir heute, gerade im politischen Westen, verdammt gut gebrauchen. Denn auch vor Fälschungen der Aufklärung sei gewarnt. Gerade haben sich im Minarett-Streit unter den Schweizer Eidgenossen ausgerechnet die schlechtesten Argumente Voltaires durchgesetzt – und zwar mit plebiszitären Methoden, in einer Art Karikatur der rousseauschen Volksherrschaft. Die verbotenen Minarette sahen auf dem Plakat aus wie Raketen. Wo die Angst obsiegt, unterliegt die Neugier. Und die Chancen schwinden für zivilen Konflikt, für bürgerlichen Streit.
Denken heißt immer Entscheiden
Wenn ein so bedeutender Kenner der spätantiken und mittelalterlichen Philosophie mit einem Preis geehrt wird, der den Namen Hannah Arendts trägt, dann ist das gelinde gesagt, überraschend. Dem Nachdenkenden wird möglicherweise bald ein Licht darüber aufgehen, was und inwiefern Hannah Arendts politische Ethik mit Kurt Flaschs Geschichte des mittelalterlichen Denkens zu tun hat, überhaupt mit seinem Denken, oder auch nicht! Jedenfalls werde ich nicht damit anfangen, das arendtsche Element entdecken zu wollen. Ich begäbe mich damit nämlich in die Hände eines Vorurteils oder schlimmer noch: in die Falle einer unangemessenen Aktualisierung von Flaschs Denken. Und das ist – so glaube ich aus seinem Werk folgern zu dürfen – ein a priori zum Scheitern verurteilter Versuch jeder Erkenntnis geistesgeschichtlicher Zusammenhänge. Zunächst ist zu akzentuieren, dass die beiden großen philosophiegeschichtlichen Werke Kurt Flaschs, nach seiner Dissertation über Thomas von Aquins Ordo-Begriff, nämlich über Augustin und über die mittelalterliche Philosophie, nicht etwa wie üblich den Titel tragen »Geschichte der Philosophie« oder »Augustins Philosophie«, sondern charakteristischerweise an die Stelle von Philosophie den Begriff »Denken« setzen: Augustin. Einführung in sein Denken (1980) und Das philosophische Denken im Mittelalter (1986). Das ist nicht selbstverständlich! Durchweg alle relevanten Philosophiegeschichten und Übersichten – von Wilhelm Windelband über Heinz Heimsoeth zu Johann Hirschberger und Karl Vorländer bis hin zu Rüdiger Bubner und Wolfgang Röth verwenden den Begriff »Philosophie« im Sinne von »Systemangebot«. Mit Flaschs Abweichung von dieser terminologisch eingeübten Praxis ist implizit angedeutet, dass es nicht um die Darstellung von Systemen geht, sondern um die Beobachtung von Denkprozessen, und das bedeutet als Konsequenz auch: Das Denken Augustins und das Denken im Mittelalter sollen nicht als eine in sich notwendige quasi geistesteleologische Entwicklung betrachtet werden, sondern als ein kontingentes Ereignis. Mit der Kategorie »Ereignis« bin ich der Spezifik von Flaschs eigenem Denken einen Schritt näher gekommen: Denn seine spezifische Ansicht, das Denken der Philosophie sei nicht deduktiv aus einem ersten Prinzip ableitbar, sondern entstehe überraschend aus jeweils unvorhersehbaren historischen Anstößen, hat notwendigerweise zur Folge, dass jede philosophische Station des Mittelalters bei ihm mit dem Introitus »Die geschichtliche Situation« beginnt. Man könnte das für eigentlich selbstverständlich halten, aber es stellt doch, wie gesagt, eine sehr dezidierte Abweichung von der Kontinuitätsannahme beim philosophischen Begriff dar, weg von dem, was Kant »eine philosophierende Geschichte der Philosophie« nannte oder Windelband als Ablaufsgeschichte von Problemen und Begriffen verstand. Vielmehr ist es der Zeitpunkt und die Zeit selbst, die für Kurt Flasch beim philosophischen Denken den Ausschlag geben, durchaus im Sinne des von ihm ansonsten eher distanziert gesehenen Hegel, nämlich seine »Zeit in Gedanken zu fassen«. Zwei Titel verweisen besonders auf eine für Flasch charakteristische Perspektivierung, die sich aus der Betonung von Diskontinuitäten ergibt, nämlich das Agonale zwischen den Denkern: Es sind die Titel Kampfplätze der Philosophie. Große Kontroversen von Augustin bis Voltaire (2008) sowie Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg. Ein Versuch (2000).
Ich brauche nicht zu erklären, warum die Idee von der Philosophie als ein Kampfplatz so sympathisch ist. Denn wo es um den höchsten Einsatz geht, kann man auch verlieren. Und so ist der erste Blick darauf, wie die einstige Zentralfigur der mittelalterlichen Philosophie, Thomas von Aquin, in Flaschs philosophiegeschichtlicher Darstellung von 1980 erscheint, sofort ein Eye-Opener: Man begreift Thomas als Intellektuellen, der mit anderen Intellektuellen konkurriert. Denn im Unterschied zu früheren Philosophiegeschichten – etwa von Johannes Hirschberger, dessen Assistent der junge Flasch gewesen ist und dem er bei aller späteren Differenz in einem entscheidenden, sozusagen systematischen Punkt gefolgt ist: der Betonung der platonischen Tradition, sei es bei Augustin, sei es im Hochmittelalter – im Unterschied zu Hirschberger also gibt Flasch keinen großen Raum der Summa theologica, die auch zu meinem Kölner Studienbeginn noch als die Quintessenz des großen »Aquinaten«, wie man damals sagte, angesehen worden ist. Stattdessen sucht Flasch Thomas’ Gedanken dort auf, wo sie ihm wirklich originell erscheinen, nämlich wo dieser der sinnlichen Erkenntnis ein grö- ßeres Gewicht einräumt: Originalität also, nicht Systemgedanke! Und ganz bestimmt nicht die These von einer Art »christlichem Humanismus«, unter welchem Titel viele Ausleger von Thomas’ unterschiedlichen Ethiken aus Stoa, Platon, Aristoteles, Augustin und Seneca diese synthetisieren. Thomas, so Flasch, hat den Gedanken von der Kraft des reinen Denkens entwertet, indem er zwischen Substanz und »Daseinsakt«, wie Flasch das nennt, unterschied und das alles im Dienste einer philosophischen Verteidigung der christlichen Religion, indem Thomas die aristotelische Wissenschaftslehre kritisch auf die Theologie anwandte. Das setzte die Kenntnis der Kritik von Averroes an dem anderen großen arabischen Denker Avicenna voraus, nämlich die Frage nach der Unterscheidbarkeit von Substanz und Akzidenz. Welch ein lebhafter Schauplatz der Argumente! Und Flaschs Darstellung dessen liest sich wie ein Drama.
Hier breche ich ab und sage: Indem Flasch die Geschichte der Philosophie beziehungsweise der Theologie als intellektuelle Entscheidungssituation begreift, die so oder so entschieden werden kann, ergibt sich notwendig der Blick auf etwas Neues: erstens auf den dezisionistischen Charakter des Denkens und zweitens auf seinen argumentativen Modus. Dann rücken plötzlich Namen nach vorne sowie neben solche, die in traditionellen Philosophiegeschichten allein als Klassiker stilisiert werden. Dabei fallen in Flaschs Darstellung neben dem Kriterium der Originalität des Denkens auch das Kriterium des Epochalen der geschichtlichen Situation zusammen: Ob Abaelards Häretik, ob die Herausforderung der christlichen Theologie durch die arabische AristotelesRezeption, ob Meister Eckharts Destabilisierung der Metaphysik, ob Ockhams »Messer der Kritik«, ob Petrarcas Ruf nach der wahren Philosophie und schließlich Machiavellis Realismus – alle diese Namen, denen Flaschs besondere theoretische Neugier und Sympathie gehört, haben diese Neugier und Sympathie nicht einfach deshalb, weil Flasch mit ihrem Denken übereinstimmte, sondern deshalb, weil die Kühnheit ihres Denkens den Denker fesselt. Dabei ist eine Unterscheidung notwendig, um die Flasch’sche Antenne für Originalität nicht misszuverstehen: Flasch romantisiert seine Helden nicht als Outsider im Sinne des modernen Existentialismus. Er präsentiert sie in aller Kühle und Fremdartigkeit. Auch das ist nicht selbstverständlich, sondern ein Zeichen von Flaschs enormem intellektuellen Takt. Ja, Takt: Takt gegen- über eben jener Fremdheit, die fasziniert, ohne dass man sie in unsere aktuellen Denkkategorien zerrt, was Beeinflussung nicht ausschließt. Diese Denker haben allerdings mit Flasch etwas Entscheidendes gemeinsam: Sie synthetisieren nicht, sie bringen das vorhandene System nicht noch mehr zur Harmonie, sondern sie sprengen es. Flaschs Beschreibungen solcher Sprengvorgänge sind die Höhepunkte seiner Bücher. Es lohnt sich, genau hinzuschauen, wie er die schon genannten Abaelard, Averroes, Meister Eckhart, Wilhelm von Ockham, Petrarca und Machiavelli als agonale Denkimpulse charakterisiert. Im Unterschied zu gängigen Terminologisierungen ihres Denkens sind sie zunächst für Flasch alle »Intellektuelle«. Abaelard wird einerseits – wie es übrigens inzwischen auch die generelle Lesart ist – als einer der »bedeutendsten Denker des Mittelalters« vorgeführt. Aber eben mit den charakteristischen Strichen von Flaschs auf den Punkt kommender Zeichnung: »Er suchte den Streit«, aber war kein einseitiger Revolutionär. Seine intellektuelle Beweglichkeit war eingebettet in die Diskurse seiner Epoche. Abaelard wird vorgestellt als der Entdecker einer »unüberspringbaren Subjektivität«, einer Individualität, die als »Abaelard und Heloise«-Legende dem Bildungsbürgertum seit Anfang des 19. Jahrhunderts zu anheimig wird. Denn das genau ist nicht Flaschs Interesse, sondern der theoretische Begründungsakt von Abaelards Individualitätsidee: sein Zweifel an der Realität des Allgemeinen zugunsten der »einzig realen Individuen«. Ich habe noch nie den berühmten Universalienstreit zwischen sogenannten Realisten und sogenannten Nominalisten so anschaulich aus einer historischen Entscheidungssituation heraus dargestellt gelesen. Dabei ist es wiederum typisch, wie Flasch Abaelards Plädoyer für den Individualismus getrennt hält von dem, was man psychologischen Nominalismus nennt. Ohne dies hier weiter zu erklären, ist nur zu unterstreichen, dass Abaelards Sprachtheorie eine Rolle spielt. Und Sprache, nicht bloß Sprachtheorie, ist nun als das weitere Apriori des Denkens von Kurt Flasch selbst zu emphatisieren, worauf ich zum Schluss zu sprechen kommen werde.
Einen historischen Sprung vom frühen 12. ins frühe 14. Jahrhundert machend, blicke ich auf das Bild, das uns Flasch von dem Denker gibt, den er nicht nur nachdrücklich im Werk Das philosophische Denken im Mittelalter behandelt, sondern dem er neben Augustin ein eigenes Buch gewidmet hat: Meister Eckhart. Die Geburt der deutschen Mystik aus dem Geist der arabischen Philosophie (2006). Da es mir nicht um eine ideengeschichtliche Erinnerung anhand Flaschs geht, sondern um Flaschs eigenen Wahrnehmungsstil, möchte ich Sie nur ermuntern, seine Schilderung von Eckharts Pariser Attacke auf Thomas von Aquins aristotelische Identifizierung von Sein und Erkennen zu lesen, Seite 464 folgende im Werk Das philosophische Denken im Mittelalter: Sie bekommen dann eine Vorstellung vom scharfsinnigen Sprung Eckharts aus der vorgegebenen Denkbahn der ontologischen Theologie. Aber auch von der energetischen Anteilnahme Flaschs an diesen Sprüngen innerhalb der Vorgeschichte der neuzeitlichen Subjektivität. Eine ähnliche Demonstrationsfigur für den Sprung innerhalb des »Argumentationsstandards«, ein für Flaschs Terminologie charakteristischer Begriff, ist des Oxforder Philosophieprofessors Wilhelm von Ockhams Häresie, der, um dem Prozess der Kurie gegen ihn 1328 zu entgehen, nach München floh und eine neue Wirklichkeitskonzeption und individuelle Freiheitserfahrung formuliert hat. Das Originelle an seinem Denken war, dass er den Versuch, Theologie als Philosophie auszugeben, als unhaltbar zurückwies und dagegen die voluntaristische These stellte, Glauben hieße, zuzustimmen ohne Evidenz zu haben, nämlich aufgrund des »Befehls des Willens«. Ich glaube, die besondere Sympathie Flaschs für Ockhams Einfall liegt in dessen Misstrauen gegenüber der Ansicht, wo es theoretische Wörter gäbe, gäbe es auch die entsprechenden Realien. Das ist ja eine sehr aktuelle Problematik. Oder besser: Diese hat sich mit Hilfe des deutschen Idealismus, der ja auch das Denken gegenüber der Realität überschätzte, bis heute in Varianten in Deutschland erhalten. Und Flasch ist, trotz seiner Sympathie für die platonische Tradition, eben ein Erbe des Realismus, sagen wir: ein praktizierender Realist, das heißt ein skeptischer Beobachter von intellektuellen Positionen. Aber er ist es aufgrund von semantischer Hellhörigkeit – nicht als ein Verfechter irgendeiner Realismus-Theorie. Klar jedenfalls wird hier, wenn man es nicht vorher schon wusste: Metaphysikkritik aus sprachanalytischem Instinkt ist das Mindeste, was man über Flaschs eigene Position sagen kann und sagen darf. Von daher auch sein so lebhaftes Interesse für die beiden italienischen Gestalten, die unmittelbar in die Neuzeit führen und dem gebildeten Laien am ehesten bekannt sind: Petrarca und Machiavelli. Nichts könnte für Flasch gerufener kommen als Petrarcas Satz »Vor allem liebe ich die Philosophie, nicht allerdings die geschwätzige, schulmäßige, windige, sondern die wahre«. Auch bei Petrarca der Einwand an die Adresse der zeitgenössischen Philosophen, sich nicht mit bloßen Termini zu begnügen, sondern zu den Sachen zu kommen. Und diese Fähigkeit war bei den Zeitgenossen Petrarcas ebenso wenig zu finden, wie sie Kurt Flasch als Historiker des philosophischen Denkens zweifellos auch bei einigen zentralen Philosophen unserer Epoche vermisst. Wer war der größte Realist, nicht geschwätzig, nicht windig, unter den Denkern nach Petrarca? Zweifellos Machiavelli, der nicht umsonst, ähnlich wie Hobbes, den moralistischen Nachkriegsphilosophien in Deutschland – trotz seiner Ehrenrettung durch Hegel – Anathema blieb, unverstanden blieb nämlich seine konkrete Analyse der Welt. Eric Voegelin wurde noch vor vierzig Jahren wegen seines Plädoyers für Machiavellis Realismus von seinem Münchner Lehrstuhl weggeekelt nach Stanford. – Flaschs ebenso beredte Advokatur für Machiavelli als einem Denker, der »seine Zeit in Gedanken fasste«, wird nicht mehr von solchem Verdacht begleitet, nachdem der Florentiner Autor des Principe nicht mehr für die faschistische Adaption seines Werks verantwortlich gemacht wird. Abermals erkennt Flasch, dass Entfernung von der Universitätsphilosophie die Originalität eines Denkers eher stärkt als schwächt: Indem Machiavelli spätmittelalterliche Vorstellungen fernhielt von seiner Erfahrung des neuen Jahrhunderts, indem er nämlich die Machtlosigkeit der Moral zur Verbesserung des menschlichen Lebens zum Ausgangspunkt seiner Macht- und Staatstheorie nahm, umso tiefer drang er ein in die nicht mehr von spirituellen Instanzen geprägte Wirklichkeit, die sich nicht mehr theologisieren ließ: Es ist die phrasenlose historisch-politische Analyse der Gegenwart, der Flasch in Machiavellis Werk applaudiert. In diesem Sinne auch der ungewöhnlich provokative Abschluss von Flaschs Geschichte des mittelalterlichen Denkens: seine kompromisslose Kritik der zentralen Identifikationsfigur des deutschen protestantischen und akademischen Geistes, nämlich an Martin Luther als Intellektuellem. Dieser habe das Argumentationsniveau seiner unmittelbaren intellektuellen Gesprächspartner nicht erreicht. Eine solche Abrechnung mit Luther als einem letztlich reaktionären, intellektuell anspruchslosen Geist muss viele akademische Kollegen – und nicht bloß sie – verletzen und provozieren. So etwas konnte man bisher in dieser Schärfe und mit aktuellen Implikationen nur bei Nietzsche lesen!
Nichts zeichnet den Intellektuellen Flasch so sehr aus wie die Verweigerung gegenüber einer die Widersprüche auflösenden Harmonisierung, einer Pazifizierung des Geistes. Solche Harmonisierung hat meist zwei Varianten, besonders in der deutschen Geisteswissenschaft und Hermeneutik: Entweder wird das Denken eines Philosophen in die Bahnen generell akzeptierbarer Diskurse gelenkt, seien sie nun teleologische, idealistische oder geschichtsphilosophische, oder solches Denken wird aktualisiert nach den Grundsätzen eines »hermeneutischen Verstehens«, das unser sentimentalisches Bedürfnis nach mentaler Wiederkehr des Eigenen befriedigt. Es gibt in der deutschen akademischen Tradition wenig Sinn für den Skandal des nicht im System Unterbringbaren. Man kann den Mangel für solch einen Sinn Biedersinn oder Frömmelei oder – mit Nietzsche – die »Verlogenheit des Systematikers« nennen. Beispielhaft hierfür ist einerseits die Sinnhuberei traditioneller Hermeneutik, etwa die Identifizierung der Poesie mit möglichst philosophisch ausgewiesenen Motiven, siehe die Hölderlin- oder Rilke-Forschung. Oder aber der besondere Fall der altphilologischen Tragödieninterpretation im Namen hegelscher, geschichtsphilosophischer oder zeitgenössischer Soziologie sowie Psychoanalyse. In beiden Fällen läuft es auf die harmonisierende Welterklärung hinaus. Wie sehr Kurt Flasch sich dieser Tendenzen der deutschen (und auch amerikanischen) Universität bewusst ist, zeigt die leitmotivisch immer wiederholte Ironie beziehungsweise Skepsis a) gegenüber der nachkantischen idealistischen Philosophie überhaupt und b) gegenüber ideengeschichtlicher Einebnung des historischen Gedankensplitters. Nun gibt es unter den Flasch’schen Inszenierungen verschiedener Denkdramen zwei Figuren, die zweifellos schon deshalb herausragen, weil ihnen jeweils ein Werk gewidmet ist, Meister Eckhart und Augustin von Hippo: der Erfinder der deutschen Mystik aus arabischen Motiven und der platonische Präzeptor der christlichen Theologie über Luther hinaus bis zu Karl Barth. Ich habe schon aus Zeitgründen nicht vor, Flaschs Verständnis dieser beiden Großintellektuellen des frühen europäischen Denkens zu referieren. Am Beispiel von Flaschs größerer Beziehungsfigur, Augustin, ist aber zu erkennen, erstens inwiefern sich Flasch von hedonistischer Lektüre freihält, der sich aufdrängenden Allusion moderner Subjekt- oder Zeitphilosophie nachzugeben, ganz besonders nicht der geschichtsphilosophischen, die im Falle Augustins weitverbreitet ist. Zweitens inwiefern die »berühmte Unruhe des Herzens« aus dem ersten Kapitel der Konfessionen, sich im Scharfsinn dialektischer Denkimpulse bewegt, nicht im Poesiealbum des nachhegelschen traurigen Bewusstseins. Zunächst: Ich habe mich gefragt, warum Flasch dem frühmittelalterlichen Vater der christlichen Theologie oder dem definitiven Erfinder der abendländischen Religion eine solche Konzentration, im Sinne philologisch-historischer Akribie als auch logisch-argumentativer Denkschritte gewidmet hat. Die halbe Antwort: Es war nicht die Identifikation des Christen Flasch mit Augustins Lehre, deren Endziel in all ihrer institutionell autoritären Gewalt ohnehin Flaschs intellektuellem Temperament zuwiderläuft, wie pragmatisch er auch gerade diesen Aspekt des späten Augustin bestimmt. Die ganze Antwort lautet: Es ist die Anteilhabe Augustins an einem Typus, dessen Anziehungskraft für Flasch schon an verschiedenen Beispielen, von Abaelard bis Machiavelli, deutlich wurde. Auch Augustin war der Repräsentant einer historischen und geistesgeschichtlichen Umbruchszeit am Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus zwischen dem letzten Aufflackern noblen Heidentums in Gestalt Julian Apostatas und den Goten- und Vandalenstürmen. Aber Augustins Erscheinung darin war von viel größerer Konsequenz als die Erscheinungen der oben genannten intellektuellen Elite des Hoch- und Spätmittelalters. Sie war eine welthistorische.
Das Bild dieser welthistorischen Epoche und dieses welthistorischen Mannes zu entwerfen, war gewissermaßen das Masterpiece des Künstlers Flasch nach seinen brillanten kleineren Porträts. Zum anderen fällt Augustin aus der Reihe des Häretiker typs besonders heraus, weil er ja nicht einfach einmal gegen eine herrschende Konvention aufstand (wie Abaelard oder Meister Eckhart), sondern weil in ihm drei extrem polare Positionen miteinander wechselten oder aufeinander stießen: der Manichäer, der neuplatonische Intellektuelle und der institutionengeleitete katholische Theologe und Kirchenpolitiker. Vom Wechsel seiner autobiografisch berühmt gewordenen hedonistisch-sündigen Jugend in Karthago zur Ikone spirituell geleiteter Abstinenz und dem Sinnlichkeitsverbot in Italien ganz zu schweigen. Diese Polarität in einem Geist ist es, was Flasch faszinierte. Von den Confessiones, die neben De Civitate Dei das sind, was der Gebildete von Augustin weiß, macht Flasch charakteristischerweise kein großes Aufheben. Er ist ganz auf die intellektuelle Bewegung Augustins konzentriert. Das zeigt sich besonders an zwei Themen: dem Kommentar von Augustins Zeitanalyse innerhalb von Flaschs großem Werk über Augustin sowie dem Kommentar von Augustins »Gnaden«-Lehre. Ich hatte angedeutet, dass Flasch sich zu Beginn seines großen Augustin-Buchs von 1980 von der existentialistischen Augustin-Deutung distanziert, und das impliziert auch die Zeitthematik. Nichtsdestotrotz hat er nicht nur dreizehn Jahre später dem XI. Buch der Confessiones, in dem Augustin eine spezifische Analyse des Zeitphänomens vornimmt, einen ausführlichen historisch-philosophischen Kommentar gewidmet und dabei Augustins Zeittheorie im Kontext von Zeittheorien des 20. Jahrhunderts – nämlich Bergsson, Yorck von Wartenburg, Husserl, Heidegger, Wittgenstein und Russell – diskutiert. Vielmehr hat er auch im großen Augustin-Buch eine knappe Charakteristik, nein eine rasante, selbstbewusste Überprüfung der scharfsinnigen Zeitanalyse Augustins verfasst, die Flasch auf dem Höhepunkt seines diagnostischen Vermögens zeigt. Man sollte dazu wissen, dass Augustins Demonstration des Zeitflusses als eine Abfolge einander in ihrer jeweiligen Präsenz auslöschender Zeitpunkte zu einem zentralen Thema der modernen Literatur von Goethe über Giacomo Leopardi bis zu Charles Baudelaire werden wird: Es ist das Thema des je schon verlorenen und verschwundenen Augenblicks, das im Werk der genannten Dichter zum Leitmotiv einer Rhetorik existentieller Trauer wird. Dabei spielt Augustin gar keine Rolle! Denn er selbst musste als Anwalt der Ewigkeit aus seiner eigenen Minimalisierung der Zeit im Zeitpunkt, ja in der Aufhebung des ontologischen Status von Zeit überhaupt, keinen der modernen Poetenreaktion vergleichbaren Schluss ziehen. Flasch zeigt lakonisch, dass sich Edmund Husserl, der Autor einer Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, für den Begriff seiner »Jetzt-Punkte« nicht, wie er meinte, auf Augustins Zeitanalyse stützen kann. Flasch macht klar, dass die von Husserl bei Augustin vermutete deskriptive Psychologie beziehungsweise der erkenntnistheoretische Ansatz nicht existiert, das heißt dass es in Augustins Text kein Wort gibt zum Verhältnis von subjektivem Zeitbewusstsein und objektiver Zeit. Sie sehen: Es wird sehr kompliziert. Aber ohne das geht es nicht, will man wissen, wer der Preisträger ist. Ich habe das Thema der augustinischen Zeitanalyse sowie seiner modernen Deutung und Flaschs Reaktion deshalb erwähnt, weil Augustins Zeittext zu den am meisten kommentierten Texten Augustins überhaupt gehört. Natürlich mit der Tendenz, ihr etwas für unser Heute zu entlocken. Flasch stellt sich dem in den Weg. Aber eben differenziert: Partiell gibt er Husserl Recht, indem er konstatiert, dass Augustin nicht um metaphysischer oder theologischer Thesen willen blind gegenüber dem Phänomen von Zeiterfahrung sei. Aber Flasch besteht auf der großen Differenz: unsere Zeitlichkeitsimmanenz und Augustins Ewigkeitspathos. Wie Flasch den einzelnen augustinischen Denkschritten unser Zeitbewusstsein betreffend, folgt, ist selbst ein eindrucksvoller Beitrag zur modernen Zeitphänomenologie.
Der andere Text Augustins, an den sich, wie mir scheint, Flaschs spezifische geistige Affinität zeigt, ist für den modernen Leser der am meisten skandalöse: nämlich die »Gnaden«- Lehre Augustins. Zeigt sich am Beispiel der Zeitdiagnostik vor allem Flaschs eigene analytische Leidenschaft, so am Beispiel der »Gnaden«-Lehre seine von Bildern bewegte Einbildungskraft. Und gleichzeitig eine unkompromisslerische, fast stoische Wahrnehmungsfähigkeit von nicht, wie der aktuelle Akademiker sagen würde, »anschlussfähigen« Denkmotiven! Flasch nennt sein Buch über Augustins »Gnaden«-Lehre Logik des Schreckens (erschienen erstmals 1990, mit Nachwort verbessert herausgegeben 1995). Ohne auf Augustins berühmt-berüchtigten Text De diversis quaestionibus ad Simplicianum von 397 hier näher einzugehen, ist nur eines zu wissen: In ihm wird via einer neuen Lektüre der alttestamentarischen Geschichte vom armen Esau und glücklichen Jakob sowie des Römerbriefs von Paulus von Augustin gnadenlos deklariert, dass Gott den Menschen als solchen nicht liebe, nur wenigen die Gnade der Erlösung vom Höllenfeuer gewähre, und dies ohne jede Begründung, das heißt ohne Rechtfertigung, etwa im guten Werk der also Ausgewählten. Es gibt, so scheint es, keine Gerechtigkeit Gottes. Er ist der Vollstrecker nicht vermittelbarer Willensentschlüsse gegen alle unsere humanitären Vorstellungen.Entgegen den kompromisslerischen Erklärungen unter Augustins Auslegern beharrt Flasch auf dieser Brutalität, ja dem quasi nihilistischen Angebot des Textes. Er spricht vom »metaphysischen Grauen«, das dieser vermittle. Er besteht gegen die Ideenhistoriker, die den Skandal der »Gnaden«-Lehre umgehen wollen, auf dem »Schauder der Vormoderne« in Augustins archaisierender Theorie. Er beschreibt sie mit Worten, die den Sadismus der göttlichen Auswählung herausstellen. Offengestanden: Die Zumutung, dass der Mensch niederknie, um seine blutige Hinrichtung betend zu erwarten, erinnert an die perverse Ästhetik des Schreckens, wie sie in des Erfinders grauenhafter Bilder, nämlich in Lautréamonts Gesänge des Maldoror (1870) vorgeführt wird. Auch dort erscheint ein furchtbares Gottwesen und sein menschliches Opfer. Man könnte auch an Goyas einschlägig kannibalistisches Ungeheuer denken. Aber Augustin ist – auch wenn er einer frühhistorischen Dekadenzzeit entstammt und er zweifellos eine starke emotionelle und imaginative Begabung besaß – kein moderner ästhetizistischer Dichter und Künstler, sondern ein frühmittelalterlicher Theologe, Philosoph und Kirchenvater. Wenn Flasch Augustins skandalöse Auffassung von der göttlichen Gnade nicht unserem Freiheitsbedürfnis und unserer Empfindsamkeit vermittelt, sondern sie einerseits auf ihre Widersprü- che überprüft, vor allem die Vernachlässigung des Menschen durch Augustins Gott, sie andererseits radikal historisch präsentiert, dann kommt darin eine paradoxe Geisteshaltung zum Vorschein, die Flasch selbst als Affinität zum »Reiz der Nichtmoderne« zu erkennen gibt, die ich nun zum Abschluss mit Blick auf das eigentlich Moderne von Flaschs Denken zu verstehen suche.
Dabei muss ich nun doch auf seine, wie soll ich sagen, poetische Autobiografie mit dem Titel Über die Brücke. Mainzer Kindheit 1930–1949 zu sprechen kommen, die mich, selbst Rheinländer und Messdiener, wenn auch niederfränkisch, nicht moselfränkisch, ungemein gefesselt hat in ihrer mit epochenfotografischen Dokumenten ausgestatteter Anschaulichkeit. Nicht zuletzt das sprechende Gesicht der Kasteller Großmutter, deren feines Lächeln sich dem Witz des Enkels offenbar mitgeteilt hat, der schon als Messdiener über verschiedene Argumentationsmöglichkeiten des Menschen ins Sinnieren verfiel, ja schon in scholastischer Manier aus der Tatsache verschiedener Heiligenkörper im Himmel auf dessen Raumdimension schloss, die von der zeitgenössischen Theologie gerade verneint wurde. Ich will mich auf das politische Motiv in diesen Erinnerungen beschränken, um von dort aus Flaschs Einschätzung einer deutschen, nach dem Ersten Weltkrieg aufgetretenen Intelligenz zu markieren, die auf das Deutschland des 20. Jahrhunderts nicht nur in der ersten Hälfte große Konsequenzen hatte. Eine Einschätzung, die ihn selbst als zeitgenössischen Intellektuellen vor allen akademischen Meriten erkennbar macht. Offenbar wird, wie sehr der junge Flasch sowohl den politischen Terror des Regimes wie auch das trostlose Verhalten so vieler in diesem Regime wahrnahm, hierin unterstützt von dem regimegegnerischen Vater im Schoß einer altmodischen, großen, rheinisch-katholischen Familie und unterstützt von einigen groß- artigen Lehrern. Vor allem aber schon das jugendliche Wissen um die Kontinuitäten zwischen Drittem Reich und Bundesrepublikmentalität, nicht bloß in ihrer politischen Kriminalität, sondern in ihrer sozialpsychologischen Spießigkeit. Das sei gesagt, nicht um das Ethos eines antinazistischen bürgerlich-katholischen Elternhauses im Rheinland der Vierzigerjahre herauszustellen, sondern um Kurt Flaschs aktuelle, freimütige, unverkniffene Intellektualität als Gelehrten noch näher zu fokussieren: Denn sie war, wie wir gesehen haben, nicht darauf aus, geistige Phänomene in Ausrichtung einer wie auch immer gearteten Korrektheit zu bringen. Das haben ein Großteil von Flaschs gleichaltrigen Kollegen immer versucht, darunter die berühmtesten Namen der Nachkriegsuniversität. Der Zusammenhang mit Flaschs politischen Jugendmotiven ergibt sich aus der Tatsache, dass die Mehrheit der sich politisch artikulierenden Intelligenz der Flasch’schen Generation und Jüngerer aus einem nationalsozialistischen, zumindest rechtskonservativ nationalistischen Milieu kam. Ihre Tendenz zum teleologisch harmonisierenden Vorgehen, ihre häufig linkskonformistische Denkweise, nicht zu reden von einem nichts mehr kostenden antifaschistischen Gestus, lassen sich als Reaktion aus dieser Herkunft erklären. Umgekehrt wird Kurt Flaschs souveräner, für diese Kreise wahrscheinlich unverständlicher Denkstil, vormoderne Denkformen in ihrer authentischen Motivation zu erfassen, auch erklärbar daraus, dass er zu keiner Kompensation der angedeuteten Art gezwungen war. Das zeigt sich, wie gesagt, schon in Flaschs »coolem« Umgang mit der autoritären Seite Augustins, deren Pragmatik er sogar etwas abgewinnt, weil sich darin Augustins Kritik am bloß kontemplativen Ideal seiner Frühschriften zeigt und weil Theorie als Funktion der Institution behandelt ist, sozusagen eine No-Nonsens-Haltung. Ebenso aufschlussreich ist, wie Flasch die meist akademischen Wortführer beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs und ihre fundamentalistische Begründung des Krieges gegen die beiden westeuropäischen Nationen beschreibt. Gemeinhin werden die Texte und Reden, die Flasch nennt, die von Rudolf Eucken, Ernst Troelsch, Friedrich Meinecke und nicht zuletzt Max Scheler als die »Ideen von 1914« unter quasi protofaschistischen oder präfaschistischen Verdacht gestellt, wobei man natürlich noch aggressivere Wortmeldungen, etwa von Ernst Jünger oder dem jungen Thomas Mann hinzufügen könnte, ganz abgesehen von den definitiv rechtsradikalen Autoren der konservativen »Revolution«, deren Motive unmittelbar in der nationalsozialistischen Ideologie aufgingen. Flasch, der sich, wie gesagt, abgesehen von den beiden Intellektuellen Borchardt und Hugo Ball nur auf die genannten Weltkriegsprofessoren konzentriert, verweigert sich der ideologiekritischen Perspektive einer zensierenden Einordnung in eine angeblich notwendige negative Entwicklung zum Faschismus. Er nennt diese Professorenautoren charakteristischerweise auch »Intellektuelle«, so wie er seine mittelalterlichen Philosophen »Intellektuelle« nannte. Er spricht von einer »geistigen Mobilmachung«, zwar kritisch, aber nicht in polemischer Absicht. Er versteht diese den Krieg begründende Mobilmachung nicht von der Zukunft her, sondern von ihrer geistigen Vergangenheit sowie ihrer unmittelbaren Gegenwart. Hierin steht Flaschs methodische Originalität und philosophische Intellektualität im Kreis der westdeutschen Nachkriegshistorie – sieht man von Reinhard Koselleck ab – singulär da: Er erinnert an eine heute nicht mehr vermittelbare vergangene Gegenwart, etwa die eines Georg Simmel, der im November 1914 vor Straßburger Studenten das Erlebnis der »Mobilmachung« als eine »Offenbarung der Philosophie des Lebens« charakterisierte. Lebensphilosophie also. Flasch verurteilt sie aber nicht politisch, sondern begreift sie in ihren theoretischen Impulsen. Am sprechendsten wird dieser neue Blick auf die abgestrafte deutsche Generation von 1914 am Beispiel der Kriegsbücher Max Schelers, der bedeutendste in Flaschs Reihe. Schelers phänomenologische Bestimmung des Krieges unter einer »Wert«-Kategorie, nämlich der der »Macht«, wird von Flasch ohne moralisierende Beigabe kritisch theoretisch benannt. Dabei ahnt man, dass auch er, wie Max Scheler, von Nietzsches Moral-Genealogie angeregt ist. Diese Objektivität ist umso beeindruckender, als Schelers Denkfehler knallhart und kristallinscharf aufgedeckt sind. Wo Schelers phänomenologischer Blick Flasch beeindruckt, ist, wo Scheler, neukantianischen Einflüssen entzogen, Denken als »Tat« versteht, also dem Ordnungsmotiv Augustins nahe kommt, vor allem, wo er sich abstrakten Diskussionen der Vorkriegszeit entzieht. Sagen wir es so: Flaschs Kritik an Schelers anti-utilitaristischer Kriegsethik lautet anders, als sie heute dem Mainstream der universitären Intelligenz selbstverständlich wäre. Und das, so vermute ich, entspringt nicht bloß Flaschs strengem unparteiischen Forscherblick allein, sondern umgekehrt einer Anteilnahme: der Anteilnahme jedenfalls an Schelers dynamischem Prinzip, dem Prinzip des Wagnisses. Das ist ja genau das, was auch die Agonalität des Denkens ausmacht, weshalb Flasch die großen Kontroversen der Philosophiegeschichte als »Kampfplätze« bezeichnet hat. Die epochengerechte Einschätzung der philosophischen Motivation dieser Geister lässt Flasch ihre reaktionäre Kulturkritik, auch innerhalb der evangelischen Religionsphilosophie und besonders bei Ernst Troeltsch, nicht übersehen. Sein wirklich intellektueller Respekt und seine Sympathie gelten ohnehin dem das italienische Paradigma suchenden Rudolf Borchardt und dem anarchistischen Dadaisten Hugo Ball. Dessen Kritik der deutschen Intelligenz von 1919, nicht zuletzt Balls Polemik gegen Martin Luther als Verhinderer einer aufgeklärten romanischen Welt in Deutschland, scheint ganz nach Flaschs Gusto, auch wenn er die »geisteswissenschaftliche Etikettierung« als Grundfehler nicht nur an Ball, sondern auch an den übrigen Denkern von 1914 kritisiert. Im Zusammenhang von Flaschs Distanz zu idealistischen Systemen ist auch seine Aufmerksamkeit gegenüber Kurt Rieslers Philosophie der Unübersichtlichkeit bemerkenswert.
Und Hannah Arendt? Wie entfernt scheint sie, obwohl die Schülerin Martin Heideggers, von Schelers Kriegsethik, ein Konzept, das sie expressis verbis ausgeschlossen hat? Dass Hannah Arendt das philosophische Konzept einer »Vita contemplativa« von der »Vita activa« her kritisiert, während Kurt Flasch letztere in der »Vita contemplativa« selbst implementiert findet, würde einen interessanten Disput zwischen beiden ergeben. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will in den letzten Sätzen meiner Laudatio keinen künstlichen Anschluss an den Namen Hannah Arendts herstellen. Er wurde mir bei der Lektüre von Flaschs Werk vielmehr von Beginn an evident, auch wenn in ihm der Name der Autorin von The human condition (1958) an keiner Stelle erwähnt ist, obwohl sie bei der Erläuterung des Wortes »Vita activa« von dessen antik-frühmittelalterlicher Bedeutung und Differenz ausgeht. Ich sehe den Zusammenhang auch nicht in dem Umstand, dass Hannah Arendt in Rücksicht auf Augustins Frage, wer er selbst denn sei, diese Frage als unbeantwortbar bezeichnet hat. Vielmehr sehe ich zwei Eigenschaften, die beide Denker trotz aller offensichtlicher Differenz verbindet: Erstens im Verständnis des »Urteil«-Begriffs, der Hannah Arendt im Anschluss an Kant so nachdrücklich beschäftigte, kommt etwas zum Vorschein, das auch bei Flaschs Verständnis denkerischer Prozesse charakteristisch ist: Es gibt keine diskursive Letztbegründbarkeit, Denken heißt immer Entscheiden, heißt zu wissen, was auf dem Spiele steht. Zweitens: Dieses Apriori, das bei Flaschs Darstellung seiner wagemutig kreativen Gedankenhelden immer wieder hervorsticht, ist formuliert in einer Sprache ohne terminologischen Jargon. Das ist nicht einfach nur die Eigentümlichkeit eines brillanten Stils. Darin äußert sich vielmehr gerade die Selbstüberprüfung des Denkens in seiner semantischen Evidenz. Schließlich – und das betrifft Flaschs kulturell gesättigte Intellektualität allein – scheint mir für ihren Ausdruck die fachliche und private Nähe zur italienischen Kultur entscheidend geworden zu sein. Flaschs Übersetzung von Bocaccios Decamerone und sein Kommentar dazu sowie seine Übersetzung von Dantes Göttlicher Komödie, dem fünften und sechsundzwanzigsten Gesang der Hölle, belegen dies vielsprechend. Von daher die passionierte Stellungnahme ohne Rücksicht auf gängige akademische Ansichten, ohne Rücksicht darauf, sich Gegner zu machen, ob sie Gadamer oder Löwith oder wie auch immer heißen. Das impliziert andererseits auch ein Lob, wo man es nicht erwartet, wie im Fall der aktuellen Übersetzung der Ilias durch Raoul Schrott. Grüßen wir also den Preisträger des Hannah-Arendt-Preises, Professor Kurt Flasch, als den ungewöhnlichen Gelehrten und Intellektuellen.
»Die Vergangenheit vergangen sein lassen«
Jeder, der einen Preis bekommt, wird sich so artig wie möglich bedanken. Ich muss es doppelt tun. Denn die Jury hat sich um mich zweifach verdient gemacht. Erstens hat sie mir gleich anfangs mit auffallender Energie erklärt: Der Hannah-Arendt-Preis ist ein politischer Preis. Ich hörte die Befürchtung heraus, es könnte zu akademisch zugehen. Es klang, als sei jemand besorgt, ich könnte als Augustinus-Spezialist die feierliche Gelegenheit missbrauchen, um ein Hühnchen zu rupfen mit Hannah Arendts Dissertation über den Liebesbegriff bei Augustin. Diese Taktlosigkeit war mir tatsächlich zuzutrauen. Aber die Jury hat mich bewahrt vor dieser seelischen Rohheit. Dabei hatte ich noch ganz andere Versuchungen zu überstehen: Herausfordernd war der Meinungsstreit zwischen Hannah Arendt und Karl Jaspers: Sie fand Heideggers Platonauslegung »großartig«, er (im Brief vom 12.4.56, S. 321) nannte sie »lächerlich«. Will denn gar niemand wissen, wer da Recht hatte? Da hätte ich meinen Senf gerne dazugegeben, aber nein, der Hannah-Arendt-Preis – ich war gewarnt – ist ein politischer Preis. Damit komme ich zu einem zweiten, einem gewichtigeren Kompliment an die Jury: Sie hat in meinen Arbeiten als Historiker des Denkens das Politische erkannt. Sie hat das historistische Mimikry eines Spezialisten für abgelebte Zeiten durchschaut. Denn schließlich hat ihr Preisträger sich vorwiegend als Spezialist für Spätantike und Mittelalter betätigt, als Taktschläger des langsamen Geistes, bedeckt vom Bibliotheksstaub uralter Bücher. Auf die politische Pauke gehauen habe ich selten. Manchmal schon, wenn es unbedingt sein musste. Bei der Doppelbeschlussund Nachrüstungsdebatte stand und stehe ich heute noch klar auf Seiten der Gegner von Helmut Schmidt und las in der FAZ, wir Friedensfreunde seien von »winselnder Harmlosigkeit«. Da war sie wieder, die »Immer-feste-druff«-Rhetorik von 1914. Da war sie wieder, die Kritik an Friedensfreunden als dogmatischen, weltfremden Pazifisten. Ich war als Mann vom Fach betroffen; ich wusste es besser: Kants Friedensschrift ist an Realismus schwer zu übertreffen, Erasmus hat nicht gewinselt und war nicht arglos; er hielt fest, als er erklärte, nur Unerfahrenen scheine der Krieg gut: »Dulce bellum inexpertis.« Und dann war da ja auch noch Dante: Er hat die Arbeit am »Paradiso« unterbrochen und in strengster Argumentation, ganz ohne zu winseln, sein Jahrhundert in die Schranken gefordert und scholastisch dafür argumentiert, Friede sei der oberste, und zwar der einzige oberste Wert. – Da hatte der Vergangenheitsspezialist etwas Politisches klarzustellen. Lagen die Gegenstände meiner Arbeit auch oft in der Vergangenheit, das Auge, das sie wahrnahm, lebt mit scharfem Kontrast-Bewusstsein in der Gegenwart. Alles historische Wissen beginnt in der Gegenwart, vergisst dies nur manchmal. Und was war das für eine Gegenwart! 1930 geboren, wurde ich als Kind einer politisch unzuverlässigen Familie angeleitet zur schärfsten Beobachtung von Nazigewalt, Kriegsvorbereitung und -verlauf, von Judenschicksal, Duckmäusertum und kriegsfördernder Rhetorik. Dabei entstand zwischen zwölf und fünfzehn mein Bewusstsein. Die Politik blieb immer präsent. Sie war das Schicksal. Politik und Gegenwartsbewusstsein motivierten meine Monographie über die deutschen Intellektuellen im Ersten Weltkrieg. 1992 erschien mein anti-revisionistischer Artikel in der FAZ mit dem Titel: »War die SA ein Trachtenverein?« Als die Deutschen anfingen, sich als Opfer des Krieges zu beklagen, beschrieb ich öffentlich meine Motive: Warum ich, der ich ihn nur zu gut kannte, vom Bombenkrieg geschwiegen habe. Das waren Randarbeiten, von aufkommendem Brandgeruch provoziert und ohnmächtig verhallt. Ich habe Recherchen zum Begriff der Euthanasie getrieben und eine »Plauderei über Euthanasie« gedruckt; der unbedachte Gebrauch dieser Vokabel läuft ungestört weiter. Solche kleinen Erfolglosigkeiten raubten mir weder Heiterkeit noch Kampflust: Sie betrafen Nebenschauplätze; mein Impuls war umfassender: Ich wollte, ich musste mir nicht nur einen Vers machen – auf Krieg, auf Nazizeit, auf das, was danach kam. Ich wollte wissen, wie es zugegangen ist an den Umbruchstellen der deutschen, der europäischen Geschichte. Ich nenne nur einige Themen: Die Geschichte des Christentums, seine dogmatische Fixierung im vierten Jahrhundert. Seine Umdeutung durch Augustinus. Dessen zwiespältige Erbschaft, wirksam bis heute. Die Pluriformität des langen Mittelalters. Aufklärerische Elemente darin durch Präsenz des antiken Vernunftkonzepts und griechisch-arabischer Wissenschaft. Wie die denkende Menschheit schweren Abschied nahm von der Scholastik. Die Philosophie des Quattrocento. Überhaupt Florenz. Dann die genaue Position Luthers, und sein Konflikt mit Erasmus. Langer Umgang mit Leibniz und Lessing, auch Voltaire. Als Historiker habe ich mich lange mit Bismarck befasst: Seine deutsche Blut- und Eisen-Einheit, die Ausstoßung des alten Kaiserzentrums aus seinem Reich war ein europäisches Unglück, dessen Ausbruch er durch geniale Politik um Jahrzehnte verschieben konnte. Der Erste Weltkrieg. Heute wundere ich mich kaum, dass niemand aufschreit, wenn die sich für gesittet haltende Welt von uns ausgerechnet Polizisten und Soldaten fordert, nicht Krankenschwestern, Verfassungsrechtler oder Ärzte, nein, sie wollen Polizisten und Soldaten. Der Hannah-Arendt-Preis ist, wie mir eingeschärft wurde, ein politischer Preis. Nun, politisch ist das Studium der Vergangenheit, wenn es quellennah bleibt und Aufmerksamkeit einschließt auf den gegenwärtigen Umgang mit der Vergangenheit. Dazu einige ruhigere Überlegungen, auch um die Einschränkungen zu begründen, die dazugehören.
Was wir »Vergangenheit« nennen, ist selbst ein Konstrukt, ein politisch-kulturelles Produkt. – Vergangenheitsspezialisten sprechen zwar von ihren »Quellen« und meinen Chroniken, Urkunden und Briefe, aber niemand darf glauben, diese »Quellen« flössen friedlich, ungebrochen, unbearbeitet in unsere Gegenwart ein. Rückblickendes Selbstverständnis, kollektives wie individuelles, wird gemacht, nicht einfach vorgefunden. Das beginnt schon bei individuellen Lebenserinnerungen. Wir würden Ereignisse nicht behalten haben, hätten wir sie nicht behalten wollen, und wir würden sie nicht behalten wollen, wären sie uns nichts wert und zu nichts dienlich. Erinnerungen, erst recht Autobiographien sind auch ein individualpolitisches Produkt. Selbst steinerne Monumente der Vergangenheit – antike Ruinen und mittelalterliche Burgen – existieren nur noch, wo man glaubte Gründe zu haben, sie zu erhalten. Urkunden und Chroniken wurden aufgeschrieben, um sie zu nutzen zur Erhaltung und Erweiterung eines Vermögens, einer Stadt oder eines Klosters. Nationalgeschichtliche Erinnerungen nehmen gern die Form gro- ßer Erzählungen an in der Art Rankes, der in der Weltgeschichte den Mantel Gottes wehen sah; sie lief ihm in geheimer Teleologie auf die preußische Gegenwart zu. Ob man alte Dokumente aufbewahrt und Leute ausbildet, die sie lesen können, oder ob man ein Stadtarchiv auch mal eben einstürzen lässt, das alles sind politische Vorgänge. Da wird allemal etwas gewollt oder nicht gewollt. Politische, quasi-juristische Streitigkeiten führten seit dem 17. und 18. Jahrhundert zur Entstehung der historischen Wissenschaften. Schon die Polemiken der Reformationszeit hatten große Urkundensammlungen hervorgebracht; jede Seite brachte Dokumente und beanspruchte die Auslegungshoheit. So entstand historisches Wissen als gelehrt-politische Konstruktion. Individuen, Institutionen und Nationen erzeugen von sich kompakte Vergangenheitsbilder. Das Schöne an ihnen ist, sie sind überlistbar. Mit Dokumenten in der Hand lassen sie sich kritisieren und korrigieren. Die Vorgänge, die sie vermelden, wurden auch von anderen gesehen, und zwar anders: Deren Stimmen sind aufzufinden. Konflikterzeugende andere Quellen sind zu suchen und zur Sprache zu bringen. Skepsis ist angebracht, aber kein prinzipieller Skeptizismus. Der politisch und philosophisch querdenkende Bearbeiter der Geschichte hat eine Chance. Daher haben wir wechselnde und unter sich uneinige Darstellungen der Reformation, der bismarckschen Reichseinheit und ihrer Folgen. Nietzsche hatte seinen Kampf mit der protestantisch-deutschen Historikerzunft. Sie feierte Luther als Befreier, vergaß aber hinzuzusagen, wie rasch Obrigkeiten aller Art, Superintendenten, Stadtregierungen und Territorialherren, in die entstandene Lücke drängten. Nietzsche schrieb am 5. Oktober 1879 an Peter Gast, er sei immer weniger imstande, ehrlich etwas Verehrendes über Luther zu sagen. Und dies sei die Wirkung einer mächtigen Materialsammlung, auf die Jakob Burckhardt ihn aufmerksam gemacht habe, das Buch des Katholiken Johannes Janssen (Geschichte des deutschen Volkes, Band II, Freiburg 1877). Er sah: Man muss etwas tiefer ins Mittelalter hinabsteigen und über Deutschland hinaus blicken, um die deutsche Reformation zu bewerten. Handwerksregeln historischer Arbeit sind zu respektieren. Punkt für Punkt, Text neben Text sind sie nebeneinander zu legen: Luthers Verwerfung der Bauernaufstände als Teufelswerk vergleichen mit Machiavellis sozialgeschichtlicher Analyse der Bauernunruhen in der Valdichiana, ebenso Luthers Diskussion mit Erasmus über den freien Willen, präzise, kleinteilig, pedantisch. Für Belehrungsresistente entsteht dadurch der Anschein einer, wie sie sagen, »bloß historischen« Betrachtung. Aber anders ist es nicht zu machen.
Ich wende mich einem zweiten Zusammenhang von Politik und geschichtlicher Orientierung zu und gebe zu bedenken: Individuen und Institutionen, Feuerwehrvereine und Städte, Nationen und Kirchen reißen die Vergangenheit an sich. Sie legitimieren sich als ihr Ergebnis. Ihnen muss der selbstdenkende Historiker oft die Vergangenheit entreißen; er muss das mit Dokumenten machen. In diesem Sinn habe ich meine Diskussion mit Josef Ratzinger am Jahrtausendende im Grand Amphitheatre der Sorbonne geführt und maßvolle Kritik an seiner Regensburger Rede geübt, mit dem Ziel: Die Vergangenheit, sogar die des christlichen Denkens, dem ideenpolitischen Missbrauch zu entziehen, das Mittelalter gegen eine überholte Historiographie zu verteidigen, die Legitimität der Neuzeit begreiflich zu machen und auch unserem Kant ein Minimum von Genauigkeit zu gönnen. Ich hätte ihm auch sagen können, der Herr solle das Vergangene vergangen sein lassen. Das Vergangene vergangen sein lassen, heißt nicht, es zu vergessen, sondern sich dagegen zu stellen, wenn das Gewesene für modische Geschmäcke oder aktuelle Zwecke zurechtgemacht wird. Es soll als Vergangenes gegenwärtig sein. Nur so begünstigt es Freiheit. Das muss ich erklären. Hier gähnt auf beiden Seiten der Abgrund: Die einen lassen die Zeit der Verbrechen zusammenschrumpfen auf zwölf oder vierzig Jahre, und nennen diesen Zeitblock in schonender Umschreibung »die Vergangenheit«. Wenn sie raten, wir sollten die »Vergangenheit« vergangen sein lassen, dann wünschen sie, wir sollten sie auf sich beruhen lassen und nicht länger danach fragen. Die Vergangenheit beginnt aber nicht 1933 oder 1949, sondern etwa bei den Neandertalern. Sie auf ein paar Jahre zusammenschnurren zu lassen, ist sprachlich und gedanklich unerträglich. Verbunden mit der unsäglichen Metapher, jemand sei in die Vergangenheit »verstrickt« gewesen, wird die Redensart zum politischen Skandal. Diese eingeengte Bedeutung des Wortes »Vergangenheit«, die Adorno in der berühmten Rede über Vergangenheitsbewältigung noch durchgehen ließ, ist schlicht falsch und politisch verdächtig. Das Wort »Vergangenheit« bezieht sich auf unsere ganze Geschichte, nicht nur auf die deutsche, sondern auf die Vergangenheit in offener Breite. Das sind ein paar mehr als zwölf oder vierzig Jahre. Aber noch einmal: Vorsicht! Das sprachlich-politische Gelände ist vermint. Lassen sie es uns noch ein bisschen besichtigen. Hat uns doch schon mancher Politiker ermahnt, wir sollten die deutsche Geschichte nicht auf 1933 bis 1945 einengen. Sie sei weiter und größer, zu ihr gehörten auch Bach und die Heilige Elisabeth, die Staufer, Albrecht Dürer und Richard Wagner. Solche Herren evozieren statt der neueren Unglücks- und Verbrechenshistorie die Vergangenheit als Ruhmestempel. Sie berauben die lange Vergangenheit ihrer Vielfalt, ihrer Spannungen und Exzesse, ihrer Befremdlichkeit. Uns nehmen sie die Freiheit, der Geschichte wertend und wählend gegenüber zu treten. Sie lieben die völlig falsche Metapher der »Wurzel«, als seien wir verwurzelt in der Tradition, wie sie sagen. Der Mensch hat keine Wurzeln. Hätte Gott uns verwurzelt gewollt, hätte er Bäume machen müssen. So aber gab er uns Beine, um hinzugehen und zurückzutreten. Wer uns erklärt, wir hätten »Wurzeln« in der Vergangenheit, versetzt uns, statt zu detaillierter Analyse anzuhalten, in die Walhalla seiner Leitkultur: Geht es um deutsche Geschichte, verschwinden deren überregionale Bezüge – alter Orient, Perser, Araber und Juden; verschwiegen bleiben die ungeheuren Schäden, die uns schon der vornazistische Nationalismus eingebrockt hat. Hier lauern auf beiden Seiten Gefahren. Es hilft nur, den Begriff »Vergangenheit« so weit, so langfristig und international zu halten und sich von ihr Rechenschaft zu geben, so gerecht, so hart und so genau wie möglich. Dann tauchen die zwölf oder vierzig Jahre darin schon nicht unter. Wie werden wir also reagieren, wenn uns jemand zuruft, wir sollten die Vergangenheit vergangen sein lassen? Die Formel ist zum Erschrecken vieldeutig. Sie diente dem Vertuschen, dem Wegsehen, dem Ablenken. Welche Kunst des Wegsehens müssen unsere im Land gebliebenen Lehrer, Philosophen, Theologen, Regisseure, Historiker und Schriftsteller zwölf oder vierzig Jahre eingeübt und beherrscht haben, um ihren Staat anerkennungswürdig zu finden und in ihm ihr Handwerk durchhalten zu können. Wirkte die Scheuklappentechnik nicht noch lange nach? Was hat Heidegger an rassistischem Gebrüll überhören müssen, um an die große Wende glauben und die schönen Hände Hitlers bewundern zu können? Und doch sollten wir sehr wohl das Vergangene vergangen sein lassen. Wir sollten es der Aneignungswut entziehen. Es soll sperrig bleiben und Andersheit behalten dürfen. Die GuidoKnopp-History präpariert es zum raschen Konsum. Dagegen mein Lob der Pedanterie, der Aufruf zum Lesen dicker, alter Bücher, das Vergangene genau zu nehmen, es in seiner vergangenen Welt zu belassen. Die historisch-politische, aber auch die individualhistorische Aufgabe gegenüber der Vergangenheit besteht darin, sie so lange zu studieren, bis sie uns fremd anschaut. Größer noch als die Gefahr des Vertuschens der Nazi- und der DDR-Zeit ist die ständige Überformung des Gewesenen, das Überwältigen der Vergangenheit, ihr rasches Vernaschen, ihre zweckvolle Verwendung. Das Gewesene wird zum starren, aber schnell ausgewechselten Bild; es verliert den Charakter von Prozess, von Widerspruch, von Sperrigkeit, also: von Geschichte. Die fortrasende Geschichtslosigkeit delektiert sich an ihm, eignet es sich an zur Herrschaft oder Zier, lernt aber nichts. Eine Furie wütet bei uns, sie bringt das Vergangene als Vergangenes zum Verschwinden. Das kann man mit leiblichen Augen sehen. Viele alte Gebäude werden verputzt, man sagt, um den Stein vor Verfall zu schützen. Solche Denkmalschützer herrschen über das Vergangene, sie halten es zum raschen Konsum verfügbar. Nichts darf alt aussehen, weder Menschen noch Dinge. Alles wird angetüncht, alles Verwertbare geschminkt. Sie streichen Dome an, unterwerfen sich der chemischen Industrie und rühmen sich ihrer Sorge um das Vergangene. Sie geben gotischen Kirchen eine Einheitsfarbe oder tönen sie geschmäcklerisch ab, den alten Stein sehen wir nie. An alten Bauten und alten Büchern tobt sich heute eine dritte Welle der Zerstörung aus. Was Bombenkrieg und die schonungslose Plattmacherei der Wirtschaftswunderzeit zurückgelassen haben, übertünchen heute betuliche Restaurateure mit langweiliger Korrektheit: Das Alte muss proper, »gepflegt«, ordentlich und assimilierbar aussehen. Das Raue, das Schiefe und Abgeblätterte der alten Dinge verschwindet.
Ich schließe mit folgender Überlegung: Die deutsche, die europäische Vergangenheit bedarf ständiger Revision. Ihre kritische Durchsicht ist Aufgabe der Wenigen, die Muse und Methode haben. Sie haben daran ein Leben lang zu tun, sich Rechenschaft zu geben von einer langen Geschichte, von Denkart und Erziehung, von Philosophie und Kunst, Dichtung und Religion. Mit Distanz die Vergangenheit erforschen und aus der Vergangenheit mit Distanz auf die Gegenwart blicken – aber damit solche Gratwanderungen wahr sind und für andere nützlich, müssen sie genau erfolgen, mit strengem philologisch-historischem Beweisanspruch. Drei Elemente gehören zusammen: altmodische Philologie, philosophische Reflexion und politische Wachheit. Dazu die Abgrenzung nach beiden Seiten: Hier verkürzen Konservative die Vergangenheit auf bayrischen Barock, deutsche Leitkultur oder ornamenta ecclesiae. Dort glaubt mancher Nicht-Konservative, er stehe schon links, weil er kein Latein kann. Dagegen hilft nur der politische Sinn und die konkrete Arbeit am geschichtlichen Stoff. Dann wird das Studium der Vergangenheit zum gegenwärtigen Politikum. Davon wäre lange zu reden, aufs Detail kommt es an, aber Details dauern etwas länger. Doch für heute respektiere ich das Zeremoniell und höre jetzt auf, nicht ohne zuvor noch einmal Stiftung und Jury gedankt zu haben für diesen angesehenen Preis.
Dieses Jahr darf ich zum dritten Mal an der Verleihung des HannahArendt-Preises mitwirken. Bisher fand dieses festliche Ereignis immer im Bremer Rathaus statt. Dieses Jahr sind wir zum ersten Mal in den Festsaal der Bremischen Bürgerschaft geladen. Ich bedanke mich bei Christian Weber für diese Gastfreundschaft. Der Hannah-Arendt-Preis ist ein Preis für politisches Denken, er ist ein akademischer Preis und ein öffentlicher Preis. Von daher freut es mich besonders, dass wir dieses Jahr im Haus des Parlaments, der gewählten politischen Vertretung in Bremen, sind. Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken wurde 1994 ins Leben gerufen und 1995 zum ersten Mal verliehen. Den Preis stiften der Senat der Freien Hansestadt Bremen gemeinsam mit der Heinrich Böll Stiftung. Die Preisträ- ger werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt, auf die kein Einfluss genommen wird, und anschließend gemeinsam von den Preisgebern Senat und Heinrich-Böll-Stiftung verliehen. Diese Form der Preisvergabe an sich ist bereits ein Ausdruck für politisches Denken, das sich nicht instrumentalisieren lässt. Hannah Arendt wird in diesem Preis als herausragende Denkerin des 20. Jahrhunderts gewürdigt, die uns ein Vorbild in ihrer Unabhängigkeit von Ideologien und vorgegebenen Denkstrukturen ist. Dieser Preis ist auch Ausdruck des Versuchs, politisches Denken jenseits von Parteipolitik selbst zum Gegenstand des Diskurses einer interessierten Öffentlichkeit zu machen. Der allgemeinen »Politikverdrossenheit«, die in den Medien beklagt wird, wollen wir mit diesem Preis den Wert von Politik, die auf Denken beruht und des Denkens, das auf sein Umfeld rekurriert, entgegensetzen. Kurt Flasch hat in seinen sehr kenntnisreichen und lebhaften Schriften über die mittelalterliche Philosophie – aber auch über die Intellektuellen in der Zeit des Ersten Weltkriegs (Die geistige Mobilmachung) – gezeigt, dass es niemals das beschauliche, ruhige Denken abseits jeder Politik gegeben hat. Das Buch Kampfplätze der Philosophie trägt diesen Ansatz bereits im Titel. Kurt Flasch hat in seinem philosophiehistorischen Schriften – vor allem über mittelalterliche Philosophen – nachvollziehbar gemacht, welche grundsätzliche Konflikte immer wieder Anlass zu Auseinandersetzungen in den verschiedenen Zeitabschnitten bieten konnten. Indem wir verfolgen können, welche Kontroversen jeweils vor dem Hintergrund der vorherrschenden gesellschaftlichen Konventionen, der verfügbaren Erkenntnisse, dem Rahmen der dadurch gesetzten Tabus, geführt wurden, können wir in den Auseinandersetzungen, die jeweilig herangezogenen Kriterien und Maßstäbe entdecken. Wie Antonia Grunenberg es beschrieben hat, sind die Schriften von Kurt Flasch historische Abhandlungen über aktuelle Probleme. Heutige politische Dilemmata zeigen die philosophischen Grundprobleme, die uns seit der Antike begleiten. Es geht um die alten Polaritäten des politisches Denkens: Ethik und Macht, Verantwortung und Freiheit. Der Streit über die gültige, die richtige Bewertung der Welt fand stets im Kontext der jeweiligen Ideenwelt und der machtpolitischen Auseinandersetzung statt. Es gab nie die Philosophie als Denken im luftleeren Raum. Der aus dem zeitlichen Abstand als geradlinige geistesgeschichtliche Entwicklung, gar als Fortschritt »geschönte« und idealisierte Weg von der Spätantike und Mittelalter über die Aufklärung bis in die Gegenwart, wird in Kurt Flaschs Werk hinterfragt. Hier finden wir den Ansatz von Hannah Arendts Denken abseits der LinksRechts-Polarisierung des akademischen Denkens. Damit wird auch die Meinung in Frage gestellt, dass Werte absolut gesetzt werden können und universelle Allgemeingültigkeit besitzen. Der Ansatz weist auf die Relativität des eigenen Denkgebäudes hin, die uns in diesem Denkansatz gewahr wird. Dies ist ein politisches Denken, das sich bewusst ist, dass es eine Begrenztheit der eigenen Denkprozesse gibt. Denken findet statt vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Kontextes, der eigenen Geschichte und der eigenen Lebenswelt. Es ist geprägt von dem eigenen Geschlecht und Alter, sozialer Situation und Umfeld. Auf diese Art der Annäherung finden wir in aktuellen Konflikten, aktuellen politischen Auseinandersetzungen möglicherweise einen kritischen Zugang zu den dahinterliegenden Bedingtheiten.
Der Senat, ich als Bürgermeisterin kommen von der anderen Seite des politischen Denkens. Nicht von der Philosophie, dem intellektuellen Diskurs, sondern von den praktischen Anforderungen, für das Miteinander der Menschen in einem Bundesland. Für das Miteinander der Länder in Deutschland Lösungswege vorzuschlagen, zu überzeugen, durchzusetzen oder auch zu unterliegen. Alltäglich werde ich als Finanzministerin mit Setzungen konfrontiert, bei denen die jeweiligen Denkzusammenhänge im Blick gehalten werden müssen: — Leistung muss sich wieder lohnen. — Anreize für den Mittelstand. — Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen versus Reichtum ist Gotteslästerung. Dieser Preis ist ein Preis wider den Hochmut, wider den Eurozentrismus. Eine Rückbesinnung auf den Kern von Wissenschaft, nämlich Neugier, und das gibt es nur, wenn man nicht per se die eigenen Erkenntnisse für den Nabel der Welt hält. Danke Ihnen, Herr Flasch, für Ihr Werk und der Jury für die Wahl, die eine tröstliche Übereinstimmung im Denken ahnen lässt
Meine Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich in der Bremischen Bürgerschaft begrüßen. Allen voran Frau Bürgermeisterin Linnert, Herrn Prof. Bohrer, Herrn Fücks vom Vorstand der Heinrich Böll Stiftung, die Mitglieder der Jury und natürlich den diesjährigen Preisträger, Herrn Prof. Kurt Flasch. Es ist bisher eher die Ausnahme, dass uns Philosophen besuchen. Deshalb, verehrter Herr Prof. Flasch und Ihnen allen, ein besonderes Willkommen zur ersten Hannah-Arendt-Preisverleihung im Haus der Bremischen Bürgerschaft. Die Politik – das wissen wir, die darin verstrickt sind – steht vor allem im Spannungsdreieck mit den Wählern und den Medien. Aber Philosophie? Nun: Ich denke, sie lebt wie die demokratisch organisierte Politik von der Kraft der Vernunft und vom Diskurs. Etwas, bei dem jeder mitreden und jede sich einmischen kann, unabhängig von Herkunft, Weltanschauung oder gesellschaftlicher Stellung. Und schließlich ist der Hannah-Arendt-Preis ja ein Preis für politisches Denken. Ich konnte im Zusammenhang mit unserem heutigen Preisträger lesen: Philosophie beschränkt sich nicht auf Streben nach Wahrheit und Weisheit. Sie ist auch ein Kampf, ein Streit, ein Konflikt. Als Politiker weiß ich damit etwas anzufangen. Philosophen geraten vielleicht in diese Niederungen, wenn sie sich von einer Schule trennen und sich einer anderen anschließen – oder sich die eigene erdenken. Ich habe heute Morgen im Nordwestradio Herrn Prof. Flasch in einem Gespräch gehört und von seinen Schwierigkeiten mit der Frankfurter Schule erfahren. Da war er, der Streit!
Meine Damen und Herren, auch dieses Haus hat – wenn Sie so wollen – eine Philosophie, die sich insbesondere hier im Festsaal bemerkbar macht. Sie lautet: Licht als Baumaterial. Der Architekt dieses in seiner Entstehungszeit höchst umstrittenen Parlamentsgebäudes, Wassily Luckhardt, setzte auf das Licht als Quelle der Sinne und der Erkenntnis. Er ging mit Glas oder Beton ohne Pathos um, beschränkte sich auf das Notwendigste. Weiße Wände und Pfeiler, die »schwebende Decke« ebenfalls weiß. Luckhardt hat scharfe Kontraste bewusst vermieden. Als der Bundestagsabgeordnete und spätere Berliner Senator für Kunst, Adolf Arndt, 1960 einen Vortrag zum Thema »Demokratie als Bauherr« hielt, stieß er damit eine der interessantesten Architekturdebatten der Nachkriegszeit in Deutschland an: »Sollte es nicht einen Zusammenhang geben zwischen dem Öffentlichkeitsprinzip der Demokratie und einer äußeren wie inneren Durchsichtigkeit und Zugänglichkeit ihrer öffentlichen Bauwerke?« Es geht hier um den Transparenz-Gedanken. Luckhardts Haus der Bürgerschaft kann als eine frühe Verwirklichung dieses Konzepts angesehen werden. Sie werden sagen: Symbolik! Ja, aber Symbole sagen sehr viel über den Zustand einer verfassungsrechtlich verankerten Institution aus. Parlamentarismus, das wissen wir, lässt sich auch über Einlasskontrollen, Bannmeilen und Absperrgitter regeln. Sie befinden sich hier jedenfalls in einem offenen Haus. Mehr noch: Wenn Sie rausschauen, über den Weihnachtsmarkt hinweg, sehen Sie, wie Legislative und Exekutive, Kaufmannschaft
und Bürgerhäuser hier dicht und ungehindert nebeneinander stehen. Das ist das klassische Grundverständnis von Stadtgesellschaft. Oder, wenn wir griechisch und philosophisch bleiben wollen, der Polis. Keine deutsche Länderhauptstadt verfügt über eine vergleichbare demokratische Mitte. Ungeachtet dieser Symbolik müssen wir im Alltag allerdings feststellen, dass die Transparenz und die Einladung zum Mitmachen und Mitgestalten viele Bürgerinnen und Bürger nicht mehr erreichen. Dafür gibt es viele Ursachen, auf die ich hier nicht eingehen will. Nur eines: Verantwortlich dafür sind nicht allein die vermeintliche Entrücktheit und Unfähigkeit der Politikerinnen und Politiker. Ich sage, gerade auch mit Blick auf schwindende Wahlbeteiligungen und unser neues, komplexeres Wahlrecht in Bremen: Wir müssen intensiver denn je um die Menschen und ihre Interessen werben und daran arbeiten, Vertrauen wiederzugewinnen. Wir müssen also handeln, nicht nur, weil nach Hannah Arendt im Handeln Freiheit entsteht. Wir müssen auch deswegen handeln, um Freiheit nicht unter die Räder kommen zu lassen. Wir stehen vor der Situation, dass einerseits das Ansehen der Politiker in der Bevölkerung beständig gesunken und eine Mehrheit vom Politikbetrieb enttäuscht ist. Andererseits erfordern teilweise dramatische gesellschaftliche Veränderungen eine zunehmende politische Gestaltungskraft. Wandel und Fortschritt können wir nicht aufhalten. Aber wir können einen guten Ruf und Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern wiedererlangen – mit Arbeit, die überzeugt, die jeder nachvollziehen und am Ende sogar akzeptieren kann. Womit wir bei der Sprache wären und der Kunst, uns verständlich zu machen. Wir haben heute eine Persönlichkeit unter uns, deren Sprache geradezu bewundert wird: Prof. Kurt Flasch. Damit will ich enden. Ich bin überzeugt, dass der heutige Abend ein ganz besonderer auch für unser Haus sein wird. Und ich würde Sie gerne bei einer der nächsten HannahArendt-Preisverleihungen wieder hier am Platz der Volksvertretung begrüßen dürfen.
Meine Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich in der Bremischen Bürgerschaft begrüßen. Allen voran Frau Bürgermeisterin Linnert, Herrn Prof. Bohrer, Herrn Fücks vom Vorstand der Heinrich Böll Stiftung, die Mitglieder der Jury und natürlich den diesjährigen Preisträger, Herrn Prof. Kurt Flasch. Es ist bisher eher die Ausnahme, dass uns Philosophen besuchen. Deshalb, verehrter Herr Prof. Flasch und Ihnen allen, ein besonderes Willkommen zur ersten Hannah-Arendt-Preisverleihung im Haus der Bremischen Bürgerschaft. Die Politik – das wissen wir, die darin verstrickt sind – steht vor allem im Spannungsdreieck mit den Wählern und den Medien. Aber Philosophie? Nun: Ich denke, sie lebt wie die demokratisch organisierte Politik von der Kraft der Vernunft und vom Diskurs. Etwas, bei dem jeder mitreden und jede sich einmischen kann, unabhängig von Herkunft, Weltanschauung oder gesellschaftlicher Stellung. Und schließlich ist der Hannah-Arendt-Preis ja ein Preis für politisches Denken. Ich konnte im Zusammenhang mit unserem heutigen Preisträger lesen: Philosophie beschränkt sich nicht auf Streben nach Wahrheit und Weisheit. Sie ist auch ein Kampf, ein Streit, ein Konflikt. Als Politiker weiß ich damit etwas anzufangen. Philosophen geraten vielleicht in diese Niederungen, wenn sie sich von einer Schule trennen und sich einer anderen anschließen – oder sich die eigene erdenken. Ich habe heute Morgen im Nordwestradio Herrn Prof. Flasch in einem Gespräch gehört und von seinen Schwierigkeiten mit der Frankfurter Schule erfahren. Da war er, der Streit!
Meine Damen und Herren, auch dieses Haus hat – wenn Sie so wollen – eine Philosophie, die sich insbesondere hier im Festsaal bemerkbar macht. Sie lautet: Licht als Baumaterial. Der Architekt dieses in seiner Entstehungszeit höchst umstrittenen Parlamentsgebäudes, Wassily Luckhardt, setzte auf das Licht als Quelle der Sinne und der Erkenntnis. Er ging mit Glas oder Beton ohne Pathos um, beschränkte sich auf das Notwendigste. Weiße Wände und Pfeiler, die »schwebende Decke« ebenfalls weiß. Luckhardt hat scharfe Kontraste bewusst vermieden. Als der Bundestagsabgeordnete und spätere Berliner Senator für Kunst, Adolf Arndt, 1960 einen Vortrag zum Thema »Demokratie als Bauherr« hielt, stieß er damit eine der interessantesten Architekturdebatten der Nachkriegszeit in Deutschland an: »Sollte es nicht einen Zusammenhang geben zwischen dem Öffentlichkeitsprinzip der Demokratie und einer äußeren wie inneren Durchsichtigkeit und Zugänglichkeit ihrer öffentlichen Bauwerke?« Es geht hier um den Transparenz-Gedanken. Luckhardts Haus der Bürgerschaft kann als eine frühe Verwirklichung dieses Konzepts angesehen werden. Sie werden sagen: Symbolik! Ja, aber Symbole sagen sehr viel über den Zustand einer verfassungsrechtlich verankerten Institution aus. Parlamentarismus, das wissen wir, lässt sich auch über Einlasskontrollen, Bannmeilen und Absperrgitter regeln. Sie befinden sich hier jedenfalls in einem offenen Haus. Mehr noch: Wenn Sie rausschauen, über den Weihnachtsmarkt hinweg, sehen Sie, wie Legislative und Exekutive, Kaufmannschaft
und Bürgerhäuser hier dicht und ungehindert nebeneinander stehen. Das ist das klassische Grundverständnis von Stadtgesellschaft. Oder, wenn wir griechisch und philosophisch bleiben wollen, der Polis. Keine deutsche Länderhauptstadt verfügt über eine vergleichbare demokratische Mitte. Ungeachtet dieser Symbolik müssen wir im Alltag allerdings feststellen, dass die Transparenz und die Einladung zum Mitmachen und Mitgestalten viele Bürgerinnen und Bürger nicht mehr erreichen. Dafür gibt es viele Ursachen, auf die ich hier nicht eingehen will. Nur eines: Verantwortlich dafür sind nicht allein die vermeintliche Entrücktheit und Unfähigkeit der Politikerinnen und Politiker. Ich sage, gerade auch mit Blick auf schwindende Wahlbeteiligungen und unser neues, komplexeres Wahlrecht in Bremen: Wir müssen intensiver denn je um die Menschen und ihre Interessen werben und daran arbeiten, Vertrauen wiederzugewinnen. Wir müssen also handeln, nicht nur, weil nach Hannah Arendt im Handeln Freiheit entsteht. Wir müssen auch deswegen handeln, um Freiheit nicht unter die Räder kommen zu lassen. Wir stehen vor der Situation, dass einerseits das Ansehen der Politiker in der Bevölkerung beständig gesunken und eine Mehrheit vom Politikbetrieb enttäuscht ist. Andererseits erfordern teilweise dramatische gesellschaftliche Veränderungen eine zunehmende politische Gestaltungskraft. Wandel und Fortschritt können wir nicht aufhalten. Aber wir können einen guten Ruf und Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern wiedererlangen – mit Arbeit, die überzeugt, die jeder nachvollziehen und am Ende sogar akzeptieren kann. Womit wir bei der Sprache wären und der Kunst, uns verständlich zu machen. Wir haben heute eine Persönlichkeit unter uns, deren Sprache geradezu bewundert wird: Prof. Kurt Flasch. Damit will ich enden. Ich bin überzeugt, dass der heutige Abend ein ganz besonderer auch für unser Haus sein wird. Und ich würde Sie gerne bei einer der nächsten HannahArendt-Preisverleihungen wieder hier am Platz der Volksvertretung begrüßen dürfen.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz