
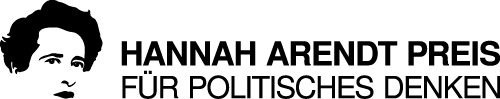

François Jullien, französischer Philosoph und Sinologe, lehrt in Paris
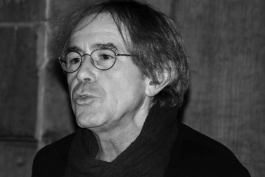
© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Hannah Arendt steht für ein politisches Denken, das sich den Herausforderungen der Zeit stellt. Sie hatte die Fähigkeit, die dunklen Seiten der politischen Moderne in der Tiefe zu beleuchten und die beispiellosen Schrecken des 20. Jahrhunderts als etwas bisher nicht Dagewesenes zu durchdenken, dabei ohne Scheu – wie sie sagte – auf die »Geländer« bisher geltender philosophischer Wahrheiten verzichtend. So sind ihre Erkenntnisse über totalitäre Herrschaft möglich geworden; ebenso ihre wegweisenden Überlegungen zum Verhältnis von Macht und Gewalt und nicht zuletzt ihre Gedanken zur Bedeutung von republikanischer Freiheit. Die Kraft dieser Schlüsselkategorien ihres Denkens hat sich besonders im Verständnis der Freiheitsrevolutionen im Europa der letzten Jahrzehnte – nicht zuletzt 1989 – erwiesen. Den Preisgründern aus Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit liegt seit der ersten Preisverleihung 1995, seinerzeit an die ungarische Philosophin Agnes Heller, daran, die Bedeutung des politischen Denkens von Hannah Arendt für die Erneuerung republikanischer Freiheitspotenziale in West und darüber hinaus in Ost hervorzuheben. Nicht alle bisherigen Hannah-ArendtPreisträger weilen noch unter uns. Wir beklagen den Verlust von Tony Judt, den seine tödliche Krankheit im August dieses Jahres besiegt hat und wir beklagen auch den Tod von Claude Lefort, der im Oktober dieses Jahres starb. Von beiden herausragenden Denkern sind in diesem Jahr neue Bücher erschienen, bedeutende Essaysammlungen, und dazu von Tony Judt ein Buch über seine Kindheitserinnerungen. Bücher, die es uns erlauben, uns mit ihren Vorstellungen und Gedanken weiterhin auseinanderzusetzen.
Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken soll dazu ermutigen, Hannah Arendts handlungsnahes und ereignisoffenes Politikverständnis auch für gegenwärtige Diskurse in Politik und Gesellschaft fruchtbar zu machen. Daher werden Personen geehrt, die das von Hannah Arendt so eindringlich beschriebene und von ihr selbst praktizierte »Wagnis Öffentlichkeit« angenommen haben, also Personen. die sich gegen das einfache Fortschreiben des bisher für richtig Gehaltenen verwahren, es vielmehr prüfen und das, was neu gedacht und behandelt werden muss, öffentlich, auch kontrovers, darlegen. Unser diesjähriger Preisträger, François Jullien, hat die Herausforderung eines wachen Hinsehens und Hinhörens zum Begreifen von Veränderungen und Wandel in unserer globalen Welt besonders von seinem Verständnis chinesischen Denkens her angenommen: Er arbeitet darin die Aufmerksamkeit auf Prozesse nicht sichtbarer, aber prägender und durchdringender Beeinflussungen heraus, deren Bedeutung erst nach einer gewissen Dauer schlagartig deutlich werden. In seiner Schrift Die stillen Wandlungen hat er solchen Vorgang so beschrieben: »Eine untergehende und verlöschende Welt, ein plötzlich explodierender Stern enthüllen mitunter wie durch einen Paukenschlag dieses ununterbrochene Gewebe, auf das wir mit offenen Augen blicken, ohne es richtig zu begreifen.« Es besteht kein Zweifel, dass wir am Ende des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts vor großen Veränderungen stehen. Die keineswegs ausgestandene Krise der Finanzwelt hat uns mit den möglichen Ausmaßen dieser Veränderungen schon konfrontiert. Die Politik, die sich in den letzten Jahrzehnten in eine neoliberale Zwangsjacke manövrierte, musste erfahren, dass wir ohne politische Gestaltung nicht gut leben können, dass ein Markt ohne Rahmen und Grenzen zwar die Lebenswelt kommerzialisieren kann, nicht aber eine Welt schafft, die menschenwürdig ist. Jedoch – hat die Politik inzwischen den elementaren Sachverhalt wirklich gelernt und begriffen, dass globale Prozesse ohne Regeln jetzt uns, anders als viele denken, längst in zerstörerischer Form einholen? Die vom Westen in Gang gesetzten Prozesse machen es heute unabweisbar nötig, dass wir uns mit dem Denken auf anderen Kontinenten und mit anderen, nichtwestlichen Kontexten befassen. Unser Preisträger hat sich mit nichtwestlichem Denken befasst und dieses in der Tiefe beleuchtet. Professor Jullien ist Philosoph und Sinologe, geboren 1951 in Embrun im französischem Département Hautes-Alpes. Er studierte in den 1970erJahren in Paris Philosophie sowie Chinesisch in Shanghai. Seit 2001 ist er Mitglied in verschiedenen hochrangigen akademischen Institutionen Frankreichs: Er ist unter anderem Direktor des Instituts für zeitgenössisches Denken und seit 2004 Professor für ostasiatische Sprachen und Kultur. Professor Jullien ist zudem tätig als Wirtschaftsberater französischer Unternehmen, die Projekte in China durchführen, sowie als Herausgeber der Sammlungen »Orientales« und »Libelles« beim Verlag Presses Universitaires de France in Paris. Seine Schriften wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
In einem Brief an Uwe Johnson vom 12. Februar 1974 schreibt Hannah Arendt: »Inzwischen dürfte zu den Teilen der Welt, die weder Sie noch ich verstehen, auch noch China hinzugekommen sein. Die große Frage ist, wer ist Konfuzius? Ich fürchte sehr Chou Enlai.« Interpretieren lässt sich diese Briefpassage nur durch ihre Beziehung zu den damaligen, schwer durchschaubaren Auseinandersetzungen in China. Uwe Johnson hatte ihr zuvor geschrieben, dass er jetzt noch ganz andere Teile der Welt nicht verstehe als vordem. »Es wird Sie nicht überraschen, aber mich plagt es.« Offensichtlich plagte sich auch Hannah Arendt: »Eins ist sicher: Weder Sie noch ich wissen genau, ›wie es in Wahrheit sich verhält‹, nämlich mit der wieder ins Rutschen geratenen Weltgeschichte.« Was in China nach Beendigung der Kulturrevolution passieren würde, schien damals völlig offen. Auf Karl Jaspers, den Lehrer und Freund, hatte, wie er Hannah Arendt im September 1957 schrieb, gerade Konfuzius »großen Eindruck« gemacht. Er hatte ihn im ersten Teil seiner Schrift über die großen Philosophen neben Jesus, Sokrates und Buddha zu den vier »maßgeblichen Menschen« gerechnet: »Ich wollte ihn nicht nur gegen die Banalisierung sogar seitens der meisten Sinologen schützen, sondern er war mir für uns ergiebig.« Bei Hannah Arendt hat dieser »große Eindruck« keine Wirkung erzielt. China interessierte sie vor allem als Machtfaktor im Umfeld des Vietnamkrieges und in seinem Verhältnis zur Sowjetunion. So schrieb sie am 28. April 1965 an ihre Freundin Mary McCarthy, der Vietnamkrieg mache alle vernünftigen und vorteilhaften Lösungen für die Region unmöglich. »Wenn wir es gut sein ließen, würden wir dort eine Vielzahl sozialistischer bis kommunistischer Regime bekommen, mit denen wir sehr gut leben könnten, von denen einige an Russland orientiert wären und andere mehr China zuneigen würden. Ich habe keinen Zweifel, dass Asien als Ganzes auf lange Sicht unter chinesischen Einfluss kommen wird, aber nicht notwendigerweise unter chinesische Vorherrschaft. Wenn wir mit unserer Torheit China und Russland wieder zusammenbringen – ach, der Satz sei nicht beendet.« Auf China sei die ideologische und politische Initiative übergegangen, hatte sie 1957 nach der Niederschlagung des Ungarnaufstandes und in Interpretation von Maos Rede über die »inneren Widersprüche« geurteilt. Offensichtlich sei die Rede in bewusster Abgrenzung zur offiziellen russischen Ideologie formuliert. Sie sei »zweifellos das erste ideologisch neue und ernstzunehmende Dokument, das seit Lenins Tod aus dem kommunistischen Machtbereich zu uns kommt … Das kann von großer Bedeutung für die Zukunft sein, es mag sogar irgendwann einmal die totalitäre Natur des russischen Regimes ändern.« Im August 1966 schreibt sie dann Jaspers, dass sie bald anfange, Maos Tage zu zählen. Sie glaube, »dass er entweder tot oder halbtot ist – die Schwimmerei schien mir ein Beweis, dass er nicht mehr da ist«. Da hatte sie sich allerdings um gut zehn Jahre verschätzt. Hannah Arendt hat sich mit China nolens volens als Zeitgenossin politisch beschäftigt und das auch eher vage und selten. Selbst als Analytikerin des Totalitarismus hat China sie nur am Rande interessiert. Ihr politisches Denken war ganz durch die Polis und das Wiederanknüpfen an die Antike durch Renaissance und republikanische Revolution geprägt. Der Totalitarismus bedeutete für sie die Zerstörung dieser Tradition. Diese Tradition hatte es aber in China so nie gegeben. Das chinesische Denken lag, so kann man wohl sagen, weitgehend außerhalb ihres philosophischen Interesses. Insofern blieb sie ganz Kind der klassischen europäischen Bildung.
In der Jury des Hannah-Arendt-Preises fragen wir uns natürlich bei jeder Preisverleihung nach dem »Hannah-Arendt-Bezug«. Diesmal ist der Bezug zu Hannah Arendt also eher eine Lücke, eine Leerstelle in ihrem Werk. 1974 fiel ihr das, wie eingangs zitiert, schmerzlich auf. In China tobte die Kampagne zur Kritik an Lin Biao und Konfuzius. Die Frage »Wer ist Konfuzius?« war also aktuell. Zugleich zeigte sie, wie die aktuellen Auseinandersetzungen in China ihr Material aus der langen Tradition chinesischen Denkens bezogen und immer noch beziehen. Das macht sie im Westen nicht unbedingt leichter durchschaubar.
China und Europa hatten sich mehr als ein Jahrtausend nebeneinander in ihrer jeweiligen Welt entfaltet. In diesem Nebeneinander ohne größere Berührungspunkte entwickelte sich das Denken in inneren Kontroversen ohne wechselseitigen Bezug aufeinander. In den letzten fünfhundert Jahren haben sich die Beziehungen zwischen dem Westen und China aus einem Nebeneinander zu einem Gegen- und Miteinander entwickelt. Man ist also gezwungen, sich nach und nach gegenseitig besser zu verstehen. Auch in den alltäglichen Auseinandersetzungen machen sich die unterschiedlichen Denkweisen bemerkbar. Auf die amerikanische Kritik an der chinesischen Währungspolitik und die Forderung nach rascher Aufwertung des Renminbi antwortete der Chef der chinesischen Notenbank, die Wechselkursdebatte sei wie ein Wettstreit zwischen »westlichen Tabletten, die das Problem über Nacht lösen« und Behandlungen im Sinne der chinesischen Heilkunde, die »zehn Kräuter zusammenrührt, die das Problem nicht über Nacht, aber vielleicht in ein, zwei Monaten lösen«. In der Debatte um politische Reformen zwischen China und dem Westen spielen Tempo und Dauer eine entscheidende Rolle.
Aber stellt die rasante wirtschaftliche und urbane Entwicklung in China nicht jede Mählichkeit infrage? Mark Siemons, unser Laudator, gibt mit seinen Korrespondenzen aus China regelmäßig zu denken. Modernisierung sei bis jetzt im chinesischen Bewusstsein gleichbedeutend mit Geschwindigkeit und Veränderung, schrieb er kürzlich. Viele Strukturen jedoch, mentale wie institutionelle, hielten mit dem Tempo der Modernisierung in immer mehr Lebensbereichen nicht mit. Als Beleg für das damit verbundene Unbehagen kann er die KP-Zeitung Global Times anführen. Die forderte von der Regierung, sie müsse sich genauso für die Sicherheit der Bürger wie für die nationale Sicherheit einsetzen: »Die Modernisierung sollte auch das Verlangen nach einer größeren Ruhe des Geistes einschließen.« Stammt diese Überlegung nicht ganz aus Chinas ureigener Tradition? Aber wird sie heute noch Wirkung zeigen? Zumindest gibt es erneut Auseinandersetzungen mit und über Konfuzius. Mark Siemons hat auch darüber berichtet. Man kann das Verhältnis von individueller Freiheit und politischer Ordnung von beiden Seiten her angehen. Theoretisch, aber nicht ohne Weiteres praktisch, wird im Westen immer vertreten, dass ohne individuelle Freiheiten eine dauerhafte politische Ordnung nicht möglich sei. Umgekehrt lautet das chinesische Argument, dass ohne stabile politische Ordnung die individuelle Freiheit bestenfalls für wenige gelte, für die meisten aber nur auf dem Papier stehe. In Wirklichkeit fordert das Verhältnis von Freiheit und Ordnung keine Entscheidung für die eine oder andere Seite, sondern Erörterung und Abwägung. Diese werden aber immer unterschiedliche Ausgangspunkte behalten und die beiden Seiten unterschiedlich gewichten. Für Chinas politische Führung wird bis auf Weiteres politische Ordnung und Stabilität den Vorrang einnehmen. Wahrscheinlich wird auch der Mehrheit der chinesischen Gesellschaft Liberalisierung des Regimes und nicht Regimewechsel als Ziel vorschweben.
Unser diesjähriger Preisträger macht es sich zur Aufgabe, auf dem Umweg über China auch das westliche Denken besser in seiner Besonderheit zu verstehen. In immer neuen Anläufen und zu verschiedenen Themen bemüht er sich, das chinesische Denken zu verstehen und zu verdeutlichen. China zu verstehen heißt dann aber auch Schranken des eigenen, des westlichen Denkens fühlbar zu machen. Die Grenzen überschreiten lässt die Grenzen nicht verschwinden. »Das Angenehme, Seltsame und Erfrischende im Denken der Chinesen ist, dass sie sich von Kategorien fernhalten, ohne Empiristen zu werden.« Die Bemerkung aus dem Mai 1947 findet sich in den Aufzeichnungen Franz B. Steiners, eines Prager Philosophen im britischen Exil. Ich könnte mir vorstellen, dass sie François Jullien gefällt. Die Preisvergabe an François Jullien hat vonseiten der Jury – wenn ich hier für alle Mitglieder sprechen darf – den Sinn, auf das wachsende Interesse an China, an dessen Rolle und Entwicklung und damit auch an chinesischem Denken mit dem nachdrücklichen Hinweis auf einen Autor zu antworten, der das jahrtausendlange unverbundene Nebeneinander Chinas und des Westens in ihren jeweiligen Entwicklungen, Ausprägungen und Folgen ernst nimmt und sich immer erneut auf den Umweg über China macht. Unermüdlich nimmt er seine transkulturelle Übersetzungsarbeit neu in Angriff, um ein wechselseitig aufgeklärtes Miteinander zu fördern. Um mit Hannah Arendt zu sprechen: Die Weltgeschichte ist heute erneut ins Rutschen geraten. Es gab mal die Frage nach dem Gleichgewicht der Blöcke, sie verschob sich zur Frage nach der Gewichtung in den G 8. Heute fragt sich, wie der Westen in den G 20 mit den neuen Schwergewichten unter den Schwellenländern und mit dem spezifischen Gewicht Chinas zurechtkommt. Die Frage nach den Universalien stellt sich nicht mehr einfach als Frage der Durchsetzung westlicher Werte, sondern als Frage, wie globale Gemeinsamkeiten erarbeitet werden können und wie haltbar sie sein werden. Ich glaube, Hannah Arendt würde François Julliens Umwege über China zurück auf das europäische Forum schätzen. Immer wieder bringt er Neues heim.
Das Denken in Bewegung setzen
Europa und China, jenseits des Kulturrelativismus – Laudatio auf François Jullien
Wer heute darüber nachdenkt, was die Verschiedenheit der Kulturen für die Politik bedeutet, kommt um China nicht herum. Der Aufstieg der alten Kultur zu einer wirtschaftlichen und politischen Macht, die sich den Strukturen des Westens nicht eingliedert, lässt nach den Bewertungskriterien fragen, die man an Vorgänge wie diesen anlegen kann. Soll man, darf man, ein Land wie China aus seinen eigenen Maßstäben heraus verstehen? Oder betreibt, wer sich auf die Andersartigkeit einer Kultur beruft, das Geschäft repressiver Ideologen, die ihr Volk vor den Ansprüchen universeller Werte fernhalten wollen? Auf den ersten Blick ist China der klassische Fall einer solchen Auseinandersetzung zwischen Kulturrelativisten auf der einen Seite und Universalisten auf der anderen. Auf den zweiten Blick zeigt jedoch gerade das Beispiel China, dass so einfach die Sache nicht ist. Die chinesische Kultur zeichnete sich von jeher eben durch ihre Beweglichkeit aus, mit der sie fremde Einflüsse in sich aufnahm. Und so, wie sie früher den indischen Buddhismus und den deutsch-russischen Marxismus integrierte, ist nicht zu erkennen, dass heute die Chinesen, die etwa im Internet oder an den Universitäten über Demokratie und Menschenrechte diskutieren, darin etwas sehen, was ihrer Kultur wesensfremd wäre. Sogar die Kommunistische Partei, die immer von den besonderen »chinesischen Kennzeichen« spricht, die verbieten würden, dass China eine westliche Demokratieform übernehme, hütet sich, das mit einer speziellen »Kultur« inhaltlich zu füllen. Offenbar betrifft die Kultur im Fall Chinas gar keine Ansammlung essenzialistischer, sich nach außen abgrenzender Positionen, sondern im Gegenteil eine gleichsam begriffslose Beweglichkeit, die potenziell alles einschließt und doch zugleich zu etwas Eigenem umschmilzt. So gesehen würde die chinesische Kultur also vor allem anderen die Frage danach aufwerfen, was überhaupt eine Kultur ist, und dabei alle vorgefassten Gewissheiten hinter sich lassen. Den chinesischen Weisen Zhuangzi pflegt François Jullien gern mit dem Satz zu zitieren: »In jeder Diskussion gibt es etwas Undiskutiertes.« All dies gilt es zu erwägen, wenn mit einem Preis für politisches Denken heute ein Philosoph ausgezeichnet wird, der seine ganze Energie in das Ausloten sprachlicher Finessen zu stecken scheint. Ein Philosoph, der, genauer gesagt, jenen Abstand rekonstruieren will, den das klassische Chinesisch mit einigen seiner charakteristischen Besonderheiten zur europäischen Rationalität herstellt. Konfuzius zum Beispiel übersetzt er nicht wie üblich so: »Wer am Morgen den rechten Weg erkannt hat, könnte am Abend getrost sterben« (Gespräche IV, 8) – so als ob der Meister einer jener Sinnsucher wäre, wie man sie im Abendland gut kennt. Sondern er versucht, zu einer ursprünglichen, noch nicht in westliche Semantik übertragenen Struktur der alten Schriftzeichen zurückzugehen. Dann lautet der Satz so: »In der Frühe den Weg vernehmen und des Abends sterben: das geht.« Auf einmal stehen nicht mehr der »Weg« oder das »Sterben« im Zentrum des Satzes, sondern das kaum hörbare, am Rande der Nicht-Aussage balancierende: »Das geht.« François Jullien ist der Philosoph solcher kaum hörbaren Sätze, deren vermeintlich widerstandslos vor sich hin plätschernde Flachheit er unter den verfälschenden Versuchen, sie zu einer diskursfähigen Aussage umzuschmieden, freilegt. François Jullien hat gerade selber demonstriert, welche weitgehenden Konsequenzen eine solche Philologie des kaum Hörbaren für die europäische Theorie des Politischen haben kann. Ich möchte nun zeigen, welche Rolle dieses Denken auch für die gegenwärtige Politik spielen kann – wie es ins Zentrum jener irritierenden Fragen führt, denen sich das Zusammenleben im eigenen Land und in der ganzen Welt durch die Globalisierung zurzeit ausgesetzt sieht. Ich möchte mich also auf den Umgang mit Kulturen konzentrieren, wie ihm François Jullien eine neue Perspektive eröffnet hat, die über den Ausgangspunkt China hinausgeht. Bei Jullien wird die Sprache der alten chinesischen Denker zur Probe aufs Exempel dessen, was Universalismus und was Kulturen bedeuten können – und was sie nicht bedeuten können.
Jeder spürt, dass sich im Gefüge der Weltordnung etwas verschiebt, sei es durch den Aufstieg nicht-westlicher Mächte, durch die globalen Wanderbewegungen oder durch die Politisierung des Islam. Das alte Europa konzentriert sich in dieser Lage vielfach darauf, was es zu verlieren hat, und reagiert mit Unsicherheit. Eben noch schienen republikanisches Staatsverständnis, universalistische Werte und kulturelle Offenheit einen solchen Status unangefochtener Selbstverständlichkeit in Europa zu besitzen, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass Ressentiments in der öffentlichen Sphäre gegen sie eine Chance hätten. Und jetzt wirbelt der Druck der ökonomischen, aber auch der kulturellen Globalisierung die vertrauten Kategorien durcheinander und zwingt dazu, ihren Zusammenhang neu und präziser als vorher zu bedenken. Auf der einen Seite wird ein in sich erstarrter Kulturbegriff dazu verwendet, republikanische Standards aufzuweichen – nicht nur nach außen, wenn man repressiven Regimen immer wieder eine spezielle kulturelle Tradition als Rechtfertigung durchgehen lässt, sondern neuerdings auch nach innen, wenn etwa die Bewohner der Bundesrepublik auf eine spezielle deutsche Kultur, genannt »Leitkultur«, verpflichtet werden sollen. Auf der anderen Seite muss der Universalismus dazu herhalten, den Wert kultureller Verschiedenheit in Zweifel zu ziehen oder gar zu leugnen, dass es eine solche kulturelle Verschiedenheit überhaupt gibt, sofern damit etwas in irgendeiner Weise Relevantes gemeint sein soll. Jenseits solcher Versuchungen tut sich eine grundsätzlichere Frage auf: die Frage nach dem Verständnis der Rationalität. Der Anspruch der Universalität von Werten kann sich nur von der Universalität der Vernunft herleiten, auf der sie gründen. Welche Rolle spielt es nun, dass die Menschenrechte zum ersten Mal in Europa formuliert wurden? Ist die europäische Rationalität, die das möglich machte, selber schon etwas Universelles? Oder bedarf sie aufgrund ihrer unvermeidlichen Begrenztheit und Partikularität einer fortwährenden Ergänzung und Kritik, damit die von ihr postulierten Werte sich mit immer größerem Recht tatsächlich als universelle bezeichnen können? Erschöpft, mit anderen Worten, »der Westen« die Rationalität? Oder kann man es für denkbar halten, dass andere Weltgegenden weitere Rationalitätsmöglichkeiten bergen? Das ist der Kern der Frage nach der Verschiedenheit der Kulturen, sofern damit nicht bloß andere folkloristische Oberflächen gemeint sein sollen. Stecken in nicht-westlichen Kulturen andere Rationalitätselemente, die der Westen sich umso weniger leisten kann zu ignorieren, als er am universellen Anspruch der von ihm vertretenen Werte interessiert ist? Solche Fragen, die man auf den ersten Blick für bloß akademische halten könnte, haben sehr handfeste Auswirkungen auf das globale Zusammenleben, auf die Art und Weise, mit der Europa seine Werte in der Welt zur Geltung bringt.
François Jullien hat oft darüber berichtet, wie es dazu kam, dass er seinen »Umweg über China« antrat. Als junger Gräzist suchte er nach einer Möglichkeit, die eigene europäische Rationalität von außen zu betrachten, um so auch ihre blinden Flecken, ihre uneingestandenen, da von innen notwendigerweise unsichtbaren Voraussetzungen in den Blick zu bekommen. Aus sich selbst heraus kann diese Rationalität ihr Außen, eine »Heterotopie«, wie Jullien mit Foucault formuliert, nicht erschaffen, da sie es dabei ja immer nur wie in einem Spiegelkabinett mit Projektionen ihrer selbst zu tun hätte. Wo aber sonst wäre das Außen dann zu suchen? Die Urkulturen, mit denen sich die Ethnologen beschäftigen, drücken sich nicht schriftlich aus und waren daher für Julliens Zwecke nicht geeignet. Indien kam nicht infrage, weil diese Kultur ihre etymologischen Wurzeln und Syntaxformen mit den europäischen Sprachen teilt. Die arabische Tradition war durch eine lange gemeinsame Geschichte und viele gegenseitige Beeinflussungen mit Europa verbunden, fiel also auch fort. Es blieb für Jullien am Ende nur eine Kultur, die alle Bedingungen erfüllte: die chinesische. So wurde er zum Sinologen, ein Sinologe freilich, der seine philosophische Ausgangsfrage nie aus dem Blick verlor. Die Art und Weise, auf die Jullien von China aus nun auf Europa blickt, sollte sich sehr von der Art unterscheiden, auf die gewöhnlicherweise Kulturen miteinander verglichen, gegeneinander ausgespielt oder wechselseitig in Dialog gebracht werden. Kulturen sind für ihn keine opaken großen Textbausteine, die in dem aufgehen, was sie selbst von sich behaupten. »Jede Kultur«, so hat er einmal geschrieben, »und vor allem die europäische, die nicht aufhört, sich zu verändern und zu wandeln, sich zu ent-spezifizieren, um sich anders zu re-spezifizieren –, welche Merkmale wären bei ihr festzuhalten, die nicht eine Karikatur oder ein Klischee von ihr wären?« Die sogenannten dominanten, die auffälligsten Merkmale einer Kultur seien in Wirklichkeit auch die uninteressantesten. Der Grund dafür ist, dass Kulturen eben keine in sich geschlossenen, starren Monaden sind, die sich in ihren Absichten und Maßstäben definieren, also eingrenzen und fixieren ließen. So wie eine Kultur die Menschen, die in ihr aufwachsen, nicht determiniert, verändert sie sich selbst auch mit diesen Menschen, deren Leben – heute mehr denn je – durch vielerlei kulturelle Elemente beeinflusst ist und im Übrigen durch immer neue technische, ökonomische und politische Herausforderungen geprägt wird. Man könnte vielleicht so weit gehen, zu sagen, dass ein Gutteil heutiger Kurzschlüsse, Missverständnisse und Konfrontationen auf jene fatale Abstraktion zurückgeht, die Kulturen zu fest umgrenzten Blöcken macht, die wie im Modellbaukasten hin und her verschoben werden können. François Jullien wählt einen anderen Weg. Bei seiner Suche nach noch unergründeten Möglichkeiten der Rationalität fahndet er nach dem, was er den »Übereinstimmungsgrund« einer Kultur nennt: dasjenige, was in einer Kultur schon gar nicht mehr eigens zum Thema gemacht wird, weil es deren für selbstverständlich gehaltenen, undiskutierten Boden darstellt. Diese impliziten Bedingungen einer Kultur lassen sich nicht durch die Großbegriffe erfassen, wie sie üblicherweise gegeneinandergestellt werden. Jullien sucht stattdessen nach möglichst unverbrauchten, wenig kompromittierten Vokabeln vom Rand des Diskurses, die auf der schiefen Ebene des Textverlaufs ihren Bedeutungshof allmählich zu erweitern vermögen; in seinen Essays geht es daher um Kategorien wie Fadheit, Neigung, Regulierung, Effizienz oder Kongruenz. Statt »Europa« und »China« frontal aufeinanderstoßen zu lassen, geht er von vielen einzelnen solcher Punkte aus, deren Linien sich dann in der Folge seiner Texte zu einem Netz verdichten, bis sie am Ende etwas enthüllen, was ursprünglich nicht abzusehen war.
Diese Methode verdankt sich einer gegen den Strich gebürsteten Lektüre alter chinesischer Autoren. Konfuzius zum Beispiel, der, wie wir gesehen haben, Jullien nicht in dem am interessantesten erscheint, was sich geschmeidig in einen westlichen Diskursrahmen wie den der Sinnsuche einfügen lässt, sondern in dem, was eine eigene Möglichkeit, zu denken und sich zu äußern begründet: eine Möglichkeit, die um so bemerkenswerter ist, je weniger hörbar, wahrnehmbar sie den westlichen Diskursmustern erst einmal vorkommt. In seinem Essay »Umweg und Zugang« zeigte Jullien, wie solche Texte dem definierenden Diskurs des Westens, der die Dinge möglichst eng einkreisen will, eine mehr hinweisende Rede gegenüberstellen. In dem Buch Der Weise hängt an keiner Idee demonstrierte er, wie diese Denkweise etwas in den Blick bekommen kann, das der auf Streitfragen und Debatten fixierten westlichen Rationalität entgeht: die Evidenz des allzu Bekannten und Gewöhnlichen. Ein erst kürzlich erschienener Band befasst sich mit »stillen Wandlungen« wie dem Altern, die ein auf Identität und Kontinuitäten bezogenes Denken schwer auf seine Begriffe bringen kann. Im Bereich der Ästhetik, so schrieb er in dem Band Über das Fade, drücke sich dieser allen rationalen Unterscheidungen und Ausgrenzungen vorausliegende »Immanenzgrund« der Wirklichkeit in der »Fadheit« aus, mit der Dichtung, Malerei und Musik alle dramatischen Kontraste unterlaufen. Auf dem Feld des Handelns, legte er in dem Essay »Über die Wirksamkeit« dar, stehe der westlichen Modellbildung und Zweck-Mittel-Beziehung ein Denken in Situationspotenzialen gegenüber, das alle Wirkung organisch aus einer Ausgangsbedingung entstehen lässt. Mit diesem Verfahren bringt Jullien erst einmal das Denken selbst in Bewegung. Indem er die eingefahrenen Pfade mit deren gewohnten Begriffen und Problemen verlässt und sich den in der Sprache und der jeweiligen Perspektive enthaltenen impliziten Vorannahmen zuwendet, schafft er neue Anknüpfungsmöglichkeiten. Entsprechend groß ist die Wirkung, die er auch weit außerhalb der Fachmilieus in Künstler- und Intellektuellenkreisen erzielt. Seine Kritiker versuchten Jullien dagegen vielfach weiter in den konventionellen Rastern einzuschließen, die sein Verfahren gerade aufgebrochen hatte, vor allem dem Raster des Kulturrelativismus. Das weist auf etwas Allgemeineres hin: wie schwer nämlich die Vorstellung zu akzeptieren zu sein scheint, dass auch der im Westen zuerst formulierte Universalismus einer Erhellung durch Regionen außerhalb seines Ursprungsorts bedürfen kann. Dass Kulturen sich zwar fortwährend im Austausch mit anderen ändern, aber dabei doch ihre Fähigkeit behalten können, einander wechselseitig mit bislang Ungedachtem und Ungelebtem zu konfrontieren. Nachdem vielen klar geworden ist, dass Kulturen die Menschen nicht in Geiselhaft nehmen, dass sie, mit anderen Worten, nicht alles sind, schwingt das Pendel mittlerweile offenbar öfter in die entgegengesetzte Richtung aus. Inzwischen muss man anscheinend wieder lernen: Kulturen sind auch nicht nichts. Die Kritik veranlasste Jullien jedenfalls zu immer differenzierteren Erklärungen und Systematisierungen seines Ansatzes. Diese Selbstkommentare, vor allem in dem 2008 erschienenen und letztes Jahr auf Deutsch veröffentlichten Buch Das Universelle, das Einförmige, das Gemeinsame und der Dialog zwischen den Kulturen, sind zu einem wesentlichen Bestandteil des Werks selbst geworden: Ein Werk, das nicht nur die Ergebnisse seiner chinesischen Erkundungen präsentieren, sondern ein methodisches Exempel statuieren will – einen Rahmen skizzieren, in dem sich das bewegen kann, was man eine Philosophie des kulturellen Abstands nennen kann. Diese Philosophie geht davon aus, dass nicht nur das Reden über Kultur durch starre Abstraktionen in die Irre geführt wird, sondern auch das über Universalismus. Nur unter den Voraussetzungen solch vorschneller schematischer Abstraktionen kann man nämlich jenen Gegensatz zwischen Universalismus auf der einen Seite und Kulturalismus oder Kulturrelativismus auf der anderen konstruieren, der heute so viel Einfluss hat. Wieder bei Konfuzius hat Jullien die Bemerkung gefunden, dass der Weise »an keiner Idee hängt«, also nicht eine einzelne Idee allen weiteren Überlegungen voranstellt und sich dadurch begrenzen lässt. Er deutet diesen Ansatz als Forderung, das Denken in einer fortwährenden Spannung zu halten. Vielleicht hat ihn dieses Fundstück bei seiner Feststellung beeinflusst, dass es nicht im Voraus gegeben und definiert ist, was »der Mensch« ist, von dem die universellen Werte sprechen. Er bevorzugt daher den Ausdruck »das Menschliche« und schreibt: »Das Menschliche reflektiert sich – spiegelt sich und denkt gleichzeitig über sich nach – in seinen verschiedenen Vis-à-vis«, die, wie man ergänzen muss, in den verschiedenen Facetten der verschiedenen Kulturen gegeben sind. Er besteht also sowohl darauf, dass es reale Unterschiede gibt, als auch, dass es etwas Gemeinsames gibt, das »Gemeinsame des Intelligiblen«, das sich gerade in den Unterschieden erkennen lässt. Gerade wenn man das »Universelle« als regulative Idee ernst nehme, schreibt er, werde es jede gegebene Totalität (wie die der »installierten Universalismen«) aufbrechen und fortlaufend »die Bedingungen der Möglichkeit eines Gemeinsamen freisetzen«. Bei der »Selbstreflexion des Menschlichen«, die in einer solchen Art Kulturdialog stattfindet, könne es freilich nicht darum gehen, einen faulen Kompromiss zwischen den Werten auszuhandeln. »Warum sollte Europa auch nur ein wenig über die Freiheit verhandeln?«, fragt Jullien, und er formuliert ein weiteres Mal den Ausgangspunkt seiner intellektuellen Reise: »Für Europa geht es heute nicht darum, auf die Ansprüche seiner Vernunft, deren Universelles durchaus der Schlussstein ist, der so viele unterschiedliche Bestandteile zusammenhält, zu verzichten, sondern die Vernunft einer neuen Bearbeitung zu unterziehen.« Die einzige Lösung bestehe im Verstehen, in einer Toleranz, die »aus einer geteilten Intelligenz« kommt: »… dass jede Kultur, jede Person sich in der eigenen Sprache die Werte der anderen verständlich macht und sich dann von ihnen ausgehend reflektiert – also auch mit ihnen arbeitet.«
Es gilt also, in Julliens Worten, »die abgeschlossenen Universalitäten« aufzubrechen, um so »den Anspruch der Überschreitung, der dem Universellen eigen ist, zu befreien«. Eine solche Philosophie des kulturellen Abstands, der »Selbstreflexion des Menschlichen«, oder wie man sie nennen will, ist so recht erst durch die Globalisierung sowohl notwendig wie möglich geworden. Jullien selber weist darauf hin, dass die heutigen Philosophen die erste Generation darstellen, die das durch ihre Reisen durch die verschiedenen Intelligibilitäten leisten kann. Es liegt auf der Hand, dass durch eine solche Perspektive allein noch keine Lösungen und Handlungsanweisungen in den komplizierten Konflikten der Gegenwart zu erhoffen sind – das sollte man von der Philosophie vielleicht generell nicht erwarten. Aber sie ist dazu geeignet, den Blick zu öffnen, der durch eine Reihe falscher Gegensätze verstellt und verengt zu werden drohte. Wie notwendig das ist, merkt man, wenn man sich die Konsequenzen des Gegenteils vor Augen führt. Jullien hat gezeigt, dass Kulturen, die keinen Abstand zu sich selbst herstellen können, die sich nicht transformieren und auf diese Weise im Plural existieren, von vornherein tote Kulturen sind. Man könnte also vielleicht mit anderen Worten formulieren: Eine Kultur ist tot, wenn sie zur Abstraktion erstarrt ist. Und das gilt erschreckenderweise, dies ist die spezielle Pointe Julliens, auch für die europäische Kultur, wenn es ihr nicht mehr gelingen würde, ihre Rationalität von außen zu betrachten. In anderen Fällen ist es augenscheinlich, dass eine solche Erstarrung unduldsam und gefährlich werden kann. Insofern liegt es geradezu im Interesse des Friedens, Kulturen wechselseitig lebendig zu halten. »In jeder Diskussion gibt es etwas Undiskutiertes«, sagte Zhuangzi, und François Jullien hat ein Verfahren dafür entwickelt, dieses Undiskutierte zu beachten und fruchtbar zu machen. Kulturen bergen eben viel mehr als das, was sie selbst von sich behaupten, womit sie sich entweder gegeneinander abgrenzen oder gegenseitig neutralisieren. Deshalb ist die Alternative Kampf der Kulturen oder Ende der Geschichte keineswegs das Schicksal, dem wir ausgeliefert sind. Was könnte politischer sein, als inmitten solcher Schein-Dilemmata einen Weg zum Weiterdenken aufzuzeigen? Wir gratulieren François Jullien zum Hannah-ArendtPreis für politisches Denken.
Hinterfragen wir - ausgehend von der Exteriorität des Chinesischen – erneut die europäische Entstehung des Politischen
Was mich so empfänglich macht für die Verleihung des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«, mit dem Sie mich heute ehren und für den ich Ihnen danke, hängt in erster Linie mit folgendem Umstand zusammen. Dieser Preis, der den so hoch angesehenen Namen Hannah Arendts trägt, betrifft wesentlich das politische Denken, doch keine meiner Arbeiten beschäftigt sich hauptsächlich mit dem politischen Denken. Zudem bezieht sich der Hannah-Arendt-Preis auf Europa; wie Sie jedoch wissen, geht meine Arbeit nicht von Europa aus, sondern von China, einem Land, das so lange Zeit keine Beziehung zu Europa hatte. Sie haben jedoch das Wesentliche erfasst, das ich sicherlich in dieser Deutlichkeit nie gesagt habe: Auch wenn ich mich nicht unmittelbar mit dem politischen Denken befasse, so ist das Politische in meiner Arbeit immer mit angesprochen. Selbst wenn ich mich oft auf das chinesische Denken beziehe, nehme ich doch die als selbstverständlich erachteten Fundamente des europäischen Denkens neu in den Blick. In beiden Fällen nutze ich einen Abstand, um unser Denken gerade in den Aspekten infrage zu stellen, die es selbst nicht hinterfragt. Aus meiner Sicht handelt es sich also in beiden Fällen um eine indirekte Strategie, mit der ich versuche, die Ausprägungen innerhalb des europäischen politischen Denkens zu erfassen, die es vielleicht selber nicht aus eigenem Antrieb heraus wahrnähme. Aber zunächst einmal muss dieser doppelte Umweg begründet werden, und zwar zuallererst der Umweg über China. In einem zweiten Schritt werde ich dann zwei Weisen, das Politische zu fassen, einander gegenüberstellen: einerseits die Modellbildung, so wie die Griechen sie für uns herausgebildet haben und andererseits die Regulierung, so wie wir sie in China auffinden. Diese Gegenüberstellung führt uns dazu, den jeweiligen Kern jeder dieser beiden Konzeptionen freizulegen: Einerseits das Denken des Gesetzes und andrerseits das Denken, das wir mit dem Begriff Ritus übersetzen. So können wir besser wahrnehmen, was für uns das Ideal des Gesetzes ausmacht, indem wir es vom normativen Charakter der Riten in China und von ihrer Auswirkung innerhalb der Gesellschaft abgrenzen. Von hier aus und indem wir diese Diskrepanz ins Spiel bringen, können wir uns schlussendlich fragen, was für uns heutzutage von der Beziehung zwischen dem Ideal und dem Politischen übrig bleibt.
I ÜBER EINE PHILOSOPHISCHE STRATEGIE
China als Heterotopie
Wie Sie ja wissen, bildet China eine gegenüber der europäischen Kultur sehr ausgeprägte Exteriorität. Da ist die Exteriorität der Sprache: Das Chinesische gehört nicht zur großen indo-europäischen Sprachengemeinschaft, im Unterschied zum Sanskrit, das mit unseren Sprachen in Europa kommuniziert. Und auch wenn andere Sprachen eine ideographische Schrift hatten, so hat nur das Chinesische diese bewahrt. Auch gibt es eine Exteriorität der Geschichte: Selbst wenn man seit der Römerzeit einen minimalen, indirekten Austausch (über die Seidenstraße) wahrnehmen kann, so treten doch die beiden Pole des großen Kontinents erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in einen tatsächlichen Kontakt, als die Evangelisierungsmissionen sich in China niederlassen. Eine wirkliche Kommunikation ist aber erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, mit dem Opiumkrieg und der erzwungenen Öffnung der chinesischen Häfen. Erst dann unternimmt es das triumphierende Europa, dank der Wissenschaft, China durch Gewalt und nicht mehr durch den Glauben zu kolonisieren. Und obwohl China für Europa die Kultur darstellt, die Europa am äußerlichsten ist, ist China bekanntermaßen doch mit Europa vergleichbar, und zwar einmal durch sein Alter und zum Zweiten durch seine Entwicklung. Deshalb habe ich mich auch persönlich für das chinesische »Feld«, wie die Anthropologen sagen würden, entschieden. Aber da ich eben nicht Anthropologe, sondern Philosoph werden wollte, wollte ich mich mit einem Denken befassen, das genauso reflektiert, in Texten überliefert, kommentiert und erläutert ist wie das unsere in Europa: so wie es eben nur in China präsent ist. Ihnen wird sicherlich aufgefallen sein, dass ich den Begriff Exteriorität und nicht den Begriff Andersheit verwendet habe: Die Exteriorität ist durch die geografische Lage, die Geschichte, die Sprache vorgegeben; sie ist ein Faktum, während die Andersheit, wenn es denn so etwas überhaupt gibt, erst geschaffen werden muss. China ist »woanders«; inwieweit ist es »anders«? Das ist das, was Foucault wortwörtlich am Anfang von Die Ordnung der Dinge (Les mots et les choses) die »Heterotopie« Chinas genannt hat, die von der Utopie zu unterscheiden ist; und erinnern wir uns an das, was auf der nächsten Seite steht: »Die Utopien trösten«, »die Heterotopien beunruhigen« …
Ressourcen der Heterotopie
Mit anderen Worten: Die aufgetretene Schwierigkeit rührt also nicht so sehr von der »Verschiedenheit« (différence) des fernöstlichen Denkens vom europäischen her als vielmehr von der Gleichgültigkeit, mit der sie sich traditionell begegnen. Der erste Arbeitsschritt, der jedes Mal eine Konstruktion erfordert, und der niemals abgeschlossen ist, besteht also zunächst darin, diese Foto: Katrin Kieffer, Bremen François Jullien VI Kommune 1/2011 beiden Denkweisen aus ihrer gegenseitigen Gleichgültigkeit herauszulösen und sie einander gegenüberzustellen, und zwar so, dass sie sich wechselseitig beobachten können. In beiden Fällen ist es dann dieser Rahmenwechsel, der seinerseits zum Denken anregt. Dieser Ansatz führt wiederum dazu, sich zu fragen: Was geschieht mit dem Denken, wenn es aus der großen indo-europäischen Familie herausgelöst wird und man es von vornherein von der sprachlichen Verwandtschaft abtrennt, wenn man sich also nicht mehr auf die Semantik stützen und auch nicht auf die Etymologie zurückgehen kann, und wenn man mit den syntaktischen Regelungen bricht, an die sich unser Denken gewöhnt hat, in die es hineingeflossen ist? Oder was geschieht dem Denken, wenn es aus unserer Geschichte (der der »westlichen« Welt) heraustritt und wir gleichzeitig mit der Geschichte der Philosophie brechen und uns nicht mehr auf die Herkunft der Begriffe oder der Lehren stützen können – auf die sich unser Geist stützt?
Der Vorteil des Umwegs: Die Möglichkeit einer Rückkehr
Der Vorteil, den man durch den Umweg über China erlangt, ist ein doppelter. Er besteht zum einen darin, andere möglichen Arten der Kohärenz, die ich andere Verständlichkeiten nennen möchte, zu entdecken; und dadurch ausloten zu können, wie weit die Deterritorisierung des Denkens gehen kann. Aber dieser Umweg impliziert auch eine Rückkehr: Von diesem äußeren Blickwinkel aus betrachtet gilt es, sich wieder mit den Positionen zu befassen, auf deren Grundlage sich die europäische Vernunft entwickelt hat; das sind implizite, nicht explizite Positionen, mit denen das europäische Denken gleichsam evident verfährt, wenn es sie als Selbstverständlichkeiten transportiert, wenn es sie assimiliert und sich auf dieser Grundlage herausbildet. Somit besteht das Ziel darin, im Ungedachten das Denken zurückzuverfolgen und dabei die europäische Vernunft umgekehrt von diesem externen Blickwinkel aus zu betrachten. Diesen Vorgang nenne ich eine Dekonstruktion von außen. Denn würde man diesen Vorgang von innen heraus (ausgehend von unserer Tradition) durchführen, würde das zu kurz greifen: Wer versucht, Abstand zur (griechischen) Metaphysik zu gewinnen, wird allein aufgrund dieser Tatsache auf die »andere Seite« schwenken und zwar auf die Seite der biblisch-hebräischen Quelle (von Heidegger bis Derrida: die berühmte »ungedachte Schuld«). Den Umweg über China zu gehen, heißt, aus dieser großen Pendelbewegung – zwischen Athen und Jerusalem –, die die Philosophie in Europa getragen hat, herauszutreten und sich anderen Gründungserzählungen zu öffnen.
Abweichungen, nicht Unterschiede
Zweifellos beginnen Sie bereits zu verstehen, warum ich Beziehungen zwischen Kulturen, wie zwischen der chinesischen und der europäischen Kultur, als Abweichungen und nicht als Unterschiede begreife. In der Tat führt die Betrachtung der Vielfalt der Kulturen auf der Grundlage ihrer Unterschiede dazu, ihnen spezifische Eigenschaften zuzusprechen und jede einzelne von ihnen in eine grundsätzliche Einheit einzuschließen, von der man sehr schnell feststellen wird, wie gewagt sie ist, denn man weiß, dass jede Kultur genauso so vielfältig wie einzigartig ist und einem ständigen Wandel unterliegt: Man kann ihr also keine Identität zusprechen, auf die sich die Entstehung der Unterschiede stützen würde. Der Begriff der Abweichung hingegen fördert eine Sichtweise, die nicht mehr identifikatorisch vorgeht, sondern eher auslotend: Im Begriff wird man gewahr, bis zu welchem Punkt sich verschiedene Möglichkeiten entfalten können und welche Abzweigungen im Denken unterscheidbar sind. Anstatt also einordnend zu verfahren, wozu das Differenzprinzip führt, ermöglicht die Kategorie der Abweichung eine andere Perspektive und öffnet einen Raum für Reflexivität. Anstatt also eine überragende Stellung vorauszusetzen, in der es sich zwischen dem »Selben« und dem »Anderen« bewegt, wie das bei der Kategorie des Unterschieds der Fall ist, setzt die Abweichung, das, was sie getrennt hat, unter Spannung und entdeckt das eine durch das andere, spiegelt es im jeweils anderen wider. Damit wird auch der Blickwinkel vorteilhaft verschoben: Nicht nur von jenem der Unterscheidung, der dem Begriff der Differenz eigen ist, zu dem des Abstands und folglich in Richtung des offenen Feldes des Denkens, sondern auch konsequenterweise von der Frage der Identität hin zu einer Hoffnung auf eine Fruchtbarkeit. Die Kategorie der Abweichung ermöglicht auch die Vielfalt der Kulturen oder der Denkweisen als jeweilig verfügbare Ressourcen zu begreifen, die jedes Verstehen nutzen kann, um sich zu erweitern und wieder in Unruhe zu geraten.
II MODELLBILDUNG ODER REGULIERUNG
Lassen wir also Abweichungen zwischen dem chinesischen und dem europäischen Denken vom Standpunkt des Politischen aus wirken. Ich möchte zunächst kurz auf einige Eigenarten der griechischen politischen Ordnung eingehen, die wir uns vielleicht so gut angeeignet haben, dass wir sie gar nicht mehr ausmachen, nicht mehr hinterfragen können. Vertrautheit ist ja nicht mit Kenntnis gleichzusetzen; genauso wenig bedeutet, etwas von außen in den Blick zu nehmen, es aus der Ferne zu betrachten. »Das Bekannte ist dadurch, weil es bekannt ist, nicht erkannt« (Hegel). Zumindest sollten wir Plato das Verdienst der Radikalität zusprechen. Indem er abstrakt, also Prinzipien folgend, die selber wiederum der Ausdruck von Wesenheiten sind (wie die Gerechtigkeit an sich oder das Gute an sich), festgelegt hat, wie das Gemeinwesen idealerweise beschaffen sein sollte, hat er eine Vorstellung entworfen, wie wir in Gesellschaft leben sollten. Das Denken des Politischen leitet sich gänzlich von einer abenteuerlichen, sehr riskanten Deduktion ab, die ihren Ausgangspunkt im Begriff der Wahrheit hat. Dass das Politische somit in Begriffen wie »Ideen« oder »Idealformen«, als eide oder als »Typen«, gedacht ist, die zunächst »wie im Traum« (politeia, 443c) erscheinen, wird unmittelbar in diesen Formen des Politischen veranschaulicht, die die verschiedenen politischen Regime darstellen: in diesen Verfassungstypen, die die Griechen in der Regel parallel betrachtet haben, und deren jeweilige Verdienste sie vergleichen. Vom Einzigartigen zur Pluralität übergehend, begründet sich die Idee oder die Form der Vernunft in einem System von Fällen. Dabei setzt die Ausarbeitung der »idealen Verfassung«, der nomothesia arista (Aristokratie), die Untersuchung dieser verschiedenen Möglichkeiten voraus, die sich zu einem Spektrum entfalten: Monarchie – Oligarchie (Aristokratie) – Demokratie – Tyrannei. Dieses System von »Fällen« bleibt jedoch abstrakten Kriterien verhaftet: Nicht nur dass die Macht von einer oder mehreren Personen oder von der größtmöglichen Anzahl ausgeübt werden soll, mehr noch, sie wird auch gemäß folgenden Parametern ausgeübt: Zwang oder Freiheit, Armut oder Reichtum, Legalität oder Illegalität. Zudem ist diese Typologie der Regierungen als solche vollständig und bildet ein System: Es kann keine andere Form –idea – des Regierens geben und jede entspricht einem spezifischen Verhaltenstyp. So einander gegenübergestellt bleiben diese unterschiedlichen Formen der Macht eng an ihre prinzipielle Ausprägung gebunden und lassen uns von einem Extrem zum anderen durch ihre große Ausfächerung und kategorisch »die Auswirkungen der reinen Gerechtigkeit und der reinen Ungerechtigkeit« sehen. Auch wenn sie der Geschichte entlehnt sind, sind diese Formen des Politischen weiterhin entsprechend einer Modellbildung verfasst. So bleibt das politische Wirken letztendlich immer eine Sache von »Wissenschaft«, und dieses alleinige Kriterium, die theoretische Kompetenz dessen, der das Gemeinwesen leitet, behält am Ende die Oberhand gegenüber den anderen.
Doch ist es nicht mehr noch als die Demokratie (oder ihr vorausgehend) diese Theoretisierung des Politischen, die wir von den Griechen übernommen haben, die das »Abendland« ausmacht? War Plato nicht gewissermaßen selber der Erbe dieser Theorie, die er radikalisiert? Wenn man die Geburt des griechischen Gemeinwesens betrachtet, so muss man feststellen, dass es durch den eingeführten Bruch, der zur Modellisierung führte, begünstigt wurde. Als Ende des 6. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung in Athen Kleisthenes nach einem ausgefeilten Plan beginnt, das ganze Gebiet Attikas in Grundeinheiten aufzuteilen, die wiederum in spezifische geografische Gebilde zusammengefasst werden, bilden die zehn Stämme, die aus dieser Vermischung neu hervorgehen, fortan ein einheitliches Konstrukt, das die unterschiedlichen Strukturen der Orte, der Arbeitsverfassungen und der Lebensweisen überschreitet. Diese Stämme leiten nacheinander die Verwaltung des Gemeinwesens; so wird systematisch sowohl der gesellschaftliche als auch der räumliche Kontext zerstört, der den alten aristokratischen Familien ihre Macht und ihre Rangordnung verliehen hatte. Wenn es jedoch der Revolution des Kleisthenes gelingt, eine neue egalitäre, »isonomische« Mitwirkung des Volkes an den Institutionen einzuführen und dadurch den Bruch mit der gentilizistischen Religion zu vollziehen, so verdankt sie es doch in erster Linie den neu gefundenen Modellen. So hat man einerseits eine Kontinuität gestiftet zwischen der geometrischen Weltanschauung des Anaximander, der zum ersten Mal eine geografische Darstellung der Erde in Gestalt eines für den Geist befriedigenden Stützpunktsystems vornahm; auf der anderen Seite stand die Konzeption eines einheitlichen und rationalen Gemeinwesens mit einem qualitativ einheitlichen Raum, die Kleisthenes auf den Weg gebracht hat.
Auch der Vergleich politischer Regime, der darauf abzielt herauszufinden, welches das Beste ist, ist ein Thema, das der Philosophie vorausgegangen ist. Herodot (III, 80-82) berichtet, dass während einer Ratssitzung bei den Persern folgende drei Regime Gegenstand von Streitgesprächen sind. Der eine kritisiert die Monarchie, weil sie Hochmut und Neid begünstigt und uns zwangsläufig vor das Dilemma stellt, entweder den Fürsten hofieren zu müssen oder ihm nicht genügend zu schmeicheln. Diesem Regime müsse man die Regierung durch das Volk vorziehen, die »Isonomie«, in dem Ämter per Los vergeben werden, ein Regime, in dem man sich in Bezug auf die Macht, die ausgeübt wird, rechtfertigen muss, in dem alle Aussprachen öffentlich ausgetragen werden. Demgegenüber beruht das Lob der Oligarchie auf der Tatsache, dass allein sie in der Lage ist, sich sowohl der Respektlosigkeit der Menge als auch der Tyrannei des Fürsten zu erwehren. Wenn aber diese drei Regimes hypothetisch, also im Gespräch, als gut genug in Betracht gezogen werden, widerspricht der Dritte, so muss man die Monarchie sowohl dem einen wie auch dem anderen Regime vorziehen. Laufen diese Regime nicht ohnehin auf eine natürliche Art und Weise bei ihr zusammen, da die Oligarchie Rivalitäten und folglich »persönliche Feindschaften« und die Demokratie die Boshaftigkeit und folglich »gewalttätige Freundschaften« fördert … Schöner Parallelismus! Bevor sie überhaupt im Abendland als Grundlage der politischen Philosophie fungiert, findet schon eine systematische Modellierung der Regierungsformen statt, die zu kontroversen Diskussionen und somit zu einer wesentlichen Tatsache führt, die trotz ihrer abendländischen Banalisierung keineswegs selbstverständlich ist. Zumindest prinzipiell wird die politische Ordnung als Gegenstand einer Aussprache gefasst; in der Folge wird sie zur Angelegenheit einer konzertierten Entscheidung. Dieses Tableau der politischen Formen ist so erfolgreich übernommen worden, dass wir uns schon gar nicht mehr darüber wundern, dass wir unsere Lebensweisen innerhalb der Gesellschaft von einer abstrakten Aussprache über die besten »Zwecke« ableiten (siehe Aristoteles, Politik, III, 6). Folglich begreifen wir die Gestaltung der Macht nach Maßgabe modellhafter Formen; dies führt dazu, dass wir ihre Verfassungen (politeiai) unterscheiden und sie sogar einander gegenüberstellen. Nicht zuletzt begreifen wir das Politische als einen Ort, an dem der Widerspruch legitim und die Auseinandersetzung notwendig ist, wobei beide eine Wahl bieten und die Bedingungen der Möglichkeit von Freiheit schaffen. Jedoch wird der Sinologe auf diese grundsätzliche, zumindest direkt wenig gestellte Frage zu antworten haben. Er muss dieses griechische Erbe neu betrachten, indem er dessen implizite Voraussetzungen auslotet: Warum hat China nur ein einziges politisches Regime gekannt und entwickelt, das des »Königswegs«, wangdao, die Monarchie? Mehr noch: Indem China nur eine einzige mögliche Form des Politischen herausgebildet hat, hat es diese folglich nicht als unterscheidbare und vergleichbare »Formen« oder als eide bestimmt: Es hat sich niemals die Frage nach dem besten aller Regime gestellt und unterscheidet nur zwischen »Ordnung« und »Unordnung«, zhi-luan, dem guten und dem schlechten Fürsten. Ist es nicht bemerkenswert, dass das kaiserliche Amt selber während des gesamten Reiches nie Gegenstand irgendeiner institutionellen Untersuchung war, ganz abgesehen davon, dass nie zwischen seinen verschiedenen Seiten unterschieden wurde? China hat jedoch gleichzeitig unentwegt über die Macht, ihre Effizienz und den Umgang mit ihr nachgedacht und hat sie auch schon sehr früh von der religiösen Sphäre getrennt: China ist kein Gottesstaat. Das bringt mich dazu, präziser zu fragen: Was verhindert in China die Modellisierung des Politischen, und welche andere Logik hat man ihr in Bezug auf die Regulierung der gesellschaftlichen Beziehungen vorgezogen? Auch wenn China heutzutage eine Verfassung angenommen hat und sogar begonnen hat, Institutionen zu bilden, wobei dies unter westlichem Einfluss und Druck geschah, bleibt diese Frage bestehen – trotz der uniformen Oberfläche.
In China galt zu allen Zeiten das Sprichwort: »Im Himmel gibt es keine zwei Sonnen, auf Erden gibt es keine zwei Fürsten: Oben kann es auch keine zwei Wesen geben, denen auf die gleiche Weise gehuldigt wird« (liji, fang ji). Dass China nicht aus diesem einheitlichen und hierarchischen System herausgetreten ist, kann nur verstehen, wer sich das Übergewicht der familiären Strukturen vergegenwärtigt. Anstatt dass die Entwicklung der archaischen Gesellschaft wie in Griechenland zur Entstehung von neuen, spezifischen Strukturen führt, die sich von der Privatsphäre und den verwandtschaftlichen Beziehungen lösen, ist es in China die Vaterfunktion, die sich so ausgedehnt hat, dass sie mit ihrer Autorität die gesamte Gemeinschaft überzogen hat. Auch die eigentlich politischeren Strukturen, die mit der Gründung der monarchischen Ordnung einhergehen und Verwaltungs- und Regierungsaufgaben wahrnehmen, lösen sich trotzdem nicht von den gentilizistischen Beziehungen; die Machtbeziehungen sind vielmehr auf diesen verwandtschaftlichen Beziehungen aufgebaut. Dass der Fürst in China Vater des Volkes genannt wird, ist seither viel mehr als nur eine Metapher oder die Erinnerung an eine verblassende Tradition, denn durch den Schwund von Verzweigungen innerhalb der alten Strukturen wird, wie es Léon Vandermeersch beschrieben hat, ein einziges Individuum als Vater der Ethnie eingesetzt, als Erbe der Macht des Gründungsvaters, und zwar zuallererst auf der kulturellen Ebene. Aus diesem Umstand, dass alle Beziehungen auf ihn zentriert sind, kommen vorrangig die Betrachtungen über Rang und Hierarchie. Während in Griechenland die politische Institution nur dadurch ihre Macht behaupten konnte, dass sie sich von der Familienbeziehung löste, ist es im Gegenteil der nahtlose Übergang von der Familie zum Politischen, der dazu führt, dass man das Politische in China als Verlängerung der Strukturen betrachtet, die für naturgegeben gehalten werden. China musste also nicht spezifische Vorbilder hervorbringen, wie das geometrische Modell, das Kleisthenes eingerichtet hat; China musste überhaupt keine Modelle entwickeln, um das Politische herauszubilden. Aber warum hat China keinen Regierungsapparat (politeuma) im eigentlichen Sinne des Wortes herausgebildet, obwohl sich in China der Machtapparat mit der Entwicklung des Reiches früh ausgebildet hat und verbessert wurde? Kurz, ich denke, das kommt daher, dass die Chinesen sich auf eine andere Ressource verlassen haben als auf das Prinzip der Modellierung, und zwar auf das, was ich demgegenüber als Regulierung benannt habe. Da man dort annimmt, dass die gesellschaftlichen Beziehungen sich aus den natürlichen Beziehungen zwischen Menschen, das heißt, den Familienbeziehungen ableiten, müssen diese selber, um die gute Ordnung zwischen den Menschen zu gewährleisten, nur so gut wie möglich die spontane Veranlagung nachahmen, die in diesen Grundbeziehungen vorausgesetzt wird: Sie bieten einerseits Schutz, andererseits fordern sie Unterwerfung, wobei beide mit der emotionalen Neigung zusammenhängen, die »Wohlwollen« oder »Respekt« hervorbringt. Wenn diese Polarität zwischen oben und unten ohne Abweichung voll funktioniert, wird das harmonische »Gleichgewicht« gewahrt (dafür steht der Begriff zhong). Überflüssig und sogar gefährlich wäre die zwingende Wirkung eines (künstlich aufgesetzten) Regierungsapparats. Oder das Zwangssystem ist so beschaffen, dass die Unterwerfung sich von selber davon ableiten lässt, wobei sich die reziproke Konstellation zwischen Regierenden und Regierten in diesem Fall in ein eindeutiges Dispositiv des Gehorsams verwandeln würde (die Vertreter dieser Position werden bei den Autoritaristen fälschlicherweise »Legisten« genannt): Unterdrückt Ihr das Volk irregulär und ungleich, so wird es aufbegehren; wenn es aber ständig und extrem unterdrückt wird, betrachtet es diese Unterdrückung als natürlich, wie es der Tod in der Natur ist. Gegenüber dem Ideal der Freiheit, das die Formen des Politischen in Griechenland begünstigen, steht somit in China die Fähigkeit, sponte sua politische Beziehungen zu stiften, die den verwandtschaftlichen Beziehungen nachempfunden sind (auf der konfuzianischen Seite), oder sie gründen sich auf alleinige Beweggründe, die genauso verankert sind, die der Angst und des Nutzens (auf der Seite der Legisten). In beiden Fällen herrscht der Fürst umso uneingeschränkter, je mehr er diese natürlichen Regulierungen walten lässt und nicht mehr eingreifen und sich einmischen muss. Wenn man jedoch die Freiheit gestalten kann und wenn sie zu ihrer Einrichtung Institutionen erfordert, die man immer wieder verbessert, dann ist das Spontane im Sinne des sponte sua, das ihr gegenübersteht, etwas, das sich grundsätzlich einer Modellisierung entzieht. Erinnern wir uns doch an diese lapidare Antwort des Konfuzius, als man ihn über die Kunst des Regierens befragte: »… der Fürst muss Fürst sein, der Vasall muss ein Vasall sein, der Vater muss ein Vater sein, der Sohn ein Sohn« (Gespräche, XII, 11). Diese Formel reicht als politische Vorschrift aus, beziehungsweise diese Tautologie besagt alles: Nicht nur dass die politischen Beziehungen auf die Familienbeziehungen ausgelegt sind, sondern die Ausübung der Macht darf nicht über die gegenseitigen und hierarchischen Beziehungen hinausgehen, zu denen die Mitglieder der Familie natürlich neigen.
III DAS GESETZ – DER RITUS
Diese beiden Logiken, die man als konträre nachvollziehen muss, und zwar einerseits als Modellbildung und andrerseits als Regulierung, finden ihren symmetrischen Ausdruck in zwei Arten der gesellschaftlichen Strukturierung: Die Gesetze bei den Griechen (nomoi) und das, was wir als »Riten« (li) bei den Chinesen übersetzen. Die Tatsache, dass unser Begriff Ritus so wenig geeignet ist, den chinesischen Begriff zu übertragen, wir aber in den europäischen Sprachen über keinen anderen Begriff verfügen, um dessen Tragweite auszudrücken, und dass wir daher seit Jahrhunderten, also seit der Zeit, als die ersten Missionare nach China gegangen sind, diese zweifelhafte Entsprechung verwenden, sollte uns schon zu denken geben. Diese chinesische Vorstellung will sich einfach nicht in die Kategorisierungen und Abtrennungen einfügen, aus denen das Ideal und die Freiheit hervorgehen, und aus denen sich die europäische Kultur herausgebildet hat.
Montesquieu hatte im Geist der Gesetze (L’Esprit des Lois, XIX, 16) bereits angenommen, dass diese Konstellation am eindeutigsten mit dem bricht, was »Europa« darstellt: »Die Gesetzgeber in China gingen noch weiter: Sie warfen Religion, Gesetze, Sitten und Gebräuche zusammen; das alles zusammen ergab das Sittengesetz, die Tugend. Die Vorschriften über diese vier Pfeiler bildeten die sogenannten Riten.« »Verworrenheit«, sagt man dazu in Europa. Aber warum sind diese Begriffe getrennt worden, würde man von China aus entgegnen, und zwar insbesondere das Absolute des Religiösen vom Empirischen und Vertrauten der Sitten oder Gebräuche? Warum gehen diese nicht in die Verlängerung kultureller Praktiken ein? Warum kann der Respekt, der sich im menschlichen Umgang zeigt, sich nicht zu einer Huldigung der Weltordnung vertiefen? Warum hat man denn einen Bruch eingeführt, wenn nicht aufgrund einer abendländischen Schizophrenie, die das Ideale vom Alltäglichen trennt und innerhalb dessen noch einmal trennt und das dann im Verhalten als ein Ganzes wahrnimmt, das von der Einhaltung der Vorschriften im Tempel der Ahnen bis zur Höflichkeit in der Gesellschaft reicht? Die »gewissenhafte Aufmerksamkeit« (jing), die man in jeder Lebenslage einhalten soll, ist von derselben Art. Oder was sagt der Begriff der Konfusion hier ex negativo über eine Nicht-Aufspaltung des Verhaltens aus, die die Religion mit den »Manieren« verbindet, und deren Schwerpunkt sich eher dem aus der Mode gekommenen Begriff des »Anstands« annähert? Noch einmal sei Montesquieu zitiert: »So gaben sie (die Chinesen) den Anstandsregeln den weitesten Spielraum.« Jedoch: »Die Höflichkeit schmeichelt den Lastern der anderen, der Anstand aber hindert uns, unsere eigenen Fehler an den Tag zu bringen« (ibid.): In diesem Letzten liegt also tatsächlich der Ursprung der Moralität. China ist also dieser zivilisatorische Zusammenhang, der am besten von außen verdeutlichen kann, was der Begriff Gesetz in seinem Verhältnis zum Idealen, wie es Europa entwickelt hat, an Seltsamem und Erfinderischem enthält. China lässt umso deutlicher dieses griechische Dreieck hervortreten, das Plato als Erster definiert hat, indem er diese drei Aspekte miteinander verband: Die Formen des Politischen, die von den Verfassungen, der Gerechtigkeit und den Gesetzen dargestellt werden. Oder vielmehr, es sind die Gesetze, die zwischen den Formen der Macht und der Form der Gerechtigkeit an sich vermitteln müssen. Denn einerseits gibt es so viele Formen, eide, die den Gesetzen eigen sind wie es Formen politischer Regimes gibt (eide tôn politeiôn): Die Gesetze verschmelzen mit den unterschiedlichen Verfassungen und sie sind ihr Ausdruck (Vom Geist der Gesetze, 714 b). Wenn andererseits unsere Diskussion über die Gesetze »von höchster Wichtigkeit« ist, dann liegt es daran, weil sie uns veranlasst zu suchen, von welcher Seite aus sie »die Gerechtigkeit und die Ungerechtigkeit betrachten müssen«; diese sind mehr als ein Kriterium, sie errichten daraus das Ideal. Während die Gesetze die Formen sind, gemäß derer das Notwendige gedacht wird, sind Riten Formen, durch die man eine Anpassung an eine Situation erforscht. Jene »wendet man« durch eine abgestimmte Entscheidung im Rahmen einer vorgegebenen Zugehörigkeit zur Bürgerschaft an, während diese die Sitten nach und nach, und ohne dass man darüber nachdenkt, »durchtränken«. Auch und im Gegensatz zu dem Gesetz, das ausgesprochen und erlassen wird, über das man diskutiert, dem man folgt oder nicht, und das folglich ein Seinsollen auf Distanz (das kritisiert werden kann) begründet, beziehen Riten, weil sie allmählich und unbemerkt verinnerlicht werden, ihren Wert daraus, dass sie, indem sie über eine fortschreitende Annäherung gehen, auch ohne dass man diese bemerkt, geringstmöglichen Bruch oder Hinterfragung erzeugen. Die Gesetze beziehen sich auf Handlungen (durch die man sich verpflichtet, und die man für freiwillig ausgibt), die Riten beziehen sich auf Verhaltenweisen, an die man sich anpassen muss. Während das Gesetz befiehlt, indem es sich auf ein Seinsollen beruft, prädisponiert der Ritus gewissermaßen gemäß der normierten Form und nicht durch Gehorsam ihm gegenüber, sondern nach Maßgabe seiner Anpassungsfähigkeit. Das richtige Maß jeder Gebärde, der kleinsten Bewegung, der geringsten Haltung, wie auch aller Faktoren, die eine Polarität darstellen, sind yin und yang, die die Welt bilden: In der Tat verbindet der Sinn der Riten beide nicht nur analogisierend, sondern er führt dazu, dass man jede Wirklichkeit als einen laufenden Prozess ansieht, ob dieser sich im Himmel vollzieht oder im Verhalten (tian-xing/ ren-xing); die einzige Forderung besteht darin, dass er nicht abweicht. Die Riten sind die Normen für dieses Nichtabweichen. Sie sind es eher als die »Regeln«, auch wenn deren Aufstellung sehr genau, ja sehr minutiös sein kann, um diese Vielfalt abzudecken (qu li). Es handelt sich hier, um es noch einmal zu sagen, um dieselbe und konstante Regulierung der Gegensätze, verstanden als Fähigkeit, durch die Verwandlung hindurch das Gleichgewicht zu bewahren, wie auch immer die jeweilige Situation beschaffen ist.
Frage: Ist das (europäische) politische Ideal eine ausgeschöpfte Ressource?
Man kommt nicht umhin, sich diese Frage in einer Zeit zu stellen, in der die politische Einigung Europas sich so schwer tut, was man an der unmöglich gewordenen Präambel seiner begrabenen Verfassung sehen kann. Was hat denn maßgeblich zu der geistigen, aber auch kulturellen Dynamik Europas beigetragen, wenn nicht schlussendlich das, was man bei Plato als ideale Begrifflichkeit vorfindet, in deren Schatten sich unser Denken, aber auch unser Leben, unsere Hoffnung, unsere Kämpfe, unsere Arbeit seither vollzogen haben? »Wir«, das ist eben dieses europäische »Wir«, das jetzt, wo es plötzlich näher rückt, sich in ihm mustert und wiedererkennt. Das sind das Wahre, das Gerechte, das Schöne, aufgestellt wie bei einer Parade. Welche zivilisatorische, kanalisierende Wirkung haben denn diese Ideale erzeugt, die von Plato aufgestellt worden sind, und zwar nicht in Gestalt von versteinerten Hypostasen, sondern aus der Erregung ihrer Entdeckung sowie ihrer Erfindung heraus? Man merkt, dass Plato von dieser Möglichkeit, die er eröffnet, selbst fasziniert ist. Diese Ideale haben jeweils das Streben der Wissenschaft, der Politik oder der Kunst beflügelt. Sie haben auch nur in diesem Abhängigkeitsverhältnis ihre Legitimität gefunden. In Europa haben sich diese Ideale in verschiedene Bereiche getrennt; gleichzeitig haben sie sich gemäß diesem einzigen Einheitskonzept definiert, das für jeden Bereich dessen Ziel formuliert und dieses zum Schicksal hypostasiert. Auf Grundlage dieser Ideale ist »Europa« seither entstanden, wobei »Schicksal« hier eine eigenartige Entfaltung in der Geschichte meint, die in dem Moment, in dem sie zusammenfassend erkennbar wird, schließlich das Ausmaß ihres Fremdseins erfasst. Dass das Denken in Idealen gerade dazu geführt hat, das Politische als eigenständiges und unabhängiges System zu isolieren, indem es dieses von den natürlichen Regulierungen und Abläufen getrennt hat, kommt daher, dass es angefangen hat, das Gerechte als Wesenheit zu begreifen, um das gemeinschaftliche Zusammenleben auf der ausschließlichen Grundlage dieses Verständnisses zu denken. Wie viel Wagemut bedarf es, räumt Plato ein, um eine so radikale Trennung von der bestehenden (natürlichen) Ordnung zu vollziehen … anstatt von dieser auszugehen, sie zu verbessern oder zu versuchen, die Unordnung zu »reparieren«, indem die Regulierung verstärkt wird, wie man es immer in China gemacht hat, ohne die Herrschaft des Fürsten von der dem Himmel und der Natur eigenen »Harmonie« zu trennen. Aber aufgrund der Tatsache, dass er sich nicht auf diese andere Welt stützen konnte, um die diesseitige zu kritisieren und neu zu gestalten, ist der chinesische Gelehrte immer im Schatten des Fürsten geblieben, ohne mit ihm in Streit zu geraten; er ist nie ein »Intellektueller« geworden. Gegenüber der Macht ist er immer schutzlos geblieben und konnte nur sein »Klagelied« oder seinen »Protest« gegen die Verderbtheit und das Elend seiner Zeit erheben. Er hat keine andere Ordnungsvorstellung dagegenstellen können, die tatsächlich einen Bruch in der Geschichte hätte bewirken können und deren Perfektion er anschließend nur noch konsequent innerhalb der Gesellschaft hätte nachahmen müssen. Dass man Plato aufgrund der von ihm vertretenen Gedanken als reaktionär ansieht, ändert nichts an der Tatsache, dass er derjenige war, der durch seine Vorgehensweise die theoretische Möglichkeit von Revolution überhaupt freigesetzt hat. Revolution meint hier nicht nur den Sturz der etablierten Macht und ihre Ablösung durch eine bessere Macht, wie man es immer wieder vielerorts und zu jeder Zeit in der Welt unter dem Gewicht des Unerträglichen unternommen hat, sondern sie meint tatsächlich die Einführung und Vervielfältigung einer Form (des Seinsollens) in die Geschichte, die man a priori festgelegt hat. Es vollzieht sich jedoch heutzutage von verschiedenen Seiten her eine lautlose Veränderung, die das an uns weitergegebene große zivilisatorische Gefüge untergräbt. Rührt die Krise Europas, die in erster Linie ideologischer Art ist, nicht daher, dass sich Europa mehr oder weniger unbemerkt von diesen »eindeutigen Modellen« gelöst hat, mit denen es gearbeitet hat und die es so lange getragen haben? Ist es nicht das, dessen Europa müde, oder, um es etwas klinischer zu sagen, überdrüssig ist? Der Überdruss (an einer Zivilisation) rührt für Europa daher, dass die Spannung des Ideals nachgelassen hat; man könnte auch sagen, sie rührt daher, dass Europa ihm misstraut, ohne zu wissen wie es das Ideal ersetzen soll oder will: Es bringt diese Spannung nicht mehr auf. Ist es denn, insbesondere in der Politik, noch die Gerechtigkeit, die, ungeachtet ihres Weiterbestehens in konventionellen Diskursen, die Vorstellungen von der Zukunft leitet? Ist es nicht vielmehr, und zwar ohne dass man es sich eingesteht, ohne dass man es analysiert, das Streben nach umfassender Regulierung, das sich darauf beschränkt, Konsens zu erzeugen? Gibt es für uns Europäer überhaupt noch eine Vorstellung von der Zukunft, wenn jede Aussicht auf Erlösung oder auf Revolution schwindet? Das Wahre selbst herrscht nicht mehr unangefochten, auch nicht in seinem ureigensten Reich, der Wissenschaft, bei der man schonungslos die Schattenseite ihres Mythos aufdeckt hat, dass sie viel magischer, umständlicher und mühseliger vorgegangen ist. Sicher nimmt die Modellisierung (samt ihrer Mathematisierung) heutzutage eine dominierende, um nicht zu sagen eine hypertrophische Stellung ein, aber diese beschränkt sich auf das reine, funktionelle und gebietsweise Verwalten. Dieser Gedanke eines Modells trägt global nicht mehr, er ist nicht mehr imstande, einen Plan für die Menschheit zu entwerfen. Unsicher über sich selbst geworden von dem Moment an, in dem es nicht mehr an diese Ideale angebunden ist, die es getragen haben, blickt Europa in jüngster Zeit verstärkt auf Denkweisen, die von woanders herkommen. Das Phänomen gehört zu dieser Generation; es wirkt durch unauffällige Risse, die jeden Tag tiefer werden, und die nach und nach das Ideal zerfasern. Da dieser Wandel sich nicht durch Diskurse, Konstruktion und Überzeugung vollzieht, wie innerhalb des Logos zu erwarten wäre, tun wir uns schwer, diesen diffusen und allgegenwärtigen Einfluss zu erfassen, der alles durchdringt und sich unauffällig verzweigt. Erst jetzt beginnen wir, dessen Ergebnis zu bemerken. Denn da Europa nicht mehr das Gewicht dieses Strebens nach Idealen auf sich nimmt, das es in Gang gehalten hat – oder dass es dieses Streben als illusionär verdächtigt und als zu kostspielig betrachtet, weil es dazu zwingt, zu abstrahieren und die Erfahrung zu opfern –, hofft Europa, seine Versöhnung in dem zu finden, was es gerne als seine Kehrseite betrachtet: ein kompensierender »Orient«, der diese aufwendigen Dualismen auflösen würde. Dem großen Theater einer Offenbarungsrevolution stellt sich so eine Regulierung entgegen, die eine kontinuierliche Entfaltung fördert, ohne das Vertrauen aufzubrauchen. Was man heutzutage unter der Überschrift »persönliche Entfaltung« verkauft und was die Buchhandlungen füllt, wobei Philosophie auf gefällige Portionen reduziert ist, speist sich aus einem solchen Rückfluss; es fördert stillschweigend seine Vermarktung. Es ist nicht Gegenstand einer abgestimmten Entscheidung, sondern ordnet sich unauffällig diesem Richtungswechsel zu: »zen leben«, als Marketing-Formel, das ist eben das Gegenteil des Ideals. Es handelt sich hier jedoch um viel mehr als nur um einen Wandel oder um eine Umkehrung der Werte: Indem es sich vom Ideal löst, wendet sich Europa von dem ab, worauf sich seine Entwicklung gestützt hat oder zumindest wendet es sich von dem ab, was ihm Vertrauen in dieses Ideal gegeben hat. Es wendet sich von dem ab, an was es geglaubt hat. Gegenüber dem, was sich zu unauffällig in der europäischen Ideologie auflöst, um analysiert zu werden, sollte man jetzt gleichzeitig zwei Dinge tun: Man sollte den Begriff des Ideals aus der Standardisierung lösen, die es weltweit durch die geistige Vorherrschaft des Abendlandes erhalten hat, die jedoch gleichzeitig zu seinem Schwinden beiträgt, um erneut das erscheinen zu lassen, was es eigentlich bedeutet, und um zu begreifen, unter welchen besonderen Umständen es aus dem Denken entstehen musste. Gleichzeitig sollte man die Bilanz daraus ziehen, was durch diese Erfindung des Ideals ermöglicht worden ist, und was darin fruchtbar ist. Denn es geht nicht mehr darum, kulturelle Identitäten zu schaffen, die nunmehr aufgrund des weltweiten Austausches und der Kommunikation künstlich geworden sind, sondern es geht darum, Ressourcen ausfindig zu machen. Wir können nicht mehr die Konstruktion der Idealität als Notwendigkeit eines Denkens erfassen, das die unweigerliche Zukunft der ganzen Menschheit aufspürt. Europa muss sich fortan als besonderen, der Konkurrenz ausgesetzten »Fundus« betrachten. Damit ist überhaupt nicht gesagt, dass das (politische) Ideal ausgeschöpft wäre, dass es seinen Erfindungsreichtum eingebüßt hätte.
China und Europa – das politische Denken Europas von China aus neu denken, durch einen »Ortswechsel des Denkens« ins Fremde die Fundamente des europäischen politischen Ideals freilegen, die sonst dem eigenen Denken verborgen bleiben. Zu dieser Denkbewegung lädt uns der französische Philosoph und Sinologe François Jullien ein. Europa sieht sich heute durch China vielfältig herausgefordert – als politisch schwergewichtiger Systemgegner und wirtschaftlicher Konkurrent, aber auch als attraktiver Wachstumsmarkt und Produktionsstandort. Die Bilder, in denen wir diese Gegenüberstellung wahrnehmen, rahmen und einordnen, sind meist geprägt von europäischen Interessen – und wie sollten sie auch nicht? François Jullien stößt durch diese von der Tagesaktualität bestimmten Wahrnehmungen vor zu grundlegenderen Fragen. So grundlegend, dass er am Ende auch die Frage stellt, ob das europäische politische Ideal eine ausgeschöpfte Ressource ist. Das kommt darauf an, würde ich meinen, wie wir dieses Ideal konstruieren und gegenüber dem ihm Fremden konturieren: ob als ideale Gerechtigkeit der Intellektuellen, der Elite oder einer Avantgarde, wie man das politische Ideal im Anschluss an Plato rekonstruieren könnte, oder als politische Bürgergesellschaft, die ich in der Tradition von Aristoteles und Hannah Arendt als Hort von Mitte und Maß, von Kontroverse und Konsens, der Idealwelt der intellektuellen und politischen Avantgarden gegenüberstellen würde. »Der Sinn von Politik ist Freiheit.« Hannah Arendts Diktum, an das der heute zu vergebende Preis erinnern soll, ist Ausdruck eines riskanten und radikalen politischen Denkens. Wenn wir im herkömmlichen Sinn von Politik sprechen, dann meinen wir damit den Erwerb und Erhalt von Macht, die Herstellung bindender Entscheidungen und ihre Durchsetzung als Gesetz. Vielleicht denken wir auch an das Streben nach Ruhm und Ehre. Und vielleicht auch an Selbstbestimmung. Aber wir denken nicht in erster Linie an Freiheit. Hannah Arendts politisches Denken nimmt seinen Ausgang beim Unerhörten der Schrecken des 20. Jahrhunderts, beim Zeitalter der Extreme, es durchdringt den Totalitarismus und die innige Beziehung von Macht und Gewalt aus der Perspektive von Politik als Polis. Die Polis stellt als Vergemeinschaftung vieler selbst einen Zweck in sich dar. In ihr steigern die Einzelnen ihre Entfaltungsmöglichkeiten und erkennen in ihrem politischen Handeln einen neuen Sinn ihres individuellen Lebens. Diese Gemeinschaft unterscheidet sich von natürlichen Gemeinschaften wie Familie oder Stamm grundlegend. In ihr können sich auch einander fremde Individuen zusammenschließen. Dazu müssen sie zu außerordentlichen Anstrengungen bereit sein. Sie müssen, weil sie einander fremd sind, zueinander in ein Verhältnis der Wechselseitigkeit, der wechselseitigen Anerkennung treten. Das ist nur im Medium der Freiheit möglich, nicht durch Befehl und Gehorsam, nicht von natürlicher Abhängigkeit. Das ist nur möglich in der wechselseitigen Anerkennung als Gleiche. Hannah Arendts Republikanismus mutet uns antik an. Die politische Vergemeinschaftung, die sie denkt und von der aus sie denkt, scheint nicht recht vereinbar zu sein mit unserem modernen Verständnis von staatlicher Vergemeinschaftung und der Freiheit, die erst durch Begrenzung der staatlichen Gewalt – etwa durch eine Verfassung – gesichert werden muss. Neben dieser negativen Freiheit, an die wir immer zuerst denken, gibt es aber auch die positive Freiheit: seine Meinung frei zu äußern, seinen Glauben zu bekennen, den eigensinnigen Logiken von Kunst und Wissenschaft öffentlich nachzugehen, sich mit anderen zu assoziieren und zu versammeln. Hier kommen Freiheitsrechte zur Sprache, die nur in Gesellschaft mit anderen ausgeübt werden können. Hier kommt so etwas wie eine politische Vergemeinschaftung der Freien und Gleichen zum Vorschein, auf die staatliche Institutionen in einer lebendigen Demokratie in höchstem Maße angewiesen sind. Fallen rechtsstaatlich zustande gekommene demokratische Entscheidungen im Parlament und das politische Gemeinwesen auseinander, so fehlt diesen Entscheidungen die Legitimität. Das erleben wir derzeit bei den Protesten in Stuttgart und anderswo, die ja nicht egoistische Interessen durchsetzen, sondern ein anderes politisches Gemeinwesen erstreiten wollen. Ist es übertrieben, in diesen Protesten den Versuch der republikanischen Wiederaneignung der repräsentativen parlamentarischen Demokratie und rechtsstaatlicher Verfahren zu sehen? Hannah Arendts Republikanismus hat uns die demokratischen Revolutionen in Europa von 1989 als Folge von Freiheitsbewegungen verstehen lassen. Das Ende der Geschichte haben diese Revolutionen gleichwohl nicht eingeläutet. Weder wurde der Systemwettbewerb mit den unvollkommenen Demokratien und autokratischen Regimen in der Folge zugunsten der Demokratie entschieden. »Freedom in Retreat: Is the Tide Turning?«, überschrieb Freedom House seinen Bericht über das Jahr 2007. Noch haben die liberalen Demokratien an Festigkeit gewonnen, weil ihrem politischen Betrieb, der sich mehr und mehr auf politische Märkte und Kunden statt auf ein politisches Gemeinwesen bezieht, Legitimitätsressourcen verloren gegangen sind. Es ist zu hoffen, dass die Bürgerproteste in Stuttgart nicht die Krise der Demokratie, sondern ihre Erneuerung anzeigen. Lässt die Entstehung einer breiten sowohl gebildeten wie wirtschaftlich erfolgreichen chinesischen Mittelschicht auch auf die Entwicklung einer lebendigen politischen Bürgergesellschaft in China hoffen? In der chinesischen Bürgerrechtsbewegung können wir vielleicht erste Anzeichen dafür erkennen. Ist die Mitte der Bürgergesellschaft schwach, kommt das den Avantgarden – ob als Einparteiensystemen oder politisierenden Intellektuellen – zugute. Damit haben die Europäer im 20. Jahrhundert keine guten Erfahrungen gemacht, und Hannah Arendt hat daraus für ihr politisches Denken bis heute aktuelle Schlüsse gezogen. Ich bin gespannt, zu welchen Schlüssen uns die Denkbewegung führen wird, zu der uns François Jullien einlädt.
Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Jahr darf ich zum vierten Mal an der Verleihung des Hannah-Arendt-Preises mitwirken. Ich möchte Sie im Namen des Senats ganz herzlich in der schönen oberen Halle unseres historischen Rathauses begrüßen. Der Hannah-Arendt-Preis ist ein Preis für politisches Denken, er ist ein akademischer Preis und ein öffentlicher Preis. Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken wurde 1994 ins Leben gerufen und 1995 zum ersten Mal verliehen. Den Preis stiften der Senat der Freien Hansestadt Bremen gemeinsam mit der Heinrich- Böll-Stiftung. Die Preisträger werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt, auf die kein Einfluss genommen wird, und anschließend gemeinsam von den Preisgebern Senat und Heinrich-Böll-Stiftung verliehen. Diese Form der Preisvergabe an sich ist bereits ein Ausdruck für politisches Denken, das sich nicht instrumentalisieren lassen will. Hannah Arendt wird in diesem Preis als herausragende Denkerin des 20. Jahrhunderts gewürdigt, die uns ein Vorbild in ihrer Unabhängigkeit von Ideologien und vorgegebenen Denkstrukturen ist. Bei der Preisverleihung im Dezember 2009 war Kurt Flasch der Preisträger. Ein Philosophiehistoriker, der in seinem Buch Kampfplätze der Philosophie dargelegt hatte, wie viele der heute als gegeben hingenommenen Wahrheiten der Philosophie, die scheinbar ruhige, abgeklärte und kontemplative Philosophie, ihren Ursprung in heftigen Auseinandersetzungen ihrer Zeit gefunden haben. Dieser Preis ist auch Ausdruck des Versuchs, politisches Denken jenseits von Parteipolitik selbst zum Gegenstand des Diskurses einer interessierten Öffentlichkeit zu machen. Der allgemeinen »Politikverdrossenheit«, die in den Medien beklagt wird, wollen wir mit diesem Preis den Wert von Politik, die auf Denken beruht und des Denkens, das auf sein Umfeld rekurriert, entgegensetzen. Hier finden wir den Ansatz von Hannah Arendts Denken abseits der Links-rechts-Polarisierung des akademischen Denkens. Damit wird auch die Meinung infrage gestellt, dass Werte absolut gesetzt werden können und universelle Allgemeingültigkeit besitzen. Der Ansatz weist auf die Relativität des eigenen Denkgebäudes hin, die uns in diesem Denkansatz gewahr wird. Dies ist ein politisches Denken, das sich bewusst ist, dass es eine Begrenztheit der eigenen Denkprozesse gibt. Denken findet statt vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Kontextes, der eigenen Geschichte und der eigenen Lebenswelt. Es ist geprägt von dem eigenen Geschlecht und Alter, sozialer Situation und Umfeld. Dieses Jahr hat die Jury des HannahArendt-Preises einen Denker als Preisträger ausgewählt, der von einem noch viel entfernteren Ort einen Blick auf unsere Denkgewohnheiten wirft. Die gesamte Philosophie, die Werte, auf der unsere europäische, westliche Gesellschaft beruht, haben ihren Ursprung in der griechischen Philosophie und Sprache. Durch die Entfernung von den Ursprüngen der gewohnten Denkmuster in eine von den griechischen Wurzeln freie Denk- und Sprachentwicklung, nach China, nähert sich François Jullien auf ungewohnte Weise dem europäischen Denken. China ist derzeit hauptsächlich als aufstrebende Weltwirtschaftsmacht mit großen Geldreserven und einem geradezu beängstigenden Appetit, einem beunruhigenden wirtschaftlichen Engagement auch in Europa in der Öffentlichkeit präsent. Lange schon hat sich China davon verabschiedet für das Ausland nur ein großer Exportmarkt zu sein oder für das Ausland billige Massenproduktion zu übernehmen. Auch vor dem Hintergrund der jüngeren politischen Ereignisse wie dem Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die studentischen Proteste oder der Haltung in Menschrechtsfragen oder dem Umgang mit Tibet ist es umso wichtiger, sich in das chinesische Denken hineinzubegeben, allerdings meine ich, ohne Relativierung der eigenen Werte, der eigenen Gewissheiten und Denkstrukturen aber wohl. So hilft uns der Preisträger zu verstehen, dass die Dualität westlichen Denkens nicht alternativlos ist. Der bei uns lange vorherrschende Glaube an die Allmacht des technischen Fortschrittes findet ausgerechnet im modernen China nicht nur die Karikatur, wie wir sie gerne sehen wollen, sondern wird durch eine andere Denktradition neuen Brüchen zugeführt. Wir bekommen einen Spiegel vorgehalten, in dem unserem eigenen Zweck-, Mittel- und Ziel-Denken chinesisches Denken als andere Möglichkeit gegenübergestellt wird. Wir wissen zwar, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings die Welt verändern kann, aber eben nicht welcher und wann. Jeder kennt die großen Strategen und Paranoiker, die ernsthaft glauben, genau zu wissen, welches Schräubchen gedreht werden muss oder gedreht wurde, um definierte Folgen zu erzeugen. Die Preisverleihung ist wieder eine Herausforderung für den Kopf. Der politische, philosophische Diskurs in Europa ist von den Ideen Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenrechte nicht zu trennen. Jullien fordert uns auf, einen von unserer gedanklichen Herkunft unbelasteten Blick auf China zu werfen. Es soll hier jemand sagen, dass das leicht ist. Danke an die Jury für die Auswahl. Es tut Bremen gut, dass Sie helfen, nicht im politischen Pragmatismus zu ersticken. Ihnen, Herr Jullien, meinen ganz herzlichen Glückwunsch und uns allen noch einen spannenden Abend.
François Jullien, französischer Philosoph und Sinologe, lehrt in Paris
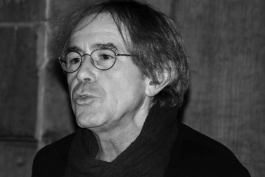
© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Hannah Arendt steht für ein politisches Denken, das sich den Herausforderungen der Zeit stellt. Sie hatte die Fähigkeit, die dunklen Seiten der politischen Moderne in der Tiefe zu beleuchten und die beispiellosen Schrecken des 20. Jahrhunderts als etwas bisher nicht Dagewesenes zu durchdenken, dabei ohne Scheu – wie sie sagte – auf die »Geländer« bisher geltender philosophischer Wahrheiten verzichtend. So sind ihre Erkenntnisse über totalitäre Herrschaft möglich geworden; ebenso ihre wegweisenden Überlegungen zum Verhältnis von Macht und Gewalt und nicht zuletzt ihre Gedanken zur Bedeutung von republikanischer Freiheit. Die Kraft dieser Schlüsselkategorien ihres Denkens hat sich besonders im Verständnis der Freiheitsrevolutionen im Europa der letzten Jahrzehnte – nicht zuletzt 1989 – erwiesen. Den Preisgründern aus Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit liegt seit der ersten Preisverleihung 1995, seinerzeit an die ungarische Philosophin Agnes Heller, daran, die Bedeutung des politischen Denkens von Hannah Arendt für die Erneuerung republikanischer Freiheitspotenziale in West und darüber hinaus in Ost hervorzuheben. Nicht alle bisherigen Hannah-ArendtPreisträger weilen noch unter uns. Wir beklagen den Verlust von Tony Judt, den seine tödliche Krankheit im August dieses Jahres besiegt hat und wir beklagen auch den Tod von Claude Lefort, der im Oktober dieses Jahres starb. Von beiden herausragenden Denkern sind in diesem Jahr neue Bücher erschienen, bedeutende Essaysammlungen, und dazu von Tony Judt ein Buch über seine Kindheitserinnerungen. Bücher, die es uns erlauben, uns mit ihren Vorstellungen und Gedanken weiterhin auseinanderzusetzen.
Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken soll dazu ermutigen, Hannah Arendts handlungsnahes und ereignisoffenes Politikverständnis auch für gegenwärtige Diskurse in Politik und Gesellschaft fruchtbar zu machen. Daher werden Personen geehrt, die das von Hannah Arendt so eindringlich beschriebene und von ihr selbst praktizierte »Wagnis Öffentlichkeit« angenommen haben, also Personen. die sich gegen das einfache Fortschreiben des bisher für richtig Gehaltenen verwahren, es vielmehr prüfen und das, was neu gedacht und behandelt werden muss, öffentlich, auch kontrovers, darlegen. Unser diesjähriger Preisträger, François Jullien, hat die Herausforderung eines wachen Hinsehens und Hinhörens zum Begreifen von Veränderungen und Wandel in unserer globalen Welt besonders von seinem Verständnis chinesischen Denkens her angenommen: Er arbeitet darin die Aufmerksamkeit auf Prozesse nicht sichtbarer, aber prägender und durchdringender Beeinflussungen heraus, deren Bedeutung erst nach einer gewissen Dauer schlagartig deutlich werden. In seiner Schrift Die stillen Wandlungen hat er solchen Vorgang so beschrieben: »Eine untergehende und verlöschende Welt, ein plötzlich explodierender Stern enthüllen mitunter wie durch einen Paukenschlag dieses ununterbrochene Gewebe, auf das wir mit offenen Augen blicken, ohne es richtig zu begreifen.« Es besteht kein Zweifel, dass wir am Ende des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts vor großen Veränderungen stehen. Die keineswegs ausgestandene Krise der Finanzwelt hat uns mit den möglichen Ausmaßen dieser Veränderungen schon konfrontiert. Die Politik, die sich in den letzten Jahrzehnten in eine neoliberale Zwangsjacke manövrierte, musste erfahren, dass wir ohne politische Gestaltung nicht gut leben können, dass ein Markt ohne Rahmen und Grenzen zwar die Lebenswelt kommerzialisieren kann, nicht aber eine Welt schafft, die menschenwürdig ist. Jedoch – hat die Politik inzwischen den elementaren Sachverhalt wirklich gelernt und begriffen, dass globale Prozesse ohne Regeln jetzt uns, anders als viele denken, längst in zerstörerischer Form einholen? Die vom Westen in Gang gesetzten Prozesse machen es heute unabweisbar nötig, dass wir uns mit dem Denken auf anderen Kontinenten und mit anderen, nichtwestlichen Kontexten befassen. Unser Preisträger hat sich mit nichtwestlichem Denken befasst und dieses in der Tiefe beleuchtet. Professor Jullien ist Philosoph und Sinologe, geboren 1951 in Embrun im französischem Département Hautes-Alpes. Er studierte in den 1970erJahren in Paris Philosophie sowie Chinesisch in Shanghai. Seit 2001 ist er Mitglied in verschiedenen hochrangigen akademischen Institutionen Frankreichs: Er ist unter anderem Direktor des Instituts für zeitgenössisches Denken und seit 2004 Professor für ostasiatische Sprachen und Kultur. Professor Jullien ist zudem tätig als Wirtschaftsberater französischer Unternehmen, die Projekte in China durchführen, sowie als Herausgeber der Sammlungen »Orientales« und »Libelles« beim Verlag Presses Universitaires de France in Paris. Seine Schriften wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
In einem Brief an Uwe Johnson vom 12. Februar 1974 schreibt Hannah Arendt: »Inzwischen dürfte zu den Teilen der Welt, die weder Sie noch ich verstehen, auch noch China hinzugekommen sein. Die große Frage ist, wer ist Konfuzius? Ich fürchte sehr Chou Enlai.« Interpretieren lässt sich diese Briefpassage nur durch ihre Beziehung zu den damaligen, schwer durchschaubaren Auseinandersetzungen in China. Uwe Johnson hatte ihr zuvor geschrieben, dass er jetzt noch ganz andere Teile der Welt nicht verstehe als vordem. »Es wird Sie nicht überraschen, aber mich plagt es.« Offensichtlich plagte sich auch Hannah Arendt: »Eins ist sicher: Weder Sie noch ich wissen genau, ›wie es in Wahrheit sich verhält‹, nämlich mit der wieder ins Rutschen geratenen Weltgeschichte.« Was in China nach Beendigung der Kulturrevolution passieren würde, schien damals völlig offen. Auf Karl Jaspers, den Lehrer und Freund, hatte, wie er Hannah Arendt im September 1957 schrieb, gerade Konfuzius »großen Eindruck« gemacht. Er hatte ihn im ersten Teil seiner Schrift über die großen Philosophen neben Jesus, Sokrates und Buddha zu den vier »maßgeblichen Menschen« gerechnet: »Ich wollte ihn nicht nur gegen die Banalisierung sogar seitens der meisten Sinologen schützen, sondern er war mir für uns ergiebig.« Bei Hannah Arendt hat dieser »große Eindruck« keine Wirkung erzielt. China interessierte sie vor allem als Machtfaktor im Umfeld des Vietnamkrieges und in seinem Verhältnis zur Sowjetunion. So schrieb sie am 28. April 1965 an ihre Freundin Mary McCarthy, der Vietnamkrieg mache alle vernünftigen und vorteilhaften Lösungen für die Region unmöglich. »Wenn wir es gut sein ließen, würden wir dort eine Vielzahl sozialistischer bis kommunistischer Regime bekommen, mit denen wir sehr gut leben könnten, von denen einige an Russland orientiert wären und andere mehr China zuneigen würden. Ich habe keinen Zweifel, dass Asien als Ganzes auf lange Sicht unter chinesischen Einfluss kommen wird, aber nicht notwendigerweise unter chinesische Vorherrschaft. Wenn wir mit unserer Torheit China und Russland wieder zusammenbringen – ach, der Satz sei nicht beendet.« Auf China sei die ideologische und politische Initiative übergegangen, hatte sie 1957 nach der Niederschlagung des Ungarnaufstandes und in Interpretation von Maos Rede über die »inneren Widersprüche« geurteilt. Offensichtlich sei die Rede in bewusster Abgrenzung zur offiziellen russischen Ideologie formuliert. Sie sei »zweifellos das erste ideologisch neue und ernstzunehmende Dokument, das seit Lenins Tod aus dem kommunistischen Machtbereich zu uns kommt … Das kann von großer Bedeutung für die Zukunft sein, es mag sogar irgendwann einmal die totalitäre Natur des russischen Regimes ändern.« Im August 1966 schreibt sie dann Jaspers, dass sie bald anfange, Maos Tage zu zählen. Sie glaube, »dass er entweder tot oder halbtot ist – die Schwimmerei schien mir ein Beweis, dass er nicht mehr da ist«. Da hatte sie sich allerdings um gut zehn Jahre verschätzt. Hannah Arendt hat sich mit China nolens volens als Zeitgenossin politisch beschäftigt und das auch eher vage und selten. Selbst als Analytikerin des Totalitarismus hat China sie nur am Rande interessiert. Ihr politisches Denken war ganz durch die Polis und das Wiederanknüpfen an die Antike durch Renaissance und republikanische Revolution geprägt. Der Totalitarismus bedeutete für sie die Zerstörung dieser Tradition. Diese Tradition hatte es aber in China so nie gegeben. Das chinesische Denken lag, so kann man wohl sagen, weitgehend außerhalb ihres philosophischen Interesses. Insofern blieb sie ganz Kind der klassischen europäischen Bildung.
In der Jury des Hannah-Arendt-Preises fragen wir uns natürlich bei jeder Preisverleihung nach dem »Hannah-Arendt-Bezug«. Diesmal ist der Bezug zu Hannah Arendt also eher eine Lücke, eine Leerstelle in ihrem Werk. 1974 fiel ihr das, wie eingangs zitiert, schmerzlich auf. In China tobte die Kampagne zur Kritik an Lin Biao und Konfuzius. Die Frage »Wer ist Konfuzius?« war also aktuell. Zugleich zeigte sie, wie die aktuellen Auseinandersetzungen in China ihr Material aus der langen Tradition chinesischen Denkens bezogen und immer noch beziehen. Das macht sie im Westen nicht unbedingt leichter durchschaubar.
China und Europa hatten sich mehr als ein Jahrtausend nebeneinander in ihrer jeweiligen Welt entfaltet. In diesem Nebeneinander ohne größere Berührungspunkte entwickelte sich das Denken in inneren Kontroversen ohne wechselseitigen Bezug aufeinander. In den letzten fünfhundert Jahren haben sich die Beziehungen zwischen dem Westen und China aus einem Nebeneinander zu einem Gegen- und Miteinander entwickelt. Man ist also gezwungen, sich nach und nach gegenseitig besser zu verstehen. Auch in den alltäglichen Auseinandersetzungen machen sich die unterschiedlichen Denkweisen bemerkbar. Auf die amerikanische Kritik an der chinesischen Währungspolitik und die Forderung nach rascher Aufwertung des Renminbi antwortete der Chef der chinesischen Notenbank, die Wechselkursdebatte sei wie ein Wettstreit zwischen »westlichen Tabletten, die das Problem über Nacht lösen« und Behandlungen im Sinne der chinesischen Heilkunde, die »zehn Kräuter zusammenrührt, die das Problem nicht über Nacht, aber vielleicht in ein, zwei Monaten lösen«. In der Debatte um politische Reformen zwischen China und dem Westen spielen Tempo und Dauer eine entscheidende Rolle.
Aber stellt die rasante wirtschaftliche und urbane Entwicklung in China nicht jede Mählichkeit infrage? Mark Siemons, unser Laudator, gibt mit seinen Korrespondenzen aus China regelmäßig zu denken. Modernisierung sei bis jetzt im chinesischen Bewusstsein gleichbedeutend mit Geschwindigkeit und Veränderung, schrieb er kürzlich. Viele Strukturen jedoch, mentale wie institutionelle, hielten mit dem Tempo der Modernisierung in immer mehr Lebensbereichen nicht mit. Als Beleg für das damit verbundene Unbehagen kann er die KP-Zeitung Global Times anführen. Die forderte von der Regierung, sie müsse sich genauso für die Sicherheit der Bürger wie für die nationale Sicherheit einsetzen: »Die Modernisierung sollte auch das Verlangen nach einer größeren Ruhe des Geistes einschließen.« Stammt diese Überlegung nicht ganz aus Chinas ureigener Tradition? Aber wird sie heute noch Wirkung zeigen? Zumindest gibt es erneut Auseinandersetzungen mit und über Konfuzius. Mark Siemons hat auch darüber berichtet. Man kann das Verhältnis von individueller Freiheit und politischer Ordnung von beiden Seiten her angehen. Theoretisch, aber nicht ohne Weiteres praktisch, wird im Westen immer vertreten, dass ohne individuelle Freiheiten eine dauerhafte politische Ordnung nicht möglich sei. Umgekehrt lautet das chinesische Argument, dass ohne stabile politische Ordnung die individuelle Freiheit bestenfalls für wenige gelte, für die meisten aber nur auf dem Papier stehe. In Wirklichkeit fordert das Verhältnis von Freiheit und Ordnung keine Entscheidung für die eine oder andere Seite, sondern Erörterung und Abwägung. Diese werden aber immer unterschiedliche Ausgangspunkte behalten und die beiden Seiten unterschiedlich gewichten. Für Chinas politische Führung wird bis auf Weiteres politische Ordnung und Stabilität den Vorrang einnehmen. Wahrscheinlich wird auch der Mehrheit der chinesischen Gesellschaft Liberalisierung des Regimes und nicht Regimewechsel als Ziel vorschweben.
Unser diesjähriger Preisträger macht es sich zur Aufgabe, auf dem Umweg über China auch das westliche Denken besser in seiner Besonderheit zu verstehen. In immer neuen Anläufen und zu verschiedenen Themen bemüht er sich, das chinesische Denken zu verstehen und zu verdeutlichen. China zu verstehen heißt dann aber auch Schranken des eigenen, des westlichen Denkens fühlbar zu machen. Die Grenzen überschreiten lässt die Grenzen nicht verschwinden. »Das Angenehme, Seltsame und Erfrischende im Denken der Chinesen ist, dass sie sich von Kategorien fernhalten, ohne Empiristen zu werden.« Die Bemerkung aus dem Mai 1947 findet sich in den Aufzeichnungen Franz B. Steiners, eines Prager Philosophen im britischen Exil. Ich könnte mir vorstellen, dass sie François Jullien gefällt. Die Preisvergabe an François Jullien hat vonseiten der Jury – wenn ich hier für alle Mitglieder sprechen darf – den Sinn, auf das wachsende Interesse an China, an dessen Rolle und Entwicklung und damit auch an chinesischem Denken mit dem nachdrücklichen Hinweis auf einen Autor zu antworten, der das jahrtausendlange unverbundene Nebeneinander Chinas und des Westens in ihren jeweiligen Entwicklungen, Ausprägungen und Folgen ernst nimmt und sich immer erneut auf den Umweg über China macht. Unermüdlich nimmt er seine transkulturelle Übersetzungsarbeit neu in Angriff, um ein wechselseitig aufgeklärtes Miteinander zu fördern. Um mit Hannah Arendt zu sprechen: Die Weltgeschichte ist heute erneut ins Rutschen geraten. Es gab mal die Frage nach dem Gleichgewicht der Blöcke, sie verschob sich zur Frage nach der Gewichtung in den G 8. Heute fragt sich, wie der Westen in den G 20 mit den neuen Schwergewichten unter den Schwellenländern und mit dem spezifischen Gewicht Chinas zurechtkommt. Die Frage nach den Universalien stellt sich nicht mehr einfach als Frage der Durchsetzung westlicher Werte, sondern als Frage, wie globale Gemeinsamkeiten erarbeitet werden können und wie haltbar sie sein werden. Ich glaube, Hannah Arendt würde François Julliens Umwege über China zurück auf das europäische Forum schätzen. Immer wieder bringt er Neues heim.
Das Denken in Bewegung setzen
Europa und China, jenseits des Kulturrelativismus – Laudatio auf François Jullien
Wer heute darüber nachdenkt, was die Verschiedenheit der Kulturen für die Politik bedeutet, kommt um China nicht herum. Der Aufstieg der alten Kultur zu einer wirtschaftlichen und politischen Macht, die sich den Strukturen des Westens nicht eingliedert, lässt nach den Bewertungskriterien fragen, die man an Vorgänge wie diesen anlegen kann. Soll man, darf man, ein Land wie China aus seinen eigenen Maßstäben heraus verstehen? Oder betreibt, wer sich auf die Andersartigkeit einer Kultur beruft, das Geschäft repressiver Ideologen, die ihr Volk vor den Ansprüchen universeller Werte fernhalten wollen? Auf den ersten Blick ist China der klassische Fall einer solchen Auseinandersetzung zwischen Kulturrelativisten auf der einen Seite und Universalisten auf der anderen. Auf den zweiten Blick zeigt jedoch gerade das Beispiel China, dass so einfach die Sache nicht ist. Die chinesische Kultur zeichnete sich von jeher eben durch ihre Beweglichkeit aus, mit der sie fremde Einflüsse in sich aufnahm. Und so, wie sie früher den indischen Buddhismus und den deutsch-russischen Marxismus integrierte, ist nicht zu erkennen, dass heute die Chinesen, die etwa im Internet oder an den Universitäten über Demokratie und Menschenrechte diskutieren, darin etwas sehen, was ihrer Kultur wesensfremd wäre. Sogar die Kommunistische Partei, die immer von den besonderen »chinesischen Kennzeichen« spricht, die verbieten würden, dass China eine westliche Demokratieform übernehme, hütet sich, das mit einer speziellen »Kultur« inhaltlich zu füllen. Offenbar betrifft die Kultur im Fall Chinas gar keine Ansammlung essenzialistischer, sich nach außen abgrenzender Positionen, sondern im Gegenteil eine gleichsam begriffslose Beweglichkeit, die potenziell alles einschließt und doch zugleich zu etwas Eigenem umschmilzt. So gesehen würde die chinesische Kultur also vor allem anderen die Frage danach aufwerfen, was überhaupt eine Kultur ist, und dabei alle vorgefassten Gewissheiten hinter sich lassen. Den chinesischen Weisen Zhuangzi pflegt François Jullien gern mit dem Satz zu zitieren: »In jeder Diskussion gibt es etwas Undiskutiertes.« All dies gilt es zu erwägen, wenn mit einem Preis für politisches Denken heute ein Philosoph ausgezeichnet wird, der seine ganze Energie in das Ausloten sprachlicher Finessen zu stecken scheint. Ein Philosoph, der, genauer gesagt, jenen Abstand rekonstruieren will, den das klassische Chinesisch mit einigen seiner charakteristischen Besonderheiten zur europäischen Rationalität herstellt. Konfuzius zum Beispiel übersetzt er nicht wie üblich so: »Wer am Morgen den rechten Weg erkannt hat, könnte am Abend getrost sterben« (Gespräche IV, 8) – so als ob der Meister einer jener Sinnsucher wäre, wie man sie im Abendland gut kennt. Sondern er versucht, zu einer ursprünglichen, noch nicht in westliche Semantik übertragenen Struktur der alten Schriftzeichen zurückzugehen. Dann lautet der Satz so: »In der Frühe den Weg vernehmen und des Abends sterben: das geht.« Auf einmal stehen nicht mehr der »Weg« oder das »Sterben« im Zentrum des Satzes, sondern das kaum hörbare, am Rande der Nicht-Aussage balancierende: »Das geht.« François Jullien ist der Philosoph solcher kaum hörbaren Sätze, deren vermeintlich widerstandslos vor sich hin plätschernde Flachheit er unter den verfälschenden Versuchen, sie zu einer diskursfähigen Aussage umzuschmieden, freilegt. François Jullien hat gerade selber demonstriert, welche weitgehenden Konsequenzen eine solche Philologie des kaum Hörbaren für die europäische Theorie des Politischen haben kann. Ich möchte nun zeigen, welche Rolle dieses Denken auch für die gegenwärtige Politik spielen kann – wie es ins Zentrum jener irritierenden Fragen führt, denen sich das Zusammenleben im eigenen Land und in der ganzen Welt durch die Globalisierung zurzeit ausgesetzt sieht. Ich möchte mich also auf den Umgang mit Kulturen konzentrieren, wie ihm François Jullien eine neue Perspektive eröffnet hat, die über den Ausgangspunkt China hinausgeht. Bei Jullien wird die Sprache der alten chinesischen Denker zur Probe aufs Exempel dessen, was Universalismus und was Kulturen bedeuten können – und was sie nicht bedeuten können.
Jeder spürt, dass sich im Gefüge der Weltordnung etwas verschiebt, sei es durch den Aufstieg nicht-westlicher Mächte, durch die globalen Wanderbewegungen oder durch die Politisierung des Islam. Das alte Europa konzentriert sich in dieser Lage vielfach darauf, was es zu verlieren hat, und reagiert mit Unsicherheit. Eben noch schienen republikanisches Staatsverständnis, universalistische Werte und kulturelle Offenheit einen solchen Status unangefochtener Selbstverständlichkeit in Europa zu besitzen, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass Ressentiments in der öffentlichen Sphäre gegen sie eine Chance hätten. Und jetzt wirbelt der Druck der ökonomischen, aber auch der kulturellen Globalisierung die vertrauten Kategorien durcheinander und zwingt dazu, ihren Zusammenhang neu und präziser als vorher zu bedenken. Auf der einen Seite wird ein in sich erstarrter Kulturbegriff dazu verwendet, republikanische Standards aufzuweichen – nicht nur nach außen, wenn man repressiven Regimen immer wieder eine spezielle kulturelle Tradition als Rechtfertigung durchgehen lässt, sondern neuerdings auch nach innen, wenn etwa die Bewohner der Bundesrepublik auf eine spezielle deutsche Kultur, genannt »Leitkultur«, verpflichtet werden sollen. Auf der anderen Seite muss der Universalismus dazu herhalten, den Wert kultureller Verschiedenheit in Zweifel zu ziehen oder gar zu leugnen, dass es eine solche kulturelle Verschiedenheit überhaupt gibt, sofern damit etwas in irgendeiner Weise Relevantes gemeint sein soll. Jenseits solcher Versuchungen tut sich eine grundsätzlichere Frage auf: die Frage nach dem Verständnis der Rationalität. Der Anspruch der Universalität von Werten kann sich nur von der Universalität der Vernunft herleiten, auf der sie gründen. Welche Rolle spielt es nun, dass die Menschenrechte zum ersten Mal in Europa formuliert wurden? Ist die europäische Rationalität, die das möglich machte, selber schon etwas Universelles? Oder bedarf sie aufgrund ihrer unvermeidlichen Begrenztheit und Partikularität einer fortwährenden Ergänzung und Kritik, damit die von ihr postulierten Werte sich mit immer größerem Recht tatsächlich als universelle bezeichnen können? Erschöpft, mit anderen Worten, »der Westen« die Rationalität? Oder kann man es für denkbar halten, dass andere Weltgegenden weitere Rationalitätsmöglichkeiten bergen? Das ist der Kern der Frage nach der Verschiedenheit der Kulturen, sofern damit nicht bloß andere folkloristische Oberflächen gemeint sein sollen. Stecken in nicht-westlichen Kulturen andere Rationalitätselemente, die der Westen sich umso weniger leisten kann zu ignorieren, als er am universellen Anspruch der von ihm vertretenen Werte interessiert ist? Solche Fragen, die man auf den ersten Blick für bloß akademische halten könnte, haben sehr handfeste Auswirkungen auf das globale Zusammenleben, auf die Art und Weise, mit der Europa seine Werte in der Welt zur Geltung bringt.
François Jullien hat oft darüber berichtet, wie es dazu kam, dass er seinen »Umweg über China« antrat. Als junger Gräzist suchte er nach einer Möglichkeit, die eigene europäische Rationalität von außen zu betrachten, um so auch ihre blinden Flecken, ihre uneingestandenen, da von innen notwendigerweise unsichtbaren Voraussetzungen in den Blick zu bekommen. Aus sich selbst heraus kann diese Rationalität ihr Außen, eine »Heterotopie«, wie Jullien mit Foucault formuliert, nicht erschaffen, da sie es dabei ja immer nur wie in einem Spiegelkabinett mit Projektionen ihrer selbst zu tun hätte. Wo aber sonst wäre das Außen dann zu suchen? Die Urkulturen, mit denen sich die Ethnologen beschäftigen, drücken sich nicht schriftlich aus und waren daher für Julliens Zwecke nicht geeignet. Indien kam nicht infrage, weil diese Kultur ihre etymologischen Wurzeln und Syntaxformen mit den europäischen Sprachen teilt. Die arabische Tradition war durch eine lange gemeinsame Geschichte und viele gegenseitige Beeinflussungen mit Europa verbunden, fiel also auch fort. Es blieb für Jullien am Ende nur eine Kultur, die alle Bedingungen erfüllte: die chinesische. So wurde er zum Sinologen, ein Sinologe freilich, der seine philosophische Ausgangsfrage nie aus dem Blick verlor. Die Art und Weise, auf die Jullien von China aus nun auf Europa blickt, sollte sich sehr von der Art unterscheiden, auf die gewöhnlicherweise Kulturen miteinander verglichen, gegeneinander ausgespielt oder wechselseitig in Dialog gebracht werden. Kulturen sind für ihn keine opaken großen Textbausteine, die in dem aufgehen, was sie selbst von sich behaupten. »Jede Kultur«, so hat er einmal geschrieben, »und vor allem die europäische, die nicht aufhört, sich zu verändern und zu wandeln, sich zu ent-spezifizieren, um sich anders zu re-spezifizieren –, welche Merkmale wären bei ihr festzuhalten, die nicht eine Karikatur oder ein Klischee von ihr wären?« Die sogenannten dominanten, die auffälligsten Merkmale einer Kultur seien in Wirklichkeit auch die uninteressantesten. Der Grund dafür ist, dass Kulturen eben keine in sich geschlossenen, starren Monaden sind, die sich in ihren Absichten und Maßstäben definieren, also eingrenzen und fixieren ließen. So wie eine Kultur die Menschen, die in ihr aufwachsen, nicht determiniert, verändert sie sich selbst auch mit diesen Menschen, deren Leben – heute mehr denn je – durch vielerlei kulturelle Elemente beeinflusst ist und im Übrigen durch immer neue technische, ökonomische und politische Herausforderungen geprägt wird. Man könnte vielleicht so weit gehen, zu sagen, dass ein Gutteil heutiger Kurzschlüsse, Missverständnisse und Konfrontationen auf jene fatale Abstraktion zurückgeht, die Kulturen zu fest umgrenzten Blöcken macht, die wie im Modellbaukasten hin und her verschoben werden können. François Jullien wählt einen anderen Weg. Bei seiner Suche nach noch unergründeten Möglichkeiten der Rationalität fahndet er nach dem, was er den »Übereinstimmungsgrund« einer Kultur nennt: dasjenige, was in einer Kultur schon gar nicht mehr eigens zum Thema gemacht wird, weil es deren für selbstverständlich gehaltenen, undiskutierten Boden darstellt. Diese impliziten Bedingungen einer Kultur lassen sich nicht durch die Großbegriffe erfassen, wie sie üblicherweise gegeneinandergestellt werden. Jullien sucht stattdessen nach möglichst unverbrauchten, wenig kompromittierten Vokabeln vom Rand des Diskurses, die auf der schiefen Ebene des Textverlaufs ihren Bedeutungshof allmählich zu erweitern vermögen; in seinen Essays geht es daher um Kategorien wie Fadheit, Neigung, Regulierung, Effizienz oder Kongruenz. Statt »Europa« und »China« frontal aufeinanderstoßen zu lassen, geht er von vielen einzelnen solcher Punkte aus, deren Linien sich dann in der Folge seiner Texte zu einem Netz verdichten, bis sie am Ende etwas enthüllen, was ursprünglich nicht abzusehen war.
Diese Methode verdankt sich einer gegen den Strich gebürsteten Lektüre alter chinesischer Autoren. Konfuzius zum Beispiel, der, wie wir gesehen haben, Jullien nicht in dem am interessantesten erscheint, was sich geschmeidig in einen westlichen Diskursrahmen wie den der Sinnsuche einfügen lässt, sondern in dem, was eine eigene Möglichkeit, zu denken und sich zu äußern begründet: eine Möglichkeit, die um so bemerkenswerter ist, je weniger hörbar, wahrnehmbar sie den westlichen Diskursmustern erst einmal vorkommt. In seinem Essay »Umweg und Zugang« zeigte Jullien, wie solche Texte dem definierenden Diskurs des Westens, der die Dinge möglichst eng einkreisen will, eine mehr hinweisende Rede gegenüberstellen. In dem Buch Der Weise hängt an keiner Idee demonstrierte er, wie diese Denkweise etwas in den Blick bekommen kann, das der auf Streitfragen und Debatten fixierten westlichen Rationalität entgeht: die Evidenz des allzu Bekannten und Gewöhnlichen. Ein erst kürzlich erschienener Band befasst sich mit »stillen Wandlungen« wie dem Altern, die ein auf Identität und Kontinuitäten bezogenes Denken schwer auf seine Begriffe bringen kann. Im Bereich der Ästhetik, so schrieb er in dem Band Über das Fade, drücke sich dieser allen rationalen Unterscheidungen und Ausgrenzungen vorausliegende »Immanenzgrund« der Wirklichkeit in der »Fadheit« aus, mit der Dichtung, Malerei und Musik alle dramatischen Kontraste unterlaufen. Auf dem Feld des Handelns, legte er in dem Essay »Über die Wirksamkeit« dar, stehe der westlichen Modellbildung und Zweck-Mittel-Beziehung ein Denken in Situationspotenzialen gegenüber, das alle Wirkung organisch aus einer Ausgangsbedingung entstehen lässt. Mit diesem Verfahren bringt Jullien erst einmal das Denken selbst in Bewegung. Indem er die eingefahrenen Pfade mit deren gewohnten Begriffen und Problemen verlässt und sich den in der Sprache und der jeweiligen Perspektive enthaltenen impliziten Vorannahmen zuwendet, schafft er neue Anknüpfungsmöglichkeiten. Entsprechend groß ist die Wirkung, die er auch weit außerhalb der Fachmilieus in Künstler- und Intellektuellenkreisen erzielt. Seine Kritiker versuchten Jullien dagegen vielfach weiter in den konventionellen Rastern einzuschließen, die sein Verfahren gerade aufgebrochen hatte, vor allem dem Raster des Kulturrelativismus. Das weist auf etwas Allgemeineres hin: wie schwer nämlich die Vorstellung zu akzeptieren zu sein scheint, dass auch der im Westen zuerst formulierte Universalismus einer Erhellung durch Regionen außerhalb seines Ursprungsorts bedürfen kann. Dass Kulturen sich zwar fortwährend im Austausch mit anderen ändern, aber dabei doch ihre Fähigkeit behalten können, einander wechselseitig mit bislang Ungedachtem und Ungelebtem zu konfrontieren. Nachdem vielen klar geworden ist, dass Kulturen die Menschen nicht in Geiselhaft nehmen, dass sie, mit anderen Worten, nicht alles sind, schwingt das Pendel mittlerweile offenbar öfter in die entgegengesetzte Richtung aus. Inzwischen muss man anscheinend wieder lernen: Kulturen sind auch nicht nichts. Die Kritik veranlasste Jullien jedenfalls zu immer differenzierteren Erklärungen und Systematisierungen seines Ansatzes. Diese Selbstkommentare, vor allem in dem 2008 erschienenen und letztes Jahr auf Deutsch veröffentlichten Buch Das Universelle, das Einförmige, das Gemeinsame und der Dialog zwischen den Kulturen, sind zu einem wesentlichen Bestandteil des Werks selbst geworden: Ein Werk, das nicht nur die Ergebnisse seiner chinesischen Erkundungen präsentieren, sondern ein methodisches Exempel statuieren will – einen Rahmen skizzieren, in dem sich das bewegen kann, was man eine Philosophie des kulturellen Abstands nennen kann. Diese Philosophie geht davon aus, dass nicht nur das Reden über Kultur durch starre Abstraktionen in die Irre geführt wird, sondern auch das über Universalismus. Nur unter den Voraussetzungen solch vorschneller schematischer Abstraktionen kann man nämlich jenen Gegensatz zwischen Universalismus auf der einen Seite und Kulturalismus oder Kulturrelativismus auf der anderen konstruieren, der heute so viel Einfluss hat. Wieder bei Konfuzius hat Jullien die Bemerkung gefunden, dass der Weise »an keiner Idee hängt«, also nicht eine einzelne Idee allen weiteren Überlegungen voranstellt und sich dadurch begrenzen lässt. Er deutet diesen Ansatz als Forderung, das Denken in einer fortwährenden Spannung zu halten. Vielleicht hat ihn dieses Fundstück bei seiner Feststellung beeinflusst, dass es nicht im Voraus gegeben und definiert ist, was »der Mensch« ist, von dem die universellen Werte sprechen. Er bevorzugt daher den Ausdruck »das Menschliche« und schreibt: »Das Menschliche reflektiert sich – spiegelt sich und denkt gleichzeitig über sich nach – in seinen verschiedenen Vis-à-vis«, die, wie man ergänzen muss, in den verschiedenen Facetten der verschiedenen Kulturen gegeben sind. Er besteht also sowohl darauf, dass es reale Unterschiede gibt, als auch, dass es etwas Gemeinsames gibt, das »Gemeinsame des Intelligiblen«, das sich gerade in den Unterschieden erkennen lässt. Gerade wenn man das »Universelle« als regulative Idee ernst nehme, schreibt er, werde es jede gegebene Totalität (wie die der »installierten Universalismen«) aufbrechen und fortlaufend »die Bedingungen der Möglichkeit eines Gemeinsamen freisetzen«. Bei der »Selbstreflexion des Menschlichen«, die in einer solchen Art Kulturdialog stattfindet, könne es freilich nicht darum gehen, einen faulen Kompromiss zwischen den Werten auszuhandeln. »Warum sollte Europa auch nur ein wenig über die Freiheit verhandeln?«, fragt Jullien, und er formuliert ein weiteres Mal den Ausgangspunkt seiner intellektuellen Reise: »Für Europa geht es heute nicht darum, auf die Ansprüche seiner Vernunft, deren Universelles durchaus der Schlussstein ist, der so viele unterschiedliche Bestandteile zusammenhält, zu verzichten, sondern die Vernunft einer neuen Bearbeitung zu unterziehen.« Die einzige Lösung bestehe im Verstehen, in einer Toleranz, die »aus einer geteilten Intelligenz« kommt: »… dass jede Kultur, jede Person sich in der eigenen Sprache die Werte der anderen verständlich macht und sich dann von ihnen ausgehend reflektiert – also auch mit ihnen arbeitet.«
Es gilt also, in Julliens Worten, »die abgeschlossenen Universalitäten« aufzubrechen, um so »den Anspruch der Überschreitung, der dem Universellen eigen ist, zu befreien«. Eine solche Philosophie des kulturellen Abstands, der »Selbstreflexion des Menschlichen«, oder wie man sie nennen will, ist so recht erst durch die Globalisierung sowohl notwendig wie möglich geworden. Jullien selber weist darauf hin, dass die heutigen Philosophen die erste Generation darstellen, die das durch ihre Reisen durch die verschiedenen Intelligibilitäten leisten kann. Es liegt auf der Hand, dass durch eine solche Perspektive allein noch keine Lösungen und Handlungsanweisungen in den komplizierten Konflikten der Gegenwart zu erhoffen sind – das sollte man von der Philosophie vielleicht generell nicht erwarten. Aber sie ist dazu geeignet, den Blick zu öffnen, der durch eine Reihe falscher Gegensätze verstellt und verengt zu werden drohte. Wie notwendig das ist, merkt man, wenn man sich die Konsequenzen des Gegenteils vor Augen führt. Jullien hat gezeigt, dass Kulturen, die keinen Abstand zu sich selbst herstellen können, die sich nicht transformieren und auf diese Weise im Plural existieren, von vornherein tote Kulturen sind. Man könnte also vielleicht mit anderen Worten formulieren: Eine Kultur ist tot, wenn sie zur Abstraktion erstarrt ist. Und das gilt erschreckenderweise, dies ist die spezielle Pointe Julliens, auch für die europäische Kultur, wenn es ihr nicht mehr gelingen würde, ihre Rationalität von außen zu betrachten. In anderen Fällen ist es augenscheinlich, dass eine solche Erstarrung unduldsam und gefährlich werden kann. Insofern liegt es geradezu im Interesse des Friedens, Kulturen wechselseitig lebendig zu halten. »In jeder Diskussion gibt es etwas Undiskutiertes«, sagte Zhuangzi, und François Jullien hat ein Verfahren dafür entwickelt, dieses Undiskutierte zu beachten und fruchtbar zu machen. Kulturen bergen eben viel mehr als das, was sie selbst von sich behaupten, womit sie sich entweder gegeneinander abgrenzen oder gegenseitig neutralisieren. Deshalb ist die Alternative Kampf der Kulturen oder Ende der Geschichte keineswegs das Schicksal, dem wir ausgeliefert sind. Was könnte politischer sein, als inmitten solcher Schein-Dilemmata einen Weg zum Weiterdenken aufzuzeigen? Wir gratulieren François Jullien zum Hannah-ArendtPreis für politisches Denken.
Hinterfragen wir - ausgehend von der Exteriorität des Chinesischen – erneut die europäische Entstehung des Politischen
Was mich so empfänglich macht für die Verleihung des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«, mit dem Sie mich heute ehren und für den ich Ihnen danke, hängt in erster Linie mit folgendem Umstand zusammen. Dieser Preis, der den so hoch angesehenen Namen Hannah Arendts trägt, betrifft wesentlich das politische Denken, doch keine meiner Arbeiten beschäftigt sich hauptsächlich mit dem politischen Denken. Zudem bezieht sich der Hannah-Arendt-Preis auf Europa; wie Sie jedoch wissen, geht meine Arbeit nicht von Europa aus, sondern von China, einem Land, das so lange Zeit keine Beziehung zu Europa hatte. Sie haben jedoch das Wesentliche erfasst, das ich sicherlich in dieser Deutlichkeit nie gesagt habe: Auch wenn ich mich nicht unmittelbar mit dem politischen Denken befasse, so ist das Politische in meiner Arbeit immer mit angesprochen. Selbst wenn ich mich oft auf das chinesische Denken beziehe, nehme ich doch die als selbstverständlich erachteten Fundamente des europäischen Denkens neu in den Blick. In beiden Fällen nutze ich einen Abstand, um unser Denken gerade in den Aspekten infrage zu stellen, die es selbst nicht hinterfragt. Aus meiner Sicht handelt es sich also in beiden Fällen um eine indirekte Strategie, mit der ich versuche, die Ausprägungen innerhalb des europäischen politischen Denkens zu erfassen, die es vielleicht selber nicht aus eigenem Antrieb heraus wahrnähme. Aber zunächst einmal muss dieser doppelte Umweg begründet werden, und zwar zuallererst der Umweg über China. In einem zweiten Schritt werde ich dann zwei Weisen, das Politische zu fassen, einander gegenüberstellen: einerseits die Modellbildung, so wie die Griechen sie für uns herausgebildet haben und andererseits die Regulierung, so wie wir sie in China auffinden. Diese Gegenüberstellung führt uns dazu, den jeweiligen Kern jeder dieser beiden Konzeptionen freizulegen: Einerseits das Denken des Gesetzes und andrerseits das Denken, das wir mit dem Begriff Ritus übersetzen. So können wir besser wahrnehmen, was für uns das Ideal des Gesetzes ausmacht, indem wir es vom normativen Charakter der Riten in China und von ihrer Auswirkung innerhalb der Gesellschaft abgrenzen. Von hier aus und indem wir diese Diskrepanz ins Spiel bringen, können wir uns schlussendlich fragen, was für uns heutzutage von der Beziehung zwischen dem Ideal und dem Politischen übrig bleibt.
I ÜBER EINE PHILOSOPHISCHE STRATEGIE
China als Heterotopie
Wie Sie ja wissen, bildet China eine gegenüber der europäischen Kultur sehr ausgeprägte Exteriorität. Da ist die Exteriorität der Sprache: Das Chinesische gehört nicht zur großen indo-europäischen Sprachengemeinschaft, im Unterschied zum Sanskrit, das mit unseren Sprachen in Europa kommuniziert. Und auch wenn andere Sprachen eine ideographische Schrift hatten, so hat nur das Chinesische diese bewahrt. Auch gibt es eine Exteriorität der Geschichte: Selbst wenn man seit der Römerzeit einen minimalen, indirekten Austausch (über die Seidenstraße) wahrnehmen kann, so treten doch die beiden Pole des großen Kontinents erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in einen tatsächlichen Kontakt, als die Evangelisierungsmissionen sich in China niederlassen. Eine wirkliche Kommunikation ist aber erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, mit dem Opiumkrieg und der erzwungenen Öffnung der chinesischen Häfen. Erst dann unternimmt es das triumphierende Europa, dank der Wissenschaft, China durch Gewalt und nicht mehr durch den Glauben zu kolonisieren. Und obwohl China für Europa die Kultur darstellt, die Europa am äußerlichsten ist, ist China bekanntermaßen doch mit Europa vergleichbar, und zwar einmal durch sein Alter und zum Zweiten durch seine Entwicklung. Deshalb habe ich mich auch persönlich für das chinesische »Feld«, wie die Anthropologen sagen würden, entschieden. Aber da ich eben nicht Anthropologe, sondern Philosoph werden wollte, wollte ich mich mit einem Denken befassen, das genauso reflektiert, in Texten überliefert, kommentiert und erläutert ist wie das unsere in Europa: so wie es eben nur in China präsent ist. Ihnen wird sicherlich aufgefallen sein, dass ich den Begriff Exteriorität und nicht den Begriff Andersheit verwendet habe: Die Exteriorität ist durch die geografische Lage, die Geschichte, die Sprache vorgegeben; sie ist ein Faktum, während die Andersheit, wenn es denn so etwas überhaupt gibt, erst geschaffen werden muss. China ist »woanders«; inwieweit ist es »anders«? Das ist das, was Foucault wortwörtlich am Anfang von Die Ordnung der Dinge (Les mots et les choses) die »Heterotopie« Chinas genannt hat, die von der Utopie zu unterscheiden ist; und erinnern wir uns an das, was auf der nächsten Seite steht: »Die Utopien trösten«, »die Heterotopien beunruhigen« …
Ressourcen der Heterotopie
Mit anderen Worten: Die aufgetretene Schwierigkeit rührt also nicht so sehr von der »Verschiedenheit« (différence) des fernöstlichen Denkens vom europäischen her als vielmehr von der Gleichgültigkeit, mit der sie sich traditionell begegnen. Der erste Arbeitsschritt, der jedes Mal eine Konstruktion erfordert, und der niemals abgeschlossen ist, besteht also zunächst darin, diese Foto: Katrin Kieffer, Bremen François Jullien VI Kommune 1/2011 beiden Denkweisen aus ihrer gegenseitigen Gleichgültigkeit herauszulösen und sie einander gegenüberzustellen, und zwar so, dass sie sich wechselseitig beobachten können. In beiden Fällen ist es dann dieser Rahmenwechsel, der seinerseits zum Denken anregt. Dieser Ansatz führt wiederum dazu, sich zu fragen: Was geschieht mit dem Denken, wenn es aus der großen indo-europäischen Familie herausgelöst wird und man es von vornherein von der sprachlichen Verwandtschaft abtrennt, wenn man sich also nicht mehr auf die Semantik stützen und auch nicht auf die Etymologie zurückgehen kann, und wenn man mit den syntaktischen Regelungen bricht, an die sich unser Denken gewöhnt hat, in die es hineingeflossen ist? Oder was geschieht dem Denken, wenn es aus unserer Geschichte (der der »westlichen« Welt) heraustritt und wir gleichzeitig mit der Geschichte der Philosophie brechen und uns nicht mehr auf die Herkunft der Begriffe oder der Lehren stützen können – auf die sich unser Geist stützt?
Der Vorteil des Umwegs: Die Möglichkeit einer Rückkehr
Der Vorteil, den man durch den Umweg über China erlangt, ist ein doppelter. Er besteht zum einen darin, andere möglichen Arten der Kohärenz, die ich andere Verständlichkeiten nennen möchte, zu entdecken; und dadurch ausloten zu können, wie weit die Deterritorisierung des Denkens gehen kann. Aber dieser Umweg impliziert auch eine Rückkehr: Von diesem äußeren Blickwinkel aus betrachtet gilt es, sich wieder mit den Positionen zu befassen, auf deren Grundlage sich die europäische Vernunft entwickelt hat; das sind implizite, nicht explizite Positionen, mit denen das europäische Denken gleichsam evident verfährt, wenn es sie als Selbstverständlichkeiten transportiert, wenn es sie assimiliert und sich auf dieser Grundlage herausbildet. Somit besteht das Ziel darin, im Ungedachten das Denken zurückzuverfolgen und dabei die europäische Vernunft umgekehrt von diesem externen Blickwinkel aus zu betrachten. Diesen Vorgang nenne ich eine Dekonstruktion von außen. Denn würde man diesen Vorgang von innen heraus (ausgehend von unserer Tradition) durchführen, würde das zu kurz greifen: Wer versucht, Abstand zur (griechischen) Metaphysik zu gewinnen, wird allein aufgrund dieser Tatsache auf die »andere Seite« schwenken und zwar auf die Seite der biblisch-hebräischen Quelle (von Heidegger bis Derrida: die berühmte »ungedachte Schuld«). Den Umweg über China zu gehen, heißt, aus dieser großen Pendelbewegung – zwischen Athen und Jerusalem –, die die Philosophie in Europa getragen hat, herauszutreten und sich anderen Gründungserzählungen zu öffnen.
Abweichungen, nicht Unterschiede
Zweifellos beginnen Sie bereits zu verstehen, warum ich Beziehungen zwischen Kulturen, wie zwischen der chinesischen und der europäischen Kultur, als Abweichungen und nicht als Unterschiede begreife. In der Tat führt die Betrachtung der Vielfalt der Kulturen auf der Grundlage ihrer Unterschiede dazu, ihnen spezifische Eigenschaften zuzusprechen und jede einzelne von ihnen in eine grundsätzliche Einheit einzuschließen, von der man sehr schnell feststellen wird, wie gewagt sie ist, denn man weiß, dass jede Kultur genauso so vielfältig wie einzigartig ist und einem ständigen Wandel unterliegt: Man kann ihr also keine Identität zusprechen, auf die sich die Entstehung der Unterschiede stützen würde. Der Begriff der Abweichung hingegen fördert eine Sichtweise, die nicht mehr identifikatorisch vorgeht, sondern eher auslotend: Im Begriff wird man gewahr, bis zu welchem Punkt sich verschiedene Möglichkeiten entfalten können und welche Abzweigungen im Denken unterscheidbar sind. Anstatt also einordnend zu verfahren, wozu das Differenzprinzip führt, ermöglicht die Kategorie der Abweichung eine andere Perspektive und öffnet einen Raum für Reflexivität. Anstatt also eine überragende Stellung vorauszusetzen, in der es sich zwischen dem »Selben« und dem »Anderen« bewegt, wie das bei der Kategorie des Unterschieds der Fall ist, setzt die Abweichung, das, was sie getrennt hat, unter Spannung und entdeckt das eine durch das andere, spiegelt es im jeweils anderen wider. Damit wird auch der Blickwinkel vorteilhaft verschoben: Nicht nur von jenem der Unterscheidung, der dem Begriff der Differenz eigen ist, zu dem des Abstands und folglich in Richtung des offenen Feldes des Denkens, sondern auch konsequenterweise von der Frage der Identität hin zu einer Hoffnung auf eine Fruchtbarkeit. Die Kategorie der Abweichung ermöglicht auch die Vielfalt der Kulturen oder der Denkweisen als jeweilig verfügbare Ressourcen zu begreifen, die jedes Verstehen nutzen kann, um sich zu erweitern und wieder in Unruhe zu geraten.
II MODELLBILDUNG ODER REGULIERUNG
Lassen wir also Abweichungen zwischen dem chinesischen und dem europäischen Denken vom Standpunkt des Politischen aus wirken. Ich möchte zunächst kurz auf einige Eigenarten der griechischen politischen Ordnung eingehen, die wir uns vielleicht so gut angeeignet haben, dass wir sie gar nicht mehr ausmachen, nicht mehr hinterfragen können. Vertrautheit ist ja nicht mit Kenntnis gleichzusetzen; genauso wenig bedeutet, etwas von außen in den Blick zu nehmen, es aus der Ferne zu betrachten. »Das Bekannte ist dadurch, weil es bekannt ist, nicht erkannt« (Hegel). Zumindest sollten wir Plato das Verdienst der Radikalität zusprechen. Indem er abstrakt, also Prinzipien folgend, die selber wiederum der Ausdruck von Wesenheiten sind (wie die Gerechtigkeit an sich oder das Gute an sich), festgelegt hat, wie das Gemeinwesen idealerweise beschaffen sein sollte, hat er eine Vorstellung entworfen, wie wir in Gesellschaft leben sollten. Das Denken des Politischen leitet sich gänzlich von einer abenteuerlichen, sehr riskanten Deduktion ab, die ihren Ausgangspunkt im Begriff der Wahrheit hat. Dass das Politische somit in Begriffen wie »Ideen« oder »Idealformen«, als eide oder als »Typen«, gedacht ist, die zunächst »wie im Traum« (politeia, 443c) erscheinen, wird unmittelbar in diesen Formen des Politischen veranschaulicht, die die verschiedenen politischen Regime darstellen: in diesen Verfassungstypen, die die Griechen in der Regel parallel betrachtet haben, und deren jeweilige Verdienste sie vergleichen. Vom Einzigartigen zur Pluralität übergehend, begründet sich die Idee oder die Form der Vernunft in einem System von Fällen. Dabei setzt die Ausarbeitung der »idealen Verfassung«, der nomothesia arista (Aristokratie), die Untersuchung dieser verschiedenen Möglichkeiten voraus, die sich zu einem Spektrum entfalten: Monarchie – Oligarchie (Aristokratie) – Demokratie – Tyrannei. Dieses System von »Fällen« bleibt jedoch abstrakten Kriterien verhaftet: Nicht nur dass die Macht von einer oder mehreren Personen oder von der größtmöglichen Anzahl ausgeübt werden soll, mehr noch, sie wird auch gemäß folgenden Parametern ausgeübt: Zwang oder Freiheit, Armut oder Reichtum, Legalität oder Illegalität. Zudem ist diese Typologie der Regierungen als solche vollständig und bildet ein System: Es kann keine andere Form –idea – des Regierens geben und jede entspricht einem spezifischen Verhaltenstyp. So einander gegenübergestellt bleiben diese unterschiedlichen Formen der Macht eng an ihre prinzipielle Ausprägung gebunden und lassen uns von einem Extrem zum anderen durch ihre große Ausfächerung und kategorisch »die Auswirkungen der reinen Gerechtigkeit und der reinen Ungerechtigkeit« sehen. Auch wenn sie der Geschichte entlehnt sind, sind diese Formen des Politischen weiterhin entsprechend einer Modellbildung verfasst. So bleibt das politische Wirken letztendlich immer eine Sache von »Wissenschaft«, und dieses alleinige Kriterium, die theoretische Kompetenz dessen, der das Gemeinwesen leitet, behält am Ende die Oberhand gegenüber den anderen.
Doch ist es nicht mehr noch als die Demokratie (oder ihr vorausgehend) diese Theoretisierung des Politischen, die wir von den Griechen übernommen haben, die das »Abendland« ausmacht? War Plato nicht gewissermaßen selber der Erbe dieser Theorie, die er radikalisiert? Wenn man die Geburt des griechischen Gemeinwesens betrachtet, so muss man feststellen, dass es durch den eingeführten Bruch, der zur Modellisierung führte, begünstigt wurde. Als Ende des 6. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung in Athen Kleisthenes nach einem ausgefeilten Plan beginnt, das ganze Gebiet Attikas in Grundeinheiten aufzuteilen, die wiederum in spezifische geografische Gebilde zusammengefasst werden, bilden die zehn Stämme, die aus dieser Vermischung neu hervorgehen, fortan ein einheitliches Konstrukt, das die unterschiedlichen Strukturen der Orte, der Arbeitsverfassungen und der Lebensweisen überschreitet. Diese Stämme leiten nacheinander die Verwaltung des Gemeinwesens; so wird systematisch sowohl der gesellschaftliche als auch der räumliche Kontext zerstört, der den alten aristokratischen Familien ihre Macht und ihre Rangordnung verliehen hatte. Wenn es jedoch der Revolution des Kleisthenes gelingt, eine neue egalitäre, »isonomische« Mitwirkung des Volkes an den Institutionen einzuführen und dadurch den Bruch mit der gentilizistischen Religion zu vollziehen, so verdankt sie es doch in erster Linie den neu gefundenen Modellen. So hat man einerseits eine Kontinuität gestiftet zwischen der geometrischen Weltanschauung des Anaximander, der zum ersten Mal eine geografische Darstellung der Erde in Gestalt eines für den Geist befriedigenden Stützpunktsystems vornahm; auf der anderen Seite stand die Konzeption eines einheitlichen und rationalen Gemeinwesens mit einem qualitativ einheitlichen Raum, die Kleisthenes auf den Weg gebracht hat.
Auch der Vergleich politischer Regime, der darauf abzielt herauszufinden, welches das Beste ist, ist ein Thema, das der Philosophie vorausgegangen ist. Herodot (III, 80-82) berichtet, dass während einer Ratssitzung bei den Persern folgende drei Regime Gegenstand von Streitgesprächen sind. Der eine kritisiert die Monarchie, weil sie Hochmut und Neid begünstigt und uns zwangsläufig vor das Dilemma stellt, entweder den Fürsten hofieren zu müssen oder ihm nicht genügend zu schmeicheln. Diesem Regime müsse man die Regierung durch das Volk vorziehen, die »Isonomie«, in dem Ämter per Los vergeben werden, ein Regime, in dem man sich in Bezug auf die Macht, die ausgeübt wird, rechtfertigen muss, in dem alle Aussprachen öffentlich ausgetragen werden. Demgegenüber beruht das Lob der Oligarchie auf der Tatsache, dass allein sie in der Lage ist, sich sowohl der Respektlosigkeit der Menge als auch der Tyrannei des Fürsten zu erwehren. Wenn aber diese drei Regimes hypothetisch, also im Gespräch, als gut genug in Betracht gezogen werden, widerspricht der Dritte, so muss man die Monarchie sowohl dem einen wie auch dem anderen Regime vorziehen. Laufen diese Regime nicht ohnehin auf eine natürliche Art und Weise bei ihr zusammen, da die Oligarchie Rivalitäten und folglich »persönliche Feindschaften« und die Demokratie die Boshaftigkeit und folglich »gewalttätige Freundschaften« fördert … Schöner Parallelismus! Bevor sie überhaupt im Abendland als Grundlage der politischen Philosophie fungiert, findet schon eine systematische Modellierung der Regierungsformen statt, die zu kontroversen Diskussionen und somit zu einer wesentlichen Tatsache führt, die trotz ihrer abendländischen Banalisierung keineswegs selbstverständlich ist. Zumindest prinzipiell wird die politische Ordnung als Gegenstand einer Aussprache gefasst; in der Folge wird sie zur Angelegenheit einer konzertierten Entscheidung. Dieses Tableau der politischen Formen ist so erfolgreich übernommen worden, dass wir uns schon gar nicht mehr darüber wundern, dass wir unsere Lebensweisen innerhalb der Gesellschaft von einer abstrakten Aussprache über die besten »Zwecke« ableiten (siehe Aristoteles, Politik, III, 6). Folglich begreifen wir die Gestaltung der Macht nach Maßgabe modellhafter Formen; dies führt dazu, dass wir ihre Verfassungen (politeiai) unterscheiden und sie sogar einander gegenüberstellen. Nicht zuletzt begreifen wir das Politische als einen Ort, an dem der Widerspruch legitim und die Auseinandersetzung notwendig ist, wobei beide eine Wahl bieten und die Bedingungen der Möglichkeit von Freiheit schaffen. Jedoch wird der Sinologe auf diese grundsätzliche, zumindest direkt wenig gestellte Frage zu antworten haben. Er muss dieses griechische Erbe neu betrachten, indem er dessen implizite Voraussetzungen auslotet: Warum hat China nur ein einziges politisches Regime gekannt und entwickelt, das des »Königswegs«, wangdao, die Monarchie? Mehr noch: Indem China nur eine einzige mögliche Form des Politischen herausgebildet hat, hat es diese folglich nicht als unterscheidbare und vergleichbare »Formen« oder als eide bestimmt: Es hat sich niemals die Frage nach dem besten aller Regime gestellt und unterscheidet nur zwischen »Ordnung« und »Unordnung«, zhi-luan, dem guten und dem schlechten Fürsten. Ist es nicht bemerkenswert, dass das kaiserliche Amt selber während des gesamten Reiches nie Gegenstand irgendeiner institutionellen Untersuchung war, ganz abgesehen davon, dass nie zwischen seinen verschiedenen Seiten unterschieden wurde? China hat jedoch gleichzeitig unentwegt über die Macht, ihre Effizienz und den Umgang mit ihr nachgedacht und hat sie auch schon sehr früh von der religiösen Sphäre getrennt: China ist kein Gottesstaat. Das bringt mich dazu, präziser zu fragen: Was verhindert in China die Modellisierung des Politischen, und welche andere Logik hat man ihr in Bezug auf die Regulierung der gesellschaftlichen Beziehungen vorgezogen? Auch wenn China heutzutage eine Verfassung angenommen hat und sogar begonnen hat, Institutionen zu bilden, wobei dies unter westlichem Einfluss und Druck geschah, bleibt diese Frage bestehen – trotz der uniformen Oberfläche.
In China galt zu allen Zeiten das Sprichwort: »Im Himmel gibt es keine zwei Sonnen, auf Erden gibt es keine zwei Fürsten: Oben kann es auch keine zwei Wesen geben, denen auf die gleiche Weise gehuldigt wird« (liji, fang ji). Dass China nicht aus diesem einheitlichen und hierarchischen System herausgetreten ist, kann nur verstehen, wer sich das Übergewicht der familiären Strukturen vergegenwärtigt. Anstatt dass die Entwicklung der archaischen Gesellschaft wie in Griechenland zur Entstehung von neuen, spezifischen Strukturen führt, die sich von der Privatsphäre und den verwandtschaftlichen Beziehungen lösen, ist es in China die Vaterfunktion, die sich so ausgedehnt hat, dass sie mit ihrer Autorität die gesamte Gemeinschaft überzogen hat. Auch die eigentlich politischeren Strukturen, die mit der Gründung der monarchischen Ordnung einhergehen und Verwaltungs- und Regierungsaufgaben wahrnehmen, lösen sich trotzdem nicht von den gentilizistischen Beziehungen; die Machtbeziehungen sind vielmehr auf diesen verwandtschaftlichen Beziehungen aufgebaut. Dass der Fürst in China Vater des Volkes genannt wird, ist seither viel mehr als nur eine Metapher oder die Erinnerung an eine verblassende Tradition, denn durch den Schwund von Verzweigungen innerhalb der alten Strukturen wird, wie es Léon Vandermeersch beschrieben hat, ein einziges Individuum als Vater der Ethnie eingesetzt, als Erbe der Macht des Gründungsvaters, und zwar zuallererst auf der kulturellen Ebene. Aus diesem Umstand, dass alle Beziehungen auf ihn zentriert sind, kommen vorrangig die Betrachtungen über Rang und Hierarchie. Während in Griechenland die politische Institution nur dadurch ihre Macht behaupten konnte, dass sie sich von der Familienbeziehung löste, ist es im Gegenteil der nahtlose Übergang von der Familie zum Politischen, der dazu führt, dass man das Politische in China als Verlängerung der Strukturen betrachtet, die für naturgegeben gehalten werden. China musste also nicht spezifische Vorbilder hervorbringen, wie das geometrische Modell, das Kleisthenes eingerichtet hat; China musste überhaupt keine Modelle entwickeln, um das Politische herauszubilden. Aber warum hat China keinen Regierungsapparat (politeuma) im eigentlichen Sinne des Wortes herausgebildet, obwohl sich in China der Machtapparat mit der Entwicklung des Reiches früh ausgebildet hat und verbessert wurde? Kurz, ich denke, das kommt daher, dass die Chinesen sich auf eine andere Ressource verlassen haben als auf das Prinzip der Modellierung, und zwar auf das, was ich demgegenüber als Regulierung benannt habe. Da man dort annimmt, dass die gesellschaftlichen Beziehungen sich aus den natürlichen Beziehungen zwischen Menschen, das heißt, den Familienbeziehungen ableiten, müssen diese selber, um die gute Ordnung zwischen den Menschen zu gewährleisten, nur so gut wie möglich die spontane Veranlagung nachahmen, die in diesen Grundbeziehungen vorausgesetzt wird: Sie bieten einerseits Schutz, andererseits fordern sie Unterwerfung, wobei beide mit der emotionalen Neigung zusammenhängen, die »Wohlwollen« oder »Respekt« hervorbringt. Wenn diese Polarität zwischen oben und unten ohne Abweichung voll funktioniert, wird das harmonische »Gleichgewicht« gewahrt (dafür steht der Begriff zhong). Überflüssig und sogar gefährlich wäre die zwingende Wirkung eines (künstlich aufgesetzten) Regierungsapparats. Oder das Zwangssystem ist so beschaffen, dass die Unterwerfung sich von selber davon ableiten lässt, wobei sich die reziproke Konstellation zwischen Regierenden und Regierten in diesem Fall in ein eindeutiges Dispositiv des Gehorsams verwandeln würde (die Vertreter dieser Position werden bei den Autoritaristen fälschlicherweise »Legisten« genannt): Unterdrückt Ihr das Volk irregulär und ungleich, so wird es aufbegehren; wenn es aber ständig und extrem unterdrückt wird, betrachtet es diese Unterdrückung als natürlich, wie es der Tod in der Natur ist. Gegenüber dem Ideal der Freiheit, das die Formen des Politischen in Griechenland begünstigen, steht somit in China die Fähigkeit, sponte sua politische Beziehungen zu stiften, die den verwandtschaftlichen Beziehungen nachempfunden sind (auf der konfuzianischen Seite), oder sie gründen sich auf alleinige Beweggründe, die genauso verankert sind, die der Angst und des Nutzens (auf der Seite der Legisten). In beiden Fällen herrscht der Fürst umso uneingeschränkter, je mehr er diese natürlichen Regulierungen walten lässt und nicht mehr eingreifen und sich einmischen muss. Wenn man jedoch die Freiheit gestalten kann und wenn sie zu ihrer Einrichtung Institutionen erfordert, die man immer wieder verbessert, dann ist das Spontane im Sinne des sponte sua, das ihr gegenübersteht, etwas, das sich grundsätzlich einer Modellisierung entzieht. Erinnern wir uns doch an diese lapidare Antwort des Konfuzius, als man ihn über die Kunst des Regierens befragte: »… der Fürst muss Fürst sein, der Vasall muss ein Vasall sein, der Vater muss ein Vater sein, der Sohn ein Sohn« (Gespräche, XII, 11). Diese Formel reicht als politische Vorschrift aus, beziehungsweise diese Tautologie besagt alles: Nicht nur dass die politischen Beziehungen auf die Familienbeziehungen ausgelegt sind, sondern die Ausübung der Macht darf nicht über die gegenseitigen und hierarchischen Beziehungen hinausgehen, zu denen die Mitglieder der Familie natürlich neigen.
III DAS GESETZ – DER RITUS
Diese beiden Logiken, die man als konträre nachvollziehen muss, und zwar einerseits als Modellbildung und andrerseits als Regulierung, finden ihren symmetrischen Ausdruck in zwei Arten der gesellschaftlichen Strukturierung: Die Gesetze bei den Griechen (nomoi) und das, was wir als »Riten« (li) bei den Chinesen übersetzen. Die Tatsache, dass unser Begriff Ritus so wenig geeignet ist, den chinesischen Begriff zu übertragen, wir aber in den europäischen Sprachen über keinen anderen Begriff verfügen, um dessen Tragweite auszudrücken, und dass wir daher seit Jahrhunderten, also seit der Zeit, als die ersten Missionare nach China gegangen sind, diese zweifelhafte Entsprechung verwenden, sollte uns schon zu denken geben. Diese chinesische Vorstellung will sich einfach nicht in die Kategorisierungen und Abtrennungen einfügen, aus denen das Ideal und die Freiheit hervorgehen, und aus denen sich die europäische Kultur herausgebildet hat.
Montesquieu hatte im Geist der Gesetze (L’Esprit des Lois, XIX, 16) bereits angenommen, dass diese Konstellation am eindeutigsten mit dem bricht, was »Europa« darstellt: »Die Gesetzgeber in China gingen noch weiter: Sie warfen Religion, Gesetze, Sitten und Gebräuche zusammen; das alles zusammen ergab das Sittengesetz, die Tugend. Die Vorschriften über diese vier Pfeiler bildeten die sogenannten Riten.« »Verworrenheit«, sagt man dazu in Europa. Aber warum sind diese Begriffe getrennt worden, würde man von China aus entgegnen, und zwar insbesondere das Absolute des Religiösen vom Empirischen und Vertrauten der Sitten oder Gebräuche? Warum gehen diese nicht in die Verlängerung kultureller Praktiken ein? Warum kann der Respekt, der sich im menschlichen Umgang zeigt, sich nicht zu einer Huldigung der Weltordnung vertiefen? Warum hat man denn einen Bruch eingeführt, wenn nicht aufgrund einer abendländischen Schizophrenie, die das Ideale vom Alltäglichen trennt und innerhalb dessen noch einmal trennt und das dann im Verhalten als ein Ganzes wahrnimmt, das von der Einhaltung der Vorschriften im Tempel der Ahnen bis zur Höflichkeit in der Gesellschaft reicht? Die »gewissenhafte Aufmerksamkeit« (jing), die man in jeder Lebenslage einhalten soll, ist von derselben Art. Oder was sagt der Begriff der Konfusion hier ex negativo über eine Nicht-Aufspaltung des Verhaltens aus, die die Religion mit den »Manieren« verbindet, und deren Schwerpunkt sich eher dem aus der Mode gekommenen Begriff des »Anstands« annähert? Noch einmal sei Montesquieu zitiert: »So gaben sie (die Chinesen) den Anstandsregeln den weitesten Spielraum.« Jedoch: »Die Höflichkeit schmeichelt den Lastern der anderen, der Anstand aber hindert uns, unsere eigenen Fehler an den Tag zu bringen« (ibid.): In diesem Letzten liegt also tatsächlich der Ursprung der Moralität. China ist also dieser zivilisatorische Zusammenhang, der am besten von außen verdeutlichen kann, was der Begriff Gesetz in seinem Verhältnis zum Idealen, wie es Europa entwickelt hat, an Seltsamem und Erfinderischem enthält. China lässt umso deutlicher dieses griechische Dreieck hervortreten, das Plato als Erster definiert hat, indem er diese drei Aspekte miteinander verband: Die Formen des Politischen, die von den Verfassungen, der Gerechtigkeit und den Gesetzen dargestellt werden. Oder vielmehr, es sind die Gesetze, die zwischen den Formen der Macht und der Form der Gerechtigkeit an sich vermitteln müssen. Denn einerseits gibt es so viele Formen, eide, die den Gesetzen eigen sind wie es Formen politischer Regimes gibt (eide tôn politeiôn): Die Gesetze verschmelzen mit den unterschiedlichen Verfassungen und sie sind ihr Ausdruck (Vom Geist der Gesetze, 714 b). Wenn andererseits unsere Diskussion über die Gesetze »von höchster Wichtigkeit« ist, dann liegt es daran, weil sie uns veranlasst zu suchen, von welcher Seite aus sie »die Gerechtigkeit und die Ungerechtigkeit betrachten müssen«; diese sind mehr als ein Kriterium, sie errichten daraus das Ideal. Während die Gesetze die Formen sind, gemäß derer das Notwendige gedacht wird, sind Riten Formen, durch die man eine Anpassung an eine Situation erforscht. Jene »wendet man« durch eine abgestimmte Entscheidung im Rahmen einer vorgegebenen Zugehörigkeit zur Bürgerschaft an, während diese die Sitten nach und nach, und ohne dass man darüber nachdenkt, »durchtränken«. Auch und im Gegensatz zu dem Gesetz, das ausgesprochen und erlassen wird, über das man diskutiert, dem man folgt oder nicht, und das folglich ein Seinsollen auf Distanz (das kritisiert werden kann) begründet, beziehen Riten, weil sie allmählich und unbemerkt verinnerlicht werden, ihren Wert daraus, dass sie, indem sie über eine fortschreitende Annäherung gehen, auch ohne dass man diese bemerkt, geringstmöglichen Bruch oder Hinterfragung erzeugen. Die Gesetze beziehen sich auf Handlungen (durch die man sich verpflichtet, und die man für freiwillig ausgibt), die Riten beziehen sich auf Verhaltenweisen, an die man sich anpassen muss. Während das Gesetz befiehlt, indem es sich auf ein Seinsollen beruft, prädisponiert der Ritus gewissermaßen gemäß der normierten Form und nicht durch Gehorsam ihm gegenüber, sondern nach Maßgabe seiner Anpassungsfähigkeit. Das richtige Maß jeder Gebärde, der kleinsten Bewegung, der geringsten Haltung, wie auch aller Faktoren, die eine Polarität darstellen, sind yin und yang, die die Welt bilden: In der Tat verbindet der Sinn der Riten beide nicht nur analogisierend, sondern er führt dazu, dass man jede Wirklichkeit als einen laufenden Prozess ansieht, ob dieser sich im Himmel vollzieht oder im Verhalten (tian-xing/ ren-xing); die einzige Forderung besteht darin, dass er nicht abweicht. Die Riten sind die Normen für dieses Nichtabweichen. Sie sind es eher als die »Regeln«, auch wenn deren Aufstellung sehr genau, ja sehr minutiös sein kann, um diese Vielfalt abzudecken (qu li). Es handelt sich hier, um es noch einmal zu sagen, um dieselbe und konstante Regulierung der Gegensätze, verstanden als Fähigkeit, durch die Verwandlung hindurch das Gleichgewicht zu bewahren, wie auch immer die jeweilige Situation beschaffen ist.
Frage: Ist das (europäische) politische Ideal eine ausgeschöpfte Ressource?
Man kommt nicht umhin, sich diese Frage in einer Zeit zu stellen, in der die politische Einigung Europas sich so schwer tut, was man an der unmöglich gewordenen Präambel seiner begrabenen Verfassung sehen kann. Was hat denn maßgeblich zu der geistigen, aber auch kulturellen Dynamik Europas beigetragen, wenn nicht schlussendlich das, was man bei Plato als ideale Begrifflichkeit vorfindet, in deren Schatten sich unser Denken, aber auch unser Leben, unsere Hoffnung, unsere Kämpfe, unsere Arbeit seither vollzogen haben? »Wir«, das ist eben dieses europäische »Wir«, das jetzt, wo es plötzlich näher rückt, sich in ihm mustert und wiedererkennt. Das sind das Wahre, das Gerechte, das Schöne, aufgestellt wie bei einer Parade. Welche zivilisatorische, kanalisierende Wirkung haben denn diese Ideale erzeugt, die von Plato aufgestellt worden sind, und zwar nicht in Gestalt von versteinerten Hypostasen, sondern aus der Erregung ihrer Entdeckung sowie ihrer Erfindung heraus? Man merkt, dass Plato von dieser Möglichkeit, die er eröffnet, selbst fasziniert ist. Diese Ideale haben jeweils das Streben der Wissenschaft, der Politik oder der Kunst beflügelt. Sie haben auch nur in diesem Abhängigkeitsverhältnis ihre Legitimität gefunden. In Europa haben sich diese Ideale in verschiedene Bereiche getrennt; gleichzeitig haben sie sich gemäß diesem einzigen Einheitskonzept definiert, das für jeden Bereich dessen Ziel formuliert und dieses zum Schicksal hypostasiert. Auf Grundlage dieser Ideale ist »Europa« seither entstanden, wobei »Schicksal« hier eine eigenartige Entfaltung in der Geschichte meint, die in dem Moment, in dem sie zusammenfassend erkennbar wird, schließlich das Ausmaß ihres Fremdseins erfasst. Dass das Denken in Idealen gerade dazu geführt hat, das Politische als eigenständiges und unabhängiges System zu isolieren, indem es dieses von den natürlichen Regulierungen und Abläufen getrennt hat, kommt daher, dass es angefangen hat, das Gerechte als Wesenheit zu begreifen, um das gemeinschaftliche Zusammenleben auf der ausschließlichen Grundlage dieses Verständnisses zu denken. Wie viel Wagemut bedarf es, räumt Plato ein, um eine so radikale Trennung von der bestehenden (natürlichen) Ordnung zu vollziehen … anstatt von dieser auszugehen, sie zu verbessern oder zu versuchen, die Unordnung zu »reparieren«, indem die Regulierung verstärkt wird, wie man es immer in China gemacht hat, ohne die Herrschaft des Fürsten von der dem Himmel und der Natur eigenen »Harmonie« zu trennen. Aber aufgrund der Tatsache, dass er sich nicht auf diese andere Welt stützen konnte, um die diesseitige zu kritisieren und neu zu gestalten, ist der chinesische Gelehrte immer im Schatten des Fürsten geblieben, ohne mit ihm in Streit zu geraten; er ist nie ein »Intellektueller« geworden. Gegenüber der Macht ist er immer schutzlos geblieben und konnte nur sein »Klagelied« oder seinen »Protest« gegen die Verderbtheit und das Elend seiner Zeit erheben. Er hat keine andere Ordnungsvorstellung dagegenstellen können, die tatsächlich einen Bruch in der Geschichte hätte bewirken können und deren Perfektion er anschließend nur noch konsequent innerhalb der Gesellschaft hätte nachahmen müssen. Dass man Plato aufgrund der von ihm vertretenen Gedanken als reaktionär ansieht, ändert nichts an der Tatsache, dass er derjenige war, der durch seine Vorgehensweise die theoretische Möglichkeit von Revolution überhaupt freigesetzt hat. Revolution meint hier nicht nur den Sturz der etablierten Macht und ihre Ablösung durch eine bessere Macht, wie man es immer wieder vielerorts und zu jeder Zeit in der Welt unter dem Gewicht des Unerträglichen unternommen hat, sondern sie meint tatsächlich die Einführung und Vervielfältigung einer Form (des Seinsollens) in die Geschichte, die man a priori festgelegt hat. Es vollzieht sich jedoch heutzutage von verschiedenen Seiten her eine lautlose Veränderung, die das an uns weitergegebene große zivilisatorische Gefüge untergräbt. Rührt die Krise Europas, die in erster Linie ideologischer Art ist, nicht daher, dass sich Europa mehr oder weniger unbemerkt von diesen »eindeutigen Modellen« gelöst hat, mit denen es gearbeitet hat und die es so lange getragen haben? Ist es nicht das, dessen Europa müde, oder, um es etwas klinischer zu sagen, überdrüssig ist? Der Überdruss (an einer Zivilisation) rührt für Europa daher, dass die Spannung des Ideals nachgelassen hat; man könnte auch sagen, sie rührt daher, dass Europa ihm misstraut, ohne zu wissen wie es das Ideal ersetzen soll oder will: Es bringt diese Spannung nicht mehr auf. Ist es denn, insbesondere in der Politik, noch die Gerechtigkeit, die, ungeachtet ihres Weiterbestehens in konventionellen Diskursen, die Vorstellungen von der Zukunft leitet? Ist es nicht vielmehr, und zwar ohne dass man es sich eingesteht, ohne dass man es analysiert, das Streben nach umfassender Regulierung, das sich darauf beschränkt, Konsens zu erzeugen? Gibt es für uns Europäer überhaupt noch eine Vorstellung von der Zukunft, wenn jede Aussicht auf Erlösung oder auf Revolution schwindet? Das Wahre selbst herrscht nicht mehr unangefochten, auch nicht in seinem ureigensten Reich, der Wissenschaft, bei der man schonungslos die Schattenseite ihres Mythos aufdeckt hat, dass sie viel magischer, umständlicher und mühseliger vorgegangen ist. Sicher nimmt die Modellisierung (samt ihrer Mathematisierung) heutzutage eine dominierende, um nicht zu sagen eine hypertrophische Stellung ein, aber diese beschränkt sich auf das reine, funktionelle und gebietsweise Verwalten. Dieser Gedanke eines Modells trägt global nicht mehr, er ist nicht mehr imstande, einen Plan für die Menschheit zu entwerfen. Unsicher über sich selbst geworden von dem Moment an, in dem es nicht mehr an diese Ideale angebunden ist, die es getragen haben, blickt Europa in jüngster Zeit verstärkt auf Denkweisen, die von woanders herkommen. Das Phänomen gehört zu dieser Generation; es wirkt durch unauffällige Risse, die jeden Tag tiefer werden, und die nach und nach das Ideal zerfasern. Da dieser Wandel sich nicht durch Diskurse, Konstruktion und Überzeugung vollzieht, wie innerhalb des Logos zu erwarten wäre, tun wir uns schwer, diesen diffusen und allgegenwärtigen Einfluss zu erfassen, der alles durchdringt und sich unauffällig verzweigt. Erst jetzt beginnen wir, dessen Ergebnis zu bemerken. Denn da Europa nicht mehr das Gewicht dieses Strebens nach Idealen auf sich nimmt, das es in Gang gehalten hat – oder dass es dieses Streben als illusionär verdächtigt und als zu kostspielig betrachtet, weil es dazu zwingt, zu abstrahieren und die Erfahrung zu opfern –, hofft Europa, seine Versöhnung in dem zu finden, was es gerne als seine Kehrseite betrachtet: ein kompensierender »Orient«, der diese aufwendigen Dualismen auflösen würde. Dem großen Theater einer Offenbarungsrevolution stellt sich so eine Regulierung entgegen, die eine kontinuierliche Entfaltung fördert, ohne das Vertrauen aufzubrauchen. Was man heutzutage unter der Überschrift »persönliche Entfaltung« verkauft und was die Buchhandlungen füllt, wobei Philosophie auf gefällige Portionen reduziert ist, speist sich aus einem solchen Rückfluss; es fördert stillschweigend seine Vermarktung. Es ist nicht Gegenstand einer abgestimmten Entscheidung, sondern ordnet sich unauffällig diesem Richtungswechsel zu: »zen leben«, als Marketing-Formel, das ist eben das Gegenteil des Ideals. Es handelt sich hier jedoch um viel mehr als nur um einen Wandel oder um eine Umkehrung der Werte: Indem es sich vom Ideal löst, wendet sich Europa von dem ab, worauf sich seine Entwicklung gestützt hat oder zumindest wendet es sich von dem ab, was ihm Vertrauen in dieses Ideal gegeben hat. Es wendet sich von dem ab, an was es geglaubt hat. Gegenüber dem, was sich zu unauffällig in der europäischen Ideologie auflöst, um analysiert zu werden, sollte man jetzt gleichzeitig zwei Dinge tun: Man sollte den Begriff des Ideals aus der Standardisierung lösen, die es weltweit durch die geistige Vorherrschaft des Abendlandes erhalten hat, die jedoch gleichzeitig zu seinem Schwinden beiträgt, um erneut das erscheinen zu lassen, was es eigentlich bedeutet, und um zu begreifen, unter welchen besonderen Umständen es aus dem Denken entstehen musste. Gleichzeitig sollte man die Bilanz daraus ziehen, was durch diese Erfindung des Ideals ermöglicht worden ist, und was darin fruchtbar ist. Denn es geht nicht mehr darum, kulturelle Identitäten zu schaffen, die nunmehr aufgrund des weltweiten Austausches und der Kommunikation künstlich geworden sind, sondern es geht darum, Ressourcen ausfindig zu machen. Wir können nicht mehr die Konstruktion der Idealität als Notwendigkeit eines Denkens erfassen, das die unweigerliche Zukunft der ganzen Menschheit aufspürt. Europa muss sich fortan als besonderen, der Konkurrenz ausgesetzten »Fundus« betrachten. Damit ist überhaupt nicht gesagt, dass das (politische) Ideal ausgeschöpft wäre, dass es seinen Erfindungsreichtum eingebüßt hätte.
China und Europa – das politische Denken Europas von China aus neu denken, durch einen »Ortswechsel des Denkens« ins Fremde die Fundamente des europäischen politischen Ideals freilegen, die sonst dem eigenen Denken verborgen bleiben. Zu dieser Denkbewegung lädt uns der französische Philosoph und Sinologe François Jullien ein. Europa sieht sich heute durch China vielfältig herausgefordert – als politisch schwergewichtiger Systemgegner und wirtschaftlicher Konkurrent, aber auch als attraktiver Wachstumsmarkt und Produktionsstandort. Die Bilder, in denen wir diese Gegenüberstellung wahrnehmen, rahmen und einordnen, sind meist geprägt von europäischen Interessen – und wie sollten sie auch nicht? François Jullien stößt durch diese von der Tagesaktualität bestimmten Wahrnehmungen vor zu grundlegenderen Fragen. So grundlegend, dass er am Ende auch die Frage stellt, ob das europäische politische Ideal eine ausgeschöpfte Ressource ist. Das kommt darauf an, würde ich meinen, wie wir dieses Ideal konstruieren und gegenüber dem ihm Fremden konturieren: ob als ideale Gerechtigkeit der Intellektuellen, der Elite oder einer Avantgarde, wie man das politische Ideal im Anschluss an Plato rekonstruieren könnte, oder als politische Bürgergesellschaft, die ich in der Tradition von Aristoteles und Hannah Arendt als Hort von Mitte und Maß, von Kontroverse und Konsens, der Idealwelt der intellektuellen und politischen Avantgarden gegenüberstellen würde. »Der Sinn von Politik ist Freiheit.« Hannah Arendts Diktum, an das der heute zu vergebende Preis erinnern soll, ist Ausdruck eines riskanten und radikalen politischen Denkens. Wenn wir im herkömmlichen Sinn von Politik sprechen, dann meinen wir damit den Erwerb und Erhalt von Macht, die Herstellung bindender Entscheidungen und ihre Durchsetzung als Gesetz. Vielleicht denken wir auch an das Streben nach Ruhm und Ehre. Und vielleicht auch an Selbstbestimmung. Aber wir denken nicht in erster Linie an Freiheit. Hannah Arendts politisches Denken nimmt seinen Ausgang beim Unerhörten der Schrecken des 20. Jahrhunderts, beim Zeitalter der Extreme, es durchdringt den Totalitarismus und die innige Beziehung von Macht und Gewalt aus der Perspektive von Politik als Polis. Die Polis stellt als Vergemeinschaftung vieler selbst einen Zweck in sich dar. In ihr steigern die Einzelnen ihre Entfaltungsmöglichkeiten und erkennen in ihrem politischen Handeln einen neuen Sinn ihres individuellen Lebens. Diese Gemeinschaft unterscheidet sich von natürlichen Gemeinschaften wie Familie oder Stamm grundlegend. In ihr können sich auch einander fremde Individuen zusammenschließen. Dazu müssen sie zu außerordentlichen Anstrengungen bereit sein. Sie müssen, weil sie einander fremd sind, zueinander in ein Verhältnis der Wechselseitigkeit, der wechselseitigen Anerkennung treten. Das ist nur im Medium der Freiheit möglich, nicht durch Befehl und Gehorsam, nicht von natürlicher Abhängigkeit. Das ist nur möglich in der wechselseitigen Anerkennung als Gleiche. Hannah Arendts Republikanismus mutet uns antik an. Die politische Vergemeinschaftung, die sie denkt und von der aus sie denkt, scheint nicht recht vereinbar zu sein mit unserem modernen Verständnis von staatlicher Vergemeinschaftung und der Freiheit, die erst durch Begrenzung der staatlichen Gewalt – etwa durch eine Verfassung – gesichert werden muss. Neben dieser negativen Freiheit, an die wir immer zuerst denken, gibt es aber auch die positive Freiheit: seine Meinung frei zu äußern, seinen Glauben zu bekennen, den eigensinnigen Logiken von Kunst und Wissenschaft öffentlich nachzugehen, sich mit anderen zu assoziieren und zu versammeln. Hier kommen Freiheitsrechte zur Sprache, die nur in Gesellschaft mit anderen ausgeübt werden können. Hier kommt so etwas wie eine politische Vergemeinschaftung der Freien und Gleichen zum Vorschein, auf die staatliche Institutionen in einer lebendigen Demokratie in höchstem Maße angewiesen sind. Fallen rechtsstaatlich zustande gekommene demokratische Entscheidungen im Parlament und das politische Gemeinwesen auseinander, so fehlt diesen Entscheidungen die Legitimität. Das erleben wir derzeit bei den Protesten in Stuttgart und anderswo, die ja nicht egoistische Interessen durchsetzen, sondern ein anderes politisches Gemeinwesen erstreiten wollen. Ist es übertrieben, in diesen Protesten den Versuch der republikanischen Wiederaneignung der repräsentativen parlamentarischen Demokratie und rechtsstaatlicher Verfahren zu sehen? Hannah Arendts Republikanismus hat uns die demokratischen Revolutionen in Europa von 1989 als Folge von Freiheitsbewegungen verstehen lassen. Das Ende der Geschichte haben diese Revolutionen gleichwohl nicht eingeläutet. Weder wurde der Systemwettbewerb mit den unvollkommenen Demokratien und autokratischen Regimen in der Folge zugunsten der Demokratie entschieden. »Freedom in Retreat: Is the Tide Turning?«, überschrieb Freedom House seinen Bericht über das Jahr 2007. Noch haben die liberalen Demokratien an Festigkeit gewonnen, weil ihrem politischen Betrieb, der sich mehr und mehr auf politische Märkte und Kunden statt auf ein politisches Gemeinwesen bezieht, Legitimitätsressourcen verloren gegangen sind. Es ist zu hoffen, dass die Bürgerproteste in Stuttgart nicht die Krise der Demokratie, sondern ihre Erneuerung anzeigen. Lässt die Entstehung einer breiten sowohl gebildeten wie wirtschaftlich erfolgreichen chinesischen Mittelschicht auch auf die Entwicklung einer lebendigen politischen Bürgergesellschaft in China hoffen? In der chinesischen Bürgerrechtsbewegung können wir vielleicht erste Anzeichen dafür erkennen. Ist die Mitte der Bürgergesellschaft schwach, kommt das den Avantgarden – ob als Einparteiensystemen oder politisierenden Intellektuellen – zugute. Damit haben die Europäer im 20. Jahrhundert keine guten Erfahrungen gemacht, und Hannah Arendt hat daraus für ihr politisches Denken bis heute aktuelle Schlüsse gezogen. Ich bin gespannt, zu welchen Schlüssen uns die Denkbewegung führen wird, zu der uns François Jullien einlädt.
Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Jahr darf ich zum vierten Mal an der Verleihung des Hannah-Arendt-Preises mitwirken. Ich möchte Sie im Namen des Senats ganz herzlich in der schönen oberen Halle unseres historischen Rathauses begrüßen. Der Hannah-Arendt-Preis ist ein Preis für politisches Denken, er ist ein akademischer Preis und ein öffentlicher Preis. Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken wurde 1994 ins Leben gerufen und 1995 zum ersten Mal verliehen. Den Preis stiften der Senat der Freien Hansestadt Bremen gemeinsam mit der Heinrich- Böll-Stiftung. Die Preisträger werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt, auf die kein Einfluss genommen wird, und anschließend gemeinsam von den Preisgebern Senat und Heinrich-Böll-Stiftung verliehen. Diese Form der Preisvergabe an sich ist bereits ein Ausdruck für politisches Denken, das sich nicht instrumentalisieren lassen will. Hannah Arendt wird in diesem Preis als herausragende Denkerin des 20. Jahrhunderts gewürdigt, die uns ein Vorbild in ihrer Unabhängigkeit von Ideologien und vorgegebenen Denkstrukturen ist. Bei der Preisverleihung im Dezember 2009 war Kurt Flasch der Preisträger. Ein Philosophiehistoriker, der in seinem Buch Kampfplätze der Philosophie dargelegt hatte, wie viele der heute als gegeben hingenommenen Wahrheiten der Philosophie, die scheinbar ruhige, abgeklärte und kontemplative Philosophie, ihren Ursprung in heftigen Auseinandersetzungen ihrer Zeit gefunden haben. Dieser Preis ist auch Ausdruck des Versuchs, politisches Denken jenseits von Parteipolitik selbst zum Gegenstand des Diskurses einer interessierten Öffentlichkeit zu machen. Der allgemeinen »Politikverdrossenheit«, die in den Medien beklagt wird, wollen wir mit diesem Preis den Wert von Politik, die auf Denken beruht und des Denkens, das auf sein Umfeld rekurriert, entgegensetzen. Hier finden wir den Ansatz von Hannah Arendts Denken abseits der Links-rechts-Polarisierung des akademischen Denkens. Damit wird auch die Meinung infrage gestellt, dass Werte absolut gesetzt werden können und universelle Allgemeingültigkeit besitzen. Der Ansatz weist auf die Relativität des eigenen Denkgebäudes hin, die uns in diesem Denkansatz gewahr wird. Dies ist ein politisches Denken, das sich bewusst ist, dass es eine Begrenztheit der eigenen Denkprozesse gibt. Denken findet statt vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Kontextes, der eigenen Geschichte und der eigenen Lebenswelt. Es ist geprägt von dem eigenen Geschlecht und Alter, sozialer Situation und Umfeld. Dieses Jahr hat die Jury des HannahArendt-Preises einen Denker als Preisträger ausgewählt, der von einem noch viel entfernteren Ort einen Blick auf unsere Denkgewohnheiten wirft. Die gesamte Philosophie, die Werte, auf der unsere europäische, westliche Gesellschaft beruht, haben ihren Ursprung in der griechischen Philosophie und Sprache. Durch die Entfernung von den Ursprüngen der gewohnten Denkmuster in eine von den griechischen Wurzeln freie Denk- und Sprachentwicklung, nach China, nähert sich François Jullien auf ungewohnte Weise dem europäischen Denken. China ist derzeit hauptsächlich als aufstrebende Weltwirtschaftsmacht mit großen Geldreserven und einem geradezu beängstigenden Appetit, einem beunruhigenden wirtschaftlichen Engagement auch in Europa in der Öffentlichkeit präsent. Lange schon hat sich China davon verabschiedet für das Ausland nur ein großer Exportmarkt zu sein oder für das Ausland billige Massenproduktion zu übernehmen. Auch vor dem Hintergrund der jüngeren politischen Ereignisse wie dem Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die studentischen Proteste oder der Haltung in Menschrechtsfragen oder dem Umgang mit Tibet ist es umso wichtiger, sich in das chinesische Denken hineinzubegeben, allerdings meine ich, ohne Relativierung der eigenen Werte, der eigenen Gewissheiten und Denkstrukturen aber wohl. So hilft uns der Preisträger zu verstehen, dass die Dualität westlichen Denkens nicht alternativlos ist. Der bei uns lange vorherrschende Glaube an die Allmacht des technischen Fortschrittes findet ausgerechnet im modernen China nicht nur die Karikatur, wie wir sie gerne sehen wollen, sondern wird durch eine andere Denktradition neuen Brüchen zugeführt. Wir bekommen einen Spiegel vorgehalten, in dem unserem eigenen Zweck-, Mittel- und Ziel-Denken chinesisches Denken als andere Möglichkeit gegenübergestellt wird. Wir wissen zwar, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings die Welt verändern kann, aber eben nicht welcher und wann. Jeder kennt die großen Strategen und Paranoiker, die ernsthaft glauben, genau zu wissen, welches Schräubchen gedreht werden muss oder gedreht wurde, um definierte Folgen zu erzeugen. Die Preisverleihung ist wieder eine Herausforderung für den Kopf. Der politische, philosophische Diskurs in Europa ist von den Ideen Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenrechte nicht zu trennen. Jullien fordert uns auf, einen von unserer gedanklichen Herkunft unbelasteten Blick auf China zu werfen. Es soll hier jemand sagen, dass das leicht ist. Danke an die Jury für die Auswahl. Es tut Bremen gut, dass Sie helfen, nicht im politischen Pragmatismus zu ersticken. Ihnen, Herr Jullien, meinen ganz herzlichen Glückwunsch und uns allen noch einen spannenden Abend.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz