
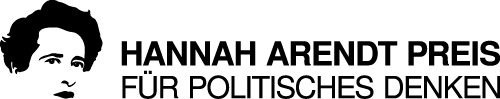

Navid Kermani, deutsch-iranischer Journalist, Autor und Orientalist, lebt in Köln

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.
Wir vom Vorstandsteam des Vereins »Hannah-Arendt-Preis für Politisches Denken«, Antonia Grunenberg, Peter Rüdel und ich, wir freuen uns sehr, Sie heute an diesem adventlichen Abend zur Verleihung dieses Preises an Navid Kermani begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Eva Senghaas-Knobloch; mir kommt heute Abend die Aufgabe zu, Sie durch unser Programm zu führen. Gefunden wird der jährliche Preisträger des Hannah-Arendt-Preises durch eine internationale Jury, deren Begründung heute unser Jurymitglied Marie Luise Knott darlegen wird. Das Preisgeld für den Hannah-ArendtPreis wird großzügiger- und dankenswerterweise jährlich vom Senat der Freien Hansestadt Bremen und der HeinrichBöll-Stiftung gestiftet. Wir sind glücklich, dass wir die Preisverleihung heute wiederum hier, in unseren wunderschönen Rathausräumen vornehmen können, besonderen Dank dafür an Sie, Frau Bürgermeisterin Linnert. Vielen Dank auch an Sie und Herrn Poltermann von der Heinrich-Böll-Stiftung, dass Sie für die Preisgeber zu uns sprechen werden. Ganz besonders möchte ich auch Frau Dr. Isolde Charim begrüßen, wir sind glücklich, dass wir Sie heute für die Laudatio unseres Preisträgers gewinnen konnten. Sie sind Wienerin, Philosophin und Publizistin, lehren an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien und sind als freie Publizistin in Österreich und Deutschland tätig; vielen sind Sie bekannt als taz-Kolumnistin und einigen als wissenschaftliche Kuratorin der Reihe »Diaspora – Erkundungen eines Lebensmodells« sowie der Reihe »Demokratie reloaded« am Kreisky Forum in Wien. Vielen Dank, Frau Charim, dass Sie den weiten Weg aus Wien nach Bremen gefunden haben. Wir werden Sie auch morgen während unseres Colloquiums bei uns haben, das wir wie jedes Jahr am Tag nach der Preisverleihung mit unserem Preisträger und allen Interessierten zum besseren Kennenlernen und zur Diskussion seiner Gedankengänge durchführen; das Colloquium steht dieses Jahr unter dem Thema des islamischen Erbes in den europäischen Ländern und findet nun schon traditionell im Institut Français statt, so auch morgen zwischen 10 und 13 Uhr. Allen, die zum Colloquium beitragen, das von Antonia Grunenberg moderiert werden wird, möchte ich schon an dieser Stelle unseren besonderen Dank aussprechen. Meine Damen und Herren: HannahArendt steht für ein politisches Denken, das sich den Herausforderungen der Zeit stellt. Arendts Erkenntnisse über totalitäre Herrschaft, ihre Einsichten zum Verhältnis von Macht und Gewalt und zur republikanischen Freiheit verdanken wir den Bemühungen dieser Philosophin, auch die dunklen Seiten der politischen Moderne auszuleuchten. Die historischbiografischen Arbeiten Hannah Arendts haben unser kulturelles Wissen von Identität und Selbst bereichert. Unser Verständnis der Freiheitsrevolutionen der letzten Jahrzehnte von 1989 bis 2011 und der ihnen eigenen Herausforderungen gewinnt durch die Schlüsselkategorien des Denkens von Hannah Arendt an Tiefe. Den Preisgründern aus Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit liegt seit der ersten Preisverleihung 1995, seinerzeit an die ungarische Philosophin Agnes Heller, daran, die Bedeutung des politischen Denkens von Hannah-Arendt für die Erneuerung republikanischer Freiheitspotenziale hervorzuheben und eben darüber zu befördern. Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken soll dazu ermutigen, Hannah Arendts handlungsnahes und ereignisoffenes Politikverständnis auch für gegenwärtige Diskurse in Politik und Gesellschaft fruchtbar zu machen. Daher werden Personen geehrt, die wie unser Preisträger auf die ihnen je eigene Weise das von Hannah Arendt so eindringlich beschriebene und von ihr selbst praktizierte »Wagnis Öffentlichkeit« angenommen haben. Meine Damen und Herren, als ich im letzten Jahr an dieser Stelle auf die keineswegs ausgestandene Krise der Finanzwelt hingewiesen hatte, zeichnete sich ab, dass wir am Ende des ersten Jahrzehnts des nicht mehr ganz neuen Jahrhunderts vor großen Herausforderungen stehen. Die Politik, die sich in den letzten Jahrzehnten in eine neoliberale Zwangsjacke manövrierte, musste erfahren, dass wir ohne politische Gestaltung der Rahmenbedingungen transnationaler Finanzaktivitäten den politischen Gestaltungsspielraum hierzulande so einschnüren, dass in der Folge eine Welt mit menschenunwürdigen sozialen Zerklüftungen geschaffen wird, die uns längst auch hierzulande in zerstörerischer Form einholen. Die verschiedenen vom Westen in Gang gesetzten Prozesse machen es heute unabweisbar nötig, dass wir uns mit Denkweisen in anderen, nichtwestlichen Kulturen befassen, insbesondere weil diese Denkweisen auch Europa selbst in vieler Hinsicht beeinflusst und bereichert haben, einst, aber auch heute. Europa kennt eine gute Tradition der Pluralität und – wie wir in der Friedensforschung sagen – der vielfältig sich überlappenden Loyalitäten oder – wie unser Preisträger so eindrucksvoll formuliert hat – »der sich nicht ausschließenden Identitäten«. Ein enthusiastischer Kölner zu sein und sich liebevoll um ein Haus in Isfahan zu bemühen, schließt sich keinesfalls aus, sondern stärkt sich wechselseitig. Unser heutiger Preisträger Navid Kermani wurde 1967 in Siegen geboren und lebt in Köln. Er studierte Orientalistik, Theaterwissenschaft und Philosophie in Deutschland und Ägypten. 1994 gründete er im Land seiner Eltern, dem Iran, ein Sprach- und Kulturzentrum in Isfahan, welches er bis 1997 leitete. Navid Kermani arbeitete am Wissenschaftskolleg Berlin, war Regisseur und Kurator am Schauspielhaus Köln und Stipendiat an der deutschen Akademie Villa Massimo in Rom. Seit 2009 ist er Senior Fellow des kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Navid Kermani erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise, unter anderem den Ernst-Bloch-Förderpreis (2000) und die Buber-Rosenzweig-Medaille (2011).
2009 wurde er mit dem Hessischen Kulturpreis geehrt, wobei eine heftige und schließlich heilsame Kontroverse über seine Äußerungen zur Kreuzestheologie ausgelöst wurde. Navid Kermani ist Mitglied der Deutschen Islamkonferenz und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Seine Schriften eröffnen Einblick in die kulturelle und politische Vielfalt des Orients, aber sie nehmen auch Stellung zu politischen Herausforderungen, vor denen Europa steht – und dies in einer Sprache, die gute Kräfte weckt und Möglichkeitsräume für politische Gemeinwesen eröffnet. Ich bitte nun Marie Luise Knott, Mitglied der Internationalen Jury, die diesjährige Preisverleihung an Navid Kermani zu begründen. Marie Luise Knott ist Politikwissenschaftlerin und Romanistin, war Chefredakteurin der deutschsprachigen Le Monde Diplomatique und ist seit Langem als Autorin bekannt. In diesem Jahr erschien ihr Band Verlernen. Denkwege bei Hannah Arendt. Im letzten Jahr gab sie den Briefwechsel von Hannah Arendt und Gershom Scholem heraus.
Die Offenheit des Auges
Es gibt eine Parallele, die unmittelbar ins Auge fällt, wenn man die Werke von Hannah Arendt und Navid Kermani betrachtet. Es handelt sich um ein Detail, könnte man meinen, aber eins, das im englischen Sinn ein »telling detail« ist. Hannah Arendt, die ihren Diderot gründlich gelesen hatte, sah in den Juden politisch schon früh ein entscheidendes europäisches Bindeglied. 1945, bei Kriegsende, hoffte sie auf ein Nachkriegseuropa ohne Nationalstaaten; stattdessen plädierte sie für eine Europäische Föderation, in der sie den Juden eine besondere, nationenübergreifende politische Wirkkraft beimaß. Ähnlich wie Arendt beharrt auch Navid Kermani auf der einigenden europäischen Kraft der Juden und der Muslime: »Die enthusiastischsten Europäer«, sagte er vor einigen Jahren auf dem Kongress Europa eine Seele geben, »... die enthusiastischsten Europäer findet man dort, wo Europa nicht selbstverständlich ist, in Osteuropa, auf dem Balkan oder in der Türkei, unter Juden und Muslimen«.
Kermani, der hierzulande gerne als »außereuropäische Stimme« zu Talkshows eingeladen wird, engagiert sich leidenschaftlich für Europa, für das alte und das neue Europa: »Wer von Menschen wie von einer Seuche spricht, hat Europa verraten, indem er es zu schützen vorgibt.« Dieser Ausspruch ist paradigmatisch für Kermanis Kunst, sich in die Widersprüche seiner Zeit hineinzubegeben. Die Themen, die andere eher umschiffen, weil sie sich leicht an ihnen in Rage reden, sind Kermani, so scheint es, in aller Ruhe die liebsten, sie sind seine wahren Herausforderungen an das Denken. Ich nenne nur einige wenige Themen: Mythos und Wirklichkeit der Heiligen Ursula und ihrer Jungfrauen, die Schönheit des Koran, die performative Kraft religiöser Rituale, die Gefahren des aktiven Nihilismus in der Politik, ebenso wie die Verehrung Attars oder die Kreuzesdarstellungen. Alles befragt Kermani neu, und es stellt sich heraus, dass seine Geschichten uns – Kennern wie Laien – ganz Neues zu sagen haben. Denn, und das ist es, was Kermanis Texte auszeichnet, sie sind »Reisen in die Verwirrung« (SZ), und zwar in eine zwiefache Verwirrung. Kermani lässt sich selbst verwirren von dem, was er liest, hört und empfindet, und gleichzeitig verwirrt er uns Leser – und unsere oft allzu eingefahrenen Erwartungen, in Orient und Okzident. Er verlässt sich nicht allein auf den Verstand, sondern auf alle seine Sinne und kultiviert eine Fähigkeit, die wir längst vergessen hatten: die Offenheit des Auges. Anders als der Verstand und anders als das Ohr hat das Auge nämlich keine Mühe, gleichzeitig Widersprüchliches aufzunehmen.
Offenheit des Auges – was das bedeutet, kann man an jedem von Navid Kermanis Texten studieren. Doch bevor ich darauf eingehe, möchte ich einen Freund von Hannah Arendt zu Wort kommen lassen, nämlich Walter Benjamin, der sich in der Offenheit des Auges zeitlebens besonders geschult hat. Benjamin schrieb in einem Brief an Grete Karplus über das Wagnis solchen Sehens: Wer versucht, die Weite zu behaupten, also wer sich die Freiheit nimmt, »Dinge und Gedanken, die als unvereinbar gelten, nebeneinander zu bewegen«, der lebt gefährlich. Kermanis Texte tun genau dies: Sie stellen nicht einfach Dinge, die als unvereinbar gelten, nebeneinander – das könnte auf Beliebigkeit hinauslaufen –, nein: seine Texte bewegen diese Dinge nebeneinander. Das ist Kermanis Kunst. Sein Denken hält Unvereinbares in Spannung. Und Benjamin wusste: So einer lebt gefährlich, 1930 ebenso wie 2011.
Einige Male schon hat Kermani die denkerische Gefahr, der er sich tagtäglich an seinem Schreibtisch aussetzt, auch im Öffentlichen zu spüren bekommen. Unter der äußerst christlich konnotierten, jedoch häretischen Überschrift »Warum hast Du uns verlassen?« beschrieb er 2009 den Besuch in einer Kirche in Rom, wo er die Kreuzigungsdarstellung des Barockmalers Guido Reni betrachten wollte – ein Meisterwerk, sagte sein Romführer. Dem wollte er sich offensichtlich aussetzen.
Renis Kreuzigung ist ein Aufruhr, berichtet Kermani später von dieser Begegnung mit dem Werk, denn das Bild widerspricht den gewöhnlichen verklärenden Schmerzensdarstellungen. Wer das Bild gesehen hat, weiß, was gemeint ist. Kermani hat sich offensichtlich mit Kreuzigungsdarstellungen beschäftigt. Ein Kenner, entnimmt man seinen Reflektionen. Er spricht auch davon, wie fremd und bedrohlich ihm Märtyrer-Abbildungen sind und kritisiert deren Tendenz zum Pornografischen – unabhängig davon, ob das Martyrium sich aus der Bibel oder aus der Schia begründet.
Doch dann, im dritten Absatz, formuliert Kermani den umstrittenen Satz: »Kreuzen gegenüber bin ich prinzipiell negativ eingestellt.« Diesen Satz, das erfuhr Kermani in der Folge, kann oder darf ein »Kreuz-Kenner« nicht sagen. Gleich nach der Absage an das Kreuz, die keine Ablehnung gläubiger Christen sein will, läuft das offene Auge des Schriftstellers zu seiner vollen Stärke auf. Denn man liest dort tatsächlich, dass er, Kermani, in der Kirche vom Anblick des Bildes so berückt war, dass er am liebsten nicht mehr aufgestanden wäre: »Erstmals dachte ich: Ich – nicht nur man – ich könnte an ein Kreuz glauben.« Unglaublich! Und er sagt auch gleich, was ihn an Renis Bild so anrührt, dass die Todesvorstellung, auf die er in dem Bild von Reni stieß, sich von der ihm bekannten Idee des Opfertodes unterscheidet. Renis Christus, so seine Schlussfolgerung, ist kein Christenchristus, sondern ein Menschenchristus. Dies dürften die christlichen Kreuzigungs-Kenner als Enteignung ihres Gottes empfunden haben. Doch man vertue sich nicht: Der von Kermani angesprochene theologische Bruch, den der Kreuzestod zwischen Christentum einerseits und Judentum wie Islam andererseits darstellt, rührt an einen sensiblen Punkt und ist wahrscheinlich der wirkliche Grund für die ganze Aufregung gewesen. So weit zu dieser Geschichte.
Kermanis Offenheit des Auges negiert überlieferte Begrenzungen. Er weicht nicht aus ins Universelle, sondern denkt transkulturell und transreligiös, ohne je der so naheliegenden Gefahr zu erliegen, das tatsächlich Trennende zu überspielen oder zu übergehen. So wie jede der unzähligen Personen in dem Roman Dein Name seine eigene Welt hat, die sie mit den anderen Romanfiguren teilt, so gibt es auch in den Essays verschiedene Standpunkte und jeder hat seine Berechtigung, sofern er dem Anderen dessen Berechtigung lässt. Als Historiker sieht Kermani es als seine Aufgabe an, das Gewesene und das Geschriebene immer neu in der Erzählung vom Ballast der überlieferten Interpretationen zu befreien; als Schriftsteller gibt er jedem Einzelnen Raum – und gerade auch den in ihrer Weltsicht allzu Verstrickten. Er dekonstruiert mit Sorgfalt und sprachlicher Energie die Vor-Stellungen, die wir uns – und natürlich zuallererst: die er sich – vom Anderen macht. »Unser Beruf ist das Fragenstellen, nicht das Antworten«, notiert er. Tatsächlich wird die Welt durch die Schönheit gerettet – ein Gedanke, den Kermani von Dostojewski hat; und man möchte hinzufügen: durch die Erzählung. Beides, Schönheit und Erzählung, hat die Begegnung des Autors mit Renis Kreuzigung mitgestaltet und uns neue denkerische Zugänge ermöglicht, denn Kermani ist ein großer Erzähler, dem es gelingt, die Geschichte in Geschichten immer neu in ihr Recht zu setzen. Die Auflösung eingefahrener Zugehörigkeitsmuster und tradierter Denkgewohnheiten, die am Denken und am Leben, ja vor allem am Zusammenleben und Zusammenwirken hindern, verbindet seinen Ansatz mit Hannah Arendts Idee von der Welt, die zwischen den Menschen immer neu ausgehandelt werden muss – wenngleich sein Ausgangspunkt in einem Punkt von Arendts grundverschieden ist, denn Kermani ist zuallererst ein Schriftsteller, sein Denken geht vom Ich aus, seine Literatur weist immer wieder die eigenen Erfahrung als Denkanstoß aus.
In einer Zeit, da politische und religiöse Lager sich weltweit zu polarisieren scheinen, erhält Navid Kermani den HannahArendt-Preis für politisches Denken 2011 für seine Analysen und Interventionen, die gerade auch durch ihre fundierten Kenntnisse den Blick frei und freiheitlich schweifen lassen können in christlicher, jüdischer wie islamischer Geschichte und Bild-Gegenwart und auf diese Weise weit mehr zum Verstehen der Zeit, in der wir leben, beitragen, als wohlmeinende interreligiöse Podiumsdebatten (Otto Kallscheuer). Das Dynamit dieses außereuropäischen Europäers und muslimischen Deutschen ist von eigener Art, denn sein an Kants Kritik des Erhabenen geschulter Ansatz hat eine eigene Bildwelt, die uns zu denken gibt. Dafür danken wir.
Die Realisierung der partiellen Säkularisierung
Mir war, als würde nicht ich ausgezeichnet, nicht ich aufgenommen, sondern meine Vorfahren, ihr Wissensdurst, ihre Sehnsucht nach der Welt, ihr Mut, sie zu entdecken, ihr Ehrgeiz ebenso wie ihre Tugendhaftigkeit und meinetwegen Großvaters Ernst und seine Humorlosigkeit, die sie von Generation zu Generation weitergaben, damit am Ende einer ihrer Söhne in die Akademie der Franken aufgenommen wird. Jetzt sehe ich Großvater, wie er weinend auf der Kutsche sitzt, die gleich nach Teheran abfährt, und denke, dort zum Beispiel, auch dort, hat unsere Reise begonnen.« Das, meine Damen und Herren, hat sich Navid Kermani (oder zumindest sein Alter Ego aus dem Roman Dein Name auf S. 228) während der Aufnahmezeremonie der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung im Staatstheater Darmstadt gedacht. Ich weiß ja nicht, was Navid Kermani sich heute, da er den HannahArendt-Preis bekommt, denkt. Aber er könnte es sich denken. Und darum würde ich gerne etwas dazu sagen. »Unsere Reise«, die dort begonnen hat, diese Reise von Isfahan an die Amerikanische Schule nach Teheran, war eine Reise zur Bildung, eine Reise, die in Auszeichnung und Aufnahme mündete. Ist das nicht eine exemplarische Vollendung des Bildungsversprechens? Dieses Versprechen ist heute eine zentrale gesellschaftliche Kategorie. Bildung gilt als das Allheilmittel für alle gesellschaftlichen Probleme. Bildung ist das Kaninchen, das bei allen Diskussionen um Fragen der Migration aus dem Hut gezaubert wird, der Zauberschlüssel der Integration, der alle Türen zu unserer Gesellschaft aufzusperren verspricht. Warum eigentlich? Was soll Bildung genau leisten? Sie soll eine reflexive Distanz herstellen, eine Distanz zu den Wurzeln, eine Distanz zu einer Identität, die direkt, naiv gelebt wird. Bildung soll die Aufgabe erledigen, die die Migration der Mehrheitsgesellschaft stellt. Sie soll fürs Ankommen sorgen. Bei Navid Kermani ist Wissensdurst, ist Bildung genau das und zugleich genau das Gegenteil davon. Denn Bildung ist auch das Versprechen gegenüber seinen Vorfahren. Bildung ist für ihn auch das Medium, in dem er seinen Vorfahren treu ist. »Unsere Bildungsreise« – das ist zugleich sein Modus anzukommen, hier, in diesem Deutschland, in dem er geboren und aufgewachsen ist, aus dem er aber nicht stammt, ein Modus anzukommen und zugleich ein Modus der Treue zu seinen Vorfahren. Und das zeigt sehr deutlich, was passiert, wenn man dem Versprechen der Bildung folgt. Was dabei passiert, ist eine doppelte Verschiebung: Das Ankommen, das so stattfindet, dieses Ankommen ist nicht das Aufgehen in der bildenden Gesellschaft. Bildung produziert nicht – oder nicht notwendig – das Lossagen von dem, was immer noch die »eigene« Kultur ist. Bildung ist nicht der Königsweg zur Assimilation, zur assimilierenden Integration. Und gleichzeitig ist die Treue zu den Vorfahren, die Treue zu ihrem Erbe – selbst wenn sie sich im glücklichsten Fall, wie in dem von Navid Kermani, im Medium der Bildung selbst vollzieht –, gleichzeitig wird diese Treue zu einem Umschreiben des Erbes: Es lässt sich nur bewahren, wenn es verändert wird.
Was aber bedeutet das für die Identität des Einzelnen? Die übliche Antwort lautet: Wir leben heute eben in verschiedenen Kulturen, Loyalitäten, Sprachen und nicht in fest umrissenen, monolithischen, monokulturellen Identitäten. Aber die Vielzahl, die Vervielfältigung von Identitäten ist nur die oberflächliche Antwort auf die Frage, was das mit uns macht. Oberflächlich, denn sie suggeriert, diese Pluralisierung sei einfach nur eine Akkumulation von unterschiedlichen kulturellen Elementen. Der eigentliche, der zentrale, der drängende Punkt ist doch: Was macht diese Pluralität mit uns? Wie bewohnen wir diese Vielfalt, wie bewohnen wir unsere Identitäten? Eines ist klar: Wir bewohnen sie anders als unsere Vorfahren (nicht nur jene Navid Kermanis). Für diese war Identität die Konstruktion einer imaginären Ganzheit. Das Versprechen der Gemeinschaft, aber auch jenes der Nation, war ja, man könne ihr voll und ganz angehören. Diese Gruppierungen versorgten ihre Mitglieder mit einem Herrensignifikanten, mit einem dominierenden Identitätsmerkmal, das die vielen verschiedenen biografischen Elemente, aus denen jeder besteht, vereinheitlicht. Sie haben also die Vorstellung einer vollen Identität erzeugt. Dieses Verhältnis ist aber dabei, sich gründlich zu verändern. Nicht weil wir heute so aufgeklärt wären – nichts ist so aufklärungsresistent wie eine Identität. Auch nicht, weil wir heute so fragmentiert wären oder weil es keine funktionierenden Gruppen mehr gäbe. Die vollen Identitäten, die vollen Zugehörigkeiten zu einer Gemeinschaft sind deshalb Vergangenheit, weil heute die Spaltung Eingang in die Identität, Eingang in die imaginäre Konstruktion selbst gefunden hat. Das, was die Illusion der vollen Zugehörigkeit im alten Sinne heute verhindert, ist schlicht deren Pluralisierung, die Vielzahl von »vollen« Identitäten, die heute nebeneinander existieren. Dabei handelt es sich aber gerade nicht um eine Akkumulation von Vielfalt, sondern vielmehr um eine grundlegende, eine radikale Veränderung. Diese Veränderung, die die Pluralisierung bewirkt, lautet: Westliche Gesellschaften haben heute kein Weltbild mehr, das von allen geteilt werden kann.
Das betrifft auch und gerade das Konzept der Nation. Die Nation war der Versuch, die Gemeinschaft unter den Bedingungen der Moderne in die Gesellschaft einzuführen. Die Erzählung von der Nation war also ein Weg, in Massengesellschaften tatsächliche Bindungen herzustellen. Heute erodiert das Konzept der Nation – nicht nur weil deren Souveränität eingeschränkt wird. Es erodiert auch, weil die Nation weniger denn je eine volle Gemeinschaft herzustellen vermag. Wir leben in Gesellschaften, die kulturell, religiös, ethnisch so vielfältig sind, dass sie nicht einmal mehr in der Erzählung homogenisierbar sind. Nun lässt sich aber das Konzept einer homogenen Nation nicht einfach durch das einer pluralen Nation ersetzen. Eben weil Nation auch eine bestimmte Art der Bindung des Einzelnen ans Ganze bedeutete. Die Nation war das Angebot einer vollen Identität, während plurale Gesellschaften, eben weil sie plural sind, nur mehr Identitäten, die das Faktum des Pluralismus einbegreifen, anbieten können. Das ist eine Verschiebung auf der Ebene der Bindungen, eine Verschiebung in der Art, wie wir unsere Identität heute bewohnen.
Was das bedeutet, zeigt sich am deutlichsten an der Veränderung des Konzepts des Staatsbürgers. Identitätspolitisch bedeutet Staatsbürgerschaft heute nicht mehr, dass man »weiß« werden muss, dass man seine »Differenzen an der Garderobe abgeben muss« (um hier auch an Hannah Arendt zu erinnern). Es erfordert keine Konversion mehr. Man muss heute keine andere volle Identität annehmen. Bei Kermani heißt das: Migranten sollen sich »Züge von Fremdheit bewahren« unter der Bedingung, »dass sie sich eindeutig zum Grundgesetz und seinen Werten bekennen« (Wer ist wir? Deutschland und seine Muslime). Ich würde da noch weiter gehen: Denn ein solches Bekenntnis setzt noch einen emphatischen Citoyen und in diesem Sinne ein gemeinsames Weltbild voraus. Heute aber ist der Citoyen keine eigene Identität mehr, sondern nur eine Einschränkung unserer privaten Identitäten. Die öffentliche Identität als Staatsbürger bedeutet nur einen Abzug von unseren vollen Identitäten, das Paradoxon eines Weniger an Identität, das zu unserer Identität hinzukommt. Das ist also die Art, wie wir heute unsere Subjektivität bewohnen: als nicht-volle Identitäten. So manifestiert sich das – unhintergehbare – Faktum der Pluralität. Nicht als ein Mehr an Identität, nicht als eine Akkumulation unterschiedlicher Identitäten, sondern als deren Einschränkung, als ein Weniger, als nicht-volle Identität eben. Migranten werden immer wieder danach gefragt, für wen sie beim Fußball die Daumen drücken, um daran den Grad ihrer Integration abzulesen. Die Frage verkennt aber diese Verschiebung völlig. Selbst wenn ein türkischer Migrant die Daumen für Deutschland drückt, so hat er trotzdem keine volle deutsche Identität. Und wenn er zur Türkei hält, so ist er deswegen doch kein voller Türke. Die Nation selbst hat gewissermaßen ein spaltendes Element bekommen: das einer nicht-vollen Identität ihrer Bürger. Emotion ist da kein Indikator, denn nicht-voll ist nicht gleichbedeutend mit abgekühlt. Nicht-volle Identität gibt es auch bei aufrechtem Hitzebetrieb. Sie ist aber auch nicht gleichbedeutend mit Hybrisierung oder Bindestrich-Identitäten, geht sie doch diesen Formen vielmehr voraus. Anders gesagt: Sogar wenn wir nicht gemischt sind, sogar wenn wir der kulturellen und nationalen Identität genügen, sogar katholische Österreicher und protestantische Norddeutsche sind heute nicht-volle Identitäten, nichtvolle Bürger.
Diese Bewegung erfasst auch den religiös Gläubigen. In seiner Studie Ein säkulares Zeitalter schreibt Charles Taylor, der Gläubige könne heute nicht mehr im vollumfänglichen Sinn gläubig sein, da sein Glaube immer neben anderen Glauben ebenso wie neben dem Nichtglauben bestehen muss. Die Pluralität konkurrierender Identitäten, Überzeugungen, Gemeinschaften hat Eingang in den Glauben selbst gefunden. Dieser funktioniert nur noch als Gegenbehauptung, nicht mehr als einfache Behauptung. Jede Identität, jede Gruppenzugehörigkeit steht heute, nach Verlust der Dominanzstellung von Kirche und Nation, von Hochkultur und was es mehr an solchen homogenisierenden Instanzen gab, neben anderen, und das Wissen darum schränkt diese ein. Selbst der überzeugteste Gläubige, selbst der glühendste Patriot gehört heute seiner Gemeinschaft nicht mehr voll an, sondern nur noch nicht-voll. Nicht-voll heißt, dass die eigene volle Überzeugung und auch Bindung immer Bescheid weiß, dass sie nur eine Option unter anderen ist. Man könnte dies auch als eine partielle Säkularisierung bezeichnen.
Und das führt uns zurück zu Navid Kermanis Großvater. Die Treue zu den Vorfahren – verstanden als testamentarisches Band, das einen zum Erben macht –, solchen Umgang mit dem Andenken der Toten hat Jacques Derrida als religiös bezeichnet. Diese Form der Religiosität scheint aber bei Kermani von genau solcher partiellen Säkularisierung bestimmt. Das wird besonders deutlich an dem, wie das Heilige bei ihm vorkommt. Genauer gesagt daran, dass es überhaupt vorkommt und welchen Platz es dabei einnimmt. Denn das Heilige hat bei Kermani keinen vorgesehenen, abgesonderten Platz. Es erscheint vielmehr in seinem Gegenteil – im Profanen, im Alltäglichen. Es war der Ethnologe Michel Leiris, der in seinem Buch Das Heilige im Alltagsleben das Konzept des Profan-Heiligen beschrieben hat. Profan-heilig sind Alltagsdinge, die zur Reliquie werden. Diese Ambivalenz eignet vornehmlich Dingen, die aus der Kindheit stammen. An diese kann man glauben, diese können heilig aufgeladen werden, weil mit ihnen eine Geschichte verbunden wird. Bei Kermani erzeugt diese Verdoppelung, dieses oft schroffe Aufeinandertreffen des Heiligen und des Profanen häufig Momente von großer Komik. Etwa wenn er schildert, welche Überwindung es kostet, in der Pause eines Workshops die Sekretärin nach einem Raum für eine »Eskapade wie das Gebet zu fragen«. Und wenn er dann am Waschbecken einer öffentlichen Toilette eine rituelle Reinigung vollzieht – »dieser ganze Vorgang, das Ausziehen der Schuhe, das Waschen der Füße, dann wieder in die Schuhe hineinschlüpfen, möglichst ohne mit den Füßen aufzutreten, das alles ist kurios, wenn hinter einem ein wissenschaftlicher Mitarbeiter steht«. Auf dieser Toilette, in diesem Zusammenprall von heilig und profan wird die partielle Säkularisierung schlagend. Kermani beschreibt die Spaltung der vollen Identität, wenn er »durch das Gebet an einer Gemeinschaft teilhat« und gleichzeitig »den Eindruck vermeiden möchte, sich aus einer anderen Gemeinschaft auszuschließen«. Oder auch in »Mittelstrahl«, einer Szene aus seinem neuesten Roman, in der der Protagonist beim Urologen auf der Toilette – wieder eine Toilette (!) – steht, um eine Urinprobe abzugeben, die dann aber ins »heilignüchterne« Wasser des WCs kippt. Heilignüchtern ist die ganze Szene, in der das Niedrige mit dem Hohen verknüpft wird – wir kennen das von Hegel, der diese Verknüpfung im Organ der Zeugung findet, das zugleich Organ des Pissens ist. Bei Kermani verknüpft sich das profane Toilettenwasser mit jenem weihevollen »heilignüchternen Wasser« aus Hölderlins Gedicht »Hälfte des Lebens«, in das die Schwäne »trunken von Küssen ihr Haupt tunken«. Kermani hat sich – und das ist für mich das vielleicht Erstaunlichste –, er hat sich bei seiner partiellen Säkularisierung sehr weit vorgewagt. So weit, dass es ihm sogar gelungen ist, in das Heilige der Anderen vorzudringen – in jenes der Deutschen durch seine Anverwandlungen deutscher Tradition wie etwa bei Hölderlin. Hölderlin, den er den »Sufi der deutschen Literatur« nannte. Das ist ein Eindringen in eine andere Tradition, ein Eindringen, das nicht nur Bildung, also Wissen ist, sondern ein emotionales Durchdringen, ein Zugang zu einem anderen Heiligen. Noch weiter und noch viel erstaunlicher ist dies jedoch in Bezug auf eine andere Religion, das Christentum. Sein Zugang zum Kreuz, sein Eindringen, ja sein Übertritt in »verschlossene Gefühls- und Glaubenswelten« (wie das Gustav Seibt in der SZ genannt hat) ist wirklich sehr erstaunlich. Weiter kann man sich kaum vorwagen. Die völlig verständnislosen Reaktionen darauf seitens der christlichen Kirchen bestätigten noch einmal deren Verkennen der partiellen Säkularisierung, die uns alle – Gläubige und Nicht-Gläubige – betrifft. Und wenn man sagen kann, diese partielle Säkularisierung sei das Signum Europas, jenes Europas, von dem man gar nicht weiß, wie lange es noch besteht, dann muss man aber auch hinzufügen, dass dies ein bedrohtes Signum ist. Eiferer aller Art laufen Sturm gegen das Europa der partiellen Säkularisierung, gegen das Europa der nicht-vollen Identitäten. Dagegen setzen sie von der Leitkultur übers christliche Abendland bis hin zur Beschwörung der Volksgemeinschaft ein ganzes Arsenal zur Rekonstruktion der vollen Identitäten. Einer Rekonstruktion bedarf es aber erst nach einem Verlust. Gerade weil die vollen nationalen, religiösen, kulturellen Identitäten nicht mehr in der Form greifen, kommt es zu einer massiven Gegenbewegung. Eine solche findet sich bei den Rechten, bei den Eiferern auf beiden Seiten: bei jenen der Mehrheits- und bei jenen der Minderheitsgesellschaft. Die Rekonstruktion kann jedoch nicht mehr volle, sondern nur geschlossene Identitäten herstellen. Bei den Minderheitengruppen heißt diese Strategie: Abschottung, niemand darf hinaus. In der Mehrheitsgesellschaft bedeutet das: Keiner darf herein, Exklusion. »Die Rechten«, schreibt Kermani, »attackieren den Islam, aber zielen auf Europa«. Ja, sie zielen auf die nicht-vollen, auf die in diesem Sinne »europäischen« Identitäten. Hier verläuft die wahre Trennlinie, die unsere Gesellschaften spaltet. Wenn der Moslem Navid Kermani heute einen Preis bekommt, der den Namen und den Geist der Jüdin Hannah Arendt trägt, wenn heute im protestantischen Norden eine ganz säkulare Jüdin aus Wien die Laudatio dazu hält, dann ist das keine große Ökumene, dann ist das nicht der Beweis eines interkulturellen Dialogs, sondern die Realisierung des demokratischen, des europäischen Geists der partiellen Säkularisierung, in dem wir uns alle treffen können. In diesem Sinne gratuliere ich uns allen, wenn ich sage: Meinen herzlichen Glückwunsch zum Hannah-Arendt-Preis, Navid Kermani.
Ein politisches Denken als Widerlegung der Geschichte
Es gibt zahlreiche Preise, die in Deutschland verliehen werden, und wohl die meisten tragen den Namen eines verstorbenen Literaten, eines Gelehrten, eines Politikers oder Mäzens. Der Preis, den ich heute erhalte, hat neben dem Namen der berühmten Person einen merkwürdigen Zusatz: Es ist ein Preis für politisches Denken. Ich muss sagen, dass der Ausdruck mir spontan gefiel: politisches Denken. Zugleich fragte ich mich, was damit wohl genau gemeint sei. Die Frage, was Politik ist, ließe sich mit Hannah Arendt sehr viel leichter beantworten, sie hat in ihren letzten Jahrzehnten immer wieder darüber nachgedacht, sogar ein eigenes Buch darüber geschrieben. Auch für das politische Urteilen, die politische Philosophie, das politische Handeln könnte man Erklärungen anführen, die auf ihren eigenen Worten beruhen. Aber was bedeutet es, politisch zu denken? Wodurch unterscheidet sich ein politisches von einem nichtpolitischen Denken? Und was wäre, da ich nun einmal mit eben diesem Preis ausgezeichnet werde, was wäre an meinem Denken politisch? Nun wäre es nahe liegend, das politische Denken in einem Analogieschluss durch seinen Bezug zur Politik zu definieren, damit zu der Welt zwischen den Menschen, wie Hannah Arendt den politischen Raum selbst nannte. Vielleicht hätte sie selbst diese Erklärung akzeptiert, die sich aus ihrem Begriff des Politischen ableiten lässt. Und doch griffe das relativ neutrale Merkmal des öffentlichen Bezugs zu kurz, würde man es auf ihr eigenes Werk anwenden. Schließlich versieht Hannah Arendt selbst das Wesen der Politik mit einer Wertung, die nicht politikwissenschaftlich, sondern allein politisch zu rechtfertigen ist: Politik sei »die Sache der Freiheit gegen das Unheil der Zwangsherrschaft jeglicher Art«. Sehr viel tiefgründiger ist das politische Denken, wie Hannah Arendt es vielleicht nicht definiert, aber mir in ihren Büchern zum Vorbild gibt, in drei Formulierungen bezeichnet, die gar nicht ihr eigenes Werk meinen. Nebenher bemerkt ist es wohl auch Ausdruck ihrer Noblesse, dass sie ihr eigenes Bemühen markiert, indem sie vom Gelingen anderer Autoren spricht.
Die erste Formulierung, die ich anführen möchte, stammt aus einer Zueignung an ihren Lehrer Karl Jaspers: sich in der Wirklichkeit zurechtzufinden, ohne sich ihr zu verschreiben, wie man sich früher dem Teufel verschrieb. In diesem Dreiklang sind wesentliche Motive von Hannah Arendts eigener Arbeit zum Ausdruck gebracht: der Wille, die Wirklichkeit zu verstehen – sich in ihr zurechtzufinden –, aber dann eben auch der Wille, die Wirklichkeit nötigenfalls zu verändern – sich ihr nicht zu verschreiben – und schließlich der Glaube an die Veränderbarkeit, damit den freien Willen und den Auftrag der Vernunft – hingegen man sich der Wirklichkeit früher wie dem Teufel verschrieb. Denken allein ist ein Prozess begrifflicher Klärung und Verdichtung. Politisches Denken hingegen, wie Hannah Arendt es zum Vorbild gibt, entschlüsselt das Gewordene als Gemachtes und ist damit seinem Wesen nach widerspenstig. Es akzeptiert die Verhältnisse niemals als notwendig, die es zu verstehen sucht. Die Notwendigkeit, so schreibt Hannah Arendt wenige Zeilen später, sei nur der Spuk, »der uns locken möchte, eine Rolle zu spielen, anstatt zu versuchen, irgendwie ein Mensch zu sein«. Irgendwie ein Mensch zu sein – das ist nun ein außerordentlich vager, geradezu pathetischer Ausdruck, wie man ihn bei Hannah Arendt selten findet. Und doch ist er ebenso wohlplatziert wie vielsagend, insofern das politische Denken zwar analytisch vorgeht, aber auf einem vorbegrifflichen Akt der Empathie beruht, der Mitmenschlichkeit oder Parteinahme, sei es in der Ausprägung des Mitleids oder des Zorns.
Im Zusammenhang mit Gotthold Ephraim Lessing – und damit bin ich bei der zweiten Zuschreibung angelangt, die ich anführen möchte, um das politische Denken zu bezeichnen –, im Zusammenhang mit Lessing weist Hannah Arendt darauf hin, dass die griechische Affektlehre nicht nur das Mitleid, sondern auch den Zorn unter die angenehmen Gemütsempfindungen rechnete, während sie die Hoffnung zusammen mit der Furcht als Übel verbuchte. Diese Wertschätzung des Zorns habe nichts mit dem Grad der Erschütterung zu tun, sondern mit dem Grad seines »Realitätsbewusstseins«, wie Hannah Arendt betont: »In der Hoffnung überspringt die Seele die Wirklichkeit, wie sie in der Furcht sich vor ihr zurückzieht. Aber der Zorn … stellt die Welt bloß.« Zorn und Mitleid sind keine Wörter, die einem auf Anhieb in den Sinn kommen, wenn man Hannah Arendt liest. So elegant ihre Prosa ist, so kühl ist sie auch, betont rational, beinah distanziert und frei von rhetorischen Effekten. Gerade im Vergleich mit ihren philosophischen Lehrern sticht diese Klarheit ins Auge, mit der Feierlichkeit Karl Jaspers und dem Raunen Martin Heideggers. Gleichwohl meine ich eben in der Abwehr jedweder Sentimentalität jenes Übermaß des Sentiments angezeigt zu sehen, das im Übermaß der Not brennt. Diese Not ist mehr als existenziell, denn sie wird nicht nur durch die Möglichkeit der eigenen, individuellen Auslöschung erzeugt. Die Not ist zugleich kollektiv, insofern sie mit der Auslöschung ihres gesamten Volkes rechnen muss, damit der Vergangenheit, der Erinnerung, des bloßen Namens. Zu morden ist das eine. Das Unvorstellbare, das der Nationalsozialismus versucht hat, ist es gewesen, niemanden übrig zu lassen, der um die Ermordeten trauert, damit den ärgsten Fluch der Juden wahr werden zu lassen: Nicht gedacht soll deiner werden. Damit bin ich bei der dritten Formulierung angelangt, mit der Hannah Arendt jemand anderen charakterisiert, aber beinah treffender sich selbst: Mit Blick auf Stefan Zweig spricht sie von »jener erbarmungslosen Genauigkeit, welche der Kälte der echten Verzweiflung entspringt«. Ich kenne keine Beschreibung, die für ihre großen historischen Werke und zumal die Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft treffender wäre. Neben vielen anderen, was dieses Buch heute so unglaublich erscheinen lässt, die Weite der gedanklichen Bögen, die analytische Durchdringung der geschichtlichen Erfahrung, die Originalität der deutenden Synthese, das helle Bewusstsein der Gegenwart, ist es auch seine Entstehungszeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Toten nicht einmal überschlagen, die Überlebenden noch ohne Gelegenheit zur Besinnung waren, als die Bilder der Vernichtungslager nicht im Geschichtsunterricht, sondern in den Wochenschauen gezeigt wurden. Obwohl das Buch praktisch in der Zeitgenossenschaft der Katastrophe entstand, die Hannah Arendt unmittelbar betraf, hat es den Gestus abwägender Geschichtsschreibung. Kaum eine Formulierung findet sich darin, die vordergründig anklagt, nichts menschelt, nichts schwelgt, nichts rüttelt durch sprachliche Effekte auf. Nicht ein einziges Ausrufezeichen benötigt sie auf den annähernd tausend Seiten, keine Superlative, keine rhetorischen, also Mitgefühl beschwörenden Fragen, keine Aufrufe zur Empörung. Mitleid und Zorn sind in Hannah Arendts politischem Denken in einen anderen, unsichtbaren Aggregatzustand überführt. Was sie sich vereinzelt erlaubt, ist der zeremonielle Ton einer Grundsatzerklärung, aber auch nur dort, wo sie das Ideal anführt, bevor sie dessen Unzulänglichkeit nachweist. Etwa setzt sie den Beginn der politischen Neuzeit bei der Erklärung der Menschenrechte durch die beiden großen Revolutionen an, der amerikanischen und der französischen, mithin auf das letzte Drittel des achtzehnten Jahrhunderts. »Diese Erklärung«, so schreibt sie, »besagt nicht mehr und nicht weniger, als dass von nun an der Mensch als solcher, und weder die Gebote Gottes noch die des Naturrechts, noch die Gebräuche und Sitten der durch Tradition geheiligten Vergangenheit, den Maßstab dafür abgeben können, was recht und unrecht sei. In der Sprache des achtzehnten Jahrhunderts besagte sie, dass die Völker sich von der Vormundschaft aller gesellschaftlichen, religiösen und historischen Autoritäten befreit hätten, dass das Menschengeschlecht seine ›Erziehung‹ beendet habe und mündig geworden sei.«
Das sind wohlklingende, auch wohlgesetzte, zugleich erhabene wie erhebende Worte, die noch heute jede Festrede auf die Aufklärung, auf Europa, auf die westliche Zivilisation schmücken könnten. Aber bei Hannah Arendt stehen solche Worte nicht in einer erbaulichen Abhandlung über den Fortschritt der Menschheit; sie leiten den letzten Abschnitt eines Kapitels ein, das wie kaum eine andere historische Analyse des zwanzigsten Jahrhunderts noch einen heutigen Leser beunruhigen müsste: das Kapitel über den Niedergang des Nationalstaates und das Ende der Menschenrechte. Das aus ihrer Feder selten salbungsvolle Lob der Menschenrechte steht ausgerechnet dort, wo sie deren Aporie zu erklären anhebt. Und Hannah Arendt selbst lässt keinen Zweifel, dass eben in der Feierlichkeit der Sprache, die sich aus dem neunzehnten Jahrhundert konserviert hat, selbst schon ein Problem liegt. Nur eine Seite später bemerkt sie: »Die Menschenrechte haben immer das Unglück gehabt, von politisch bedeutungslosen Individuen oder Vereinen repräsentiert zu werden, deren sentimental humanitäre Sprache sich oft nur um ein geringes von den Broschüren der Tierschützer unterschied.« Was dann folgt, ist eine bezwingend logische, historisch fundierte, aber in der Ausweglosigkeit auch beklemmende Darstellung der Dilemmata der modernen Nationalstaaten und deren – nein, nicht deren Versagen, schlimmer: deren strukturell bedingte Unfähigkeit, die universellen Menschenrechte zu garantieren. Insofern die Proklamation der Menschenrechte mit der Schaffung des Nationalstaates einherging und die Französische Revolution die Menschheit daher als eine Familie von Nationen begriff, bezogen sich diese Rechte von vornherein auf ein Volk, nicht auf das einzelne Individuum. Das hieß aber auch, dass die Menschenrechte an die Staatsbürgerrechte gekoppelt waren. »Was diese Verquickung der Menschenrechte mit der im Nationalstaat verwirklichten Volkssouveränität eigentlich bedeutet, stellte sich erst heraus, als immer mehr Menschen und immer mehr Volksgruppen erschienen, deren elementare Rechte als Völker im Herzen Europas so wenig gesichert waren, als hätte sie ein widriges Schicksal plötzlich in die Wildnis des afrikanischen Erdteils verschlagen.«8 Als sich mit dem Ende des Ersten Weltkriegs die letzten multiethnischen Großreiche auflösten und überall auf dem Kontinent neue, teilweise willkürlich konstruierte Nationen entstanden, deren Staatsvolk sich keineswegs mit deren Bewohnern deckte, blieben allerorten Minderheiten über, die nicht in der alten, auch schon imaginierten Dreieinigkeit von Volk-Territorium Staat aufgingen. Kam den anerkannten Minderheiten zwar nicht Gleichberechtigung, aber als Staatsbürger immerhin ein Rechtsanspruch zu, so war die Situation noch dramatischer für die vielen Millionen Flüchtlinge und Staatenlosen, die der Erste Weltkrieg ohne Papiere zurückließ. Insofern sie sich nicht des Schutzes einer Regierung erfreuten, waren sie auf das Minimum an Recht verwiesen, das ihnen angeblich eingeboren war. Allein: Es gab niemanden, es gab keine staatliche oder zwischenstaatliche Autorität, die diesen Staatenlosen das Recht garantieren konnte. »Staatenlosigkeit in Massendimensionen«, so schreibt Hannah Arendt, »hat die Welt faktisch vor die unausweichliche und höchst verwirrende Frage gestellt, ob es überhaupt so etwas wie unabdingbare Menschenrechte gibt, das heißt Rechte, die unabhängig sind von jedem besonderen politischen Status und einzig der bloßen Tatsache des Menschseins entspringen.« Jedenfalls die Minderheiten, Flüchtlinge und Vertriebenen des Ersten Weltkrieges scheinen diese Frage verneint zu haben, denn wo immer sie sich organisierten, appellierten sie an ihre Rechte als Polen, als Juden oder als Deutsche. Niemand unter ihnen kam auf die Idee, an die Menschenrechte zu appellieren. »Es ist sinnlos, Gleichheit vor dem Gesetz zu verlangen, für den es kein Gesetz gibt.« Einige Leser Arendts haben vorgeschlagen, ihre Argumentation auf die Flüchtlinge unserer Zeit zu übertragen, die ohne Pass oder Aufenthaltsrecht, im Illegalen also leben. Ob das nun hilfreich ist oder nicht, so meine ich doch, dass Arendts These vom Ende der Menschenrechte heute in einem noch umfassenderen Sinne von Belang ist, insofern sie das Wesen des Nationalstaates als solchen berührt. Interessant ist ja, dass Hannah Arendt vom Ende der Menschenrechte zu einem Zeitpunkt spricht, als die Vollversammlung der Vereinten Nationen gerade einstimmig die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet hat. Ohne Zweifel hat sie die Entwicklungen begrüßt, die es nach dem Zweiten Weltkrieg im internationalen Recht gegeben hat. Ich denke hier vor allem auch an die Genfer Flüchtlingskonvention, den Hohen Kommissar für Flüchtlingsfragen der Vereinten Nationen oder den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Aufgabe dieser Institutionen ist es eben, auch jenen ein Recht zu sichern, denen innerhalb einer nationalen Staatlichkeit kein Recht zukommt. Und doch bleibt die Problematik des Nationalstaats, dem wir zugleich die Demokratie verdanken, im Kern bestehen. Aus der Souveränität des Volkes, das an die Stelle des absoluten Fürsten getreten ist, folgt bis heute notwendig eine Definition derer, die zum Volk gehören und also auch derer, die nicht zum Volk gehören. Gerade das Prinzip der Volkssouveränität zwingt den Nationalstaat zur Unterscheidung, zur Identifikation. »Sofern sich innerhalb der Nation auch Menschen anderer volksmäßigen Abstammung befinden, so verlangt das Nationalgefühl, dass sie entweder assimiliert oder ausgestoßen werden.«
Gewiss hat Europa das Gewaltpotenzial, das in dieser Unterscheidung in Bürger und Nichtbürger liegt, seit dem Zweiten Weltkrieg entschärft, und verbietet sich jeder Vergleich mit der Situation, die Hannah Arendt vor Augen hatte, als Nichtbürger wie Leprakranke gekennzeichnet, später wie Tiere geschlachtet wurden. Und doch sind die Debatten, die schon lange vor dem Nationalsozialismus und auch heute wieder um die Rechte der anderen geführt werden, der Minderheiten, der Andersgläubigen, der Einwanderer und sogar der Touristen, die je nach Herkunftsland für ein Visum inzwischen einen Aktenordner voll von Bürgschaften, Grundbüchern, Kontoauszügen, Versicherungen, Urkunden und Arbeitsbescheinigungen vorlegen müssen – sind diese Debatten nicht zu verstehen, ohne die Grundlagen, aber auch Abgründe der modernen Nationalstaatlichkeit zu berücksichtigen, wie sie sich infolge der Französischen Revolution herausgebildet hat. Noch immer liegt den Debatten wie den Passkontrollen die Frage zugrunde: Wer ist Wir? Dieses Wir ist durchlässiger geworden, ja. Der Sohn oder die Tochter eines Einwanderers kann in höchste Staatsämter oder Akademien gelangen. Aber allein schon das Wort der Integration, das Norm geworden ist, zeigt an, dass die Grundlage weiterhin die Vorstellung eines irgendwie einheitlichen Staatsvolkes ist, für das ein Fremder sich zu qualifizieren, in das er sich einzubringen hat. Integration ist schon dem Wort nach ein einseitiger Vorgang: Ein Einzelner oder eine Gruppe integriert sich in ein bestehendes Ganzes. Man kann in Deutschland Gründe dafür anführen, den Begriff des Staatsvolkes auch weiterhin als etwas Einheitliches zu denken, als eine ethnisch und religiös inzwischen erweiterbare, aber doch sprachlich und kulturell irgendwie homogene Gemeinschaft. Aber man sollte sich mit Hannah Arendt der Entstehungsgeschichte dieses Anspruchs bewusst sein und ihn nicht für ein Naturgesetz halten. Volkssouveränität hat etwa in der amerikanischen Revolution eine gänzlich andere Bedeutung als in der französischen, und so stellen sich die Probleme, die die Einwanderung heute in den Vereinigten Staaten aufwirft, auf ganz andere Weise dar als in Europa. In der Französischen Revolution verlagerte sich der Akzent früh von der Republik auf das Volk, sodass Dauer und Identität des Staates also nicht durch die Institutionen, sondern im Rückgriff auf Rousseaus Theorien von einem angenommenen Willen des Volkes garantiert werden sollten, der als einheitlich gedacht, im tatsächlichen Verlauf der Revolution aber in eine Einmütigkeit gezwungen wurde; ganz anders verstanden die Väter der amerikanischen Revolution das Wort »Volk« niemals als einen Singular, sondern schon aufgrund der Zusammensetzung der Gesellschaft aus Zuwanderern vieler Länder natürlicherweise als eine Vielheit, die es nicht kulturell zu vereinheitlichen, sondern demokratisch zu organisieren galt. Entsprechend wurde als die wichtigste und bedeutungsvollste aller revolutionären Taten die Verabschiedung einer Verfassung empfunden, während in allen anderen, und zwar nicht nur europäischen Revolutionen seither der neue Verfassungsstaat stets in Gefahr stand, von denen wieder weggeschwemmt zu werden, die sich auf die öffentliche Meinung oder die Volonté générale beriefen, als habe das Volk tatsächlich nur eine Meinung, nur einen Willen. Der Verrat Robespierres, der die Volksgesellschaften mit dem Argument auflöste, es gäbe nur eine große Société populaire, das französische Volk, ist bei Hannah Arendt mehr als nur die Machtergreifung durch eine einzelne Fraktion. Er steht stellvertretend für den Betrug des Nationalismus überhaupt, »der eine Wahnvorstellung an die Stelle einer lebendigen Realität setzt«. Nicht nur für die Deutschen, auch für die siegreichen Völker des Zweiten Weltkrieges wäre es ungleich bequemer, den Nationalsozialismus als Fehlentwicklung der abendländischen Zivilisation abhandeln zu können, isoliert von den anderen westlichen Demokratien, als eine Barbarei und damit, wie es das Wort schon sagt, als etwas Fremdes, Dunkles, aus der europäischen Geschichte nicht kausal Abzuleitendes. Hannah Arendt, hierin sehr viel näher an der Dialektik der Aufklärung als an der Apologetik ihrer eigenen Lehrer, weist nach, wie im Ursprung der Französischen Revolution selbst schon der Nationalismus angelangt war, der sich keineswegs auf Deutschland beschränkte, sondern im Nationalsozialismus nur seine radikalste Ausformung fand. Dass Europa die Tyrannei im Namen des Volkes nicht aus eigener Kraft überwand, sondern der Hilfe der Vereinigten Staaten bedurfte, ergab sich für sie nicht aus der zufälligen geostrategischen oder militärischen Konstellation, sondern logisch aus der Geschichte der Revolutionen. So überrascht es auch nicht, dass sie das Projekt der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg zwar wohlwollend, dessen Erfolgsaussichten aber zunächst sehr skeptisch beurteilte. Noch 1958 befürchtete sie, dass Europa so wenig einen Ausweg aus der nationalstaatlichen Organisation finden würde wie die Spätantike aus der Organisation der Stadtstaaten. Der Nationalsozialismus ist überwunden, das wird man auch am Ende dieses Herbstes noch sagen dürfen – so bestürzend die Mordserie ist, die durch den Selbstmord zweier rechtsradikaler Attentäter ans Licht kam, so unfassbar das Versagen nicht nur der Behörden, sondern der Öffentlichkeit, deren Vorurteile sie verleitet hatte, den Opfern mehr als nur die Empathie zu verweigern, nämlich sie ohne jeden Beleg zu kriminalisieren. Der Nationalsozialismus ist überwunden, aber offenbar nicht der Nationalismus, aus dem er sich herleitete. So ist es eine zufällige zeitliche Koinzidenz, aber nicht ohne inneren Zusammenhang, dass dieser Herbst nicht nur Deutschland und zuvor Norwegen mit einer neuen Qualität fremdenfeindlichen Terrors konfrontiert, sondern drastisch auch mit den Niedergang des europäischen Projektes vor Augen geführt hat. Gewiss begann dieser Niedergang nicht erst mit der Finanzkrise. Die Finanzkrise ist Ausdruck und Folge einer politischen Krise, die vor Jahren bereits einsetzte, genau gesagt im Übergang der Generation, die noch eigene Erinnerungen an die Schrecken des Krieges hatte, zu unserer Generation der Nachgeborenen, die das Wundersame der europäischen Einigung nicht aus eigener Anschauung wertschätzen kann, die jedenfalls im Westen nicht erfahren haben, was Unfreiheit konkret bedeutet. Um den Niedergang des europäischen Projekts zu konstatieren, muss man nicht abschätzig auf unsere Nachbarstaaten blicken, in denen rechtspopulistische, fremdenfeindliche, dezidiert anti-europäische Parteien auf dem Vormarsch und teilweise bereits an der Regierung beteiligt sind. Wenn ein führender Vertreter der Partei Konrad Adenauers und Helmut Kohls wie der Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag triumphierend erklärt, dass in Europa wieder deutsch gesprochen wird, ist das einen Tag vor dem Besuch des britischen Premierministers mehr als nur diplomatische Idiotie. Es ist Geschichtsvergessenheit in einem Maße, dass jedem Leser Hannah Arendts nur angst und bange werden kann. (Damit nun auf der anderen Seite des politischen Spektrums nicht allzu selbstgefällig genickt wird, möchte ich daran erinnern, dass die Verbindung von Intelligenz und Rasse von einem prominenten Vertreter der Linken wieder hoffähig gemacht wurde, und zwar, das ist für unseren Kontext dann doch sprechend, und zwar mit dem nicht minder idiotischen und erst recht geschichtsvergessenen Hinweis auf eine höhere Intelligenz des jüdischen Volkes). Aber noch einmal kurz zum Fraktionsvorsitzenden der CDU im Bundestag. Dieser deutsche Triumphator ist der gleiche, der landauf landab verkündet, die Deutschen müssten, da sie doch Christen seien, sich besonders des Schutzes der Christenheit annehmen, die wie keine andere Religionsgemeinschaft weltweit verfolgt würde. Ich werde nun nicht auf diese Behauptung eingehen oder gar die Anzahl christlicher Opfer mit den Angehörigen anderer religiöser oder ethnischer Minderheiten aufrechnen, die heute ebenfalls auf der Welt verfolgt werden. Nein, ich möchte bei Hannah Arendt bleiben und dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Bundestag die Lektüre ihres Revolutionsbuches noch aus anderem Grunde empfehlen. Es findet sich darin, obwohl von einer Jüdin geschrieben, in einer glänzenden Doppelinterpretation des Großinquisitors und des Billy Budd eine der präzisesten und eindringlichsten Darstellungen der Güte, die Jesus von Nazareth auf die Welt oder jedenfalls in die Religionsgeschichte eingebracht hat: »dass dieser es fertigbrachte, mit allen Menschen als Einzelnen mitzuleiden, und dass diese, obwohl es buchstäblich alle waren, ihm doch nicht in irgendein Kollektiv, in die eine leidende Menschheit zusammenflossen«.
Jeder Mensch, jeder gewöhnliche Mensch, handelt, denkt, urteilt, liebt als Mitglied einer Gemeinschaft, geleitet von seinem Sensus communis, wie Hannah Arendt an anderer Stelle mit Verweis auf Kant erklärt. Zugleich ist jeder Mensch durch die einfache Tatsache, ein Mensch zu sein, Mitglied einer Weltgemeinschaft. Wer politisch handelt, so hebt Hannah Arendt hervor, soll sich, wenn schon nicht der Tatsächlichkeit, dann immerhin der Idee seiner weltbürgerlichen Existenz bewusst sein, sich an seinem Weltbürgertum orientieren. Das ist das Spannungsverhältnis jedweder Politik: im Sinne der eigenen Gemeinschaft zu handeln, ohne die berechtigten Interessen anderer Gemeinschaften zu übersehen. Das ist das Spannungsverhältnis, in dem die alttestamentlichen, später auch der islamische Prophet gestanden haben: dem eigenen Volk eine Botschaft zu verkündigen, die sich doch an die gesamte Menschheit richtet. Jesu Mitleiden, wie Hannah Arendt es deutet, geht darüber weit hinaus: Es überwindet nicht nur, es sprengt die Grenzen des Gemeinschaftlichen. Die Vorstellung, dass Jesus von Nazareth einen Aufruf unterschreiben würde, nur oder auch nur speziell den Christen in der Welt beizustehen, ist im Sinne des Evangeliums widersinnig. Sein Mitgefühl kollektiviert nicht, sondern gilt radikal dem Individuum, allen Individuen, ist also als erste Liebe in der aufgezeichneten Geschichte der Menschheit wahrhaft universal. Dass Hannah Arendt als vertriebene deutsche Jüdin das »Mitleiden auf seiner höchsten Stufe« an der Person Jesu aufzeigt, dem Begründer einer anderen, dem Judentum über fast zweitausend Jahre hinweg meist feindseligen Gemeinschaft, das sagt allerdings auch etwas über ihre eigene Persönlichkeit aus: Wenn sie die Größe der Geschichte, die Dostojewski und auf indirekte Weise Melville von Jesus erzählen, darin sieht, »dass wir spüren, wie falsch und wie unecht die idealistischen, hochtönenden Phrasen des erlesensten bloßen Mitleidens klingen, sobald sie mit wirklichem Mit-Leiden konfrontiert werden«, dann ist auch etwas über die Empfindung gesagt, die das Lesen ihrer Texte erzeugt. Kennzeichnend für das politische Denken, wie Hannah Arendt es zum Vorbild gibt, ist aber nun, dass sie das Mitleiden nicht etwa nur auf seiner höchsten Stufe beschreibt, sondern zugleich dessen gesellschaftliche Ambivalenz erfasst und die Leidenschaft sofort wieder zurückdrängt. Ähnlich der Liebe könne es dem Mitleid »wohl gelingen, die in allem menschlichem Verkehr sonst immer vorhandene Distanz, den weltlichen Zwischenraum, der Menschen voneinander trennt und sie gleichzeitig verbindet, auszulöschen«. Genau durch seine spezifische Qualität, weil es die Welt zwischen den Menschen, damit den Raum des Politischen überwindet, sei das Mitleid allerdings politisch ohne Bedeutung. Jesus hörte der langen Rede des Großinquisitors nicht deshalb schweigend zu, »weil er keine Argumente gegen sie wüsste, sondern weil er im Zuhören angefangen hat mitzuleiden, weil er bereits getroffen ist von dem Leiden, das hinter dem Redefluss des großen Monologs liegt und sich in ihm gerade nicht ausspricht«. Auch als der Großinquisitor zu Ende gesprochen hat, ist Jesus zu keiner sprachlichen Erwiderung fähig. Seine einzige Reaktion ist ein Kuss. Und ähnlich versöhnt sich Billy Budd unterm Galgen in einem letzten, gestammelten Ausruf mit seinem Richter, der von Gewissensbissen geplagt ist. »Jesu Schweigen und Billy Budds Stottern weisen auf das Gleiche hin, nämlich auf ihre Unfähigkeit oder Ungeneigtheit, sich der normalen aussagenden oder argumentierenden Sprechweise zu bedienen, in der man zu jemandem über etwas spricht, das von Interesse für beide ist, weil es in der Tat interest, zwischen ihnen lokalisiert ist. Das beredte und argumentative Interesse an der Welt ist dem Mitleiden ganz fremd, denn dieses drängt mit leidenschaftlicher Intensität über die Welt hinweg direkt zu den Leidenden selbst.« Wer etwa, um Hannah Arendts Gedanken an einem Beispiel zu illustrieren, wer mit den Armen so tief mitleidet wie ein Heiliger, der gesellt sich zu ihnen, der hilft ihnen oder teilt die Armut mit ihnen. Aber er geht selten daran, die Bedingungen zu ändern, unter denen Armut entsteht. Wird er durch irgendwelche Umstände, etwa die massenhafte Not oder die Bitten der Bedürftigen angestiftet, das Feld der Politik zu betreten, so wird gerade sein übergroßes Mitleid zu einer Gefahr, insofern es ihn »vor den langwierigen und langweiligen Prozessen des Überredens, Überzeugens, Verhandelns und Kompromisse-Schließens, welche die der Politik gemäßen Handlungen sind, zurückscheuen« lässt. Menschen mit übergroßer Empathie werden ihrer Natur nach »stattdessen versuchen, dem Leiden selbst Stimme zu verschaffen und zur ›direkten Aktion‹ schreiten – nämlich zum Handeln mit den Mitteln der Gewalt.« Gewalt aber könne nie mehr, als die Grenzen des politischen Bereichs schützen. Wo die Gewalt in die Politik selbst eindringt, sei es um die Politik geschehen. Wie Hannah Arendt im Folgenden anhand der Wirkung von Rousseau, der das Mitleiden für die Grundlage aller echten menschlichen Bezüge hielt, aufzeigt, dass gerade die nobelste der Leidenschaften, das Mitleiden, auf dem Gebiet der Politik in die absolute Mitleidlosigkeit umschlug und die Französische Revolution von 1789 schließlich in der Katastrophe mündete, das ließe sich auf die Geschichte aller großen Revolutionen seither übertragen, nicht nur der Russischen von 1917, wie es Hannah Arendt selbst getan hat, sondern gerade auch der Iranischen Revolution von 1979. Auch das Unglück der Iranischen Revolution bestand darin, »dass sie sehr bald von dem Kurs, der zur Gründung eines neuen politischen Körpers führte, durch die unmittelbare Vordringlichkeit der Not des Volkes abgedrängt wurde; die Richtung, die sie dann einschlug, war nicht mehr von den Erfordernissen bestimmt, welche die Befreiung von der Tyrannei bestimmt, sondern von denen, welche die Befreiung von der Notwendigkeit diktierten«. Die Vordringlichkeit der sozialen Frage hat auch in Iran dazu geführt, dass die ursprünglichen Träger der Revolution, nämlich das Bürgertum mit seinen Intellektuellen, Studenten, Frauenrechtlerinnen, Ingenieuren und Geschäftsleuten, denen es um die Sache der Freiheit ging, von denen verdrängt, vertrieben, oder physisch vernichtet wurden, die als Agenten des gemeinen Volkes auftraten, als Agenten insbesondere der Bevölkerung in den Elendsvierteln der Städte, den sogenannten »Bedürftigen« oder Mostazafin. Um den Satz Robespierres aus der Anklagerede auf Louis XVI. aufzunehmen, der für die Männer der Französischen Revolution nahezu selbstverständlich wurde: Auch Ajatollah Chomeini erklärte sehr bald, dass Recht ist, was der Revolution nützt, und ging dabei so weit, selbst das Heilige Gesetz des Islams für obsolet zu erklären, wo dessen Abschaffung im Interesse des neuen Staates sei. Auch in Iran bildete diese Umwertung des Rechts in ein Mittel zum Zweck den Auftakt zu den Säuberungen und Massenhinrichtungen. »Dass das Gesetz Erbarmen nicht kennt, wer wollte es leugnen?«, ist sich Hannah Arendt bewusst. »Nur darf man darüber nicht vergessen, dass es immer brutale Gewalt ist, die sich an die Stelle des Gesetzes setzt, ganz gleich aus welchem Grunde Menschen es abschaffen. Nichts ist geeigneter, dies zu lehren, als die Geschichte der Revolutionen.«
Eine einzige Revolution blieb in der Geschichte, die Hannah Arendt in ihrem Buch erzählt, von den Exzessen der Tugendhaftigkeit verschont, und zwar weil sie als einzige nicht unter dem Fluch der Armut stand und der notwendige Pragmatismus des Politischen sich nie am »Prüfstein des Mitleids« erproben musste. Dass Hannah Arendt die amerikanische Revolution stets als die glückhaftere unter den beiden großen Revolutionen des Westens beschrieb, hat vor allem in der frühen Rezeption dazu verleitet, sie als Rechte entweder zu vereinnahmen oder abzutun. Dabei lässt sich ihr Amerikanismus in kein Links-rechts-Schema fügen. Eher läge darin ein Plädoyer für Multikulturalität, sofern diese nicht als anything goes verstanden würde, sondern als die strikte Gleichheit des Verschiedenen vor dem Gesetz. Hannah Arendt hatte nicht nur als Historikerin studiert, sondern als Jüdin konkret erfahren, wie der Nationalstaat europäischer Prägung in eine Identität zwingt, sei es zur Assimilation oder zum Paria. Hingegen zu Amerika konnte sie gehören, ohne ganz dazugehören zu müssen. Eben die Loyalität, die sie als amerikanische Staatsbürgerin empfand, trieb sie an, die amerikanische Politik mit beinah jener Leidenschaft zu kritisieren, die sie als Historikerin unter Verdacht stellte. Dass sie Einspruch gegen McCarthy oder den Vietnam-Krieg erhob, ist dabei nicht das Entscheidende, wenn ich darüber nachdenke, was politisches Denken sei. Andere amerikanische Intellektuelle haben ihr Land ähnlich scharf oder noch schärfer kritisiert, wie man überhaupt Intellektualität als die kritische Reflexion des je Eigenen definieren könnte. Politisch zu denken, bedeutet die Welt in ihrer Ambivalenz, Widersprüchlichkeit und Komplexität verstehen zu wollen. So hat sie zwar den relativen Erfolg der amerikanischen Revolution hervorgehoben, aber zugleich deren Unzulänglichkeit benannt. Wie aus dem ursprünglichen Ausdruck des Pursuit of public Happiness der Begriff des Öffentlichen verschwand, sodass in der Unabhängigkeitserklärung nur noch von Pursuit of Happiness die Rede blieb, erzählt in ihrer Lesart beispielhaft die Ausbreitung jener Überzeugung, die sich in Amerika bis heute auswirke, »dass die Freiheit in dem freien Spiel von Privatinteresse bestünde und die Bürgerrechte in dem Recht auf rücksichtlose Verfolgung des Eigennutzes«. Hannah Arendt hat aber nicht nur den Ungeist des ungebremsten Kapitalismus und Individualismus aus dem Geiste der amerikanischen Revolution erklärt, sondern auch auf deren begrenzte, »gleichsam lokale Bedeutung« verwiesen. »Die Gründung der Freiheit konnte gelingen, weil den ›gründenden Vätern‹ die politisch unlösbare soziale Frage nicht im Wege stand«, heißt es in ihrem Buch über die Revolution; »aber diese Gründung konnte für die Sache der Freiheit nicht allgemeingültig werden, weil die gesamte übrige Welt von dem Elend der Massen beherrscht war.« Damit nicht genug, beruhte der relative Wohlstand und die soziale Balance der amerikanischen Gesellschaft, Jeffersons lovely Equality, die den gewaltfreien Verlauf der Revolution überhaupt erst ermöglichte, auf der Arbeit der Sklaven. Das heißt, ausgerechnet der größte Triumph der Freiheit in der Geschichte des Westens verdankt sich in der Analyse Hannah Arendts der schlimmstmöglichen Ausbeutung. Die amerikanische Revolution gelang, weil das Mitleid in ihr keine Rolle spielte. Aber diese nobelste aller Leidenschaften spielte nur deshalb keine Rolle, weil das Elend der Schwarzen, die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts fast ein Viertel der Bevölkerung ausmachten, von den Männern der Revolution wie insgesamt von der Mehrheit der Amerikaner vollkommen ausgeblendet wurde. Es sind exakt solche Antagonismen, Ambivalenzen, Aporien, die das politische Denken markieren, wie es Hannah Arendt zum Vorbild gibt. Es ist ein Denken ohne das Geländer der Systeme, Ideologien und Wunschvorstellungen, sondern so verwirrend, spannungsreich, ungesichert und paradox wie die wirkliche Erfahrung des Menschen. Eben weil es sich bemüht, die Geschichte ebenso wie das Zeitgeschehen in ihrer Widersprüchlichkeit zu beurteilen und sich niemals für nur eine Sicht der Dinge entscheidet, kann dieses Denken für alle möglichen Ziele vereinnahmt werden, je nachdem, welchen Aspekt man herausgreift. So wurde Hannah Arendt im Laufe ihrer Rezeptionsgeschichte mal zu einer linken, mal zu einer rechten Denkerin erklärt, mal zur Befürworterin, mal zur Gegnerin des Zionismus, mal zur Apologetin, mal zur Anklägerin Amerikas, mal zur Verfechterin, mal zur Kritikerin des europäischen Projekts. Dass diese extreme Gegensätzlichkeit ihrer Rezeption in der Struktur ihres Denkens angelegt ist, scheint ihr bewusst gewesen zu sein, obschon sie darüber in vornehmer Diskretion wieder nur in der Würdigung eines anderen sprach. In ihrer Rede über Lessing, aus der ich eingangs bereits zitierte, heißt es, dass Kritik in dessen Sinne diese Gesinnung sei, »die immer Partei ergreift im Interesse der Welt, ein jegliches von seiner jeweiligen weltlichen Position her begreift und beurteilt und so niemals zu einer Weltanschauung werden kann, die von weiteren Erfahrungen in der Welt unabhängig bleibt, weil sie sich auf eine mögliche Perspektive festgelegt hat.« Und Hannah Arendt schreibt weiter, »dass Lessings Parteinahme für die Welt so weit gehen konnte, dass er für sie sogar die Widerspruchslosigkeit mit sich selbst, die wir doch bei allen, die schreiben und sprechen, als selbstverständlich voraussetzen, opfern konnte«.
Was hätte Hannah Arendt zum arabischen Frühling gesagt? Ihre Prophezeiung, dass in der Weltpolitik »diejenigen schließlich die Oberhand behalten werden, die verstehen, was eine Revolution ist, was sie vermag und was sie nicht vermag, während alle die, welche auf die Karte reiner Machtpolitik setzen und daher auf die Fortsetzung des Krieges als der Ultimo Ratio aller Außenpolitik bestehen, in einer nicht allzu entfernten Zukunft entdecken dürften, dass ihr Handwerk veraltet ist und dass mit ihrer Meisterschaft niemand mehr etwas Rechtes anzufangen weiß«27 – dieser Satz hat mit Blick auf die westliche Nahostpolitik seit dem 11. September 2001 und die westliche Verblüffung über die nahöstlichen Freiheitsbewegungen der letzten Jahre neue Aktualität gewonnen. Der Wille zur Freiheit, der im Sommer 2009 auf den Straßen von Teheran, in diesem Jahr in Tunesien, in Ägypten, in Libyen, Bahrain, Jemen, Syrien zu beobachten war, hätte Hannah Arendt ebenso gewiss begeistert, wie sie gegen Theorien argumentiert hätte, die bestimmten Völkern die politische Unmündigkeit in die Kultur schreiben. Und doch würde Hannah Arendt dieser Tage wahrscheinlich nicht besonders optimistisch auf den Nahen Osten blicken, der leider mehr an 1789 als an 1776 erinnert. Folgt man ihrer historischen Analyse, gelingen Revolutionen nicht in Ländern, die unter dem Fluch der Armut stehen. Tatsächlich stehen die Chancen für die Etablierung eines demokratischen Rechtsstaates unter allen arabischen Ländern noch am besten in Tunesien, das eine vergleichsweise ausgewogene soziale Struktur aufweist. In den anderen arabischen Ländern hingegen und zumal in Ägypten lässt sich jetzt bereits beobachten, wie sich die revolutionäre Bewegung aufspaltet in die vorrangig jungen, vorrangig mittelständischen Aktivisten, denen es weiterhin um die politische Freiheit geht, und den Bewohnern der Elendsviertel, die nach der Euphorie des Anfangs nun erst recht vor der Frage stehen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen, da im Zuge der Revolution die Wirtschaft eingebrochen ist. Aber wer weiß? Das politische Denken, das Hannah Arendt zum Vorbild gibt, beschränkt sich nicht darauf, aus der Geschichte zu lernen. Es stiftet dazu an, die Geschichte zu widerlegen. Das ist heute nicht nur eine Aufgabe der arabischen Bürger. Es ist im Sinne der Weltbürgerschaft, die Hannah Arendt für das politische Handeln anmahnte, eine Aufgabe auch für uns – und zwar nicht nur für politische Stiftungen. Was die arabischen Völker jetzt am dringendsten benötigen, ist nicht die Aufklärung über ihre Rechte, sondern handfeste Beiträge zum Abbau der Massenarmut, also etwa die Aufhebung von Zöllen, das Ende subventionierter Agrarexporte, die die lokale Landwirtschaft zerstören, die Entwicklung der Infrastruktur, von Strom, Wasser, Energie, Bildung, natürlich auch Wirtschaftshilfen und eher kurzals mittelfristig die Integration in den europäischen Binnenmarkt. Ja, das würde teuer, das würde sehr viel mehr kosten als Broschüren, die an die sentimentale Sprache von Tierschutzvereinen erinnern. Aber wie viel wäre für Europa politisch, ökonomisch und strategisch verloren, wenn sich südlich des Mittelmeeres die Geschichte seiner eigenen Revolution wiederholte. Wie Amerika den Deutschen nach dem Krieg nicht aus Mitleid eine Perspektive geboten hat, so wäre es heute im wohlverstandenen Eigeninteresse der europäischen Staaten, nie mehr in Diktaturen, sondern endlich in die Freiheit zu investieren. Es gibt nur einen Nachbarn der arabischen Völker, für den auf dem Tahrir-Platz noch mehr auf dem Spiel steht als für die Europäer: Es ist der Staat Israel. Den dauerhaften Frieden, den Hannah Arendt als jüdische Denkerin stets vor Augen hatte, wird es im Nahen Osten erst geben, wenn das Unheil der Zwangsherrschaft überwunden ist. Wem das angesichts der Wahlergebnisse in Ägypten und Tunesien, aber auch angesichts der zunehmenden Repression in Israel selbst, illusorisch erscheint, der sei darauf hingewiesen, dass das politische Denken, wie Hannah Arendt es mir zum Vorbild gibt, mit nichts Geringerem als mit Wundern rechnete – »nicht weil wir wundergläubig wären«, wie sie betont, »sondern weil die Menschen, solange sie handeln können, das Unwahrscheinliche und Unerrechenbare zu leisten imstande sind und dauernd leisten, ob sie es wissen oder nicht.«28 Und so will ich, um so paradox zu schließen, wie sie die Welt erfuhr, so will ich für die arabischen Revolutionen mit Hannah Arendt hoffen, dass Hannah Arendt nicht recht behält.
Es gibt viele gute Gründe, Navid Kermani den Hannah-Arendt-Preis zu verleihen: sein Engagement für Europa, ja sein europäisches Denken, wenn er nach dem »Wir« pluraler Gesellschaften fragt, oder wenn er als Muslim und Gelehrter Vorstöße unternimmt ins Heilige der Anderen, etwa mit seiner subtilen Meditation über Guido Renis Gemälde »Die Kreuzigung«, die ihm als Minderheitsangehörigem zunächst die Ausgrenzung seitens der christlichen Großkirchen und die Nicht-Verleihung des hessischen Kulturpreises, sodann aber die Solidarität der Öffentlichkeit eingebracht hat, zum Beweis, dass die europäische Zivilisation zum Schutz von Minderheiten bereit und fähig ist. Ausgrenzung und Solidarität beschreibt Kermani in seinem im September 2011 publizierten Roman Dein Name. Navid Kermani als »Repräsentant einer Religion« sei der Adressat des Kulturpreises gewesen. Ob er Repräsentant ist, sei dahingestellt. Jedenfalls ist er noch viel mehr. Im Roman bezeichnet der Protagonist sich als »Schriftsteller«, »Leser«, »Navid Kermani«, »Freund«, »Vater«, »Berichterstatter«, »Sohn«, »Nachbar«, »Enkel«, »Poetologe«, »Handlungsreisender«, »Islamerklärer«, »Liebhaber«, »Nummer 10« und »Romanschriftsteller«. Kleine Netze und Gemeinschaften. »Die einzige Gemeinschaft, welcher der Romanschriftsteller angehört«, heißt es im Roman, »ist weder Nation noch Konfession. Es ist die deutsche Literatur. Und sein Fußballverein natürlich.« Vom Beitrag zur Gemeinschaft der deutschen Literatur und zur Gemeinschaftsbildung durch Literatur soll hier die Rede sein. Denn auch Kermanis Roman Dein Name ist ein gewichtiger Grund für die Preisverleihung – vielleicht besonders aus Sicht einer Stiftung, die den Namen des Schriftstellers Heinrich Böll trägt. Navid Kermani hat einen wunderbaren Roman geschrieben: Dein Name. Ein Roman, wie es noch keinen gab – heißt es auf dem Umschlag. Also neu, kühn, mitreißend. Was Verlage sich so einfallen lassen, um ein Buch aus dem Meer der Neuerscheinungen 2011 herauszuheben. Doch dieses Buch ist wirklich besonders. Es hätte ein Buch über Migration und MigrantInnen werden können, ein wunderbares Erinnerungsbuch, eine west-östliche Familiengeschichte von Großvater und Mutter. Familiengeschichten sind sehr gefragt, sie bieten Ankerplätze im Herkommen, wo heute sonst alles ins Schwimmen gerät. Erinnerungsbücher haben Anfang und Ende. Aber der Roman des Schriftstellers ist kein Erinnerungsbuch, es ist nur ein »Papierkorb ohne Handlung, Thema, Erzählstrategie und am schlimmsten: ohne Ende«. Wie also enden? Das ist die spannendste Frage dieses handlungsund spannungsarmen Romans. Soll er den Umzug nach Rom als Stipendiat der Villa Massimo für das Enden nutzen? Die Notate reichen über diese Zeit hinaus. Der Beginn der Frankfurter Poetikvorlesung »Über den Zufall. Jean Paul, Hölderlin und der Roman, den ich schreibe« könnte für den Ausstieg genutzt werden. Wieder nichts. Poetologisch, notiert der Schriftsteller, könne dieser Roman erst mit dem Tod enden. Doch zum Ende kommt der Roman nicht durch den Tod des Protagonisten, sondern durch den Verleger, der einen Termin setzt, Kürzungen erzwingt und damit diesen Roman erst möglich macht. Dem Drängen des Verlegers sucht der Protagonist noch eine kurze Weile durch Ausschweifungen vom Hundertsten zum Tausendsten auszuweichen, doch am Ende limitiert die Setzerin die Anschläge und der Akku des Laptop geht aus. Der Verleger macht den Roman möglich. Am Ende entsteht der Autor, der sich die schier unendlichen Abschweifungen und Umund Neuschreibungen zuschreiben und das damit verbundene symbolische und finanzielle Kapital gutschreiben lässt. Am Ende geht es zu wie bei Cervantes. Dessen Don Quijote gibt sich nicht nur als Übersetzung aus dem Arabischen aus. Im zweiten Teil nimmt der Roman auch Bezug auf diverse Raubkopien des ersten Teils und spottet auf die apokryphe Fortsetzung eines gewissen Alonso Fernández de Avellaneda, die 1614 in Umlauf kam und die Fertigstellung des zweiten Teils des originalen »Don Quijote« von 1615 wohl erheblich beschleunigt hat. Cervantes versieht die Fortsetzung mit einem Echtheitszertifikat und bekräftigt gegenüber dem Leser, »dass dieser zweite Teil des Don Quijote, den ich dir jetzt übergebe, von dem nämlichen Künstler und aus dem nämlichen Zeuge wie der erste gearbeitet sei und ich dir hiermit den Don Quijote übergebe, vermehrt und endlich tot und begraben, damit keiner es über sich nehme, neue Zeugnisse seinetwegen herbeizubringen.« So geht das dann. Den gesamten Roman über wird in tausend Einzelgeschichten, Abschweifungen und Um- und Neuschreibungen gegen Tod und Vergessen angeschrieben, um am Ende mit dem Tod des Helden den Autor aus dem Geist urheberrechtlicher Ansprüche und geschäftlicher Abmachungen hervorgehen zu lassen. Zugleich aber auch einen Autor, der sich positioniert, der seinen Roman als Handlung inszeniert, mit dem er teilnimmt am moralischen Universum und mit dem er zu seinem Leser eine verbindliche Beziehung aufbaut. Kermani hat auf Deutsch einen europäischen Roman geschrieben – einen epischen Roman, wie ihn uns Cervantes geschenkt hat und wie er in Deutschland, seit der Vorherrschaft des protestantischen Bildungs- und Bewusstseinsromans, nur wenige unternommen haben: darunter Alfred Döblin in den 1920er-Jahren oder Martin Mosebach heute, wie Kermani in seiner Laudatio auf den Büchner-Preisträger ausführt. Er glaubt an den epischen Roman, das epische Schreiben ist für ihn ein moralisches Unternehmen, ein »religiöses Unterfangen« – Weltbejahung und Vertrauen auf die Gnade, dass das Vergängliche und Kreatürliche vor dem Vergessen bewahrt sein möge. Sein Bauprinzip ist die Parataxe, die durch Abschweifungen und Umschreibungen aufgehaltene Handlung, die es ermöglicht, jederzeit und an jedem Ort in den Roman einzusteigen – wie in Don Quijote oder Tausendundeine Nacht. Die Toten und die Alltäglichkeiten, die der Roman beschreibt, sind für sich »vollkommen gleichgültig«, im Roman über Gott und die Welt werden sie zu Zeichen – nicht eines erlebenden und erinnernden Bewusstseins auf der Suche nach sich selbst, sondern eines überindividuellen Weltzusammenhangs. Sie sind, so der Gestus, so die Anmutung, unmittelbar zu Gott. Georg Lukács hat den Bildungsroman als Form der transzendentalen Obdachund Heimatlosigkeit beschrieben, als Form einsamen Welterlebens eines suchenden und erlebenden Ichs, das der einsame Leser nachempfindet. Schlüpfe in das Bewusstsein dieses erlebenden Ichs, fordert der Bildungsroman den Leser auf und bietet ihm mit der »erlebten Rede«, die die Differenz zwischen erlebendem Bewusstsein und Erzählerrede löschen will, das avancierte Stilmittel. Diese Art Bildungsroman ist ein Illusionsroman. Er gibt vor, kein Roman zu sein. Er hinterlässt den Leser in der Einsamkeit des Nachvollzugs einsamer Reflexion. Kermanis epischer Roman will Gemeinschaft stiften, dazu verbirgt er das erzählende Ich nicht, sondern vervielfältigt es, lässt es Rollen spielen und ohne Ende aus der Literatur zitieren, um am Ende als Autor und Urheber eines Romans zu erscheinen, der Stellung bezieht und zum Mitdenken auffordert. Freilich: die Gemeinschaft, die Kermani stiften will, ist nicht das sozialistische Kollektiv als Effekt der didaktisch eingesetzten Verfremdung wie bei Brecht. »Hätte er« – gemeint ist Brecht – »die Verfremdung, die das Natürlichste, ja die Voraussetzung für jede Form des Schauspiels ist, nicht ideologisch in Beschlag genommen, hätte das Illusionstheater nicht überlebt. Dann wären auch die Romane andere …« Gemeinschaftsstiftend und gemeinschaftsfähig sind Individuen, die zu moralischem Verhalten fähig und bereit sind. So möchte ich, zum Ende kommend, Navid Kermani mit Hannah Arendt interpretieren. Moral hängt an einem starken, sich seiner Kriterien, Ansprüche und der Konsequenzen seines Handelns bewussten Individuum, das imstande und bereit ist, auch im Roman Person zu sein, also durch Masken zu uns zu sprechen und handelnd zu uns in eine Beziehung zu treten. Das Böse, so hat es Hannah Ahrendt formuliert, ist das, was von niemandem getan wird, das heißt von Wesen, die sich weigern, Personen zu sein. Navid Kermani tritt durch den Roman vor uns als Person – dafür muss er die Konsequenzen tragen: mal die Kritik oder gar Schmähung, mal die Ehrung. Heute ist es die Ehrung. Vielen Dank an Navid Kermani für diesen Mut, Person zu sein, und herzlichen Glückwunsch zum HannahArendt-Preis!
Ich freue mich sehr, heute im Bremer Rathaus den Hannah-Arendt-Preis an Navid Kermani verleihen zu können. Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken wird seit 1995 vom Bremer Senat gemeinsam mit der HeinrichBöll-Stiftung verliehen. Heute findet die Verleihung zum 17. Mal statt, für mich ist es das fünfte Mal, dass ich bei dieser Preisverleihung für den Senat sprechen kann. Der Preis für Politisches Denken bewegt sich zwischen Philosophie, Geschichtswissenschaft, Literatur, Publizistik und eben auch Politik. Wer ist Navid Kermani? Ein Schriftsteller, ein Orientalist, ein Regisseur, ein Wissenschaftler im besten Sinne. Kaum jemand kann wie Navid Kermani aus den Erfahrungen so vielfältiger Erfahrungszusammenhänge schöpfen. Kermani hat vielen von uns die frühe Erfahrung von zwei verschiedenen Kulturen voraus. Die deutsche Sprache mit dem Akzent des Siegerlands im Freundeskreis, mit Spielkameraden und in der Schule. Die Umgangsformen, die Sprache einer persischen Arztfamilie in einem gehobenen Wohnumfeld. Dazu dann die zusätzliche Erfahrung als Kind im Fußballverein, was einen großen Unterschied, die soziale Zugehörigkeit auf Verhalten, Sprache, »Anderssein« hat. Ich will mich in meinen kurzen Ausführungen ausschließlich auf sein Buch mit einer Essaysammlung aus dem Jahr 2009 beziehen: Wer ist wir? Deutschland und seine Muslime. Stark von eigenen, individuellen, sehr persönlichen Erfahrungen ausgehend, beobachtet Kermani die Welt um sich herum. Durch seinen präzisen, klaren Blick kommen die Leser, die sich darauf einlassen, komme ich zu einer anderen Perspektive. In wunderbar erzählten Skizzen gesellschaftlicher Zusammenhänge wird offensichtlich, was so grundfalsch ist an der gegenwärtigen Integrationsdebatte in Deutschland. »Integration« setzt die Fiktion einer einheitlichen gesellschaftlichen deutschen Identität voraus, in die »Fremde« integriert werden können. Was für ein Irrtum ist schon allein die Annahme einer deutschen Identität, die sich allein über Religion definieren ließe. Welche deutsche Identität wäre dies? Katholizismus, Protestantismus? Judentum, Agnostizismus, Atheismus? Bäuerliches Leben auf dem Lande, Arbeiter am Rand einer Großstadt? Und das in scharfer Abgrenzung zum Islam? Lebenswirklichkeiten werden von vielen Bedingungen bestimmt, bei denen die Religion eine eher untergeordnete Bedeutung hat. Auf alle Fälle haben die soziale Situation der Menschen, ihr Einkommen, die familiären Beziehungen, der Bildungszugang, die Chancen häufig einen weit größeren Einfluss als der eine, reduzierte Aspekt der Religionszugehörigkeit. Navid Kermani ist ein Verfechter der europäischen Werte, die zumindest in unseren intellektuell geprägten Kreisen sehr hoch bewertet werden. Humanismus, Menschenwürde, Toleranz, Akzeptieren der Verschiedenartigkeit, gegenseitiger Respekt, Individualität, das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Die Fähigkeit, Menschen in ihren komplexen Lebenszusammenhängen wahrzunehmen. Für diejenigen, die wie ich zu wenig Zeit zum Lesen haben, habe ich aus dem Buch Wer ist wir? aus dem Jahr 2009 von Navid Kermani drei wunderschöne Passagen herausgesucht, die seine Denkgrundpfeiler widerspiegeln. »Dass Menschen gleichzeitig mit und in verschiedenen Kulturen, Loyalitäten, Identitäten und Sprachen leben können, scheint in Deutschland immer noch Staunen hervorzurufen – dabei ist es kulturgeschichtlich eher die Regel als die Ausnahme. Im Habsburger oder im Osmanischen Reich, bis vor Kurzem in Städten wie Samarkand oder Sarajevo, heute noch in Isfahan oder Los Angeles, waren oder sind Parallelgesellschaften kein Schreckgespenst, sondern der Modus, durch den es den Minderheiten gelang, einigermaßen unbehelligt zu leben und ihre Kultur und Sprache zu bewahren. Ohne sie gäbe es vermutlich keine Christen mehr im Nahen Osten, und ihr heutiger Exodus hat viel mit dem verhängnisvollen Drang mal der Mehrheitsgesellschaft, mal der Staatsführer, mal von ein paar hundert Terroristen zu tun, Einheitlichkeit herzustellen und kulturelle Nischen auszumerzen.« Diese Passage weist dem Gerede von der deutschen Leitkultur den ihr zustehenden Platz im Reich des unhistorischen Geschwafels zu. Die zweite Textstelle behandelt den Hang zur Abgrenzung gegen das als fremd Empfundene. »Wir nehmen den Fundamentalismus und überhaupt die Rückkehr der Religionen nur dann wahr, wenn sie mit politischen Forderungen auftreten oder gar mit physischer Gewalt. In der Breite ist der Fundamentalismus seit seinen Anfängen im frühen zwanzigsten Jahrhundert bis heute überall – sei es im Nahen Osten, in Südasien oder den Vereinigten Staaten – eine Bewegung, die den Einzelnen einbindet in die klar umrissene Ordnung eines Kollektivs, das streng unterschieden ist von anderen Kollektiven. Das muss keine aggressive Unterscheidung sein. Fundamentalistische Lebensentwürfe sind attraktiv, weil sie die Menschen mit dem versorgen, was ihnen in der modernen, globalisierten Welt am meisten fehlt: Eindeutigkeit, verbindliche Regeln, feste Zugehörigkeiten – eine Identität.« Mit dieser sehr psychologischen Sichtweise legt Navid Kermani auch einen Finger in die Wunde des Agierens der politischen Elite, die das Bedürfnis von Menschen nach Wurzeln und Vergewisserung leicht und oft auch systematisch unterschätzt. Wer eine offene Gesellschaft will, muss den Wünschen nach Identität, die eben verschieden ist, Rechnung tragen. Die letzte Textstelle spricht mir besonders aus der Seele: »Weshalb erzähle ich das? Weil ich sagen will, dass es andere Unterschiede gibt, die in den meisten Fällen gravierender sind als die Hautfarbe oder die Religion. Und weil ich denke, dass zum Beispiel arm oder reich, Stadt oder Land, gebildet oder ungebildet Kategorien sind, durch die Menschen, wenn sie nicht eben in einem rassistischen Staat leben, mehr voneinander getrennt, benachteiligt oder bevorzugt werden als durch die Nationalität oder den Glauben. Ich behaupte nicht, dass es keine kulturellen Konflikte gibt, aber ich meine, dass die größte Bruchstelle in einer Gesellschaft weiterhin die ökonomische ist – selbst wenn soziale Konflikte immer häufiger in einem kulturellen oder religiösen Vokabular ausgedrückt werden.« Mit Navid Kermani können auch praktizierende PolitikerInnen etwas anfangen, und dafür bin ich dankbar, weil es meiner Meinung nach auch der Sinn eines Preises für politisches Denken ist. Herzlichen Glückwunsch an Navid Kermani! Ich freue mich auf Ihre Festrede.
Navid Kermani, deutsch-iranischer Journalist, Autor und Orientalist, lebt in Köln

Wir vom Vorstandsteam des Vereins »Hannah-Arendt-Preis für Politisches Denken«, Antonia Grunenberg, Peter Rüdel und ich, wir freuen uns sehr, Sie heute an diesem adventlichen Abend zur Verleihung dieses Preises an Navid Kermani begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Eva Senghaas-Knobloch; mir kommt heute Abend die Aufgabe zu, Sie durch unser Programm zu führen. Gefunden wird der jährliche Preisträger des Hannah-Arendt-Preises durch eine internationale Jury, deren Begründung heute unser Jurymitglied Marie Luise Knott darlegen wird. Das Preisgeld für den Hannah-ArendtPreis wird großzügiger- und dankenswerterweise jährlich vom Senat der Freien Hansestadt Bremen und der HeinrichBöll-Stiftung gestiftet. Wir sind glücklich, dass wir die Preisverleihung heute wiederum hier, in unseren wunderschönen Rathausräumen vornehmen können, besonderen Dank dafür an Sie, Frau Bürgermeisterin Linnert. Vielen Dank auch an Sie und Herrn Poltermann von der Heinrich-Böll-Stiftung, dass Sie für die Preisgeber zu uns sprechen werden. Ganz besonders möchte ich auch Frau Dr. Isolde Charim begrüßen, wir sind glücklich, dass wir Sie heute für die Laudatio unseres Preisträgers gewinnen konnten. Sie sind Wienerin, Philosophin und Publizistin, lehren an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien und sind als freie Publizistin in Österreich und Deutschland tätig; vielen sind Sie bekannt als taz-Kolumnistin und einigen als wissenschaftliche Kuratorin der Reihe »Diaspora – Erkundungen eines Lebensmodells« sowie der Reihe »Demokratie reloaded« am Kreisky Forum in Wien. Vielen Dank, Frau Charim, dass Sie den weiten Weg aus Wien nach Bremen gefunden haben. Wir werden Sie auch morgen während unseres Colloquiums bei uns haben, das wir wie jedes Jahr am Tag nach der Preisverleihung mit unserem Preisträger und allen Interessierten zum besseren Kennenlernen und zur Diskussion seiner Gedankengänge durchführen; das Colloquium steht dieses Jahr unter dem Thema des islamischen Erbes in den europäischen Ländern und findet nun schon traditionell im Institut Français statt, so auch morgen zwischen 10 und 13 Uhr. Allen, die zum Colloquium beitragen, das von Antonia Grunenberg moderiert werden wird, möchte ich schon an dieser Stelle unseren besonderen Dank aussprechen. Meine Damen und Herren: HannahArendt steht für ein politisches Denken, das sich den Herausforderungen der Zeit stellt. Arendts Erkenntnisse über totalitäre Herrschaft, ihre Einsichten zum Verhältnis von Macht und Gewalt und zur republikanischen Freiheit verdanken wir den Bemühungen dieser Philosophin, auch die dunklen Seiten der politischen Moderne auszuleuchten. Die historischbiografischen Arbeiten Hannah Arendts haben unser kulturelles Wissen von Identität und Selbst bereichert. Unser Verständnis der Freiheitsrevolutionen der letzten Jahrzehnte von 1989 bis 2011 und der ihnen eigenen Herausforderungen gewinnt durch die Schlüsselkategorien des Denkens von Hannah Arendt an Tiefe. Den Preisgründern aus Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit liegt seit der ersten Preisverleihung 1995, seinerzeit an die ungarische Philosophin Agnes Heller, daran, die Bedeutung des politischen Denkens von Hannah-Arendt für die Erneuerung republikanischer Freiheitspotenziale hervorzuheben und eben darüber zu befördern. Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken soll dazu ermutigen, Hannah Arendts handlungsnahes und ereignisoffenes Politikverständnis auch für gegenwärtige Diskurse in Politik und Gesellschaft fruchtbar zu machen. Daher werden Personen geehrt, die wie unser Preisträger auf die ihnen je eigene Weise das von Hannah Arendt so eindringlich beschriebene und von ihr selbst praktizierte »Wagnis Öffentlichkeit« angenommen haben. Meine Damen und Herren, als ich im letzten Jahr an dieser Stelle auf die keineswegs ausgestandene Krise der Finanzwelt hingewiesen hatte, zeichnete sich ab, dass wir am Ende des ersten Jahrzehnts des nicht mehr ganz neuen Jahrhunderts vor großen Herausforderungen stehen. Die Politik, die sich in den letzten Jahrzehnten in eine neoliberale Zwangsjacke manövrierte, musste erfahren, dass wir ohne politische Gestaltung der Rahmenbedingungen transnationaler Finanzaktivitäten den politischen Gestaltungsspielraum hierzulande so einschnüren, dass in der Folge eine Welt mit menschenunwürdigen sozialen Zerklüftungen geschaffen wird, die uns längst auch hierzulande in zerstörerischer Form einholen. Die verschiedenen vom Westen in Gang gesetzten Prozesse machen es heute unabweisbar nötig, dass wir uns mit Denkweisen in anderen, nichtwestlichen Kulturen befassen, insbesondere weil diese Denkweisen auch Europa selbst in vieler Hinsicht beeinflusst und bereichert haben, einst, aber auch heute. Europa kennt eine gute Tradition der Pluralität und – wie wir in der Friedensforschung sagen – der vielfältig sich überlappenden Loyalitäten oder – wie unser Preisträger so eindrucksvoll formuliert hat – »der sich nicht ausschließenden Identitäten«. Ein enthusiastischer Kölner zu sein und sich liebevoll um ein Haus in Isfahan zu bemühen, schließt sich keinesfalls aus, sondern stärkt sich wechselseitig. Unser heutiger Preisträger Navid Kermani wurde 1967 in Siegen geboren und lebt in Köln. Er studierte Orientalistik, Theaterwissenschaft und Philosophie in Deutschland und Ägypten. 1994 gründete er im Land seiner Eltern, dem Iran, ein Sprach- und Kulturzentrum in Isfahan, welches er bis 1997 leitete. Navid Kermani arbeitete am Wissenschaftskolleg Berlin, war Regisseur und Kurator am Schauspielhaus Köln und Stipendiat an der deutschen Akademie Villa Massimo in Rom. Seit 2009 ist er Senior Fellow des kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Navid Kermani erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise, unter anderem den Ernst-Bloch-Förderpreis (2000) und die Buber-Rosenzweig-Medaille (2011).
2009 wurde er mit dem Hessischen Kulturpreis geehrt, wobei eine heftige und schließlich heilsame Kontroverse über seine Äußerungen zur Kreuzestheologie ausgelöst wurde. Navid Kermani ist Mitglied der Deutschen Islamkonferenz und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Seine Schriften eröffnen Einblick in die kulturelle und politische Vielfalt des Orients, aber sie nehmen auch Stellung zu politischen Herausforderungen, vor denen Europa steht – und dies in einer Sprache, die gute Kräfte weckt und Möglichkeitsräume für politische Gemeinwesen eröffnet. Ich bitte nun Marie Luise Knott, Mitglied der Internationalen Jury, die diesjährige Preisverleihung an Navid Kermani zu begründen. Marie Luise Knott ist Politikwissenschaftlerin und Romanistin, war Chefredakteurin der deutschsprachigen Le Monde Diplomatique und ist seit Langem als Autorin bekannt. In diesem Jahr erschien ihr Band Verlernen. Denkwege bei Hannah Arendt. Im letzten Jahr gab sie den Briefwechsel von Hannah Arendt und Gershom Scholem heraus.
Die Offenheit des Auges
Es gibt eine Parallele, die unmittelbar ins Auge fällt, wenn man die Werke von Hannah Arendt und Navid Kermani betrachtet. Es handelt sich um ein Detail, könnte man meinen, aber eins, das im englischen Sinn ein »telling detail« ist. Hannah Arendt, die ihren Diderot gründlich gelesen hatte, sah in den Juden politisch schon früh ein entscheidendes europäisches Bindeglied. 1945, bei Kriegsende, hoffte sie auf ein Nachkriegseuropa ohne Nationalstaaten; stattdessen plädierte sie für eine Europäische Föderation, in der sie den Juden eine besondere, nationenübergreifende politische Wirkkraft beimaß. Ähnlich wie Arendt beharrt auch Navid Kermani auf der einigenden europäischen Kraft der Juden und der Muslime: »Die enthusiastischsten Europäer«, sagte er vor einigen Jahren auf dem Kongress Europa eine Seele geben, »... die enthusiastischsten Europäer findet man dort, wo Europa nicht selbstverständlich ist, in Osteuropa, auf dem Balkan oder in der Türkei, unter Juden und Muslimen«.
Kermani, der hierzulande gerne als »außereuropäische Stimme« zu Talkshows eingeladen wird, engagiert sich leidenschaftlich für Europa, für das alte und das neue Europa: »Wer von Menschen wie von einer Seuche spricht, hat Europa verraten, indem er es zu schützen vorgibt.« Dieser Ausspruch ist paradigmatisch für Kermanis Kunst, sich in die Widersprüche seiner Zeit hineinzubegeben. Die Themen, die andere eher umschiffen, weil sie sich leicht an ihnen in Rage reden, sind Kermani, so scheint es, in aller Ruhe die liebsten, sie sind seine wahren Herausforderungen an das Denken. Ich nenne nur einige wenige Themen: Mythos und Wirklichkeit der Heiligen Ursula und ihrer Jungfrauen, die Schönheit des Koran, die performative Kraft religiöser Rituale, die Gefahren des aktiven Nihilismus in der Politik, ebenso wie die Verehrung Attars oder die Kreuzesdarstellungen. Alles befragt Kermani neu, und es stellt sich heraus, dass seine Geschichten uns – Kennern wie Laien – ganz Neues zu sagen haben. Denn, und das ist es, was Kermanis Texte auszeichnet, sie sind »Reisen in die Verwirrung« (SZ), und zwar in eine zwiefache Verwirrung. Kermani lässt sich selbst verwirren von dem, was er liest, hört und empfindet, und gleichzeitig verwirrt er uns Leser – und unsere oft allzu eingefahrenen Erwartungen, in Orient und Okzident. Er verlässt sich nicht allein auf den Verstand, sondern auf alle seine Sinne und kultiviert eine Fähigkeit, die wir längst vergessen hatten: die Offenheit des Auges. Anders als der Verstand und anders als das Ohr hat das Auge nämlich keine Mühe, gleichzeitig Widersprüchliches aufzunehmen.
Offenheit des Auges – was das bedeutet, kann man an jedem von Navid Kermanis Texten studieren. Doch bevor ich darauf eingehe, möchte ich einen Freund von Hannah Arendt zu Wort kommen lassen, nämlich Walter Benjamin, der sich in der Offenheit des Auges zeitlebens besonders geschult hat. Benjamin schrieb in einem Brief an Grete Karplus über das Wagnis solchen Sehens: Wer versucht, die Weite zu behaupten, also wer sich die Freiheit nimmt, »Dinge und Gedanken, die als unvereinbar gelten, nebeneinander zu bewegen«, der lebt gefährlich. Kermanis Texte tun genau dies: Sie stellen nicht einfach Dinge, die als unvereinbar gelten, nebeneinander – das könnte auf Beliebigkeit hinauslaufen –, nein: seine Texte bewegen diese Dinge nebeneinander. Das ist Kermanis Kunst. Sein Denken hält Unvereinbares in Spannung. Und Benjamin wusste: So einer lebt gefährlich, 1930 ebenso wie 2011.
Einige Male schon hat Kermani die denkerische Gefahr, der er sich tagtäglich an seinem Schreibtisch aussetzt, auch im Öffentlichen zu spüren bekommen. Unter der äußerst christlich konnotierten, jedoch häretischen Überschrift »Warum hast Du uns verlassen?« beschrieb er 2009 den Besuch in einer Kirche in Rom, wo er die Kreuzigungsdarstellung des Barockmalers Guido Reni betrachten wollte – ein Meisterwerk, sagte sein Romführer. Dem wollte er sich offensichtlich aussetzen.
Renis Kreuzigung ist ein Aufruhr, berichtet Kermani später von dieser Begegnung mit dem Werk, denn das Bild widerspricht den gewöhnlichen verklärenden Schmerzensdarstellungen. Wer das Bild gesehen hat, weiß, was gemeint ist. Kermani hat sich offensichtlich mit Kreuzigungsdarstellungen beschäftigt. Ein Kenner, entnimmt man seinen Reflektionen. Er spricht auch davon, wie fremd und bedrohlich ihm Märtyrer-Abbildungen sind und kritisiert deren Tendenz zum Pornografischen – unabhängig davon, ob das Martyrium sich aus der Bibel oder aus der Schia begründet.
Doch dann, im dritten Absatz, formuliert Kermani den umstrittenen Satz: »Kreuzen gegenüber bin ich prinzipiell negativ eingestellt.« Diesen Satz, das erfuhr Kermani in der Folge, kann oder darf ein »Kreuz-Kenner« nicht sagen. Gleich nach der Absage an das Kreuz, die keine Ablehnung gläubiger Christen sein will, läuft das offene Auge des Schriftstellers zu seiner vollen Stärke auf. Denn man liest dort tatsächlich, dass er, Kermani, in der Kirche vom Anblick des Bildes so berückt war, dass er am liebsten nicht mehr aufgestanden wäre: »Erstmals dachte ich: Ich – nicht nur man – ich könnte an ein Kreuz glauben.« Unglaublich! Und er sagt auch gleich, was ihn an Renis Bild so anrührt, dass die Todesvorstellung, auf die er in dem Bild von Reni stieß, sich von der ihm bekannten Idee des Opfertodes unterscheidet. Renis Christus, so seine Schlussfolgerung, ist kein Christenchristus, sondern ein Menschenchristus. Dies dürften die christlichen Kreuzigungs-Kenner als Enteignung ihres Gottes empfunden haben. Doch man vertue sich nicht: Der von Kermani angesprochene theologische Bruch, den der Kreuzestod zwischen Christentum einerseits und Judentum wie Islam andererseits darstellt, rührt an einen sensiblen Punkt und ist wahrscheinlich der wirkliche Grund für die ganze Aufregung gewesen. So weit zu dieser Geschichte.
Kermanis Offenheit des Auges negiert überlieferte Begrenzungen. Er weicht nicht aus ins Universelle, sondern denkt transkulturell und transreligiös, ohne je der so naheliegenden Gefahr zu erliegen, das tatsächlich Trennende zu überspielen oder zu übergehen. So wie jede der unzähligen Personen in dem Roman Dein Name seine eigene Welt hat, die sie mit den anderen Romanfiguren teilt, so gibt es auch in den Essays verschiedene Standpunkte und jeder hat seine Berechtigung, sofern er dem Anderen dessen Berechtigung lässt. Als Historiker sieht Kermani es als seine Aufgabe an, das Gewesene und das Geschriebene immer neu in der Erzählung vom Ballast der überlieferten Interpretationen zu befreien; als Schriftsteller gibt er jedem Einzelnen Raum – und gerade auch den in ihrer Weltsicht allzu Verstrickten. Er dekonstruiert mit Sorgfalt und sprachlicher Energie die Vor-Stellungen, die wir uns – und natürlich zuallererst: die er sich – vom Anderen macht. »Unser Beruf ist das Fragenstellen, nicht das Antworten«, notiert er. Tatsächlich wird die Welt durch die Schönheit gerettet – ein Gedanke, den Kermani von Dostojewski hat; und man möchte hinzufügen: durch die Erzählung. Beides, Schönheit und Erzählung, hat die Begegnung des Autors mit Renis Kreuzigung mitgestaltet und uns neue denkerische Zugänge ermöglicht, denn Kermani ist ein großer Erzähler, dem es gelingt, die Geschichte in Geschichten immer neu in ihr Recht zu setzen. Die Auflösung eingefahrener Zugehörigkeitsmuster und tradierter Denkgewohnheiten, die am Denken und am Leben, ja vor allem am Zusammenleben und Zusammenwirken hindern, verbindet seinen Ansatz mit Hannah Arendts Idee von der Welt, die zwischen den Menschen immer neu ausgehandelt werden muss – wenngleich sein Ausgangspunkt in einem Punkt von Arendts grundverschieden ist, denn Kermani ist zuallererst ein Schriftsteller, sein Denken geht vom Ich aus, seine Literatur weist immer wieder die eigenen Erfahrung als Denkanstoß aus.
In einer Zeit, da politische und religiöse Lager sich weltweit zu polarisieren scheinen, erhält Navid Kermani den HannahArendt-Preis für politisches Denken 2011 für seine Analysen und Interventionen, die gerade auch durch ihre fundierten Kenntnisse den Blick frei und freiheitlich schweifen lassen können in christlicher, jüdischer wie islamischer Geschichte und Bild-Gegenwart und auf diese Weise weit mehr zum Verstehen der Zeit, in der wir leben, beitragen, als wohlmeinende interreligiöse Podiumsdebatten (Otto Kallscheuer). Das Dynamit dieses außereuropäischen Europäers und muslimischen Deutschen ist von eigener Art, denn sein an Kants Kritik des Erhabenen geschulter Ansatz hat eine eigene Bildwelt, die uns zu denken gibt. Dafür danken wir.
Die Realisierung der partiellen Säkularisierung
Mir war, als würde nicht ich ausgezeichnet, nicht ich aufgenommen, sondern meine Vorfahren, ihr Wissensdurst, ihre Sehnsucht nach der Welt, ihr Mut, sie zu entdecken, ihr Ehrgeiz ebenso wie ihre Tugendhaftigkeit und meinetwegen Großvaters Ernst und seine Humorlosigkeit, die sie von Generation zu Generation weitergaben, damit am Ende einer ihrer Söhne in die Akademie der Franken aufgenommen wird. Jetzt sehe ich Großvater, wie er weinend auf der Kutsche sitzt, die gleich nach Teheran abfährt, und denke, dort zum Beispiel, auch dort, hat unsere Reise begonnen.« Das, meine Damen und Herren, hat sich Navid Kermani (oder zumindest sein Alter Ego aus dem Roman Dein Name auf S. 228) während der Aufnahmezeremonie der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung im Staatstheater Darmstadt gedacht. Ich weiß ja nicht, was Navid Kermani sich heute, da er den HannahArendt-Preis bekommt, denkt. Aber er könnte es sich denken. Und darum würde ich gerne etwas dazu sagen. »Unsere Reise«, die dort begonnen hat, diese Reise von Isfahan an die Amerikanische Schule nach Teheran, war eine Reise zur Bildung, eine Reise, die in Auszeichnung und Aufnahme mündete. Ist das nicht eine exemplarische Vollendung des Bildungsversprechens? Dieses Versprechen ist heute eine zentrale gesellschaftliche Kategorie. Bildung gilt als das Allheilmittel für alle gesellschaftlichen Probleme. Bildung ist das Kaninchen, das bei allen Diskussionen um Fragen der Migration aus dem Hut gezaubert wird, der Zauberschlüssel der Integration, der alle Türen zu unserer Gesellschaft aufzusperren verspricht. Warum eigentlich? Was soll Bildung genau leisten? Sie soll eine reflexive Distanz herstellen, eine Distanz zu den Wurzeln, eine Distanz zu einer Identität, die direkt, naiv gelebt wird. Bildung soll die Aufgabe erledigen, die die Migration der Mehrheitsgesellschaft stellt. Sie soll fürs Ankommen sorgen. Bei Navid Kermani ist Wissensdurst, ist Bildung genau das und zugleich genau das Gegenteil davon. Denn Bildung ist auch das Versprechen gegenüber seinen Vorfahren. Bildung ist für ihn auch das Medium, in dem er seinen Vorfahren treu ist. »Unsere Bildungsreise« – das ist zugleich sein Modus anzukommen, hier, in diesem Deutschland, in dem er geboren und aufgewachsen ist, aus dem er aber nicht stammt, ein Modus anzukommen und zugleich ein Modus der Treue zu seinen Vorfahren. Und das zeigt sehr deutlich, was passiert, wenn man dem Versprechen der Bildung folgt. Was dabei passiert, ist eine doppelte Verschiebung: Das Ankommen, das so stattfindet, dieses Ankommen ist nicht das Aufgehen in der bildenden Gesellschaft. Bildung produziert nicht – oder nicht notwendig – das Lossagen von dem, was immer noch die »eigene« Kultur ist. Bildung ist nicht der Königsweg zur Assimilation, zur assimilierenden Integration. Und gleichzeitig ist die Treue zu den Vorfahren, die Treue zu ihrem Erbe – selbst wenn sie sich im glücklichsten Fall, wie in dem von Navid Kermani, im Medium der Bildung selbst vollzieht –, gleichzeitig wird diese Treue zu einem Umschreiben des Erbes: Es lässt sich nur bewahren, wenn es verändert wird.
Was aber bedeutet das für die Identität des Einzelnen? Die übliche Antwort lautet: Wir leben heute eben in verschiedenen Kulturen, Loyalitäten, Sprachen und nicht in fest umrissenen, monolithischen, monokulturellen Identitäten. Aber die Vielzahl, die Vervielfältigung von Identitäten ist nur die oberflächliche Antwort auf die Frage, was das mit uns macht. Oberflächlich, denn sie suggeriert, diese Pluralisierung sei einfach nur eine Akkumulation von unterschiedlichen kulturellen Elementen. Der eigentliche, der zentrale, der drängende Punkt ist doch: Was macht diese Pluralität mit uns? Wie bewohnen wir diese Vielfalt, wie bewohnen wir unsere Identitäten? Eines ist klar: Wir bewohnen sie anders als unsere Vorfahren (nicht nur jene Navid Kermanis). Für diese war Identität die Konstruktion einer imaginären Ganzheit. Das Versprechen der Gemeinschaft, aber auch jenes der Nation, war ja, man könne ihr voll und ganz angehören. Diese Gruppierungen versorgten ihre Mitglieder mit einem Herrensignifikanten, mit einem dominierenden Identitätsmerkmal, das die vielen verschiedenen biografischen Elemente, aus denen jeder besteht, vereinheitlicht. Sie haben also die Vorstellung einer vollen Identität erzeugt. Dieses Verhältnis ist aber dabei, sich gründlich zu verändern. Nicht weil wir heute so aufgeklärt wären – nichts ist so aufklärungsresistent wie eine Identität. Auch nicht, weil wir heute so fragmentiert wären oder weil es keine funktionierenden Gruppen mehr gäbe. Die vollen Identitäten, die vollen Zugehörigkeiten zu einer Gemeinschaft sind deshalb Vergangenheit, weil heute die Spaltung Eingang in die Identität, Eingang in die imaginäre Konstruktion selbst gefunden hat. Das, was die Illusion der vollen Zugehörigkeit im alten Sinne heute verhindert, ist schlicht deren Pluralisierung, die Vielzahl von »vollen« Identitäten, die heute nebeneinander existieren. Dabei handelt es sich aber gerade nicht um eine Akkumulation von Vielfalt, sondern vielmehr um eine grundlegende, eine radikale Veränderung. Diese Veränderung, die die Pluralisierung bewirkt, lautet: Westliche Gesellschaften haben heute kein Weltbild mehr, das von allen geteilt werden kann.
Das betrifft auch und gerade das Konzept der Nation. Die Nation war der Versuch, die Gemeinschaft unter den Bedingungen der Moderne in die Gesellschaft einzuführen. Die Erzählung von der Nation war also ein Weg, in Massengesellschaften tatsächliche Bindungen herzustellen. Heute erodiert das Konzept der Nation – nicht nur weil deren Souveränität eingeschränkt wird. Es erodiert auch, weil die Nation weniger denn je eine volle Gemeinschaft herzustellen vermag. Wir leben in Gesellschaften, die kulturell, religiös, ethnisch so vielfältig sind, dass sie nicht einmal mehr in der Erzählung homogenisierbar sind. Nun lässt sich aber das Konzept einer homogenen Nation nicht einfach durch das einer pluralen Nation ersetzen. Eben weil Nation auch eine bestimmte Art der Bindung des Einzelnen ans Ganze bedeutete. Die Nation war das Angebot einer vollen Identität, während plurale Gesellschaften, eben weil sie plural sind, nur mehr Identitäten, die das Faktum des Pluralismus einbegreifen, anbieten können. Das ist eine Verschiebung auf der Ebene der Bindungen, eine Verschiebung in der Art, wie wir unsere Identität heute bewohnen.
Was das bedeutet, zeigt sich am deutlichsten an der Veränderung des Konzepts des Staatsbürgers. Identitätspolitisch bedeutet Staatsbürgerschaft heute nicht mehr, dass man »weiß« werden muss, dass man seine »Differenzen an der Garderobe abgeben muss« (um hier auch an Hannah Arendt zu erinnern). Es erfordert keine Konversion mehr. Man muss heute keine andere volle Identität annehmen. Bei Kermani heißt das: Migranten sollen sich »Züge von Fremdheit bewahren« unter der Bedingung, »dass sie sich eindeutig zum Grundgesetz und seinen Werten bekennen« (Wer ist wir? Deutschland und seine Muslime). Ich würde da noch weiter gehen: Denn ein solches Bekenntnis setzt noch einen emphatischen Citoyen und in diesem Sinne ein gemeinsames Weltbild voraus. Heute aber ist der Citoyen keine eigene Identität mehr, sondern nur eine Einschränkung unserer privaten Identitäten. Die öffentliche Identität als Staatsbürger bedeutet nur einen Abzug von unseren vollen Identitäten, das Paradoxon eines Weniger an Identität, das zu unserer Identität hinzukommt. Das ist also die Art, wie wir heute unsere Subjektivität bewohnen: als nicht-volle Identitäten. So manifestiert sich das – unhintergehbare – Faktum der Pluralität. Nicht als ein Mehr an Identität, nicht als eine Akkumulation unterschiedlicher Identitäten, sondern als deren Einschränkung, als ein Weniger, als nicht-volle Identität eben. Migranten werden immer wieder danach gefragt, für wen sie beim Fußball die Daumen drücken, um daran den Grad ihrer Integration abzulesen. Die Frage verkennt aber diese Verschiebung völlig. Selbst wenn ein türkischer Migrant die Daumen für Deutschland drückt, so hat er trotzdem keine volle deutsche Identität. Und wenn er zur Türkei hält, so ist er deswegen doch kein voller Türke. Die Nation selbst hat gewissermaßen ein spaltendes Element bekommen: das einer nicht-vollen Identität ihrer Bürger. Emotion ist da kein Indikator, denn nicht-voll ist nicht gleichbedeutend mit abgekühlt. Nicht-volle Identität gibt es auch bei aufrechtem Hitzebetrieb. Sie ist aber auch nicht gleichbedeutend mit Hybrisierung oder Bindestrich-Identitäten, geht sie doch diesen Formen vielmehr voraus. Anders gesagt: Sogar wenn wir nicht gemischt sind, sogar wenn wir der kulturellen und nationalen Identität genügen, sogar katholische Österreicher und protestantische Norddeutsche sind heute nicht-volle Identitäten, nichtvolle Bürger.
Diese Bewegung erfasst auch den religiös Gläubigen. In seiner Studie Ein säkulares Zeitalter schreibt Charles Taylor, der Gläubige könne heute nicht mehr im vollumfänglichen Sinn gläubig sein, da sein Glaube immer neben anderen Glauben ebenso wie neben dem Nichtglauben bestehen muss. Die Pluralität konkurrierender Identitäten, Überzeugungen, Gemeinschaften hat Eingang in den Glauben selbst gefunden. Dieser funktioniert nur noch als Gegenbehauptung, nicht mehr als einfache Behauptung. Jede Identität, jede Gruppenzugehörigkeit steht heute, nach Verlust der Dominanzstellung von Kirche und Nation, von Hochkultur und was es mehr an solchen homogenisierenden Instanzen gab, neben anderen, und das Wissen darum schränkt diese ein. Selbst der überzeugteste Gläubige, selbst der glühendste Patriot gehört heute seiner Gemeinschaft nicht mehr voll an, sondern nur noch nicht-voll. Nicht-voll heißt, dass die eigene volle Überzeugung und auch Bindung immer Bescheid weiß, dass sie nur eine Option unter anderen ist. Man könnte dies auch als eine partielle Säkularisierung bezeichnen.
Und das führt uns zurück zu Navid Kermanis Großvater. Die Treue zu den Vorfahren – verstanden als testamentarisches Band, das einen zum Erben macht –, solchen Umgang mit dem Andenken der Toten hat Jacques Derrida als religiös bezeichnet. Diese Form der Religiosität scheint aber bei Kermani von genau solcher partiellen Säkularisierung bestimmt. Das wird besonders deutlich an dem, wie das Heilige bei ihm vorkommt. Genauer gesagt daran, dass es überhaupt vorkommt und welchen Platz es dabei einnimmt. Denn das Heilige hat bei Kermani keinen vorgesehenen, abgesonderten Platz. Es erscheint vielmehr in seinem Gegenteil – im Profanen, im Alltäglichen. Es war der Ethnologe Michel Leiris, der in seinem Buch Das Heilige im Alltagsleben das Konzept des Profan-Heiligen beschrieben hat. Profan-heilig sind Alltagsdinge, die zur Reliquie werden. Diese Ambivalenz eignet vornehmlich Dingen, die aus der Kindheit stammen. An diese kann man glauben, diese können heilig aufgeladen werden, weil mit ihnen eine Geschichte verbunden wird. Bei Kermani erzeugt diese Verdoppelung, dieses oft schroffe Aufeinandertreffen des Heiligen und des Profanen häufig Momente von großer Komik. Etwa wenn er schildert, welche Überwindung es kostet, in der Pause eines Workshops die Sekretärin nach einem Raum für eine »Eskapade wie das Gebet zu fragen«. Und wenn er dann am Waschbecken einer öffentlichen Toilette eine rituelle Reinigung vollzieht – »dieser ganze Vorgang, das Ausziehen der Schuhe, das Waschen der Füße, dann wieder in die Schuhe hineinschlüpfen, möglichst ohne mit den Füßen aufzutreten, das alles ist kurios, wenn hinter einem ein wissenschaftlicher Mitarbeiter steht«. Auf dieser Toilette, in diesem Zusammenprall von heilig und profan wird die partielle Säkularisierung schlagend. Kermani beschreibt die Spaltung der vollen Identität, wenn er »durch das Gebet an einer Gemeinschaft teilhat« und gleichzeitig »den Eindruck vermeiden möchte, sich aus einer anderen Gemeinschaft auszuschließen«. Oder auch in »Mittelstrahl«, einer Szene aus seinem neuesten Roman, in der der Protagonist beim Urologen auf der Toilette – wieder eine Toilette (!) – steht, um eine Urinprobe abzugeben, die dann aber ins »heilignüchterne« Wasser des WCs kippt. Heilignüchtern ist die ganze Szene, in der das Niedrige mit dem Hohen verknüpft wird – wir kennen das von Hegel, der diese Verknüpfung im Organ der Zeugung findet, das zugleich Organ des Pissens ist. Bei Kermani verknüpft sich das profane Toilettenwasser mit jenem weihevollen »heilignüchternen Wasser« aus Hölderlins Gedicht »Hälfte des Lebens«, in das die Schwäne »trunken von Küssen ihr Haupt tunken«. Kermani hat sich – und das ist für mich das vielleicht Erstaunlichste –, er hat sich bei seiner partiellen Säkularisierung sehr weit vorgewagt. So weit, dass es ihm sogar gelungen ist, in das Heilige der Anderen vorzudringen – in jenes der Deutschen durch seine Anverwandlungen deutscher Tradition wie etwa bei Hölderlin. Hölderlin, den er den »Sufi der deutschen Literatur« nannte. Das ist ein Eindringen in eine andere Tradition, ein Eindringen, das nicht nur Bildung, also Wissen ist, sondern ein emotionales Durchdringen, ein Zugang zu einem anderen Heiligen. Noch weiter und noch viel erstaunlicher ist dies jedoch in Bezug auf eine andere Religion, das Christentum. Sein Zugang zum Kreuz, sein Eindringen, ja sein Übertritt in »verschlossene Gefühls- und Glaubenswelten« (wie das Gustav Seibt in der SZ genannt hat) ist wirklich sehr erstaunlich. Weiter kann man sich kaum vorwagen. Die völlig verständnislosen Reaktionen darauf seitens der christlichen Kirchen bestätigten noch einmal deren Verkennen der partiellen Säkularisierung, die uns alle – Gläubige und Nicht-Gläubige – betrifft. Und wenn man sagen kann, diese partielle Säkularisierung sei das Signum Europas, jenes Europas, von dem man gar nicht weiß, wie lange es noch besteht, dann muss man aber auch hinzufügen, dass dies ein bedrohtes Signum ist. Eiferer aller Art laufen Sturm gegen das Europa der partiellen Säkularisierung, gegen das Europa der nicht-vollen Identitäten. Dagegen setzen sie von der Leitkultur übers christliche Abendland bis hin zur Beschwörung der Volksgemeinschaft ein ganzes Arsenal zur Rekonstruktion der vollen Identitäten. Einer Rekonstruktion bedarf es aber erst nach einem Verlust. Gerade weil die vollen nationalen, religiösen, kulturellen Identitäten nicht mehr in der Form greifen, kommt es zu einer massiven Gegenbewegung. Eine solche findet sich bei den Rechten, bei den Eiferern auf beiden Seiten: bei jenen der Mehrheits- und bei jenen der Minderheitsgesellschaft. Die Rekonstruktion kann jedoch nicht mehr volle, sondern nur geschlossene Identitäten herstellen. Bei den Minderheitengruppen heißt diese Strategie: Abschottung, niemand darf hinaus. In der Mehrheitsgesellschaft bedeutet das: Keiner darf herein, Exklusion. »Die Rechten«, schreibt Kermani, »attackieren den Islam, aber zielen auf Europa«. Ja, sie zielen auf die nicht-vollen, auf die in diesem Sinne »europäischen« Identitäten. Hier verläuft die wahre Trennlinie, die unsere Gesellschaften spaltet. Wenn der Moslem Navid Kermani heute einen Preis bekommt, der den Namen und den Geist der Jüdin Hannah Arendt trägt, wenn heute im protestantischen Norden eine ganz säkulare Jüdin aus Wien die Laudatio dazu hält, dann ist das keine große Ökumene, dann ist das nicht der Beweis eines interkulturellen Dialogs, sondern die Realisierung des demokratischen, des europäischen Geists der partiellen Säkularisierung, in dem wir uns alle treffen können. In diesem Sinne gratuliere ich uns allen, wenn ich sage: Meinen herzlichen Glückwunsch zum Hannah-Arendt-Preis, Navid Kermani.
Ein politisches Denken als Widerlegung der Geschichte
Es gibt zahlreiche Preise, die in Deutschland verliehen werden, und wohl die meisten tragen den Namen eines verstorbenen Literaten, eines Gelehrten, eines Politikers oder Mäzens. Der Preis, den ich heute erhalte, hat neben dem Namen der berühmten Person einen merkwürdigen Zusatz: Es ist ein Preis für politisches Denken. Ich muss sagen, dass der Ausdruck mir spontan gefiel: politisches Denken. Zugleich fragte ich mich, was damit wohl genau gemeint sei. Die Frage, was Politik ist, ließe sich mit Hannah Arendt sehr viel leichter beantworten, sie hat in ihren letzten Jahrzehnten immer wieder darüber nachgedacht, sogar ein eigenes Buch darüber geschrieben. Auch für das politische Urteilen, die politische Philosophie, das politische Handeln könnte man Erklärungen anführen, die auf ihren eigenen Worten beruhen. Aber was bedeutet es, politisch zu denken? Wodurch unterscheidet sich ein politisches von einem nichtpolitischen Denken? Und was wäre, da ich nun einmal mit eben diesem Preis ausgezeichnet werde, was wäre an meinem Denken politisch? Nun wäre es nahe liegend, das politische Denken in einem Analogieschluss durch seinen Bezug zur Politik zu definieren, damit zu der Welt zwischen den Menschen, wie Hannah Arendt den politischen Raum selbst nannte. Vielleicht hätte sie selbst diese Erklärung akzeptiert, die sich aus ihrem Begriff des Politischen ableiten lässt. Und doch griffe das relativ neutrale Merkmal des öffentlichen Bezugs zu kurz, würde man es auf ihr eigenes Werk anwenden. Schließlich versieht Hannah Arendt selbst das Wesen der Politik mit einer Wertung, die nicht politikwissenschaftlich, sondern allein politisch zu rechtfertigen ist: Politik sei »die Sache der Freiheit gegen das Unheil der Zwangsherrschaft jeglicher Art«. Sehr viel tiefgründiger ist das politische Denken, wie Hannah Arendt es vielleicht nicht definiert, aber mir in ihren Büchern zum Vorbild gibt, in drei Formulierungen bezeichnet, die gar nicht ihr eigenes Werk meinen. Nebenher bemerkt ist es wohl auch Ausdruck ihrer Noblesse, dass sie ihr eigenes Bemühen markiert, indem sie vom Gelingen anderer Autoren spricht.
Die erste Formulierung, die ich anführen möchte, stammt aus einer Zueignung an ihren Lehrer Karl Jaspers: sich in der Wirklichkeit zurechtzufinden, ohne sich ihr zu verschreiben, wie man sich früher dem Teufel verschrieb. In diesem Dreiklang sind wesentliche Motive von Hannah Arendts eigener Arbeit zum Ausdruck gebracht: der Wille, die Wirklichkeit zu verstehen – sich in ihr zurechtzufinden –, aber dann eben auch der Wille, die Wirklichkeit nötigenfalls zu verändern – sich ihr nicht zu verschreiben – und schließlich der Glaube an die Veränderbarkeit, damit den freien Willen und den Auftrag der Vernunft – hingegen man sich der Wirklichkeit früher wie dem Teufel verschrieb. Denken allein ist ein Prozess begrifflicher Klärung und Verdichtung. Politisches Denken hingegen, wie Hannah Arendt es zum Vorbild gibt, entschlüsselt das Gewordene als Gemachtes und ist damit seinem Wesen nach widerspenstig. Es akzeptiert die Verhältnisse niemals als notwendig, die es zu verstehen sucht. Die Notwendigkeit, so schreibt Hannah Arendt wenige Zeilen später, sei nur der Spuk, »der uns locken möchte, eine Rolle zu spielen, anstatt zu versuchen, irgendwie ein Mensch zu sein«. Irgendwie ein Mensch zu sein – das ist nun ein außerordentlich vager, geradezu pathetischer Ausdruck, wie man ihn bei Hannah Arendt selten findet. Und doch ist er ebenso wohlplatziert wie vielsagend, insofern das politische Denken zwar analytisch vorgeht, aber auf einem vorbegrifflichen Akt der Empathie beruht, der Mitmenschlichkeit oder Parteinahme, sei es in der Ausprägung des Mitleids oder des Zorns.
Im Zusammenhang mit Gotthold Ephraim Lessing – und damit bin ich bei der zweiten Zuschreibung angelangt, die ich anführen möchte, um das politische Denken zu bezeichnen –, im Zusammenhang mit Lessing weist Hannah Arendt darauf hin, dass die griechische Affektlehre nicht nur das Mitleid, sondern auch den Zorn unter die angenehmen Gemütsempfindungen rechnete, während sie die Hoffnung zusammen mit der Furcht als Übel verbuchte. Diese Wertschätzung des Zorns habe nichts mit dem Grad der Erschütterung zu tun, sondern mit dem Grad seines »Realitätsbewusstseins«, wie Hannah Arendt betont: »In der Hoffnung überspringt die Seele die Wirklichkeit, wie sie in der Furcht sich vor ihr zurückzieht. Aber der Zorn … stellt die Welt bloß.« Zorn und Mitleid sind keine Wörter, die einem auf Anhieb in den Sinn kommen, wenn man Hannah Arendt liest. So elegant ihre Prosa ist, so kühl ist sie auch, betont rational, beinah distanziert und frei von rhetorischen Effekten. Gerade im Vergleich mit ihren philosophischen Lehrern sticht diese Klarheit ins Auge, mit der Feierlichkeit Karl Jaspers und dem Raunen Martin Heideggers. Gleichwohl meine ich eben in der Abwehr jedweder Sentimentalität jenes Übermaß des Sentiments angezeigt zu sehen, das im Übermaß der Not brennt. Diese Not ist mehr als existenziell, denn sie wird nicht nur durch die Möglichkeit der eigenen, individuellen Auslöschung erzeugt. Die Not ist zugleich kollektiv, insofern sie mit der Auslöschung ihres gesamten Volkes rechnen muss, damit der Vergangenheit, der Erinnerung, des bloßen Namens. Zu morden ist das eine. Das Unvorstellbare, das der Nationalsozialismus versucht hat, ist es gewesen, niemanden übrig zu lassen, der um die Ermordeten trauert, damit den ärgsten Fluch der Juden wahr werden zu lassen: Nicht gedacht soll deiner werden. Damit bin ich bei der dritten Formulierung angelangt, mit der Hannah Arendt jemand anderen charakterisiert, aber beinah treffender sich selbst: Mit Blick auf Stefan Zweig spricht sie von »jener erbarmungslosen Genauigkeit, welche der Kälte der echten Verzweiflung entspringt«. Ich kenne keine Beschreibung, die für ihre großen historischen Werke und zumal die Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft treffender wäre. Neben vielen anderen, was dieses Buch heute so unglaublich erscheinen lässt, die Weite der gedanklichen Bögen, die analytische Durchdringung der geschichtlichen Erfahrung, die Originalität der deutenden Synthese, das helle Bewusstsein der Gegenwart, ist es auch seine Entstehungszeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Toten nicht einmal überschlagen, die Überlebenden noch ohne Gelegenheit zur Besinnung waren, als die Bilder der Vernichtungslager nicht im Geschichtsunterricht, sondern in den Wochenschauen gezeigt wurden. Obwohl das Buch praktisch in der Zeitgenossenschaft der Katastrophe entstand, die Hannah Arendt unmittelbar betraf, hat es den Gestus abwägender Geschichtsschreibung. Kaum eine Formulierung findet sich darin, die vordergründig anklagt, nichts menschelt, nichts schwelgt, nichts rüttelt durch sprachliche Effekte auf. Nicht ein einziges Ausrufezeichen benötigt sie auf den annähernd tausend Seiten, keine Superlative, keine rhetorischen, also Mitgefühl beschwörenden Fragen, keine Aufrufe zur Empörung. Mitleid und Zorn sind in Hannah Arendts politischem Denken in einen anderen, unsichtbaren Aggregatzustand überführt. Was sie sich vereinzelt erlaubt, ist der zeremonielle Ton einer Grundsatzerklärung, aber auch nur dort, wo sie das Ideal anführt, bevor sie dessen Unzulänglichkeit nachweist. Etwa setzt sie den Beginn der politischen Neuzeit bei der Erklärung der Menschenrechte durch die beiden großen Revolutionen an, der amerikanischen und der französischen, mithin auf das letzte Drittel des achtzehnten Jahrhunderts. »Diese Erklärung«, so schreibt sie, »besagt nicht mehr und nicht weniger, als dass von nun an der Mensch als solcher, und weder die Gebote Gottes noch die des Naturrechts, noch die Gebräuche und Sitten der durch Tradition geheiligten Vergangenheit, den Maßstab dafür abgeben können, was recht und unrecht sei. In der Sprache des achtzehnten Jahrhunderts besagte sie, dass die Völker sich von der Vormundschaft aller gesellschaftlichen, religiösen und historischen Autoritäten befreit hätten, dass das Menschengeschlecht seine ›Erziehung‹ beendet habe und mündig geworden sei.«
Das sind wohlklingende, auch wohlgesetzte, zugleich erhabene wie erhebende Worte, die noch heute jede Festrede auf die Aufklärung, auf Europa, auf die westliche Zivilisation schmücken könnten. Aber bei Hannah Arendt stehen solche Worte nicht in einer erbaulichen Abhandlung über den Fortschritt der Menschheit; sie leiten den letzten Abschnitt eines Kapitels ein, das wie kaum eine andere historische Analyse des zwanzigsten Jahrhunderts noch einen heutigen Leser beunruhigen müsste: das Kapitel über den Niedergang des Nationalstaates und das Ende der Menschenrechte. Das aus ihrer Feder selten salbungsvolle Lob der Menschenrechte steht ausgerechnet dort, wo sie deren Aporie zu erklären anhebt. Und Hannah Arendt selbst lässt keinen Zweifel, dass eben in der Feierlichkeit der Sprache, die sich aus dem neunzehnten Jahrhundert konserviert hat, selbst schon ein Problem liegt. Nur eine Seite später bemerkt sie: »Die Menschenrechte haben immer das Unglück gehabt, von politisch bedeutungslosen Individuen oder Vereinen repräsentiert zu werden, deren sentimental humanitäre Sprache sich oft nur um ein geringes von den Broschüren der Tierschützer unterschied.« Was dann folgt, ist eine bezwingend logische, historisch fundierte, aber in der Ausweglosigkeit auch beklemmende Darstellung der Dilemmata der modernen Nationalstaaten und deren – nein, nicht deren Versagen, schlimmer: deren strukturell bedingte Unfähigkeit, die universellen Menschenrechte zu garantieren. Insofern die Proklamation der Menschenrechte mit der Schaffung des Nationalstaates einherging und die Französische Revolution die Menschheit daher als eine Familie von Nationen begriff, bezogen sich diese Rechte von vornherein auf ein Volk, nicht auf das einzelne Individuum. Das hieß aber auch, dass die Menschenrechte an die Staatsbürgerrechte gekoppelt waren. »Was diese Verquickung der Menschenrechte mit der im Nationalstaat verwirklichten Volkssouveränität eigentlich bedeutet, stellte sich erst heraus, als immer mehr Menschen und immer mehr Volksgruppen erschienen, deren elementare Rechte als Völker im Herzen Europas so wenig gesichert waren, als hätte sie ein widriges Schicksal plötzlich in die Wildnis des afrikanischen Erdteils verschlagen.«8 Als sich mit dem Ende des Ersten Weltkriegs die letzten multiethnischen Großreiche auflösten und überall auf dem Kontinent neue, teilweise willkürlich konstruierte Nationen entstanden, deren Staatsvolk sich keineswegs mit deren Bewohnern deckte, blieben allerorten Minderheiten über, die nicht in der alten, auch schon imaginierten Dreieinigkeit von Volk-Territorium Staat aufgingen. Kam den anerkannten Minderheiten zwar nicht Gleichberechtigung, aber als Staatsbürger immerhin ein Rechtsanspruch zu, so war die Situation noch dramatischer für die vielen Millionen Flüchtlinge und Staatenlosen, die der Erste Weltkrieg ohne Papiere zurückließ. Insofern sie sich nicht des Schutzes einer Regierung erfreuten, waren sie auf das Minimum an Recht verwiesen, das ihnen angeblich eingeboren war. Allein: Es gab niemanden, es gab keine staatliche oder zwischenstaatliche Autorität, die diesen Staatenlosen das Recht garantieren konnte. »Staatenlosigkeit in Massendimensionen«, so schreibt Hannah Arendt, »hat die Welt faktisch vor die unausweichliche und höchst verwirrende Frage gestellt, ob es überhaupt so etwas wie unabdingbare Menschenrechte gibt, das heißt Rechte, die unabhängig sind von jedem besonderen politischen Status und einzig der bloßen Tatsache des Menschseins entspringen.« Jedenfalls die Minderheiten, Flüchtlinge und Vertriebenen des Ersten Weltkrieges scheinen diese Frage verneint zu haben, denn wo immer sie sich organisierten, appellierten sie an ihre Rechte als Polen, als Juden oder als Deutsche. Niemand unter ihnen kam auf die Idee, an die Menschenrechte zu appellieren. »Es ist sinnlos, Gleichheit vor dem Gesetz zu verlangen, für den es kein Gesetz gibt.« Einige Leser Arendts haben vorgeschlagen, ihre Argumentation auf die Flüchtlinge unserer Zeit zu übertragen, die ohne Pass oder Aufenthaltsrecht, im Illegalen also leben. Ob das nun hilfreich ist oder nicht, so meine ich doch, dass Arendts These vom Ende der Menschenrechte heute in einem noch umfassenderen Sinne von Belang ist, insofern sie das Wesen des Nationalstaates als solchen berührt. Interessant ist ja, dass Hannah Arendt vom Ende der Menschenrechte zu einem Zeitpunkt spricht, als die Vollversammlung der Vereinten Nationen gerade einstimmig die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet hat. Ohne Zweifel hat sie die Entwicklungen begrüßt, die es nach dem Zweiten Weltkrieg im internationalen Recht gegeben hat. Ich denke hier vor allem auch an die Genfer Flüchtlingskonvention, den Hohen Kommissar für Flüchtlingsfragen der Vereinten Nationen oder den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Aufgabe dieser Institutionen ist es eben, auch jenen ein Recht zu sichern, denen innerhalb einer nationalen Staatlichkeit kein Recht zukommt. Und doch bleibt die Problematik des Nationalstaats, dem wir zugleich die Demokratie verdanken, im Kern bestehen. Aus der Souveränität des Volkes, das an die Stelle des absoluten Fürsten getreten ist, folgt bis heute notwendig eine Definition derer, die zum Volk gehören und also auch derer, die nicht zum Volk gehören. Gerade das Prinzip der Volkssouveränität zwingt den Nationalstaat zur Unterscheidung, zur Identifikation. »Sofern sich innerhalb der Nation auch Menschen anderer volksmäßigen Abstammung befinden, so verlangt das Nationalgefühl, dass sie entweder assimiliert oder ausgestoßen werden.«
Gewiss hat Europa das Gewaltpotenzial, das in dieser Unterscheidung in Bürger und Nichtbürger liegt, seit dem Zweiten Weltkrieg entschärft, und verbietet sich jeder Vergleich mit der Situation, die Hannah Arendt vor Augen hatte, als Nichtbürger wie Leprakranke gekennzeichnet, später wie Tiere geschlachtet wurden. Und doch sind die Debatten, die schon lange vor dem Nationalsozialismus und auch heute wieder um die Rechte der anderen geführt werden, der Minderheiten, der Andersgläubigen, der Einwanderer und sogar der Touristen, die je nach Herkunftsland für ein Visum inzwischen einen Aktenordner voll von Bürgschaften, Grundbüchern, Kontoauszügen, Versicherungen, Urkunden und Arbeitsbescheinigungen vorlegen müssen – sind diese Debatten nicht zu verstehen, ohne die Grundlagen, aber auch Abgründe der modernen Nationalstaatlichkeit zu berücksichtigen, wie sie sich infolge der Französischen Revolution herausgebildet hat. Noch immer liegt den Debatten wie den Passkontrollen die Frage zugrunde: Wer ist Wir? Dieses Wir ist durchlässiger geworden, ja. Der Sohn oder die Tochter eines Einwanderers kann in höchste Staatsämter oder Akademien gelangen. Aber allein schon das Wort der Integration, das Norm geworden ist, zeigt an, dass die Grundlage weiterhin die Vorstellung eines irgendwie einheitlichen Staatsvolkes ist, für das ein Fremder sich zu qualifizieren, in das er sich einzubringen hat. Integration ist schon dem Wort nach ein einseitiger Vorgang: Ein Einzelner oder eine Gruppe integriert sich in ein bestehendes Ganzes. Man kann in Deutschland Gründe dafür anführen, den Begriff des Staatsvolkes auch weiterhin als etwas Einheitliches zu denken, als eine ethnisch und religiös inzwischen erweiterbare, aber doch sprachlich und kulturell irgendwie homogene Gemeinschaft. Aber man sollte sich mit Hannah Arendt der Entstehungsgeschichte dieses Anspruchs bewusst sein und ihn nicht für ein Naturgesetz halten. Volkssouveränität hat etwa in der amerikanischen Revolution eine gänzlich andere Bedeutung als in der französischen, und so stellen sich die Probleme, die die Einwanderung heute in den Vereinigten Staaten aufwirft, auf ganz andere Weise dar als in Europa. In der Französischen Revolution verlagerte sich der Akzent früh von der Republik auf das Volk, sodass Dauer und Identität des Staates also nicht durch die Institutionen, sondern im Rückgriff auf Rousseaus Theorien von einem angenommenen Willen des Volkes garantiert werden sollten, der als einheitlich gedacht, im tatsächlichen Verlauf der Revolution aber in eine Einmütigkeit gezwungen wurde; ganz anders verstanden die Väter der amerikanischen Revolution das Wort »Volk« niemals als einen Singular, sondern schon aufgrund der Zusammensetzung der Gesellschaft aus Zuwanderern vieler Länder natürlicherweise als eine Vielheit, die es nicht kulturell zu vereinheitlichen, sondern demokratisch zu organisieren galt. Entsprechend wurde als die wichtigste und bedeutungsvollste aller revolutionären Taten die Verabschiedung einer Verfassung empfunden, während in allen anderen, und zwar nicht nur europäischen Revolutionen seither der neue Verfassungsstaat stets in Gefahr stand, von denen wieder weggeschwemmt zu werden, die sich auf die öffentliche Meinung oder die Volonté générale beriefen, als habe das Volk tatsächlich nur eine Meinung, nur einen Willen. Der Verrat Robespierres, der die Volksgesellschaften mit dem Argument auflöste, es gäbe nur eine große Société populaire, das französische Volk, ist bei Hannah Arendt mehr als nur die Machtergreifung durch eine einzelne Fraktion. Er steht stellvertretend für den Betrug des Nationalismus überhaupt, »der eine Wahnvorstellung an die Stelle einer lebendigen Realität setzt«. Nicht nur für die Deutschen, auch für die siegreichen Völker des Zweiten Weltkrieges wäre es ungleich bequemer, den Nationalsozialismus als Fehlentwicklung der abendländischen Zivilisation abhandeln zu können, isoliert von den anderen westlichen Demokratien, als eine Barbarei und damit, wie es das Wort schon sagt, als etwas Fremdes, Dunkles, aus der europäischen Geschichte nicht kausal Abzuleitendes. Hannah Arendt, hierin sehr viel näher an der Dialektik der Aufklärung als an der Apologetik ihrer eigenen Lehrer, weist nach, wie im Ursprung der Französischen Revolution selbst schon der Nationalismus angelangt war, der sich keineswegs auf Deutschland beschränkte, sondern im Nationalsozialismus nur seine radikalste Ausformung fand. Dass Europa die Tyrannei im Namen des Volkes nicht aus eigener Kraft überwand, sondern der Hilfe der Vereinigten Staaten bedurfte, ergab sich für sie nicht aus der zufälligen geostrategischen oder militärischen Konstellation, sondern logisch aus der Geschichte der Revolutionen. So überrascht es auch nicht, dass sie das Projekt der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg zwar wohlwollend, dessen Erfolgsaussichten aber zunächst sehr skeptisch beurteilte. Noch 1958 befürchtete sie, dass Europa so wenig einen Ausweg aus der nationalstaatlichen Organisation finden würde wie die Spätantike aus der Organisation der Stadtstaaten. Der Nationalsozialismus ist überwunden, das wird man auch am Ende dieses Herbstes noch sagen dürfen – so bestürzend die Mordserie ist, die durch den Selbstmord zweier rechtsradikaler Attentäter ans Licht kam, so unfassbar das Versagen nicht nur der Behörden, sondern der Öffentlichkeit, deren Vorurteile sie verleitet hatte, den Opfern mehr als nur die Empathie zu verweigern, nämlich sie ohne jeden Beleg zu kriminalisieren. Der Nationalsozialismus ist überwunden, aber offenbar nicht der Nationalismus, aus dem er sich herleitete. So ist es eine zufällige zeitliche Koinzidenz, aber nicht ohne inneren Zusammenhang, dass dieser Herbst nicht nur Deutschland und zuvor Norwegen mit einer neuen Qualität fremdenfeindlichen Terrors konfrontiert, sondern drastisch auch mit den Niedergang des europäischen Projektes vor Augen geführt hat. Gewiss begann dieser Niedergang nicht erst mit der Finanzkrise. Die Finanzkrise ist Ausdruck und Folge einer politischen Krise, die vor Jahren bereits einsetzte, genau gesagt im Übergang der Generation, die noch eigene Erinnerungen an die Schrecken des Krieges hatte, zu unserer Generation der Nachgeborenen, die das Wundersame der europäischen Einigung nicht aus eigener Anschauung wertschätzen kann, die jedenfalls im Westen nicht erfahren haben, was Unfreiheit konkret bedeutet. Um den Niedergang des europäischen Projekts zu konstatieren, muss man nicht abschätzig auf unsere Nachbarstaaten blicken, in denen rechtspopulistische, fremdenfeindliche, dezidiert anti-europäische Parteien auf dem Vormarsch und teilweise bereits an der Regierung beteiligt sind. Wenn ein führender Vertreter der Partei Konrad Adenauers und Helmut Kohls wie der Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag triumphierend erklärt, dass in Europa wieder deutsch gesprochen wird, ist das einen Tag vor dem Besuch des britischen Premierministers mehr als nur diplomatische Idiotie. Es ist Geschichtsvergessenheit in einem Maße, dass jedem Leser Hannah Arendts nur angst und bange werden kann. (Damit nun auf der anderen Seite des politischen Spektrums nicht allzu selbstgefällig genickt wird, möchte ich daran erinnern, dass die Verbindung von Intelligenz und Rasse von einem prominenten Vertreter der Linken wieder hoffähig gemacht wurde, und zwar, das ist für unseren Kontext dann doch sprechend, und zwar mit dem nicht minder idiotischen und erst recht geschichtsvergessenen Hinweis auf eine höhere Intelligenz des jüdischen Volkes). Aber noch einmal kurz zum Fraktionsvorsitzenden der CDU im Bundestag. Dieser deutsche Triumphator ist der gleiche, der landauf landab verkündet, die Deutschen müssten, da sie doch Christen seien, sich besonders des Schutzes der Christenheit annehmen, die wie keine andere Religionsgemeinschaft weltweit verfolgt würde. Ich werde nun nicht auf diese Behauptung eingehen oder gar die Anzahl christlicher Opfer mit den Angehörigen anderer religiöser oder ethnischer Minderheiten aufrechnen, die heute ebenfalls auf der Welt verfolgt werden. Nein, ich möchte bei Hannah Arendt bleiben und dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Bundestag die Lektüre ihres Revolutionsbuches noch aus anderem Grunde empfehlen. Es findet sich darin, obwohl von einer Jüdin geschrieben, in einer glänzenden Doppelinterpretation des Großinquisitors und des Billy Budd eine der präzisesten und eindringlichsten Darstellungen der Güte, die Jesus von Nazareth auf die Welt oder jedenfalls in die Religionsgeschichte eingebracht hat: »dass dieser es fertigbrachte, mit allen Menschen als Einzelnen mitzuleiden, und dass diese, obwohl es buchstäblich alle waren, ihm doch nicht in irgendein Kollektiv, in die eine leidende Menschheit zusammenflossen«.
Jeder Mensch, jeder gewöhnliche Mensch, handelt, denkt, urteilt, liebt als Mitglied einer Gemeinschaft, geleitet von seinem Sensus communis, wie Hannah Arendt an anderer Stelle mit Verweis auf Kant erklärt. Zugleich ist jeder Mensch durch die einfache Tatsache, ein Mensch zu sein, Mitglied einer Weltgemeinschaft. Wer politisch handelt, so hebt Hannah Arendt hervor, soll sich, wenn schon nicht der Tatsächlichkeit, dann immerhin der Idee seiner weltbürgerlichen Existenz bewusst sein, sich an seinem Weltbürgertum orientieren. Das ist das Spannungsverhältnis jedweder Politik: im Sinne der eigenen Gemeinschaft zu handeln, ohne die berechtigten Interessen anderer Gemeinschaften zu übersehen. Das ist das Spannungsverhältnis, in dem die alttestamentlichen, später auch der islamische Prophet gestanden haben: dem eigenen Volk eine Botschaft zu verkündigen, die sich doch an die gesamte Menschheit richtet. Jesu Mitleiden, wie Hannah Arendt es deutet, geht darüber weit hinaus: Es überwindet nicht nur, es sprengt die Grenzen des Gemeinschaftlichen. Die Vorstellung, dass Jesus von Nazareth einen Aufruf unterschreiben würde, nur oder auch nur speziell den Christen in der Welt beizustehen, ist im Sinne des Evangeliums widersinnig. Sein Mitgefühl kollektiviert nicht, sondern gilt radikal dem Individuum, allen Individuen, ist also als erste Liebe in der aufgezeichneten Geschichte der Menschheit wahrhaft universal. Dass Hannah Arendt als vertriebene deutsche Jüdin das »Mitleiden auf seiner höchsten Stufe« an der Person Jesu aufzeigt, dem Begründer einer anderen, dem Judentum über fast zweitausend Jahre hinweg meist feindseligen Gemeinschaft, das sagt allerdings auch etwas über ihre eigene Persönlichkeit aus: Wenn sie die Größe der Geschichte, die Dostojewski und auf indirekte Weise Melville von Jesus erzählen, darin sieht, »dass wir spüren, wie falsch und wie unecht die idealistischen, hochtönenden Phrasen des erlesensten bloßen Mitleidens klingen, sobald sie mit wirklichem Mit-Leiden konfrontiert werden«, dann ist auch etwas über die Empfindung gesagt, die das Lesen ihrer Texte erzeugt. Kennzeichnend für das politische Denken, wie Hannah Arendt es zum Vorbild gibt, ist aber nun, dass sie das Mitleiden nicht etwa nur auf seiner höchsten Stufe beschreibt, sondern zugleich dessen gesellschaftliche Ambivalenz erfasst und die Leidenschaft sofort wieder zurückdrängt. Ähnlich der Liebe könne es dem Mitleid »wohl gelingen, die in allem menschlichem Verkehr sonst immer vorhandene Distanz, den weltlichen Zwischenraum, der Menschen voneinander trennt und sie gleichzeitig verbindet, auszulöschen«. Genau durch seine spezifische Qualität, weil es die Welt zwischen den Menschen, damit den Raum des Politischen überwindet, sei das Mitleid allerdings politisch ohne Bedeutung. Jesus hörte der langen Rede des Großinquisitors nicht deshalb schweigend zu, »weil er keine Argumente gegen sie wüsste, sondern weil er im Zuhören angefangen hat mitzuleiden, weil er bereits getroffen ist von dem Leiden, das hinter dem Redefluss des großen Monologs liegt und sich in ihm gerade nicht ausspricht«. Auch als der Großinquisitor zu Ende gesprochen hat, ist Jesus zu keiner sprachlichen Erwiderung fähig. Seine einzige Reaktion ist ein Kuss. Und ähnlich versöhnt sich Billy Budd unterm Galgen in einem letzten, gestammelten Ausruf mit seinem Richter, der von Gewissensbissen geplagt ist. »Jesu Schweigen und Billy Budds Stottern weisen auf das Gleiche hin, nämlich auf ihre Unfähigkeit oder Ungeneigtheit, sich der normalen aussagenden oder argumentierenden Sprechweise zu bedienen, in der man zu jemandem über etwas spricht, das von Interesse für beide ist, weil es in der Tat interest, zwischen ihnen lokalisiert ist. Das beredte und argumentative Interesse an der Welt ist dem Mitleiden ganz fremd, denn dieses drängt mit leidenschaftlicher Intensität über die Welt hinweg direkt zu den Leidenden selbst.« Wer etwa, um Hannah Arendts Gedanken an einem Beispiel zu illustrieren, wer mit den Armen so tief mitleidet wie ein Heiliger, der gesellt sich zu ihnen, der hilft ihnen oder teilt die Armut mit ihnen. Aber er geht selten daran, die Bedingungen zu ändern, unter denen Armut entsteht. Wird er durch irgendwelche Umstände, etwa die massenhafte Not oder die Bitten der Bedürftigen angestiftet, das Feld der Politik zu betreten, so wird gerade sein übergroßes Mitleid zu einer Gefahr, insofern es ihn »vor den langwierigen und langweiligen Prozessen des Überredens, Überzeugens, Verhandelns und Kompromisse-Schließens, welche die der Politik gemäßen Handlungen sind, zurückscheuen« lässt. Menschen mit übergroßer Empathie werden ihrer Natur nach »stattdessen versuchen, dem Leiden selbst Stimme zu verschaffen und zur ›direkten Aktion‹ schreiten – nämlich zum Handeln mit den Mitteln der Gewalt.« Gewalt aber könne nie mehr, als die Grenzen des politischen Bereichs schützen. Wo die Gewalt in die Politik selbst eindringt, sei es um die Politik geschehen. Wie Hannah Arendt im Folgenden anhand der Wirkung von Rousseau, der das Mitleiden für die Grundlage aller echten menschlichen Bezüge hielt, aufzeigt, dass gerade die nobelste der Leidenschaften, das Mitleiden, auf dem Gebiet der Politik in die absolute Mitleidlosigkeit umschlug und die Französische Revolution von 1789 schließlich in der Katastrophe mündete, das ließe sich auf die Geschichte aller großen Revolutionen seither übertragen, nicht nur der Russischen von 1917, wie es Hannah Arendt selbst getan hat, sondern gerade auch der Iranischen Revolution von 1979. Auch das Unglück der Iranischen Revolution bestand darin, »dass sie sehr bald von dem Kurs, der zur Gründung eines neuen politischen Körpers führte, durch die unmittelbare Vordringlichkeit der Not des Volkes abgedrängt wurde; die Richtung, die sie dann einschlug, war nicht mehr von den Erfordernissen bestimmt, welche die Befreiung von der Tyrannei bestimmt, sondern von denen, welche die Befreiung von der Notwendigkeit diktierten«. Die Vordringlichkeit der sozialen Frage hat auch in Iran dazu geführt, dass die ursprünglichen Träger der Revolution, nämlich das Bürgertum mit seinen Intellektuellen, Studenten, Frauenrechtlerinnen, Ingenieuren und Geschäftsleuten, denen es um die Sache der Freiheit ging, von denen verdrängt, vertrieben, oder physisch vernichtet wurden, die als Agenten des gemeinen Volkes auftraten, als Agenten insbesondere der Bevölkerung in den Elendsvierteln der Städte, den sogenannten »Bedürftigen« oder Mostazafin. Um den Satz Robespierres aus der Anklagerede auf Louis XVI. aufzunehmen, der für die Männer der Französischen Revolution nahezu selbstverständlich wurde: Auch Ajatollah Chomeini erklärte sehr bald, dass Recht ist, was der Revolution nützt, und ging dabei so weit, selbst das Heilige Gesetz des Islams für obsolet zu erklären, wo dessen Abschaffung im Interesse des neuen Staates sei. Auch in Iran bildete diese Umwertung des Rechts in ein Mittel zum Zweck den Auftakt zu den Säuberungen und Massenhinrichtungen. »Dass das Gesetz Erbarmen nicht kennt, wer wollte es leugnen?«, ist sich Hannah Arendt bewusst. »Nur darf man darüber nicht vergessen, dass es immer brutale Gewalt ist, die sich an die Stelle des Gesetzes setzt, ganz gleich aus welchem Grunde Menschen es abschaffen. Nichts ist geeigneter, dies zu lehren, als die Geschichte der Revolutionen.«
Eine einzige Revolution blieb in der Geschichte, die Hannah Arendt in ihrem Buch erzählt, von den Exzessen der Tugendhaftigkeit verschont, und zwar weil sie als einzige nicht unter dem Fluch der Armut stand und der notwendige Pragmatismus des Politischen sich nie am »Prüfstein des Mitleids« erproben musste. Dass Hannah Arendt die amerikanische Revolution stets als die glückhaftere unter den beiden großen Revolutionen des Westens beschrieb, hat vor allem in der frühen Rezeption dazu verleitet, sie als Rechte entweder zu vereinnahmen oder abzutun. Dabei lässt sich ihr Amerikanismus in kein Links-rechts-Schema fügen. Eher läge darin ein Plädoyer für Multikulturalität, sofern diese nicht als anything goes verstanden würde, sondern als die strikte Gleichheit des Verschiedenen vor dem Gesetz. Hannah Arendt hatte nicht nur als Historikerin studiert, sondern als Jüdin konkret erfahren, wie der Nationalstaat europäischer Prägung in eine Identität zwingt, sei es zur Assimilation oder zum Paria. Hingegen zu Amerika konnte sie gehören, ohne ganz dazugehören zu müssen. Eben die Loyalität, die sie als amerikanische Staatsbürgerin empfand, trieb sie an, die amerikanische Politik mit beinah jener Leidenschaft zu kritisieren, die sie als Historikerin unter Verdacht stellte. Dass sie Einspruch gegen McCarthy oder den Vietnam-Krieg erhob, ist dabei nicht das Entscheidende, wenn ich darüber nachdenke, was politisches Denken sei. Andere amerikanische Intellektuelle haben ihr Land ähnlich scharf oder noch schärfer kritisiert, wie man überhaupt Intellektualität als die kritische Reflexion des je Eigenen definieren könnte. Politisch zu denken, bedeutet die Welt in ihrer Ambivalenz, Widersprüchlichkeit und Komplexität verstehen zu wollen. So hat sie zwar den relativen Erfolg der amerikanischen Revolution hervorgehoben, aber zugleich deren Unzulänglichkeit benannt. Wie aus dem ursprünglichen Ausdruck des Pursuit of public Happiness der Begriff des Öffentlichen verschwand, sodass in der Unabhängigkeitserklärung nur noch von Pursuit of Happiness die Rede blieb, erzählt in ihrer Lesart beispielhaft die Ausbreitung jener Überzeugung, die sich in Amerika bis heute auswirke, »dass die Freiheit in dem freien Spiel von Privatinteresse bestünde und die Bürgerrechte in dem Recht auf rücksichtlose Verfolgung des Eigennutzes«. Hannah Arendt hat aber nicht nur den Ungeist des ungebremsten Kapitalismus und Individualismus aus dem Geiste der amerikanischen Revolution erklärt, sondern auch auf deren begrenzte, »gleichsam lokale Bedeutung« verwiesen. »Die Gründung der Freiheit konnte gelingen, weil den ›gründenden Vätern‹ die politisch unlösbare soziale Frage nicht im Wege stand«, heißt es in ihrem Buch über die Revolution; »aber diese Gründung konnte für die Sache der Freiheit nicht allgemeingültig werden, weil die gesamte übrige Welt von dem Elend der Massen beherrscht war.« Damit nicht genug, beruhte der relative Wohlstand und die soziale Balance der amerikanischen Gesellschaft, Jeffersons lovely Equality, die den gewaltfreien Verlauf der Revolution überhaupt erst ermöglichte, auf der Arbeit der Sklaven. Das heißt, ausgerechnet der größte Triumph der Freiheit in der Geschichte des Westens verdankt sich in der Analyse Hannah Arendts der schlimmstmöglichen Ausbeutung. Die amerikanische Revolution gelang, weil das Mitleid in ihr keine Rolle spielte. Aber diese nobelste aller Leidenschaften spielte nur deshalb keine Rolle, weil das Elend der Schwarzen, die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts fast ein Viertel der Bevölkerung ausmachten, von den Männern der Revolution wie insgesamt von der Mehrheit der Amerikaner vollkommen ausgeblendet wurde. Es sind exakt solche Antagonismen, Ambivalenzen, Aporien, die das politische Denken markieren, wie es Hannah Arendt zum Vorbild gibt. Es ist ein Denken ohne das Geländer der Systeme, Ideologien und Wunschvorstellungen, sondern so verwirrend, spannungsreich, ungesichert und paradox wie die wirkliche Erfahrung des Menschen. Eben weil es sich bemüht, die Geschichte ebenso wie das Zeitgeschehen in ihrer Widersprüchlichkeit zu beurteilen und sich niemals für nur eine Sicht der Dinge entscheidet, kann dieses Denken für alle möglichen Ziele vereinnahmt werden, je nachdem, welchen Aspekt man herausgreift. So wurde Hannah Arendt im Laufe ihrer Rezeptionsgeschichte mal zu einer linken, mal zu einer rechten Denkerin erklärt, mal zur Befürworterin, mal zur Gegnerin des Zionismus, mal zur Apologetin, mal zur Anklägerin Amerikas, mal zur Verfechterin, mal zur Kritikerin des europäischen Projekts. Dass diese extreme Gegensätzlichkeit ihrer Rezeption in der Struktur ihres Denkens angelegt ist, scheint ihr bewusst gewesen zu sein, obschon sie darüber in vornehmer Diskretion wieder nur in der Würdigung eines anderen sprach. In ihrer Rede über Lessing, aus der ich eingangs bereits zitierte, heißt es, dass Kritik in dessen Sinne diese Gesinnung sei, »die immer Partei ergreift im Interesse der Welt, ein jegliches von seiner jeweiligen weltlichen Position her begreift und beurteilt und so niemals zu einer Weltanschauung werden kann, die von weiteren Erfahrungen in der Welt unabhängig bleibt, weil sie sich auf eine mögliche Perspektive festgelegt hat.« Und Hannah Arendt schreibt weiter, »dass Lessings Parteinahme für die Welt so weit gehen konnte, dass er für sie sogar die Widerspruchslosigkeit mit sich selbst, die wir doch bei allen, die schreiben und sprechen, als selbstverständlich voraussetzen, opfern konnte«.
Was hätte Hannah Arendt zum arabischen Frühling gesagt? Ihre Prophezeiung, dass in der Weltpolitik »diejenigen schließlich die Oberhand behalten werden, die verstehen, was eine Revolution ist, was sie vermag und was sie nicht vermag, während alle die, welche auf die Karte reiner Machtpolitik setzen und daher auf die Fortsetzung des Krieges als der Ultimo Ratio aller Außenpolitik bestehen, in einer nicht allzu entfernten Zukunft entdecken dürften, dass ihr Handwerk veraltet ist und dass mit ihrer Meisterschaft niemand mehr etwas Rechtes anzufangen weiß«27 – dieser Satz hat mit Blick auf die westliche Nahostpolitik seit dem 11. September 2001 und die westliche Verblüffung über die nahöstlichen Freiheitsbewegungen der letzten Jahre neue Aktualität gewonnen. Der Wille zur Freiheit, der im Sommer 2009 auf den Straßen von Teheran, in diesem Jahr in Tunesien, in Ägypten, in Libyen, Bahrain, Jemen, Syrien zu beobachten war, hätte Hannah Arendt ebenso gewiss begeistert, wie sie gegen Theorien argumentiert hätte, die bestimmten Völkern die politische Unmündigkeit in die Kultur schreiben. Und doch würde Hannah Arendt dieser Tage wahrscheinlich nicht besonders optimistisch auf den Nahen Osten blicken, der leider mehr an 1789 als an 1776 erinnert. Folgt man ihrer historischen Analyse, gelingen Revolutionen nicht in Ländern, die unter dem Fluch der Armut stehen. Tatsächlich stehen die Chancen für die Etablierung eines demokratischen Rechtsstaates unter allen arabischen Ländern noch am besten in Tunesien, das eine vergleichsweise ausgewogene soziale Struktur aufweist. In den anderen arabischen Ländern hingegen und zumal in Ägypten lässt sich jetzt bereits beobachten, wie sich die revolutionäre Bewegung aufspaltet in die vorrangig jungen, vorrangig mittelständischen Aktivisten, denen es weiterhin um die politische Freiheit geht, und den Bewohnern der Elendsviertel, die nach der Euphorie des Anfangs nun erst recht vor der Frage stehen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen, da im Zuge der Revolution die Wirtschaft eingebrochen ist. Aber wer weiß? Das politische Denken, das Hannah Arendt zum Vorbild gibt, beschränkt sich nicht darauf, aus der Geschichte zu lernen. Es stiftet dazu an, die Geschichte zu widerlegen. Das ist heute nicht nur eine Aufgabe der arabischen Bürger. Es ist im Sinne der Weltbürgerschaft, die Hannah Arendt für das politische Handeln anmahnte, eine Aufgabe auch für uns – und zwar nicht nur für politische Stiftungen. Was die arabischen Völker jetzt am dringendsten benötigen, ist nicht die Aufklärung über ihre Rechte, sondern handfeste Beiträge zum Abbau der Massenarmut, also etwa die Aufhebung von Zöllen, das Ende subventionierter Agrarexporte, die die lokale Landwirtschaft zerstören, die Entwicklung der Infrastruktur, von Strom, Wasser, Energie, Bildung, natürlich auch Wirtschaftshilfen und eher kurzals mittelfristig die Integration in den europäischen Binnenmarkt. Ja, das würde teuer, das würde sehr viel mehr kosten als Broschüren, die an die sentimentale Sprache von Tierschutzvereinen erinnern. Aber wie viel wäre für Europa politisch, ökonomisch und strategisch verloren, wenn sich südlich des Mittelmeeres die Geschichte seiner eigenen Revolution wiederholte. Wie Amerika den Deutschen nach dem Krieg nicht aus Mitleid eine Perspektive geboten hat, so wäre es heute im wohlverstandenen Eigeninteresse der europäischen Staaten, nie mehr in Diktaturen, sondern endlich in die Freiheit zu investieren. Es gibt nur einen Nachbarn der arabischen Völker, für den auf dem Tahrir-Platz noch mehr auf dem Spiel steht als für die Europäer: Es ist der Staat Israel. Den dauerhaften Frieden, den Hannah Arendt als jüdische Denkerin stets vor Augen hatte, wird es im Nahen Osten erst geben, wenn das Unheil der Zwangsherrschaft überwunden ist. Wem das angesichts der Wahlergebnisse in Ägypten und Tunesien, aber auch angesichts der zunehmenden Repression in Israel selbst, illusorisch erscheint, der sei darauf hingewiesen, dass das politische Denken, wie Hannah Arendt es mir zum Vorbild gibt, mit nichts Geringerem als mit Wundern rechnete – »nicht weil wir wundergläubig wären«, wie sie betont, »sondern weil die Menschen, solange sie handeln können, das Unwahrscheinliche und Unerrechenbare zu leisten imstande sind und dauernd leisten, ob sie es wissen oder nicht.«28 Und so will ich, um so paradox zu schließen, wie sie die Welt erfuhr, so will ich für die arabischen Revolutionen mit Hannah Arendt hoffen, dass Hannah Arendt nicht recht behält.
Es gibt viele gute Gründe, Navid Kermani den Hannah-Arendt-Preis zu verleihen: sein Engagement für Europa, ja sein europäisches Denken, wenn er nach dem »Wir« pluraler Gesellschaften fragt, oder wenn er als Muslim und Gelehrter Vorstöße unternimmt ins Heilige der Anderen, etwa mit seiner subtilen Meditation über Guido Renis Gemälde »Die Kreuzigung«, die ihm als Minderheitsangehörigem zunächst die Ausgrenzung seitens der christlichen Großkirchen und die Nicht-Verleihung des hessischen Kulturpreises, sodann aber die Solidarität der Öffentlichkeit eingebracht hat, zum Beweis, dass die europäische Zivilisation zum Schutz von Minderheiten bereit und fähig ist. Ausgrenzung und Solidarität beschreibt Kermani in seinem im September 2011 publizierten Roman Dein Name. Navid Kermani als »Repräsentant einer Religion« sei der Adressat des Kulturpreises gewesen. Ob er Repräsentant ist, sei dahingestellt. Jedenfalls ist er noch viel mehr. Im Roman bezeichnet der Protagonist sich als »Schriftsteller«, »Leser«, »Navid Kermani«, »Freund«, »Vater«, »Berichterstatter«, »Sohn«, »Nachbar«, »Enkel«, »Poetologe«, »Handlungsreisender«, »Islamerklärer«, »Liebhaber«, »Nummer 10« und »Romanschriftsteller«. Kleine Netze und Gemeinschaften. »Die einzige Gemeinschaft, welcher der Romanschriftsteller angehört«, heißt es im Roman, »ist weder Nation noch Konfession. Es ist die deutsche Literatur. Und sein Fußballverein natürlich.« Vom Beitrag zur Gemeinschaft der deutschen Literatur und zur Gemeinschaftsbildung durch Literatur soll hier die Rede sein. Denn auch Kermanis Roman Dein Name ist ein gewichtiger Grund für die Preisverleihung – vielleicht besonders aus Sicht einer Stiftung, die den Namen des Schriftstellers Heinrich Böll trägt. Navid Kermani hat einen wunderbaren Roman geschrieben: Dein Name. Ein Roman, wie es noch keinen gab – heißt es auf dem Umschlag. Also neu, kühn, mitreißend. Was Verlage sich so einfallen lassen, um ein Buch aus dem Meer der Neuerscheinungen 2011 herauszuheben. Doch dieses Buch ist wirklich besonders. Es hätte ein Buch über Migration und MigrantInnen werden können, ein wunderbares Erinnerungsbuch, eine west-östliche Familiengeschichte von Großvater und Mutter. Familiengeschichten sind sehr gefragt, sie bieten Ankerplätze im Herkommen, wo heute sonst alles ins Schwimmen gerät. Erinnerungsbücher haben Anfang und Ende. Aber der Roman des Schriftstellers ist kein Erinnerungsbuch, es ist nur ein »Papierkorb ohne Handlung, Thema, Erzählstrategie und am schlimmsten: ohne Ende«. Wie also enden? Das ist die spannendste Frage dieses handlungsund spannungsarmen Romans. Soll er den Umzug nach Rom als Stipendiat der Villa Massimo für das Enden nutzen? Die Notate reichen über diese Zeit hinaus. Der Beginn der Frankfurter Poetikvorlesung »Über den Zufall. Jean Paul, Hölderlin und der Roman, den ich schreibe« könnte für den Ausstieg genutzt werden. Wieder nichts. Poetologisch, notiert der Schriftsteller, könne dieser Roman erst mit dem Tod enden. Doch zum Ende kommt der Roman nicht durch den Tod des Protagonisten, sondern durch den Verleger, der einen Termin setzt, Kürzungen erzwingt und damit diesen Roman erst möglich macht. Dem Drängen des Verlegers sucht der Protagonist noch eine kurze Weile durch Ausschweifungen vom Hundertsten zum Tausendsten auszuweichen, doch am Ende limitiert die Setzerin die Anschläge und der Akku des Laptop geht aus. Der Verleger macht den Roman möglich. Am Ende entsteht der Autor, der sich die schier unendlichen Abschweifungen und Umund Neuschreibungen zuschreiben und das damit verbundene symbolische und finanzielle Kapital gutschreiben lässt. Am Ende geht es zu wie bei Cervantes. Dessen Don Quijote gibt sich nicht nur als Übersetzung aus dem Arabischen aus. Im zweiten Teil nimmt der Roman auch Bezug auf diverse Raubkopien des ersten Teils und spottet auf die apokryphe Fortsetzung eines gewissen Alonso Fernández de Avellaneda, die 1614 in Umlauf kam und die Fertigstellung des zweiten Teils des originalen »Don Quijote« von 1615 wohl erheblich beschleunigt hat. Cervantes versieht die Fortsetzung mit einem Echtheitszertifikat und bekräftigt gegenüber dem Leser, »dass dieser zweite Teil des Don Quijote, den ich dir jetzt übergebe, von dem nämlichen Künstler und aus dem nämlichen Zeuge wie der erste gearbeitet sei und ich dir hiermit den Don Quijote übergebe, vermehrt und endlich tot und begraben, damit keiner es über sich nehme, neue Zeugnisse seinetwegen herbeizubringen.« So geht das dann. Den gesamten Roman über wird in tausend Einzelgeschichten, Abschweifungen und Um- und Neuschreibungen gegen Tod und Vergessen angeschrieben, um am Ende mit dem Tod des Helden den Autor aus dem Geist urheberrechtlicher Ansprüche und geschäftlicher Abmachungen hervorgehen zu lassen. Zugleich aber auch einen Autor, der sich positioniert, der seinen Roman als Handlung inszeniert, mit dem er teilnimmt am moralischen Universum und mit dem er zu seinem Leser eine verbindliche Beziehung aufbaut. Kermani hat auf Deutsch einen europäischen Roman geschrieben – einen epischen Roman, wie ihn uns Cervantes geschenkt hat und wie er in Deutschland, seit der Vorherrschaft des protestantischen Bildungs- und Bewusstseinsromans, nur wenige unternommen haben: darunter Alfred Döblin in den 1920er-Jahren oder Martin Mosebach heute, wie Kermani in seiner Laudatio auf den Büchner-Preisträger ausführt. Er glaubt an den epischen Roman, das epische Schreiben ist für ihn ein moralisches Unternehmen, ein »religiöses Unterfangen« – Weltbejahung und Vertrauen auf die Gnade, dass das Vergängliche und Kreatürliche vor dem Vergessen bewahrt sein möge. Sein Bauprinzip ist die Parataxe, die durch Abschweifungen und Umschreibungen aufgehaltene Handlung, die es ermöglicht, jederzeit und an jedem Ort in den Roman einzusteigen – wie in Don Quijote oder Tausendundeine Nacht. Die Toten und die Alltäglichkeiten, die der Roman beschreibt, sind für sich »vollkommen gleichgültig«, im Roman über Gott und die Welt werden sie zu Zeichen – nicht eines erlebenden und erinnernden Bewusstseins auf der Suche nach sich selbst, sondern eines überindividuellen Weltzusammenhangs. Sie sind, so der Gestus, so die Anmutung, unmittelbar zu Gott. Georg Lukács hat den Bildungsroman als Form der transzendentalen Obdachund Heimatlosigkeit beschrieben, als Form einsamen Welterlebens eines suchenden und erlebenden Ichs, das der einsame Leser nachempfindet. Schlüpfe in das Bewusstsein dieses erlebenden Ichs, fordert der Bildungsroman den Leser auf und bietet ihm mit der »erlebten Rede«, die die Differenz zwischen erlebendem Bewusstsein und Erzählerrede löschen will, das avancierte Stilmittel. Diese Art Bildungsroman ist ein Illusionsroman. Er gibt vor, kein Roman zu sein. Er hinterlässt den Leser in der Einsamkeit des Nachvollzugs einsamer Reflexion. Kermanis epischer Roman will Gemeinschaft stiften, dazu verbirgt er das erzählende Ich nicht, sondern vervielfältigt es, lässt es Rollen spielen und ohne Ende aus der Literatur zitieren, um am Ende als Autor und Urheber eines Romans zu erscheinen, der Stellung bezieht und zum Mitdenken auffordert. Freilich: die Gemeinschaft, die Kermani stiften will, ist nicht das sozialistische Kollektiv als Effekt der didaktisch eingesetzten Verfremdung wie bei Brecht. »Hätte er« – gemeint ist Brecht – »die Verfremdung, die das Natürlichste, ja die Voraussetzung für jede Form des Schauspiels ist, nicht ideologisch in Beschlag genommen, hätte das Illusionstheater nicht überlebt. Dann wären auch die Romane andere …« Gemeinschaftsstiftend und gemeinschaftsfähig sind Individuen, die zu moralischem Verhalten fähig und bereit sind. So möchte ich, zum Ende kommend, Navid Kermani mit Hannah Arendt interpretieren. Moral hängt an einem starken, sich seiner Kriterien, Ansprüche und der Konsequenzen seines Handelns bewussten Individuum, das imstande und bereit ist, auch im Roman Person zu sein, also durch Masken zu uns zu sprechen und handelnd zu uns in eine Beziehung zu treten. Das Böse, so hat es Hannah Ahrendt formuliert, ist das, was von niemandem getan wird, das heißt von Wesen, die sich weigern, Personen zu sein. Navid Kermani tritt durch den Roman vor uns als Person – dafür muss er die Konsequenzen tragen: mal die Kritik oder gar Schmähung, mal die Ehrung. Heute ist es die Ehrung. Vielen Dank an Navid Kermani für diesen Mut, Person zu sein, und herzlichen Glückwunsch zum HannahArendt-Preis!
Ich freue mich sehr, heute im Bremer Rathaus den Hannah-Arendt-Preis an Navid Kermani verleihen zu können. Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken wird seit 1995 vom Bremer Senat gemeinsam mit der HeinrichBöll-Stiftung verliehen. Heute findet die Verleihung zum 17. Mal statt, für mich ist es das fünfte Mal, dass ich bei dieser Preisverleihung für den Senat sprechen kann. Der Preis für Politisches Denken bewegt sich zwischen Philosophie, Geschichtswissenschaft, Literatur, Publizistik und eben auch Politik. Wer ist Navid Kermani? Ein Schriftsteller, ein Orientalist, ein Regisseur, ein Wissenschaftler im besten Sinne. Kaum jemand kann wie Navid Kermani aus den Erfahrungen so vielfältiger Erfahrungszusammenhänge schöpfen. Kermani hat vielen von uns die frühe Erfahrung von zwei verschiedenen Kulturen voraus. Die deutsche Sprache mit dem Akzent des Siegerlands im Freundeskreis, mit Spielkameraden und in der Schule. Die Umgangsformen, die Sprache einer persischen Arztfamilie in einem gehobenen Wohnumfeld. Dazu dann die zusätzliche Erfahrung als Kind im Fußballverein, was einen großen Unterschied, die soziale Zugehörigkeit auf Verhalten, Sprache, »Anderssein« hat. Ich will mich in meinen kurzen Ausführungen ausschließlich auf sein Buch mit einer Essaysammlung aus dem Jahr 2009 beziehen: Wer ist wir? Deutschland und seine Muslime. Stark von eigenen, individuellen, sehr persönlichen Erfahrungen ausgehend, beobachtet Kermani die Welt um sich herum. Durch seinen präzisen, klaren Blick kommen die Leser, die sich darauf einlassen, komme ich zu einer anderen Perspektive. In wunderbar erzählten Skizzen gesellschaftlicher Zusammenhänge wird offensichtlich, was so grundfalsch ist an der gegenwärtigen Integrationsdebatte in Deutschland. »Integration« setzt die Fiktion einer einheitlichen gesellschaftlichen deutschen Identität voraus, in die »Fremde« integriert werden können. Was für ein Irrtum ist schon allein die Annahme einer deutschen Identität, die sich allein über Religion definieren ließe. Welche deutsche Identität wäre dies? Katholizismus, Protestantismus? Judentum, Agnostizismus, Atheismus? Bäuerliches Leben auf dem Lande, Arbeiter am Rand einer Großstadt? Und das in scharfer Abgrenzung zum Islam? Lebenswirklichkeiten werden von vielen Bedingungen bestimmt, bei denen die Religion eine eher untergeordnete Bedeutung hat. Auf alle Fälle haben die soziale Situation der Menschen, ihr Einkommen, die familiären Beziehungen, der Bildungszugang, die Chancen häufig einen weit größeren Einfluss als der eine, reduzierte Aspekt der Religionszugehörigkeit. Navid Kermani ist ein Verfechter der europäischen Werte, die zumindest in unseren intellektuell geprägten Kreisen sehr hoch bewertet werden. Humanismus, Menschenwürde, Toleranz, Akzeptieren der Verschiedenartigkeit, gegenseitiger Respekt, Individualität, das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Die Fähigkeit, Menschen in ihren komplexen Lebenszusammenhängen wahrzunehmen. Für diejenigen, die wie ich zu wenig Zeit zum Lesen haben, habe ich aus dem Buch Wer ist wir? aus dem Jahr 2009 von Navid Kermani drei wunderschöne Passagen herausgesucht, die seine Denkgrundpfeiler widerspiegeln. »Dass Menschen gleichzeitig mit und in verschiedenen Kulturen, Loyalitäten, Identitäten und Sprachen leben können, scheint in Deutschland immer noch Staunen hervorzurufen – dabei ist es kulturgeschichtlich eher die Regel als die Ausnahme. Im Habsburger oder im Osmanischen Reich, bis vor Kurzem in Städten wie Samarkand oder Sarajevo, heute noch in Isfahan oder Los Angeles, waren oder sind Parallelgesellschaften kein Schreckgespenst, sondern der Modus, durch den es den Minderheiten gelang, einigermaßen unbehelligt zu leben und ihre Kultur und Sprache zu bewahren. Ohne sie gäbe es vermutlich keine Christen mehr im Nahen Osten, und ihr heutiger Exodus hat viel mit dem verhängnisvollen Drang mal der Mehrheitsgesellschaft, mal der Staatsführer, mal von ein paar hundert Terroristen zu tun, Einheitlichkeit herzustellen und kulturelle Nischen auszumerzen.« Diese Passage weist dem Gerede von der deutschen Leitkultur den ihr zustehenden Platz im Reich des unhistorischen Geschwafels zu. Die zweite Textstelle behandelt den Hang zur Abgrenzung gegen das als fremd Empfundene. »Wir nehmen den Fundamentalismus und überhaupt die Rückkehr der Religionen nur dann wahr, wenn sie mit politischen Forderungen auftreten oder gar mit physischer Gewalt. In der Breite ist der Fundamentalismus seit seinen Anfängen im frühen zwanzigsten Jahrhundert bis heute überall – sei es im Nahen Osten, in Südasien oder den Vereinigten Staaten – eine Bewegung, die den Einzelnen einbindet in die klar umrissene Ordnung eines Kollektivs, das streng unterschieden ist von anderen Kollektiven. Das muss keine aggressive Unterscheidung sein. Fundamentalistische Lebensentwürfe sind attraktiv, weil sie die Menschen mit dem versorgen, was ihnen in der modernen, globalisierten Welt am meisten fehlt: Eindeutigkeit, verbindliche Regeln, feste Zugehörigkeiten – eine Identität.« Mit dieser sehr psychologischen Sichtweise legt Navid Kermani auch einen Finger in die Wunde des Agierens der politischen Elite, die das Bedürfnis von Menschen nach Wurzeln und Vergewisserung leicht und oft auch systematisch unterschätzt. Wer eine offene Gesellschaft will, muss den Wünschen nach Identität, die eben verschieden ist, Rechnung tragen. Die letzte Textstelle spricht mir besonders aus der Seele: »Weshalb erzähle ich das? Weil ich sagen will, dass es andere Unterschiede gibt, die in den meisten Fällen gravierender sind als die Hautfarbe oder die Religion. Und weil ich denke, dass zum Beispiel arm oder reich, Stadt oder Land, gebildet oder ungebildet Kategorien sind, durch die Menschen, wenn sie nicht eben in einem rassistischen Staat leben, mehr voneinander getrennt, benachteiligt oder bevorzugt werden als durch die Nationalität oder den Glauben. Ich behaupte nicht, dass es keine kulturellen Konflikte gibt, aber ich meine, dass die größte Bruchstelle in einer Gesellschaft weiterhin die ökonomische ist – selbst wenn soziale Konflikte immer häufiger in einem kulturellen oder religiösen Vokabular ausgedrückt werden.« Mit Navid Kermani können auch praktizierende PolitikerInnen etwas anfangen, und dafür bin ich dankbar, weil es meiner Meinung nach auch der Sinn eines Preises für politisches Denken ist. Herzlichen Glückwunsch an Navid Kermani! Ich freue mich auf Ihre Festrede.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz