
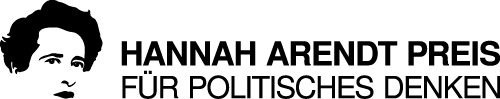

Yfaat Weiss, Historikerin an der Hebräischen Universität in Jerusalem
Sehr verehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie heute Abend anlässlich der nunmehr zum achtzehnten Male stattfindenden Verleihung des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken« in dem altehrwürdigen Bremer Rathaussaal begrüßen zu dürfen. Besonders jedoch heiße ich Sie - liebe und geehrte Frau Yfaat Weiss - als diesjährige Preisträgerin, wie auch ihren Mann, ganz herzlich in Bremen willkommen. Alljährlich entscheidet eine unabhängige und internationale Jury darüber, wem der »Hannah-Arendt-Preis« zugedacht werden soll. Gewürdigt wird »im Lichte der Öffentlichkeit« heute die Historikerin Yfaat Weiss. Yfaat Weiss, in Haifa geboren, lehrt als Professorin für jüdische Geschichte und zeitgenössisches Judentum an der hebräischen Universität in Jerusalem und ist derzeitige Direktorin des dortigen Franz Rosenzweig Minerva Forschungszentrums. Überdies ist sie an dem Aufbau des Lehrstuhls für Jüdische Geschichte an der Universität München beteiligt gewesen und hat zahlreiche Forschungsaufenthalte, unter anderem in Wien, Leipzig und Hamburg verbracht. Dies sind selbstverständlich nur einige Stationen ihres vielgestaltigen Wirkens und Tätigseins. Eigens hervorgehoben sei allerdings noch ihr Buch Verdrängte Nachbarn. Wadi SalibHaifas enteignete Erinnerung, das seit dem Frühjahr 2012 auch in deutscher Sprache vorliegt. Wir danken ebenfalls an dieser Stelle der Jury für ihr nicht nachlassendes Gespür, erneut eine genuin politische Denkerin wie Yfaat Weiss zur Ehrung befunden zu haben, welche den Arendt'schen Grundgedanken der Pluralität auf ihre Weise gedanklich fortbahnt und bewahrt. (Oder, wie Yfaat Weiss es so schön zum Ausdruck bringt: »Die Grundessenz des öffentlichen Bereichs besteht in der Vielzahl seiner diversen simultanen Stimmen.«) Um nun den Erläuterungen der Jury in Bezug auf die Preisvergabe nicht vorzugreifen, möchte ich es bei diesen wenigen Anmerkungen belassen. Nicht zuletzt jedoch gilt der neuerliche und unsererseits außerordentlich herzliche Dank auch diesmal wieder den großzügigen Geldgebern und freundlichen Förderern, namentlich dem Bremer Senat (repräsentiert von der Senatorin Frau Stahmann) und der Heinrich Böll Stiftung (vertreten durch Herrn Fücks), welche seit vielen Jahren die Preisvergabe tragen und maßgeblich unterstützen. Ohne Sie wäre ein Festakt wie der heutige nicht möglich. Zudem gebührt ein besonderer Dank neben der Jury, den Mitstreiterinnen aus dem Vorstand —genannt seien: Antonia Grunenberg, Eva Senghaas-Knobloch und Peter Rüde[ - wie auch den Mitgliedern und Unterstützerinnen des Vereins »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken«. Gestatten Sie mir, verehrte Gäste, Sie nun auf den weiteren Fortgang der Festveranstaltung hinzuweisen. Zunächst wird Willfried Maier, stellvertretend für die Jury, die Entscheidung darlegen, Yfaat Weiss heute mit dem Hannah-Arendt-Preis auszuzeichnen. Danach folgt die Laudatio seitens Doug Saunders', welcher den weiten Weg hierher auf sich genommen hat. Auch ihm sei ausdrücklich gedankt. im unmittelbaren Anschluss hieran, damit gewissermaßen zum Hauptakt gelangend, haben wir die Gelegenheit, den Festvortrag von Yfaat Weiss zu hören, auf den wir alle freudig gespannt sind. Zu guter Letzt werden die erwähnten Stifter des Preises, die Heinrich Böll Stiftung und der Senat der Freien Hansestadt Bremen, zu Wort kommen. Nach der darauffolgenden feierlichen Preisübergabe sind Sie, meine Damen und Herren, wie immer herzlichst dazu eingeladen, bei einem Glas Sekt im hiesigen Nachbarsaal, den Abend nach- und ausklingen zu lassen. Hoffentlich in der begründeten Zuversicht, dass, um eine Wendung Helmuth Plessners aufzugreifen, in der Welt doch mehr - und vor allem politischer gedacht wird, als man zuweilen vielleicht denkt, ich danke nochmals allen, die von nah und fern angereist sind im Namen des Vereins »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken« für ihr Erscheinen und darf Sie, liebe Anwesende, abschließend noch zu dem morgigen, gegen 10 Uhr angesetzten Kolloquium im Institut Francais recht herzlich willkommen heißen. Dort werden Yfaat Weiss und Doug Sounders miteinander diskutieren. Die Moderation übernimmt Ulrich Bielefeld. Hiermit reiche ich das Wort an Willfried Maier von der Jury weiter.
Vielen Dank.
AIs wir uns im März dieses Jahres entschieden, Yfaat Weiss mit dem Hannah-Arendt-Preis auszuzeichnen, wussten wir nicht, dass im November am Gaza-Streifen wieder gekämpft würde. Wenn auch jetzt eine Waffenruhe vereinbart wurde: Die Aktualität und Schärfe des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern ist wieder im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit. Ob wir wollen oder nicht, stellt sich damit die Frage: Hält unsere Entscheidung vom Frühjahr der politischen Entwicklung im Herbst stand? Ich denke, sie hält nicht nur stand. Sie hat sogar an Bedeutung gewonnen.
Dabei ist Yfaat Weiss Historikerin, keine Politikerin, und sie macht in ihren Werken keine Vorschläge zur Lösung des israelischpalästinensischen Konflikts, Sie hat auch keine Geschichte dieses Konflikts geschrieben. Sie beschäftigt sich in ihrem letzten in Deutsch veröffentlichten Buch Verdrängte Nachbarn vor allem mit einem innerisraetischen Konflikt, So wie sie sich in ihrem Buch über Deutsche und polnische Juden vor dem Holocaust mit einer innerjüdischen Auseinandersetzung beschäftigte. Und in ihrer Studie über die israelische Lyrikerin und Schriftstellerin Lea Goldberg - Lehrjahre in beutsdüand 1930-1933 mit der Herausbildung einer intellektuellen jüdisch-israelischen Identität aus den Minoritäts- und Unterdrückungserfahrungen in Deutschland und Europa.
Und dennoch beleuchten diese internen Konflikte und Auseinandersetzungen zugleich die verdrängte Konfliktgeschichte mit den Palästinensern sowie die europäische Welt vor dem Holocaust. In ihrem Buch Verdrängte Nachbarn, Wadi Salib - Haifas enteignete Erinnerung geht Yfaat Weiss von einem Ereignis im Sommer 1959 aus, »als sich der Protest von jüdischen Immigranten aus arabischen Ländern - überwiegend aus Marokko - in einer Welle von Unruhen entlud, die sich gegen die Behörden und das städtische, aschkenasische, sozialdemokratische Establishment vor Ort richtete«. Weiss bezeichnet diese Ereignisse als »Katalysator«, an dem ein »politisches Bewusstsein für die ethni5che Diskriminierung sowie die Frustration und die Vorbehalte unter den Juden in Israel« erwachte.
Aber sie belässt es nicht dabei, sondern beleuchtet von diesem Ereignis aus die gesamte neuere Geschichte Haifas: Die flucht und Vertreibung des größten Teils der arabischen Bevölkerung Haifas während des Krieges1948 und die Verhinderung ihrer Rückkehr in den Jahren danach. Und weiter zurück: Die Neubegründung Haifas als religiös und ethnisch plurale Hafenstadt und Bahnknotenpunkt seit Ende des 19. Jahrhunderts und die zunehmende nationale Segregation ihrer Bewohner während der britischen Mandatsherrschaft, Schließlich wirft sie von den 1959er-Ereigni5sen imursprünglich arabischen, dann miarachischen Stadtviertel Wadi Salib aus den Blick auf die weitere Entwicklung Haifas bei dem Versuch, ethnische Segregation unter Juden planerisch-bürokratisch aufzulösen, bis heute mit der immer noch nicht geschlossenen Wunde des zerstörten Wadi Salib5 im Zentrum der Stadt.
Hannah Arendt hat in den Fünfzigerjahren in ihrem Essay »Verstehen und Politik« einen Grundsatz der Geschichtsschreibung entfaltet: »Wann immer ein Ereignis vorkommt, das groß genug ist, seine eigene Vergangenheit zu erhellen, entsteht Geschichte. Nur dann zeigt sich der Irrgarten vergangener Geschehnisse als eine Geschichte (story), die erzählt werden kann, weil sie einen Anfang und ein Ende hat.« Und: »Das Ereignis erhellt seine eigene Vergangenheit, niemals kann es aus ihr abgeleitet werden.« (5. 122)
Arendt wendet sich mit diesem Gedanken gegen die Vorstellung, dass es in der Geschichtsschreibung um kausales Erklären von Entwicklungen gehe, also um Ableitungen aus Notwendigkeit, Es geht vielmehr darum, Handlungen zu beschreiben und ihren Sinn zu verstehen. Und der ergibt sich weder aus objektiven Notwendigkeiten noch aus der je subjektiven Perspektive der unmittelbar Agierenden, sondern aus der Bedeutung für die Welt, die aus diesen Handlungen - für den Einzelnen unkalkulierbar - schließlich erwachsen ist.
Arendts unmittelbares Interesse bei diesem Gedanken ist die Rettung der Freiheit des Handelns in der Geschichtsschreibung - gegen die historische Notwendigkeit der ideologischen Konstruktionen. Die Vertreibung und Flucht der Araber aus Haifa im Jahr 1948 war nicht notwendig, sondern ergab sich aus bestimmten Handlungen: Handlungen der Hagana, aus Handlungen der britischen Maldatsverwattung, der palästinensischen Honoratioren in Haifa und der palästinensischen Führung im ganzen Land, sowie aus den Massenreaktionen der verängstigten Flüchtlinge, deren Handeln am ehesten Züge von Notwendigkeit trägt. Und wo auf Handlungen verwiesen werden kann, gibt es Freiheit und nicht nur Notwendigkeit. Yfaat Weiss schreibt: »0a5 Buch postuliert... keine zwingende Kausalität, die zur Zerstörung Wadi SaLibs führte.« (S.11)
Dass Arendts theoretische Überlegung zur Geschichtsschreibung sich nicht nur ihrer Vorliebe für die Freiheit verdankt, sondern historisch fruchtbar ist, lässt sich an Yfaat Weiss' Buch schön studieren. Das Ereignis, von dem sie ausgeht - der mizrachi5che Aufruhr in Wadi Salib 1959— war ein kollektiver Vorgang. Es ging - beginnend mit einer Wirtshausschlägerei und einem übereilten Polizistenschuss - uni Handlungen ganzer Menschengruppen. lind diese Handlungen schlagen sich nicht nur nieder im Geschehen derAufruhrtage, sondern auch in Institutionen, die diese Ereignisse aufzuarbeiten versuchen, In der Archäologie des Eigentums In der Stadt, In Aktionen der städtischen Planungsbürokratie, in der Einwanderungspolitik des Staates und schließlich in den städtebaulichen Strukturen, die aus alledem entstehen.
Und diese Handlungen tragen eine Bedeutung in sich, die sich im Ereignis enthüllt: Im Aufruhr der aus Marokko stammenden Juden wird sichtbar, wie viel orientalisch-arabische Lebensweise und Kultur Israel in sich hat, auch nach Vertreibung und Flucht des größten Teils der arabischen Bevölkerung aus Halfa. Und Im Umgang der von Aschkenasen dominierten staatlichen Bürokratie mit diesem Ereignis zeigt sich, dass die aus Europa stammenden Zionisten mit diesem Umstand auch innerjüdisch nicht leben wollten, sondern Ihn durch Umsiedlung der mizrachlschen Juden in verstreute Siedlungs-Wohnungen aufzulösen versuchten. »Die Liquldlerung Wadi Saubs, seine Zerstörung und seine Konservierung als Ruinenfeld über Jahrzehnte hinweg kennzeichnete mehr als altes andere die Verleugnung der arabischen Vergangenheit der Stadt, während die partielle und schwierige Rehabilitierung seiner Bewohner das Unbehagen angesichts der arabischen Geburtsorte seiner orientalischen Bewohner symbolisierte.« S. 246)
Wenn die Kategorie der Kausalität hier wie bei allem historischen Handeln unangemessen ist, gibt es doch wiederkehrende Muster von Handlungen, in denen man sie wiedererkennt und in eine gemeinsame Welt durch Analogiewahrnehmungen einordnen kann. Yfaat Weiss deutet bei der Beschreibung der Stadtplanungspolitik der sozialdemokratischen Stadtverwaltung Halfas auf solche in vielen europäischen und nordamerikanischen Städten wiederkehrende ähnliche Muster hin. Der langjährige Bürgermeister von Haifa, Abba Khoushi, begründete die Aussiedlung der nordafrikanischen Juden aus Wadi Salib und ihre geplante Zerstreuung auf gemischte WohnsiedlungsproJekte mit den Worten: »Sie vermischen sich und vergessen die Herkunft« (S. 225) lind genau diese Absicht, die Herkunft von Zuwanderern vergessen und sie in die Homogenität einer Nation in Bildung aufgehen zu lassen, wurde und wird »Im Rahmen nationaler Projekte« auch anderswo bis heute verfolgt.
Im Fall der Mizrachini aus Wadi Salib scheiterte die Absicht. Die Mehrheit der Bewohner Wadi Salibs verweigerte sich der Lösung der Wohnraumbeschaffung in Siedlungsprojekten am Stadtrand und suchte Ersatzwohnungen in der Nähe von Wadi Salib sowie in der Unterstadt Haifas, der Altstadt - trotz des geringeren Wohnstandards. Und die Minderheit, die das städtische Wohnangebot annahm, beklagte trotz der nun größeren Wohnungen die Überfüllung und die Vereinsamung in der neuen Wohnsituation.
Vfaat Weiss ordnet diese Erfahrung in den allgemeineren Trend der städtischen Moderne ein: »Die Politik der Wohnraumbeschaffung und Stadtplanung war das gesamte 20. Jahrhundert hindurch von dem Wunsch getrieben, die physische Umgebung der unteren Schichten -In vielen Fällen die städtische Arbeiterklasse - zu reinigen< und auf diesem Weg die gesellschaftliche Realität zu verändern.« (5. 223)
In Haifa wurde dieses Integrationsprojekt der nationalstaatlichen Moderne »unter den Bedingungen eines nationalen Konflikts« allerdings variiert: Die verbliebene arabische Bevölkerung wurde von ihm ausgeschlossen: »Die modernistisch zionistische Konzeption, die bereits in den frühen Plänen, wie denen des Haifa-Komitees 1939, selektiv und exklusiv hauptsächlich auf die Juden ausgerichtet war, blieb auch nach der Staatsgründung überwiegend die gleiche« (S. 225)
Von Hannah Arendt gibt es einen kleinen Essay. der 1959 unter dem Titel »Little Rock. Ketzerische Ansichten über die Negerfrage und equality« Skandal machte. Arendt vertrat darin gegenüber dem US-amerikanischen Versuch, die Rassentrennung im Süden durch bundestaatlichen Eingriff zu beenden, den Standpunkt: Sache des Staates sei es, allen Bürgern die vollen politischen Rechte zu garantieren und die ungeschmälerten individuellen Rechte der Lebensgestaltung, zum Beispiel der Eheschließung (Aufhebung des Verbots der »Mischehe« in verschiedenen Bundesstaaten). Außerdem hätten alle Bürgerinnen und Bürger den gleichen Anspruch auf Nutzung öffentlicher Einrichtungen und des öffentlichen Raums. Mit wem sie aber zusammen wohnen und in wessen Gesellschaft sie ihren Urlaub verbringen wollten, sei eine bloß gesellschaftliche Frage und da müsse Vereinigungsfreiheit herrschen.
Nicht weit davon entfernt sind die (Iberlegungen Yfaat Weiss' zu möglichen Handlungsatternativen im Konflikt um Wadi Salib und zur modernen Stadtplanung überhaupt: »Die Sanierung des Stadtzentrums, eine Lösung, zu der die meisten der Bewohner tendierten, die eine Ersatzwohnung einer Wohnung in einer neuen Siedlung vorzogen, wäre möglicherweise erfolgreicher gewesen.
Sie hätte eventuell zum Entstehen einer städtischen Kultur beigetragen, die im Laufe der Peripherisierung der Bewohner der Stadtmitte geschwächt wurde. Doch dazu hätte es einer räumlichen Vorstellung und einer anderen Konzeption bedurft als der integrativen, die der städtischen Sozialdemokratie Haifas vor Augen stand. Zum Beispiel eine De-Segregation, ein Zukunftsmodell das danach strebt, fließende Übergänge zwischen Gruppen mit definierten kulturellen Charakteristika zu schaffen. Keine Eliminierung der Unterschiede ...‚ sondern die Grenzen passierbar machen.« (S. 231) Eine Lösung, die nicht nur in Haifa von Interesse ist, sondern in Yfaat Weiss' Sicht »im Geist der gegenwärtigen Trends in multikultureller Planung« liegt.
Diese Sicht betrifft die ethnischen Unterschiede zwischen Juden in Israel. Hinsichtlich der Segregation der Araber in Haifa erklärt sie diese stadtplanerischen Begriffe für nicht anwendbar: Deren SegTegation sei ihnen 1948 aufgezwungen und seitdem durch ihre mindere rechtliche Stellung befestigt worden. Hinsichtlich der Situation in den USA bestand Hannah Arendt darauf, dass gegen gesetzlich erzwungene Diskriminierung nur gehandelt werden kann, indem die diskriminierenden Gesetze abgeschafft und damit die Gleichheit im politischen Gemeinwesen hergestellt wird.
Auch das ist bekanntlich nicht nur in Israel eine wichtige Frage gegenüber der eingesessenen Minorität der Araber, sondern in allen P Einwanderungsländern heute gegenüber den Zuwanderern, denen lange die Staatsbürgerschaft verweigert wurde und wird. Im Epilog ihres Buches stellt Yfaat Weiss zwei Werke palästinensischer Schriftsteller vor, die die Flucht aus Haifa und eine geträumte Heimkehr erinnern sowie vorstellen. Einmal vom - Erzähler Kanafani den Versuch einer Konservierung der Erinnerung, aus der der Wunsch nach der Rückkehr in eine erstarrte Vergangenheit erwächst. Zum anderen beim Lyriker Darwish die Sehnsucht, sein einstiges Zuhause besuchen zu können und die Aufforderung an den israelischen »Feind«, im palästinensischen Flüchtling ein Ebenbild zu sehen und eine Situation eintreten zu lassen, in der die Amnesie der einen wie die Nostalgie der anderen Seite im Verstehen überwunden werden kann.
Verstehen ist für Hannah Arendt »die andere Seite des Handelns, nämlich jene Form der Erkenntnis, durch welche.- die handelnden Menschen... das, was unwiderruflich passiert ist, schließlich begreifen können und sich mit dem, • was unvermeidlich existiert, versöhnen,« - (»Verstehen und Politik«, 5. 125 f.) Dass das eine offene Aufgabe für beide Konfliktparteien - -- in Palästina ist, davon legt Yfaat Weiss' Buch I Zeugnis ab. Für die palästinensische Seite: anzuerkennen, dass der Staat Israel unvermeidlich existiert. Für die israelische Seite: anzuerkennen, dass sie durch die Verwirklichung ihres eigenen nationalen Projekts auch die palästinensischen Araber unversehens zu einem Volk mit einem eigenen nationalen Projekt gemacht haben.
Herzlichen Dank meine Damen und Herren. Es ist mir eine große Ehre und ebenso eine große Freude an dem heutigen Abend hier In Bremen zu sein - Insbesondere angesichts der Tatsache, dass wir unsere Anwesenheit hier dem Vermächtnis zweier wahrhaft großer und origineller Figuren des 20. Jahrhunderts verdanken; Heinrich BÖlL und Hannah Arendt. Dieser Preis und der heutige Abend sind das Verdienst der Organisationen, die die wichtige Arbeit erbracht haben, die Werte und Botschaften dieser beiden Schriftsteller In diesem neuen Jahrhundert Lebendig zu halten. Heute Abend ehren wir eine dritte großartige und originelle PersönUchkeit, die israelische Historikerin Vfaat Weiss. Und ich kann mir keine bessere Beschreibung der Bedeutung ihrer Arbeit einfallen lassen als zu sagen, es ist die Destillation der Beobachtungsgabe Heinrich Bölls und der Zivilcourage und intellektuellen Bandbreite Hannah Arendis.
Und in der Tat; als ich zum ersten Mal das Vergnügen hatte, Dr. Weiss' eindrucksvolle und bewegende Arbeit Verdrängte Nachbarn zu lesen, erinnerte es mich an nichts weniger als Heinrich Bölls großes Meisterwerk Billard um hall, zehn. Nicht nur die Entschlossenheit beider Autoren, die vergrabenen Geheimnisse der Nachkriegsjahre freizulegen, sondern insbesondere die Erzählweise, die sie dafür wählten. Denken Sie nur an die elf Erzähler in Bölls Roman - keiner von ihnen absolut vertrauenswürdig, keiner, der die Meinungen der anderen teilt, viele von ihnen sich selbst täuschend, alle Jedoch überraschend und unterschiedlich. Keiner von Ihnen völlig gut oder völlig böse. Zusammen hinterlassen uns diese wetteifernden Stimmen ein lebhafteres und komptexeres Verständnis der schuldigen Geheimnisse der Nachkriegsjahre in diesem Land, als es je eine einzige, allwissende Stimme der Autorität vermocht hätte. Dies Ist genau das, was auch Vfaat Weiss in Verdrängte Nachbarn getan hat. Ihre Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle von Geographie und Geschichte, aber sie hat die Methode der Romanautorin gewählt, die sich auf einen bestimmten physischen Ort fokussiert, einen scheinbar uriauffälligen Ort, an dem sie auf die Macht seiner Stimmen und Charaktere trifft.
Ihr Ausgangspunkt ist ein Haufen Steine. Es sind die Ruinen eines Dorfas, seit Jahrzehnten verlassen, in der israelischen Hafenstadt Haifa.
Die meisten Israelis und Besucher Israels—tatsächlich die meisten Historiker -‚ die diese Narbe aus Schutt, die sich durch das Zentrum Haifas zieht, betrachten, tun sie ab mit einer einfachen Erzählung: »Verlassen von den Arabern«— »Von der Moderne verdrängt« - »Abgelöst durch den Fortschritt Israels«. Dr. Weiss indessen bietet uns die konkurrierenden Geschichten, die multiplen Zukunftsmöglichkeiten an, die In diesen Steinen enthalten sind. Wir hören von den verängstigten Ashkenazi-Juden, ausgespielt gegen die verarmten Mizrahi-Juden; von europäischen Werten kontra afrikanische Werte; von Veteranen kontra Flüchtlinge; von Arabern, die gezwungen waren zu fliehen, und solchen, die versuchten zu bleiben; von lokalen Organisationen wider staatliche Bürokratien; von sozialistischen Staatsplanern und kosmopolitischen Stadtplanern.
Und wir hören nicht nur die Geschichte der Vergangenheit, sondern auch die Geschichte, die sie »die vielfältigen Visionen einer möglichen Zukunft« nennt. Nur eine dieser Visionen, eine tragische Vision, wurde zur Realität. Viel mehr Wahrheit jedoch lässt sich aus den aufgegebenen und verstummten Visionen gewinnen. Dr. Weiss beschreibt ein Terrain, das Journalisten wie ich gewöhnlich in wenige einfache Kategorien übertragen: Den Nahen Osten. Israelis und Palästinenser. Juden und Araber. Zionisten und Islamisten. Siedler und Besetzer. Aber wenn wir ein ehrliches und wertvolles Verständnis des Nahen Ostens haben - und, so darf Ich wohl sagen, wenn wir in irgendeiner Weise darauf hoffen können, eine friedliche Versöhnung im Nahen Osten zu finden—, müssen wir von diesen einfachen Kategorien abrücken, Wie Dr. Weiss schreibt; »Es ist unmöglich, die Geschichte Wadi Salibs zu verstehen, ohne die üblichen Trennlinien aufzuschlüsseln.«
Sie hat »simplistlsche und unmissverständllche Kausalerklärungen«, wie sie sie nennt, vermieden. Sie hat die historische Vereinfachung und ideologische Hülle jener einfachen Kategorien entfernt und das darunterliegende, echte Haifa offengelegt, und damit auch die echte Geschichte des modernen Israels. Mit Hilfe der multiplen. konkurrierenden Stimmen erzählt sie die Geschichte Israels In einer Weise, wie kein einfaches Narrativ und keine Ideologische Erklärung es je könnte.
Dies ist der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken, und es ist mehr als passend, dass e5 sich bei Weiss' Buch uni ein Werk handelt, das von der Vision der menschlichen Widersprüchlichkeit durchwoben ist, die Hannah Arendts Karriere geprägt hat. Arendt war ein Flüchtling, und Ihre Forschung war die erste, die das Fluchtlingsprohlem als Zentrum der Probleme identifiziert hat, denen sich Nationen und menschliche Gesellschaften stellen müssen. Und die Geschichte, die Dr. Weiss uns erzählt, ist im Wesentlichen eine Geschichte, in der alle Charaktere flüchtlinge sind. Einige sind europäische Jüdische Flüchtlinge. kaum anders, als Arendt selbst, die der völkermörderischen Hölle Europas in das unbekannte Terrain Haifas entflohen, mit einer Mischung aus Angst, Entschlossenheit und Vergeltung— und von denen einige den Flüchtlingsstatus nutzen würden, um der sie umgebenden Welt eine soziale Hierarchie aufzuerlegen. Manche sind arabische Flüchtlinge, einige vertrieben aus ihren Häusern in Haifa zu den Siedlungen, die bis heute in den Nachrichten erscheinen. Andere sind Flüchtende aus den deutlich prekäreren Vierteln Haifas.
Und wieder andere sind marokkanische jüdische flüchtlinge. die zunächst ermutigt wurden, aus ihrem Heimatland zu fliehen und sich an hoffnungslosen Orten wie Wadi Salib niederzulassen, und dann von diesen Orten vertrieben wurden und gezwungen waren, in Sozialwohnungen oder anderen Städten Zuflucht zu suchen. Und es ist auch die Geschichte städtischer Flüchtlinge, die der auferlegten bäuerlichen Existenz des Kibbuz und den gesichtslosen vorstädtischen Wohnungsbauprojekten zu entkommen versuchten, für einen Griff nach dem urbanen Leben, egal in welchen Vierteln der Stadt sie es finden konnten.
Das Problem des Flüchtlings, wie Hannah Arendt bemerkt, ist, dass seine fundamentalen Menschenrechte von keiner Gemeinschaft garantiert werden - er gehört nicht dazu, Und dies ist die Chronik eines historischen Moments, als Rechte nicht anerkannt wurden. Die Vorstellung von Menschenrechten, so Arendt, »zerfiel zu Ruinen, sobald jene, die sich zu ihr bekannten, sich erstmals Menschen gegenübersahen, die wahrhaftig jegliche andere spezifische Eigenschaft und Verbindung verloren hatten außer der bloßen Tatsache, Menschen zu sein. Die Welt fand nichts Heiliges in der abstrakten Nacktheit des Menschseins ... Inder Tat wussten die Flüchtlinge, dass die abstrakte Nacktheit ihres Nichts-als-Menschseins ihre größte Gefahr war.«
Was Dr. Weiss hier konfrontiert, ist genau der Moment, als die fundmentale Notwendigkeit des Staates Israel mit der fundamentalen Notwendigkeit der Menschenrechte kollidierte. Und die Menschen und Organisationen, die sie aufzeichnet -die Stimmen, die sie aus jenem Haufen Steine zieht—, reagieren auf die Herausforderung in unterschiedlicher Weise. Manche sind heldenhaft und menschlich. Manche sind kalt und gnadenlos. Andere widmen sich blind abstrakten ideologischen oder Planungs-Konzepten. Viele versuchen einfach nur zu überleben.
Wie Hannah Arendt angesichts der Misere der an internationalen Grenzen gefangenen Flüchtlinge sagte: »Es war kein Problem des Raums sondern der politischen Organisation.« Was Dr. Weiss hier getan hat, ist, den Fokus von dem abstrakten Gebiet politischer Organisation wieder zurück in die Realität der Orte zu verlegen, an denen Menschen leben.
Ihre analytische Einheit ist die Nachbarschaft. Sie ist Teil einer sehr bedeutenden neuen Bewegung von Historikern und Geographen, die sich darüber bewusst werden, dass die roten Fäden in der Geschichte von Nationen gefunden werden können, indem sie die inneren Strukturen spezifischer städtischer Nachbarschaften untersuchen. Die Nachbarschaft ist—trotz allem, wo diese Konflikte sich physisch abspielen - der Preis, um den wir ringen.
Durch das Ausgraben der Masse an Dokumenten und Aufzeichnungen und Briefen und Artikeln und Interview-Stimmen, die eine spezifische, verloren gegangene Nachbarschaft einkreisen, liefert Dr. Weiss uns die Art bedeutungsvoller, polyphoner Geschichtsschreibung, die uns ein breiteres Verständnis ermöglicht, ohne einfache und ideologisch befriedigende Antworten zu geben.
»Würde man der schlichten Chronologie folgen, nämlich den Annalen Wadi Salibs von ihrem verheißungsvollen Anfang bis zum bitteren Ende, hätte dies die Erwartung einer direkten Beziehung von Ursache und Wirkung nach sich gezogen und eine automatische Parallelisierung zwischen Chronologie und Kausalität entstehen lassen.« Doch dieses Buch ist bei Weitem zu differenziert, um eine solche unvermeidliche Kausalität für sich zu beanspruchen. Sie fährt fort: »Wadi Salib hatte, wie auch die Stadt Haifa, eine glänzende Zukunft mit zahlreichen Visionen vor sich, die eine nach der anderen ad acta gelegt wurden, was jedoch nicht unvermeidbar hätte sein müssen.«
Ich denke, das ist eine sehr gute Zusammenzählung historischer Best Practice: Nicht die Linie aufzuspüren, der gefolgt wurde, sondern die Stimmen zu hören, die für einen anderen Ausgang argumentierten. Die Geschichte, die uns Dr. Weiss hier erzählt, ist eine Tragödie. Die Nachbarschaft ist verlorengegangen. Fehler werden begangen - politische Fehler, juristische Fehler, persönliche Fehler, kriminelle Fehler, bürokratische Fehler, planerische Fehler. Aber indem sie der ganzen Bandbreite der Stimmen zuhört, die aus dem Schutt auftauchen, lässt sie uns die Saat der Hoffnung angedeihen. Was wir aus der Art Geschichtsschreibung, deren Pionierin Yfaat Weis5 ist, lernen, ist, dass in jeder verlassenen Ruine zahlreiche bessere Zukunftsversionen enthalten sind. Und mehr als jede einfache Antwort, ist es das, was wir aus unserer Geschichte ziehen sollten. Es ist das große Verdienst von Vfaat Weiss, dass sie einen kraftvollen und glaubwürdigen Weg gefunden hat, dies zu tun.
Geschichte ist nicht vergänglich. Um eine bessere Zukunft aufbauen zu können, müssen wir unsere Schlüsse aus ihr ziehen. Aus diesem Grund sind wir heute hier zusammengekommen, um eine Frau zu ehren, die dieses Ziel konsequent verfolgt. - Ich fasse mich kurz, gehe aber dennoch kurz auf das bisherige Wirken der Preisträgerin ein. Frau Yfaat Weiss, geboren 1962 in Haifa, ist Professorin am Fachbereich für jüdische Geschichte und zeitgenössisches Judentum an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Sie leitete von 2008-2011 die dortige Fakultät für Geschichte und ist derzeit Direktorin des Franz Rosenzweig Minerva Forschungszentrums. Ihre Forschungsschwerpunkte lagen dort auf der Vergangenheit Deutschlands und Zentraleuropas. Am Lehrstuhl für Jüdische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München forschte sie zu den deutsch-israelisch-tschechischen Beziehungen. 2012 erschien die deutsche Fassung ihres Buches Verdrängte Nachbarn. Wadi Salib - Haifas enteignete Erinnerung. Frau Weiss hat in ihrer Arbeit stets auch die Vielschichtigkeit der geschichtlichen Ereignisse und ihrer Hintergründe im Blick gehabt. _____ Enteignete Erinnerung -welch personifizierte Beschreibung für einen gesellschaftlichen Konflikt eines Mädchens, das seiner Erinnerung beraubt wird. Als seine Erinnerungen gehören sie nicht mehr ihm, sondern sind der gesellschaftlichen Beurteilung ausgesetzt. In ihrem Buch erzählt sie von den aus dem bis dato intakten Wohnquartier »Haifa« vertriebenen arabischen Einwohnern. Nach den Kämpfen wurden europäische und marokkanische Flüchtlinge in deren verlassene Wohnungen einquartiert, woraus Diskriminierungen zwischen israelischen Juden und europäischen und arabischen Flüchtlingen entstanden. Sie thematisiert Interessenskonflikte zwischen der arabisch-palästinensischen, der jüdisch-mizrachischen und der jüdisch-aschkenasischen Bevölkerung. Yfaat Weiss machte ihr Leben lang diese und andere Erfahrungen Einzelner sichtbar. Sie erzählt die Geschichte vertriebener Menschen und derer, die zwar die gleiche Religion haben, aber unterschiedlicher Herkunft sind. Sie gab ihre Erinnerung denjenigen zurück, denen sie genommen wurde. Machte sich zum Sprachrohr der Menschen, die im Zuge des Israel-Palästina-Konflikts oft vergessen wurden. Wer glaubt, dass es dabei vordergründig um Vergangenheitsbewältigung geht, irrt. Die Frage, wie wir mit Menschen, die einer anderen Religion angehören oder anderer Herkunft sind, umgehen, ist hochaktuell. Inwieweit schenken wir ihnen und ihren Belangen Gehör? Das ist einer der Gründe, warum wir heute Yfaat Weiss mit dem Hannah-Arendt-Preis auszeichnen. Sie führt uns vor Augen, welche Vielschichtigkeit ethnische Konflikte haben können. Wie Menschen innerhalb einer Nachbarschaft, einer Gesellschaft, zwischen Staaten interagieren und welche Rolle sie ihn ihr einnehmen. Yfaat Weiss transportiert diese Fragen ins 21. Jahrhundert. Ihre Arbeit hilft uns, unser Handeln zu hinterfragen und uns unserer Verantwortung für ein funktionierendes Gemeinwohl zu stellen. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zum Preis und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude bei Ihrer Forschung und uns allen wünsche ich interessante, zukunftsweisende Erkenntnisse daraus.
Es ist das gute Recht und vielleicht sogar die Pflicht der Jury des HannahArendt-Preises, die Öffentlichkeit mit ihren Entscheidungen zu verblüffen und manchmal sogar zu irritieren. Doch diesmal kann ich die Wahl der Jury mit Herz und Verstand teilen, sogar aus vollem Herzen und ungeteiltem Verstand. Yfaat Weiss ist nicht nur eine kluge Intellektuelle. Sie ist in jeder Hinsicht ein feiner Mensch: in ihrer genauen Beobachtungsgabe, ihrer gedanklichen und emotionalen Empfindsamkeit, ihrer von keiner ideologischen Prädisposition korrumpierten Integrität als Historikerin und in der Genauigkeit ihrer Sprache. Zugleich zeichnet sie ein sanfter Mut aus -kein polemisches Geschrei, keine lautstarken Anklagen, sondern der Mut, sich auf vermintes Terrain zu begeben. Im Fußballerjargon würde man sagen, sie geht dorthin, wo es weh tut. Das gilt nicht nur für die Ausgrabungsarbeit, die sie mit ihrem Buch über die Geschichte von Wadi Salib geleistet hat. Auch ihre anderen Veröffentlichungen gehen ans Eingemachte: über Staatsbürgerschaft und Ethnizität, über Deutsche und Juden im Dritten Reich, über Postkolonialismus und Zionismus, um nur einige zu nennen. Die Einmischung in die öffentlichen Angelegenheiten unterscheidet einen Intellektuellen vom bloßen Gelehrten. Yfaat Weiss beteiligt sich am öffentlichen Diskurs nicht mit Aufrufen und Appellen. Man wird ihren Namen auf wenigen Unterschriftenlisten finden. Vielmehr haben ihre wissenschaftlichen Arbeiten selbst eine hoch politische Dimension, weil sie an wunde Punkte rühren, die bis heute nicht verheilt sind. Indem sie darauf beharrt, dass die geschichtliche Wahrheit nicht der politischen Opportunität geopfert werden darf, geht sie auch das Risiko des Beifalls von der falschen Seite ein. Aber sie zieht zugleich eine klare Trennlinie zwischen historischer Aufarbeitung und dem »bewussten oder unbewussten Versuch, die Legitimität des nationalstaatlichen Projekts Israel zu bestreiten«. Dieser Satz stammt aus einem Vortrag, den sie bereits vor Jahren auf einer Veranstaltung der Heinrich Böll Stiftung in Bremen gehalten hat. Wer ihn heute liest, könnte ihn für einen aktuellen Text halten. Yfaat spricht von deutsch-israelischen »Entfernungsprozessen« und dem Hang zur selbstgerechten Verurteilung Israels, der mit einer Verkennung seiner Handlungsbedingungen einhergeht. Ein Großteil der deutschen Öffentlichkeit hat keine wirkliche Vorstellung von der soziokulturellen und politischen Heterogenität Israels, die zu enormen inneren Spannungen führt. Daran gemessen ist das Land immer noch ein Wunder an demokratischer Vitalität. Auch mit dem Verständnis für Israels prekäre Sicherheitslage ist es bei uns nicht weit her. Viele glauben, dass allein die israelische Besatzungspolitik einer friedlichen Koexistenz zwischen Juden und Arabern im Wege steht. Dabei ist keineswegs ausgemacht, dass ein Rückzug aus der Westbank zur dauerhaften Anerkennung Israels durch seine Nachbarn führen wird. Nicht nur der Iran, Hizbollah und Hamas haben die Vernichtung des »zionistischen Krebsgeschwürs« auf ihre Fahnen geschrieben. Und niemand weiß genau, was die Umwälzungen in der arabischen Welt mittelfristig für Israels Sicherheit bedeuten werden. Wir verkennen gern, um noch einmal Yfaat Weiss zu zitieren, »dass es Feinde und nicht nur Feindbilder gibt«. Gerade in Deutschland huldigen viele einem unpolitischen »Pazifismus als scheinbar moralische Haltung, und zwar in Verkennung der historischen Zusammenhänge, die Deutschland den Frieden gesichert haben«. Dabei ist die Anmaßung moralischer Überlegenheit gegenüber Israel allzu offenkundig ein Akt der Schuldumkehr; eine »Projektion der eigenen Schuld auf die damaligen Opfer, die heute scheinbar zu Tätern geworden sind«. Ich plädiere keineswegs für Nichteinmischung in die israelische Politik. Und ich halte eine ZweiStaaten-Lösung immer noch für den besten Weg zu einer halbwegs friedlichen Koexistenz zwischen Israel und seinen Nachbarn. Der bald ein Jahrhundert währende jüdisch-arabische Konflikt kann nur durch die wechselseitige Anerkennung der Kontrahenten beendet werden. Wenn diese Option verspielt wird, droht ein bitterer, lang anhaltender Kampf um »ganz Palästina«. Dann geht es nicht mehr um die Grenzen von 1967, sondern um eine Neuauflage der Kämpfe von 1948, die Yfaat Weiss am Beispiel Haifas so eindringlich geschildert hat. Wir sollten uns jedoch im Klaren sein, dass politischer Druck auf Israel mit Verpflichtungen verbunden ist. Eine Zwei-Staaten-Lösung muss die politische Souveränität der Palästinenser und die Sicherheit Israels garantieren. Wenn wir das eine wollen, können wir uns vor dem anderen nicht drücken. Mit den Worten von Yfaat Weiss: »Sich an diesem Prozess zu beteiligen, heißt für unsere Sicherheit zu haften. Ob ein Deutscher das Ausmaß dieser Verantwortung begreift, bleibt an dieser Stelle unbeantwortet.« Weil das so ist, habe ich keine Veranlassung, die Bundeskanzlerin für ihr Wort zu rügen, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson ist. Das ergibt sich aus einer Vergangenheit, die nicht vergeht. Die fundamentale Verbundenheit mit Israel schließt Empathie für die bedrängte Lage der Palästinenser keineswegs aus. Auch das können wir von Yfaat Weiss lernen: Ohne Empathie für den anderen gibt es keinen Ausweg aus der Spirale von Gewalt und Gegengewalt. Das gilt allerdings für alle Seiten dieses Konflikts. Ich gratuliere Yfaat Weiss zu dieser Auszeichnung, beglückwünsche die Jury zu ihrer Entscheidung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Im Jahre 1965 schuf der israelische Künstler Michael Druks eine aufregende, ganz in Ocker- und roten Lehmtönen gehaltene Assemblage, die den Titel Ein MahnmalflirMonshiya trügt (siehe Titelseite). Es Ist eine dreidimensionale Collage aus Bauschutt und Überresten von Mobiliar, aufgelesen von Druks am Strand zwischen Tel Aviv und jaffa. in einem hülzemen Fensterrahmen arrangiert der Künstler Bruchstücke von Fußbodenfliesen, Sprungfedern aus Bettgestellen, Tür- oder Fensterscharniere und ein Stück Stuhl- oder Tischbein zu einer Komposition, die sich auf der gesamten Fläche des ursprünglichen Fensterrahmens drängt. Der Blick wird zudem versperrt durch die massive Betcinplatte, auf die die einzelnen Elemente der Assembiage aufgeklebt sind. Hängt es an der Wand, wie ein Fenster, ist das Kunstwerk zwar horizontal ausgerichtet, doch ist seine Perspektive eigentlich eine senkrechte, auf den Boden und die Überreste der Pflasterung gerichtet. Darunter offenbart sich eine Art archäologischer Grabung, die eine materielle arabische Kultur freilegt, wie sie in den geometrischen Verzierungen der Kachelbruchstücke erkennbar wird, in der abgerundeten Form des herausgerissenen Fensters und den Oberresten seiner kunstvollen Beschläge. Dieses Werk aus den Bruchstücken von Erinnerung, die den Dingen Innewohnt, beschreibt Vergängrils und Vergehen, ein Prozess, der durch Wasser, Salz und Sand, die an Eisen, Keramik und Holz nagen, beschleunigt wird.
Man könnte meinen, Druks habe in dem Fensterrahmen einlangen wollen, was der polnische Dichter Zbigniew Herbert einmal als »die Verwandlung von Leben in Altertumsforschung« bezeichnet hat. Druks Arbeit dokumentiert die Überreste von Manshlye, ein von wohlhabenden Arabern Ende des 19. Jahrhunderts außerhalb der Mauern von Jaffa errichtetes Viertel, das im Zuge der Kämpfe von 1948 aufgegeben und gleich nach Kriegsende durch mittellose jüdische Flüchtlinge und Immigranten in Besitz genommen worden war. Zu dem Zeitpunkt, als Druks seine Arbeit anfertigte, Mitte der Sechzigerjahre, war Manshlye gerade dabei, geräumt und abgerissen zu werden. Die Funde, die bei Freilegung der obersten archäologischen Schicht zutage treten, dokumentieren den rasanten Übergang von einem Habitat hin zu bloßem Bauschutt.
Mit genau diesem Übergang beschäftigt sich mein Schreiben und Forschen. Und so wie das in einem Fensterrahmen gefangene Manshlye einem »Jaffolschen Rahmen«, wie Druks seine Arbeit in Anspielung auf eine lokale pittoreske Romantik ironisch nennt - ihm als Gleichnis dient, so dient mir das Viertel Wadi Salib in Haifa als Ausgrabungsstätte, deren Funde Schicht um Schicht die historische Textur in ihrer Gesamtheit offen legen: die muslimische Phase, die kurze Präsenz von zugezogenen HoLocau5tüberlebenden und die Anwesenheit der letzten Bewohner, der jüdischen Emigranten aus den Armenvierteln - den Mellahs Marokkos. Oberflüssig zu erwähnen, dass - im Unterschied zur gängigen archäologischen Praxis - das Interesse dieser kontemporären Archäologie vor allem den feinen Schichten zwischen den kurzen Zeiträumen und raschen Übergängen von einer Phase zur nächsten gilt. Die Ausgrabungsarbeit indes wird durch die Kornprimiertheit der einzelnen Schichten verkompliziert, da sie auch eine Deutung und Dechlifrierung der Funde erschwert.
In der kontemporären Archäologie, die sich sowohl visueller als auch verbaler Mittel bedient, ist die Ausbreitung der Fundstücke mit einer Vergegenwärtigung vergleichbar. Ein Habitat, das sich sonst verborgen innerhalb der Mauern eines Hauses findet, liegt - nachdem die Mauern eingestürzt sind - entblößt und für alle Weltsichtbar da. Die Gegenstände sind - wie der palästinensische Autor Ghassan Kanafani seinen Helden Sald sagen lässt - »sein geheiligter. persönlichster Besitz, den nie jemand, wer immer es auch sei, kennenlernen oder berühren oder auch nur sehen dürfe«; so in der im Exil in Beirut verfassten Novelle »Rückkehr nach Haifa«, in der der Besuch eines Flüchtlings in seinem Haus fast zwanzig Jahre nach seiner Flucht oder Vertreibung beschrieben wird. Die Entblößung dieses »hinterlassenen Besitzes« —so die Bezeichnung durch die israelische Rechtsprechung — vergegenwärtigt die Existenz seines vormaligen Bewohners als die eines Abwesenden. Gleichzeitig zeugt der private und alltägliche Charakter der Fundstücke, von Hausrat und Einrichtungsgegenständen, wie sie das Leben eines Jeden Einzelnen von uns ausfüllen, von den persönlichen Vorlieben eines Menschen, der sich sein Zuhause schafft, gibt Neigungen und Geschmack preis, seine geheimen Wünsche und Erwartungen, und dient als Beleg dafür, dass - wie Alexander Demandt einmal schrieb - »alle geschichtliche Vergangenheit einmal menschliche Zukunft war«.
An dieser Tatsache ist auf den ersten Blick nichts Besonderes. Historiographie befasst sich stets mit der Spannung zwischen gegenläufigen Zeitachsen. Historiker betrachten ein Ereignis von einem späteren Zeitpunkt aus, von dessen Ende her - während die Objekte dieses historischen Prozesses diesen gelebt und von Anbeginn an teilhatten. Pointiert formuliert Demandt dies in seinem Buch Ungeschehene Geschichte, er schreibt: »Der Historiker sieht aus der jeweils gegebenen Situation zurück auf deren Vergangenheit. Diese erscheint als ein Fächer von Einbahnstraßen, die alle auf das zur Blickbasis gewählte Ereignis zulaufen, ..‚ Der Handelnde hingegen blickt aus der Lage. In der er sich befindet, in die Zukunft. Für ihn kehrt sich der Fächer um.«
D och diese bekannte teteologische Falle macht es vor allem jenen schwer, die über ein noch offenes historisches Kapitel schreiben, ein Kapitel, dessen Ende nicht abzusehen ist. Dies umso mehr, als es sich um einen noch virulenten, aktiven nationalen Konflikt handelt, der als historisches Ereignis von den an ihm Beteiligten beschrieben wird. Unter solchen Umständen werden Historiker und Handelnder de facto eins. Das historische Schreiben sieht sich dabei nicht nur mit dem Ausbleiben einer Perspektive konfrontiert, die es erlauben würde, für die Gegenseite Ernpathie zu empfinden, sondern mit dem Wissen, dass das Schreiben von Geschichte politische Implikationen besitzt. Sie kann zu Legitimationszwecken in einem Diskurs bemüht werden, über den der Historiker oder die Historikerin keine Kontrolle ausüben, und der in der Lage ist, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Uni mich ein wenig von der Lähmung freizumachen, die dem historischen Schreiben inmitten eines Konfliktes und angesichts einer ungewissen Zukunft innewohnt, habe ich einige Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Um die unterste Schicht freizulegen, die früheste und verborgenste Schicht von allen, habe ich die oberste, die jüngste und offensichtliche Schicht, beiseite geräumt und sie dabei vielleicht auch beschädigt. Denn die archäologische Grabung kehrt die Anordnung der Schichten um und bringt so den chronologischen Ablauf als kausale Erklärung ins Wanken. Zudem ermöglicht die Einbeziehung einer weiteren zeitlichen Dimension, des Konjunktiv II, der »Geschichte, die sich nicht ereignet hat, beziehungsweise der Geschichte, wie sie sich hätte ereignen können«, ein tieferes Verständnis der Gegenwart als etwas Kontingentes, Zufälliges.
Das frappierende Ergebnis dieses Zurllckdrehens der Geschichte gegen den Uhrzeigersinn der historischen Abfolge ist eine Vergegenwärtigung der ehemaligen Bewohner und deren symbolische Rückführung in ihr vormaliges Zuhause, indem ihre Habseligkeiten aus einem Haufen Schutt geborgen und als Habitat imaginiert werden. Doch wäre es irrig anzunehmen, dieses textuelle Vorgehen sei gleichbedeutend mit der politischen Forderung nach einem palästinensischen Recht auf Rückkehr. Die Frage der Legitimität einer solchen Forderung und deren Aussichten im Verhältnis und Vergleich zu anderen Forderungen auf Repatriierung in einem Jahrhundert ethnischer Homogenisierung und nationalerZusamnienfuhrung ist in anderen Kontexten von vielen berufenen Stimmen erörtert worden. Ich aber befasse mich nicht mit Rückkehr, sondern mit einer Rückgabe, nicht mit Restauration, sondern mit einer Restitution. Denn die symbolische Rückführung der ehemaligen Bewohner möchte inmitten und ungeachtet der Dynamik eines noch aktiven Konfliktes ein Gegengewicht ausüben zu der allgemein verbreiteten Neigung, in dem Flüchtling jemanden zu sehen, der sich aufgrund seiner Existenz außerhalb der kosmologischen Ordnung der Dinge befindet. Es war Hannah Arendt, die als eine der ersten in dem bekannten Kapitel »Aporien der Menschenrechte« in ihrem Buch Ursprange und Elemente totaler Herrschaft— ein Kapitel, das Dan Diner als jene Textteile des Werkes charakterisiert hat, »in denen die jüdische Erfahrung der politischen Heimatlosigkeit in eine Kritik der universellen Menschen- und Bürgerrechte übergeht«—, auf die für die Lage des Flüchtlings charakteristische Heimatlosigkeit hingewiesen hat, auf eine Identität, die zwischen dem Verlust der Heimat und dem politischen Status und eines Ausstoßens aus der Menschheit überhaupt entsteht. Gegen eine solche »Ausstoßung aus der Menschheit überhaupt« möchte die so vorgenommene virtuelle Repatriierung die palästinensischen Flüchtlinge in der Sphäre des israelischen Bewusstseins einbürgern.
Die virtuelle Einbürgerung des palästinensischen Flüchtlings soll zum Verständnis seiner Motive in Vergangenheit und Gegenwart beitragen -und dies mit dem Ziel, Empathie zu erzeugen, die vielleicht das ihre zu einer künftigen politischen Regelung wird beitragen können, Dieses Vorhaben ist eng verbunden mit bestehenden Tendenzen in der geschichtlichen Forschung, wie sie von israelischen und anderen Historikerinnen und Historikern in den letzten zwei Jahrzehnten betrieben wird, Einer solchen Historiographie geht es darum, die Zeituhr anzuhalten, um durch einen neuen und erneuerten Blick auf Entwicklungen, die der Tragödie vorausgingen, historische Alternativen zu erwägen, die — vielleicht — den Konflikt hätten verhindern oder zumindest seine Auswirkungen hätten mildern können. Der Beginn dieser »neuen« Historiographie fällt zusammen mit der optimistischen, ja beinahe euphorischen Atmosphäre einer Vorstellung vom »Ende des Konflikts«, wie sie mit den Verträgen von Oslo Einzug hielt, Ihr Währen über diese Zeit hinaus trotzt der nachfolgenden Enttäuschung und des mit ihr einhergehenden Pessimismus, Der Bankrott des Osloer Konstrukts, des - bislang— letzten Versuchs, eine Aufteilung des Landes herbeizuführen, begünstigte eine politische und historiographische Neigung, Modellen der Vergangenheit nachzugehen, die jenseits Von Territorialität angelegt sind - so etwa das Modell einer binationalen Lösung. Diese Vision war zum ersten Mal Mitte der Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts formuliert worden, von einigen Zionisten, die allermeisten von ihnen Intellektuelle aus Mitteleuropa, die, zum Teil am eigenen Leibe, die verheerenden Resultate der europäischen Minderheitenpolitik erfahren hatten, wie sie sich als Ergebnis des Ersten Weltkriegs ausgestaltet hatten. Ober direkte Kontakte zur arabischen Seite, basierend auf einem Plan zur Dezentrali5ierung von Kompetenzen und der Schaffung eines vielgliedrigen Regierungssystems, das das Gewicht der hereditären Identitäten abschwächen sollte und diese von der zentralen, paritätischen politischen Herrschaft weg- und in begrenzte Bereiche lokaler kultureller Autonomie Uberftihren sollte, hofften diese Intellektuellen, eine Alternative zu schaffen zur Errichtung eines jüdischen Nationalstaates in Palästina. Denn ein solcher Nationalstaat, so ihre Oberzeugung, sei untauglich, in dem die Nation sich den Staat zu Eigen gemacht hat, um mit Hannah Arendt zu sprechen. Erhebliche Zweifel allerdings bestehen, ob eine paritätische Lösung, wie sie die Mitglieder des »Brit Shalom«, viele von ihnen Mitbegründer der Hebräischen Universität in Jerusalem, Ende der Zwanzigerjahre den Arabern antragen wollten, bei diesen überhaupt auf Gegenliebe gestoßen wäre, zu einem Zeitpunkt, als die arabische Bevölkerung rund 90 Prozent aller Bewohner des unter britischer Mandatsherrschaft stehenden Palästinas ausmachten. Auch die jüdische Öffentlichkeit im Lande begegnete den Initiatoren dieses Vorstoßes mehrheitlich mit Unverständnis, vor allem aufgrund ihrer Bereitschaft, auf die zionistische Forderung nach einer freien, unbeschränkten jüdischen Zuwanderung zu verzichten. Doch wie auch immer, ihre Hoffnungen sollten untergehen in einer Welle der Gewalt, die das Land im Jahre 1929 erfasste und ausgerechnet in den gemischt arabisch-j üdischen Städten ihren Höhepunkt erreichte -mithin an jenen Orten, die das Zentrum der binationalen Vision ausmachen sollten und mehr als alles andere die erhoffte Alternative eines Lebens in friedlicher Eintracht symbolisierten.
F reiheit gibt es nur in dem eigentümlichen Zwischen-Bereich der Politik. Von dieser Freiheit retten wir uns in die Notwendigkeit4 der Geschichte«. schreibt Arendt im August 1950. Eine erneute Sichtung ihres publizistischen Schaffens mit Erscheinen der AufsatzsammlungJewish Writings offenbart, dass selbst sie - die »nicht-zionistische Zionistin« oder »Proto-Zionistin« - Mitte der Vierzigerjahre vermeiden wollte, was sich als historische Notwendigkeit abzeichnete, und den Gang der Ereignisse aufzuhalten gewillt war, das heißt die Errichtung eines jüdischen Nationalstaates in Palästina, Ein Plan, der zum damaligen Zeitpunkt wachsende Unterstützung in zionistischen Gremien verbuchen konnte und den Arendt, als ihrer Meinung nach irrige Lösung, nachdrücklich ablehnte. Es gibt, wie inzwischen überzeugend nachgewiesen wurde, viele, die fälschlicherweise annehmen oder aber weiterhin die irreführende Meinung vertreten, Arendt habe stets die binationale Option unterstützt. Doch dem ist nicht so. Nach ihrem Verständnis hätte eine Binationalität den Status der Juden als Minderheit gegenüber einer arabischen Bevölkerungsmehrheit auf immer festgeschrieben. De facto aber trat sie für eine föderative Idee ein, ein Ansatz, der in verschiedenen Zusammenhängen in den frühen Vierzigerjahren in Europa erörtert wurde. Sei es eine Ordnung im Rahmen des britischen Commonwealth oder aber innerhalb einer mediterranen Föderation. Arendt jedenfalls glaubte, eine föderative Lösung könne verhindern, was sich nach ihren Worten als »tragischer Konflikt« abzuzeichnen begann, da ein jüdischer Nationalstaat den Arabern keine andere Option ließe, »als zwischen freiwilliger Emigration und einer Existenz als Bürger zweiter Klasse zu wählen«.
Ungeachtet aller Nähe Arendts zu jenen mitteleuropäischen Gelehrten des »Brit Shalom« ist mehr Trennendes als Gemeinsames zu erkennen. So öffnet sich eine Kluft zwischen deren Suche Ende der Zwanzigerjahre nach einer Kompromissformel der Koexistenz zwischen den jüdischen Kolonisten und den arabischen Einheimischen einerseits und jenem Moment, Ende 1944, andererseits, als Arendt in ihrem breit rezipierten Aufsatz »Zionism Reconsidered« ihre Vorbehalte gegen einen jüdischen Nationalstaat formulierte, Ein entscheidendes historisches Ereignis liegt zwischen diesen beiden Zeitpunkten, ein Ereignis, ohne das es zweifelhaft erscheint, ob sich die Dinge so entwickelt hätten, wie sie sich entwickelt haben. Als entscheidend, so hat Max Weber vorgeschlagen, erweist sich ein historisches Ereignis, wenn »bei Ausschaltung desselben aus dem Komplex der als rriitbedingend in Betracht gezogenen Faktoren oder bei seiner Abänderung in einem bestimmten Sinne der Ablauf der Geschehnisse nach allgemeinen Erfahrungsregeln eine in den für unser Interesse entscheidenden Punkten irgendwie anders gestaltete Richtung hätte einschlagen können«,
Kaum jemand würde ernsthaft in Frage stellen, dass sich der Konflikt, und mit ihm das Schicksal der Palästinenser, in eine gärizlich andere Richtung entwickelt hätte, hätte es den Holocaust an den europäischen Juden nicht gegeben. Hannah Arendt hat zu Recht auf die Machtlosigkeit des Zionismus zur Rettung der luden Europas verwiesen und darauf, dass die Juden im Lande um ein Haar ebenfalls der Vernichtung hätten anheimfallen können, wäre der Vormarsch von Rommels Truppen im westlichen Ägypten nicht gestoppt worden. Diese Feststellung Arendts hat seinerzeit ihren Freund Gershomn Schotern sehr verärgert,, genauso wie sie bis auf den heutigen Tag bei nicht Wenigen Erregung hervorruft. Dennoch, eingedenk der Kluft, die sich zunehmend auftat zwischen Scholems Sorge um das Judentum und Hannah Arendts Sorge um die Juden, war und ist Arendts stichelnde Bemerkung nicht von der Hand zu weisen. Die Vernichtung der europäischen Juden hingegen veränderte sowohl die Zielsetzung des Zionismus grundlegend als auch die Chancen für eine Realisierung seiner Aspiration, in Palästina einen jüdischen Staat zu errichten. Während sich Arendts pessimistische Prognosen zum Schicksal der Palästinenser angesichts der zionistischen Bestrebungen im Nachhinein als präzise und zutreffend erweisen sollten, konnte sie zum damaligen Zeitpunkt noch nicht jene Entwicklungen voraussehen, die die Aussichten auf eine Ver- wirklichung der zionistischen Bestrebungen entscheidend verbessern sollten. In jenem, Ende 1944 verfassten Aufsatz »Zionism Reconsidered«, bezweifelt Arendt, ob die einhunderttausend jüdischen Flüchtlinge - so ihre Schätzung—, die sich nach dem Krieg in Europa finden würden und in einem langsamen Strom, der sich gut und gerne über zehn Jahre zu erstrecken versprach, nach Palästina würden emigrieren können, dies tatsächlich auch tun wollten. Angesichts der Möglichkeiten eines Verbleibs, einer Integration und Einbürgerung in Europa war Arendt davon überzeugt, dass diese Menschen es zumindest zu einem Teil vorziehen würden, auf dem alten Kontinent zu verbleiben und sich gegen eine Emigration entscheiden werden.
Diese Prognose des Jahres 1944 sollte sich schlicht als falsch erweisen, sowohl hinsichtlich der Zahl der Flüchtlinge und Überlebenden als auch in Bezug auf die hypothetischen Möglichkeiten, die sich ihnen im Westen eröffnen würden. Insbesondere jedoch sollte Arendt mit Blick auf die politische Realität, die sich in Mittel- und Osteuropa herauszubilden begann, falsch liegen, vor allem mit Blick auf jenen Prozess einer ethnischen Homogenisierung, den diese Staaten im sowjetischen Einflussbereich unter kommunistischer Ägide und als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs zu durchlaufen begannen. Der Zionismus hatte, selbstverständlich, nicht den Holocaust an den europäischen Juden verhindern können, doch die Vernichtung des europäischen Judentums, die Ethnifizierungen in Mittel- und Osteuropa, der Kalte Krieg und der Beginn der Dekolonisierung als Folge und Ergebnis des Zweiten Weltkriegs, nach dessen Ende, schufen eine internationale Konstellation, die die Errichtung des Staates Israel ermöglichen sollte. Die Zahl der jüdischen Überlebenden und Flüchtlinge war größer als Arendt angenommen hatte, deren Möglichkeiten, in den Westen zu emigrieren oder sich in den westeuropäischen Demokratien zu integrieren, jedoch weitaus eingeschränkter, während ihr Vermögen in den Volksrepubliken, die im sowjetischen Einflussbereich Osteuropas entstanden, eine ethnische und kulturelle jüdische Existenz zu bewahren, gleich Null war. Folgerichtig sollte sich die Bereitschaft dieser Menschen, angesichts fehlender Alternativen zu warten und hartnäckig an die Tore Palästinas zu pochen, größer erweisen, als Hannah Arendt angenommen hatte, während die internationale Legitimation, die sie zu wecken vermochten, letztendlich eindeutiger ausfiel als erwartet. So wurde die Heimat der palästinensischen Araber tragischer Weise zur Zufluchtsstätte der Holocaustüberlebenden, eine Lage, die Arendt in Ursprünge und Elemente totaler Herrschaft wie folgt resümiert: »Nach dem Krieg hat sich dann herausgestellt, dass man gerade die Judenfrage, die als die einzig unlösbare galt, lösen konnte, und zwar aufgrund eines inzwischen erst kolonisierten und dann eroberten Territoriums, dass aber damit weder die Minderheitenhi noch die Staatenlosenfrage gelöst sind, sondern dass im Gegenteil die Lösung der Judenfrage, wie nahezu alle Ereignisse unseres Jahrhunderts, auch nur zur Folge gehabt hat, dass eine neue Kategorie, die arabischen Flüchtlinge, die Zahl der Staaten- und Rechtlosen um weitere siebenhundert- bis achthunderttausend Menschen vermehrte.«
Wie genau aber vollzog sich ein derartiger Vorgang? In Haifa zum Beispiel wurden in den verlassenen Häusern der Araber rund 24000 der insgesamt etwa 190000 jüdischen Flüchtlinge und Emigranten angesiedelt, die in dem kurzen Zeitraum zwischen dem Abzug der Briten aus Palästina im Mai 1948 und dem März des darauffolgenden Jahres ins Land kamen. In seinem bekannten Standardwerk Die Geburt des palästinensischen Flüchtlingsproblems widmet Benny Morris dem eine kurze und lakonische Beschreibung, in der er zu der Feststellung kommt: »In Jaffa und Haifa befanden sich die größten - und auch modernsten - Konzentrationen an verlassenen arabischen Häusern, und daher war es nur natürlich, dass man die ersten Massen der Neueinwanderer in diese Städte kanalisierte.«
Morris nüchternes Diktum jedoch stellt eine Ausnahme dar, die nicht von der Regel kündet, das soll heißen der historiographischen Forschung in ihrer Gesamtheit, die es vorzog, sich nicht allzu intensiv mit dem Überlebenden zu beschäftigen, der im Haus des Flüchtlings wohnt. Die Tragödie blieb ein Betätigungsfeld der Literatur. So etwa bei Ghassan Kanafani, der sich 1969 im Exil in Beirut entschloss, in seiner Novelle '>Die Rückkehr nach Haifa« die Holocaustüberlebende Miriam Goshen im Haus der palästinensischen Flüchtlinge Said und Safiya wohnhaft werden zu lassen. Kanafanis Fähigkeit, den Konnex der Ereignisse zu erkennen, und der Wagemut seiner empathischen Geste, die er als Flüchtling gegenüber dem Schicksal des Feindes, der zugleich Überlebender des Holocausts ist, an den Tag legt, waren seiner Zeit weit voraus. Eine Lösung im politischen Sinne indes enthielt sie nicht. Alle Empathie vermochte die Frustration des Flüchtlings angesichts des Unvermögens, das eigene Haus, mithin die eigene Vergangenheit wiederzuerlangen, nicht zu beseitigen. Nachdem Kanafani seinen Helden Said auf die Reise geschickt hat, um sein ehemaliges Zuhause aufzusuchen, und ihm so ermöglicht, einen Blick auf eine Zukunft zu werfen, die sich für ihn nicht erfüllt hat, lässt er ihm am Ende der Novelle keinen anderen Ausweg, als beim Verlassen seines verlorenen Heims noch auf der Schwelle den jetzigen Bewohnern zuzuwerfen: »Ihr könnt vorläufig in unserem Haus bleiben. Das ist etwas, zu dessen Bereinigung es einen Krieg braucht.« Diese Prophezeiung Ende der Sechzigerjahre spiegelt glaubwürdig die damalige Zeit wider, eine Zeit des bewaffneten Kampfes, womit Kanafanis Novelle in zwei Sprachen verharrt: der literarisch-empathischen einerseits und der ideologisch-bellizistischen andererseits. Das Wissen darum, dass der Überlebende im Hause des Flüchtlings wohnt, scheint allerdings ein wenig abgestumpft zu sein, je mehr Zeit seitdem verstrichen ist. Denn diesem Wissen ist offenbar ein Schicksal bestimmt, das sich mit dem Paradoxon deckt, welches das Strandgut auf der von Druks geschaffenen Assemblage zum Ausdruck bringt: Gerade die festen, harten Materialien sind unter dem Einfluss von Wasser und Sand abgeschliffen und haben ihre scharfen Konturen verloren. Ja, mehr noch, der politische Stillstand und die durch die Fortdauer der Besatzung erfolgte Wandlung von etwas Akutem in Chronisches haben in gewissem Maße Erschöpfung und Überdruss hervorgebracht. Zudem haben sie das obsessive Beharren der jüdischen Seite, ihr Schicksal als Argument im Konflikt heranzuziehen, auf Dauer entkräftet.
In der Schichtung der kontemporären Archäologie stellen die Holocaustüberlebenden eine weitere Schicht dar, auch wenn ihr Verbleib in dem verlassenen palästinensischen Eigentum zumeist nur von kurzer Dauer war. Zu Beginn der Fünfzigerjahre und nachdem sie im Lande Fuß gefasst hatten, tauschten viele von ihnen die »hinterlassenen Besitztümer« gegen modernere und großzügiger geschnittene Wohnverhältnisse ein. Die von den Holocaustüberlebenden geräumten Häuser und Wohnungen wurden von der nächsten Welle von Einwanderern bezogen, vor allem von mittellosen jüdischen Emigranten, vormaligen Bewohnern der Mellahs, der Armenviertel Marokkos, die nach ihrer Einwanderung nach Israel den Weg in die großen Städte fanden und ihre in Marokko zurückgelassenen Behausungen gegen die der Palästinenser eintauschten. Ihre Emigration war ein verkehrtes Spiegelbild der Ereignisse des Jahres 1948 in Palästina, und es besteht kein Zweifel, dass die Ereignisse dort auf ihren Status und ihre Situation in Marokko abgestrahlt haben. Denn diese Entwicklungen in Palästina und Israel einerseits und in Marokko am Vorabend der Unabhängigkeit des Landes andererseits vollzogen sich als Teil eines Dekolonisierungsprozesses und waren, ähnlich den ethnischen Homogenisierungen in den mittel- und osteuropäischen Staaten einige Jahre zuvor, ein indirektes Resultat des Zweiten Weltkriegs. Dass die zionistische Bewegung mit Verspätung ihr Interesse auf die Juden in den islamischen Ländern richtete, resultierte aus den katastrophalen demographischen Auswirkungen, die der Zweite Weltkrieg gezeitigt hatte. Dabei war es der zionistischen Führung ein Leichtes, das religiöse Empfinden, das vielen der marokkanischen Juden gemein war, vom »Heiligen Land« auf den Staat Israel zu übertragen, insbesondere nachdem der Widerstand gegen den Zionismus in jenen Kreisen, die in der Vergangenheit noch assimilatorische Positionen unterstützt hatten, sukzessive schwand, vor allem vor dem Hintergrund der für sie folgenreichen Kollaboration des Vichy-Regimes mit Nazideutschland und der antijüdischen Gesetzgebung in Nordafrika.
Der Protest dieser jüdischen Einwanderer aus Marokko, der letzten Bewohner Wadi Salibs, und die schweren Unruhen, die im Sommer 1959 aufflammten, erzeugten in Israel zum ersten Mal ein politisches Bewusstsein für den tiefen Riss, der sich aufgetan hatte zwischen den aus Europa eingewanderten Emigranten — den »A.schkeriasim« nach landläufiger Sprachregelung— und den aus Afrika und Asien ins Land gekommenen Juden, den »Sephardirn«, wie sie in der Vergangenheit bezeichnet wurden, ehe sich die heute übliche Bezeichnung »Mirachim« - »Orientalen« - durchsetzte. Die materielle Notlage dieser mittellosen Immigranten wurde nun allmählich wahrgenommen, zu einem Zeitpunkt indes, da in den Jahren nach 1952 ein Teil der im Lande lebenden Holocaustüberlebenden mittels persönlicher Entschädigungszahlungen ganz allmählich die eigenen Lebensbedingungen hatte verbessern können. Doch während die so genannten Wiedergutmachungszahlungen die materielle Lage der Hotocaustüberlebenden verbesserten, vertieften sie gleichzeitig die materielle Kluft zwischen ihnen und den mittellosen Immigranten aus den arabischen Ländern. Zur materiellen Dimension gesellte sich die symbolische. Während die Entschädigungszahlungen den Überlebenden Anerkennung zollte, wurde der vergangenen Welt der marokkanischen Juden speziell und der der Einwanderer aus arabischen Ländern allgemein in Israel keinerlei Anerkennung zuteil.
Mancher ist heutzutage versucht, eine Inventarliste des Jüdischen Eigentums zu erstellen, das die Juden in den arabischen Staaten zurückgelassen haben, um dieses - als Geste gewissermaßen der retroaktiven Anerkennung der jüdischen Einwanderung aus den islamischen Ländern als Teil eines großen, orchestrierten Bevölkerungsaustausches -als künftige Berechn ungsbasi5 und Faustpfand gegen mögliche palästinensische Entschädigungsforderungen zu verwenden. Dieses Verfahren jedoch, das eine Negativverbindung zwischen den palästinensischen Flüchtlingen einerseits und den Emigranten aus den Ländern des Islam andererseits herstellt, ist unlauter. Denn aus zionistischer Perspektive waren die Menschen keine Flüchtlinge, sondern Einwanderer gewesen, die in ihre alt-neue Heimat zurückkehrten. Ani anderen Ende des politischen Spektrums in Israel finden sich jene, die im Sinne einer orientalistischen Deutung eine Verbindung zwischen den »Misrachim« und den palästinensischen Bürgern Israels herstellen wollen, eine Verbindung zweier Gruppen, die durch das zionistische, das aschkenasische Establishment gleichermaßen benachteiligt und unterdrückt würden. Doch neigt dieses Verständniswissentlich oder nicht - dazu, die Charakteristika des israelischen Projekts einer ethnischen Homogenisierung zu übersehen. Denn ungeachtet seiner osteuropäischen Wurzeln und der Tatsache, dass es sich parallel zu ähnlichen Entwicklungen in Osteuropa in den ersten Jahren nach 1945 vollzog, unterscheidet sich die israelische Variante von diesen maßgeblich darin, dass sie nationale Minderheiten nicht zu assimilieren gedachte. Der jüdische Nationalstaat hat weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart eine nationale Minderheit— konkret: die Palästinenser — jemals angehalten noch es ihnen ermöglicht, sich in die Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Eine tatsächlich existierende oder auch nur imaginierte kulturelle Beziehung zwischen Palästinensern und Misrachim kann die grundlegende Tatsache nicht aus der Welt schaffen, dass die Notlage der Palästinenser schon immer im politischen Bereich verortet war, während die der Misrachim eindeutig im sozialen Bereich festzumachen ist. In Bezug auf die Unterscheidung zwischen diesen beiden Bereichen gilt noch immer Hannah Arendts Diktum, zu finden in ihrem scharfen Artikel »Little Rock«, ein Artikel, der auf viel Unverständnis gestoßen war, obschon er völlig verständlich ist: »Diskriminierung ist ein ebenso unabdingbares gesellschaftliches Recht wie Gleichheit ein politisches ist.«
E s wäre naiv anzunehmen, der hier betriebenen kontemporären Archäologie könne es gelingen, dem Telos des Konfliktes entgegenzuwirken und mittels einer Geschichte, die sich nicht ereignet hat, die Historiographie zu einem politischen Gebrauchsinstrument zu machen. Eine Geschichtsschreibung, die entschärfen möchte, um Dinge zu verschärfen, will nicht instrumentalisiert werden und lässt sich nicht für einen akuten Zweck rekrutieren. Die Aussöhnung verschiedener Narrative durch den Historiker ist kein Ersatz für die Lösung von Konflikten durch die Politik, und mit einigem Fug und Recht lässt sich behaupten, dass die Annäherung historischer Narrative nur unter der Bedingung eines Endes des Konfliktes überhaupt möglich wird. Die beiden zurückliegenden Jahrzehnte waren bestimmt von Turbulenzen und Verwerfungen, dennoch herrschte die optimistische Grundannahme vor, über kurz oder lang werde sich der Konflikt als lösbar erweisen. Diese Annahme und Hoffnung haben mein Schreiben genährt, haben ihm zugleich bescheidene Ziele diktiert, so zum Beispiel sich darauf zu beschränken, Ernpathie hervorzurufen: das Mitempfinden der Juden in Israel für das Schicksal der palästinensischen Flüchtlinge zu steigern und gleichzeitig die Lage der Palästinenser, soweit sie Bürger des Staates sind, zu verbessern; die innerisraelisch-jüdische Empathie für die verlorene Welt der Hobcaustüberlebenden einerseits und der Einwanderer aus den muslimischen Ländern andererseits zu stärken; und vielleicht auch die Empathie des Betrachters und der Betrachterin von außen zu erzeugen, die des nicht enden wollenden Konfliktes nicht selten überdrüssig sind, weil sie angesichts der Dichte und der schnellen Abfolge der Ereignisse die tragischen Umstände vergessen haben, aufgrund derer sich der Überlebende eines Tages im Hause des Flüchtlings wiederfand.
Würde eine solche Hypothese fehlen, eine derartige optimistische Grundhaltung, etwa im Falle einer Veränderung des Telos und eines Schwindens der Aussöhnungsoption, erschiene es sehr zweifelhaft, welchen Nutzen die kontemporäre Archäologie und ihre feinen textuetlen Schritte hätte.
Yfaat Weiss, Historikerin an der Hebräischen Universität in Jerusalem
Sehr verehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie heute Abend anlässlich der nunmehr zum achtzehnten Male stattfindenden Verleihung des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken« in dem altehrwürdigen Bremer Rathaussaal begrüßen zu dürfen. Besonders jedoch heiße ich Sie - liebe und geehrte Frau Yfaat Weiss - als diesjährige Preisträgerin, wie auch ihren Mann, ganz herzlich in Bremen willkommen. Alljährlich entscheidet eine unabhängige und internationale Jury darüber, wem der »Hannah-Arendt-Preis« zugedacht werden soll. Gewürdigt wird »im Lichte der Öffentlichkeit« heute die Historikerin Yfaat Weiss. Yfaat Weiss, in Haifa geboren, lehrt als Professorin für jüdische Geschichte und zeitgenössisches Judentum an der hebräischen Universität in Jerusalem und ist derzeitige Direktorin des dortigen Franz Rosenzweig Minerva Forschungszentrums. Überdies ist sie an dem Aufbau des Lehrstuhls für Jüdische Geschichte an der Universität München beteiligt gewesen und hat zahlreiche Forschungsaufenthalte, unter anderem in Wien, Leipzig und Hamburg verbracht. Dies sind selbstverständlich nur einige Stationen ihres vielgestaltigen Wirkens und Tätigseins. Eigens hervorgehoben sei allerdings noch ihr Buch Verdrängte Nachbarn. Wadi SalibHaifas enteignete Erinnerung, das seit dem Frühjahr 2012 auch in deutscher Sprache vorliegt. Wir danken ebenfalls an dieser Stelle der Jury für ihr nicht nachlassendes Gespür, erneut eine genuin politische Denkerin wie Yfaat Weiss zur Ehrung befunden zu haben, welche den Arendt'schen Grundgedanken der Pluralität auf ihre Weise gedanklich fortbahnt und bewahrt. (Oder, wie Yfaat Weiss es so schön zum Ausdruck bringt: »Die Grundessenz des öffentlichen Bereichs besteht in der Vielzahl seiner diversen simultanen Stimmen.«) Um nun den Erläuterungen der Jury in Bezug auf die Preisvergabe nicht vorzugreifen, möchte ich es bei diesen wenigen Anmerkungen belassen. Nicht zuletzt jedoch gilt der neuerliche und unsererseits außerordentlich herzliche Dank auch diesmal wieder den großzügigen Geldgebern und freundlichen Förderern, namentlich dem Bremer Senat (repräsentiert von der Senatorin Frau Stahmann) und der Heinrich Böll Stiftung (vertreten durch Herrn Fücks), welche seit vielen Jahren die Preisvergabe tragen und maßgeblich unterstützen. Ohne Sie wäre ein Festakt wie der heutige nicht möglich. Zudem gebührt ein besonderer Dank neben der Jury, den Mitstreiterinnen aus dem Vorstand —genannt seien: Antonia Grunenberg, Eva Senghaas-Knobloch und Peter Rüde[ - wie auch den Mitgliedern und Unterstützerinnen des Vereins »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken«. Gestatten Sie mir, verehrte Gäste, Sie nun auf den weiteren Fortgang der Festveranstaltung hinzuweisen. Zunächst wird Willfried Maier, stellvertretend für die Jury, die Entscheidung darlegen, Yfaat Weiss heute mit dem Hannah-Arendt-Preis auszuzeichnen. Danach folgt die Laudatio seitens Doug Saunders', welcher den weiten Weg hierher auf sich genommen hat. Auch ihm sei ausdrücklich gedankt. im unmittelbaren Anschluss hieran, damit gewissermaßen zum Hauptakt gelangend, haben wir die Gelegenheit, den Festvortrag von Yfaat Weiss zu hören, auf den wir alle freudig gespannt sind. Zu guter Letzt werden die erwähnten Stifter des Preises, die Heinrich Böll Stiftung und der Senat der Freien Hansestadt Bremen, zu Wort kommen. Nach der darauffolgenden feierlichen Preisübergabe sind Sie, meine Damen und Herren, wie immer herzlichst dazu eingeladen, bei einem Glas Sekt im hiesigen Nachbarsaal, den Abend nach- und ausklingen zu lassen. Hoffentlich in der begründeten Zuversicht, dass, um eine Wendung Helmuth Plessners aufzugreifen, in der Welt doch mehr - und vor allem politischer gedacht wird, als man zuweilen vielleicht denkt, ich danke nochmals allen, die von nah und fern angereist sind im Namen des Vereins »Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken« für ihr Erscheinen und darf Sie, liebe Anwesende, abschließend noch zu dem morgigen, gegen 10 Uhr angesetzten Kolloquium im Institut Francais recht herzlich willkommen heißen. Dort werden Yfaat Weiss und Doug Sounders miteinander diskutieren. Die Moderation übernimmt Ulrich Bielefeld. Hiermit reiche ich das Wort an Willfried Maier von der Jury weiter.
Vielen Dank.
AIs wir uns im März dieses Jahres entschieden, Yfaat Weiss mit dem Hannah-Arendt-Preis auszuzeichnen, wussten wir nicht, dass im November am Gaza-Streifen wieder gekämpft würde. Wenn auch jetzt eine Waffenruhe vereinbart wurde: Die Aktualität und Schärfe des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern ist wieder im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit. Ob wir wollen oder nicht, stellt sich damit die Frage: Hält unsere Entscheidung vom Frühjahr der politischen Entwicklung im Herbst stand? Ich denke, sie hält nicht nur stand. Sie hat sogar an Bedeutung gewonnen.
Dabei ist Yfaat Weiss Historikerin, keine Politikerin, und sie macht in ihren Werken keine Vorschläge zur Lösung des israelischpalästinensischen Konflikts, Sie hat auch keine Geschichte dieses Konflikts geschrieben. Sie beschäftigt sich in ihrem letzten in Deutsch veröffentlichten Buch Verdrängte Nachbarn vor allem mit einem innerisraetischen Konflikt, So wie sie sich in ihrem Buch über Deutsche und polnische Juden vor dem Holocaust mit einer innerjüdischen Auseinandersetzung beschäftigte. Und in ihrer Studie über die israelische Lyrikerin und Schriftstellerin Lea Goldberg - Lehrjahre in beutsdüand 1930-1933 mit der Herausbildung einer intellektuellen jüdisch-israelischen Identität aus den Minoritäts- und Unterdrückungserfahrungen in Deutschland und Europa.
Und dennoch beleuchten diese internen Konflikte und Auseinandersetzungen zugleich die verdrängte Konfliktgeschichte mit den Palästinensern sowie die europäische Welt vor dem Holocaust. In ihrem Buch Verdrängte Nachbarn, Wadi Salib - Haifas enteignete Erinnerung geht Yfaat Weiss von einem Ereignis im Sommer 1959 aus, »als sich der Protest von jüdischen Immigranten aus arabischen Ländern - überwiegend aus Marokko - in einer Welle von Unruhen entlud, die sich gegen die Behörden und das städtische, aschkenasische, sozialdemokratische Establishment vor Ort richtete«. Weiss bezeichnet diese Ereignisse als »Katalysator«, an dem ein »politisches Bewusstsein für die ethni5che Diskriminierung sowie die Frustration und die Vorbehalte unter den Juden in Israel« erwachte.
Aber sie belässt es nicht dabei, sondern beleuchtet von diesem Ereignis aus die gesamte neuere Geschichte Haifas: Die flucht und Vertreibung des größten Teils der arabischen Bevölkerung Haifas während des Krieges1948 und die Verhinderung ihrer Rückkehr in den Jahren danach. Und weiter zurück: Die Neubegründung Haifas als religiös und ethnisch plurale Hafenstadt und Bahnknotenpunkt seit Ende des 19. Jahrhunderts und die zunehmende nationale Segregation ihrer Bewohner während der britischen Mandatsherrschaft, Schließlich wirft sie von den 1959er-Ereigni5sen imursprünglich arabischen, dann miarachischen Stadtviertel Wadi Salib aus den Blick auf die weitere Entwicklung Haifas bei dem Versuch, ethnische Segregation unter Juden planerisch-bürokratisch aufzulösen, bis heute mit der immer noch nicht geschlossenen Wunde des zerstörten Wadi Salib5 im Zentrum der Stadt.
Hannah Arendt hat in den Fünfzigerjahren in ihrem Essay »Verstehen und Politik« einen Grundsatz der Geschichtsschreibung entfaltet: »Wann immer ein Ereignis vorkommt, das groß genug ist, seine eigene Vergangenheit zu erhellen, entsteht Geschichte. Nur dann zeigt sich der Irrgarten vergangener Geschehnisse als eine Geschichte (story), die erzählt werden kann, weil sie einen Anfang und ein Ende hat.« Und: »Das Ereignis erhellt seine eigene Vergangenheit, niemals kann es aus ihr abgeleitet werden.« (5. 122)
Arendt wendet sich mit diesem Gedanken gegen die Vorstellung, dass es in der Geschichtsschreibung um kausales Erklären von Entwicklungen gehe, also um Ableitungen aus Notwendigkeit, Es geht vielmehr darum, Handlungen zu beschreiben und ihren Sinn zu verstehen. Und der ergibt sich weder aus objektiven Notwendigkeiten noch aus der je subjektiven Perspektive der unmittelbar Agierenden, sondern aus der Bedeutung für die Welt, die aus diesen Handlungen - für den Einzelnen unkalkulierbar - schließlich erwachsen ist.
Arendts unmittelbares Interesse bei diesem Gedanken ist die Rettung der Freiheit des Handelns in der Geschichtsschreibung - gegen die historische Notwendigkeit der ideologischen Konstruktionen. Die Vertreibung und Flucht der Araber aus Haifa im Jahr 1948 war nicht notwendig, sondern ergab sich aus bestimmten Handlungen: Handlungen der Hagana, aus Handlungen der britischen Maldatsverwattung, der palästinensischen Honoratioren in Haifa und der palästinensischen Führung im ganzen Land, sowie aus den Massenreaktionen der verängstigten Flüchtlinge, deren Handeln am ehesten Züge von Notwendigkeit trägt. Und wo auf Handlungen verwiesen werden kann, gibt es Freiheit und nicht nur Notwendigkeit. Yfaat Weiss schreibt: »0a5 Buch postuliert... keine zwingende Kausalität, die zur Zerstörung Wadi SaLibs führte.« (S.11)
Dass Arendts theoretische Überlegung zur Geschichtsschreibung sich nicht nur ihrer Vorliebe für die Freiheit verdankt, sondern historisch fruchtbar ist, lässt sich an Yfaat Weiss' Buch schön studieren. Das Ereignis, von dem sie ausgeht - der mizrachi5che Aufruhr in Wadi Salib 1959— war ein kollektiver Vorgang. Es ging - beginnend mit einer Wirtshausschlägerei und einem übereilten Polizistenschuss - uni Handlungen ganzer Menschengruppen. lind diese Handlungen schlagen sich nicht nur nieder im Geschehen derAufruhrtage, sondern auch in Institutionen, die diese Ereignisse aufzuarbeiten versuchen, In der Archäologie des Eigentums In der Stadt, In Aktionen der städtischen Planungsbürokratie, in der Einwanderungspolitik des Staates und schließlich in den städtebaulichen Strukturen, die aus alledem entstehen.
Und diese Handlungen tragen eine Bedeutung in sich, die sich im Ereignis enthüllt: Im Aufruhr der aus Marokko stammenden Juden wird sichtbar, wie viel orientalisch-arabische Lebensweise und Kultur Israel in sich hat, auch nach Vertreibung und Flucht des größten Teils der arabischen Bevölkerung aus Halfa. Und Im Umgang der von Aschkenasen dominierten staatlichen Bürokratie mit diesem Ereignis zeigt sich, dass die aus Europa stammenden Zionisten mit diesem Umstand auch innerjüdisch nicht leben wollten, sondern Ihn durch Umsiedlung der mizrachlschen Juden in verstreute Siedlungs-Wohnungen aufzulösen versuchten. »Die Liquldlerung Wadi Saubs, seine Zerstörung und seine Konservierung als Ruinenfeld über Jahrzehnte hinweg kennzeichnete mehr als altes andere die Verleugnung der arabischen Vergangenheit der Stadt, während die partielle und schwierige Rehabilitierung seiner Bewohner das Unbehagen angesichts der arabischen Geburtsorte seiner orientalischen Bewohner symbolisierte.« S. 246)
Wenn die Kategorie der Kausalität hier wie bei allem historischen Handeln unangemessen ist, gibt es doch wiederkehrende Muster von Handlungen, in denen man sie wiedererkennt und in eine gemeinsame Welt durch Analogiewahrnehmungen einordnen kann. Yfaat Weiss deutet bei der Beschreibung der Stadtplanungspolitik der sozialdemokratischen Stadtverwaltung Halfas auf solche in vielen europäischen und nordamerikanischen Städten wiederkehrende ähnliche Muster hin. Der langjährige Bürgermeister von Haifa, Abba Khoushi, begründete die Aussiedlung der nordafrikanischen Juden aus Wadi Salib und ihre geplante Zerstreuung auf gemischte WohnsiedlungsproJekte mit den Worten: »Sie vermischen sich und vergessen die Herkunft« (S. 225) lind genau diese Absicht, die Herkunft von Zuwanderern vergessen und sie in die Homogenität einer Nation in Bildung aufgehen zu lassen, wurde und wird »Im Rahmen nationaler Projekte« auch anderswo bis heute verfolgt.
Im Fall der Mizrachini aus Wadi Salib scheiterte die Absicht. Die Mehrheit der Bewohner Wadi Salibs verweigerte sich der Lösung der Wohnraumbeschaffung in Siedlungsprojekten am Stadtrand und suchte Ersatzwohnungen in der Nähe von Wadi Salib sowie in der Unterstadt Haifas, der Altstadt - trotz des geringeren Wohnstandards. Und die Minderheit, die das städtische Wohnangebot annahm, beklagte trotz der nun größeren Wohnungen die Überfüllung und die Vereinsamung in der neuen Wohnsituation.
Vfaat Weiss ordnet diese Erfahrung in den allgemeineren Trend der städtischen Moderne ein: »Die Politik der Wohnraumbeschaffung und Stadtplanung war das gesamte 20. Jahrhundert hindurch von dem Wunsch getrieben, die physische Umgebung der unteren Schichten -In vielen Fällen die städtische Arbeiterklasse - zu reinigen< und auf diesem Weg die gesellschaftliche Realität zu verändern.« (5. 223)
In Haifa wurde dieses Integrationsprojekt der nationalstaatlichen Moderne »unter den Bedingungen eines nationalen Konflikts« allerdings variiert: Die verbliebene arabische Bevölkerung wurde von ihm ausgeschlossen: »Die modernistisch zionistische Konzeption, die bereits in den frühen Plänen, wie denen des Haifa-Komitees 1939, selektiv und exklusiv hauptsächlich auf die Juden ausgerichtet war, blieb auch nach der Staatsgründung überwiegend die gleiche« (S. 225)
Von Hannah Arendt gibt es einen kleinen Essay. der 1959 unter dem Titel »Little Rock. Ketzerische Ansichten über die Negerfrage und equality« Skandal machte. Arendt vertrat darin gegenüber dem US-amerikanischen Versuch, die Rassentrennung im Süden durch bundestaatlichen Eingriff zu beenden, den Standpunkt: Sache des Staates sei es, allen Bürgern die vollen politischen Rechte zu garantieren und die ungeschmälerten individuellen Rechte der Lebensgestaltung, zum Beispiel der Eheschließung (Aufhebung des Verbots der »Mischehe« in verschiedenen Bundesstaaten). Außerdem hätten alle Bürgerinnen und Bürger den gleichen Anspruch auf Nutzung öffentlicher Einrichtungen und des öffentlichen Raums. Mit wem sie aber zusammen wohnen und in wessen Gesellschaft sie ihren Urlaub verbringen wollten, sei eine bloß gesellschaftliche Frage und da müsse Vereinigungsfreiheit herrschen.
Nicht weit davon entfernt sind die (Iberlegungen Yfaat Weiss' zu möglichen Handlungsatternativen im Konflikt um Wadi Salib und zur modernen Stadtplanung überhaupt: »Die Sanierung des Stadtzentrums, eine Lösung, zu der die meisten der Bewohner tendierten, die eine Ersatzwohnung einer Wohnung in einer neuen Siedlung vorzogen, wäre möglicherweise erfolgreicher gewesen.
Sie hätte eventuell zum Entstehen einer städtischen Kultur beigetragen, die im Laufe der Peripherisierung der Bewohner der Stadtmitte geschwächt wurde. Doch dazu hätte es einer räumlichen Vorstellung und einer anderen Konzeption bedurft als der integrativen, die der städtischen Sozialdemokratie Haifas vor Augen stand. Zum Beispiel eine De-Segregation, ein Zukunftsmodell das danach strebt, fließende Übergänge zwischen Gruppen mit definierten kulturellen Charakteristika zu schaffen. Keine Eliminierung der Unterschiede ...‚ sondern die Grenzen passierbar machen.« (S. 231) Eine Lösung, die nicht nur in Haifa von Interesse ist, sondern in Yfaat Weiss' Sicht »im Geist der gegenwärtigen Trends in multikultureller Planung« liegt.
Diese Sicht betrifft die ethnischen Unterschiede zwischen Juden in Israel. Hinsichtlich der Segregation der Araber in Haifa erklärt sie diese stadtplanerischen Begriffe für nicht anwendbar: Deren SegTegation sei ihnen 1948 aufgezwungen und seitdem durch ihre mindere rechtliche Stellung befestigt worden. Hinsichtlich der Situation in den USA bestand Hannah Arendt darauf, dass gegen gesetzlich erzwungene Diskriminierung nur gehandelt werden kann, indem die diskriminierenden Gesetze abgeschafft und damit die Gleichheit im politischen Gemeinwesen hergestellt wird.
Auch das ist bekanntlich nicht nur in Israel eine wichtige Frage gegenüber der eingesessenen Minorität der Araber, sondern in allen P Einwanderungsländern heute gegenüber den Zuwanderern, denen lange die Staatsbürgerschaft verweigert wurde und wird. Im Epilog ihres Buches stellt Yfaat Weiss zwei Werke palästinensischer Schriftsteller vor, die die Flucht aus Haifa und eine geträumte Heimkehr erinnern sowie vorstellen. Einmal vom - Erzähler Kanafani den Versuch einer Konservierung der Erinnerung, aus der der Wunsch nach der Rückkehr in eine erstarrte Vergangenheit erwächst. Zum anderen beim Lyriker Darwish die Sehnsucht, sein einstiges Zuhause besuchen zu können und die Aufforderung an den israelischen »Feind«, im palästinensischen Flüchtling ein Ebenbild zu sehen und eine Situation eintreten zu lassen, in der die Amnesie der einen wie die Nostalgie der anderen Seite im Verstehen überwunden werden kann.
Verstehen ist für Hannah Arendt »die andere Seite des Handelns, nämlich jene Form der Erkenntnis, durch welche.- die handelnden Menschen... das, was unwiderruflich passiert ist, schließlich begreifen können und sich mit dem, • was unvermeidlich existiert, versöhnen,« - (»Verstehen und Politik«, 5. 125 f.) Dass das eine offene Aufgabe für beide Konfliktparteien - -- in Palästina ist, davon legt Yfaat Weiss' Buch I Zeugnis ab. Für die palästinensische Seite: anzuerkennen, dass der Staat Israel unvermeidlich existiert. Für die israelische Seite: anzuerkennen, dass sie durch die Verwirklichung ihres eigenen nationalen Projekts auch die palästinensischen Araber unversehens zu einem Volk mit einem eigenen nationalen Projekt gemacht haben.
Herzlichen Dank meine Damen und Herren. Es ist mir eine große Ehre und ebenso eine große Freude an dem heutigen Abend hier In Bremen zu sein - Insbesondere angesichts der Tatsache, dass wir unsere Anwesenheit hier dem Vermächtnis zweier wahrhaft großer und origineller Figuren des 20. Jahrhunderts verdanken; Heinrich BÖlL und Hannah Arendt. Dieser Preis und der heutige Abend sind das Verdienst der Organisationen, die die wichtige Arbeit erbracht haben, die Werte und Botschaften dieser beiden Schriftsteller In diesem neuen Jahrhundert Lebendig zu halten. Heute Abend ehren wir eine dritte großartige und originelle PersönUchkeit, die israelische Historikerin Vfaat Weiss. Und ich kann mir keine bessere Beschreibung der Bedeutung ihrer Arbeit einfallen lassen als zu sagen, es ist die Destillation der Beobachtungsgabe Heinrich Bölls und der Zivilcourage und intellektuellen Bandbreite Hannah Arendis.
Und in der Tat; als ich zum ersten Mal das Vergnügen hatte, Dr. Weiss' eindrucksvolle und bewegende Arbeit Verdrängte Nachbarn zu lesen, erinnerte es mich an nichts weniger als Heinrich Bölls großes Meisterwerk Billard um hall, zehn. Nicht nur die Entschlossenheit beider Autoren, die vergrabenen Geheimnisse der Nachkriegsjahre freizulegen, sondern insbesondere die Erzählweise, die sie dafür wählten. Denken Sie nur an die elf Erzähler in Bölls Roman - keiner von ihnen absolut vertrauenswürdig, keiner, der die Meinungen der anderen teilt, viele von ihnen sich selbst täuschend, alle Jedoch überraschend und unterschiedlich. Keiner von Ihnen völlig gut oder völlig böse. Zusammen hinterlassen uns diese wetteifernden Stimmen ein lebhafteres und komptexeres Verständnis der schuldigen Geheimnisse der Nachkriegsjahre in diesem Land, als es je eine einzige, allwissende Stimme der Autorität vermocht hätte. Dies Ist genau das, was auch Vfaat Weiss in Verdrängte Nachbarn getan hat. Ihre Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle von Geographie und Geschichte, aber sie hat die Methode der Romanautorin gewählt, die sich auf einen bestimmten physischen Ort fokussiert, einen scheinbar uriauffälligen Ort, an dem sie auf die Macht seiner Stimmen und Charaktere trifft.
Ihr Ausgangspunkt ist ein Haufen Steine. Es sind die Ruinen eines Dorfas, seit Jahrzehnten verlassen, in der israelischen Hafenstadt Haifa.
Die meisten Israelis und Besucher Israels—tatsächlich die meisten Historiker -‚ die diese Narbe aus Schutt, die sich durch das Zentrum Haifas zieht, betrachten, tun sie ab mit einer einfachen Erzählung: »Verlassen von den Arabern«— »Von der Moderne verdrängt« - »Abgelöst durch den Fortschritt Israels«. Dr. Weiss indessen bietet uns die konkurrierenden Geschichten, die multiplen Zukunftsmöglichkeiten an, die In diesen Steinen enthalten sind. Wir hören von den verängstigten Ashkenazi-Juden, ausgespielt gegen die verarmten Mizrahi-Juden; von europäischen Werten kontra afrikanische Werte; von Veteranen kontra Flüchtlinge; von Arabern, die gezwungen waren zu fliehen, und solchen, die versuchten zu bleiben; von lokalen Organisationen wider staatliche Bürokratien; von sozialistischen Staatsplanern und kosmopolitischen Stadtplanern.
Und wir hören nicht nur die Geschichte der Vergangenheit, sondern auch die Geschichte, die sie »die vielfältigen Visionen einer möglichen Zukunft« nennt. Nur eine dieser Visionen, eine tragische Vision, wurde zur Realität. Viel mehr Wahrheit jedoch lässt sich aus den aufgegebenen und verstummten Visionen gewinnen. Dr. Weiss beschreibt ein Terrain, das Journalisten wie ich gewöhnlich in wenige einfache Kategorien übertragen: Den Nahen Osten. Israelis und Palästinenser. Juden und Araber. Zionisten und Islamisten. Siedler und Besetzer. Aber wenn wir ein ehrliches und wertvolles Verständnis des Nahen Ostens haben - und, so darf Ich wohl sagen, wenn wir in irgendeiner Weise darauf hoffen können, eine friedliche Versöhnung im Nahen Osten zu finden—, müssen wir von diesen einfachen Kategorien abrücken, Wie Dr. Weiss schreibt; »Es ist unmöglich, die Geschichte Wadi Salibs zu verstehen, ohne die üblichen Trennlinien aufzuschlüsseln.«
Sie hat »simplistlsche und unmissverständllche Kausalerklärungen«, wie sie sie nennt, vermieden. Sie hat die historische Vereinfachung und ideologische Hülle jener einfachen Kategorien entfernt und das darunterliegende, echte Haifa offengelegt, und damit auch die echte Geschichte des modernen Israels. Mit Hilfe der multiplen. konkurrierenden Stimmen erzählt sie die Geschichte Israels In einer Weise, wie kein einfaches Narrativ und keine Ideologische Erklärung es je könnte.
Dies ist der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken, und es ist mehr als passend, dass e5 sich bei Weiss' Buch uni ein Werk handelt, das von der Vision der menschlichen Widersprüchlichkeit durchwoben ist, die Hannah Arendts Karriere geprägt hat. Arendt war ein Flüchtling, und Ihre Forschung war die erste, die das Fluchtlingsprohlem als Zentrum der Probleme identifiziert hat, denen sich Nationen und menschliche Gesellschaften stellen müssen. Und die Geschichte, die Dr. Weiss uns erzählt, ist im Wesentlichen eine Geschichte, in der alle Charaktere flüchtlinge sind. Einige sind europäische Jüdische Flüchtlinge. kaum anders, als Arendt selbst, die der völkermörderischen Hölle Europas in das unbekannte Terrain Haifas entflohen, mit einer Mischung aus Angst, Entschlossenheit und Vergeltung— und von denen einige den Flüchtlingsstatus nutzen würden, um der sie umgebenden Welt eine soziale Hierarchie aufzuerlegen. Manche sind arabische Flüchtlinge, einige vertrieben aus ihren Häusern in Haifa zu den Siedlungen, die bis heute in den Nachrichten erscheinen. Andere sind Flüchtende aus den deutlich prekäreren Vierteln Haifas.
Und wieder andere sind marokkanische jüdische flüchtlinge. die zunächst ermutigt wurden, aus ihrem Heimatland zu fliehen und sich an hoffnungslosen Orten wie Wadi Salib niederzulassen, und dann von diesen Orten vertrieben wurden und gezwungen waren, in Sozialwohnungen oder anderen Städten Zuflucht zu suchen. Und es ist auch die Geschichte städtischer Flüchtlinge, die der auferlegten bäuerlichen Existenz des Kibbuz und den gesichtslosen vorstädtischen Wohnungsbauprojekten zu entkommen versuchten, für einen Griff nach dem urbanen Leben, egal in welchen Vierteln der Stadt sie es finden konnten.
Das Problem des Flüchtlings, wie Hannah Arendt bemerkt, ist, dass seine fundamentalen Menschenrechte von keiner Gemeinschaft garantiert werden - er gehört nicht dazu, Und dies ist die Chronik eines historischen Moments, als Rechte nicht anerkannt wurden. Die Vorstellung von Menschenrechten, so Arendt, »zerfiel zu Ruinen, sobald jene, die sich zu ihr bekannten, sich erstmals Menschen gegenübersahen, die wahrhaftig jegliche andere spezifische Eigenschaft und Verbindung verloren hatten außer der bloßen Tatsache, Menschen zu sein. Die Welt fand nichts Heiliges in der abstrakten Nacktheit des Menschseins ... Inder Tat wussten die Flüchtlinge, dass die abstrakte Nacktheit ihres Nichts-als-Menschseins ihre größte Gefahr war.«
Was Dr. Weiss hier konfrontiert, ist genau der Moment, als die fundmentale Notwendigkeit des Staates Israel mit der fundamentalen Notwendigkeit der Menschenrechte kollidierte. Und die Menschen und Organisationen, die sie aufzeichnet -die Stimmen, die sie aus jenem Haufen Steine zieht—, reagieren auf die Herausforderung in unterschiedlicher Weise. Manche sind heldenhaft und menschlich. Manche sind kalt und gnadenlos. Andere widmen sich blind abstrakten ideologischen oder Planungs-Konzepten. Viele versuchen einfach nur zu überleben.
Wie Hannah Arendt angesichts der Misere der an internationalen Grenzen gefangenen Flüchtlinge sagte: »Es war kein Problem des Raums sondern der politischen Organisation.« Was Dr. Weiss hier getan hat, ist, den Fokus von dem abstrakten Gebiet politischer Organisation wieder zurück in die Realität der Orte zu verlegen, an denen Menschen leben.
Ihre analytische Einheit ist die Nachbarschaft. Sie ist Teil einer sehr bedeutenden neuen Bewegung von Historikern und Geographen, die sich darüber bewusst werden, dass die roten Fäden in der Geschichte von Nationen gefunden werden können, indem sie die inneren Strukturen spezifischer städtischer Nachbarschaften untersuchen. Die Nachbarschaft ist—trotz allem, wo diese Konflikte sich physisch abspielen - der Preis, um den wir ringen.
Durch das Ausgraben der Masse an Dokumenten und Aufzeichnungen und Briefen und Artikeln und Interview-Stimmen, die eine spezifische, verloren gegangene Nachbarschaft einkreisen, liefert Dr. Weiss uns die Art bedeutungsvoller, polyphoner Geschichtsschreibung, die uns ein breiteres Verständnis ermöglicht, ohne einfache und ideologisch befriedigende Antworten zu geben.
»Würde man der schlichten Chronologie folgen, nämlich den Annalen Wadi Salibs von ihrem verheißungsvollen Anfang bis zum bitteren Ende, hätte dies die Erwartung einer direkten Beziehung von Ursache und Wirkung nach sich gezogen und eine automatische Parallelisierung zwischen Chronologie und Kausalität entstehen lassen.« Doch dieses Buch ist bei Weitem zu differenziert, um eine solche unvermeidliche Kausalität für sich zu beanspruchen. Sie fährt fort: »Wadi Salib hatte, wie auch die Stadt Haifa, eine glänzende Zukunft mit zahlreichen Visionen vor sich, die eine nach der anderen ad acta gelegt wurden, was jedoch nicht unvermeidbar hätte sein müssen.«
Ich denke, das ist eine sehr gute Zusammenzählung historischer Best Practice: Nicht die Linie aufzuspüren, der gefolgt wurde, sondern die Stimmen zu hören, die für einen anderen Ausgang argumentierten. Die Geschichte, die uns Dr. Weiss hier erzählt, ist eine Tragödie. Die Nachbarschaft ist verlorengegangen. Fehler werden begangen - politische Fehler, juristische Fehler, persönliche Fehler, kriminelle Fehler, bürokratische Fehler, planerische Fehler. Aber indem sie der ganzen Bandbreite der Stimmen zuhört, die aus dem Schutt auftauchen, lässt sie uns die Saat der Hoffnung angedeihen. Was wir aus der Art Geschichtsschreibung, deren Pionierin Yfaat Weis5 ist, lernen, ist, dass in jeder verlassenen Ruine zahlreiche bessere Zukunftsversionen enthalten sind. Und mehr als jede einfache Antwort, ist es das, was wir aus unserer Geschichte ziehen sollten. Es ist das große Verdienst von Vfaat Weiss, dass sie einen kraftvollen und glaubwürdigen Weg gefunden hat, dies zu tun.
Geschichte ist nicht vergänglich. Um eine bessere Zukunft aufbauen zu können, müssen wir unsere Schlüsse aus ihr ziehen. Aus diesem Grund sind wir heute hier zusammengekommen, um eine Frau zu ehren, die dieses Ziel konsequent verfolgt. - Ich fasse mich kurz, gehe aber dennoch kurz auf das bisherige Wirken der Preisträgerin ein. Frau Yfaat Weiss, geboren 1962 in Haifa, ist Professorin am Fachbereich für jüdische Geschichte und zeitgenössisches Judentum an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Sie leitete von 2008-2011 die dortige Fakultät für Geschichte und ist derzeit Direktorin des Franz Rosenzweig Minerva Forschungszentrums. Ihre Forschungsschwerpunkte lagen dort auf der Vergangenheit Deutschlands und Zentraleuropas. Am Lehrstuhl für Jüdische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München forschte sie zu den deutsch-israelisch-tschechischen Beziehungen. 2012 erschien die deutsche Fassung ihres Buches Verdrängte Nachbarn. Wadi Salib - Haifas enteignete Erinnerung. Frau Weiss hat in ihrer Arbeit stets auch die Vielschichtigkeit der geschichtlichen Ereignisse und ihrer Hintergründe im Blick gehabt. _____ Enteignete Erinnerung -welch personifizierte Beschreibung für einen gesellschaftlichen Konflikt eines Mädchens, das seiner Erinnerung beraubt wird. Als seine Erinnerungen gehören sie nicht mehr ihm, sondern sind der gesellschaftlichen Beurteilung ausgesetzt. In ihrem Buch erzählt sie von den aus dem bis dato intakten Wohnquartier »Haifa« vertriebenen arabischen Einwohnern. Nach den Kämpfen wurden europäische und marokkanische Flüchtlinge in deren verlassene Wohnungen einquartiert, woraus Diskriminierungen zwischen israelischen Juden und europäischen und arabischen Flüchtlingen entstanden. Sie thematisiert Interessenskonflikte zwischen der arabisch-palästinensischen, der jüdisch-mizrachischen und der jüdisch-aschkenasischen Bevölkerung. Yfaat Weiss machte ihr Leben lang diese und andere Erfahrungen Einzelner sichtbar. Sie erzählt die Geschichte vertriebener Menschen und derer, die zwar die gleiche Religion haben, aber unterschiedlicher Herkunft sind. Sie gab ihre Erinnerung denjenigen zurück, denen sie genommen wurde. Machte sich zum Sprachrohr der Menschen, die im Zuge des Israel-Palästina-Konflikts oft vergessen wurden. Wer glaubt, dass es dabei vordergründig um Vergangenheitsbewältigung geht, irrt. Die Frage, wie wir mit Menschen, die einer anderen Religion angehören oder anderer Herkunft sind, umgehen, ist hochaktuell. Inwieweit schenken wir ihnen und ihren Belangen Gehör? Das ist einer der Gründe, warum wir heute Yfaat Weiss mit dem Hannah-Arendt-Preis auszeichnen. Sie führt uns vor Augen, welche Vielschichtigkeit ethnische Konflikte haben können. Wie Menschen innerhalb einer Nachbarschaft, einer Gesellschaft, zwischen Staaten interagieren und welche Rolle sie ihn ihr einnehmen. Yfaat Weiss transportiert diese Fragen ins 21. Jahrhundert. Ihre Arbeit hilft uns, unser Handeln zu hinterfragen und uns unserer Verantwortung für ein funktionierendes Gemeinwohl zu stellen. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zum Preis und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude bei Ihrer Forschung und uns allen wünsche ich interessante, zukunftsweisende Erkenntnisse daraus.
Es ist das gute Recht und vielleicht sogar die Pflicht der Jury des HannahArendt-Preises, die Öffentlichkeit mit ihren Entscheidungen zu verblüffen und manchmal sogar zu irritieren. Doch diesmal kann ich die Wahl der Jury mit Herz und Verstand teilen, sogar aus vollem Herzen und ungeteiltem Verstand. Yfaat Weiss ist nicht nur eine kluge Intellektuelle. Sie ist in jeder Hinsicht ein feiner Mensch: in ihrer genauen Beobachtungsgabe, ihrer gedanklichen und emotionalen Empfindsamkeit, ihrer von keiner ideologischen Prädisposition korrumpierten Integrität als Historikerin und in der Genauigkeit ihrer Sprache. Zugleich zeichnet sie ein sanfter Mut aus -kein polemisches Geschrei, keine lautstarken Anklagen, sondern der Mut, sich auf vermintes Terrain zu begeben. Im Fußballerjargon würde man sagen, sie geht dorthin, wo es weh tut. Das gilt nicht nur für die Ausgrabungsarbeit, die sie mit ihrem Buch über die Geschichte von Wadi Salib geleistet hat. Auch ihre anderen Veröffentlichungen gehen ans Eingemachte: über Staatsbürgerschaft und Ethnizität, über Deutsche und Juden im Dritten Reich, über Postkolonialismus und Zionismus, um nur einige zu nennen. Die Einmischung in die öffentlichen Angelegenheiten unterscheidet einen Intellektuellen vom bloßen Gelehrten. Yfaat Weiss beteiligt sich am öffentlichen Diskurs nicht mit Aufrufen und Appellen. Man wird ihren Namen auf wenigen Unterschriftenlisten finden. Vielmehr haben ihre wissenschaftlichen Arbeiten selbst eine hoch politische Dimension, weil sie an wunde Punkte rühren, die bis heute nicht verheilt sind. Indem sie darauf beharrt, dass die geschichtliche Wahrheit nicht der politischen Opportunität geopfert werden darf, geht sie auch das Risiko des Beifalls von der falschen Seite ein. Aber sie zieht zugleich eine klare Trennlinie zwischen historischer Aufarbeitung und dem »bewussten oder unbewussten Versuch, die Legitimität des nationalstaatlichen Projekts Israel zu bestreiten«. Dieser Satz stammt aus einem Vortrag, den sie bereits vor Jahren auf einer Veranstaltung der Heinrich Böll Stiftung in Bremen gehalten hat. Wer ihn heute liest, könnte ihn für einen aktuellen Text halten. Yfaat spricht von deutsch-israelischen »Entfernungsprozessen« und dem Hang zur selbstgerechten Verurteilung Israels, der mit einer Verkennung seiner Handlungsbedingungen einhergeht. Ein Großteil der deutschen Öffentlichkeit hat keine wirkliche Vorstellung von der soziokulturellen und politischen Heterogenität Israels, die zu enormen inneren Spannungen führt. Daran gemessen ist das Land immer noch ein Wunder an demokratischer Vitalität. Auch mit dem Verständnis für Israels prekäre Sicherheitslage ist es bei uns nicht weit her. Viele glauben, dass allein die israelische Besatzungspolitik einer friedlichen Koexistenz zwischen Juden und Arabern im Wege steht. Dabei ist keineswegs ausgemacht, dass ein Rückzug aus der Westbank zur dauerhaften Anerkennung Israels durch seine Nachbarn führen wird. Nicht nur der Iran, Hizbollah und Hamas haben die Vernichtung des »zionistischen Krebsgeschwürs« auf ihre Fahnen geschrieben. Und niemand weiß genau, was die Umwälzungen in der arabischen Welt mittelfristig für Israels Sicherheit bedeuten werden. Wir verkennen gern, um noch einmal Yfaat Weiss zu zitieren, »dass es Feinde und nicht nur Feindbilder gibt«. Gerade in Deutschland huldigen viele einem unpolitischen »Pazifismus als scheinbar moralische Haltung, und zwar in Verkennung der historischen Zusammenhänge, die Deutschland den Frieden gesichert haben«. Dabei ist die Anmaßung moralischer Überlegenheit gegenüber Israel allzu offenkundig ein Akt der Schuldumkehr; eine »Projektion der eigenen Schuld auf die damaligen Opfer, die heute scheinbar zu Tätern geworden sind«. Ich plädiere keineswegs für Nichteinmischung in die israelische Politik. Und ich halte eine ZweiStaaten-Lösung immer noch für den besten Weg zu einer halbwegs friedlichen Koexistenz zwischen Israel und seinen Nachbarn. Der bald ein Jahrhundert währende jüdisch-arabische Konflikt kann nur durch die wechselseitige Anerkennung der Kontrahenten beendet werden. Wenn diese Option verspielt wird, droht ein bitterer, lang anhaltender Kampf um »ganz Palästina«. Dann geht es nicht mehr um die Grenzen von 1967, sondern um eine Neuauflage der Kämpfe von 1948, die Yfaat Weiss am Beispiel Haifas so eindringlich geschildert hat. Wir sollten uns jedoch im Klaren sein, dass politischer Druck auf Israel mit Verpflichtungen verbunden ist. Eine Zwei-Staaten-Lösung muss die politische Souveränität der Palästinenser und die Sicherheit Israels garantieren. Wenn wir das eine wollen, können wir uns vor dem anderen nicht drücken. Mit den Worten von Yfaat Weiss: »Sich an diesem Prozess zu beteiligen, heißt für unsere Sicherheit zu haften. Ob ein Deutscher das Ausmaß dieser Verantwortung begreift, bleibt an dieser Stelle unbeantwortet.« Weil das so ist, habe ich keine Veranlassung, die Bundeskanzlerin für ihr Wort zu rügen, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson ist. Das ergibt sich aus einer Vergangenheit, die nicht vergeht. Die fundamentale Verbundenheit mit Israel schließt Empathie für die bedrängte Lage der Palästinenser keineswegs aus. Auch das können wir von Yfaat Weiss lernen: Ohne Empathie für den anderen gibt es keinen Ausweg aus der Spirale von Gewalt und Gegengewalt. Das gilt allerdings für alle Seiten dieses Konflikts. Ich gratuliere Yfaat Weiss zu dieser Auszeichnung, beglückwünsche die Jury zu ihrer Entscheidung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Im Jahre 1965 schuf der israelische Künstler Michael Druks eine aufregende, ganz in Ocker- und roten Lehmtönen gehaltene Assemblage, die den Titel Ein MahnmalflirMonshiya trügt (siehe Titelseite). Es Ist eine dreidimensionale Collage aus Bauschutt und Überresten von Mobiliar, aufgelesen von Druks am Strand zwischen Tel Aviv und jaffa. in einem hülzemen Fensterrahmen arrangiert der Künstler Bruchstücke von Fußbodenfliesen, Sprungfedern aus Bettgestellen, Tür- oder Fensterscharniere und ein Stück Stuhl- oder Tischbein zu einer Komposition, die sich auf der gesamten Fläche des ursprünglichen Fensterrahmens drängt. Der Blick wird zudem versperrt durch die massive Betcinplatte, auf die die einzelnen Elemente der Assembiage aufgeklebt sind. Hängt es an der Wand, wie ein Fenster, ist das Kunstwerk zwar horizontal ausgerichtet, doch ist seine Perspektive eigentlich eine senkrechte, auf den Boden und die Überreste der Pflasterung gerichtet. Darunter offenbart sich eine Art archäologischer Grabung, die eine materielle arabische Kultur freilegt, wie sie in den geometrischen Verzierungen der Kachelbruchstücke erkennbar wird, in der abgerundeten Form des herausgerissenen Fensters und den Oberresten seiner kunstvollen Beschläge. Dieses Werk aus den Bruchstücken von Erinnerung, die den Dingen Innewohnt, beschreibt Vergängrils und Vergehen, ein Prozess, der durch Wasser, Salz und Sand, die an Eisen, Keramik und Holz nagen, beschleunigt wird.
Man könnte meinen, Druks habe in dem Fensterrahmen einlangen wollen, was der polnische Dichter Zbigniew Herbert einmal als »die Verwandlung von Leben in Altertumsforschung« bezeichnet hat. Druks Arbeit dokumentiert die Überreste von Manshlye, ein von wohlhabenden Arabern Ende des 19. Jahrhunderts außerhalb der Mauern von Jaffa errichtetes Viertel, das im Zuge der Kämpfe von 1948 aufgegeben und gleich nach Kriegsende durch mittellose jüdische Flüchtlinge und Immigranten in Besitz genommen worden war. Zu dem Zeitpunkt, als Druks seine Arbeit anfertigte, Mitte der Sechzigerjahre, war Manshlye gerade dabei, geräumt und abgerissen zu werden. Die Funde, die bei Freilegung der obersten archäologischen Schicht zutage treten, dokumentieren den rasanten Übergang von einem Habitat hin zu bloßem Bauschutt.
Mit genau diesem Übergang beschäftigt sich mein Schreiben und Forschen. Und so wie das in einem Fensterrahmen gefangene Manshlye einem »Jaffolschen Rahmen«, wie Druks seine Arbeit in Anspielung auf eine lokale pittoreske Romantik ironisch nennt - ihm als Gleichnis dient, so dient mir das Viertel Wadi Salib in Haifa als Ausgrabungsstätte, deren Funde Schicht um Schicht die historische Textur in ihrer Gesamtheit offen legen: die muslimische Phase, die kurze Präsenz von zugezogenen HoLocau5tüberlebenden und die Anwesenheit der letzten Bewohner, der jüdischen Emigranten aus den Armenvierteln - den Mellahs Marokkos. Oberflüssig zu erwähnen, dass - im Unterschied zur gängigen archäologischen Praxis - das Interesse dieser kontemporären Archäologie vor allem den feinen Schichten zwischen den kurzen Zeiträumen und raschen Übergängen von einer Phase zur nächsten gilt. Die Ausgrabungsarbeit indes wird durch die Kornprimiertheit der einzelnen Schichten verkompliziert, da sie auch eine Deutung und Dechlifrierung der Funde erschwert.
In der kontemporären Archäologie, die sich sowohl visueller als auch verbaler Mittel bedient, ist die Ausbreitung der Fundstücke mit einer Vergegenwärtigung vergleichbar. Ein Habitat, das sich sonst verborgen innerhalb der Mauern eines Hauses findet, liegt - nachdem die Mauern eingestürzt sind - entblößt und für alle Weltsichtbar da. Die Gegenstände sind - wie der palästinensische Autor Ghassan Kanafani seinen Helden Sald sagen lässt - »sein geheiligter. persönlichster Besitz, den nie jemand, wer immer es auch sei, kennenlernen oder berühren oder auch nur sehen dürfe«; so in der im Exil in Beirut verfassten Novelle »Rückkehr nach Haifa«, in der der Besuch eines Flüchtlings in seinem Haus fast zwanzig Jahre nach seiner Flucht oder Vertreibung beschrieben wird. Die Entblößung dieses »hinterlassenen Besitzes« —so die Bezeichnung durch die israelische Rechtsprechung — vergegenwärtigt die Existenz seines vormaligen Bewohners als die eines Abwesenden. Gleichzeitig zeugt der private und alltägliche Charakter der Fundstücke, von Hausrat und Einrichtungsgegenständen, wie sie das Leben eines Jeden Einzelnen von uns ausfüllen, von den persönlichen Vorlieben eines Menschen, der sich sein Zuhause schafft, gibt Neigungen und Geschmack preis, seine geheimen Wünsche und Erwartungen, und dient als Beleg dafür, dass - wie Alexander Demandt einmal schrieb - »alle geschichtliche Vergangenheit einmal menschliche Zukunft war«.
An dieser Tatsache ist auf den ersten Blick nichts Besonderes. Historiographie befasst sich stets mit der Spannung zwischen gegenläufigen Zeitachsen. Historiker betrachten ein Ereignis von einem späteren Zeitpunkt aus, von dessen Ende her - während die Objekte dieses historischen Prozesses diesen gelebt und von Anbeginn an teilhatten. Pointiert formuliert Demandt dies in seinem Buch Ungeschehene Geschichte, er schreibt: »Der Historiker sieht aus der jeweils gegebenen Situation zurück auf deren Vergangenheit. Diese erscheint als ein Fächer von Einbahnstraßen, die alle auf das zur Blickbasis gewählte Ereignis zulaufen, ..‚ Der Handelnde hingegen blickt aus der Lage. In der er sich befindet, in die Zukunft. Für ihn kehrt sich der Fächer um.«
D och diese bekannte teteologische Falle macht es vor allem jenen schwer, die über ein noch offenes historisches Kapitel schreiben, ein Kapitel, dessen Ende nicht abzusehen ist. Dies umso mehr, als es sich um einen noch virulenten, aktiven nationalen Konflikt handelt, der als historisches Ereignis von den an ihm Beteiligten beschrieben wird. Unter solchen Umständen werden Historiker und Handelnder de facto eins. Das historische Schreiben sieht sich dabei nicht nur mit dem Ausbleiben einer Perspektive konfrontiert, die es erlauben würde, für die Gegenseite Ernpathie zu empfinden, sondern mit dem Wissen, dass das Schreiben von Geschichte politische Implikationen besitzt. Sie kann zu Legitimationszwecken in einem Diskurs bemüht werden, über den der Historiker oder die Historikerin keine Kontrolle ausüben, und der in der Lage ist, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Uni mich ein wenig von der Lähmung freizumachen, die dem historischen Schreiben inmitten eines Konfliktes und angesichts einer ungewissen Zukunft innewohnt, habe ich einige Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Um die unterste Schicht freizulegen, die früheste und verborgenste Schicht von allen, habe ich die oberste, die jüngste und offensichtliche Schicht, beiseite geräumt und sie dabei vielleicht auch beschädigt. Denn die archäologische Grabung kehrt die Anordnung der Schichten um und bringt so den chronologischen Ablauf als kausale Erklärung ins Wanken. Zudem ermöglicht die Einbeziehung einer weiteren zeitlichen Dimension, des Konjunktiv II, der »Geschichte, die sich nicht ereignet hat, beziehungsweise der Geschichte, wie sie sich hätte ereignen können«, ein tieferes Verständnis der Gegenwart als etwas Kontingentes, Zufälliges.
Das frappierende Ergebnis dieses Zurllckdrehens der Geschichte gegen den Uhrzeigersinn der historischen Abfolge ist eine Vergegenwärtigung der ehemaligen Bewohner und deren symbolische Rückführung in ihr vormaliges Zuhause, indem ihre Habseligkeiten aus einem Haufen Schutt geborgen und als Habitat imaginiert werden. Doch wäre es irrig anzunehmen, dieses textuelle Vorgehen sei gleichbedeutend mit der politischen Forderung nach einem palästinensischen Recht auf Rückkehr. Die Frage der Legitimität einer solchen Forderung und deren Aussichten im Verhältnis und Vergleich zu anderen Forderungen auf Repatriierung in einem Jahrhundert ethnischer Homogenisierung und nationalerZusamnienfuhrung ist in anderen Kontexten von vielen berufenen Stimmen erörtert worden. Ich aber befasse mich nicht mit Rückkehr, sondern mit einer Rückgabe, nicht mit Restauration, sondern mit einer Restitution. Denn die symbolische Rückführung der ehemaligen Bewohner möchte inmitten und ungeachtet der Dynamik eines noch aktiven Konfliktes ein Gegengewicht ausüben zu der allgemein verbreiteten Neigung, in dem Flüchtling jemanden zu sehen, der sich aufgrund seiner Existenz außerhalb der kosmologischen Ordnung der Dinge befindet. Es war Hannah Arendt, die als eine der ersten in dem bekannten Kapitel »Aporien der Menschenrechte« in ihrem Buch Ursprange und Elemente totaler Herrschaft— ein Kapitel, das Dan Diner als jene Textteile des Werkes charakterisiert hat, »in denen die jüdische Erfahrung der politischen Heimatlosigkeit in eine Kritik der universellen Menschen- und Bürgerrechte übergeht«—, auf die für die Lage des Flüchtlings charakteristische Heimatlosigkeit hingewiesen hat, auf eine Identität, die zwischen dem Verlust der Heimat und dem politischen Status und eines Ausstoßens aus der Menschheit überhaupt entsteht. Gegen eine solche »Ausstoßung aus der Menschheit überhaupt« möchte die so vorgenommene virtuelle Repatriierung die palästinensischen Flüchtlinge in der Sphäre des israelischen Bewusstseins einbürgern.
Die virtuelle Einbürgerung des palästinensischen Flüchtlings soll zum Verständnis seiner Motive in Vergangenheit und Gegenwart beitragen -und dies mit dem Ziel, Empathie zu erzeugen, die vielleicht das ihre zu einer künftigen politischen Regelung wird beitragen können, Dieses Vorhaben ist eng verbunden mit bestehenden Tendenzen in der geschichtlichen Forschung, wie sie von israelischen und anderen Historikerinnen und Historikern in den letzten zwei Jahrzehnten betrieben wird, Einer solchen Historiographie geht es darum, die Zeituhr anzuhalten, um durch einen neuen und erneuerten Blick auf Entwicklungen, die der Tragödie vorausgingen, historische Alternativen zu erwägen, die — vielleicht — den Konflikt hätten verhindern oder zumindest seine Auswirkungen hätten mildern können. Der Beginn dieser »neuen« Historiographie fällt zusammen mit der optimistischen, ja beinahe euphorischen Atmosphäre einer Vorstellung vom »Ende des Konflikts«, wie sie mit den Verträgen von Oslo Einzug hielt, Ihr Währen über diese Zeit hinaus trotzt der nachfolgenden Enttäuschung und des mit ihr einhergehenden Pessimismus, Der Bankrott des Osloer Konstrukts, des - bislang— letzten Versuchs, eine Aufteilung des Landes herbeizuführen, begünstigte eine politische und historiographische Neigung, Modellen der Vergangenheit nachzugehen, die jenseits Von Territorialität angelegt sind - so etwa das Modell einer binationalen Lösung. Diese Vision war zum ersten Mal Mitte der Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts formuliert worden, von einigen Zionisten, die allermeisten von ihnen Intellektuelle aus Mitteleuropa, die, zum Teil am eigenen Leibe, die verheerenden Resultate der europäischen Minderheitenpolitik erfahren hatten, wie sie sich als Ergebnis des Ersten Weltkriegs ausgestaltet hatten. Ober direkte Kontakte zur arabischen Seite, basierend auf einem Plan zur Dezentrali5ierung von Kompetenzen und der Schaffung eines vielgliedrigen Regierungssystems, das das Gewicht der hereditären Identitäten abschwächen sollte und diese von der zentralen, paritätischen politischen Herrschaft weg- und in begrenzte Bereiche lokaler kultureller Autonomie Uberftihren sollte, hofften diese Intellektuellen, eine Alternative zu schaffen zur Errichtung eines jüdischen Nationalstaates in Palästina. Denn ein solcher Nationalstaat, so ihre Oberzeugung, sei untauglich, in dem die Nation sich den Staat zu Eigen gemacht hat, um mit Hannah Arendt zu sprechen. Erhebliche Zweifel allerdings bestehen, ob eine paritätische Lösung, wie sie die Mitglieder des »Brit Shalom«, viele von ihnen Mitbegründer der Hebräischen Universität in Jerusalem, Ende der Zwanzigerjahre den Arabern antragen wollten, bei diesen überhaupt auf Gegenliebe gestoßen wäre, zu einem Zeitpunkt, als die arabische Bevölkerung rund 90 Prozent aller Bewohner des unter britischer Mandatsherrschaft stehenden Palästinas ausmachten. Auch die jüdische Öffentlichkeit im Lande begegnete den Initiatoren dieses Vorstoßes mehrheitlich mit Unverständnis, vor allem aufgrund ihrer Bereitschaft, auf die zionistische Forderung nach einer freien, unbeschränkten jüdischen Zuwanderung zu verzichten. Doch wie auch immer, ihre Hoffnungen sollten untergehen in einer Welle der Gewalt, die das Land im Jahre 1929 erfasste und ausgerechnet in den gemischt arabisch-j üdischen Städten ihren Höhepunkt erreichte -mithin an jenen Orten, die das Zentrum der binationalen Vision ausmachen sollten und mehr als alles andere die erhoffte Alternative eines Lebens in friedlicher Eintracht symbolisierten.
F reiheit gibt es nur in dem eigentümlichen Zwischen-Bereich der Politik. Von dieser Freiheit retten wir uns in die Notwendigkeit4 der Geschichte«. schreibt Arendt im August 1950. Eine erneute Sichtung ihres publizistischen Schaffens mit Erscheinen der AufsatzsammlungJewish Writings offenbart, dass selbst sie - die »nicht-zionistische Zionistin« oder »Proto-Zionistin« - Mitte der Vierzigerjahre vermeiden wollte, was sich als historische Notwendigkeit abzeichnete, und den Gang der Ereignisse aufzuhalten gewillt war, das heißt die Errichtung eines jüdischen Nationalstaates in Palästina, Ein Plan, der zum damaligen Zeitpunkt wachsende Unterstützung in zionistischen Gremien verbuchen konnte und den Arendt, als ihrer Meinung nach irrige Lösung, nachdrücklich ablehnte. Es gibt, wie inzwischen überzeugend nachgewiesen wurde, viele, die fälschlicherweise annehmen oder aber weiterhin die irreführende Meinung vertreten, Arendt habe stets die binationale Option unterstützt. Doch dem ist nicht so. Nach ihrem Verständnis hätte eine Binationalität den Status der Juden als Minderheit gegenüber einer arabischen Bevölkerungsmehrheit auf immer festgeschrieben. De facto aber trat sie für eine föderative Idee ein, ein Ansatz, der in verschiedenen Zusammenhängen in den frühen Vierzigerjahren in Europa erörtert wurde. Sei es eine Ordnung im Rahmen des britischen Commonwealth oder aber innerhalb einer mediterranen Föderation. Arendt jedenfalls glaubte, eine föderative Lösung könne verhindern, was sich nach ihren Worten als »tragischer Konflikt« abzuzeichnen begann, da ein jüdischer Nationalstaat den Arabern keine andere Option ließe, »als zwischen freiwilliger Emigration und einer Existenz als Bürger zweiter Klasse zu wählen«.
Ungeachtet aller Nähe Arendts zu jenen mitteleuropäischen Gelehrten des »Brit Shalom« ist mehr Trennendes als Gemeinsames zu erkennen. So öffnet sich eine Kluft zwischen deren Suche Ende der Zwanzigerjahre nach einer Kompromissformel der Koexistenz zwischen den jüdischen Kolonisten und den arabischen Einheimischen einerseits und jenem Moment, Ende 1944, andererseits, als Arendt in ihrem breit rezipierten Aufsatz »Zionism Reconsidered« ihre Vorbehalte gegen einen jüdischen Nationalstaat formulierte, Ein entscheidendes historisches Ereignis liegt zwischen diesen beiden Zeitpunkten, ein Ereignis, ohne das es zweifelhaft erscheint, ob sich die Dinge so entwickelt hätten, wie sie sich entwickelt haben. Als entscheidend, so hat Max Weber vorgeschlagen, erweist sich ein historisches Ereignis, wenn »bei Ausschaltung desselben aus dem Komplex der als rriitbedingend in Betracht gezogenen Faktoren oder bei seiner Abänderung in einem bestimmten Sinne der Ablauf der Geschehnisse nach allgemeinen Erfahrungsregeln eine in den für unser Interesse entscheidenden Punkten irgendwie anders gestaltete Richtung hätte einschlagen können«,
Kaum jemand würde ernsthaft in Frage stellen, dass sich der Konflikt, und mit ihm das Schicksal der Palästinenser, in eine gärizlich andere Richtung entwickelt hätte, hätte es den Holocaust an den europäischen Juden nicht gegeben. Hannah Arendt hat zu Recht auf die Machtlosigkeit des Zionismus zur Rettung der luden Europas verwiesen und darauf, dass die Juden im Lande um ein Haar ebenfalls der Vernichtung hätten anheimfallen können, wäre der Vormarsch von Rommels Truppen im westlichen Ägypten nicht gestoppt worden. Diese Feststellung Arendts hat seinerzeit ihren Freund Gershomn Schotern sehr verärgert,, genauso wie sie bis auf den heutigen Tag bei nicht Wenigen Erregung hervorruft. Dennoch, eingedenk der Kluft, die sich zunehmend auftat zwischen Scholems Sorge um das Judentum und Hannah Arendts Sorge um die Juden, war und ist Arendts stichelnde Bemerkung nicht von der Hand zu weisen. Die Vernichtung der europäischen Juden hingegen veränderte sowohl die Zielsetzung des Zionismus grundlegend als auch die Chancen für eine Realisierung seiner Aspiration, in Palästina einen jüdischen Staat zu errichten. Während sich Arendts pessimistische Prognosen zum Schicksal der Palästinenser angesichts der zionistischen Bestrebungen im Nachhinein als präzise und zutreffend erweisen sollten, konnte sie zum damaligen Zeitpunkt noch nicht jene Entwicklungen voraussehen, die die Aussichten auf eine Ver- wirklichung der zionistischen Bestrebungen entscheidend verbessern sollten. In jenem, Ende 1944 verfassten Aufsatz »Zionism Reconsidered«, bezweifelt Arendt, ob die einhunderttausend jüdischen Flüchtlinge - so ihre Schätzung—, die sich nach dem Krieg in Europa finden würden und in einem langsamen Strom, der sich gut und gerne über zehn Jahre zu erstrecken versprach, nach Palästina würden emigrieren können, dies tatsächlich auch tun wollten. Angesichts der Möglichkeiten eines Verbleibs, einer Integration und Einbürgerung in Europa war Arendt davon überzeugt, dass diese Menschen es zumindest zu einem Teil vorziehen würden, auf dem alten Kontinent zu verbleiben und sich gegen eine Emigration entscheiden werden.
Diese Prognose des Jahres 1944 sollte sich schlicht als falsch erweisen, sowohl hinsichtlich der Zahl der Flüchtlinge und Überlebenden als auch in Bezug auf die hypothetischen Möglichkeiten, die sich ihnen im Westen eröffnen würden. Insbesondere jedoch sollte Arendt mit Blick auf die politische Realität, die sich in Mittel- und Osteuropa herauszubilden begann, falsch liegen, vor allem mit Blick auf jenen Prozess einer ethnischen Homogenisierung, den diese Staaten im sowjetischen Einflussbereich unter kommunistischer Ägide und als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs zu durchlaufen begannen. Der Zionismus hatte, selbstverständlich, nicht den Holocaust an den europäischen Juden verhindern können, doch die Vernichtung des europäischen Judentums, die Ethnifizierungen in Mittel- und Osteuropa, der Kalte Krieg und der Beginn der Dekolonisierung als Folge und Ergebnis des Zweiten Weltkriegs, nach dessen Ende, schufen eine internationale Konstellation, die die Errichtung des Staates Israel ermöglichen sollte. Die Zahl der jüdischen Überlebenden und Flüchtlinge war größer als Arendt angenommen hatte, deren Möglichkeiten, in den Westen zu emigrieren oder sich in den westeuropäischen Demokratien zu integrieren, jedoch weitaus eingeschränkter, während ihr Vermögen in den Volksrepubliken, die im sowjetischen Einflussbereich Osteuropas entstanden, eine ethnische und kulturelle jüdische Existenz zu bewahren, gleich Null war. Folgerichtig sollte sich die Bereitschaft dieser Menschen, angesichts fehlender Alternativen zu warten und hartnäckig an die Tore Palästinas zu pochen, größer erweisen, als Hannah Arendt angenommen hatte, während die internationale Legitimation, die sie zu wecken vermochten, letztendlich eindeutiger ausfiel als erwartet. So wurde die Heimat der palästinensischen Araber tragischer Weise zur Zufluchtsstätte der Holocaustüberlebenden, eine Lage, die Arendt in Ursprünge und Elemente totaler Herrschaft wie folgt resümiert: »Nach dem Krieg hat sich dann herausgestellt, dass man gerade die Judenfrage, die als die einzig unlösbare galt, lösen konnte, und zwar aufgrund eines inzwischen erst kolonisierten und dann eroberten Territoriums, dass aber damit weder die Minderheitenhi noch die Staatenlosenfrage gelöst sind, sondern dass im Gegenteil die Lösung der Judenfrage, wie nahezu alle Ereignisse unseres Jahrhunderts, auch nur zur Folge gehabt hat, dass eine neue Kategorie, die arabischen Flüchtlinge, die Zahl der Staaten- und Rechtlosen um weitere siebenhundert- bis achthunderttausend Menschen vermehrte.«
Wie genau aber vollzog sich ein derartiger Vorgang? In Haifa zum Beispiel wurden in den verlassenen Häusern der Araber rund 24000 der insgesamt etwa 190000 jüdischen Flüchtlinge und Emigranten angesiedelt, die in dem kurzen Zeitraum zwischen dem Abzug der Briten aus Palästina im Mai 1948 und dem März des darauffolgenden Jahres ins Land kamen. In seinem bekannten Standardwerk Die Geburt des palästinensischen Flüchtlingsproblems widmet Benny Morris dem eine kurze und lakonische Beschreibung, in der er zu der Feststellung kommt: »In Jaffa und Haifa befanden sich die größten - und auch modernsten - Konzentrationen an verlassenen arabischen Häusern, und daher war es nur natürlich, dass man die ersten Massen der Neueinwanderer in diese Städte kanalisierte.«
Morris nüchternes Diktum jedoch stellt eine Ausnahme dar, die nicht von der Regel kündet, das soll heißen der historiographischen Forschung in ihrer Gesamtheit, die es vorzog, sich nicht allzu intensiv mit dem Überlebenden zu beschäftigen, der im Haus des Flüchtlings wohnt. Die Tragödie blieb ein Betätigungsfeld der Literatur. So etwa bei Ghassan Kanafani, der sich 1969 im Exil in Beirut entschloss, in seiner Novelle '>Die Rückkehr nach Haifa« die Holocaustüberlebende Miriam Goshen im Haus der palästinensischen Flüchtlinge Said und Safiya wohnhaft werden zu lassen. Kanafanis Fähigkeit, den Konnex der Ereignisse zu erkennen, und der Wagemut seiner empathischen Geste, die er als Flüchtling gegenüber dem Schicksal des Feindes, der zugleich Überlebender des Holocausts ist, an den Tag legt, waren seiner Zeit weit voraus. Eine Lösung im politischen Sinne indes enthielt sie nicht. Alle Empathie vermochte die Frustration des Flüchtlings angesichts des Unvermögens, das eigene Haus, mithin die eigene Vergangenheit wiederzuerlangen, nicht zu beseitigen. Nachdem Kanafani seinen Helden Said auf die Reise geschickt hat, um sein ehemaliges Zuhause aufzusuchen, und ihm so ermöglicht, einen Blick auf eine Zukunft zu werfen, die sich für ihn nicht erfüllt hat, lässt er ihm am Ende der Novelle keinen anderen Ausweg, als beim Verlassen seines verlorenen Heims noch auf der Schwelle den jetzigen Bewohnern zuzuwerfen: »Ihr könnt vorläufig in unserem Haus bleiben. Das ist etwas, zu dessen Bereinigung es einen Krieg braucht.« Diese Prophezeiung Ende der Sechzigerjahre spiegelt glaubwürdig die damalige Zeit wider, eine Zeit des bewaffneten Kampfes, womit Kanafanis Novelle in zwei Sprachen verharrt: der literarisch-empathischen einerseits und der ideologisch-bellizistischen andererseits. Das Wissen darum, dass der Überlebende im Hause des Flüchtlings wohnt, scheint allerdings ein wenig abgestumpft zu sein, je mehr Zeit seitdem verstrichen ist. Denn diesem Wissen ist offenbar ein Schicksal bestimmt, das sich mit dem Paradoxon deckt, welches das Strandgut auf der von Druks geschaffenen Assemblage zum Ausdruck bringt: Gerade die festen, harten Materialien sind unter dem Einfluss von Wasser und Sand abgeschliffen und haben ihre scharfen Konturen verloren. Ja, mehr noch, der politische Stillstand und die durch die Fortdauer der Besatzung erfolgte Wandlung von etwas Akutem in Chronisches haben in gewissem Maße Erschöpfung und Überdruss hervorgebracht. Zudem haben sie das obsessive Beharren der jüdischen Seite, ihr Schicksal als Argument im Konflikt heranzuziehen, auf Dauer entkräftet.
In der Schichtung der kontemporären Archäologie stellen die Holocaustüberlebenden eine weitere Schicht dar, auch wenn ihr Verbleib in dem verlassenen palästinensischen Eigentum zumeist nur von kurzer Dauer war. Zu Beginn der Fünfzigerjahre und nachdem sie im Lande Fuß gefasst hatten, tauschten viele von ihnen die »hinterlassenen Besitztümer« gegen modernere und großzügiger geschnittene Wohnverhältnisse ein. Die von den Holocaustüberlebenden geräumten Häuser und Wohnungen wurden von der nächsten Welle von Einwanderern bezogen, vor allem von mittellosen jüdischen Emigranten, vormaligen Bewohnern der Mellahs, der Armenviertel Marokkos, die nach ihrer Einwanderung nach Israel den Weg in die großen Städte fanden und ihre in Marokko zurückgelassenen Behausungen gegen die der Palästinenser eintauschten. Ihre Emigration war ein verkehrtes Spiegelbild der Ereignisse des Jahres 1948 in Palästina, und es besteht kein Zweifel, dass die Ereignisse dort auf ihren Status und ihre Situation in Marokko abgestrahlt haben. Denn diese Entwicklungen in Palästina und Israel einerseits und in Marokko am Vorabend der Unabhängigkeit des Landes andererseits vollzogen sich als Teil eines Dekolonisierungsprozesses und waren, ähnlich den ethnischen Homogenisierungen in den mittel- und osteuropäischen Staaten einige Jahre zuvor, ein indirektes Resultat des Zweiten Weltkriegs. Dass die zionistische Bewegung mit Verspätung ihr Interesse auf die Juden in den islamischen Ländern richtete, resultierte aus den katastrophalen demographischen Auswirkungen, die der Zweite Weltkrieg gezeitigt hatte. Dabei war es der zionistischen Führung ein Leichtes, das religiöse Empfinden, das vielen der marokkanischen Juden gemein war, vom »Heiligen Land« auf den Staat Israel zu übertragen, insbesondere nachdem der Widerstand gegen den Zionismus in jenen Kreisen, die in der Vergangenheit noch assimilatorische Positionen unterstützt hatten, sukzessive schwand, vor allem vor dem Hintergrund der für sie folgenreichen Kollaboration des Vichy-Regimes mit Nazideutschland und der antijüdischen Gesetzgebung in Nordafrika.
Der Protest dieser jüdischen Einwanderer aus Marokko, der letzten Bewohner Wadi Salibs, und die schweren Unruhen, die im Sommer 1959 aufflammten, erzeugten in Israel zum ersten Mal ein politisches Bewusstsein für den tiefen Riss, der sich aufgetan hatte zwischen den aus Europa eingewanderten Emigranten — den »A.schkeriasim« nach landläufiger Sprachregelung— und den aus Afrika und Asien ins Land gekommenen Juden, den »Sephardirn«, wie sie in der Vergangenheit bezeichnet wurden, ehe sich die heute übliche Bezeichnung »Mirachim« - »Orientalen« - durchsetzte. Die materielle Notlage dieser mittellosen Immigranten wurde nun allmählich wahrgenommen, zu einem Zeitpunkt indes, da in den Jahren nach 1952 ein Teil der im Lande lebenden Holocaustüberlebenden mittels persönlicher Entschädigungszahlungen ganz allmählich die eigenen Lebensbedingungen hatte verbessern können. Doch während die so genannten Wiedergutmachungszahlungen die materielle Lage der Hotocaustüberlebenden verbesserten, vertieften sie gleichzeitig die materielle Kluft zwischen ihnen und den mittellosen Immigranten aus den arabischen Ländern. Zur materiellen Dimension gesellte sich die symbolische. Während die Entschädigungszahlungen den Überlebenden Anerkennung zollte, wurde der vergangenen Welt der marokkanischen Juden speziell und der der Einwanderer aus arabischen Ländern allgemein in Israel keinerlei Anerkennung zuteil.
Mancher ist heutzutage versucht, eine Inventarliste des Jüdischen Eigentums zu erstellen, das die Juden in den arabischen Staaten zurückgelassen haben, um dieses - als Geste gewissermaßen der retroaktiven Anerkennung der jüdischen Einwanderung aus den islamischen Ländern als Teil eines großen, orchestrierten Bevölkerungsaustausches -als künftige Berechn ungsbasi5 und Faustpfand gegen mögliche palästinensische Entschädigungsforderungen zu verwenden. Dieses Verfahren jedoch, das eine Negativverbindung zwischen den palästinensischen Flüchtlingen einerseits und den Emigranten aus den Ländern des Islam andererseits herstellt, ist unlauter. Denn aus zionistischer Perspektive waren die Menschen keine Flüchtlinge, sondern Einwanderer gewesen, die in ihre alt-neue Heimat zurückkehrten. Ani anderen Ende des politischen Spektrums in Israel finden sich jene, die im Sinne einer orientalistischen Deutung eine Verbindung zwischen den »Misrachim« und den palästinensischen Bürgern Israels herstellen wollen, eine Verbindung zweier Gruppen, die durch das zionistische, das aschkenasische Establishment gleichermaßen benachteiligt und unterdrückt würden. Doch neigt dieses Verständniswissentlich oder nicht - dazu, die Charakteristika des israelischen Projekts einer ethnischen Homogenisierung zu übersehen. Denn ungeachtet seiner osteuropäischen Wurzeln und der Tatsache, dass es sich parallel zu ähnlichen Entwicklungen in Osteuropa in den ersten Jahren nach 1945 vollzog, unterscheidet sich die israelische Variante von diesen maßgeblich darin, dass sie nationale Minderheiten nicht zu assimilieren gedachte. Der jüdische Nationalstaat hat weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart eine nationale Minderheit— konkret: die Palästinenser — jemals angehalten noch es ihnen ermöglicht, sich in die Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Eine tatsächlich existierende oder auch nur imaginierte kulturelle Beziehung zwischen Palästinensern und Misrachim kann die grundlegende Tatsache nicht aus der Welt schaffen, dass die Notlage der Palästinenser schon immer im politischen Bereich verortet war, während die der Misrachim eindeutig im sozialen Bereich festzumachen ist. In Bezug auf die Unterscheidung zwischen diesen beiden Bereichen gilt noch immer Hannah Arendts Diktum, zu finden in ihrem scharfen Artikel »Little Rock«, ein Artikel, der auf viel Unverständnis gestoßen war, obschon er völlig verständlich ist: »Diskriminierung ist ein ebenso unabdingbares gesellschaftliches Recht wie Gleichheit ein politisches ist.«
E s wäre naiv anzunehmen, der hier betriebenen kontemporären Archäologie könne es gelingen, dem Telos des Konfliktes entgegenzuwirken und mittels einer Geschichte, die sich nicht ereignet hat, die Historiographie zu einem politischen Gebrauchsinstrument zu machen. Eine Geschichtsschreibung, die entschärfen möchte, um Dinge zu verschärfen, will nicht instrumentalisiert werden und lässt sich nicht für einen akuten Zweck rekrutieren. Die Aussöhnung verschiedener Narrative durch den Historiker ist kein Ersatz für die Lösung von Konflikten durch die Politik, und mit einigem Fug und Recht lässt sich behaupten, dass die Annäherung historischer Narrative nur unter der Bedingung eines Endes des Konfliktes überhaupt möglich wird. Die beiden zurückliegenden Jahrzehnte waren bestimmt von Turbulenzen und Verwerfungen, dennoch herrschte die optimistische Grundannahme vor, über kurz oder lang werde sich der Konflikt als lösbar erweisen. Diese Annahme und Hoffnung haben mein Schreiben genährt, haben ihm zugleich bescheidene Ziele diktiert, so zum Beispiel sich darauf zu beschränken, Ernpathie hervorzurufen: das Mitempfinden der Juden in Israel für das Schicksal der palästinensischen Flüchtlinge zu steigern und gleichzeitig die Lage der Palästinenser, soweit sie Bürger des Staates sind, zu verbessern; die innerisraelisch-jüdische Empathie für die verlorene Welt der Hobcaustüberlebenden einerseits und der Einwanderer aus den muslimischen Ländern andererseits zu stärken; und vielleicht auch die Empathie des Betrachters und der Betrachterin von außen zu erzeugen, die des nicht enden wollenden Konfliktes nicht selten überdrüssig sind, weil sie angesichts der Dichte und der schnellen Abfolge der Ereignisse die tragischen Umstände vergessen haben, aufgrund derer sich der Überlebende eines Tages im Hause des Flüchtlings wiederfand.
Würde eine solche Hypothese fehlen, eine derartige optimistische Grundhaltung, etwa im Falle einer Veränderung des Telos und eines Schwindens der Aussöhnungsoption, erschiene es sehr zweifelhaft, welchen Nutzen die kontemporäre Archäologie und ihre feinen textuetlen Schritte hätte.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz