
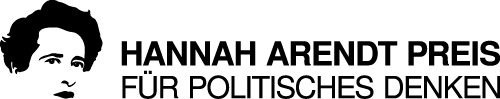

Timothy Snyder, Historiker an der Universität Yale
Bemerkenswerte Befunde
Im Namen des Senats der Freien Hansestadt Bremen begrüße ich Sie herzlich hier in der oberen Rathaushalle. Es ist dem Senat eine Ehre, den Hannah-Arendt-Preis alljährlich gemeinsam mit der Heinrich Böll Stiftung zu verleihen. Dies ist ein Preis für politisches Denken; es erhalten ihn also Denkerinnen und Denker, deren Denken politische Wirkungen hat – und die, soweit sie Wissenschaftler sind, den abgeschirmten Bereich reiner Wissenschaft bewusst verlassen, um sich mit ihren Thesen der politischen Debatte in einer breiteren Öffentlichkeit zu stellen.
Je unabhängiger jemand dabei vorgeht und je weniger er oder sie gerade auch die »sensiblen« Themen scheut, die politisch und emotional besonders aufgeladen sind, desto mehr braucht es dafür Mut. Mut im Hinblick auf die dann unvermeidlichen Kontroversen, Missverständnisse, Etikettierungen, ja Anfeindungen. Es braucht Vertrauen in die Kraft der eigenen Argumente und ein Vertrauen in den öffentlichen Diskurs, in dem sich diese Argumente zur Geltung bringen lassen.
Das Kulturgut der öffentlichen Debatte zu fördern, ist in meinen Augen ein ganz wichtiges Ziel dieses Preises: den Raum zu eröffnen und zu erweitern, in dem Argumente engagiert und ernsthaft ausgetauscht werden, um so den gesellschaftlichen Erkenntnisstand und vielleicht sogar die Gesellschaft insgesamt voranzubringen. Dieser Raum bedarf einer sorgsamen und kontinuierlichen Pflege, da in unseren heutigen Medien zumindest die großen Schlagzeilen und die Hauptsendezeiten meist nicht den am besten fundierten Aussagen gehören, sondern eher den schnellsten und den schrillsten.
Hannah Arendt als Patronin dieses Preises brauchte solchen Mut und solches Zutrauen in hohem Maße. Ihr Diktum in Bezug auf Adolf Eichmann von der Banalität des Bösen hat zu bitteren Auseinandersetzungen geführt, es hat sie Freundschaften gekostet und ihr Feindschaften eingetragen. Der Vorwurf an sie lautete, sie habe Täter und Taten des Naziterrors verharmlost und damit auch die Ehre der Opfer beschädigt. Diese Kontroverse dauert fort bis heute: weiterhin wird die These vertreten, Arendt sei auf Eichmanns Prozessstrategie hereingefallen.
Aber, meine Damen und Herren, ist das der entscheidende Punkt? Ist nicht ganz unabhängig davon Arendts Ansatz ein entscheidender Schritt dazu gewesen, das Unfassbare des Holocaust etwas besser zu verstehen? Und kommt es nicht gerade beim Unfassbaren darauf an, so viel davon zu verstehen wie nur irgend möglich? Gerade dort, wo es um monströse Themen geht, gilt es, mit offenen Augen hinzusehen und sich selbst und anderen die Ergebnisse dieser Betrachtung zuzumuten.
Auch Timothy Snyder beschäftigt sich mit dem Ungeheuren. Und auch er wagt dabei eine neue Perspektive. In Bloodlands untersucht er das geografisch definierte Gebiet, in dem sich vor dem und während des Zweiten Weltkriegs die massenhafte und systematische Ermordung von Menschen konzentriert hat. Ein solcher Ansatz handelt vom Holocaust, aber eben nicht nur von diesem. Er stellt Zusammenhänge dar. Er zeigt, wie zwei ganz unterschiedliche, auf ihre jeweilige Art mörderische Systeme sich wechselseitig befördert, ja ergänzt haben. Timothy Snyder tut das nicht im Dienste einer möglichst provokanten und pauschalen These, sondern präzise und differenziert auf der Grundlage sorgfältiger und aufwändiger Forschungsarbeit. So hat er nahezu alle Sprachen gelernt, die er braucht, um im Untersuchungsgebiet die Originalquellen nutzen zu können.
Meine Damen und Herren, eine fachliche Würdigung ist hier nicht meine Aufgabe und steht mir als Naturwissenschaftler auch nicht zu. Aber auch ein fachfremder Mensch wie ich kann erkennen, dass die Arbeit von Timothy Snyder darauf angelegt ist, neue Perspektiven zu eröffnen und unser Wissen zu erweitern. Unser Verständnis angesichts der größten Untaten des 20. Jahrhunderts – ein Thema, mit dem wir gerade hier in Deutschland nicht fertig werden können und sollen: Wer während des Kalten Krieges in Westdeutschland aufgewachsen ist, für den umfassen die schwerwiegendsten Verbrechen der Nationalsozialisten die Deportationen der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und weiterer Gruppen Verfolgter, die Ausbeutung und die vieltausendfachen Ermordungen in den Konzentrationslagern und Gaskammern, und die Niederschlagung des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Es ist beklemmend und schockierend, wenn wir heute lernen müssen, dass eine sogar noch sehr viel größere Anzahl von Menschen in den Ländern des mittleren Osteuropa durch absichtlich geplantes Aushungern und bei systematischen Erschießungen umgebracht worden sind.
Im Geographieunterricht erfuhr man hierzulande wenig bis gar nichts über diese Länder – allenfalls dieses, dass die ferne Ukraine seit jeher als die »Kornkammer Europas« galt. Umso mehr muss es bestürzen und uns mit Scham erfüllen, dass ausgerechnet in der Ukraine zehntausende Stadtbewohner, aber noch sehr viel mehr Bauern verhungert sind, weil ihnen systematisch ihre Nahrungsgrundlage geraubt wurde.
Snyders Arbeiten bringen uns ein Land wie die Ukraine zeitlich und räumlich sehr viel näher: Wir erahnen, welches unermessliche Leid unsere Vorfahren über das Land gebracht haben, und wir gewinnen angesichts der aktuellen Nachrichten noch tieferen Respekt davor, mit welcher Leiden schaft und Energie die Menschen die düstere Vergangenheit ihres Landes überwinden und in Freiheit und Demokratie leben wollen.
Snyders Buch verhilft uns zu tieferem Wissen über den Nationalsozialismus, über den Stalinismus, und über die Zusammenhänge zwischen beiden. Wer es als – unzulässige – Relativierung der Verbrechen des Nationalsozialismus ansieht, solche Zusammenhänge zu untersuchen, begeht einen Irrtum. Einen Irrtum, der die Gefahr birgt, neue wesentliche Einsichten zu blockieren. »Wir glauben die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Hitler und Stalin zu kennen«, sagt Snyder, »dabei kratzen wir bislang doch nur an der Oberfläche.« Das ist – nach über 60 Jahren – ein bemerkenswerter Befund. Mit großem Forschungseifer versucht Timothy Snyder daran etwas zu ändern. Damit hat er lebhafte Debatten ausgelöst, die sich nicht auf Fachkreise beschränken.
Ich freue mich über die Entscheidung der Jury, diese Arbeit zu würdigen. Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Snyder, spreche ich meinen herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Hannah-Arendt-Preises 2013 aus. Wir freuen uns, Sie heute hier bei uns zu haben. Vielen Dank.
Neues Licht auf die europäische Geschichte
Der Bremer Hannah-Arendt-Preis wird für Neuansätze im politischen Denken verliehen. Die Jury fand, dass Sie, Herr Snyder, mit Ihrem Buch Bloodlands. Europa zwischen Hitler und Stalin einen solchen Neuansatz vermittelt haben. Sie verweisen auf ein einmaliges Phänomen, nämlich darauf, wie in einem kurzen Zeitraum von etwa fünfzehn Jahren ganze Bevölkerungsteile, etwa zwanzig Millionen Menschen, durch Hunger, Massenerschießungen und Vergasung in Ostmitteleuropa, das heißt in dem Raum zwischen dem heutigen Rußland und dem Deutschland in den Grenzen von 1939, ermordet wurden. Sie fragen sich, was der Grund hierfür ist. Der massenhafte Mord durch Hungertod war eine sowjetische Erfindung. Die Hauptopfer bildeten Ukrainer. Die Bolschewiki verfügten über die entsprechenden Machtmittel, die betroffenen Menschen von allen Nahrungsquellen abzuschneiden. Die Nationalsozialisten mit Hitler an der Spitze planten Ähnliches, um die Gebiete mit Deutschen zu besiedeln, waren dagegen nicht in der Lage, in das örtliche soziale Netz einzugreifen, um alle verborgenen Nahrungsreserven aufzudecken. Es lag in ihrer Logik, die für sie überflüssigen und sogenannten »rassisch wertlosen« Menschen, also vor allem Juden und Slawen, auf gewaltsame Weise zu töten. Die ersten Opfer waren die sowjetischen Kriegsgefangenen, die nicht als solche angesehen und behandelt wurden, sowie die Juden in ostpolnischen Gebieten, die zum großen Teil erst 1939/1940 in die Sowjetunion einverleibt worden waren. Das einzige Kriegsziel, das Hitler verwirklichen konnte, war, wie Sie mehrmals unterstreichen, die Vernichtung der Juden, von denen die meisten im ehemaligen Polen ihr eigenes Judentum lebten und sich nicht assimiliert hatten.
Im gleichen Raum wüteten auch die Sowjets während der Besatzung zwischen 1939 und den Nachkriegsjahren, indem sie, wo sie nur konnten, bis hin in den Kaukasus, Hunderttausende in den Osten deportierten, sage und schreibe ethnische Säuberungen durchführten. Nach Kriegsende gingen die von Moskau neu eingesetzten kommunistischen Machthaber in den realsozialistischen Staaten ähnlich vor. Bereits 1940/41 führten die Sowjets Massendeportationen aus Ostpolen, Weißrussland und dem Baltikum durch – ganz zu schweigen von den Morden in Katyn und Umgebung. Weder bei den sowjetischen Massendeportationen noch bei denen ihrer Satellitenstaaten nach 1945 hat es sich, wie oft behauptet, um eine Reaktion auf die deutsche Vernichtungspolitik gehandelt: Es waren vielmehr genuin sowjetische Handlungen, die freilich Unterschiede zu der deutschen Politik aufwiesen. Zu Recht erklären Sie zugleich, daß man, wenn man nicht bereit ist, strukturelle Ähnlichkeiten zwischen dem NS- und dem Sowjetsystem anzuerkennen, auch deren Unterschiede nicht verstehen kann. All diese verbrecherischen Handlungen, einschließlich der durch Stalin initiierten antisemitischen Kampagne in der Nachkriegszeit, erklären Sie, auch das zeichnet Ihr Buch aus, nicht als irrationale Handlungen, sie sehen darin vielmehr eine rationale, interessengeleitete Strategie. Die Jury war sich einig, dass Ihr Buch mehr ist als eine geschichtswissenschaftliche Untersuchung; es ist vielmehr durch die Art, wie Sie die grausigen Geschehnisse erzählen und erklären, auch eminent politisch und vor allem wirft es ein neues Licht auf die osteuropäische und damit auf die europäische Geschichte insgesamt.
»Bloodlands« – ein energischer neuer Anstoß zum Nachdenken
Meine heutige Laudatio gilt einem Buch, auf das ich, wie ich gestehe, zunächst mit einer gewissen emotionalen, aber auch intellektuellen Abwehr reagiert habe – vor allem seines Titels wegen: »Bloodlands« (man hat Gott sei Dank nicht versucht, das ins Deutsche zu übersetzen). Diese anfänglichen Vorbehalte hatte ich trotz einer gewissen positiven Voreingenommenheit gegenüber dem Autor, der mir neben anderen, kürzeren Texten vor allem durch seine Rolle als Gesprächspartner des todkranken Tony Judt bekannt war, mit dem er eine letzte große Tour d’Horizon unternommen und uns überliefert hat: Thinking the Twentieth Century – auf Deutsch erschienen unter dem Titel Nachdenken über das 20. Jahrhundert, pointierter vielleicht: »Das 20. Jahrhundert denken«.
Judt schrieb in seinem Nachwort, datiert auf den 5. Juli 2010, einen Monat vor seinem Tod, der zwanzig Jahre jüngere, aus dem tiefen Ohio stammende Tim Snyder habe für ihn etwas verkörpert, auf das er seit 1989 gewartet habe: nämlich dass eine neue Generation amerikanischer Wissenschaftler sich wieder mit der Geschichte der östlichen Hälfte Europas beschäftige und damit den Stab eines Erbes aufnehme, das bis dahin fast ausschließlich von einer Generation älterer Emigranten vertreten worden war, die entweder vor Hitler, vor Stalin oder beiden geflüchtet waren; und, so ließe sich ergänzen, die auch die Arbeit jener ersten Nachkriegsgeneration fortsetzen würde, die (wie Judt selbst) über eine familiär tradierte oder (wie ich und etliche meiner Kollegen) auf dem Umweg über eine um das Jahr 1968 herum eröffnete linke Biographie auf diese Fragen und Themen gestoßen sind.
Das Motiv Snyders, Jahrgang 1969, der heute in Yale lehrt und in Wien forscht, sich ganz in diese mittelosteuropäische Welt, ihre Geschichte und Gegenwart zu vertiefen, dürfte neben Anderem, vielleicht Persönlichem, wohl wesentlich mit dem zu tun haben, was der Titel des gemeinsamen Buches sagte: »Das 20. Jahrhundert denken«. Mit dieser Aufgabe sind wir in der Tat noch lange nicht fertig. Und ein Schlüssel zu dieser Geschichte liegt jedenfalls dort, wo diese »Bloodlands« – oder wie immer wir diese historische Landschaft bezeichnen wollen – sich erstreckt haben.
Warum dann meine anfänglichen Widerstände gegen dieses Buch? Ich schicke voraus, dass sie durch die Lektüre nicht nur entkräftet, sondern im Gegenteil produktiv aufgelöst worden sind – sonst würde ich hier und heute keine Laudatio auf dieses Buch und seinen Autor halten. Aber es ist gerade deshalb vielleicht ganz gut, wenn ich die Gründe meiner Vorbehalte nenne – zumal dieses Buch ja gerade auch hierzulande von etlichen Kollegen unseres Fachs mit triftigen und mit weniger triftigen Argumenten kritisiert und beargwöhnt worden ist; was natürlich bei einem Hannah-ArendtPreisträger gewissermaßen seine Richtigkeit hat. Denn welches Buch der Philosophin wäre nicht umstritten gewesen und beargwöhnt worden?
Also: Der Titel »Bloodlands« schien zu suggerieren, dass in diesem historischen Gelände alles vergossene Blut und alle großen Verbrechen wie in einem einzigen, blutigen Knäuel zusammen- und ineinandergeflossen seien. Und das sind sie ja auch in mancher Hinsicht. Aber liegt die intellektuelle Aufgabe nicht gerade in der Distinktion? Historisch-genetische Verknüpfungen oder systemische Vergleiche von Nationalsozialismus und Stalinismus waren und sind unbedingt legitim und notwendig, wenn sie dazu dienen, die jeweiligen Spezifika, also die ganz eigenen historischen Charaktere, Bedingungen, Perspektiven der einen wie der anderen totalitären Machtformation dieses Zeitalters schärfer herauszuarbeiten. Im Übrigen, so der Akzent meiner eigenen Betrachtungen zu diesem Thema, handelte es sich weniger um die Geschichte zweier abstrakter Ismen oder Ideologie- und Gesellschaftssysteme; sondern im Kern ging es auch nach der Gründung einer Union Sozialistischer Sowjetrepubliken und eines nationalsozialistischen Dritten Reichs immer noch um die Geschichte zweier, ihrer sozialgeschichtlichen Statur und geopolitischen Lage nach vollkommen unterschiedlichen und gerade deshalb eng und ambivalent aufeinander bezogener Länder und Staatswesen, Deutschlands und Russlands. Nationalsozialismus und Bolschewismus waren nicht nur in ihrem ideologischpolitischen und sozial-ökonomischen Aufriss nicht zu verwechseln; sie waren historisch auch nicht gegeneinander austauschbar, sondern blieben in fast jeder Hinsicht an ihre deutsche und russische Ausgangsbasis gebunden.
Gleichwohl zwingt Timothy Snyders Untersuchung auch verstärkt wieder zu dem Umgekehrten: zur Anerkennung von tatsächlichen Parallelitäten, gegenseitigen Entlehnungen sowie einer zwar sehr unterschiedlich gefärbten und formulierten, aber in manchen Aspekten eben doch auch ähnlichen Logik ihres Denkens oder Ratio ihres Handelns. Dass das keine schlichte Rückkehr zu einer Totalitarismus-Theorie älteren Stils bedeutet, auch nicht in der unendlich gedankenreichen und nuancierten Form, in der Hannah Arendt sie seinerzeit entwickelt hat – in einer Zeit eben, in der erst ein bruchstückhaftes tatsächliches Wissen verfügbar war – dazu gleich noch ein Wort.
Mein tieferer Vorbehalt gegen die Anlage des Buches, das ich hier laudatiere, resultierte aus der Frage oder aus dem Bedenken, ob man sich dem Medusenblick einer reinen Gewaltgeschichte nicht endlich entziehen müsse, statt sich ihm immer von Neuem auszusetzen. Gerade das Prädikat der »Singularität« der Naziverbrechen hat nicht wenige Forscher und Publizisten in aller Welt angestachelt, es auch auf andere Massenverbrechen zu übertragen, fast wie ein Qualitätssiegel in einem Wettbewerb der Bestialitäten. Immer häufiger findet sich dann zum Beispiel in Geschichten des Stalinismus die Formel vom »roten Holocaust«; oder das von Stéphane Courtois herausgegebene Schwarzbuch des Kommunismus versuchte in einer fatalen Logik der Überbietung »dem Kommunismus« (im Singular) global 100 Millionen Tote zuzuweisen – auf die die Nazis und Faschisten aller Länder es angeblich niemals gebracht hätten.
Alle Ansprüche an eine differenzierte Gesellschaftsgeschichte oder eine strukturierte Globalgeschichte verschwinden dann leicht in allgemeinen und fast selbstreferenziellen Formeln wie zum Beispiel – um noch einmal Courtois zu zitieren – der einer »kriminogenen Ideologie«, in diesem Falle des Marxismus-Leninismus, die »wie ein genetischer Code« in das Denken der Kommunisten aller Länder eingebaut gewesen sei und die Quelle aller ihrer Massenverbrechen gebildet habe. Das war wiederum eine mimetische Replik auf Daniel Jonah Goldhagens Formel vom »gleichsam mit der Muttermilch« in Sprache und Denken eingedrungenen Antisemitismus der Deutschen, der ihren Massenmord an den Juden erklären sollte. Dagegen sollte der exkulpierenden Formel Ernst Noltes zufolge der bolschewistische Terror erst den nationalsozialistischen, antisemitischen Radikalfaschismus als eine Form der reaktiven »Gegenvernichtung« hervorgetrieben haben. Alle diese »Debatten«, die umso hitziger geführt werden, je einseitiger die Ausgangsthese ist, sind ihrer Natur nach uferlos. Und wer sich einen Rest historischen Denkens bewahrt hat, ist ihrer zutiefst überdrüssig.
Zugleich entfalten Gewaltgeschichten ihre eigenen Faszinationen. Lassen wir die Frage beiseite, ob, wenn jeder beliebige Fernsehabend und jedes adoleszente Videospiel in einem Massaker endet, dieser habituelle Konsum inszenierter Gewaltdarstellungen nur eine ungeheure Abstumpfung und Banalisierung produziert, oder ob er nicht doch dazu einlädt, die Grenze von Inszenierung und Realität zu überschreiten. Da, wo es wirklich ernst wird, heilig ernst sogar, gilt jedenfalls, dass die gesellschaftliche Erinnerung an wirklich geschehene, große historische Mordtaten oder auch die unmittelbare Dokumentation von Bluttaten im Hier und Heute keineswegs per se immunisierend oder abschreckend wirkt, sondern im Gegenteil eine düstere, sogar übermächtige Anziehungskraft entfalten kann – und zugleich wie ein Vakuum posthume Sinnstiftungen anzieht. In diesem Sinne hatte ich mir in meinem Buch Utopie der Säuberung von 1998 gleich eingangs den bekannten Satz Nietzsches als Warnung vor Augen gestellt, der (ganz feststellend) heißt: »Wenn du lange in einen Abgrund hineinschaust, blickt der Abgrund auch in dich hinein.«
Es gehört zu den großen Vorzügen von Snyders Buch, dass er in keiner Weise mit dem Grauen spielt; dass er sich deshalb auch nur so weit auf die Position einer (in Wirklichkeit gar nicht möglichen) »Identifizierung mit den Opfern« begibt, als er ihnen eine Stimme verleiht, dort wo überhaupt noch eine Stimme zu hören ist; dass er es letztlich aber für »moralisch dringlicher« hält, zunächst »die Handlungen der Täter zu verstehen«, weil es ohne sie die Taten nicht gegeben hätte; und dass er diese Täter, einer Maxime Arendts folgend, nicht schlichtweg als Unmenschen von sich tut, sondern als Menschen versteht – was ungleich schwieriger ist. Und immer hat er auch die posthumen Nachwirkungen dieser großen Mordaktionen im Auge, so wenn es an einer Stelle heißt: »Man erinnert sich an die Toten, aber die Toten erinnern sich nicht ... Später entscheidet immer jemand anderes, wofür sie starben.« Gerade deshalb, so in einer starken Formulierung seines Buches, »besteht das Risiko, dass mehr Mord zu mehr Bedeutung führt«.
Dem Risiko, dass mehr Mord mehr Bedeutung produziert, hat Snyder sich gestellt, indem er dieses Dilemma gleichsam bei den Hörnern gepackt hat. Das soll heißen: Er hat aus dem ganzen, ungeheuren Gewaltgeschehen dieser Weltkriegsepoche mit größtmöglicher begrifflicher Sorgfalt diejenigen Ereignisse herausisoliert, die gerade keine Akte des Krieges oder Ergebnisse eines Bürgerkriegs waren, sondern gezielte, organisierte und gewollte Menschenvernichtungsaktionen – die sich genau in dieser und keiner anderen Region der Welt in einer solchen Weise konzentriert und dabei vielfach überlagert haben. Das meint sein Begriff der »Bloodlands«. Diese gezielten, gewollten und organisierten Menschenvernichtungsaktionen stellten in der Zusammenschau ein nach Art und Umfang bis dahin präzedenzloses und vielfach miteinander und ineinander verflochtenes historisches Geschehen dar, das, so Snyders Argument oder These, auch als ein solches betrachtet werden muss und einer gesonderten Interpretation bedarf.
In Kategorien der jüngeren deutschen Geschichtsdebatten gesprochen wäre das eine Singularitätsthese eigener Ordnung – die sich aber gerade nicht auf ein einzelnes, für sich stehendes Gewaltgeschehen gründet, das sich etwa zusammenfassend mit der Metapher »Auschwitz« umschreiben ließe. Snyder bestreitet gerade, dass sich der »Holocaust«, geschweige die deutsche Kolonial-, Vernichtungs- und Kriegspolitik im Osten insgesamt, mit dieser Metapher historisch angemessen umschreiben lässt. Vielleicht würde er die »Singularität« dieser Vernichtungspolitik (die natürlich ein problematischer Begriff ist) überhaupt bestreiten. Jedenfalls handelte es sich in seiner Version um eine Kette eskalierender Massenmorde, die nur aus einem Prozess sowohl interner wie gegenseitiger Radikalisierungen und dynamischer Interaktionen zweier totalitärer Machtkomplexe verstehbar sind – wobei Snyder, wenn ich es richtig sehe, auch den Begriff des Totalitarismus eher meidet, vor allem wegen seiner theoretischen Vorbelastung. Europas Epoche des Massenmords, schreibt er an einer Stelle, sei »übertheoretisiert«, und dabei gleichzeitig in ihren Grundzügen und ihren bestimmenden Faktoren noch immer eher missverstanden.
Das Element der »Übertheoretisierung« dürfte auch Hannah Arendt gelten – obschon ja gerade sie bereits mit erstaunlicher Intuition erkannt hatte, dass die sowjetische Hungerkatastrophe 1932/33 am Beginn der Kollektivierung ein entscheidender Türöffner war; wie sie es freilich verstand: als ein erster Schritt in eine neue Zeit der radikalen Atomisierung der Gesellschaft und der Auslieferung an eine allmächtige, eben totalitäre Staats- und Parteimacht. Snyders Darstellung beginnt ebenfalls mit dieser Hungerkatastrophe, die sich aber, wie er (der beneidenswerter Weise auch des Ukrainischen mächtig ist) auf Basis aller heute verfügbaren Informationen überzeugend nachweist, in einem noch ungleich härteren Licht darstellt als Arendt hätte wissen können: nämlich als erster Akt einer Politik der sozialen wie ethnischen Säuberung und Vernichtung durch das bewusste Wegnehmen aller Lebensmittel.
Für die nationalsozialistischen Ostraumpläne, die auf einer ziemlich genauen Kenntnis, fast müsste man sagen: einer wissenschaftlichen Vorausdurchdringung, der Sowjetunion Stalins beruhten, wurde diese Politik einer planmäßigen Aushungerung und Vernichtung durch Arbeit sogar zum ersten Mittel der Wahl, um die Massen designierter Untermenschen auszudünnen und Platz für die »Siedlungsperlen« (wie Himmler sagte) der neuen Herrenmenschen zu schaffen. Auch wenn diese Ostraum-Pläne, die den Tod von 30 Millionen überflüssigen Essern vorsahen, nicht aufgingen: in der Statistik jener 14 Millionen Menschen, die zwischen 1933 und 1945, Snyder zufolge, jenseits aller Kriegshandlungen von den beiden totalitären Hauptmächten auf mehr oder weniger systematische Weise ermordet worden sind, rangierte der Tod durch Aushungerung an erster Stelle – vor allen Erschießungen und vor den Vergasungen.
Eines der ersten und konzentriertesten Einzelverbrechen dieser Art war im ersten Jahr des Barbarossafeldzugs das jeder Vorstellung sich entziehende Massensterben von Hunderttausenden auf nackter Erde verhungernden, verdurstenden, in ihrem Kot krepierenden gefangenen Rotarmisten. Auch dabei handelte es sich, so Snyder, näher betrachtet um das »Resultat einer Interaktion beider Systeme«. Solche Interaktionen hatte es eben nicht nur in der Zeit des Hitler-Stalin-Pakts von 1939-41 gegeben, wo sie sich vor allem in der parallelen Ermordung und Deportation der polnischen Eliten (Offizieren, Beamte, Professoren) auf beiden Seiten der neuen Grenze, der Ribbentrop-Molotow-Linie, materialisierten. Sondern indem die in Gefangenschaft geratenen Soldaten der sowjetischen Armee von der »Heimat«, das heißt von Stalin als Feiglinge, wenn nicht als Verräter stigmatisiert und aufgegeben wurden, waren sie zur Vernichtung freigegeben. (Ob die Nazis solcher Signale bedurften, steht auf einem anderen Blatt.)
Die Massentötung der sowjetischen Kriegsgefangenen ist nicht das einzige Beispiel für das, was Snyder, scheinbar paradox, als »Komplizenschaft im Krieg« bezeichnet: So arbeitete Stalin in vieler Hinsicht Hitlers Eroberungsund Versklavungskrieg vor, bereitete ihm das Terrain (besonders in den 1939/40 annektierten Gebieten) und trieb ihm Verbündete und Kollaborateure zu – während Hitlers Rassen-, Versklavungs- und Vernichtungskrieg Stalin fast zwangsläufig in die Rolle des Bannerträgers eines Großen Vaterländischen Krieges, und damit eines Retters und Siegers erhob. Und am Ende war es dann Stalin, der – ich zitiere wieder – »Hitlers Krieg gewann«.
Eine der Kritiken an diesem Buch war, dass Snyder in der Konstruktion der »Bloodlands« das Gesamtpanorama des Weltkriegs, eben als eines Weltkriegs, zu weitgehend ausgeblendet habe. Man könnte sich zum Beispiel fragen, ob nicht die japanische Okkupation in der Mandschurei (ab 1932), in China (ab 1937) und in ganz Ostasien (ab 1941/42) mit ihren systematischen Menschenvernichtungen eigenen Stils nicht ein ganz direktes, für ein europäisches Publikum allerdings ferner liegendes Parallelgeschehen zu all dem gewesen ist, was Snyder für die »Bloodlands« im östlichen Europa beschreibt. Tatsächlich gehört die Einbeziehung des »japanischen Faktors« aber zu den interessantesten Perspektiverweiterungen seiner Darstellung: so beispielsweise die notorischeObsession Stalins mit einer drohenden Subversion durch eine polnischjapanische Geheimverbindung (die als solche nicht einmal völlig aus der Luft gegriffen war), und insgesamt seine ebenso kaltblütige wie letztlich erfolgreiche Politik gegenüber dem absolut kriegs- und expansionsbesessenen Japan, dem er mit einer Mischung aus Beschwichtigung und Entschlossenheit gegenübertrat – aber das er jederzeit auf der Rechnung hatte.
Snyder verliert die Gesamtkonstellation, und gerade den Konnex zwischen dem europäisch-atlantischen und ostasiatisch-pazifischen Weltkriegstheater, zu keinem Zeitpunkt aus den Augen. Und diese Konstellation enthielt ja tatsächlich beunruhigende Alternativen und Optionen, gerade was Japan betraf, die den Lauf der Weltgeschichte entscheidend hätten verändern können: wenn Stalin zum Beispiel den japanischen Einladungen 1940/41 zu einem »Viererpakt« oder 1942/43 zu einem Separatfrieden mit HitlerDeutschland nachgegeben hätte, um sich gemeinsam gegen die britischamerikanische Welthegemonie zu wenden; oder wenn umgekehrt Japan sich am Krieg Hitlers gegen die Sowjetunion beteiligt hätte, statt mit Pearl Harbour im Dezember 1941 einen eigenen pazifischen Offensivkrieg gegen die USA zu eröffnen. Nur die sibirischen Truppen der sowjetischen Armee haben das halb schon evakuierte Moskau im Winter 1941 gerettet ...
Das alles ist mehr als virtuelle Geschichte. Manche dieser schicksalhaften Entscheidungen könnten am sprichwörtlichen seidenen Faden gehangen haben. Auch in dieser Hinsicht verdeckt das ex post konstruierte Narrativ vom »Antifaschistischen Krieg« die Tatsache, dass die Bündnisse, Konstellationen und Entscheidungen dieses Weltkriegs ideologisch, politisch und militärisch weniger eindeutig determiniert waren, wie sie im Nachhinein erschienen.
Die Grundoperation Snyders ist freilich eine bewusste Eingrenzung seiner Untersuchung nach dem Raum (im Kern Polen, das Baltikum, Weißrussland und die Ukraine), nach der Zeit (1933 bis 1945) sowie nach dem Charakter der Geschehnisse (gewollten Massenmorden jenseits der eigentlichen Kriegshandlungen). Das erscheint zunächst wieder in vielerlei Hinsichten fragwürdig. Geht es denn nicht eher um eine Zeitperiode von 1930 bis 1953? Warum steht die Aushungerung der Ukraine, aber nicht die gleichzeitige, proportional noch gravierendere Hungerkatastrophe in Kasachstan im Blickpunkt? Warum geht es um Polen, das Baltikum, Weißrussland und die Ukraine, aber nicht um Rumänien oder Ungarn?
Als anfangs skeptischer, dann zunehmend überzeugter Leser und nun Laudator seines Buches kann ich nur sagen, dass gerade die viel kritisierte Eingrenzung der Untersuchungsperspektive eine Fokussierung ermöglicht hat, die wie ein Scheinwerferkegel oder wie ein gerichteter Röntgenstrahl Eigenschaften des historischen Materials, der Verbindungen, Verflechtungen, Verstrickungen der historischen Akteure und der Logiken ihrer direkten oder indirekten Interaktionen sichtbar macht, die wir sonst weniger klar vor Augen hätten. Gerade die Eingrenzung und Fokussierung schafft eine solche Dichte dieser vielseitigen Bezüge und Verflechtungen, dass das Gesamtgeschehen sich – jedenfalls im historisch-analytischen Rückblick – nicht mehr in national bornierte Einzelgeschichten auflösen lässt. Insoweit erzwingt die thematische Konzentration eher eine Öffnung und Erweiterung, nicht eine Schließung der Perspektive.
Snyders Forschungsschwerpunkt am Wiener Institut vom Menschen heißt ja: »Vereintes Europa – geteilte Geschichte«; und entsprechend wird unser morgiges Kolloquium »Europas gespaltene Erinnerungen« überschrieben sein. Daher ist dieses Buch auch und vor allem eine gezielte Intervention in Diskussionen und Forschungen, die bis heute, ein Vierteljahrhundert nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Kollaps des sowjetischen Lagers, in ganz erstaunlichem Maße noch oder wieder, bewusst oder unbewusst, von autozentrierten Geschichtsbildern und von den nationalen Geschichtspolitiken der jeweiligen betroffenen oder beteiligten Länder geprägt werden. »Nur eine Geschichte der Massenmorde kann die Zahlen und die Erinnerungen verknüpfen«, schreibt Snyder an einer Stelle. »Ohne Geschichte wird Erinnerung privat, und das heißt heute national, und die Zahlen werden ... ein Werkzeug im internationalen Wettbewerb um den Märtyrerstatus.«
Was dieses Letztere, den Wettbewerb um den Märtyrerstatus, angeht, können wir als Deutsche scheinbar schlecht mitkonkurrieren – sieht man einmal vom harten Rest der Vertriebenenverbände und von einem kleinen, aber virulenten rechtsnationalen oder direkt neonazistischen »lunatic fringe« ab. Allerdings sind auch wir aufgeklärten, postheroischen Deutschen, die zur Anerkennung der von Deutschen oder im deutschen Namen begangenen Massenverbrechen vorbehaltlos bereit sind, gegen eine autozentrierte, national bornierte, selektiv verengte oder verzerrte Wahrnehmung der eigenen Geschichte keineswegs gefeit – und zwar gerade dort, wo man sich gegenüber den einstigen Objekten dieser Aggressionen und Vernichtungsaktionen, den in ihre endlosen Leidensgeschichten und heroischen Martyrien verstrickten östlichen Nachbarn, also den autochthonen Bewohnern dieser »Bloodlands«, in Sachen »Vergangenheitsbewältigung« und Bereitschaft zur Selbstkritik recht überlegen und ziemlich vorbildhaft dünkt.
Das Buch von Timothy Snyder enthält da einiges an Irritationen und Zumutungen, die auch uns scheinbar so selbstkritischen, postnationalen und postheroischen Deutschen durchaus zusetzen können. Sind wir zum Beispiel bereit, solche in Zahlen gefassten Tatsachen in unser Geschichtsbild zu integrieren, wie beispielsweise die, dass bei der Bombardierung Warschaus im September 1939 ebenso viele Polen gestorben sind wie Deutsche bei der Bombardierung Dresdens im Februar 1945? Oder: dass der Warschauer Aufstand 1944 mehr polnische Opfer gefordert hat als die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki? Wenn Polen, womöglich ja polnische Nationalisten, auf solchen Zahlenvergleichen beharrten, würden wir das überlegenerweise unter ihrem Streben nach der Opferkrone verbuchen (und abhaken). Aber was ist mit uns selbst?
Sehen wir einmal ab von den trüben Gründerjahren der westdeutschen Bundesrepublik mit ihren gespaltenen Biographien, ihren doppelten Buchführungen und ihren Raubkunstverließen, die nicht nur in Münchner Privatwohnungen, sondern in den Archivkellern unserer Museen liegen. Sehen wir auch ab von den Irrungen und Wirrungen in meiner Generation, die in einem langen »roten Jahrzehnt« aus ihrer überlegenen Haltung einer »Felix Culpa« (auch das übrigens ein luzider Eintrag von Hannah Arendt ins Stammbuch der jungen intellektuellen Avantgarden der Bundesrepublik) ein hypertrophes Maß an moralischer Selbstermächtigung und Selbsterhöhung bezogen hat, während sie das Skandalon der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik eher in eine praktisch-ideologische Universalformel vom »Faschismus« verpackt hat, den man am besten durch entschiedenen Antikapitalismus zu bekämpfen hatte. Sehen wir schließlich ab von den wie ein Schluckauf wiederkehrenden Skandalen, die sich seit den 1980er-Jahren, als das Skandalon des »Holocaust« auf keine Weise mehr zu verleugnen war, fast alljährlich an intellektuellen Fehlleistungen oder Provokationen entzündet haben – von der »Fassbinder-Affäre« über den »Historikerstreit« bis zu Martin Walsers »vor Kühnheit zitternden« Friedenspreisrede gegen die »Auschwitzkeule«; um nur einige der abrufbaren Kürzel zu nennen. Diese sich wiederholenden Debatten ließen sich mit Peter Sloterdijk als »Rituale der Labilität« beschreiben, in denen die bundesdeutsche Gesellschaft durch alle Erregungen hindurch »das stärkste Wir-Gefühl erreicht« hat.
Viel ernster könnte man allerdings nehmen, dass selbst ein so wichtiges aufklärerisches Unternehmen wie die Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht den nationalsozialistischen »Vernichtungskrieg« erst im Jahr 1941 beginnen ließ und Polen konsequent ausblendete. Und wie konnte es dazu kommen, dass die Ausstellungsmacher sich so leicht durch Bilder täuschen ließen, die ihrer Meinung nach Verbrechen der Wehrmacht dokumentierten, tatsächlich aber (gar nicht so schwierig erkennbar) Opfer von Massenexekutionen der abziehenden NKWD-Truppen zeigten?
Eine Antwort auf diese Frage scheint mir darin zu liegen, dass in der deutschen Wahrnehmung der »Russlandfeldzug« eben die zentrale und generationenübergreifende Chiffre für diesen Eroberungs- und Vernichtungskrieg im Osten war und ist. Dabei zeigt Snyder, dass die »Bloodlands« außer in Polen vor allem im Baltikum, in Weißrussland und in der Ukraine, am wenigsten in Russland selbst lagen. Gerade über die von der deutschen Wehrmacht überrannten, von den SS-Einsatzgruppen »gesäuberten« Westgebiete der Sowjetunion war bis 1941 schon ein Jahrzehnt lang der Hobel eines stalinistischen Terrorismus und sozialen Exterminismus gegangen. Der stalinistischen Politik eines »Großen Vaterländischen Kriegs« entsprach es dagegen, die Russen zum ersten Staatsvolk der UdSSR zu erheben. Dieses stalinistische Narrativ war mit einer besonderen Hervorhebung der Leiden der Nichtrussen, und insbesondere auch des Massenmords an den Juden, nicht vereinbar; im Gegenteil, es beruhte essentiell auf ihrer Verleugnung oder Einebnung und jedenfalls einem aktiven, aggressiven Beschweigen.
Dabei hatte eben gerade hier, in den »Bloodlands«, die weithin mit dem alten jüdischen Ansiedlungsgebiet zusammenfielen, also in den östlichen Gebieten und Städten Vorkriegspolens und den westlichen Gebieten der Sowjetunion, der systematische, große Judenmord begonnen, und zwar in Form von Massenerschießungen, die nicht nur das früheste, sondern quantitativ bedeutendste Kapitel im Mord der osteuropäischen Juden gewesen sind. Den deutschen Soldaten konnte das im ersten Jahr des »Russlandfeldzugs« gar nicht verborgen bleiben, und vielfach auch nicht ihren Familien daheim. Ist das möglicherweise einer der Gründe dafür, warum »Auschwitz« in solch formelhafter Weise zur Chiffre des Holocaust und der nationalsozialistischen Massenverbrechen überhaupt geworden ist – für das es sich, wie Snyder zeigt, nicht wirklich eignet. In Auschwitz, das seit 1940 ein Haft- und Arbeitslager für Polen, Russen und andere war, und dem relativ spät erst auch ein Vernichtungslager angeschlossen wurde, konnten selbst jüdische Häftlinge überleben. In den eigentlichen Todesfabriken, in Sobibor, Belzec, Treblinka konnte niemand überleben; hier gab es gar kein Lager und so gut wie keine Überlebenden, also auch keine Zeugnisse und keine Bilder. Wir aber – und das verbindet uns mit der dominanten westlichen Öffentlichkeit – sind an diese Bilder und Berichte, an dieses gerade noch Vorstellbare gebunden, und haben das Grauen in rituelle Formeln und Erzählungen (vorzugsweise vom wundersamen Überleben) verpackt, die das Geschehene noch irgendwie kommensurabel machen.
Ich breche hier ab. Das alles sind nur einige winzige Fragmente eines ungeheuren Bildes, dessen Konturen, genaue Zahlen, Abläufe und Details sich in vielen unseren etablierten oder längst standardisierten Vorstellungen nicht fügen. Entnehmen Sie also meinem Lektürebericht nur so viel: dass dieses Buch auch für mich, der ich auf diesem Feld kein völliger Laie bin, vieles zurechtgerückt und neue Blickschneisen, Querverbindungen, Gedankenlinien eröffnet hat. Es ist schließlich ein Material, das man, wie Snyder demonstriert, immer wieder wird durcharbeiten müssen: mit größtmöglicher Genauigkeit, was die Daten, die Fakten, die Umstände betrifft; mit einigem kombinatorischen Scharfsinn, was die Motive der politisch Entscheidenden und exekutiv Handelnden betrifft; vor allem aber mit einer unbedingten Unvoreingenommenheit gegenüber den Opfern jeder Kategorie, die alle einmal einen Namen, ein Gesicht, eine Stimme und eine individuelle Biographie gehabt haben.
Ja, der Abgrund schaut in dich hinein, wenn du in ihn hineinschaust. Anders ist ein Nachdenken über das 20. Jahrhundert wohl nicht zu haben. Timothy Snyder hat zu diesem Nachdenken einen energischen neuen Anstoß gegeben, getragen von einem hartnäckigen, nach vielen Seiten offenen Engagement. Etwas Besseres kann man über jemanden, der mit dem Hannah-Arendt-Preis ausgezeichnet wird, vermutlich nicht sagen.
Das Bild ist größer, als man denkt
Eine Antwort auf manche Kritiken an »Bloodlands«
Im Frühjahr 1933, als die Temperaturen stiegen und der Boden weicher wurde, grub ein Ukrainer sein eigenes Grab. Er wusste, dass er sehr wahrscheinlich sterben würde. Zu diesem Zeitpunkt waren schon mehrere Millionen Bewohner der ukrainischen Sowjetrepublik Stalins Hungerpolitik zum Opfer gefallen. Doch das wahre Motiv, warum er sein Grab schaufelte, war das Verlangen nach Würde. Wer Anfang 1933 in der Ukraine verhungerte, dessen Leichnam wurde auf einem Feld oder an einer Straße gefunden. Dann warf man ihn in einen der Karren, die fast jede Woche kamen, um Leichen aufzusammeln. Er kam mit vielen anderen in ein Massengrab an einem Ort, den die eigene Familie – falls sie überlebte – niemals finden würde. Also grub der Mann sein eigenes Grab, das dann eines Tages tatsächlich gefunden wurde.
Im April 1940 schrieb ein polnischer Offizier Tagebuch, wie viele andere polnische Offiziere auch. Die meisten von ihnen waren Reserveoffiziere, und polnische Reserveoffiziere waren Akademiker. Wer studiert hatte, wurde zur Reserve eingezogen. Und weil es ein Zeitalter des Schreibens war, führten gebildete Leute ein Tagebuch wie dieser Offizier. Der vorletzte Eintrag lautete: »Sie wollten meinen Ehering, den ich …« Hier brach der Satz ab. Der Offizier war an einem Ort namens Katyn und vermutete wahrscheinlich, dass man ihn bald hinrichten würde. Er wusste auch, dass die sowjetischen NKWD-Beamten, die ihn bewachten, seine Wertsachen fordern würden, bevor sie ihn umbrachten. Darum endet die Eintragung mit Punkten, weil er seinen Ehering so verstecken wollte, dass sie ihn nicht finden würden, aber vermutlich fanden sie ihn doch. Sein Tagebuch wurde wenige Jahre später mit ihm exhumiert, darum besitzen wir es.
Im September 1942 war die Stadt Kowel ein Teil des besetzten Ostpolen, heute gehört sie zur Westukraine. Die letzten verbliebenen Juden waren in der Synagoge eingesperrt. Der Krieg und der Holocaust waren schon so weit fortgeschritten, dass sie genau wussten, was ihnen bevorstand. Sie wussten, dass man sie herausholen und erschießen würde. Der Holocaust begann mit Erschießungen, und die Hälfte der Opfer starb auf diese Weise. Die eingeschlossenen Juden von Kowel ritzten mit Scherben, Steinen oder Ähnlichem Botschaften in die Wände der Synagoge. Eine junge Frau, die mit zweien von ihren Schwestern dort war, schrieb auf diese Weise an ihre Mutter: »Es tut uns so leid, dass du nicht bei uns bist.« Das mag uns unter diesen Umständen seltsam erscheinen, aber es sagt etwas Fundamentales über den Holocaust aus. Die Menschen wollten bei ihren Familien sein, darum verließen so wenige das Ghetto. Das ist einer der Gründe, warum es so wenig Widerstand gab. Die Botschaft endet mit dem Satz: »Wir küssen Dich viele Male.« Als die Rote Armee 1944 die Deutschen aus Kowel vertrieb, fand ein sowjetischer Offizier diese Worte und schrieb sie auf. Dann wurde die Synagoge von den Sowjets mit Getreide gefüllt und als Silo benutzt.
1. Die »Bloodlands«
Solche Ereignisse, die für mein Buch »Bloodlands« zentral sind, sind schwer zu verstehen, denn es handelt sich nur um drei von 14 Millionen Menschen, die zwischen 1933 und 1945 vorsätzlich getötet wurden, als Hitler und Stalin die Länder zwischen Berlin und Moskau beherrschten. Es sind drei von 14 Millionen Geschichten.
14 Millionen ist schließlich eine sehr große Zahl. Und sie ist noch bemerkenswerter, wenn man diese »Bloodlands« mit allen Orten vergleicht, die Hitler und Stalin beherrschten. Ich meine mit den »Bloodlands« also das Gebiet, in dem die 14 Millionen ermordet wurden. Es umfasst das heutige Polen, die Ukraine, Weißrussland, die baltischen Staaten und Westrussland. Das ist ein umfangreiches Gebiet, aber im Vergleich mit dem gesamten Territorium, das Deutsche und Sowjets 1940 oder 1941 oder 1942 beherrschten, ist es eher klein. Trotzdem fand die Mehrheit der deutschen und sowjetischen Morde hier statt.
Betrachten wir die ganze Ausdehnung der Sowjetunion und des Dritten Reichs auf dem Gipfel seiner Macht. Wir sehen ein Gebiet von Frankreich bis Sibirien, und auf diesem Gebiet werden etwa 17 Millionen Menschen ermordet. Von diesen 17 Millionen sterben aber 14 Millionen in den »Bloodlands«. Was bedeutet das? Selbst wenn uns die Opfer nicht interessieren, was sie aber sollten, und wir nur die Regime verstehen wollen, müssen wir diesen Raum verstehen.
Erstens ist 14 Millionen eine schier unfassbare Zahl. Zweitens fand hier der gesamte Holocaust statt − die meisten Juden lebten vor ihrer Ermordung hier, weil dieses Gebiet damals die Weltheimat der Juden war. Drittens waren die »Bloodlands« der Raum, wo deutsche und sowjetische Macht sich überschnitten, wo Deutsche ebenso wie Sowjets präsent waren. Wenn man an das von Deutschland besetzte Europa denkt, gab es viele Orte und Länder, in denen das NS-Regime herrschte und die Sowjets nicht, Deutschland, Frankreich, die Niederlande und so weiter. Andererseits kamen 90 Prozent des sowjetischen Territoriums nie unter deutsche Herrschaft. Orte, die nur von deutscher oder sowjetischer Macht berührt wurden, waren sehr gefährlich, aber nicht annähernd so gefährlich für Juden und alle anderen wie die Orte, an denen beide Staaten präsent waren.
Wir stehen also vor drei Fragen, die wir miteinander verbinden müssen: Warum geschah der Holocaust? Warum wurden so viele nichtjüdische Menschen an Orten getötet, wo der Holocaust stattfand, während Hitler und Stalin an der Macht waren? Und warum fanden diese Morde in einem Gebiet statt, das von deutscher wie von sowjetischer Macht berührt wurde? Von diesen Fragen geht mein Buch aus.
2. Probleme der Nationalgeschichte und des Links-rechts-Schemas
Alles bisher Gesagte bezieht sich auf Chronologie, Geografie und Arithmetik. Doch warum haben diese Aspekte in der Geschichtsschreibung bisher eine so untergeordnete Rolle gespielt? Mir erscheint es als wichtige Frage, warum auf dem Gebiet, wo fünfeinhalb Millionen Juden im Holocaust ermordet wurden, in denselben Jahren der NS-Herrschaft auch acht Millionen Nichtjuden ermordet wurden − selbst dann, wenn man sich nur für den Holocaust interessiert und nicht für die anderen Opfer. Es hat immer sehr viel Mühe gekostet, diese Opfer zu übersehen: die fünf Millionen Opfer deutscher Hungerpolitik und sogenannter Vergeltungsmaßnahmen und die vier Millionen Opfer sowjetischer Hungerpolitik und Terrormaßnahmen. Dies muss im Namen der Vernunft und der historischen Erklärung geändert werden und nicht zuletzt im Namen des Respekts für alle Betroffenen.
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Polizist und werden zu einem Tatort gerufen. Sie kommen zu einem Mietshaus. Fünf Menschen, die offensichtlich alle zu einer Familie gehören, sind ermordet worden. Fünf andere Menschen gehören nicht zu dieser Familie, wurden aber anscheinend von derselben Person ermordet. Und dann sind da noch vier Menschen, die nicht zu dieser Familie gehören und offenbar von jemand anderem ermordet wurden, aber im selben Gebäude zur selben Zeit. Wenn Sie Ihren Bericht schreiben, werden Sie vermutlich alle Morde erwähnen. Sie werden vielleicht denken, das ist sehr verwirrend, aber es muss eine Verbindung zwischen all den Morden geben – und von dieser Annahme gehe ich aus, den Arbeiten so mancher deutscher Historiker folgend.
Natürlich gibt es gute Gründe, warum wir dem Tatort bisher nicht in gebührender Weise Aufmerksamkeit geschenkt haben. Das größte Problem scheint mir zu sein, dass wir Geschichte national verstehen. Wir verstehen Geschichte als Geschichte der Juden oder der Polen, der Ukrainer oder der Russen oder der Deutschen. Wir benutzen die Sprache unserer Gruppe, als enthielte sie alle Lehren über unsere Taten und unser Schicksal. Das Leben ist natürlich völlig anders, aber die Geschichtsschreibung ist normalerweise so. Und alle Nationalgeschichten haben eigene Darstellungsweisen von Schurken und Helden, so dass sie sich nicht einfach integrieren lassen. Man kann nicht einfach ein Buch zur polnischen Geschichte mit einem zur jüdischen, einem zur deutschen und einem zur ukrainischen Geschichte kombinieren, um eine synthetische Geschichte zu bekommen, weil jede Nationalgeschichte nach ihrer eigenen Logik funktioniert. Nationen sind nur in der Produktion ihres Selbstbilds wahrhaft souverän, und das erschwert es uns natürlich, die Welt zu verstehen. Da die Welt immer noch durch Nationalstaaten, nationale Erziehungssysteme et cetera strukturiert ist, dominiert eine nationale Form des Verstehens dieser Ereignisse auf scheinbar natürliche und direkte, aber wenig konstruktive Art. Daneben kann Nationalgeschichte wichtige Fragen stellen, zum Beispiel, warum waren wir die Opfer oder warum waren wir die Täter oder warum standen wir dabei und taten nichts? Alles sehr gute und relevante Fragen, moralisch gewichtige Fragen, auf die wir Antworten suchen müssen, wenn wir uns mit bestimmten Nationen identifizieren. Die Nationalgeschichte stellt diese Fragen, kann sie aber nicht beantworten, weil einige von den Gründen, warum wir Opfer, Täter oder Zuschauer waren, mit Kräften zu tun haben, die nationale Grenzen überschreiten.
Der andere Grund, warum es so schwierig ist, diese Art von Geschichte zu betreiben, ist die Bipolarität der Politik. Ungefähr seit der Französischen Revolution haben wir Politik mit den Begriffen links und rechts beschrieben, was durch die Erfahrung von Faschismus und Antifaschismus zementiert wurde. Wir neigen dazu, die Sowjetunion als links und das Dritte Reich als rechts zu verstehen, und weil wir sie als links oder rechts ansehen, verstehen wir sie vor allem oder sogar allein aus ihren Ideen. Und da sich ihre Ideen natürlich sehr unterscheiden, ist es einfach für uns, sie einzuordnen, getrennt zu betrachten und zu glauben, sie hätten nicht viel Kontakt miteinander. Betrachtet man aber die »Bloodlands« und das Leben und den Tod ihrer Bewohner im am härtesten getroffenen Teil Europas, dann ist es unmöglich, die UdSSR und das Deutsche Reich als Gegensätze zu betrachten, weil diese beiden Regime trotz ihrer unterschiedlichen Ideen und Systeme ein gemeinsames Territorium besaßen. Wir Historiker schreiben im Allgemeinen so über das Dritte Reich und die Sowjetunion, als hätten sie sich auf unterschiedlichen Planeten befunden und nicht, als seien sie mächtige Systeme gewesen, die in einem bestimmten Teil der Welt am mächtigsten oder zumindest am mörderischsten waren. Wir tun das, weil es bequem ist. Es ist bequem, die Kategorien links und rechts beizubehalten, so wie es bequem ist, die Kategorien unterschiedlicher Nationen beizubehalten, aber Geschichte ist zu allererst unbequem.
3. Methoden, den Problemen zu entgehen
Wie schreibt man eine Geschichte, die diese schrecklichen Ereignisse erklären kann? Eine Methode: Ich habe versucht, nationales Sonderbewusstsein zu vermeiden. Dieses Buch handelt zwar ausführlich von Juden, Polen, Ukrainern und so weiter, aber es geht nicht von der jüdischen, polnischen oder ukrainischen Geschichte aus. Diese Feststellung mag simpel erscheinen, ist es aber nicht. Wenn man von der Beobachtung ausgeht, dass 14 Millionen Menschen ermordet wurden, hat man einen ganz anderen Ausgangspunkt, als wenn man etwa von der jüdischen oder polnischen oder ukrainischen Geschichte ausgeht.
Ich gehe also von allen Menschen aus, die das Gebiet bewohnten. Es ist natürlich wichtig, ob sie Juden waren, Polen, Litauer oder Russen. Es ist wichtig, wer jemand ist, obwohl noch wichtiger ist, wie einen die Mächte sehen, die größer sind als man selbst. Ich beginne mit der Beobachtung, dass es eine Katastrophe gab, deren schlimmster und deutlichster Teil der Holocaust war, und versuche dann, die einzelnen Teile auf der Grundlage der Erfahrung der anderen zu erklären.
In dem Buch verzichte ich nicht nur auf methodologischen Nationalismus, sondern auch auf dialektische Konstruktionen. Es gibt mindestens drei dialektische Übungen, die unser Verständnis dieser Ereignisse sehr erschweren. Nennen wir die erste die Dialektik der Sowjetapologie. Sie geht so:
»Ja, gewiss, die sowjetischen Behörden ermordeten in den 1930er-Jahren Millionen von Zivilisten. Aber die Rote Armee gewann den Zweiten Weltkrieg.« Zwischen diesen beiden Vorgängen besteht in Wirklichkeit kein logischer Zusammenhang. Das tiefere Problem ist aber: Wir können Ereignisse von 1933 nicht erklären, indem wir uns auf Ereignisse von 1945 beziehen. Wir können nicht erklären, warum Sie (zum Beispiel) diesen Artikel lesen, indem wir uns auf Ereignisse von 2024 beziehen.
Nennen wir die zweite Übung die Dialektik der NS-Apologie. Das ist die Nolte-Version, die ebenso wenig plausibel ist. Die beiden Systeme standen nicht in einer Art schicksalhafter hegelianischer Beziehung zueinander. Sie waren unterschiedliche politische Ordnungen, deren sehr unterschiedliche Führungspersonen sehr unterschiedliche Ideen hatten. Manchmal konkurrierten sie, manchmal kooperierten sie, und manchmal interagierten sie. Wann und wie sie interagieren, ist eine empirische Frage und wird nicht durch Intuitionen gelöst, die aus dialektischem Denken entstehen und bei nahezu völligem Unwissen über die Geschichte Osteuropas und der Sowjetunion, wie bei Nolte.
Die dritte Spielart ist die Dialektik des heutigen westlichen Liberalismus. Dies ist der Gedanke, dass Sowjets und Nazis, weil sie so unterschiedlich waren, irgendwie in der Mitte Europas zusammenstießen und einander aufhoben. Die Sowjets kamen irgendwie ins Spiel und machten alles rückgängig, was die Nazis getan hatten. So formuliert, wirkt es natürlich nicht plausibel, aber so denken Menschen im Allgemeinen über diese Ereignisse. Sie denken: eins minus eins ist null. Die richtige Aufgabe ist aber eins plus eins, und das ist zwei. Historisch gesehen betrachten wir Gebiete, in denen deutsche Macht wie Sowjetmacht präsent sind, das bedeutet, man hat erst die eine und dann die andere, und an einigen Orten sogar erst die eine, dann die andere und dann wieder die erste. Es ist schlimm, besetzt zu sein. Noch schlimmer ist eine doppelte Besetzung. Am schlimmsten ist eine dreifache Besetzung.
Eine dritte Prämisse neben dem Verzicht auf Nationalismus und Dialektik ist, dass ich von den Morden ausgehe. Das ist ein wenig anders als in dem dominanten Diskurs. Das beherrschende Bild des Holocaust und auch des sowjetischen Terrors ist das Lager, das Konzentrationslager. Wenn Sie zum Beispiel den Film Der Untergang gesehen haben, werden Sie sich vielleicht erinnern, dass am Schluss eine Tafel erscheint, auf der steht, dass sechs Millionen Juden in deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden. Das stimmt nicht. Die große Mehrzahl der Holocaustopfer kam nie bis in ein Konzentrationslager (wie der Öffentlichkeit noch immer nicht bewusst ist, trotz so vieler hervorragender Studien gerade in Deutschland). Juden wurden ja in Mordeinrichtungen und in Vergasungseinrichtungen getötet. Aber das waren keine Lager. Ein Lager ist ein Ort, wo man in Baracken schläft. Treblinka war kein Lager. Sobibor war kein Lager. Belzec war kein Lager. Chelmno war kein Lager. Der Teil von Auschwitz, in dem Menschen ermordet wurden, war auch kein Lager, und die meisten Auschwitzopfer sahen nie ein Lager, weil sie aus den Zügen direkt in die Gaskammern getrieben wurden. Und ein großer Teil der Juden wurde sogar außerhalb dieser Todesstätten ermordet. Wir erinnern uns an Lager, weil es dort Überlebende gab. Es waren schreckliche Orte, an denen viele Menschen starben, aber die meisten Menschen in Lagern überlebten, darum besitzen wir ein Zeugnis. Es ist ein grauenhaftes Zeugnis, das ich keineswegs in seiner Bedeutung verkleinern will, aber es ist ein unzureichendes Zeugnis. Es verweist nur auf die noch schrecklicheren Orte, an denen Menschen in Mordeinrichtungen durch Gas oder neben Massengräbern durch Kugeln oder – am häufigsten – durch Verhungernlassen ermordet wurden.
4. Der Raum als methodisches Prinzip
Mein Buch beginnt also mit einem Raum, teils aus Gründen der Moral und teils aus methodischen Gründen. Wenn 14 Millionen Menschen zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Gebiet ermordet wurden, das gar nicht so weit von einem anderen Gebiet entfernt ist, müssen wir versuchen, das zu verstehen. Dieser transnationale Raum erlaubt mir aber auch, nationales Sonderbewusstsein und konventionelle Dialektik beiseitezulassen. Die räumliche Perspektive bedeutet auch, dass ich die Regime betrachte. Im Allgemeinen werden Geschichten der Nazi-Morde von Berlin aus und Geschichten des sowjetischen Terrors von Moskau aus geschrieben. Es gibt Vergleiche, aber sie haben kein vermittelndes Drittes, das die Dinge zusammenbringt. Das kann jedoch gelingen, indem man seine Aufmerksamkeit auf das Territorium richtet, in dem sie beide präsent waren und ihre Mordeinrichtungen präsent waren. Indem man die Befehlskette von dort zurück nach Berlin und Moskau verfolgt und nicht nur in Berlin und Moskau bleibt. Das bedeutet, man muss nicht nur die Quellen der Regime auf Deutsch und Russisch lesen, sondern die Quellen der Opfer und der Zeitgenossen der Opfer auf Jiddisch, Polnisch, Ukrainisch und in den meisten Sprachen der »Bloodlands«.
Ich habe also Ort und Raum als methodisches Prinzip betont, nicht weil ich Ideen für unwichtig halte, sondern umgekehrt: weil ich meine, wir müssen Ideen ernstnehmen, und das heißt, wir müssen ihre Macht historisch verstehen. Ideen sind die Standarderklärung für Massenmord, die Nazis mordeten wegen nationalsozialistischer Ideen, die Stalinisten mordeten wegen stalinistischer Ideen. Ich habe das bewusst etwas vereinfacht formuliert, weil ich betonen möchte, dass Ideen nicht allein morden. Wenn das so wäre, wäre die Weltgeschichte noch viel mörderischer, als sie bereits ist. Wenn der Antisemitismus direkt zum Mord an den Juden führt, hätte es in Osteuropa keine Geschichte der Juden vor dem Holocaust gegeben. Erst wenn sich Ideen in Institutionen verkörpern, werden sie wirkungsmächtig. Im Fall des Holocaust war das ein antisemitischer Staat, NS-Deutschland, der Krieg gegen Nachbarländer führte, in denen Juden lebten. Das erste, was wir also tun müssen, und hier haben die Historiker, die das Dritte Reich und die Sowjetunion studiert haben, hervorragende Arbeit geleistet, ist also, das Verbinden der Ideologie mit den Institutionen herauszuarbeiten.
Zweitens müssen wir, um Ideologie mit Handlungen zu verbinden, begreifen, welches Zeitverständnis diese NS- oder Sowjetinstitutionen hatten. Ich habe es bereits erwähnt und betone es erneut, dass diese Ideologien verschieden waren. Ein Aspekt, in dem sie sich unterschieden, war ihr Verständnis von Vergangenheit und Zukunft. Für die Sowjets lag die Revolution in der Vergangenheit. Die Revolution, auf die es ankam, war die von 1917. Stalin sicherte aus seiner Sicht die Industrialisierung der UdSSR, die Kontrolle und Kollektivierung des Bodens und die autoritäre Behauptung des Sozialismus in einem Land. Darum fanden fast alle sowjetischen Morde in Friedenszeiten statt und fast alle auf sowjetischem Territorium. Für die Nazis bedeutete Revolution etwas Anderes, sie lag in der Zukunft. Revolution war für sie etwas, das nur im Krieg stattfinden könnte. Hitler, Himmler, Heydrich, Göring und die übrige NS-Elite wussten, dass der einzige Weg, die deutsche Gesellschaft in ihrem Sinne umzuwälzen und in Osteuropa ein rassisches Kolonialreich zu errichten, ein Krieg war. Während in den 1930er-Jahren die Sowjets also schon Institutionen besaßen, die unter anderem auch zum Massenmord fähig waren, freuten sich die Nazis auf den Krieg, der es ihnen erlauben würde, Mordinstitutionen zu schaffen und Mordkampagnen durchzuführen. Aus diesem Grund lag die Gesamtzahl der Naziopfer in Deutschland von 1933 bis 1939 bei einigen Tausend, die der ermordeten Juden bei einigen Hundert. Sobald Deutschland aber Krieg führte, kletterte die Zahl rasch auf Zehntausende, dann Hunderttausende, dann Millionen. Die deutschen Morde geschahen also fast ausschließlich im Krieg und außerhalb Deutschlands.
Um die Perspektive meines Buches zu verstehen, müssen wir uns klarmachen, dass »außerhalb Deutschlands« weitgehend dasselbe bedeutet wie »innerhalb der Sowjetunion«.
Drittens müssen wir erkennen, dass beide Ideologien eine ökonomische Dimension besitzen − auch hier sind übrigens deutsche Historiker vorangegangen. Ich meine, dass beide Ideologien, wenn man hinter ihre unmittelbare Ausdrucksform schaut, den Rassenkrieg oder den Klassenkrieg, auch Transformationsprojekte waren. Der Nationalsozialismus propagierte einen Rassenkrieg zur Vernichtung der Juden, aber dieser Krieg war gleichzeitig ein Projekt zur Kolonisierung eines großen Teils von Osteuropa. Er sollte zur industriellen Moderne in Deutschland ein ländliches Gegengewicht schaffen, in dem die Deutschen alle anderen Menschen entfernen und sich reinigen konnten. Ähnlich die Sowjets. Man sieht ihre Ideologie als eine des Klassenkampfes, und das ist natürlich richtig, aber der Klassenkampf hatte eine bestimmte Form, ein bestimmtes erwünschtes Ziel, und dieses Ziel war eine industrialisierte Gesellschaft, in der die Landwirtschaft kontrolliert und zur Modernisierung genutzt werden sollte. Das war fast das Gegenteil der NS-Ideologie. Die NS-Ideologie versprach, ein modernes Land durch ein agrarisches Utopia zu ergänzen. Die Sowjetideologie stellte dagegen in Aussicht, ein zurückgebliebenes Land zu modernisieren. Wir halten diese beiden Visionen gern getrennt, aber auch sie überschneiden sich in einem Gebiet, und dieses Gebiet ist vor allem die Ukraine.
Wir müssen verstehen, dass unsere Einordnung von Ideen eine Sache ist, und die Art, wie Systeme von den Menschen erlebt wurden, eine andere. Wir müssen die Unterschiede zwischen den Ideen erkennen, aber das ändert nichts daran, dass zum Beispiel Ukrainer sich daran erinnern, dass beide Regimes ihren Hungertod wünschten.
Ideologie kann ein bestimmtes Territorium in den Fokus der Weltgeschichte rücken. Nazis und Sowjets besaßen globale Visionen über Veränderung, über das Bild der Zukunft. Die Nazis stellten sich einen echten Weltkrieg vor, den sie gegen Briten und Amerikaner gewinnen würden. Sie stellten sich eine Welt vor, in der alle Juden vernichtet wären, aber in der Zwischenzeit – und das ist historisch immer die wichtigste Zeit, denn wir befinden uns stets darin – mussten die Nazis Osteuropa kontrollieren. Sie mussten ein Imperium schaffen, das eine rassische Erlösung ermöglichte, aber auch die Autarkie gegenüber Briten und Amerikanern. Auch die Sowjets hatten eine globale Vision. Sie glaubten, ihre Revolution sei etwas zu früh gekommen, aber später werde es weitere Revolutionen geben, zuletzt eine Weltrevolution. In der Zwischenzeit, auch hier die einzige Zeit, auf die es ankommt, waren die Kollektivierung der Landwirtschaft und die Industrialisierung wichtig, und auch diese Vision hatte einen bestimmten geografischen Fokus, in erster Linie die Ukraine.
Nachdem wir all das verstanden haben, ist die Katastrophe weniger überraschend. Wenn wir wissen, dass es zwei sehr unterschiedliche, aber fantastisch ehrgeizige neokoloniale Projekte gab, die denselben Teil Europas im Blick hatten, überrascht es nicht, dass so viele Menschen hier und nicht woanders sterben. Da beide Ideologien auf fruchtbaren Boden fixiert waren, überrascht es nicht, dass die wichtigste Methode des Massenmords in den 1930er- und 1940er-Jahren der Hungertod war. Es überrascht auch nicht, dass beide Regime in einem Punkt einig waren: die Zerschlagung des unabhängigen Polen. Aus der Sicht Moskaus wie aus der Sicht Berlins war der polnische Staat ein Hindernis. Er stand im Weg. Er hinderte sie an der Verwirklichung ihrer Ziele. In diesem Punkt waren Hitler und Stalin einer Meinung, und deshalb wurden sie 1939 militärische Verbündete. Worüber sie sich aber nicht einigen konnten, war die Ukraine. Aus der Sicht Deutschlands war die Ukraine der Brotkorb, der als Ergänzung zu seiner Industrie dienen sollte. Aus sowjetischer Sicht war die Ukraine der Brotkorb, der zum Aufbau der Industrie notwendig war. Die Ziele waren unterschiedlich, ebenso die Ideologien und die Zukunftsvision, aber das Land, um das gerungen wurde, war dasselbe, und nur einer konnte es beherrschen. Als sie dann gegeneinander kämpften, mussten sie um die Ukraine kämpfen, und das taten sie ab 1941.
5. »Bloodlands« und der Holocaust
Was bedeutet all das für die Juden? Damit es zum Holocaust kommen konnte, musste es eine Kombination aus zwei Elementen geben. Erstens war da die Judenfeindschaft der Nazis, die antijüdischen Maßnahmen, die damit begründet wurden, dass an allem deutschen Übel die Juden Schuld seien. In Verbindung damit gab es eine intellektuelle, politische und militärische Energie, die sich auf die osteuropäische Heimat der Juden richtete. Beides war notwendig. Die antisemitischen Ideen der Nazis allein hätten keinen Holocaust erzeugen können, weil 1939 nur 0,25 Prozent der deutschen Bevölkerung jüdisch war. Oder anders betrachtet: Als der Holocaust schließlich stattfand, waren 97 Prozent seiner Opfer Menschen, die kein Deutsch sprachen und außerhalb Mittel- und Westeuropas lebten, aus dem einfachen Grund, weil die Juden zu diesem Zeitpunkt ein weitgehend osteuropäisches Volk waren. Es braucht also beides, die besondere deutsche Judenfeindschaft und eine Erklärung, warum es in der Weltheimat der Juden einen solchen Konflikt gab.
Ich habe gerade versucht, eine Argumentation zu entwickeln, die so nicht im Buch ausgeführt wird, aber dessen Aufbau erklärt. Das Buch untersucht nacheinander die verschiedenen Mordmaßnahmen. Es beginnt mit der Hungersnot in der ukrainischen Sowjetrepublik in 1933. Dann betrachtet es die beiden Hauptformen des Großen Terrors in der Sowjetunion, den Massenmord an politisch verdächtigen Bauern (sogenannten Kulaken) und den Massenmord an politisch verdächtigen ethnischen Minderheiten. Ein entscheidendes Kapitel ist das vierte Kapitel über den Hitler-Stalin-Pakt 1939. Es ist ein wichtiges Kapitel, weil es als entscheidend erachtet, dass die Sowjetmacht nach Westen vorrückt, indem sie sich Ostpolen und das Baltikum einverleibt. Die Folge ist, dass die deutsche Macht jetzt massiv mörderisch wird, was vorher nicht im gleichen Maße der Fall war. Mit der Invasion Polens wurden die Einsatzgruppen aktiv.
Darüber hinaus begann mit dem Hitler-Stalin-Pakt de facto der Zweite Weltkrieg. Dieser Krieg hätte auch auf andere Art beginnen können, aber ich halte die Tatsache, dass er mit dem Hitler-Stalin-Pakt begann, für sehr aufschlussreich und wichtig. Der Pakt war etwas, woran Polen, Litauer, Letten und Esten die Erinnerung wachhalten wollten, weil er ihre Staaten zerstörte. Und ihre Staaten wurden von Deutschen und Sowjets gemeinsam zerstört. Für die Juden hatten der Pakt und die Zerstörung dieser Staaten die gravierendsten Folgen: Wenn man im Zweiten Weltkrieg als Jude an einem Ort in Europa lebte, in dem der Staat zerstört war, in dem staatliche Institutionen abgeschafft oder verdrängt waren, lag die Überlebenschance bei 1 zu 20. Wenn man als Jude in dieser Zeit an einem Ort in Europa lebte, in dem es einen Staat gab, selbst wenn dieser Staat mit Deutschland verbündet war wie Rumänien, Italien, Ungarn oder Bulgarien, und selbst wenn es Nazideutschland selbst war, lag die Überlebenschance bei etwa eins zu zwei. Angesichts der zentralen Rolle des Staates für das politische Denken im Allgemeinen und das jüdische politische Denken im Besonderen überrascht es, wie wenig Aufmerksamkeit wir der Zerstörung der Staaten 1939 zuwenden. Wir sahen bisher in Osteuropa nur ethnische Gruppen, aber kaum Institutionen. Unsere Sicht auf die Massenmorde war gewissermaßen nazifiziert.
Im fünften Kapitel versuche ich, den Ablauf des Holocaust zu erklären. Die Nazis hegten von Anfang an die Vorstellung, dass die Juden aus Europa verschwinden müssten. In der Praxis sollten die Juden aus dem ganzen deutschen Machtbereich entfernt werden, aber wie sollte man das anstellen? Zuerst drehten sich die Pläne des Regimes um Deportation. Deutschland eroberte Polen und deportierte die Juden aus einem Teil Polens in einen anderen. Das war wenig befriedigend. Dann überlegten die Nazistrategen, sie nach Madagaskar abzuschieben, dann in die Sowjetunion − Eichmann fragte sogar in Moskau an, ob die UdSSR zwei Millionen Juden aufnehmen würde. Dann hieß das Projekt: Wenn wir die Sowjetunion angreifen, werden wir die Juden nach Osten treiben.
Die deutsche Invasion der Sowjetunion im Juni 1941 war mit fürchterlich destruktiven Ideen verbunden, und als die Nazis die Grenzen ihrer Möglichkeiten erkannten, beschleunigten sie die sogenannte Endlösung. Zu Beginn des Angriffs glaubten die Deutschen, sie könnten die Rote Armee und den Sowjetstaat binnen neun Wochen zerschlagen und 30 Millionen Menschen im ersten Winter nach dem Sieg verhungern lassen. Eine große Kolonisierungskampagne sollte einerseits viele weitere Millionen vertreiben und dem Hungertod überlassen und andererseits die sogenannte Judenfrage lösen. Aber die Rote Armee leistete Widerstand, der Sowjetstaat brach nicht zusammen, die Deutschen konnten nicht so viele Menschen verhungern lassen wie geplant, wenn auch in sehr großer Zahl, was man nicht vergessen sollte: eine Million in Leningrad, dazu 3,1 Millionen Kriegsgefangene. Die Juden, denen natürlich die Schuld an allen Rückschlägen gegeben wurde und die mit dem Sowjetstaat identifiziert wurden, ermordeten die Deutschen seit Beginn der Invasion in immer größerer Zahl. Damit wurde die Endlösung zu dem, was wir den Holocaust nennen. Von diesem Punkt an stellt der Hauptteil des Buches die Mechanik dieses Vorgangs dar, zunächst im Baltikum, dann in der Ukraine, dann in Belarus/Weißrussland, dann in Polen.
6. Der Vergleich
Lassen Sie mich mit einer kurzen Bemerkung schließen, was dieses Buch leisten will und was nicht. Es will nicht vergleichen. Ich muss das betonen, besonders in Deutschland, weil der deutsche Methodennationalismus sich meistens durch zwei Argumente schützt: Erstens behauptet er, jede übernationale Geschichtsschreibung Osteuropas sei ein Vergleich (stimmt nicht); zweitens meint er, Vergleichen bedeute Gleichsetzen (noch mal falsch), um sich dann selbst dafür zu loben, keine Vergleiche anzustellen. Das ist eine Art intellektueller Nationalsport, der nur innerhalb der engen Grenzen des deutschen Methodennationalismus einen Sinn ergibt, wenn überhaupt. Dies gilt nicht für die ernstzunehmenden deutschen Holocaustforscher, die meine Herangehensweise in der Regel als konventionell oder sogar zu konservativ beurteilen. Wohl aber für diejenigen, welche die historische Literatur zum Holocaust in Osteuropa nicht wirklich kennen, sagen wir die Bücher von Gerlach bis Dieckmann. Anders ausgedrückt: Die Kritik meines Buches durch manche deutsche Wissenschaftler erscheint mir zuweilen als ein Ersatz für die nicht erfolgte Diskussion über die deutsche Historiografie des Holocaust der letzten zwanzig Jahre.
Was gar nicht sinnvoll ist, wäre eine Neuauflage des Historikerstreits, zumal es sich damals um eine rein deutsche Diskussion handelte, in der Osteuropa und die Juden fast gänzlich ausgeblendet wurden und in der die zwei Pole nationalistisch angehaucht waren: Nolte mit seiner unhaltbaren Argumentation und seiner Intention, die deutsche Geschichte zu exkulpieren; Habermas mit seiner Prämisse, dass Geschichte die Schule der Nation sei. In Noltes Fußstapfen sind heute diejenigen getreten, die nur deutschsprachige Quellen benutzen, um osteuropäische Ereignisse zu erörtern. Habermas folgen diejenigen, die Geschichte zugunsten von »Erinnerung« in den Hintergrund drängen, weil sie lieber selbst entscheiden, welche Lektüre für andere – in der Regel Osteuropäer – gut oder schlecht ist, statt ernstzunehmende intellektuelle Diskussionen zu führen.
Der Historikerstreit kann kein Gerüst für eine transnationale Geschichte des Holocaust sein, denn man würde die Diskussion verdeutschen, noch bevor sie überhaupt geführt werden kann. Wie die meisten Rezensenten richtig erkannt haben, betreibe ich eher transnationale als vergleichende Geschichte. Wer vergleicht, geht von zwei Voraussetzungen aus: Dass wir alles über die beiden Systeme wissen, was wir brauchen, und dass wir sie analytisch trennen und einzeln untersuchen können. Ich glaube nicht, dass wir alles über das NS- oder das Sowjetregime wissen, weil gerade ihre Pläne für Osteuropa und die Art, wie sie dort aufeinander trafen, zentrale Aspekte zu ihrem Verständnis liefern. Das Buch hat also viel mehr mit Interaktion als mit Vergleich zu tun. Ein Vergleich setzt eine analytische Trennung voraus. Eine Interaktion ist ein empirisch beobachtbares Ereignis.
Dennoch will ich den Vergleich als analytische Methode nicht beiseite schieben, weil ich glaube, ohne Vergleiche sind wir nicht in der Lage, irgendetwas Bedeutungsvolles über den Holocaust oder ein anderes dieser Verbrechen zu sagen. Wenn man sagt, der Holocaust sei schlimmer als alles andere, hat man bereits einen Vergleich angestellt. Doch wenn man diesen Vergleich anstellt, sollte es ein sinnvoller Vergleich sein, das heißt, es müssen auch Ähnlichkeiten oder gar Gemeinsamkeiten trotz aller Unterschiede bestehen. Sehr oft ist das nicht der Fall.
Obwohl mein eigenes Projekt also nicht primär vergleichend ist, ist mir klar, dass einer Tabuisierung von Vergleichen jede ernsthafte historische Arbeit auf diesem Gebiet unmöglich machen würde. Denn um Vergleiche zu verbieten, muss man das Denken einschränken. Das ist unmöglich, zumal in den Quellen selbst verglichen wird. Jeder, der längere Zeit Zeugnisse von Holocaustüberlebenden gelesen hat, und ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, weiß, dass Juden in Osteuropa Vergleiche zogen, so wie alle anderen auch, aus dem einfachen Grund, weil sie die jeweils andere Besatzungsmacht erlebt oder zumindest geahnt hatten, dass sie wiederkommen werde. Man hatte Gründe, sich über die Herrschaft der Sowjets und der Nationalsozialisten Gedanken zu machen: Flieh in die eine Richtung. Flieh in die andere Richtung. Bau einen Bunker. Bau keinen Bunker. Stell dich mit den örtlichen Kommunisten gut. Versuch dich mit dem örtlichen Priester gutzustellen. Je nachdem. Die Quellen sind voller Vergleiche. Sie sind ein unvermeidlicher organischer Teil der Erfahrung und der Geschichte.
Ich verstehe, dass die Vorsicht gegenüber Vergleichen mit der Vorstellung zu tun hat, wenn mehr als eine Sache ins Bild komme, werde das im Bild verkleinert, was doch so wichtig sei. Mein Eindruck ist dagegen: Das Bild ist viel größer, als man dachte. Die Sorge um das, was möglicherweise durch Verkleinerung nicht in angemessener Größe erscheint, ist standortgebunden. Nicht wenige Menschen waren zum Beispiel besorgt, mein Buch verharmlose den Stalinismus, weil ich den Stalinismus zu rational erscheinen lasse und weil ich die Zahl der Opfer des Stalinismus niedriger ansetze. In Deutschland befürchtet man dagegen, der Holocaust werde relativiert. In der Epoche des Kalten Krieges bis zum Erscheinen meines Buches sagten Historiker einerseits, die Sowjets waren wohl auf eigene Weise schlimmer, weil sie mehr Menschen ermordeten, aber der Holocaust sei etwas Anderes und Besonderes, weil es der einzige Versuch war, ein gesamtes Volk zu vernichten. Dieses Credo stimmt nur zur Hälfte: Nicht die Sowjets ermordeten mehr Menschen, sondern die Deutschen − allein dem Holocaust fielen mehr Menschen zum Opfer als allen stalinistischen Mordmaßnahmen zusammen. Mit anderen Worten, der Holocaust war nicht nur qualitativ, sondern quantitativ schlimmer, wenn wir von schlimmer reden wollen. In diesem Sinne verteidigt mein Buch radikal die These von der Einzigartigkeit des Holocaust. Transnationale Geschichte liefert somit belastbarere Ergebnisse als Nationalgeschichte.
Die Methode des Buchs ermöglicht Vergleiche gerade deshalb, weil ihm keine vergleichende Methode zugrunde liegt. Vergleichen dürfen wir jedoch erst am Ende, nicht am Anfang. Mit dem Vergleich zu beginnen heißt, analytisch zu trennen, was empirisch nicht trennbar ist, zum Beispiel und vor allem die Erfahrungen der Bewohner der »Bloodlands«. Am Ende kehren wir natürlich zu den großen Kategorien und großen Zahlen zurück, aber hoffentlich nur nach einer Betrachtung, die diese Erfahrung historisch wiederhergestellt hat. Meine Fragen sind dabei: Erstens, warum wurden so viele Menschen ermordet; und zweitens, was bedeuten diese Massenmorde? Was wir von Hitler, Stalin und dieser Epoche erben, sind riesige, erdrückende, überwältigende Zahlen. Sie sind eine der vielen Arten, auf die Hitler und Stalin die Geschichte des 20. Jahrhunderts dominieren. Die Historiografie als eine Humanwissenschaft sollte anerkennen und ernstnehmen, dass diese Zahlen nicht bloß quantitative, sondern qualitative Bedeutung haben. Dass die großen Zahlen sich aus kleinen Zahlen zusammensetzen. Alle großen Zahlen bestehen aus einzelnen Einheiten – solche »Einheiten« sind nicht abstrakt sondern unverwechselbare Personen.
Es gelang den politischen Systemen der Sowjetunion und NS-Deutschlands, Menschen zu Zahlen zu machen, und es gelang uns bisher weniger gut, sie wieder zu Menschen zu machen. Für mich ist das die Aufgabe der Geschichtsschreibung. Sie sollte versuchen, aus den Zahlen wieder Menschen zu machen. In diesem Sinne möchte ich Ihnen die Namen der Menschen nennen, die ich zu Beginn erwähnte, denn natürlich trugen alle 14 Millionen Menschen, die ermordet wurden, einen Namen. Der Ukrainer, der sein eigenes Grab schaufelte, hieß Petro Veldii. Der Pole, der ein Tagebuch führte, hieß Adam Solski. Und die junge jüdische Frau, die ein paar Stunden vor ihrer Erschießung eine Botschaft an ihre Mutter in die Wand der Synagoge ritzte, hieß Dobcia Kagan.
Nachbemerkung
Wer an anderen Repliken auf die umfangreiche Kritik – etwa zu den Themen Kollaboration, Ausmaß der Morde, Kausalität und Erinnerung – interessiert ist, sei verwiesen auf Snyders Texte: »Collaboration in the Bloodlands«, in: Journal of Genocide Research 13 (2011) 3, 313–352; »Global History and the Holocaust«, in: H-Diplo, 13 (2011) 2; »The Causes of the Holocaust«, in: Contemporary European History 21 (2012) 2, 149–168; »The Problem of Commemorative Causality in the Holocaust«, in: Modernism/Modernity (2013)
Ich kann mich den Glückwünschen an die Adresse der Jury zur Wahl des diesjährigen Preisträgers nur anschließen. Nicht nur deshalb, weil sein großes Werk Bloodlands perfekt zu dem großen europäischen Gedenkjahr passt, vor dem wir stehen – 2014, hundert Jahre Beginn des Ersten Weltkrieges, fünfundsiebzig Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges und fünfundzwanzig Jahre nach der großen Zäsur der demokratischen Revolution in Osteuropa –, sondern weil Timothy Snyder auch in enger Verbindung zu früheren Trägern des Hannah-Ahrend-Preises steht, insbesondere zu Tony Judt, dem Preisträger von 2007. Er hat posthum einen Band mit Gesprächen veröffentlicht, die er mit Judt über sein Leben und zur Geschichte des 20. Jahrhunderts führte – Nachdenken über das 20. Jahrhundert –, den ich sehr zur Lektüre empfehlen möchte. Die Wahl von Timothy Snyder erinnert auch an andere Preisträger, zum Beispiel François Furet und seine Geschichte des Kommunismus, aber auch an Jelena Bonner. Es gibt eine gewisse Linie in den Entscheidungen der Jury des Hannah-Ahrendt-Preises, die sich in dem diesjährigen Preisträger fortsetzt.
Was ich an Ihrem Buch, neben vielem anderen, wozu heute noch Berufenere sprechen werden, besonders erhellend fand, war der Bogen, den Sie zum Jahr 1914 geschlagen haben. Der Erste Weltkrieg hat die Büchse der Pandora geöffnet, aus dem die Schrecken emporstiegen, die dann dieses europäische 20. Jahrhundert, genauer die erste Hälfte des Jahrhunderts, gekennzeichnet haben: Nationalismus, Völkerkrieg, Klassenkrieg, Entfesselung schrankenloser Gewalt, Deportation, Völkermord – ich erinnere an den Mord an den Armeniern am Ende des Ersten Weltkrieges, der für Hitler ein erster Großversuch ethnischer Säuberung und genozidaler Politik war, den er sehr wohl beobachtet hat; auch ein Test darauf, was die internationale Öffentlichkeit, die Völkergemeinschaft hinzunehmen bereit war. Aushungerung als Waffe, auch das ist bereits im Ersten Weltkrieg und in den folgenden Jahren erprobt worden. In Russland sind schon 1920/ 1921, bei der ersten Welle der Konfiskation von Getreide und des Angriffs auf die privaten Bauern, mehrere Millionen Menschen verhungert – ein Vorläufer der zweiten großen Welle 1932/1933, die vor allem in der Ukraine stattfand.
Man muss darüber nachdenken, weshalb diese exzessive Gewalterfahrung, die mit dem Ersten Weltkrieg begonnen hat – dazu gehört auch der monströse Stellungskrieg, mit dem Millionen von Soldaten für minimale Geländegewinne abgeschlachtet wurden –, wieso diese exzessive Gewalterfahrung nicht zu einer Pazifizierung der europäischen Politik führte, sondern im Gegenteil zur zunehmenden Radikalisierung. Sie setzte schon vor dem Ausbruch der großen Weltwirtschaftskrise 1929 ein, und zwar beileibe nicht nur in der Sowjetunion und in Deutschland, den beiden revisionistischen Mächten im Zwischenkriegseuropa, die auf Umsturz der politischterritorialen Ordnung aus waren, die nach dem Ersten Weltkrieg entstand. Dabei ging es ihnen nicht nur um eine Revision der Grenzen, sondern um die Umwälzung der gesamten gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Insofern war auch der Nationalsozialismus eine revolutionäre Macht. Er war auf Umsturz aus, und zwar nicht nur auf staatlichen Umsturz, sondern auf den Umsturz aller Werte. Timothy Snyder arbeitet sehr gut heraus, dass Gewalt in der Sowjetunion, vor allem beim Stalinismus, als Mittel der inneren Kolonisierung der Gesellschaft eingesetzt wurde, während exzessive Gewalt für den Nationalsozialismus Teil der Lösung der sozialen Frage in Deutschland durch Errichtung eines germanischen Imperiums im Osten war. Das schloss Kolonisierung, Deportation, Assimilation einer kleinen Minderheit und Versklavung und Vernichtung der Mehrheit der Bevölkerung dieses Raums ein. Dieses exterministische Programm richtete sich nicht nur gegen die Juden, sondern auch gegen die slawischen Völker.
Von den ehemaligen »Bloodlands« Mittelosteuropas haben bisher Polen und die baltischen Staaten ihren Weg in die europäische Demokratie gefunden, mehr oder weniger gut, aber ich glaube doch irreversibel. Die Ukraine und Weißrussland bleiben bis heute in einer prekären Zwischensituation zwischen Autoritarismus und Demokratie, zwischen einem freiheitlichen Europa und einem Sonderweg, der sich von der westlichen Moderne abgrenzt. Das gilt auch für Russland selbst. Es ist nicht entschieden, welchen Weg diese Länder gehen werden – das liegt auch an uns, an der Politik der Europäischen Union. Wir werden diese Entscheidung nicht stellvertretend für sie treffen können, aber es ist auch an uns, alles zu tun, um den Weg in ein demokratisches Europa für diese Länder offen zu halten. Die Mission von 1989/90, der Prozess der europäischen Integration, ist noch nicht abgeschlossen. Wir sollten alles tun, um ihn zu befördern. Er ist erst vollendet, wenn ganz Europa einig und frei ist.
Ich wage die These, dass in diese politische und kulturelle Ambivalenz der Ukraine, Weißrusslands und Russlands die ungeheure Traumatisierung hineinspielt, die Timothy Snyder beschreibt. Die äußerste Gewalterfahrung dieser Zeit wirkt fort, und zwar nicht nur im kollektiven Unterbewusstsein dieser Gesellschaften, sondern auch in ihren gesellschaftlichen Strukturen. Der Terror des Nationalsozialismus wie des Stalinismus richtete sich ja nicht nur gegen Individuen. Zerschlagen wurden die gesellschaftlichen Strukturen in diesen Ländern, und zwar in einer ungeheuren Gründlichkeit, von der sie sich bis heute nicht erholt haben. Es dauert lange, um so etwas wie eine bürgerliche Gesellschaft wieder aufzubauen. Sehr lange!
Vor dem Hintergrund der europäischen Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts grenzt das, was in den Jahren seit 1989 passiert ist – die friedliche Revolution und die Überwindung der staatssozialistischen Regime, die demokratische Transformation einer ganzen Reihe von Ländern und die Osterweiterung der EU – fast an ein Wunder. Die Aufarbeitung der traumatischen Gewaltgeschichte, die über Mittelosteuropa liegt, ist ein wichtiger Beitrag zur europäischen Einigung. Und die Verleihung des HannahArendt-Preises an Tymothy Snyder ist eine gute Gelegenheit, an den Auftrag der europäischen Einigung zu erinnern. Man kann die Europäische Union nicht nur aus der Geschichte begründen, als ein Projekt gegen Gewaltherrschaft, Nationalismus und Völkermord. Aber das war und ist ein wesentlicher Impuls, sich weiter für dieses demokratische und vereinigte Europa einzusetzen.
Beitrag auf dem Bremer Kolloquium
Ich möchte an einem zentralen Gedanken anknüpfen, den Timothy Snyder hier entwickelt hat: nämlich dass sich am »Auschwitz«-Topos eine Art Grundaufstellung der historischen Erinnerung kristallisiert habe, die sich in »Zivilisierer« und »Nationalisierer« teilen lasse. Da wäre einesteils die in den Nationalsozialismus abkippende, sich selbst zerstörende oder verstümmelnde deutsche Zivilisation, deren Massenverbrechen von Dan Diner als ein regelrechter »Zivilisationsbruch« bezeichnet worden sind. Da ist andererseits dieser mittelosteuropäische Raum, der aus deutscher Perspektive in der Zwischenkriegszeit als ein bloßes »Zwischeneuropa«, ein von den westlichen Siegermächten in Versailles installierter »Cordon Sanitaire« mehr oder weniger willkürlich zugeschnittener Einzelstaaten wahrgenommen worden ist, die zu einer eigenständigen, höheren Kultur und Staatlichkeit nicht fähig waren und auch deshalb zum Kerngebiet der »Bloodlands« wurden. Und jenseits dessen lag eine Sowjetunion, die – so Snyders These – in der Erinnerungsaufstellung eher auf die Seite der »Zivilisierer« gerechnet wird, während die Länder des heutigen Mittelosteuropa auf der Seite der »Nationalisierer« stehen.
Dabei ist weder der eine noch der andere Begriff pejorativ beziehungsweise affirmativ zu verstehen; allerdings geht Snyders Argumentation, wenn ich recht verstehe, dahin, die angeblich borniertere Perspektive der »Nationalisierer« gegenüber der angeblich universelleren der »Zivilisierer« zu rehabilitieren. Ob man diese Begriffe passend findet, kann dabei erst einmal dahingestellt bleiben; es ist klar, was im Großen und Ganzen gemeint ist. Ich möchte diese Einteilung im Sinne unseres Themas einer »geteilten Erinnerung« im Prinzip aufnehmen, das Bild aber durch einige zentrale Befunde meines Buchs Der Russlandkomplex etwas weiter nuancieren und ihm eine historisch-genetische Dimension geben, die über das Chronotop von 1933 bis 1945, in dem Snyder die »Bloodlands« angesiedelt hat, in beide Richtungen hinausreicht.
Zunächst ist festzuhalten, dass die UdSSR besonders für die Deutschen, aber auch für große Teile der westlichen und vermutlich auch der mitteleuropäischen Öffentlichkeiten, über weite Strecken, wenn nicht bis zu ihrem Ende, im Kern noch immer mit »Russland« identifiziert wurde – um das es heute auch wieder geht. Die ganzen 1920er-Jahre hindurch sprach man in Deutschland so gut wie nie von der Sowjetunion, sondern von »Sowjetrussland« oder vom »Neuen Russland«. Was aus diesem Moskauer Großstaat neuen Typs einmal werden würde, als was er sich am Ende entpuppen würde, erschien noch ganz unklar. Klar war nur, dass die »Union Sozialistischer Sowjetrepubliken« eine Verwandlungsform des alten Russischen Reiches war, zu dem die Deutschen über zwei Jahrhunderte hinweg eine besondere, vielfältig changierende Beziehung unterhalten haben, die in einem binären Freund/Feind-Schema nicht aufgeht.
Das Changierende dieser Beziehungen und Wahrnehmungen ergab sich – um nur ein paar Stichworte zu nennen – zum Beispiel daraus, dass man es an der Basis mit einem riesigen Bauernland zu tun hatte, wobei es keine Rolle spielte, ob diese Bauern Russen, Ukrainer oder was immer waren. Wenn vom »russischen Menschen« die Rede war, dann war ein einfacher, bäuerlicher Mensch gemeint, den man fast im selben Atemzug negativ (als »primitiv«, »schmutzig« etc.) oder positiv (als »unverbildet«, »seelenvoll« etc.) beschreiben konnte – und oft lag nur eine Nuance dazwischen. Weit oberhalb dieser stationären bäuerlichen Basis erstreckte sich eine Zivilisationsschicht, die fast völlig europäisiert und zu großen Teilen eben deutsch geprägt war. Das galt nicht nur für die vielfältigen, beinahe exklusiven verwandtschaftlichen Beziehungen, die es seit petrinischer Zeit zwischen einigen deutschen Fürstentümern und dem russischen Hof gegeben hatte; das betraf auch das bedeutende, zeitweise fast dominante deutsche Element im zaristischen Verwaltungsapparat, besonders im Militär oder bei der Polizei; es betraf ein weiträumig agierendes, oft prosperierendes russlanddeutsches Unternehmertum, das sich im Baltikum oder an der Wolga auf große, aktive städtische oder agrarische deutsche Siedlungskerne stützen konnte; und das betraf die vielen deutschen Wissenschaftler und Schulmeister, Ingenieure oder Agronomen an den Akademien, Schulen und Hochschulen oder in den Großunternehmen und Planungsbehörden des Zarenreichs. Diese Aufzählung ließe sich noch fortsetzen.
Dazu kam Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, was Thomas Mann damals als »das Wunder der russischen Literatur« rühmte. Russland entpuppte sich als eine »Kulturnation« allerersten Ranges, teils betont konservativen Zuschnitts, teils existenzialistisch revolutionär gestimmt, und formal als Avantgarde auf so ziemlich allen Gebieten der Literatur, der modernen Kunst, der Musik, des Theaters und so fort.
Andererseits war dieses Russische Reich am Beginn des 20. Jahrhunderts ein Land, das wegen der notorischen Unruhe in seinen modernen, städtischen Milieus, von der Intelligenz bis zu den Arbeitern, aber zunehmend auch unter seinen Bauern angesichts des überkommenen, starren zaristischen Machtsystems zu einer Revolution verurteilt schien. Diese Revolution figurierte, zumal nach den Erfahrungen des Ausbruchs von 1905, in den strategischen Erörterungen der deutschen Reichsleitung vor und im Ersten Welt krieg als eine Tatsache, mit der man mehr oder weniger rechnen konnte, wenn es sich darum handelte, dieses Vielvölkerreich durch seine kriegerische Überbeanspruchung in einen Zustand der »Dekomposition« zu treiben und es so aus der Front der Feinde herauszubrechen oder einer deutschen »Durchdringung« zu öffnen. Die Frage war nur, welche Akteure in einer solchen Revolutionierung und Zerlegung Russlands zum Zuge kommen würden. In diesen Zusammenhang gehörte die kaltblütige Förderung der Bolschewiki und vieler anderer russischer, ukrainischer oder georgischer Revolutionäre durch das kaiserliche Deutschland.
Am Ausgang des chaotischen Revolutionsjahrs 1917, nach der Machteroberung der Bolschewiki, zeigte sich das alte »Russland plötzlich verwandelt«, wie man mit einem Buchtitel Kischs sagen könnte, und die deutschen Dekompositions-Pläne schienen aufgegangen – und das selbst über die eigene Niederlage und die Fieberschübe einer Bolschewismusfurcht 1918/19 hinaus. Im russischen Bürgerkrieg und in der Abwehr westlicher Interventionen und Teilungspläne erstand der Moskauer Staat in neuer Form wieder auf, als eine um »Sowjetrussland« gruppierte neue Union. Im Zeichen einer gemeinsamen Frontstellung gegen das »Versailler Weltsystem« ergab sich in den 1920er-Jahren so ein vielschichtiges und doppelbödiges Spiel deutschrussischer Verbindungen. Der Rapallo-Vertrag von 1922 hatte unter seiner harmlosen Oberfläche eine deutlich strategisch-revisionistische Komponente, die sich etwa in der geheimen, sehr weitgehenden Militärzusammenarbeit ausdrückte. Zugleich gab es eine dicht befahrene Kulturschiene MoskauBerlin. Es gab große ökonomische Kooperations- und Erschließungsprojekte. Und es gab im Weimarer Deutschland eine regelrechte literarische Obsession mit dem alten und dem neuen Russland. Das wieder aufgerichtete Sowjetrussland war für das amputierte, in seinen Weltmachtambitionen zurückgestutzte Deutsche Reich noch immer und jetzt sogar noch mehr das Inbild eines großen, vielgestaltigen Territorialreichs, das potentiell (in welcher Weise auch immer) für die im Westen blockierte und gedemütigte Weimarer Republik einen Ausweg oder jedenfalls einen fast natürlichen Betätigungsraum zu bieten schien.
Die Hitlerschen Ostraumpläne waren eine direkte Umkehrung der vielfältigen »Ostorientierungen« dieser Zeit, wie sie gerade auch in deutschnationalen oder nationalrevolutionären Milieus grassierten; wobei mit dem »Osten« immer Russland gemeint war. In Mein Kampf gab Hitler daher explizit als die neue Losung aus: Statt »Ostorientierung« – »Ostpolitik«. Der junge Goebbels war wie vor den Kopf geschlagen, als Hitler aus dem Gefängnis kam und bei der Führertagung Anfang 1926 seine neue Doktrin verkündete: Mit Sowjetrussland könne man sich nicht verbünden, man müsse seinen Zerfall beschleunigen und sich im Zuge dessen »Lebensraum im Osten« sichern.
Zu dem zu arrondierenden und kolonial zu durchdringenden Ostraum rechnete Hitler an erster Stelle sicherlich (in den Spuren der ludendorffschen Ostpolitik) eine vom Moskauer »jüdisch-bolschewistischen« Zentrum sich lösende Ukraine; aber natürlich ging es immer auch um das Baltikum, um Polen, die Tschechoslowakei oder Rumänien. »Lebensraum im Osten« – von dem schon das erste, von Rosenberg verfasste NSDAP-Programm 1921 gesprochen hatte – hieß zunächst nur, dass Deutschland sich eine Einflussund Erweiterungszone im Osten schaffen müsse, bestehend aus Ländern, Gebieten oder Staaten, die in welcher Form immer dem Reich politisch und wirtschaftlich anzugliedern waren. Das konnten Verbündete, Klienten oder Vasallen sein. Es bedeutete nicht notwendig territoriale Expansion und Annexion, und erst recht bedeutete es nicht eine militärische Zerschlagung der gesamten Sowjetunion; das wäre 1925/26 auch eine reichlich vermessene Idee gewesen. Klar war nur, und damit bewegten die Nazis sich in einem relativ breiten Strom der Weimarer Politik und Publizistik, dass die Zukunft Deutschlands im weiten Osten der »jungen Völker« lag, und nicht im alten Westen, der nicht nur den Nazis dekadent, »verniggert« und »verjudet« erschien.
Eine Politik des »Lebensraums im Osten« konnte man hypothetisch auch in einer losen Allianz oder Koordinierung mit Sowjetrussland verfolgen, als dem anderen großen Gegner der Versailler Weltordnung. So dachte ja ein großer Teil der Reichswehrführer, wenn sie in ihren Kamingesprächen mit der Führung der Roten Armee eine Zerschlagung Polens ventilierten; so dachte ein Gutteil der nationalistischen Intelligenz, etwa im fluktuierenden Feld der Gruppen und Organe der »Konservativen Revolution«; und so dachte eben auch ein Gutteil der Nationalsozialisten selbst, wie der linke NS-Flügel um die Strasser-Brüder oder eben den jungen Goebbels, der, als er von Hitlers neuer Doktrin hörte, fassungslos in sein Tagebuch schrieb: Wir – gegen Russland?!
Aber selbst in Alfred Rosenbergs Mythus des 20. Jahrhunderts, der 1930 herauskam, ist ein rotes »Moskowien« perspektivisch noch immer Teil des geopolitischen Spiels, und keineswegs notwendig ein Feind Deutschlands – sofern es eben gelänge, den expansiven Bolschewismus von Westen nach Osten, nach Asien umzulenken, wohin er eigentlich gehörte und wo er sogar große Aufgaben hätte; während Mittelosteuropa vom Baltikum (Rosenbergs Heimat) abwärts bis zur Ukraine in der einen oder anderen Form als Betätigungsfeld und Lebensraum eines nationalsozialistischen Deutschlands designiert war. So lautete in etwa die strategische Generallinie anno 1930, im Moment des Aufstiegs der Hitler-Bewegung.
Tatsächlich war von einer Zerschlagung der Sowjetunion in Hitlers Propaganda vor der Machteroberung kaum die Rede, so auch nicht in seiner Programmrede vor deutschen Schwerindustriellen im Düsseldorfer RheinRuhr-Klub 1932, für die die stalinschen Fünfjahrpläne ja eher ein Rettungsanker in der Weltwirtschaftskrise waren. Von der in Mein Kampf zentral stehenden Hypothese, dass das »große Reich im Osten« wegen seiner jüdischen Beherrscher dem Zerfall geweiht sei, war jetzt keine Rede mehr. Eher firmierte die rapide sich industrialisierende Sowjetunion Josef Stalins als ein stählerner Moloch, der Deutschland und Europa bedrohen könne, vor allem von innen her, nämlich über die Kommunistischen Parteien. Vom »jüdischen Bolschewismus« war mit keinem Wort die Rede; und überhaupt wurde dieser Topos angesichts der Agitation der Stalinisten gegen »Judas Trotzki« und die Trotzkisten nur noch viel seltener und verhaltener gebraucht. Die zentrale These der NS-Propaganda lautete stattdessen: die Versailler Mächte und der Weltkapitalismus wollen uns finanziell aussaugen, wehrlos halten und kulturell überfremden, und das bolschewistische Moskau will uns mittels der von dort gesteuerten Kommunisten (auch wenn die seit 1930 ihrerseits äußerst nationalistisch auftraten) scheinbar stützen, in Wirklichkeit aber unterminieren.
Die Machteroberung Hitlers bedeutete anfangs noch keinen Bruch mit der Sowjetunion; man brauchte sie noch als Gegengewicht. Erst ab 1934/35 schwenkte die deutsche Politik abrupt auf eine Linie und Rhetorik um, worin das nationalsozialistische Deutsche Reich (mit durchsichtigen taktischen Absichten) sich gegenüber den Westmächten, aber auch den autoritären Regimes in Mittelosteuropa, als ein Bollwerk gegen den Bolschewismus präsentierte – das deshalb in einem Akt der Notwehr legitimiert sei, die Fesseln von Versailles abzustreifen. Als das 1935 im Wesentlichen gelungen war und als mit dem Anschluss Österreichs und dem Münchener Abkommen 1938 sogar die kühnsten großdeutschen Territorialziele erreicht waren, da begann die NS-Führung unter der Hand wieder die ältere, an sich ja bewährte Option einer Politik mit Sowjetrussland auszuloten. Die »AntiKomintern«, ohnehin kaum mehr als eine Abteilung im Propagandaministerium, wurde schon im Winter 1938/39 in aller Stille beerdigt.
Die Sowjetunion ihrerseits hatte ungeachtet aller Antifa-Rhetoriken und Volksfront-Strategien nie aufgehört, um die Wiederherstellung der früheren, stillen Bündnisbeziehung mit Deutschland zu werben. So gab es zwischen 1935 und 1938 eine Reihe von Sondierungen und diskreten Angeboten. Die Inhaftierung und Ermordung des Gros der deutschen Emigranten im Großen Terror tat ein Übriges, um den Weg frei zu machen. Gleich nach München ließ Stalin die Antifa-Propaganda jedenfalls deutlich zurückfahren, während er gleichzeitig sehr aufmerksam das Ansteigen der Spannungen zwischen Hitler-Deutschland und den Westmächten nach der Pogromnacht des 9. November 1938 registrierte. Schon im Februar 1939 schob er dem Rüstungskommissar Kaganowitsch bei der Sitzung des Politbüros einen Zettel über den Tisch: Was könnten die Deutschen uns liefern? Der Pakt vom August 1939 bahnte sich über diskrete Wirtschaftsverhandlungen an; und dabei ging es von vornherein um kriegswichtige Güter, die man keinem potentiellen Gegner liefert.
Anfang September – nach dem deutschen Überfall auf Polen – bemerkte Stalin in einer seiner Instruktionsstunden gegenüber Dimitrov als dem nominellen Führer der Komintern: Hitler leistet uns gute Dienste bei der Zerschlagung des Weltkapitals; und dabei werden wir ihn vorerst unterstützen. Das ging über rein taktische Erwägungen weit hinaus. Die Sowjetunion selbst profitierte von dem Teilungspakt ja auf riesigem Terrain und führte ihre eigenen, parallelen Kriege und blutigen Säuberungen im Westen wie im Fernen Osten. Allerdings war Hitler dann etwas zu erfolgreich, als er Frankreich und halb Europa im Handstreich überrannte. Dennoch gab es von sowjetischer Seite jedenfalls keine Absage, als Ende 1940 die Japaner zu einem Viererpakt gegen die Westmächte einluden. Es war vielmehr Hitler, der das gar nicht in Erwägung zog und seine strategischen Linien schon neu zog. Stalin dagegen konnte sich einfach nicht vorstellen, dass der Mann so dumm sein könnte, sich – während er den Krieg gegen das britische Empire nicht zur Entscheidung bringen konnte – schon gegen ihn, gegen die Sowjetunion zu wenden. Selbst als die Spatzen es von den Dächern pfiffen, dass die deutsche Armee in Polen aufmarschierte, und als seine Marschälle Stalin sagten: Wir müssen etwas tun, drohte er ihnen: Wenn ihr einen Finger rührt, werdet ihr einen Kopf kürzer gemacht.
Daher rührt diese ganze jüngere Präventivkriegsdebatte. Dabei würde ich fast sagen: Hätten sie es doch bloß getan! Hätten sie doch präventiv zugeschlagen und diesen Aufmarsch zerschlagen! Aber das durften sie nicht. Stalin stand bis zuletzt im Bann der fixen Idee, die Briten wollten ihn zum Krieg mit Deutschland treiben, während sie selbst die Sowjetunion einkreisten. So schmierte und nährte die Sowjetunion die deutsche Kriegsmaschine bis zur allerletzten Minute weiterhin mit lebenswichtigen Gütern: mit Getreide, mit Öl und mit Nickel. Deutschland war vor der Eroberung von Narvik von allen Nickelvorkommen abgeschnitten; und Nickel braucht man, um Geschosse zu bauen. Die Sowjetunion kaufte sogar auf dem Weltmarkt Kautschuk für die motorisierte deutsche Kriegsmaschine ein, die im Juni 1941 dann über sie herfiel. Diese Politik Stalins war eine Mischung aus Appeasement und vermeintlich schlauer Berechnung, genährt von der Hoffnung, die deutsche Kriegsmaschine werde sich erst einmal in das britische Imperium verbeißen und beim Versuch, die britische Insel selbst einzunehmen, erschöpfen. Das alles sind Seiten einer Gesamtkonstellation, die nicht in jeder Hinsicht ausgeleuchtet und ausinterpretiert ist.
Das gilt für die Politik der deutschen Seite aber genauso. Es war schon erstaunlich, wie es nach dem Abschluss des Paktes im August 1939 plötzlich nicht nur keine ideologischen Differenzen von Nationalsozialismus und Bolschewismus mehr gab, sondern mit welcher Intensität die alte kulturelle Verbundenheit zwischen Deutschland und Russland auch in der NS-Presse beschworen wurde. Schauen Sie sich die Literatur an, die 1939/40 in Deutschland über Russland erschien. Da ging es um die »deutschen Zaren« (Peter und Katharina), um die vielseitige, sowohl künstlerische als auch bodenständige russische Kultur, um die alte Verbindung von Prussia et Russia, um den Geist von Tauroggen und so weiter. Bis im Juni 1941 Goebbels dann in sein Tagebuch schrieb: Jetzt müssen wir die antibolschewistische Walze wieder auflegen. Die jungen Männer, die in einem abrupten Renversement der Allianzen jetzt in die Tiefen des russischen Raumes bis nach Moskau marschieren sollten, mussten dafür schließlich scharfgemacht werden.
Mich interessieren vor allem diese, oft ganz raschen und scheinbar paradoxen Wechsel und Dynamiken der politisch-militärischen Entwicklungen, denen die ideologischen und mentalen Prozesse zwangsläufig folgen (mussten). Auch ein Heinrich Böll zum Beispiel musste sich als junger Wehrmachtssoldat gegen alle seine literarischen Vorprägungen und menschlichen Regungen undurchlässig und unempfindlich machen, um diesen Ostkrieg psychisch durchzustehen. Oder nehmen Sie die fehlinterpretierten Bilder der Wehrmachtsausstellung, die ganz unmittelbar zu diesen psychopolitischen Konditionierungen hinführen: Wie konnte man die jungen Soldaten, die man in die Schlachten warf, am Besten scharfmachen? Indem man sie zum Beispiel an den verstümmelten Leichen der Exekutierten des NKWD vorbeiführte und ihnen erklärte: Seht ihr! So haust die jüdisch-bolschewistische Bestie, wenn sie entfesselt ist, und ab jetzt gibt es kein Pardon mehr.
Ich habe mich immer gefragt, ob diese Wehrmachtsoldaten noch mit ihrem Dostojewski oder Tolstoi im Gepäck marschierten, der in Deutschland so intensiv gelesen worden war wie nirgends sonst auf der Welt? Ich denke hier zum Beispiel an meinen Onkel, der ein glühender Nationalsozialist war und als Arzt in Stalingrad verwundet wurde, wundersamer Weise überlebt hat (auch mit Hilfe russischer Ärzte), 1953 als Spätheimkehrer aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft kam – und bei dem nach dem Krieg dann die ganze alte und neue russische Literatur im Regal stand, während die Leute ihn als Landarzt »den Russendoktor« nannten. Krieg und Gefangenschaft sind eben auch eine Art, sich kennenzulernen. Für ihn war das alles ein Überlebensepos, und seine Schlussfolgerung daraus war, dass die Bolschewisten gefährlich waren und abgewehrt werden mussten; aber mit den »einfachen Russen« und auch manchen Gebildeten, russischen Ärzten zum Beispiel, konnte man sehr gut zurechtkommen, im Gegenteil, die hatten sogar viele positive Eigenschaften bewahrt, die uns westlich-überzivilisierten Menschen abgingen. So konnten sich manche seiner frühen nationalsozialistischen Prägungen in eine ganz andere, tendenziell gegenläufige Richtung drehen.
Ich möchte noch einmal einen Gedanken entwickeln, der mir schon bei der Lektüre der Bloodlands und noch einmal bei dem, was Timothy Snyder hier vorgetragen hat, gekommen ist: Wie und warum hat sich in den 1960/70erJahren »Auschwitz« als zentrale Metapher für den Holocaust, und in mancher Hinsicht sogar für die nationalsozialistische Vernichtungspolitik insgesamt, so durchgängig eingebürgert? Snyder hat plausibel dargelegt, wie die Auschwitz-Erzählung zu einer jüdischen und zugleich einer europäischen Rettungsgeschichte geworden ist. Und in diese Geschichte gehört dann eben auch die Rote Armee, die Auschwitz befreit hat, und also zur Rettung der Zivilisation beigetragen hat.
Meines Erachtens hat auf deutscher Seite für die psychische Ausblendung oder die notorische Ahnungslosigkeit, die viele der deutschen Massenverbrechen im Osten bis heute umgibt, so die mörderische Besatzungspolitik in Polen oder das erste Kapitel des Holocaust, Babij Jar und die Massenerschießungen überall auf sowjetischem Territorium, eine große Rolle gespielt, dass gerade diese Dinge den deutschen Soldaten (Unsere Väter, unsere Mütter) am wenigsten entgangen sein konnten. Auch meine Mutter hat in dem unter Bomben liegenden Ruhrgebiet durch ihr ukrainisches Hausmädchen – die gab es ja in vielen deutschen Haushalten – vieles von dem mitbekommen, was sich dort abspielte, wenn das Mädchen ihr etwa erzählte: Bei uns zu Hause in Charkow wird mit den Juden und Bolschewisten aufgeräumt. Das hatte sie offenbar aus Briefen erfahren, die sie von zu Hause erhielt. Die sowjetische Kollektivierung hatte sie als katastrophische Zeit erlebt; und auch darüber hat sie meiner Mutter erzählt. Für sie dürfte dieser wohlgepflegte deutsche Haushalt, in dem sie Hausmädchen war (unklar, wie freiwillig oder erzwungen), auch eine Rettungsinsel gewesen sein. Sie konnte Pakete nach Hause schicken, und vermutlich glaubte sie, auf Einverständnis zu treffen, wenn sie über all das berichtete. Meine Mutter sagte mir, dass sie das alles gar nicht habe hören und ertragen können, während ihr jüngerer Bruder vor Leningrad lag (oder schon gefallen war), und der ältere in Stalingrad eingeschlossen, dann verschollen war. Musste sich das, was da im Osten passierte, nicht irgendwann rächen? Und war gerade das nicht ein Argument, immer weiter machen zu müssen?
Die explizite oder implizite »Bindung im Verbrechen«, wie ich diesen Konnex einmal bezeichnet habe, war vermutlich eins der Geheimnisse des fatalistischen oder auch fanatischen Durchhaltens der Deutschen; aber gleich nach der Kapitulation dann auch ihrer vielfachen chamäleonhaften Anpassung und Häutung. Alliierte Reporter, die ihren Truppen 1945 auf dem Fuß folgten, aber auch Emigranten wie Hannah Arendt bei ihrem Deutschlandbesuch im Jahr 1950, stellten frappiert fest, dass es anscheinend nirgends Nazis gab oder je gegeben hatte. Keiner wollte es gewesen sein; alle wuschen die Hände in Unschuld; das alles war über sie gekommen. »Wie hat man uns betrogen«, schrieb auch mein Onkel aus dem russischen Gefangenenlager in einem seiner ersten Lebenszeichen nach dem Krieg.
Worauf ich hinauswill: Mir scheint, dass alle diese psychologischen Konstellationen und Erfahrungsschichten sich später um das »Auschwitz«-Narrativ herum aggregieren konnten. Indem die deutsche Verantwortung für diesen ungeheuren Eroberungs- und Versklavungskrieg und für die unzähligen deutschen Kriegs- und Massenverbrechen im Osten sich im »Holocaust« zusammenfassten, und dieser sich wiederum metaphorisch in »Auschwitz« lokalisierte, gerann alles zu einem stereotypen Bild und zu einer festen Formel, wurde alles Geschehene, so absurd man das finden mag, viel kommensurabler, und ließ diese ganze heillose Vergangenheit sich sehr viel besser »bewältigen« (wie dieser sprechende deutsche Ausdruck besagt), psychisch, intellektuell und praktisch.
Dass es die sowjetische Armee war, die Auschwitz befreit hat, ließ sich in dieses Bild gut integrieren. Im Kern waren das eben immer noch die Russen, so wie es auch ein »Russlandfeldzug« gewesen war, der 1945 zu seinem Ende kam und aus deutscher Perspektive das eigentliche, große Epos dieses Weltkriegs gebildet hat – im Unterschied zum alliierten Bombenkrieg, der viel niederträchtiger war, weil er doch nur die Zivilbevölkerung traf, während der Krieg im Osten eben ein richtiger Krieg war. Selbst das abschließende Wort Hitlers, wonach »dem stärkeren Ostvolk jetzt die Zukunft gehört«, da die Deutschen sich als unfähig erwiesen hatten, ein Herrenvolk zu sein – diese (nicht nur) von Albert Speer überlieferte letzte Message bringt das zum Ausdruck. Und selbst wenn sie nicht stimmt, ist sie so – als eine Art heidnisches Gottesurteil der Geschichte – weithin aufgenommen und gespeichert worden, oder sie entsprach sogar einem instinktiven Gefühl vieler, fast aller.
Dieses »stärkere Ostvolk«, die »Soffjets« (wie Adenauer sie nannte), musste man sich – ich rede von der alten Bundesrepublik – zwar mit Hilfe der Amerikaner unbedingt vom Halse halten; aber letzten Endes würde man mit ihnen doch zu irgendeinem großen Ausgleich kommen müssen, wie nicht nur Willy Brandt oder Egon Bahr, sondern auch Franz-Josef Strauß oder Helmut Kohl immer gedacht haben. Und so war dann die deutsche »Gorbymanie« vierzig Jahre nach dem Weltkrieg noch einmal ein sympathisches, aber auch hoch illusionäres Revival einer alt überkommenen deutschen Russomanie (nicht Russophilie wohlgemerkt) – an deren frühere Intensitäten und Ambivalenzen, am stärksten wohl in der Periode von 1900–1930, die Deutschen sich nach Stalingrad und nach Auschwitz, nach Berlin 1945 und 1961, und heute in der Ära Putins, nur noch ganz von Ferne erinnern. Auch das ist freilich ein Stück deutscher Geschichtsvergessenheit inmitten des Dauerbeschusses der »History«-Channels.
Wir sprechen hier über historische Narrative als symbolische Räume und Orientierungen. Wie Karol Sauerland richtig gesagt hat, war »Auschwitz« natürlich auch ein zentrales polnisches Narrativ. Damit wären wir also bei dem, was Timothy Snyder über die Erinnerungen und Geschichtspolitiken der »Nationalisierer« gesagt hat.
Was das angeht, konnten die polnischen Kommunisten vor 1989, scheint mir, eine gar nicht so unplausible Mitte zwischen beiden Diskursen, dem sowjetisch internationalen und dem polnisch nationalen, finden. So entwickelte der offizielle Museumsführer von 1970, den ich besitze, eine durchaus geschlossene Erzählung über Auschwitz als einen Ort polnischer Selbstbehauptung und als Inbegriff des Vernichtungswillens des deutschen Imperialismus, der weiter drohte. Das Gespenst eines deutschen Revanchismus wurde schließlich als Bindemittel des polnischen Nachkriegsstaats wie seines unverbrüchlichen Bündnisses mit der Sowjetunion und den anderen Völkern Osteuropas dringend benötigt. Gerade Auschwitz eignete sich dafür, eben weil von seinem Lagerkomplex so viel übrig war, als der prädestinierte Gedenkort eines gemeinsamen Martyriums aller vom Nationalsozialismus angegriffenen und unterworfenen Völker des östlichen wie des westlichen Europa und damit eines Schicksals, das die Polen nur als erste getroffen hatte. Auch das war eine machtvolle, in sich geschlossene Erzählung, in der sich der Holocaust durchaus unterbringen ließ, nämlich als ein Teil des nationalsozialistischen Massenmords an polnischen oder sowjetischen »Staatsbürgern«. Warum die jüdischen Leiden in einem solchen Meer allgemeiner Leiden hervorheben? Das hatte seine eigenen Schlüssigkeiten.
Dem steht die Geschichte eines deutschen und eines jüdischen Auschwitz-Tourismus gegenüber, der auf vollkommen konträre, aus polnischer Sicht aber auch komplementäre Weise den einen als Pilgerfahrt, den anderen als »Sühnezeichen« diente. Vor allem in der Zeit des Kriegsrechts der 1980er-Jahre war es ein wiederkehrendes Thema in Gesprächen mit polnischen Bekannten, und ein Punkt tiefer Erbitterung: nämlich dass die Deutschen wie auch die Juden exklusiv in »ihr Auschwitz« wie an einen mythischen, exterritorialen Ort reisten, unter bereitwilliger Ausblendung all dessen, was um sie herum gerade passierte; und ohne auch nur annähernd zu verstehen, in welchem Verhältnis das vor allem von Polen bevölkerte »Stammlager«, in dem sich auch das Museum befindet, und das davon getrennte, tatsächlich fast exterritoriale Vernichtungslager Birkenau, also »ihr Auschwitz«, eigentlich zusammengehörten.
In dieses Bild passt auch der Verlauf des deutschen Historikerstreits in den späten 1980er-Jahren, zu dessen Hauptergebnissen es gehörte, dass Jürgen Habermas’ Satz sich mehr oder weniger autoritativ etablierte: nämlich dass der deutsche Nachkriegsstaat im Tiefsten auf Auschwitz gegründet sei. Joschka Fischer hat als Vizekanzler und grüner Außenminister später ex officio diese Formel mehrfach wiederholt und zur ethisch-politischen Grundlage einer deutschen Politik der Menschenrechte und Demokratie erklärt, und vor allem auch einer »besonderen Verpflichtung« der Bundesrepublik gegenüber Israel. Abgesehen davon, dass selbst für Israel nur sehr eingeschränkt zutrifft, dass es »auf Auschwitz gegründet« wäre – für die Bundesrepublik Deutschland ist das eine vollkommen abstrakte, kaum in politische Termini übersetzbare, zugleich aber auch äußerst anmaßende Selbstdeklaration.
Ich würde stattdessen sagen: Es war zunächst einmal die Totalität der Niederlage 1945, die das sichere Fundament geliefert hat, auf dem jeder deutsche Nachkriegsstaat sich neu zu begründen hatte. Deutschland hatte sich die ganze Welt zum Feind gemacht und die totalste aller Niederlagen erlitten – und danach war dann endlich Ruhe im Karton. Noch einmal vom Dolchstoß zu orakeln wie 1918 oder auf irgendeinen neuen Griff nach Weltmacht zu sinnen, war ein für allemal gegenstandslos geworden. Das zweite factum brutum war ab 1948 dann die neue Weltteilung und die Rolle der beiden Deutschländer als Frontstaaten im Kalten Krieg, was ihnen einerseits wenig eigene Spielräume ließ, andererseits ihr Gewicht innerhalb der beiden, um sie herum konstruierten Bündnissysteme aber umso mehr erhöhte. In diesem Weltzustand haben sich zumindest die Westdeutschen materiell wie mental ganz komfortabel eingerichtet. Und zu diesem psychischen Komfort gehörte, etwas zynisch gesagt, auch, sich von der historischen Konkursmasse des verflossenen Reiches klar abzunabeln und das Universum der deutschen Kriegs- und Verbrechensgeschichte des Weltkriegszeitalters in den »Auschwitz«-Topos zurückzufalten.
Für die Bürger der Sowjetunion bedeutete der Vaterländische Krieg mit seinen unfassbaren Menschenopfern und dann der siegreiche Ausgang dieses Kriegs eine machtvolle Überformung aller vorangegangenen Leidenserfahrungen. Für viele war dieser historische Sieg ein Medium oder Agentium nachträglicher Sinnstiftung oder moralischer Kompensation, sogar für viele der überlebenden Opfer des Stalinismus oder ihre Angehörigen. Das wird im russischen Herzland sicherlich anders verteilt gewesen sein als zum Beispiel in der Ukraine oder unter den Nationalitäten, die vor oder im Krieg als potentielle Agenturen des Feindes mit Terror überzogen oder deportiert worden waren. Auch zwischen Russen und Nichtrussen gibt es vermutlich eine »geteilte Erinnerung«.
Aber das zentrale psychologische Faktum bleibt: dass angesichts des Versklavungs- und Vernichtungskriegs Hitlers für einen großen Teil der Sowjetbürger die Crash-Industrialisierung der 1930er-Jahre in ihrer Verbindung mit der Kollektivierung und der Hungerkatastrophe, und selbst mit den Menschenopfern des »großen Terrors«, sich auf irgendeine Weise im Nachhinein als Akte einer vorausschauenden Politik Stalins darstellten. So falsch und so vollkommen unlogisch das auch war und ist – so »psycho-logisch« nachvollziehbar ist es eben auch. Liest man etwa Swetlana Alexijewitschs Secondhand-Zeit mit diesem ungeheuren Wirrwarr von Stimmen, die sich in ihre tief vergrabenen Erinnerungen und zugleich in die widersprüchlichsten Behauptungen und Erklärungen verwickeln – dann gibt es darin nichts Beherrschenderes als die Erfahrung dieses lange vergangenen, existenziellen Krieges. Und selbst Menschen, die im Großen Terror grundlos verhaftet, gefoltert und aus der Bahn geworfen worden sind, oder die Kinder von Ermordeten können dann zum Beispiel plötzlich sagen: Eigentlich bräuchten wir wieder einen Stalin; Russland zerfällt, und diese geopolitische Katastrophe macht alles zunichte, wofür wir gekämpft und gelitten haben ... Gerade bei diesen Stimmen kann man am klarsten sehen, wie der Vaterländische Krieg als eine nachträgliche Sinnstiftung und als ein Rettungs- und sogar Versöhnungsnarrativ fungiert – Versöhnung auch mit den eigenen zerstörten Biographien und Lebenserwartungen.
Eine letzte Bemerkung noch zu den generationellen Aspekten der Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte in der Bundesrepublik, in der der 68er-Diskurs sich ja in vielem durchgesetzt hat und mehr oder weniger hegemonial geworden ist. Der »Historikerstreit« gehört in gewisser Weise auch dazu; und seither die rituelle Rede vom »Zivilisationsbruch«, der sich in Auschwitz manifestiert habe. Was natürlich in keiner Weise falsch ist, nur in vieler Hinsicht verkürzt.
Ich komme noch einmal auf meinen früheren Punkt zurück: Der vom nationalsozialistischen Deutschland 1939 entfesselte Aggressionskrieg, Eroberungs- und Versklavungskrieg als solcher ist schon ein ungeheures Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewesen, das in Nürnberg durchaus zu Recht der erste und wichtigste Anklagepunkt gewesen ist. Damit mussten wir als die erste deutsche Nachkriegsgeneration zurechtkommen, und im Schatten und im Bann dieser Geschehnisse sind wir aufgewachsen. Die große Historikerdebatte der frühen 1960er-Jahre handelte im Übrigen ja, wie man sich erinnert, von der deutschen Schuld am Ersten Weltkrieg. Also das auch noch!
Das war aber genau zu derselben Zeit, in der die Bilder aus den Vernichtungslagern erst wirklich ins allgemeine Bewusstsein traten, nicht zuletzt durch den Jerusalemer Eichmann-Prozess 1961 und den Auschwitz-Prozess in Frankfurt 1963. Wir als Nachgeborene mussten uns das alles ja irgendwie psychisch kommensurabel machen. Und dabei ist unsere Generation ziemlich verschlungene Wege gegangen.
Das entsprechende Kapitel meines Buchs Das rote Jahrzehnt hatte ich überschrieben: »Felix Culpa«. Leider hat das niemand aufgenommen, obwohl dieser Titel immerhin auf eine Bemerkung von Hannah Arendt zurückging, die sehr spitz und präzise war; nämlich in einem Brief à propos von Hans Magnus Enzensbergers »Betrachtungen vor einem Glaskasten«, einem Essay über den Eichmann-Prozess. Darin sagte Enzensberger: Die Eichmänner von heute sind die Strategen der atomaren Vernichtung in Washington, aber wir merken das nicht, sondern schauen auf diesen Jerusalemer Glaskasten ... Daraufhin schrieb Hannah Arendt an einen Zeitschriftenredakteur: »Oh felix culpa! Wie kommt der junge Herr Enzensberger sich großartig vor, wenn er die hypothetischen atomaren Vernichtungsszenarien beschwört – und sie dem tatsächlich stattgefundenen Judenmord von damals gegenüberstellt!« Wohlgemerkt, diese Zeilen sandte sie nicht an Enzensberger selbst, sondern sagte ihm sozusagen in indirekter Ansprache, stellvertretend für die deutsche Nachkriegsgeneration: Ich werfe Ihnen ja nicht vor, dass Sie die deutschen Verbrechen relativieren und verkleinern möchten, nein, Sie erkennen sie durchaus an. Aber müssen Sie sich dafür auch noch eine Feder an den Hut stecken?
Unter dieser Perspektive einer »Felix culpa« habe ich also mein Kapitel über die Bewältigung der deutschen Geschichte in meiner Generation, auch an meinem eigenen Fall, zu dechiffrieren versucht. »Auschwitz« diente darin vor allem als universelles Argument einer moralisch-politischen Delegitimierung der Eltern-, aber auch der gesamten älteren Generation, gleich welche Rolle sie im Dritten Reich tatsächlich gespielt hatten. Genährt war das natürlich auch aus eigenen, robusten generationellen Ambitionen, mit durchaus elitären Zügen. Man selbst war als »Nachgeborener« (im Sinne Brechts) diesmal jedenfalls ganz und gar auf der richtigen Seite und insoweit moralisch saniert, eine Art »reborn German«, wie man maliziös sagen könnte. Daraus folgte dann eine enorme moralisch-politische Selbsterhöhung und Selbstermächtigung, die man in ihren Extremen bis hin zum mind-set der RAF und der anderen terroristischen Gruppen durchbuchstabieren kann: Wenn »sie« (die Herrschenden) so etwas »wie Auschwitz« veranstalten konnten – was sollte uns dann nicht erlaubt sein?!
In abgemilderter Form einer recht komfortablen moralischen Selbsterhöhung zieht sich dieses Syndrom einer »Felix Culpa« bis heute durch, wie ich behaupten möchte, und hat sich von den »68ern« auf das Gros der bundesdeutschen Gesellschaft übertragen, spätestens mit der präsidialen Ansprache Richard von Weizsäckers 1990, nicht zufällig im Moment der deutschen Vereinigung. Dabei geht es mir gewiss nicht darum, dieses Syndrom einer »Felix Culpa« zu denunzieren – allerdings immer noch darum, es genauer zu beschreiben.
Was soll man, um ein allerjüngstes Beispiel zu zitieren, von dem mit riesigem Aufwand und prominenter wissenschaftlicher Begleitung produzierten, mit großer publizistischer Begleitmusik präsentierten Fernseh-Dreiteiler Unsere Väter, unsere Mütter halten – einer didaktisch und exemplarisch verstandenen Geschichte, in der nahezu nichts stimmt und deren atemverschlagende Ignoranz dann doch einigermaßen verstörend ist? Noch verstörender ist allerdings, dass das offenbar kaum jemandem aufgefallen ist, sondern dass diese Produktion von vielen prominenten Feuilletonstimmen aufs Lebhafteste akklamiert wurde.
Dabei, was soll man eigentlich verlogener an dieser Story finden: diese reihum verliebte deutsch-jüdische Swingjugendgruppe in Berlin Anno 1941; die junge Sängerin, die sich für ihren jüdischen Freund (na gut, ein bisschen auch für ihre eigene Karriere) einer SS-Charge hingibt; den steifen, eifrigpflichtbewussten Jungoffizier, der am Ende aller Schlachten seinen Vorgesetzten erschießt, desertiert und als Waldrusse an einem See sitzend von Feldgendarmen aufgegriffen und exekutiert wird; während sein sensibler, den Krieg hassender jüngerer Bruder sich in eine berserkerhafte Tötungsmaschine verwandelt, aber dafür wenigstens seinen jüdischen Freund rettet, indem er ebenfalls einen SS-Offizier erschießt, der diesen jüdischen Freund gerade festgenommen hat; kurz nachdem dieser seinen polnischen Mitpartisanen entronnen ist, die ihn ihrerseits beinahe umgelegt und jedenfalls verstoßen haben, weil er aus einem überfallenen Zug jüdische Häftlinge, die in voller Sträflingsmontur nach Auschwitz verschickt werden sollten, befreit hat, während die Polen sie nur zu gerne ihrem Schicksal überlassen hätten. Ach ja, und dann ist da noch die fünfte aus dem Bunde der verliebten Swingjugendgruppe, die im deutschen Feldlazarett in Russland eine als Krankenschwester getarnte jüdisch-sowjetische Ärztin erst freundlich anspricht, dann jedoch denunziert; nur um im Frühjahr 1945 eben von dieser, nunmehr als illustre Sowjetkommissarin auftretenden Jüdin vor der obligaten Vergewaltigung durch die betrunkenen Rotarmisten mit der Pistole gerettet zu werden. Und so treffen die drei Überlebenden (zwei Frauen und der Jude) sich dann wieder in ihrem alten Café an der Ecke, genau wie sie es sich 1941 geschworen hatten, und das Leben geht weiter.
Kein Klischee ist ausgelassen, kaum irgendein Detail stimmt oder ist auch nur plausibel; und das nach jahrzehntelangen Debatten und Forschungen, tausenden von Büchern und Artikeln, Schullektionen und Aufklärungsfilmen, präsidialen Ansprachen und einer scheinbar schonungslosen Bereitschaft zur Aufklärung und Selbstkritik! Das ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, in welchem Grade die erinnernde »Bewältigung« all dessen, was Timothy Snyder als eine Geschichte der »Bloodlands« beschrieben hat, nur partiell von vorhandenem Wissen bestimmt, in vielem dagegen noch immer von mächtigen Impulsen einer versöhnenden Selbstidentifikation diktiert wird, die am Ende – willentlich oder unwillentlich – auf eine paradoxe moralische Selbsterhöhung hinausläuft.
Anmerkungen aus polnischer Sicht
Das, was ich sage, ist nicht als nationale Sicht gemeint, sondern als ein Beispiel, das die beiden Staaten betrifft, die Polen überfallen haben, also Deutschland und die Sowjetunion. Als ich mein Buch Polen und Juden verfasste, habe ich ganz bewusst mit dem September 1939 begonnen. Ich wollte die Diskussion über den polnischen Antisemitismus vor Kriegsbeginn nicht berühren, denn mit dem 1. September 1939 wurde eine völlig neue Situation geschaffen. Innerhalb kurzer Zeit wurde Polen von den beiden großen Nachbarn als Staat völlig zerstört. Als die Rote Armee am 17. September in Ostpolen einmarschierte, floh die gesamte polnische Regierung nach Rumänien, wo sie erst einmal interniert wurde, sie konnte sich dann aber nach Frankreich begeben. Später gründete sie in London eine Exilregierung. Die Bevölkerung in Polen war plötzlich herrenlos, nachdem der polnische Staat mit Mühe zwischen 1918 und 1939 wiedererrichtet worden war. Innerhalb von zwanzig Jahren waren die drei Teile zu einem vereint worden.
Ich habe in den Neunzigerjahren in einer Monatsschrift einmal darauf verwiesen, dass die Deutschen sich in einer viel günstigeren Lage befinden als einst die Polen. Sie mussten nur zwei Teile zusammenfügen, nicht drei. Polen unterstand bekanntlich innerhalb von hundert Jahren drei verschiedenen Administrationen, drei unterschiedlichen Gesetzgebungen: der preußischen, der österreichischen und der russischen. Das alles musste durch Neues ersetzt werden. Im Grunde genommen war der Aufbau Polens, der Zweiten Republik, in nur zwei Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte, wobei man nicht vergessen darf, dass es sich um einen Vielvölkerstaat handelte. Zu den vielen Völkern gehörten auch die Juden mit einer eigenen Sprache, dem Jiddischen, das, hätte es nicht den Holocaust gegeben, sich in eine Kultursprache verwandelt hätte. In den Zwanziger- und Dreißigerjahren gab es nicht nur zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften, die in Jiddisch erschienen, sondern man begann auch wissenschaftliche Werke in dieser Sprache zu veröffentlichen. Ohne den Holocaust gäbe es heute in Polen eine große eigenständige jiddische Kultur mit etwa zwei Millionen jiddisch sprechenden Menschen.
In der Zweiten Republik wäre es nie zu einem Jedwabne gekommen, als die polnischen Bewohner dieses Ortes ihre jüdischen Nachbarn erschlugen. Es geschah fast drei Wochen nach dem Einmarsch der Deutschen, Anfang Juli 1941. Jedwabne war 1939 sowjetisch besetzt worden – die Sowjets verwandelten das eroberte Ostpolen mit Windeseile in ein Gebiet der Kolchosen und Staatsbetriebe. Zu gleicher Zeit hatten die Deutschen in Windeseile die Juden von den Nicht-Juden im besetzten Gebiet getrennt. Bereits am 1. Dezember 1939 mussten alle Juden im Generalgouvernement den Davidstern tragen. Im Reich erfolgte die Kennzeichnung im September 1941, nachdem am 8. März 1941 das »P« für Pole eingeführt worden war. In den besetzten Ländern Westeuropas trat die Bestimmung für Juden, einen Davidstern zu tragen, erst ab April beziehungsweise Mai 1942 in Kraft. Am 1. Dezember 1939 waren dagegen kaum zwei Monate Besatzung vergangen. Auch Jüngere wissen, was Besatzung heißt, sie haben es am Beispiel vom Irak erfahren können.
Diese Wucht, mit der ein Staat zerstört wurde, ist fast unfassbar.
Im Herbst 1940 wurde das Warschauer Ghetto eingerichtet. 130 000 Warschauer wechselten – jüdische wie auch polnische Warschauer – die Wohnungen. Es gibt hierzu eindrucksvolle filmische Aufnahmen in Wochenschauen: Da ziehen die Pferdewagen mit den Möbeln hin und her. In der gleichen Zeit deportieren die Sowjets Hunderttausende von Menschen von Ostpolen nach Sibirien und Kasachstan. Man könnte in einem Film zeigen, wie von zwei Besatzungsmächten eine ganze Region, die Zivilisation zerstört wird – unter Zivilisation verstehe ich hier, dass die Menschen nach bestimmten hergebrachten Regeln, ohne große Administration zu benötigen, zusammenleben können. Und plötzlich fällt dies alles zusammen. Mir sagt die These von Timothy Snyder sehr zu. Wenn ich mein Buch Polen und Juden neu auflegen sollte, würde ich noch viel stärker auf den Zerstörungsdrang der Besatzungsmächte verweisen.
Noch eine Bemerkung zu Auschwitz: in den 1960er-Jahren war ich als Student in den Sommerferien Chef eines Studentenhotels in Krakau, als solcher führte ich regelmäßig – vor allem als Übersetzer aus dem Polnischen ins Deutsche – Gruppen nach Auschwitz. Auschwitz galt damals als internationales Lager, in dem die Kommunisten im Widerstand führend waren. Vom Holocaust vernahm man da nichts, nach Birkenau fuhr man nicht, als sei es ein unbekannter Ort. Dorthin zu kommen, war fast unmöglich. Es ging schließlich so weit, dass in der DDR-Literatur – Thomas Taterka hat es sehr schön dargestellt –, Auschwitz zum Gründungsmythos der Bundesrepublik stilisiert wurde, weil dort die IG Farben tätig war, während Buchenwald zum Gründungsmythos der DDR emporgehoben wurde, denn dort habe der kommunistische Widerstand besonders erfolgreich gewirkt. Auschwitz und Buchenwald werden in der innerdeutschen Nachkriegsgeschichte gegeneinander ausgespielt. Aber das nur am Rande.
Der Holocaust wurde im Grunde genommen als unbekannt hingestellt, obwohl jeder Pole davon Kenntnis hatte, schließlich befanden sich die Todeslager auf polnischem Boden und hier lebten auch die meisten Juden mit einer eigenen Kultur. Wie war dieses Verschweigen möglich? Dadurch, dass in der offiziellen Erinnerung Opfer keine Rolle spielten. Nur der Widerstand war zu zeigen. Es ist daher ein großer Erfolg, dass es der Geschichtsschreibung im Rahmen der neuen Erinnerungskultur gelungen ist, die Opfer in den Mittelpunkt zu rücken. Im sowjetischem Erinnerungsmodell – wir lebten ja unter dem sowjetischem Modell – ging es nur um Sieg und erfolgreichen Widerstand, während die Juden als Herde angesehen wurden, die sich bereitwillig töten ließen.
Lanzmann spielte für die Aufklärung des Holocausts eine positive Rolle, wenngleich nicht der ganze Film in den Achtzigerjahren gezeigt wurde. Das Jaruzelski-Regime war daran nicht interessiert. Hier wäre auch auf Spielmann zu verweisen, der damals noch lebte, man konnte ihn als Zeugen in die Höhe heben. Erst als die Tagebücher von Hosenfeld erschienen, erkannte man, dass sich nicht alles über einen Kamm scheren lässt. Diese Tagebücher stellen eine wichtige Ergänzung zum »Pianisten« dar, denn die Spielmann-Memoiren, die gleich nach dem Krieg erschienen, waren frisiert worden. So wurde aus dem Deutschen, womit Hosenfeld gemeint ist, ein Österreicher – doch das ist eine andere Geschichte.
Die Polizei unter dem deutschen Besatzungsregime wurde blaue Polizei genannt. Es gab während der deutschen Okkupation sogar mehr Polizisten als in der Zweiten Republik. Sie waren im Prinzip für zivile Aufgaben vorgesehen. Aber sie wurden auch mit in den Holocaust einbezogen. Sie mussten zwar nicht schießen, doch hatten sie die Fluchtwege zu schließen und ähnliches mehr. Es kann zugleich nicht verschwiegen werden, dass auch in der Sowjetunion die jüdischen Gemeinschaften zerstört wurden. Jede authentische Tätigkeit von Juden wurde verboten. Es durfte weder orthodoxe Juden noch Zionisten geben. Alles wurde gleichgeschaltet, also im Grunde genommen verboten. Die Synagogen wurden im sowjetisch besetzten Polen geschlossen. Es gab dort kein jüdisches Leben mehr. Auch das gehört zu den eingangs angeführten Zerstörungsmaßnahmen. Das nur zur Ergänzung.
Hier sei an Tadeusz Borowskis Erzählung Bei uns in Auschwitz erinnert, die gleich nach dem Krieg erschien. Dort lässt der Autor einen Häftling sagen »Na Gott sei Dank werden jetzt nur noch die Juden vergast.« Es ist nicht die Meinung Borowskis, er wollte nur zeigen, dass es auch in Auschwitz Antisemitismus oder einfach Mitleidlosigkeit gab. Borowski selber war durch und durch ein Moralist; er ging so weit zu sagen, dass jeder der überlebt hat, irgendetwas im Lager verbrochen haben muss. Es ging im Übrigen soweit, dass in der polnischen Sprache sofort der Begriff »Arier« übernommen wurde, schon 1939. Ein Zeugnis davon gab Jerzy Andrzejewski in der Erzählung Karwoche. In den Übersetzungen dieser Erzählung wird das polnische Wort »arijski«, das heißt arisch, einfach weggelassen, wie ich in einer Analyse zweier Übertragungen der Karwoche ins Deutsche feststellen konnte ...
Auschwitz ist für Polen ein besonderes Symbol, denn das Lager wurde ja ursprünglich für Polen erbaut. Die ersten Insassen waren Polen. Bartoszewski war einer von ihnen. Und es schien ein Leichtes zu sein, die polnischen Juden einfach als Polen einzuordnen. Man tat lange Zeit so, als seien die polnischen Juden als Polen ermordet worden. Jetzt funktioniert das nicht mehr, denn die nationale Narration ist durch eine internationale mit Schwerpunkt auf den Holocaust verdrängt worden.
Ihr Buch, Herr Snyder, ist hochinteressant. Sie haben beispielsweise nur so nebenbei bemerkt, dass Hitler das britische Imperium, das heißt erst einmal Großbritannien selber, nicht erobern konnte, dass er das britische Imperium im Grunde genommen nicht wirklich verletzen konnte. Ich will damit auch sagen, dass Sie in Ihrem Buch internationale Konstellationen einzig am Rande berühren, Bemerkungen dieser Art sind aber für Ihre gesamte Erzählung sehr wichtig. Da steht bei Ihnen so ein Satz: Deutschland hatte nicht einmal genügend Schiffe, um genügend Waffen auf die britische Insel zu transportieren. Damals war es bekanntlich nicht möglich, an Stelle von Schiffen Flugzeuge einzusetzen. Man konnte mit ihnen noch nicht Panzer transportieren. Sie betonten, dass für Hitler der Osten das Wichtigste war, vor allem die Ukraine mit seinem Getreidevorrat und den Ölfeldern. Und Sie bringen auch die japanische Schiene mit hinein. Was wäre gewesen, fragen Sie, wenn sich Japan mehr für Sibirien als nur für die südlichen asiatischen Gebiete interessiert hätte. So etwas können Sie nur in Nebensätzen sagen, denn sonst müssten Sie ja mehrere Bände schreiben. Mit diesen zusätzlichen Bemerkungen bringen Sie Ihr Buch insofern etwas ins Wanken, als für Sie der Wille Hitlers von entscheidender Bedeutung bleibt. Sie haben aber gleichzeitig, was wir jetzt hier am Podium auch gemacht haben, auf die Mikroebene geschaut. Trotzdem meine ich, dass Ihre zusätzlichen Bemerkungen wichtige Elemente zu Ihrem Buch bilden.
Noch etwas zur Rolle Polens. Es gibt eine heftige Diskussion darüber, ob Polen gut daran getan hat, sich 1939 Hitlers Forderungen nach der Schaffung eines Korridors zu verweigern. Diese Fragen werden als rechte gebrandmarkt, und ein gewisser Piotr Żychowicz hat ein dickes Buch dazu geschrieben. Der Vorteil dieses Buches ist nach meiner Meinung, dass der Autor sehr viele Dokumente an den Tag gebracht hat, die Historikern zwar bekannt waren, aber selten zitiert werden. Sie zeigen, wie hilflos die polnische Politik angesichts der Forderungen nach dem Korridor war. Und es gibt fromme Wünsche, man hätte doch auf diese Forderung eingehen und anschließend mit Hitler gen Moskau marschieren sollen. Die meisten können sich natürlich Polen als deutschen Vasallenstaat nicht recht vorstellen, aber es sei hier nur angemerkt, dass es gerade dazu eine heftige Diskussion zu solchen Themen in Polen gibt.
Die zweite Frage betrifft die angebliche Befreiung Polens durch die Rote Armee. Es gibt das sehr schöne Tagebuch von Andrzej Bobkowski, das vor einiger Zeit von Martin Pollack unter dem Titel Wehmut? Wonach zum Teufel? ins Deutsche übersetzt worden ist. Bobkowski beschreibt die Besatzungszeit in Paris, er macht sich immer wieder über die Franzosen lustig, wie sie Widerstand leisten. Aber ich möchte vor allem auf die Stelle verweisen, an der Bobkowski sagt: ja, ich verfolge das Kriegsgeschehen, und die Sowjets haben immer größere Erfolge zu verzeichnen, bei Kiew, bei Kursk ... und ich weiß nicht, soll ich mich freuen oder traurig sein, denn jetzt rückt die sowjetische Besatzung Polens näher. Tatsächlich kam es so … Als die ersten ehemals polnischen Städte, Vilnius und Lemberg, mit Hilfe der AK, der polnischen Heimatarmee, befreit wurden, machten sich die Sowjets drei Tage später daran, die AK-Führung zu verhaften und sie gen Osten zu deportieren. Die Sowjets waren nicht bereit, mit einem selbständigen polnischen Staat zusammenzuarbeiten. Der Warschauer Aufstand von 1944 ist in diesem Zusammenhang zu sehen, denn diesmal wollte die AK die Stadt selber mit alliierter Hilfe befreien. Die Aufstandsführung dachte, dass die Sowjets den britischen und amerikanischen Flugzeugen erlauben werden, im Osten, der Ukraine, zwischenzulanden, um dort auftanken zu können, aber Stalin ließ das nicht zu. Die alliierten Flugzeuge mussten von Italien über Österreich und Krakau nach Warschau fliegen und dort nach Abwurf von Hilfsgütern wieder abdrehen.
Der Fall Jedwabne: natürlich spielt die sowjetische Besatzung eine große Rolle. Und ich habe das sehr genau verfolgt und in meinem Buch Polen und Juden beschrieben, wie die Polen mit Neid und Wut beobachteten, dass Juden Funktionen ausübten, die sie vorher nie hatten ausüben können. Zum ersten Mal waren Juden in großer Zahl zu Beamten ernannt worden. Natürlich waren sie nur kleine Beamte im sowjetischen Polen, aber immerhin hatten sie etwas zu sagen und das im Namen eines Besatzers. Das weckte Hassgefühle. Aber ich glaube wichtiger war, was Timothy Snyder angeführt hat: dass es keine Führung, keine polnischen Autoritäten mehr gab. Auch die katholische Kirche – sie existierte im sowjetisch besetzten Teil nicht – hatte an Autorität verloren. Übrigens wurde die Kirche auch im deutschen Besatzungsteil verfolgt. In Dachau sieht man viele polnische Namen von Priestern, die dort ihr Leben verloren haben. Auch die Kirche war mithin kein Ordnungsfaktor mehr. Das wird ständig unterschätzt. Schließlich spielte die katholische Kirche in der polnischen Geschichte als Ordnungsfaktor eine ganz wichtige Rolle, bis heute. Man kann sich darüber ärgern, aber sie ist es nun einmal, was von der einfachen Bevölkerung akzeptiert wird.
Wenn man von »Memorial« spricht, würde ich »Karta« noch hinzufügen. Karta ist die polnische Entsprechung des Memorial. Karta lässt alle Opfergruppen zu Worte kommen, auch die deutschen Vertriebenen. Karta und Memorial beziehen den ganzen Raum ein, in dem es so viele Opfer gibt. Zur Erinnerung gehören sowohl die Leiderfahrungen einfacher Menschen im Krieg wie auch die nach dem Krieg. In Deutschland macht man sich nur selten klar, wie viel sich im sogenannten Osten überlagert, nämlich der Hitlerfaschismus und die Sowjetherrschaft, und das von Anfang an. Es gilt die europäische Erinnerung um dieses Wissen zu erweitern. Es ist unter anderem wegen der Zunahme des Euroskeptizismus notwendig. Dieser ist im Osten besonders groß, weil sich diese Gebiete in Europa nicht entsprechend repräsentiert fühlen. Es geht hier nicht nur um Nationalgeschichte, sondern auch um die Geschichte dieses Raums, in dem es zum Beispiel am Ende des Zweiten Weltkriegs auch Kämpfe zwischen Ukrainern und Polen in Wolhynien gab. Man könnte noch viele andere Auseinandersetzungen in dieser Zeit anführen, die als nationale Auseinandersetzungen interpretiert werden, aber im Rahmen der beiden Totalitarismen gesehen werden müssen. In Wirklichkeit ist dieser Raum durch die Politik der Sowjetunion und Deutschlands durcheinander gebracht worden. Man versucht seit den Neunzigerjahren irgendwie zu sich zu kommen. Die Vertreter der polnischen Emigrationszeitschrift Kultura in Paris drangen schon in den 1950er-Jahren darauf, eine polnisch-ukrainische Versöhnungsdebatte zu führen, Polen und die Ukraine müssten zueinander kommen, betonten sie. Beide Länder würden zu Europa gehören. In unserer heutigen Diskussion komme ich zu dem Schluss, dass wir hier etwas für die Aufarbeitung der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen getan haben. Wir müssen einfach eine neue Erinnerung schaffen ...
So sollte man auch nicht sagen, dass der Zweite Weltkrieg die deutsche Tat ist. Der Zweite Weltkrieg ist eine deutsch-sowjetische Tat. Die polnische Armee hatte sich im September 1939 in den Osten zurückgezogen, und wollte von dort aus noch einmal versuchen, ihre Kräfte gegen die Wehrmacht zu konzentrieren. Die polnische Armee hätte natürlich den Krieg verloren, aber etwas später und in dieser Zeit wäre die öffentliche Meinung in Frankreich und England mobilisiert worden. In demokratischen Staaten braucht es seine Zeit, bis die Mehrzahl der Menschen bereit ist, Krieg zu führen. Wahrscheinlich hätte Hitler ohne die Hilfe der Sowjetunion seine Kriegsziele in dem Umfange nicht erreicht. Der ganze Zweite Weltkrieg wäre anders verlaufen. Ohne Sowjetunion kein Zweiter Weltkrieg ...
Die Gefahren des Gedenkens – der Schlaf des Denkens
Ohne Hitlers Antisemitismus, sein Verständnis und seine Darstellung der Juden als weltweite Bedrohung Deutschlands, wäre der Holocaust nicht geschehen. Mit dieser Aussage wird eine notwendige Bedingung für den deutschen Versuch spezifiziert, die Juden Europas zu vernichten. Doch muss die plausible historische Erklärung eines bedeutenden historischen Ereignisses plural sein und vielfältige Kausalitätslinien miteinander verknüpfen, die zusammengenommen nicht nur notwendig, sondern auch hinreichend sind. Zum Zweck der Erklärung des Holocaust ist Antisemitismus folglich nicht genug; zum Zweck des Gedenkens an ihn dagegen wohl. Das Problem ist nur, dass unsere Zeit stärker dem Gedenken als der Geschichte verhaftet ist. Gedenken erfordert keine angemessene Erklärung der Katastrophe, lediglich ein ästhetisch zu vergegenwärtigendes Bild ihrer Opfer. Wenn Gedenkkulturen das Interesse an der Geschichte ersetzen, besteht die Gefahr, dass Historiker eher zu solchen Erklärungen greifen, die sich am leichtesten vermitteln lassen.
In den letzten beiden Jahrzehnten ist der Holocaust zum zentralen Ereignis der europäischen Zeitgeschichte aufgerückt und hat damit die Französische Revolution abgelöst, die diesen Platz zwei Jahrhunderte lang innehatte. François Furet, der große Historiker ihrer gesellschaftlichen und intellektuellen Rezeption, hat vor den Gefahren einer »histoire commémorative« gewarnt, einer das Gedenken feiernden Historiographie, die erfolgreich erzählt, was am elegantesten erinnert wird. Gefahr in einem Phänomen, das man »kommemorative Kausalität« nennen könnte, wo dasjenige, dessen man am effektvollsten und häufigsten gedenkt, zu dem wird, was sich in der historischen Darstellung am bequemsten als Ursache präsentieren lässt. So zeichnet sich die Gefahr ab, ja sie ist bereits gegenwärtig, dass durch kommemorative Kausalität die Geschichte des Holocaust, wie Hannah Arendt es vorhergesagt hat, auf einen Reflex zeitgenössischer Emotionen reduziert wird.
Die kolonialen Episteme
In den frühen Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg war der Holocaust ein nachgeordneter Aspekt der Nationalgeschichte Deutschlands. Die 1970erund 1980er-Jahre waren durch die Debatte zwischen »Intentionalisten« und »Funktionalisten« beherrscht, wobei Erstere das Schwergewicht auf das kontingente Wesen von Hitlers Aufstieg zur Macht und die Bedeutung seiner Entscheidungen legten, während Letztere die Kontinuität und den Erfindungsreichtum der staatlichen Institutionen in Deutschland betonten. Der Streit wurde in den 1990er-Jahren, als die Nazizeit zunehmend durch den Holocaust definiert wurde, weitergeführt. Mittlerweile schien die entscheidende Frage in der Rolle Hitlers und anderer Naziführer bei der Initiierung eines ideologisch bestimmten Massenmordes an den Juden zu liegen, im Gegensatz zu Initiativen, die von bestimmten Institutionen in Reaktion auf wirtschaftliche oder militärische Faktoren ergriffen wurden. Für diese früheren und späteren Ausprägungen der Kontroverse zwischen Intentionalisten und Funktionalisten legten, was die deutsche Geschichtsschreibung betrifft, die Forschungen von Ian Kershaw und Peter Longerich überzeugende Lösungen vor.
Wenngleich Intentionalisten und Funktionalisten auf entgegengesetzten Seiten zu stehen scheinen, überdeckt ihr Zwist einen grundlegenden Konsens: die Bevorzugung der inneren, psychologischen und nationalen gegenüber der äußeren, soziologischen und transnationalen Geschichte. Intentionalisten und Funktionalisten waren zwar verschiedener Ansicht darüber, wie es den Deutschen gelungen war, die Herrschaft über einen Großteil Europas zu erringen, sie alle teilten jedoch die Annahme, dass sich diese Fragen auf der Grundlage von Quellen entscheiden ließen, die, selbst in den besten Fällen und in den abgewogensten Deutungen, auf deutsche Perspektiven beschränkt blieben, aus denen sie entstanden waren und denen sie Ausdruck verliehen.
Da sich die meisten Teilnehmer an diesen Disputen auf offizielle deutsche Quellen stützten, nahm der Diskurs einen implizit psychologischen Charakter an. Es ist eine Sache, aufzuzeichnen und zu interpretieren, wie die Deutschen die Welt sahen und sie umzuformen meinten; eine durchaus andere jedoch, diese Welt zu beschreiben und zu deuten. Spätestens nach dem September 1939 stießen deutsche Führer und Institutionen auf Akteure und Kräfte, die nicht ihre Schöpfungen waren, die außerhalb ihrer Kontrolle lagen und sich nicht an ihre Vorhersagen hielten. Gewiss, die polnische Regierung, die 1939 ein Bündnis verweigert, oder die Rote Armee, die 1941 Moskau verteidigt, tauchen in deutschen Quellen auf; aber kein Historiker, der sich nur auf deutsche Quellen stützt, kann die Welt rekonstruieren, aus der sich diese Quellen speisten. Tatsächlich bleibt selbst die subjektive Seite, die Frage der deutschen Ziele und Stimmungen, ohne ein unabhängiges Verständnis der überraschenden und unleugbaren Realität schleierhaft, auf die die Deutschen stießen und mit der sie sich auseinandersetzen mussten, ohne sie freilich immer verständlich festhalten zu können.
Historiker, die zugeben, sich auf den Zivilisationsbegriff zu stützen, dürften heute wohl Seltenheitswert haben, dennoch scheint die Methodologie vieler Geschichten des Holocaust eben darauf zu fußen. Als Folge der Abhängigkeit von deutschen Quellen, die zwar unverzichtbar, aber für sich genommen ungenügend sind, bekräftigte die Holocaust-Geschichtsschreibung eine bestimmte Idee einer einzigen deutschen oder westlichen Zivilisation. Natürlich machen die Holocaust-Historiker kritischen Gebrauch von ihren deutschen Quellen, im doppelten Sinn des Wortes. Aber sie gehen in einer Weise, die in der komparatistischen Geschichtswissenschaft heute inakzeptabel wäre, wie selbstverständlich davon aus, dass die Realität der Eroberung durch die Aufzeichnungen der Eroberer erschöpfend wiedergegeben werde. Das Narrativ der Zivilisation handelt von ihrer moralischen Entgleisung und imperialen Überdehnung mit der Folge des metaphysischen und physischen Zusammenbruchs. So verweisen die Geschichten der deutschen Zivilisation beispielsweise auf Institutionen, die sich missbrauchen lassen (vgl. etwa Raul Hilbergs bahnbrechendes Werk), oder sie beschreiben die Gründe für den »Irrweg« der deutschen Zivilisation (wie in allen Spielarten der Idee des deutschen »Sonderwegs«), oder sie nehmen die deutsche Zivilisation als spezifisches und extremes Beispiel einer breiteren Tendenz moderner Entfremdung, Konzentration und Zerstörung (Hannah Arendt). Aber damit eine Zivilisation untergehen, ihre Widersprüche offenbaren oder zur Moderne heranreifen kann, muss sie zunächst erst einmal existieren. Ohne die Annahme einer deutschen Zivilisation und von Zivilisation selbst wäre der narrative Bogen ihrer Selbstzerstörung unsinnig. Die Tatsache, dass man dem Handlungsfaden des Holocaust so leicht folgen kann, sollte uns stutzig machen.
Ein auffälliges Merkmal der traditionellen Methodologie sind die kolonialen Episteme: der ungerührte Gebrauch deutschsprachiger Quellen zur Beschreibung von Ereignissen, von denen Nichtdeutsche jenseits der deutschen Grenzen betroffen waren. Wie mittlerweile zwei Generationen von Historikern gründlich demonstriert haben, bedarf die Kolonialgeschichtsschreibung einer multifokalen Methodologie. In den meisten, wenn nicht allen Kolonialgeschichten gilt das als selbstverständlich – nur nicht in der Geschichte des Nazireichs in Osteuropa. So stützt sich die Geschichtsschreibung der frühen britischen Herrschaft in Südasien nicht nur auf die offiziellen britischen Quellen, sondern zunehmend auch auf Quellen in den Lokalsprachen. Es wird zunehmend schwierig, über die spanische Herrschaft in Nord- und Südamerika zu schreiben, ohne die Perspektiven indianischer und afrikanischer Bevölkerungen in die Darstellung aufzunehmen. Selbst die Geschichte des nordamerikanischen Grenzlands ist vielsprachig geworden, mit herausragenden neueren Studien, die sich auf französische, spanische und indigene Quellen stützen. Entsprechend ist die Geschichte des Nazireichs in Westeuropa ja auch auf Grundlage lokaler Quellen geschrieben worden – man versuche nur einmal, sich Robert Paxtons Arbeit über das Vichy-Regime ohne Nutzung des Französischen vorzustellen. Wohl kaum ein Historiker würde seinen Studenten den Rat erteilen, eine Geschichte der französischen Kollaboration oder Resistance ohne Kenntnis der französischen Sprache zu verfassen.
Diese Fragen haben im östlichen Teil des Nazireichs noch weit größere Bedeutung und Tragweite als im westlichen, nicht zuletzt, weil der Holocaust in Osteuropa stattfand und in der überwältigenden Mehrheit osteuropäische Juden betraf. In der Geschichte des europäischen Kolonialismus wird also heute nur eine Ausnahme von der Regel gemacht, dass die lokalen Völker eine Stimme haben sollen – und diese Ausnahme betrifft den wichtigsten Fall.
In den meisten Kolonialgeschichten besteht die Antwort auf die imperiale Historiographie in der Sozialgeschichte. Aber die Sozialgeschichte welcher Gesellschaft? Ein Nebenschauplatz des Historikerstreits von 1986/87 kreiste um die Frage der Legitimität der Alltagsgeschichte der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs. War es moralisch vertretbar, so fragten damals die Kritiker, heiles Familienleben und die Realität des Leids in der deutschen Heimat zu porträtieren, während die Deutschen die Juden ausrotteten? Könnte das nicht nahelegen, dass sich die Geschichte einer Gesellschaft isoliert von den entsetzlichsten Gräueltaten schreiben ließe, die ein Gemeinwesen jemals begangen hat? Gewiss würde eine Sozialgeschichte der Deutschen die koloniale Episteme nicht überwinden. Ein wichtiger Schritt, der in den letzten beiden Jahrzehnten in bedeutenden Darstellungen des Holocaust und des Dritten Reiches unternommen wurde, ist der Einschluss der Erfahrung deutscher Juden. Könnte dies die Beschränkungen der kolonialen Episteme überwinden?
Richard Evans erweiterte den Zuständigkeitsbereich der Sozialgeschichte, indem er durch die Anführung jüdischer und anderer deutscher Erfahrungsberichte in der ersten Person demonstrierte, wie sich das tägliche Leben durch den Aufstieg Hitlers und die Konsolidierung seines Regimes verwandelte und sich die Deutschen so veränderten, dass von Normalität, in dem Sinn, wie der Begriff in der naiven Alltagsgeschichte der 1980erJahre angenommen wurde, keine Rede mehr sein konnte. Allerdings handelte es sich hier noch immer um eine Sozialgeschichte im nationalen statt europäischen Maßstab, die somit abermals den Rahmen einer deutschen Zivilisation bekräftigte. Auch im dritten Band seiner Studie behandelt Evans die Deutschen als komplexe Gesellschaft, die eine nuancierte Untersuchung erfordert, während er die Gesellschaften der von den Deutschen eroberten Nachbarländer mit vertrauten (und ungenauen) Stereotypen beschreibt. Saul Friedländer reagierte auf dieselbe Herausforderung, indem er das Alltagsleben deutscher Juden mit nie erreichter erzählerischer Bravour in die Geschichte des politischen Antisemitismus und des Massenmords an den Juden einbettete. In seiner wie in Evans’ Synthese fügt die Sozialgeschichte der Geschichte des Holocaust die Dimension der Erfahrung hinzu, statt Deutsche und Opfer künstlich voneinander zu trennen. Doch auch die Erfahrung deutscher Juden als Wegweiser zum Holocaust hat ihre Beschränkungen und bestätigt in einigen wichtigen Aspekten die kolonialen Episteme eher, als sie zu überwinden.
Die Einbeziehung der kleinen Bevölkerungen assimilierter deutschsprachiger Westjuden und die Marginalisierung größerer Gruppen von jiddischoder russischsprachigen Ostjuden in solchen Geschichten des Holocaust verschärft die Frage der Zivilisation. Für die meisten Leser der HolocaustGeschichten sind deutsche Juden unproblematische Sympathieträger, gerade weil ihr Leben vertraut bürgerlich-kultiviert anmutet. Doch so ästhetisch bequem es ist, den erzählerischen Akzent auf die deutschen Juden zu legen, verleitet es die Leser doch zu dem Glauben, sie seien die typischen Opfer des Holocaust gewesen, was sie in einer bestimmten objektiven Hinsicht aber nicht waren. Ungefähr 97 Prozent der Opfer des Holocaust sprachen nicht die deutsche Sprache. Die Erfahrung der deutschen Juden mit der Nazimacht war, so furchtbar, erniedrigend und oft tödlich sie war, durchaus anders als die der viel größeren Gruppen osteuropäischer Juden, deren Mitglieder das Gros der Holocaust-Opfer ausmachten. Zum einen überlebten die meisten deutschen Juden. Außerdem erlebten sie, wenn sie blieben, die deutsche Herrschaft innerhalb Deutschlands, bis sie emigrierten oder deportiert und ermordet wurden. Das bedeutete bis zu zwölf Jahre Leben unter Hitler, häufig mindestens acht. Die meisten Juden unter den osteuropäischen Bevölkerungen wurden binnen drei Jahren nach ihrer ersten Berührung mit der deutschen Macht getötet, darunter etwa eine Million innerhalb der ersten sechs Monate. Im Sommer 1941 wurden mehr osteuropäische Juden innerhalb von zwei Monaten nach ihrem Erstkontakt mit den deutschen Besatzern umgebracht als deutsche Juden während des ganzen Holocaust zusammengenommen. Deutsche Juden wurden in beträchtlicher Zahl erst ermordet, nachdem der Holocaust in der besetzten Sowjetunion begonnen hatte. Sie überlebten in Deutschland aus Gründen, die weiter im Osten undenkbar gewesen wären, zum Beispiel weil sie mit Nichtjuden verheiratet waren.
Ebenso wichtig für den Charakter der Holocaust-Geschichtsschreibung ist der subjektive Unterschied zwischen deutschen Juden und anderen jüdischen Opfern, was sowohl auf Primär- wie Sekundärquellen maßgeblichen Einfluss hatte. Zum überwiegenden Teil identifizierten sich die deutschen Juden mit der deutschen Kultur, zu der einige von ihnen bedeutende Beiträge geleistet hatten, und mit der deutschen Zivilisation, von deren Sendung die meisten von ihnen überzeugt waren. Es überrascht daher nicht, dass sie ihr eigenes Schicksal als einen Verrat an den deutschen nationalen Traditionen oder als ein Zeichen des Nieder- und Untergangs der europäischen Zivilisation verstanden. Eben weil sie in der Regel patriotische Deutsche waren, eben weil sie als Juden verfolgt wurden, neigten sie dazu, den Antisemitismus als verwirrenden und isolierten Schandfleck in einer Geschichte zu sehen, zu dersie sich zugehörig betrachteten. Die deutschen Juden waren nicht in der Position, den Beginn des Holocaust wahrzunehmen, solange und sofern sie nicht selbst in den Osten deportiert wurden. Daher wird ein Narrativ, das sich von der Erfahrung der deutschen Juden leiten lässt, wichtige Ursachen und Wendepunkte übersehen.
Auf diese Weise verfestigen bedeutende Werke zur Geschichte des Holocaust, die sich auf deutschsprachige Quellen stützen, einschließlich jener, die Erinnerungen deutscher Juden zitieren, das Paradigma der deutschen Zivilisation, das ihre Darstellungen strukturiert. Die Geschichte einer modernen Katastrophe nimmt die Form einer klassischen Tragödie an: Niedergang und Fall, mit dem Antisemitismus als tragischer Verfehlung. Von Hilberg (dem locus classicus) über Friedländer und Longerich (die heutigen Standardwerke) hat die Grundgeschichte zwei Phasen, gewöhnlich in zwei Teilen oder Bänden arrangiert: der politische Antisemitismus innerhalb Deutschlands (Niedergang) und der Massenmord an den Juden jenseits von Deutschland (Fall). Aber wenn wir uns losreißen können von dem vertrauten und zwingenden geschichtlichen Handlungsverlauf, den Hilberg herausgearbeitet und Arendt theoretisch begründet hat (Diskriminierung, Separierung, Eliminierung), um einige der grundlegenden Fakten des Holocaust zu betrachten, spüren wir die Spannung zwischen der Macht der Erzählung und der tatsächlichen Macht. Wenn Antisemitismus einen Holocaust auslösen könnte, dann hätte es vor 1939 einen solchen in Deutschland geben müssen. Doch obwohl einige hundert Juden ermordet wurden und etwa die Hälfte der jüdischen Bevölkerung zwischen 1933 und 1939 emigrierte, geschah im Vorkriegsdeutschland nichts, was in die Nähe eines Massenmords an den Juden gekommen wäre. Tatsächlich kamen auf jeden in Nazideutschland während der 1930er-Jahre ermordeten Juden etwa einhundert, die in der Sowjetunion umgebracht wurden. Als der Holocaust begann, geschah dies unter Juden, die zuvor keiner systematischen Diskriminierung und Rassentrennung ausgesetzt gewesen waren. Sie wurden schlicht ermordet, als die deutsche an die Stelle der Sowjetherrschaft rückte.
Liest man Gesamtdarstellungen des Holocaust, liefert der Antisemitismus ohne Holocaust der 1930er-Jahre die dramatische Spannung, weil wir bereits wissen, was als Nächstes kommt. Aber als ursächliche Erklärung ist der politische Antisemitismus der 1930er-Jahre eindeutig unzureichend, er ist bestenfalls notwendiger Teil einer Erklärung statt diese selbst. Die – gewöhnlich unausgesprochene – Hypothese, die zwischen den Teilen eins und zwei einer Holocaustgeschichte auftaucht, ist die, dass ein in Phase eins erzeugter Überschuss an Antisemitismus überschwappt und zur treibenden Kraft von Massenermordungen in Phase zwei wird. Das hat enorme literarische Kraft, ergibt aber keinen logischen Sinn. Wenn wir annehmen, dass es allein Antisemitismus ist, der einen Holocaust hervorbringt, dann muss es in Deutschland in den 1930er-Jahren eher zu wenig als zu viel davon gegeben haben, weil es in den 1930er-Jahren in Deutschland keinen Holocaust gab.
In den Geschichten des Holocaust spielt sich alles in Deutschland ab – bis es woanders geschieht. Ostjuden (die erdrückende Mehrheit der Opfer) und andere Osteuropäer fehlen in der Geschichte, bis deutsche Augen sie sehen und deutsche Stenographen diese Wahrnehmungen niederschreiben. Wenn die Länder Osteuropas in einer Geschichte des Holocaust präsent sind, bevor sie erobert werden, so gewöhnlich als mentale Geographie der Nationalsozialisten; wenn die Völker Osteuropas gegenwärtig sind, so nur als Abstraktionen in den nationalsozialistischen Planungen. Dann, während der Invasionen im Osten von 1939 bis 1941, tauchen Territorien und Völker am epistemischen Horizont auf, um beherrscht oder vernichtet zu werden. Hier erwächst ein moralisches Problem, denn die Menschen, die zu den großen Opfergruppen gehören, werden für die Leser weit weniger real sein als führende Nazis, die Deutschen allgemein oder deutsche Juden, die in der Geschichte allesamt seit sechs oder acht Jahren präsent sind.
Auch ein Problem des Kontextes oder des Handlungsortes taucht hier auf. Man stelle sich eine Geschichte des Holocaust vor, in der vermerkt wird, dass während der Hitlerzeit in den Ländern, in denen der Holocaust stattfand, vor oder während des Massenmordes an den Juden auch acht Millionen Nichtjuden ermordet wurden. Wo das nicht erwähnt wird, fehlt den Lesern die Grundlage für das Verständnis anderer Kausalmechanismen von Massenmorden, die zu dieser Zeit an diesem Ort am Werk gewesen sein könnten. Doch das fundamentale Problem der Darstellung der östlichen Invasionen von 1939 bis 1941 ist die Abwesenheit lokaler Texte, die Abwesenheit von Quellen in den örtlichen Sprachen. Quellen auf Deutsch können den Niedergang und Fall der Zivilisation porträtieren; das Fehlen von Quellen auf Jiddisch, Polnisch und Russisch lässt die Vernichtung von Individuen und Gesellschaften als unwesentlichen Teil der Geschichte erscheinen. Ausgerechnet wo die schlimmsten Exzesse der Nazipolitik beginnen, bleibt der Historiker in einer gewissen Distanz vom Geschehen stehen. Und die Leser verbleiben zwischen einer Zivilisation, die ihren eigenen Untergang in Texten aufzeichnet, und einer Zone der Textlosigkeit, der Leere einer tabula rasa.
Kommemorative Kausalität
Üblicherweise füllt Antisemitismus die unbeschriebene Tafel. In literarischer Hinsicht ist das notwendig, da der erste Teil der Geschichte offenbar einen Überschuss an Antisemitismus hervorgebracht hat, der auf die Erfüllung historischer Bedeutsamkeit wartet. Und tatsächlich kann man starke und überzeugende Argumente vorbringen, wie es Longerich getan hat, dass sich Antisemitismus als politische Praxis zuerst in Deutschland als erfolgreich erwiesen hatte und dann seine Umsetzung im Nazireich versucht wurde. Das ist ein wichtiger Teil der Erklärung des Holocaust, aber er kann nicht erschöpfend sein: Wie Longerich selbst es versteht, waren es bestimmte Bedingungen, die die Deutschen über Deutschland hinausführten – Angriffskrieg und Kolonialplanung – und die der Politik des Antisemitismus einen neuen Handlungsort unter verwundbareren Bevölkerungen verschafften.
Der Antisemitismus, der die fehlende kausale Triebfeder liefert, ist typischerweise derjenige der osteuropäischen Bevölkerungen unter der Besatzung. Das Problem ist, dass diese Bevölkerungen gewöhnlich gar nicht erforscht worden sind. Nach äußerst sorgfältigen historischen Untersuchungen der Politik des deutschen Antisemitismus taucht der Antisemitismus in den Ländern, wo der Holocaust tatsächlich stattfand, plötzlich als ahistorische Kraft auf. Anders als bei den Deutschen, deren Antisemitismus als erforschenswertes Zivilisationsproblem präsentiert wird, treten Osteuropäer einfach als von Natur aus antisemitisch auf. Ihr Antisemitismus ist in Yitzhak Arads unverzichtbarer Studie des Holocaust in der Sowjetunion »inhärent«. Daniel Jonah Goldhagen bietet »antisemitischen Wahn« an, um die Sicht der Osteuropäer auf die Juden zu charakterisieren. Das Augenfälligste an solchen kategorischen Urteilen ist ihre ausdrückliche Ablehnung historischer Analyse. Inhärenz und Wahn sind jene Art von Begriffen, die durch ihre bloße Eindringlichkeit die Leser aus der historischen Argumentation herausziehen und diese überflüssig erscheinen lassen. So wird abermals der Rahmen der deutschen Zivilisation festgeklopft und in Gegensatz zur östlichen Barbarei gerückt: Die Deutschen mögen tief gefallen sein, aber die Osteuropäer sind schlicht von niederer Art. Die Deutschen bringen Texte hervor, deren kritische Analyse ihren tiefen Fall offenbart; keine Texte werden benötigt, um zu wissen, was wir über die Osteuropäer wissen müssen.
Der Punkt ist überhaupt nicht, dass Antisemitismus keine wichtige Ursache des Holocaust gewesen wäre. Natürlich war er das. Zusammen mit Tyrannei, Konformismus, Krieg, Kolonialismus und Staatszerstörung war er eine der notwendigen Bedingungen für die unheilvollste Massenmordkampagne der Geschichte. Hitlers ganz besonderes Verständnis der Juden als einer widernatürlichen Kraft, die vom Planeten zu entfernen ist, scheint den Anfangspunkt jeder Erklärung zu markieren. Das Problem ist, dass dies keine zureichende Erklärung des Holocaust ist. Genau, wie es in Deutschland zwischen 1933 und 1939 keinen Holocaust gab, so gab es in Osteuropa während des halben Jahrtausends, in dem die Region weltweit die zentrale Heimat der Juden war, keinen Holocaust. Dies nicht aus Mangel an antijüdischen Ressentiments. Antisemitismus war in Osteuropa praktisch allgegenwärtig; aus eben diesem Grund kann er logisch nicht als entscheidender Grund für die Explosion des Mordens im Sommer 1941 gesehen werden. Er war mehr oder weniger eine Konstante, während es in diesem Augenblick einige auffällige Variablen gab, vor allem die Zerstörung osteuropäischer Staaten während der Doppelbesetzung durch Deutschland und die Sowjetunion nach dem Scheitern anfänglicher deutscher Pläne für eine »Endlösung«. So viel war in Bewegung, als der Holocaust begann, dass der osteuropäische Antisemitismus, der zwar bedeutsam, aber in diesem zeitlichen Rahmen statisch war, als Hauptursache kaum in Frage kommt. Während einer beliebigen Woche im Jahr 1941 oder 1942 wurden in Osteuropa mehr Juden ermordet als in allen historischen Pogromen zusammengenommen. Der Holocaust war eindeutig ein Ereignis von einer anderen Ordnung als traditionelle antijüdische Gewalt und erfordert eine andere Art von Erklärung. Darüber hinaus waren die Deutschen selbst sowohl mit dem Maß des örtlichen Antisemitismus wie mit dem Chaos unzufrieden, das folgte, wenn Juden Pogromen zum Opfer fielen. Sie verließen sich nicht auf lokale Gewalt – provoziert oder nicht – als ihre Methode zur Judenvernichtung.
Es gibt sorgfältige kausale Beweisführungen über lokalen Antisemitismus, insbesondere in einer Reihe wichtiger Bücher aus jüngster Zeit von polnischen Historikern sowie in Christoph Dieckmanns bemerkenswerter Gesamtdarstellung des Holocaust in Litauen. Aber diese Nachweise können nie überzeugend allein auf Grundlage deutscher Quellen erbracht werden, die nur wenig Substantielles über die Motivationen ihrer örtlichen Kollaborateure beizusteuern vermögen und dazu neigen, die Einheimischen als Barbaren hinzustellen. Obwohl sich osteuropäische Antisemiten zweifellos am Holocaust beteiligten, ist nicht klar, dass sie dies mit viel größerer Wahrscheinlichkeit taten als andere. Die Virulenz des lokalen Antisemitismus hing natürlich mit der Besetzung, insbesondere der doppelten Besetzung, zusammen, und den durch sie ausgelösten drastischen militärischen, politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verwerfungen. Der Holocaust begann in jener Zone Europas, die einer doppelten Besetzung anheimfiel. Das zwingt uns dazu, unser Augenmerk auf mächtige externe Kräfte zu richten, in einem Maß, auf das uns das Studium des besetzten Frankreichs nur ungenügend vorbereitet.
Wenn es eine Region gibt, wo sich die Aufmerksamkeit auf die Rolle des lokalen Antisemitismus im Holocaust gerichtet hat, so ist es die Westukraine. Mit »Westukraine« meinen Historiker gewöhnlich Galizien, das zur Habsburger Monarchie gehört hatte, während die meisten Regionen der heutigen Ukraine Teil des Russischen Reichs gewesen und später, zwischen den Kriegen, Teil Polens waren. Galizien war tatsächlich die Heimat einer gewalttätigen terroristischen Bewegung, bekannt als Organisation Ukrainischer Nationalisten. Beträchtliche (und ertragreiche) Bemühungen sind in die Dokumentation der Rolle der ukrainischen Nationalisten im Holocaust geflossen. Aber es ist vollkommen klar, dass dieser Nachweis eher von moralischer als praktischer Bedeutung ist. Er belegt, dass die ukrainischen Nationalisten keine sauberen Hände hatten, was nicht sonderlich überrascht; es bedeutet keineswegs, dass die Deutschen die ukrainischen Nationalisten für den Holocaust brauchten. In der Mittel- und Ostukraine, das heißt in der besetzten Sowjetunion, war der ukrainische Nationalismus als Stimmung von geringer und als politische Bewegung von keinerlei Bedeutung. Doch hier wie im Rest der besetzten Sowjetunion hatten die Deutschen keine Probleme, örtliche Unterstützung zu finden, und die Mordrate an den Juden war so hoch wie in der Westukraine oder noch höher. Den Antisemitismus in Osteuropa zu lokalisieren und ihn mit dem Verlauf des Holocaust zu korrelieren, verstellt einigen Historikern den Blick auf die Komplexität der osteuropäischen Geschichte, die ihnen als inhärent antisemitisch infiziert erscheint. Diese geographische Distanzierung macht es den Lesern umso leichter, sich von Gefühlen zu distanzieren, deren Ablehnung, wie sie wissen, von ihnen erwartet wird, während eine solche ahistorische Perspektive die Osteuropäer weniger menschlich erscheinen lässt als die stärker kontextualisierten Deutschen. Das vertraute zivilisatorische Gefälle wird ein weiteres Mal bestätigt.
Das mangelnde Interesse von Holocaust-Historikern an der Geschichte der Länder, in denen die Juden lebten und starben, ist symptomatisch für kommemorative Kausalität. Die Revolutionen von 1848 werden als Wendepunkt erinnert, an dem die Geschichte versäumte, eine Wende zu nehmen. An die Revolutionen von 1989 wird man sich wohl als Wendepunkt erinnern, an dem die Geschichtsschreibung die Wende verpasste. Weil der Holocaust gänzlich in Ländern stattfand, die dann hinter den Eisernen Vorhang fielen, bot der 1989 eröffnete Zugang zu den postkommunistischen Archiven eine einmalige Gelegenheit nicht nur für die Erforschung des Kommunismus, sondern auch der deutschen Gräueltaten. Eigentlich kam dies dem wachsenden Interesse an Erfahrung entgegen, hatte doch die große Mehrheit der Juden, die im Holocaust ermordet wurden, in jenen Ländern gelebt, die dann Teil des kommunistischen Blocks wurden. Doch unglücklicherweise ist die Historiographie des Holocaust in den zwei Jahrzehnten seit 1989 der breiteren europäischen Tendenz zu visueller Geschichte und Gedächtnisgeschichte gefolgt. Die Erfahrung des Holocaust wurde nie zu einem zentralen Thema, wohl aber ihre Darstellung. Sie war überall sehr konservativ, da sie zwangsläufig immer von einem im Vorhinein festgelegten Verständnis von dem abhängt, was zum Gegenstand der Vorstellung, Erinnerung und Darstellung wird. Wenn wir darin persönlich gerne mancherlei Progressives erkennen möchten, so laufen diese Tendenzen in Wirklichkeit auf die Bewahrung einer veralteten Darstellung der historischen Vergangenheit hinaus.
Dieser Konservatismus des sich Ende der 1980er-Jahre herausbildenden Holocaust-Verständnisses prägte sowohl die ältere, nach einer Synthese strebende Generation von Historikern als auch die jüngere, die neue Herangehensweisen an ein scheinbar altes Thema suchte. Die besseren HolocaustHistoriker wussten natürlich, dass die Ereignisse nun in Osteuropa angesiedelt werden konnten und sollten, und dass sie in ihren Darstellungen die Erfahrungen der dort Anfang der 1940er-Jahre lebenden Gruppen berücksichtigen mussten. Sie schwammen gegen den Strom.
Eine bequeme Kontroverse
Gedenken ist der Sirenengesang der Bedeutungsgebung, es spricht zu den Gefühlen und schläfert das Denken ein. Es soll uns die Opfer näher bringen und die Täter bannen, am besten unter Verweis auf deren Überzeugungen, die wir dann unerträglich finden und als Verhängnis der Opfer betrachten können. Der Preis dafür, Faktoren jenseits des Antisemitismus zu ignorieren und dort, wo Antisemitismus das Thema ist, den historischen Schauplatz außer Acht zu lassen, ist ein bestürzend unvollständiges öffentliches Verständnis des Holocaust. Es herrscht auch und gerade unter jenen, die Bücher über den Holocaust lesen, Dokumentarfilme zum Thema sehen und auf andere Weise bemüht sind, einen Zugang zu diesem Ereignis zu gewinnen. Der Preis dafür, den osteuropäischen Antisemitismus als narrativen Kitt zu benutzen, der brüchige Erklärungen des Holocaust zusammenhält, ist die Fortschreibung des altbekannten zivilisatorischen Gefälles zwischen Westen und Osten.
Diese Einstellung ist ein ernstes intellektuelles Problem für die Historiker, doch besitzt sie aufgrund ihrer Geläufigkeit alle Vorzüge (und Reize) der Trägheit. Sie ist uns von den Nazis und aus dem Kalten Krieg vertraut. Der Fall der Berliner Mauer, ein Augenblick, der sowohl die Nachkriegszeit wie den Kalten Krieg zu beenden schien, hat weniger ausgerichtet, als man hätte erwarten können, um das vorherrschende Bild einer höheren Zivilisation im Westen (zu der Deutschland nun wieder fraglos gehört) und einer abwesenden oder niederen Zivilisation im Osten zu verändern. Sicher werden politische Revolution, wirtschaftliche Dynamik und europäische Integration am Ende eine Auswirkung auf diese Wahrnehmung haben, aber es ist doch bemerkenswert, dass die mehr als zwei Jahrzehnte radikalen Wandels seit 1989 den Rahmen der westlichen Zivilisation wohl verändert, aber nicht überwunden haben.
Überraschend ist vielleicht, wie bequem dies ebenso für die Historiker und Intellektuellen in Osteuropa gewesen ist, hat es doch auch ihnen erlaubt, Argumente aus den 1980er-Jahren und aus früherer Zeit auf die Welt von heute zu projizieren. Das Problem entspringt, wie ich glaube, der Konstellation, dass die kommemorative Kausalität in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten gerade zu jenem Zeitpunkt Fuß fasste, nämlich Anfang der 1990er-Jahre, als sich die Gelegenheit zu neuer Forschung über das Nazireich und den Osten bot. Im Internet, in der Presse und im Europäischen Parlament tobt der Streit zwischen Westlern, die auf die Einzigartigkeit des Holocaust pochen, und Ostlern, die das Gewicht auf die stalinistischen Verbrechen legen. Antriebskraft und Dauerhaftigkeit dieses Disputs zwischen westlichen »Zivilisierern« und östlichen »Nationalisierern«, wie man sie nennen könnte, erwachsen aus gewissen intellektuellen Grundüberzeugungen. Zur Sicht der Zivilisierer auf die Vergangenheit gehört die Tragödie vom Niedergang und Fall der (deutschen) Zivilisation. Sie lässt keinen Raum für die Möglichkeit anderer Zivilisationen im unmittelbaren Osten Berlins, seien sie polnisch, litauisch oder jiddisch. So widmen sie der langsamen Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland in den 1930erJahren (zweifellos ein sehr wichtiges Thema) allgemein viel Aufmerksamkeit, während die völlige Zerstörung von Staaten in Deutschlands Osten gewöhnlich überhaupt keine Beachtung findet.
1939 und 1940 zerstörten Deutsche und Sowjets im Rahmen des HitlerStalin-Pakts gemeinsam Polen, während die Sowjets außerdem die drei baltischen Staaten zerschlugen. Diese Länder waren die Heimat von grob gerechnet zehnmal so vielen Juden und zwanzigmal so vielen Holocaustopfern als Deutschland selbst. Die Zerstörung von Staaten hatte für die Juden entscheidende Konsequenzen: An Orten, wo die staatliche Autorität der Vorkriegszeit zerschlagen oder aufgehoben wurde, hatten Juden eine Überlebenschance von etwa 1 zu 20; an Orten, wo der Vorkriegsstaat erhalten blieb, selbst wenn dieser Staat der Nazistaat selbst oder ein Naziverbündeter war, lagen ihren Chancen eher bei 1 zu 2. Doch um die Bedeutung des Staates für die Juden (und natürlich für andere Bürger) zu ermessen, müssten Holocaust-Historiker das politische Leben und die Tradition jenseits Deutschlands in Betracht ziehen. Das lässt sich innerhalb des Narrativs von Niedergang und Fall unmöglich leisten, ebenso wenig wie in den Grenzen der kolonialen Episteme.
Doch für viele Zivilisierer gab es eine Zivilisation östlich von Deutschland: die Sowjetunion. Trotz all ihrer Fehler, die zuweilen auch eingeräumt werden, gilt die UdSSR als Zivilisation unter Feuer, als jene Macht, die durch ihre Selbstrettung die Menschheit rettet. Das entscheidende Bild für diese Erlösungsvorstellung ist die »Befreiung« von Auschwitz durch die Rote Armee. Dieser Topos, strapaziert, wann immer sich Zivilisierer in Bedrängnis wähnen, ist mehr als problematisch. Warum Auschwitz statt die Killing Fields weiter im Osten, wo weit mehr Juden ermordet wurden, oder die Vernichtungsfabriken weiter im Osten, wo ebenfalls weit mehr Juden vernichtet wurden? Auch diese Orte wurden von der Roten Armee befreit, aber ihnen fehlt die Resonanz von Auschwitz, wo uns einige Opfer bekannt sind und einige Opfergruppen zur vertrauteren mittel- und westeuropäischen Zivilisationsgeographie gehören. Anders als die Killing Fields, anders als die Todeslager von Treblinka, Bełżec und Sobibór war Auschwitz nicht nur ein Ort von Massentötungen, sondern auch ein großes Konzentrationslager, es konnten dort also weitaus mehr Menschen befreit werden.
Vielleicht bietet sich Auschwitz vor allem deshalb an, weil es zum Synonym für die Abgründe einer gefallenen Zivilisation geworden ist. Es wird als böse gesehen, aber auch als modern. Es offenbart einen tragischen Defekt. Aus diesem Grund ist seine Befreiung durch Soldaten, die in dialektischem Gegensatz eine gesunde und siegreiche Zivilisation zu repräsentieren scheinen, umso schlagender. Wenn die Sowjets Auschwitz befreiten, so legen die Zivilisierer nahe, dann müssen sie für Werte gestanden haben, die denen der Nazis, die es erbaut hatten, entgegengesetzt waren. Obwohl viele der Gefangenen, die in Auschwitz auf die Rote Armee warteten, gar keine Juden waren, sind sie zum Inbild jener Juden geworden, die in der Ankunft der Sowjets ihre einzige Überlebenschance sahen. Die Befreiung von Auschwitz passt so perfekt zu den Annahmen und literarischen Bedürfnissen der Zivilisierer, vermählt sie doch die emotional unwiderstehliche Kraft der verzweifelten Hoffnungen jüdischer Überlebender mit der unausgesprochenen Vorstellung, die Zivilisation selbst sei zurückgekehrt und habe triumphiert.
Dieser verführerische literarische Kunstgriff kann nur gelingen, wo vorausgehende Bezüge zu sowjetischer Macht und Politik ausgeblendet sind. So kann man eine ganze Bibliothek von Büchern über den Holocaust lesen, ohne zu erfahren, dass der Holocaust in doppelt besetzten Ländern begann, in denen die deutsche Invasion von 1941 die nach der sowjetischen Besetzung von 1939 in Polen und 1940 im Baltikum errichteten sowjetischen Strukturen auflöste; ohne zu erfahren, dass die Sowjetmacht überall präsent war, wo der Holocaust stattfand, entweder kurz nach oder (gewöhnlich) kurz vor und nach dem Massenmord an den Juden. Die Sowjets selbst ermordeten etwa vier Millionen Menschen in den Ländern, in denen der Holocaust während der Hitlerzeit stattfand. Viele der Nichtdeutschen, die Juden ermordeten oder die Todesfabriken bewachten, waren Doppelkollaborateure und Sowjetbürger. Auschwitz, das Symbol des Bösen, der Moderne und der Befreiung, war eine Stadt in Polen gewesen, die nach den Bestimmungen des Hitler-Stalin-Paktes von 1939 den Deutschen von den Sowjets überlassen wurde. Es war die (mit sowjetischer Hilfe ausgeführte) Zerschlagung des polnischen Staates, durch die die jüdische Bevölkerung in Deutschland von ein paar Hunderttausend auf über zwei Millionen wuchs. Im deutsch besetzten Polen folgten Vertreibungen und Ghettoisierungen von Juden sowie die Beschleunigung der Planungen für die »Endlösung«. Ein Plan der Nationalsozialisten sah Anfang 1940 vor, zwei Millionen polnische Juden in die zu dieser Zeit noch mit Deutschland verbündete Sowjetunion zu deportieren. Wenig überraschend, jedoch problematisch für die Zivilisierer, lehnten die Sowjets ab.
Während der deutsch-sowjetischen Allianz spielte die Sowjetpropaganda die antisemitische deutsche Politik herunter. Das führte dazu, dass Mitte 1941, als die Deutschen in sowjetisches Territorium einfielen, die jüdischen Bürger der Region auf die neue Realität nahezu völlig unvorbereitet waren. Im Verlauf des deutsch-russischen Krieges von 1941–45 waren die gefährlichsten Orte für Juden wie für alle anderen eben jene sowohl von den Sowjets wie den Deutschen besetzten Gebiete. Unbestreitbar spielten die Sowjets die entscheidende Rolle beim Sieg über die Deutschen, aber nicht anders als ihre Alliierten kämpften sie nicht dafür, den Holocaust zu stoppen. Als die Heeresgruppe Mitte der Roten Armee im August 1944 an der Weichsel Stellung bezog und zusah, wie die Deutschen den Warschauer Aufstand brutal niedermachten, gaben sie den Deutschen auch die Zeit, 67 000 überlebende Juden von Łódź nach Auschwitz zu deportieren, die beide nur ein paar Tagesmärsche entfernt waren. Sie warteten auch zu, als die meisten der verbliebenen Gefangenen von Auschwitz auf Todesmärsche nach Deutschland geschickt wurden. Der Punkt ist nicht, dass die Sowjetunion ebenso schlecht war wie Nazideutschland oder als Komplize des Holocaust angesehen werden sollte. Der Punkt ist, dass diese bedrückende Geschichte aus der Geschichtsschreibung des Holocaust ausgeklammert wird, weil sie mit dem Bild der Befreiung von Auschwitz als ergreifender Rückkehr der Zivilisation kollidiert.
Für die Gegenspieler der Zivilisierer in Osteuropa, die »Nationalisierer«, ist das Schlüsselkonzept nicht Zivilisation, sondern nationale Souveränität. Während die Holocaustforscher dazu neigen, die Bedeutung anderer deutscher oder sowjetischer Verbrechen zu untertreiben, die dort stattfanden, wo sich der Holocaust ereignete, betonen die Nationalisierer die deutschen und sowjetischen Verbrechen, die mit dem Verlust der Staatlichkeit verbunden waren (und übertreiben dabei häufig deren Bedeutung). Die Osteuropäer können über die Zerstörung ihrer Staaten nicht hinwegsehen, wie es Historiker des Holocaust gerne tun. Da es die Sowjetunion war, die sich als größter Zerstörer von Staaten hervortat (entweder in den Kriegen nach der bolschewistischen Revolution 1917, während des Nichtangriffpaktes, von 1939–41, oder bei Kriegsende 1945), können die Nationalisierer die UdSSR nicht als Erlöser der Zivilisation sehen. Sie sehen in ihr stattdessen einen Aggressor, bestrebt, die nationalen Gemeinschaften der Region zu zerstören, in die die meisten Nationalisierer hineingeboren wurden und deren Souveränität erst zwischen 1989 und 1991 wiederhergestellt wurde. Anders als die Zivilisierer, die gewöhnlich (mit Ausnahme der älteren Generation) wenig oder keine Erfahrung mit der Tyrannei haben, sind die Nationalisierer (bis auf die jüngere Generation) unter dem Kommunismus groß geworden, sodass von ihnen vernünftigerweise kaum zu erwarten ist, die UdSSR aus der Geschichte auszublenden. Ihnen ist auch bewusst, dass die Sowjetpolitik nicht nur darin bestand, Staaten zu zerstören, sondern auch deren Eliten zu liquidieren, welche die staatliche Souveränität eines Tages wiederherstellen könnten. Wenn sie Nationalgeschichte schreiben, so trotzen sie damit auch dem, was die Sowjets als Verdikt der Geschichte hinstellten.
Die Nationalisierer sehen bei ihren westlichen Kollegen eine allzu große Bereitwilligkeit, dieses Verdikt hinzunehmen; bestenfalls schrieben letztere über osteuropäische Länder, als ob dort Eliten, Staaten und Traditionen fehlten, schlimmstenfalls verlieren sie darüber überhaupt keine Zeile. Weil der Holocaust in der besetzten Sowjetunion begann und gänzlich in Ländern geschah, die unter sowjetische Herrschaft fielen, gehen die Osteuropäer wie selbstverständlich davon aus, dass eine Geschichte des Kriegs und der Gräueltaten sowohl Hitler wie Stalin einschließt. Tabus über Vergleichbarkeit und dergleichen ergeben für Menschen, deren Familien oft sowohl unter sowjetischer wie deutscher Gewaltherrschaft zu leiden hatten, wenig Sinn. In den Landschaften und Stadtbildern Osteuropas haben beide Regime bleibende Spuren hinterlassen, sodass selbst jüngere und kommende Generationen Schwierigkeiten haben werden, die Besatzung ihrer Heimat durch die Nazis als etwas völlig anderes zu sehen als den Rest der Geschichte.
Der Holocaust war in Osteuropa nie unbekannt, eben weil er in Osteuropa stattfand und weil die große Mehrheit seiner Opfer Osteuropäer waren – »Nachbarn« und »Nächste«, um den denkwürdigen Ausdruck von Jan Gross zu benutzen. Nationale Mythen von reinem Heldentum während des Kriegs und Unschuld während des Holocaust sind seit 1989 in mehreren osteuropäischen Ländern mit unterschiedlichem Erfolg in Frage gestellt worden; historiographische Debatten über den Holocaust haben auf unterschiedlichem Niveau stattgefunden. Die Zivilisierer scheinen von den Nationalisierern mehr zu erwarten: eine Wiederholung deutscher Schuldbekenntnisse, gefolgt von der Akzeptanz des gegenwärtigen Stands der HolocaustGeschichtsschreibung mit all ihren Problemen, Beschränkungen und Tabus. Das ist unmöglich. Es ist zwar unbestreitbar, dass sich Hundertausende von Osteuropäern in der einen oder anderen Weise am Holocaust beteiligten, und es ist so gut wie gewiss, dass die meisten Judenmörder keine Deutschen waren, doch die »Endlösung« war eine deutsche Politik, die auf besetztem Territorium von Deutschen (und Österreichern) betrieben wurde. Die nationale Anerkennung eines singulären nationalen Verbrechens kann jenseits von Deutschland nicht als Zivilisationsstandard gesetzt werden, weil das fragliche Verbrechen vor allem ein deutsches war. Der Zivilisationsstandard, ob als Zusammenbruch oder als Apologie, wird von Deutschland gesetzt. Es kann nur zu Verwirrungen führen, wenn die Zivilisierer Universalismus mit »der deutschen Erfahrung« verwechseln und erwarten, dass die Eliten in Osteuropa einfach dem deutschen Muster folgen.
In den letzten beiden Jahrzehnten haben wir erlebt, wie der Streit zwischen Zivilisierern und Nationalisierern die Versuche zur Konstruktion einer gemeinsamen europäischen Geschichte und das Projekt der europäischen Integration erschwert hat. Schließlich ist sich jede Seite sicher, das Beste an Europa zu repräsentieren: das Europa der Erfahrung im Osten, das Europa der Aufklärung im Westen. Der Streit dauert an und wird wohl weitergehen, weist doch jede der beiden Geschichten eine gewisse Kohärenz auf. Weit davon entfernt, die jeweils andere Position herauszufordern, hilft sie nur, sie tiefer zu verankern.
Das zentrale Merkmal der Kontroverse besteht darin, dass sie ungeachtet des Anscheins für beide Seiten höchst bequem ist. Dem Klischee zufolge schafft ein Streit mehr Hitze als Licht: Dieser hier produziert eine Art behaglicher Wärme. Jede Seite liegt bei so vielen wichtigen Fragen so handgreiflich falsch, dass die andere gar nicht umhin kann, sich selbst im Recht zu fühlen. Doch die heimliche Gemeinsamkeit im Herzen dieser komfortablen Kontroverse ist die allgemeine Einhelligkeit über kommemorative Kausalität. Beide forschen aus kolonialer Perspektive, indem sie sich der Quellen der Kolonisatoren bedienen, um das Schicksal der Unterdrückten nachzuzeichnen; beide sehen aus den Augen des Staates, um wie die Opfer zu fühlen. Sie definieren die Opfer unterschiedlich, aber sie behandeln sie ähnlich. Elemente zeitgenössischer Darstellung, die wir als postmodern oder befreiend empfinden mögen, dienen der konservativen Funktion einer bequemen, endlos perpetuierten Kontroverse. Vergegenwärtigen wir uns dies an vier Beispielen: Diskurs, Sprache, Terminologie und Darstellung.
Der Diskurs der Einzigartigkeit des Holocaust schafft einen ansteckenden Exzeptionalismus, der sowohl Zivilisierern wie Nationalisierern zupass kommt. Um die historische Frage klar zu beantworten: Der Holocaust war sowohl im Hinblick auf die Absichten wie auf das Ergebnis ein beispielloses Verbrechen. Das Problem beginnt nicht bei einer Geschichtsschreibung, welche die Einzigartigkeit zu beweisen sucht, sondern bei einem historischen Diskurs, der sie schlicht voraussetzt (und bestrebt ist, ein Tabu dagegen zu errichten, die Frage durch Beweise zu entscheiden). Die Zivilisierer halten es für selbstverständlich, dass die Nationalisierer den Diskurs der mutmaßlichen Einzigartigkeit akzeptieren, und betrachten es als Zeichen von Barbarei, wenn das nicht geschieht. Doch das Problem der Zivilisierer ist nicht, dass die Geschichte des Holocaust keinen Eindruck macht, es besteht vielmehr darin, dass sie in anderer Weise beeindruckt als erwartet.
Der Diskurs der Einzigartigkeit des Holocaust wird von Osteuropäern – nicht ganz falsch – als eine Bestätigung der konventionellen lokalen Praktiken der Geschichtsschreibung verstanden. Betrachten wir die methodologischen Annahmen des Holocaust-Diskurses: 1. Bekräftigung der Einzigartigkeit der Erfahrung der Opfer, begleitet von der Überzeugung, das Leiden der einen Gruppe könne die gesamte Menschheit erlösen; 2. die koloniale Episteme oder die kritische Verwendung kolonialer Quellen; 3. entschiedene Einsprachigkeit oder die starke Präferenz, nicht auf Quellen zurückzugreifen, durch die sich die Darstellung komplizieren könnte; 4. sorgfältige Abgrenzung von Insidern und Outsidern. Sobald diese Annahmen ausdrücklich benannt werden, erkennen wir, dass sie die traditionelle osteuropäische nationale Geschichtsschreibung charakterisieren, wie sie sich im 19. Jahrhundert herausbildete und bis zum heutigen Tag praktiziert wird. Die Geschichte des Holocaust kann so aufgefasst werden, dass sie nicht eine herausfordernde neue Art des Diskurses darstellt, sondern der nationalen Geschichtsschreibung bloß ein weiteres Beispiel liefert und so die Legitimität nationaler Historiographie als solcher bestätigt. Der Exzeptionalismus erweist sich damit als ansteckend. Die Geschichte des Holocaust wurde im späten 20. Jahrhundert nach dem Modell des osteuropäischen romantischen Nationalismus des 19. Jahrhunderts geschrieben, den sie dann ihrerseits im 21. Jahrhundert wieder bestärkt.
Die zweite Art der Kooperation zwischen den Protagonisten der Kontroverse besteht in einem linguistischen Waffenstillstand: Wenn ihr versprecht, keine unserer Sprachen zu erlernen, versprechen wir, eure nicht zu lernen. Kein Historiker des Holocaust, der 1989 Bedeutung hatte, machte sich die Mühe, in der Folge eine osteuropäische Sprache zu erlernen, trotz der unerwarteten Verfügbarkeit von Quellen in jenen Ländern, in denen der Holocaust stattgefunden hatte. Keine auf Englisch erschienene Gesamtdarstellung des Holocaust schreibt die Ortsnamen korrekt. Man stelle sich einmal vor, wie ernst wir wohl eine Geschichte der Rebellion Cromwells nehmen würden, in der die Namen englischer Städte falsch buchstabiert sind. Eine der Aufgaben, die mit trostloser Vorhersagbarkeit russischen und polnischen Übersetzern zufällt, ist die Standardisierung der exzentrischen Topologien westlicher Holocaust-Geschichten. Allzu häufig benutzen Historiker bei den Ortsnamen einfach deutsche Schreibweisen, einige aus dem Stegreif von deutschen Amtsträgern erfunden, statt zu überprüfen, wie ein gegebener Ort vielleicht von den Menschen genannt wurde, die dort lebten und starben. In der Zwischenzeit hat, ebenso erstaunlich, eine neue Generation polnischer Holocaust-Forscher die Bühne betreten, die offenbar kein Deutsch liest. Osteuropäische Historiker sind heute weniger vielsprachig als unter dem Kommunismus. Diese polnischen Forscher haben in den letzten Jahren dennoch die im internationalen Vergleich interessantesten neuen Arbeiten zum Holocaust hervorgebracht. Leider bleiben sie weitgehend ungelesen, weil nur eine kleine Schar von Historikern des Holocaust in Deutschland, Israel oder den Vereinigten Staaten die Sprache des Landes versteht, in dem ein Großteil des Holocaust stattfand.
Der Begriff »Genozid« führt eine Terminologie ein, die es Zivilisierern und Nationalisierern erlaubt, einen dauerhaften, wenn auch umstrittenen Waffenstillstand einzuhalten. Die Zivilisierer neigen zu der Auffassung, dass es nur einen Genozid gab, den Holocaust; die Nationalisierer entgegnen, dass es zwei gegeben habe, den Holocaust und ein sowjetisches Verbrechen (welches, hängt vom jeweiligen Land ab). Natürlich haben beide Unrecht, denn nach der rechtlichen Definition haben Deutsche und Sowjets vielfachen Genozid begangen. Jede Debatte darüber, ob die richtige Zahl von Genoziden mit eins oder zwei anzugeben sei, ist also politisch und wird sehr wahrscheinlich aus Ignoranz oder unredlicher Absicht oder beidem geführt. Was die Zivilisierer und Nationalisierer gleichermaßen am Begriff des Genozid schätzen, ist seine Mehrdeutigkeit
Den Nationalisierern erlaubt die breite rechtliche Definition von Genozid, zu behaupten (sehr oft zu Recht), dass ein bestimmtes Verbrechen gegen ihr Volk ein Genozid war. Aber der Reiz des Ausdrucks für die Nationalisierer liegt nicht in der Möglichkeit seiner zutreffenden Verwendung, sondern vielmehr in seiner populären Verbindung mit dem Holocaust. Viele Leute glauben, dass Genozid dasselbe bedeutet wie Holocaust, deshalb können Nationalisierer Pluspunkte einheimsen, wenn sie ein Verbrechen Genozid nennen. Aber warum sind manche der unrichtigen Ansicht, dass der Holocaust der einzige Genozid gewesen sei? Das liegt an den Zivilisierern, die auf der ausschließlichen Anwendung des Begriffs Genozid auf den Holocaust bestehen, um auf diese Weise Vergleiche zu vereiteln. Natürlich laden solche Abwehrbestrebungen zu Vergleichen durch jene ein, die ihre eigene nationale Tragödie gerne von einer ähnlichen Aureole umkränzt sähen. Folglich ist die Frage zu stellen: Warum glauben die Zivilisierer eigentlich, dass der Holocaust, der nach schlichten historischen Begriffen eindeutig beispiellos war, durch die Anwendung eines Rechtsbegriffs erhellt wird, die offenkundig unrichtig ist? Aller Wahrscheinlichkeit nach deshalb, weil die HolocaustHistoriker kein Vertrauen in ihre Behauptung der Einzigartigkeit haben und deshalb eine ahistorische Stütze ihrer Sicht suchen. Wenn das stimmt, ist dieses mangelnde Vertrauen wenig mehr als eine Einladung an die Nationalisierer, bei jeder sich bietenden Gelegenheit das Wort »Genozid« zu verwenden. Wie dem auch sei, das Einvernehmen zwischen Zivilisierern und Nationalisierern über die Unverzichtbarkeit eines Begriffs, den sie vieldeutig lassen, ermöglicht die endlose Fortführung der Diskussion.
Darstellung: Seit 1989 haben die Zivilisierer den Nationalisierern unwissentlich dabei geholfen, parallele, in kommemorativer Kausalität gründende Opfergeschichten zu etablieren. Das United States Holocaust Memorial Museum und die israelische Gedenkstätte Yad Vashem sind buchstäblich zur Inspiration für die Gedenkministerien und neuen historischen Museen geworden, die heute in einem Großteil von Osteuropa so populär und wohlfinanziert sind. Statt an ihre eigenen traditionellen Nationalmuseen anzuknüpfen, geben sich Forscher und Kuratoren alle Mühe, die wirkungsvollen Formate der Holocaust-Museen nachzuahmen. Sie glauben, dass sich die Techniken, mit deren Hilfe der Holocaust aus der Geschichte isoliert wird, auch auf andere Episoden von Massentötungen und Repression in Osteuropa anwenden lassen.
Kommemorative Kausalität ist folglich nicht nur ein Problem für Historiker des Holocaust, weil sie mangelhafte Geschichten des Holocaust hervorbringt; sie ist ein Problem, weil sie mangelhafte Geschichten von Ereignissen hervorbringt, die mit dem Holocaust in Zusammenhang stehen und mit ihm verglichen werden. Sie erlaubt es, die bequeme Kontroverse zwischen Zivilisierern und Nationalisierern zu institutionalisieren.
Zirkuläre Geschichte
Kommemorative Kausalität, die Verwechselung von gegenwärtiger Resonanz und vergangener Macht, verweigert der Geschichte ihren angemessenen Gegenstand. Die Erklärung des Holocaust wird zirkulär, sie ist nicht länger eine Suche nach den Begriffen, die den Schrecken der jüdischen Erfahrung auszudrücken vermögen, und nach den Konzepten, welche die deutsche Politik in ihrem Gesamtzusammenhang erklären, vielmehr füllt sie Darstellungs- und Verstehenslücken der Geschichtsschreibung unreflektiert mit unserem heutigen common sense aus. Natürlich ist es immer schwierig, ein Gleichgewicht zwischen Gegenwart und Vergangenheit zu finden; danach zu suchen ist die Aufgabe des Historikers. Diese Aufgabe wird indes unmöglich, wenn der kommemorative Impuls der Gegenwart mit der Vergangenheit selbst verwechselt wird, sodass das am einfachsten Darstellbare zum argumentativ am leichtesten Vertretbaren wird. Dann haben wir keine ernsthaften Erklärungen mehr, sondern nur noch emotionale Reflexe. Die Grenzen der Geschichte werden kraft kommemorativer Kausalität durch die Zufälligkeiten der Empathie gezogen, die dann zu einem kostbaren Gut wird. Über Episoden von Massentötungen außerhalb des Holocaust zu schreiben, so behauptet Omer Bartov, »schließt Empathie aus«. Wenn das stimmt, liegt der Fehler bei den Autoren von Holocaust-Geschichten, nicht bei ihren Lesern. Gewiss werden Menschen, die den Holocaust überlebten, Empathie mit jenen empfunden haben, die andere Gräuel überlebten; dahinter sollten seine Erforscher nicht zurückfallen.
Die Juden wussten während des Zweiten Weltkriegs von der Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener durch die Deutschen. Aber wer wird dieser drei Millionen Todesopfer der Naziunterdrückung gedenken? Niemand, denn sie gehören zu keiner Gedenkgemeinschaft. Weil ihrer nicht gedacht wird, gehen sie in Gesamtdarstellungen des Holocaust unter, obwohl ihre Erfahrung unabdingbar für eine angemessene Erklärung des Holocaust ist. Ihr Leid zwingt uns, unser Augenmerk auf die Planung der Nazis für den Osten zu richten: die Schaffung eines auf Rasse-Kriterien beruhenden Imperiums, nach dem Verhungern-Lassen und der Deportierung von zig Millionen Menschen. Diese Pläne muss man kennen, um zu verstehen, warum die Deutschen die von Juden besiedelten Länder eroberten. Die Erfahrung der sowjetischen Kriegsgefangenen bestätigt auch die ideologische Priorität der Judenvernichtung bei den Nazis. Als die deutschen Pläne am sowjetischen Widerstand zerbrachen, war Hitler gewillt, slawische Gefangene als Zwangsarbeiter einzusetzen, während er die »Endlösung« in einer Weise beschleunigte und eskalierte, dass daraus der Holocaust wurde. Viele dieser Menschen waren zweimal einer Politik des Verhungern-Lassens ausgesetzt: nicht erst 1941 in den entsetzlichen deutschen Hungerlagern, sondern schon 1933 in der sowjetischen Ukraine. Diese Leben gemahnen uns daran, Fragen von Modernisierung, Imperium und politischer Ökonomie zu beachten, wenn wir hoffen wollen, den Holocaust zu verstehen. Diese Kategorien eignen sich nicht für das Gedenken, weil sie nicht der Vergangenheit angehören. Sie sind gegenwärtig – eben dies ist ja der Grund, warum wir ihrer eingedenk sein sollten.
Der kommemorative Impuls trennt nicht nur Ideologie von Geschichte, er beschränkt die Ideologie auf das, was in nichttextuellen Formen dargestellt werden kann. Ideologie wird zu dem, was sich heute ästhetisieren lässt, statt als das zu erscheinen, was in der Vergangenheit angestrebt wurde. Ohne ein lebendiges Verständnis der Ansprüche der Ideologie an die Welt und ohne ein lebendiges Verständnis vergangener Welten, die durch Ideologie verändert wurden, können wir weder den Antisemitismus verstehen noch uns auf seine Rückkehr vorbereiten (oder auf das Wiederaufleben ähnlicher Ideen). Wie die Nazis, die Osteuropa erobern wollten, und die Sowjets, die es taten, leben wir in einer Welt der Knappheit. Es ist nicht allzu schwierig, sich Ideen vorzustellen, die eine radikal ungleiche Ressourcenverteilung und die Vernichtung von Gruppen rechtfertigen, die im Weg zu stehen scheinen. Kann eine solche Vermählung von Ideen und Vernichtung wieder geschehen? Sie ist bereits geschehen – in China, in Kambodscha, in Afrika. War es genauso wie der Holocaust? Natürlich nicht. Aber ist es für das historische Verständnis oder das politische Urteil produktiv, die Erforschung der Vergangenheit auf die Gedenkpraktiken von heute abzustimmen? Können wir es uns leisten, die ideologischen Dispute des 20. Jahrhunderts in Gestalt einer bequemen Kontroverse wiederaufzuführen, während wir die Verbindungen zwischen Materiellem und Ideen ignorieren? Sollten wir unsere Sache auf eine Idee von Zivilisation stützen, die von der Bewältigung einer nicht zu bewältigenden Vergangenheit im Dienste der Aufrechterhaltung einer nicht aufrechtzuerhaltenden Gegenwart abhängt? Natürlich nicht.
Aus dem Englischen von Andreas Simon dos Santos.
Timothy Snyder, Historiker an der Universität Yale
Bemerkenswerte Befunde
Im Namen des Senats der Freien Hansestadt Bremen begrüße ich Sie herzlich hier in der oberen Rathaushalle. Es ist dem Senat eine Ehre, den Hannah-Arendt-Preis alljährlich gemeinsam mit der Heinrich Böll Stiftung zu verleihen. Dies ist ein Preis für politisches Denken; es erhalten ihn also Denkerinnen und Denker, deren Denken politische Wirkungen hat – und die, soweit sie Wissenschaftler sind, den abgeschirmten Bereich reiner Wissenschaft bewusst verlassen, um sich mit ihren Thesen der politischen Debatte in einer breiteren Öffentlichkeit zu stellen.
Je unabhängiger jemand dabei vorgeht und je weniger er oder sie gerade auch die »sensiblen« Themen scheut, die politisch und emotional besonders aufgeladen sind, desto mehr braucht es dafür Mut. Mut im Hinblick auf die dann unvermeidlichen Kontroversen, Missverständnisse, Etikettierungen, ja Anfeindungen. Es braucht Vertrauen in die Kraft der eigenen Argumente und ein Vertrauen in den öffentlichen Diskurs, in dem sich diese Argumente zur Geltung bringen lassen.
Das Kulturgut der öffentlichen Debatte zu fördern, ist in meinen Augen ein ganz wichtiges Ziel dieses Preises: den Raum zu eröffnen und zu erweitern, in dem Argumente engagiert und ernsthaft ausgetauscht werden, um so den gesellschaftlichen Erkenntnisstand und vielleicht sogar die Gesellschaft insgesamt voranzubringen. Dieser Raum bedarf einer sorgsamen und kontinuierlichen Pflege, da in unseren heutigen Medien zumindest die großen Schlagzeilen und die Hauptsendezeiten meist nicht den am besten fundierten Aussagen gehören, sondern eher den schnellsten und den schrillsten.
Hannah Arendt als Patronin dieses Preises brauchte solchen Mut und solches Zutrauen in hohem Maße. Ihr Diktum in Bezug auf Adolf Eichmann von der Banalität des Bösen hat zu bitteren Auseinandersetzungen geführt, es hat sie Freundschaften gekostet und ihr Feindschaften eingetragen. Der Vorwurf an sie lautete, sie habe Täter und Taten des Naziterrors verharmlost und damit auch die Ehre der Opfer beschädigt. Diese Kontroverse dauert fort bis heute: weiterhin wird die These vertreten, Arendt sei auf Eichmanns Prozessstrategie hereingefallen.
Aber, meine Damen und Herren, ist das der entscheidende Punkt? Ist nicht ganz unabhängig davon Arendts Ansatz ein entscheidender Schritt dazu gewesen, das Unfassbare des Holocaust etwas besser zu verstehen? Und kommt es nicht gerade beim Unfassbaren darauf an, so viel davon zu verstehen wie nur irgend möglich? Gerade dort, wo es um monströse Themen geht, gilt es, mit offenen Augen hinzusehen und sich selbst und anderen die Ergebnisse dieser Betrachtung zuzumuten.
Auch Timothy Snyder beschäftigt sich mit dem Ungeheuren. Und auch er wagt dabei eine neue Perspektive. In Bloodlands untersucht er das geografisch definierte Gebiet, in dem sich vor dem und während des Zweiten Weltkriegs die massenhafte und systematische Ermordung von Menschen konzentriert hat. Ein solcher Ansatz handelt vom Holocaust, aber eben nicht nur von diesem. Er stellt Zusammenhänge dar. Er zeigt, wie zwei ganz unterschiedliche, auf ihre jeweilige Art mörderische Systeme sich wechselseitig befördert, ja ergänzt haben. Timothy Snyder tut das nicht im Dienste einer möglichst provokanten und pauschalen These, sondern präzise und differenziert auf der Grundlage sorgfältiger und aufwändiger Forschungsarbeit. So hat er nahezu alle Sprachen gelernt, die er braucht, um im Untersuchungsgebiet die Originalquellen nutzen zu können.
Meine Damen und Herren, eine fachliche Würdigung ist hier nicht meine Aufgabe und steht mir als Naturwissenschaftler auch nicht zu. Aber auch ein fachfremder Mensch wie ich kann erkennen, dass die Arbeit von Timothy Snyder darauf angelegt ist, neue Perspektiven zu eröffnen und unser Wissen zu erweitern. Unser Verständnis angesichts der größten Untaten des 20. Jahrhunderts – ein Thema, mit dem wir gerade hier in Deutschland nicht fertig werden können und sollen: Wer während des Kalten Krieges in Westdeutschland aufgewachsen ist, für den umfassen die schwerwiegendsten Verbrechen der Nationalsozialisten die Deportationen der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und weiterer Gruppen Verfolgter, die Ausbeutung und die vieltausendfachen Ermordungen in den Konzentrationslagern und Gaskammern, und die Niederschlagung des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Es ist beklemmend und schockierend, wenn wir heute lernen müssen, dass eine sogar noch sehr viel größere Anzahl von Menschen in den Ländern des mittleren Osteuropa durch absichtlich geplantes Aushungern und bei systematischen Erschießungen umgebracht worden sind.
Im Geographieunterricht erfuhr man hierzulande wenig bis gar nichts über diese Länder – allenfalls dieses, dass die ferne Ukraine seit jeher als die »Kornkammer Europas« galt. Umso mehr muss es bestürzen und uns mit Scham erfüllen, dass ausgerechnet in der Ukraine zehntausende Stadtbewohner, aber noch sehr viel mehr Bauern verhungert sind, weil ihnen systematisch ihre Nahrungsgrundlage geraubt wurde.
Snyders Arbeiten bringen uns ein Land wie die Ukraine zeitlich und räumlich sehr viel näher: Wir erahnen, welches unermessliche Leid unsere Vorfahren über das Land gebracht haben, und wir gewinnen angesichts der aktuellen Nachrichten noch tieferen Respekt davor, mit welcher Leiden schaft und Energie die Menschen die düstere Vergangenheit ihres Landes überwinden und in Freiheit und Demokratie leben wollen.
Snyders Buch verhilft uns zu tieferem Wissen über den Nationalsozialismus, über den Stalinismus, und über die Zusammenhänge zwischen beiden. Wer es als – unzulässige – Relativierung der Verbrechen des Nationalsozialismus ansieht, solche Zusammenhänge zu untersuchen, begeht einen Irrtum. Einen Irrtum, der die Gefahr birgt, neue wesentliche Einsichten zu blockieren. »Wir glauben die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Hitler und Stalin zu kennen«, sagt Snyder, »dabei kratzen wir bislang doch nur an der Oberfläche.« Das ist – nach über 60 Jahren – ein bemerkenswerter Befund. Mit großem Forschungseifer versucht Timothy Snyder daran etwas zu ändern. Damit hat er lebhafte Debatten ausgelöst, die sich nicht auf Fachkreise beschränken.
Ich freue mich über die Entscheidung der Jury, diese Arbeit zu würdigen. Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Snyder, spreche ich meinen herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Hannah-Arendt-Preises 2013 aus. Wir freuen uns, Sie heute hier bei uns zu haben. Vielen Dank.
Neues Licht auf die europäische Geschichte
Der Bremer Hannah-Arendt-Preis wird für Neuansätze im politischen Denken verliehen. Die Jury fand, dass Sie, Herr Snyder, mit Ihrem Buch Bloodlands. Europa zwischen Hitler und Stalin einen solchen Neuansatz vermittelt haben. Sie verweisen auf ein einmaliges Phänomen, nämlich darauf, wie in einem kurzen Zeitraum von etwa fünfzehn Jahren ganze Bevölkerungsteile, etwa zwanzig Millionen Menschen, durch Hunger, Massenerschießungen und Vergasung in Ostmitteleuropa, das heißt in dem Raum zwischen dem heutigen Rußland und dem Deutschland in den Grenzen von 1939, ermordet wurden. Sie fragen sich, was der Grund hierfür ist. Der massenhafte Mord durch Hungertod war eine sowjetische Erfindung. Die Hauptopfer bildeten Ukrainer. Die Bolschewiki verfügten über die entsprechenden Machtmittel, die betroffenen Menschen von allen Nahrungsquellen abzuschneiden. Die Nationalsozialisten mit Hitler an der Spitze planten Ähnliches, um die Gebiete mit Deutschen zu besiedeln, waren dagegen nicht in der Lage, in das örtliche soziale Netz einzugreifen, um alle verborgenen Nahrungsreserven aufzudecken. Es lag in ihrer Logik, die für sie überflüssigen und sogenannten »rassisch wertlosen« Menschen, also vor allem Juden und Slawen, auf gewaltsame Weise zu töten. Die ersten Opfer waren die sowjetischen Kriegsgefangenen, die nicht als solche angesehen und behandelt wurden, sowie die Juden in ostpolnischen Gebieten, die zum großen Teil erst 1939/1940 in die Sowjetunion einverleibt worden waren. Das einzige Kriegsziel, das Hitler verwirklichen konnte, war, wie Sie mehrmals unterstreichen, die Vernichtung der Juden, von denen die meisten im ehemaligen Polen ihr eigenes Judentum lebten und sich nicht assimiliert hatten.
Im gleichen Raum wüteten auch die Sowjets während der Besatzung zwischen 1939 und den Nachkriegsjahren, indem sie, wo sie nur konnten, bis hin in den Kaukasus, Hunderttausende in den Osten deportierten, sage und schreibe ethnische Säuberungen durchführten. Nach Kriegsende gingen die von Moskau neu eingesetzten kommunistischen Machthaber in den realsozialistischen Staaten ähnlich vor. Bereits 1940/41 führten die Sowjets Massendeportationen aus Ostpolen, Weißrussland und dem Baltikum durch – ganz zu schweigen von den Morden in Katyn und Umgebung. Weder bei den sowjetischen Massendeportationen noch bei denen ihrer Satellitenstaaten nach 1945 hat es sich, wie oft behauptet, um eine Reaktion auf die deutsche Vernichtungspolitik gehandelt: Es waren vielmehr genuin sowjetische Handlungen, die freilich Unterschiede zu der deutschen Politik aufwiesen. Zu Recht erklären Sie zugleich, daß man, wenn man nicht bereit ist, strukturelle Ähnlichkeiten zwischen dem NS- und dem Sowjetsystem anzuerkennen, auch deren Unterschiede nicht verstehen kann. All diese verbrecherischen Handlungen, einschließlich der durch Stalin initiierten antisemitischen Kampagne in der Nachkriegszeit, erklären Sie, auch das zeichnet Ihr Buch aus, nicht als irrationale Handlungen, sie sehen darin vielmehr eine rationale, interessengeleitete Strategie. Die Jury war sich einig, dass Ihr Buch mehr ist als eine geschichtswissenschaftliche Untersuchung; es ist vielmehr durch die Art, wie Sie die grausigen Geschehnisse erzählen und erklären, auch eminent politisch und vor allem wirft es ein neues Licht auf die osteuropäische und damit auf die europäische Geschichte insgesamt.
»Bloodlands« – ein energischer neuer Anstoß zum Nachdenken
Meine heutige Laudatio gilt einem Buch, auf das ich, wie ich gestehe, zunächst mit einer gewissen emotionalen, aber auch intellektuellen Abwehr reagiert habe – vor allem seines Titels wegen: »Bloodlands« (man hat Gott sei Dank nicht versucht, das ins Deutsche zu übersetzen). Diese anfänglichen Vorbehalte hatte ich trotz einer gewissen positiven Voreingenommenheit gegenüber dem Autor, der mir neben anderen, kürzeren Texten vor allem durch seine Rolle als Gesprächspartner des todkranken Tony Judt bekannt war, mit dem er eine letzte große Tour d’Horizon unternommen und uns überliefert hat: Thinking the Twentieth Century – auf Deutsch erschienen unter dem Titel Nachdenken über das 20. Jahrhundert, pointierter vielleicht: »Das 20. Jahrhundert denken«.
Judt schrieb in seinem Nachwort, datiert auf den 5. Juli 2010, einen Monat vor seinem Tod, der zwanzig Jahre jüngere, aus dem tiefen Ohio stammende Tim Snyder habe für ihn etwas verkörpert, auf das er seit 1989 gewartet habe: nämlich dass eine neue Generation amerikanischer Wissenschaftler sich wieder mit der Geschichte der östlichen Hälfte Europas beschäftige und damit den Stab eines Erbes aufnehme, das bis dahin fast ausschließlich von einer Generation älterer Emigranten vertreten worden war, die entweder vor Hitler, vor Stalin oder beiden geflüchtet waren; und, so ließe sich ergänzen, die auch die Arbeit jener ersten Nachkriegsgeneration fortsetzen würde, die (wie Judt selbst) über eine familiär tradierte oder (wie ich und etliche meiner Kollegen) auf dem Umweg über eine um das Jahr 1968 herum eröffnete linke Biographie auf diese Fragen und Themen gestoßen sind.
Das Motiv Snyders, Jahrgang 1969, der heute in Yale lehrt und in Wien forscht, sich ganz in diese mittelosteuropäische Welt, ihre Geschichte und Gegenwart zu vertiefen, dürfte neben Anderem, vielleicht Persönlichem, wohl wesentlich mit dem zu tun haben, was der Titel des gemeinsamen Buches sagte: »Das 20. Jahrhundert denken«. Mit dieser Aufgabe sind wir in der Tat noch lange nicht fertig. Und ein Schlüssel zu dieser Geschichte liegt jedenfalls dort, wo diese »Bloodlands« – oder wie immer wir diese historische Landschaft bezeichnen wollen – sich erstreckt haben.
Warum dann meine anfänglichen Widerstände gegen dieses Buch? Ich schicke voraus, dass sie durch die Lektüre nicht nur entkräftet, sondern im Gegenteil produktiv aufgelöst worden sind – sonst würde ich hier und heute keine Laudatio auf dieses Buch und seinen Autor halten. Aber es ist gerade deshalb vielleicht ganz gut, wenn ich die Gründe meiner Vorbehalte nenne – zumal dieses Buch ja gerade auch hierzulande von etlichen Kollegen unseres Fachs mit triftigen und mit weniger triftigen Argumenten kritisiert und beargwöhnt worden ist; was natürlich bei einem Hannah-ArendtPreisträger gewissermaßen seine Richtigkeit hat. Denn welches Buch der Philosophin wäre nicht umstritten gewesen und beargwöhnt worden?
Also: Der Titel »Bloodlands« schien zu suggerieren, dass in diesem historischen Gelände alles vergossene Blut und alle großen Verbrechen wie in einem einzigen, blutigen Knäuel zusammen- und ineinandergeflossen seien. Und das sind sie ja auch in mancher Hinsicht. Aber liegt die intellektuelle Aufgabe nicht gerade in der Distinktion? Historisch-genetische Verknüpfungen oder systemische Vergleiche von Nationalsozialismus und Stalinismus waren und sind unbedingt legitim und notwendig, wenn sie dazu dienen, die jeweiligen Spezifika, also die ganz eigenen historischen Charaktere, Bedingungen, Perspektiven der einen wie der anderen totalitären Machtformation dieses Zeitalters schärfer herauszuarbeiten. Im Übrigen, so der Akzent meiner eigenen Betrachtungen zu diesem Thema, handelte es sich weniger um die Geschichte zweier abstrakter Ismen oder Ideologie- und Gesellschaftssysteme; sondern im Kern ging es auch nach der Gründung einer Union Sozialistischer Sowjetrepubliken und eines nationalsozialistischen Dritten Reichs immer noch um die Geschichte zweier, ihrer sozialgeschichtlichen Statur und geopolitischen Lage nach vollkommen unterschiedlichen und gerade deshalb eng und ambivalent aufeinander bezogener Länder und Staatswesen, Deutschlands und Russlands. Nationalsozialismus und Bolschewismus waren nicht nur in ihrem ideologischpolitischen und sozial-ökonomischen Aufriss nicht zu verwechseln; sie waren historisch auch nicht gegeneinander austauschbar, sondern blieben in fast jeder Hinsicht an ihre deutsche und russische Ausgangsbasis gebunden.
Gleichwohl zwingt Timothy Snyders Untersuchung auch verstärkt wieder zu dem Umgekehrten: zur Anerkennung von tatsächlichen Parallelitäten, gegenseitigen Entlehnungen sowie einer zwar sehr unterschiedlich gefärbten und formulierten, aber in manchen Aspekten eben doch auch ähnlichen Logik ihres Denkens oder Ratio ihres Handelns. Dass das keine schlichte Rückkehr zu einer Totalitarismus-Theorie älteren Stils bedeutet, auch nicht in der unendlich gedankenreichen und nuancierten Form, in der Hannah Arendt sie seinerzeit entwickelt hat – in einer Zeit eben, in der erst ein bruchstückhaftes tatsächliches Wissen verfügbar war – dazu gleich noch ein Wort.
Mein tieferer Vorbehalt gegen die Anlage des Buches, das ich hier laudatiere, resultierte aus der Frage oder aus dem Bedenken, ob man sich dem Medusenblick einer reinen Gewaltgeschichte nicht endlich entziehen müsse, statt sich ihm immer von Neuem auszusetzen. Gerade das Prädikat der »Singularität« der Naziverbrechen hat nicht wenige Forscher und Publizisten in aller Welt angestachelt, es auch auf andere Massenverbrechen zu übertragen, fast wie ein Qualitätssiegel in einem Wettbewerb der Bestialitäten. Immer häufiger findet sich dann zum Beispiel in Geschichten des Stalinismus die Formel vom »roten Holocaust«; oder das von Stéphane Courtois herausgegebene Schwarzbuch des Kommunismus versuchte in einer fatalen Logik der Überbietung »dem Kommunismus« (im Singular) global 100 Millionen Tote zuzuweisen – auf die die Nazis und Faschisten aller Länder es angeblich niemals gebracht hätten.
Alle Ansprüche an eine differenzierte Gesellschaftsgeschichte oder eine strukturierte Globalgeschichte verschwinden dann leicht in allgemeinen und fast selbstreferenziellen Formeln wie zum Beispiel – um noch einmal Courtois zu zitieren – der einer »kriminogenen Ideologie«, in diesem Falle des Marxismus-Leninismus, die »wie ein genetischer Code« in das Denken der Kommunisten aller Länder eingebaut gewesen sei und die Quelle aller ihrer Massenverbrechen gebildet habe. Das war wiederum eine mimetische Replik auf Daniel Jonah Goldhagens Formel vom »gleichsam mit der Muttermilch« in Sprache und Denken eingedrungenen Antisemitismus der Deutschen, der ihren Massenmord an den Juden erklären sollte. Dagegen sollte der exkulpierenden Formel Ernst Noltes zufolge der bolschewistische Terror erst den nationalsozialistischen, antisemitischen Radikalfaschismus als eine Form der reaktiven »Gegenvernichtung« hervorgetrieben haben. Alle diese »Debatten«, die umso hitziger geführt werden, je einseitiger die Ausgangsthese ist, sind ihrer Natur nach uferlos. Und wer sich einen Rest historischen Denkens bewahrt hat, ist ihrer zutiefst überdrüssig.
Zugleich entfalten Gewaltgeschichten ihre eigenen Faszinationen. Lassen wir die Frage beiseite, ob, wenn jeder beliebige Fernsehabend und jedes adoleszente Videospiel in einem Massaker endet, dieser habituelle Konsum inszenierter Gewaltdarstellungen nur eine ungeheure Abstumpfung und Banalisierung produziert, oder ob er nicht doch dazu einlädt, die Grenze von Inszenierung und Realität zu überschreiten. Da, wo es wirklich ernst wird, heilig ernst sogar, gilt jedenfalls, dass die gesellschaftliche Erinnerung an wirklich geschehene, große historische Mordtaten oder auch die unmittelbare Dokumentation von Bluttaten im Hier und Heute keineswegs per se immunisierend oder abschreckend wirkt, sondern im Gegenteil eine düstere, sogar übermächtige Anziehungskraft entfalten kann – und zugleich wie ein Vakuum posthume Sinnstiftungen anzieht. In diesem Sinne hatte ich mir in meinem Buch Utopie der Säuberung von 1998 gleich eingangs den bekannten Satz Nietzsches als Warnung vor Augen gestellt, der (ganz feststellend) heißt: »Wenn du lange in einen Abgrund hineinschaust, blickt der Abgrund auch in dich hinein.«
Es gehört zu den großen Vorzügen von Snyders Buch, dass er in keiner Weise mit dem Grauen spielt; dass er sich deshalb auch nur so weit auf die Position einer (in Wirklichkeit gar nicht möglichen) »Identifizierung mit den Opfern« begibt, als er ihnen eine Stimme verleiht, dort wo überhaupt noch eine Stimme zu hören ist; dass er es letztlich aber für »moralisch dringlicher« hält, zunächst »die Handlungen der Täter zu verstehen«, weil es ohne sie die Taten nicht gegeben hätte; und dass er diese Täter, einer Maxime Arendts folgend, nicht schlichtweg als Unmenschen von sich tut, sondern als Menschen versteht – was ungleich schwieriger ist. Und immer hat er auch die posthumen Nachwirkungen dieser großen Mordaktionen im Auge, so wenn es an einer Stelle heißt: »Man erinnert sich an die Toten, aber die Toten erinnern sich nicht ... Später entscheidet immer jemand anderes, wofür sie starben.« Gerade deshalb, so in einer starken Formulierung seines Buches, »besteht das Risiko, dass mehr Mord zu mehr Bedeutung führt«.
Dem Risiko, dass mehr Mord mehr Bedeutung produziert, hat Snyder sich gestellt, indem er dieses Dilemma gleichsam bei den Hörnern gepackt hat. Das soll heißen: Er hat aus dem ganzen, ungeheuren Gewaltgeschehen dieser Weltkriegsepoche mit größtmöglicher begrifflicher Sorgfalt diejenigen Ereignisse herausisoliert, die gerade keine Akte des Krieges oder Ergebnisse eines Bürgerkriegs waren, sondern gezielte, organisierte und gewollte Menschenvernichtungsaktionen – die sich genau in dieser und keiner anderen Region der Welt in einer solchen Weise konzentriert und dabei vielfach überlagert haben. Das meint sein Begriff der »Bloodlands«. Diese gezielten, gewollten und organisierten Menschenvernichtungsaktionen stellten in der Zusammenschau ein nach Art und Umfang bis dahin präzedenzloses und vielfach miteinander und ineinander verflochtenes historisches Geschehen dar, das, so Snyders Argument oder These, auch als ein solches betrachtet werden muss und einer gesonderten Interpretation bedarf.
In Kategorien der jüngeren deutschen Geschichtsdebatten gesprochen wäre das eine Singularitätsthese eigener Ordnung – die sich aber gerade nicht auf ein einzelnes, für sich stehendes Gewaltgeschehen gründet, das sich etwa zusammenfassend mit der Metapher »Auschwitz« umschreiben ließe. Snyder bestreitet gerade, dass sich der »Holocaust«, geschweige die deutsche Kolonial-, Vernichtungs- und Kriegspolitik im Osten insgesamt, mit dieser Metapher historisch angemessen umschreiben lässt. Vielleicht würde er die »Singularität« dieser Vernichtungspolitik (die natürlich ein problematischer Begriff ist) überhaupt bestreiten. Jedenfalls handelte es sich in seiner Version um eine Kette eskalierender Massenmorde, die nur aus einem Prozess sowohl interner wie gegenseitiger Radikalisierungen und dynamischer Interaktionen zweier totalitärer Machtkomplexe verstehbar sind – wobei Snyder, wenn ich es richtig sehe, auch den Begriff des Totalitarismus eher meidet, vor allem wegen seiner theoretischen Vorbelastung. Europas Epoche des Massenmords, schreibt er an einer Stelle, sei »übertheoretisiert«, und dabei gleichzeitig in ihren Grundzügen und ihren bestimmenden Faktoren noch immer eher missverstanden.
Das Element der »Übertheoretisierung« dürfte auch Hannah Arendt gelten – obschon ja gerade sie bereits mit erstaunlicher Intuition erkannt hatte, dass die sowjetische Hungerkatastrophe 1932/33 am Beginn der Kollektivierung ein entscheidender Türöffner war; wie sie es freilich verstand: als ein erster Schritt in eine neue Zeit der radikalen Atomisierung der Gesellschaft und der Auslieferung an eine allmächtige, eben totalitäre Staats- und Parteimacht. Snyders Darstellung beginnt ebenfalls mit dieser Hungerkatastrophe, die sich aber, wie er (der beneidenswerter Weise auch des Ukrainischen mächtig ist) auf Basis aller heute verfügbaren Informationen überzeugend nachweist, in einem noch ungleich härteren Licht darstellt als Arendt hätte wissen können: nämlich als erster Akt einer Politik der sozialen wie ethnischen Säuberung und Vernichtung durch das bewusste Wegnehmen aller Lebensmittel.
Für die nationalsozialistischen Ostraumpläne, die auf einer ziemlich genauen Kenntnis, fast müsste man sagen: einer wissenschaftlichen Vorausdurchdringung, der Sowjetunion Stalins beruhten, wurde diese Politik einer planmäßigen Aushungerung und Vernichtung durch Arbeit sogar zum ersten Mittel der Wahl, um die Massen designierter Untermenschen auszudünnen und Platz für die »Siedlungsperlen« (wie Himmler sagte) der neuen Herrenmenschen zu schaffen. Auch wenn diese Ostraum-Pläne, die den Tod von 30 Millionen überflüssigen Essern vorsahen, nicht aufgingen: in der Statistik jener 14 Millionen Menschen, die zwischen 1933 und 1945, Snyder zufolge, jenseits aller Kriegshandlungen von den beiden totalitären Hauptmächten auf mehr oder weniger systematische Weise ermordet worden sind, rangierte der Tod durch Aushungerung an erster Stelle – vor allen Erschießungen und vor den Vergasungen.
Eines der ersten und konzentriertesten Einzelverbrechen dieser Art war im ersten Jahr des Barbarossafeldzugs das jeder Vorstellung sich entziehende Massensterben von Hunderttausenden auf nackter Erde verhungernden, verdurstenden, in ihrem Kot krepierenden gefangenen Rotarmisten. Auch dabei handelte es sich, so Snyder, näher betrachtet um das »Resultat einer Interaktion beider Systeme«. Solche Interaktionen hatte es eben nicht nur in der Zeit des Hitler-Stalin-Pakts von 1939-41 gegeben, wo sie sich vor allem in der parallelen Ermordung und Deportation der polnischen Eliten (Offizieren, Beamte, Professoren) auf beiden Seiten der neuen Grenze, der Ribbentrop-Molotow-Linie, materialisierten. Sondern indem die in Gefangenschaft geratenen Soldaten der sowjetischen Armee von der »Heimat«, das heißt von Stalin als Feiglinge, wenn nicht als Verräter stigmatisiert und aufgegeben wurden, waren sie zur Vernichtung freigegeben. (Ob die Nazis solcher Signale bedurften, steht auf einem anderen Blatt.)
Die Massentötung der sowjetischen Kriegsgefangenen ist nicht das einzige Beispiel für das, was Snyder, scheinbar paradox, als »Komplizenschaft im Krieg« bezeichnet: So arbeitete Stalin in vieler Hinsicht Hitlers Eroberungsund Versklavungskrieg vor, bereitete ihm das Terrain (besonders in den 1939/40 annektierten Gebieten) und trieb ihm Verbündete und Kollaborateure zu – während Hitlers Rassen-, Versklavungs- und Vernichtungskrieg Stalin fast zwangsläufig in die Rolle des Bannerträgers eines Großen Vaterländischen Krieges, und damit eines Retters und Siegers erhob. Und am Ende war es dann Stalin, der – ich zitiere wieder – »Hitlers Krieg gewann«.
Eine der Kritiken an diesem Buch war, dass Snyder in der Konstruktion der »Bloodlands« das Gesamtpanorama des Weltkriegs, eben als eines Weltkriegs, zu weitgehend ausgeblendet habe. Man könnte sich zum Beispiel fragen, ob nicht die japanische Okkupation in der Mandschurei (ab 1932), in China (ab 1937) und in ganz Ostasien (ab 1941/42) mit ihren systematischen Menschenvernichtungen eigenen Stils nicht ein ganz direktes, für ein europäisches Publikum allerdings ferner liegendes Parallelgeschehen zu all dem gewesen ist, was Snyder für die »Bloodlands« im östlichen Europa beschreibt. Tatsächlich gehört die Einbeziehung des »japanischen Faktors« aber zu den interessantesten Perspektiverweiterungen seiner Darstellung: so beispielsweise die notorischeObsession Stalins mit einer drohenden Subversion durch eine polnischjapanische Geheimverbindung (die als solche nicht einmal völlig aus der Luft gegriffen war), und insgesamt seine ebenso kaltblütige wie letztlich erfolgreiche Politik gegenüber dem absolut kriegs- und expansionsbesessenen Japan, dem er mit einer Mischung aus Beschwichtigung und Entschlossenheit gegenübertrat – aber das er jederzeit auf der Rechnung hatte.
Snyder verliert die Gesamtkonstellation, und gerade den Konnex zwischen dem europäisch-atlantischen und ostasiatisch-pazifischen Weltkriegstheater, zu keinem Zeitpunkt aus den Augen. Und diese Konstellation enthielt ja tatsächlich beunruhigende Alternativen und Optionen, gerade was Japan betraf, die den Lauf der Weltgeschichte entscheidend hätten verändern können: wenn Stalin zum Beispiel den japanischen Einladungen 1940/41 zu einem »Viererpakt« oder 1942/43 zu einem Separatfrieden mit HitlerDeutschland nachgegeben hätte, um sich gemeinsam gegen die britischamerikanische Welthegemonie zu wenden; oder wenn umgekehrt Japan sich am Krieg Hitlers gegen die Sowjetunion beteiligt hätte, statt mit Pearl Harbour im Dezember 1941 einen eigenen pazifischen Offensivkrieg gegen die USA zu eröffnen. Nur die sibirischen Truppen der sowjetischen Armee haben das halb schon evakuierte Moskau im Winter 1941 gerettet ...
Das alles ist mehr als virtuelle Geschichte. Manche dieser schicksalhaften Entscheidungen könnten am sprichwörtlichen seidenen Faden gehangen haben. Auch in dieser Hinsicht verdeckt das ex post konstruierte Narrativ vom »Antifaschistischen Krieg« die Tatsache, dass die Bündnisse, Konstellationen und Entscheidungen dieses Weltkriegs ideologisch, politisch und militärisch weniger eindeutig determiniert waren, wie sie im Nachhinein erschienen.
Die Grundoperation Snyders ist freilich eine bewusste Eingrenzung seiner Untersuchung nach dem Raum (im Kern Polen, das Baltikum, Weißrussland und die Ukraine), nach der Zeit (1933 bis 1945) sowie nach dem Charakter der Geschehnisse (gewollten Massenmorden jenseits der eigentlichen Kriegshandlungen). Das erscheint zunächst wieder in vielerlei Hinsichten fragwürdig. Geht es denn nicht eher um eine Zeitperiode von 1930 bis 1953? Warum steht die Aushungerung der Ukraine, aber nicht die gleichzeitige, proportional noch gravierendere Hungerkatastrophe in Kasachstan im Blickpunkt? Warum geht es um Polen, das Baltikum, Weißrussland und die Ukraine, aber nicht um Rumänien oder Ungarn?
Als anfangs skeptischer, dann zunehmend überzeugter Leser und nun Laudator seines Buches kann ich nur sagen, dass gerade die viel kritisierte Eingrenzung der Untersuchungsperspektive eine Fokussierung ermöglicht hat, die wie ein Scheinwerferkegel oder wie ein gerichteter Röntgenstrahl Eigenschaften des historischen Materials, der Verbindungen, Verflechtungen, Verstrickungen der historischen Akteure und der Logiken ihrer direkten oder indirekten Interaktionen sichtbar macht, die wir sonst weniger klar vor Augen hätten. Gerade die Eingrenzung und Fokussierung schafft eine solche Dichte dieser vielseitigen Bezüge und Verflechtungen, dass das Gesamtgeschehen sich – jedenfalls im historisch-analytischen Rückblick – nicht mehr in national bornierte Einzelgeschichten auflösen lässt. Insoweit erzwingt die thematische Konzentration eher eine Öffnung und Erweiterung, nicht eine Schließung der Perspektive.
Snyders Forschungsschwerpunkt am Wiener Institut vom Menschen heißt ja: »Vereintes Europa – geteilte Geschichte«; und entsprechend wird unser morgiges Kolloquium »Europas gespaltene Erinnerungen« überschrieben sein. Daher ist dieses Buch auch und vor allem eine gezielte Intervention in Diskussionen und Forschungen, die bis heute, ein Vierteljahrhundert nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Kollaps des sowjetischen Lagers, in ganz erstaunlichem Maße noch oder wieder, bewusst oder unbewusst, von autozentrierten Geschichtsbildern und von den nationalen Geschichtspolitiken der jeweiligen betroffenen oder beteiligten Länder geprägt werden. »Nur eine Geschichte der Massenmorde kann die Zahlen und die Erinnerungen verknüpfen«, schreibt Snyder an einer Stelle. »Ohne Geschichte wird Erinnerung privat, und das heißt heute national, und die Zahlen werden ... ein Werkzeug im internationalen Wettbewerb um den Märtyrerstatus.«
Was dieses Letztere, den Wettbewerb um den Märtyrerstatus, angeht, können wir als Deutsche scheinbar schlecht mitkonkurrieren – sieht man einmal vom harten Rest der Vertriebenenverbände und von einem kleinen, aber virulenten rechtsnationalen oder direkt neonazistischen »lunatic fringe« ab. Allerdings sind auch wir aufgeklärten, postheroischen Deutschen, die zur Anerkennung der von Deutschen oder im deutschen Namen begangenen Massenverbrechen vorbehaltlos bereit sind, gegen eine autozentrierte, national bornierte, selektiv verengte oder verzerrte Wahrnehmung der eigenen Geschichte keineswegs gefeit – und zwar gerade dort, wo man sich gegenüber den einstigen Objekten dieser Aggressionen und Vernichtungsaktionen, den in ihre endlosen Leidensgeschichten und heroischen Martyrien verstrickten östlichen Nachbarn, also den autochthonen Bewohnern dieser »Bloodlands«, in Sachen »Vergangenheitsbewältigung« und Bereitschaft zur Selbstkritik recht überlegen und ziemlich vorbildhaft dünkt.
Das Buch von Timothy Snyder enthält da einiges an Irritationen und Zumutungen, die auch uns scheinbar so selbstkritischen, postnationalen und postheroischen Deutschen durchaus zusetzen können. Sind wir zum Beispiel bereit, solche in Zahlen gefassten Tatsachen in unser Geschichtsbild zu integrieren, wie beispielsweise die, dass bei der Bombardierung Warschaus im September 1939 ebenso viele Polen gestorben sind wie Deutsche bei der Bombardierung Dresdens im Februar 1945? Oder: dass der Warschauer Aufstand 1944 mehr polnische Opfer gefordert hat als die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki? Wenn Polen, womöglich ja polnische Nationalisten, auf solchen Zahlenvergleichen beharrten, würden wir das überlegenerweise unter ihrem Streben nach der Opferkrone verbuchen (und abhaken). Aber was ist mit uns selbst?
Sehen wir einmal ab von den trüben Gründerjahren der westdeutschen Bundesrepublik mit ihren gespaltenen Biographien, ihren doppelten Buchführungen und ihren Raubkunstverließen, die nicht nur in Münchner Privatwohnungen, sondern in den Archivkellern unserer Museen liegen. Sehen wir auch ab von den Irrungen und Wirrungen in meiner Generation, die in einem langen »roten Jahrzehnt« aus ihrer überlegenen Haltung einer »Felix Culpa« (auch das übrigens ein luzider Eintrag von Hannah Arendt ins Stammbuch der jungen intellektuellen Avantgarden der Bundesrepublik) ein hypertrophes Maß an moralischer Selbstermächtigung und Selbsterhöhung bezogen hat, während sie das Skandalon der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik eher in eine praktisch-ideologische Universalformel vom »Faschismus« verpackt hat, den man am besten durch entschiedenen Antikapitalismus zu bekämpfen hatte. Sehen wir schließlich ab von den wie ein Schluckauf wiederkehrenden Skandalen, die sich seit den 1980er-Jahren, als das Skandalon des »Holocaust« auf keine Weise mehr zu verleugnen war, fast alljährlich an intellektuellen Fehlleistungen oder Provokationen entzündet haben – von der »Fassbinder-Affäre« über den »Historikerstreit« bis zu Martin Walsers »vor Kühnheit zitternden« Friedenspreisrede gegen die »Auschwitzkeule«; um nur einige der abrufbaren Kürzel zu nennen. Diese sich wiederholenden Debatten ließen sich mit Peter Sloterdijk als »Rituale der Labilität« beschreiben, in denen die bundesdeutsche Gesellschaft durch alle Erregungen hindurch »das stärkste Wir-Gefühl erreicht« hat.
Viel ernster könnte man allerdings nehmen, dass selbst ein so wichtiges aufklärerisches Unternehmen wie die Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht den nationalsozialistischen »Vernichtungskrieg« erst im Jahr 1941 beginnen ließ und Polen konsequent ausblendete. Und wie konnte es dazu kommen, dass die Ausstellungsmacher sich so leicht durch Bilder täuschen ließen, die ihrer Meinung nach Verbrechen der Wehrmacht dokumentierten, tatsächlich aber (gar nicht so schwierig erkennbar) Opfer von Massenexekutionen der abziehenden NKWD-Truppen zeigten?
Eine Antwort auf diese Frage scheint mir darin zu liegen, dass in der deutschen Wahrnehmung der »Russlandfeldzug« eben die zentrale und generationenübergreifende Chiffre für diesen Eroberungs- und Vernichtungskrieg im Osten war und ist. Dabei zeigt Snyder, dass die »Bloodlands« außer in Polen vor allem im Baltikum, in Weißrussland und in der Ukraine, am wenigsten in Russland selbst lagen. Gerade über die von der deutschen Wehrmacht überrannten, von den SS-Einsatzgruppen »gesäuberten« Westgebiete der Sowjetunion war bis 1941 schon ein Jahrzehnt lang der Hobel eines stalinistischen Terrorismus und sozialen Exterminismus gegangen. Der stalinistischen Politik eines »Großen Vaterländischen Kriegs« entsprach es dagegen, die Russen zum ersten Staatsvolk der UdSSR zu erheben. Dieses stalinistische Narrativ war mit einer besonderen Hervorhebung der Leiden der Nichtrussen, und insbesondere auch des Massenmords an den Juden, nicht vereinbar; im Gegenteil, es beruhte essentiell auf ihrer Verleugnung oder Einebnung und jedenfalls einem aktiven, aggressiven Beschweigen.
Dabei hatte eben gerade hier, in den »Bloodlands«, die weithin mit dem alten jüdischen Ansiedlungsgebiet zusammenfielen, also in den östlichen Gebieten und Städten Vorkriegspolens und den westlichen Gebieten der Sowjetunion, der systematische, große Judenmord begonnen, und zwar in Form von Massenerschießungen, die nicht nur das früheste, sondern quantitativ bedeutendste Kapitel im Mord der osteuropäischen Juden gewesen sind. Den deutschen Soldaten konnte das im ersten Jahr des »Russlandfeldzugs« gar nicht verborgen bleiben, und vielfach auch nicht ihren Familien daheim. Ist das möglicherweise einer der Gründe dafür, warum »Auschwitz« in solch formelhafter Weise zur Chiffre des Holocaust und der nationalsozialistischen Massenverbrechen überhaupt geworden ist – für das es sich, wie Snyder zeigt, nicht wirklich eignet. In Auschwitz, das seit 1940 ein Haft- und Arbeitslager für Polen, Russen und andere war, und dem relativ spät erst auch ein Vernichtungslager angeschlossen wurde, konnten selbst jüdische Häftlinge überleben. In den eigentlichen Todesfabriken, in Sobibor, Belzec, Treblinka konnte niemand überleben; hier gab es gar kein Lager und so gut wie keine Überlebenden, also auch keine Zeugnisse und keine Bilder. Wir aber – und das verbindet uns mit der dominanten westlichen Öffentlichkeit – sind an diese Bilder und Berichte, an dieses gerade noch Vorstellbare gebunden, und haben das Grauen in rituelle Formeln und Erzählungen (vorzugsweise vom wundersamen Überleben) verpackt, die das Geschehene noch irgendwie kommensurabel machen.
Ich breche hier ab. Das alles sind nur einige winzige Fragmente eines ungeheuren Bildes, dessen Konturen, genaue Zahlen, Abläufe und Details sich in vielen unseren etablierten oder längst standardisierten Vorstellungen nicht fügen. Entnehmen Sie also meinem Lektürebericht nur so viel: dass dieses Buch auch für mich, der ich auf diesem Feld kein völliger Laie bin, vieles zurechtgerückt und neue Blickschneisen, Querverbindungen, Gedankenlinien eröffnet hat. Es ist schließlich ein Material, das man, wie Snyder demonstriert, immer wieder wird durcharbeiten müssen: mit größtmöglicher Genauigkeit, was die Daten, die Fakten, die Umstände betrifft; mit einigem kombinatorischen Scharfsinn, was die Motive der politisch Entscheidenden und exekutiv Handelnden betrifft; vor allem aber mit einer unbedingten Unvoreingenommenheit gegenüber den Opfern jeder Kategorie, die alle einmal einen Namen, ein Gesicht, eine Stimme und eine individuelle Biographie gehabt haben.
Ja, der Abgrund schaut in dich hinein, wenn du in ihn hineinschaust. Anders ist ein Nachdenken über das 20. Jahrhundert wohl nicht zu haben. Timothy Snyder hat zu diesem Nachdenken einen energischen neuen Anstoß gegeben, getragen von einem hartnäckigen, nach vielen Seiten offenen Engagement. Etwas Besseres kann man über jemanden, der mit dem Hannah-Arendt-Preis ausgezeichnet wird, vermutlich nicht sagen.
Das Bild ist größer, als man denkt
Eine Antwort auf manche Kritiken an »Bloodlands«
Im Frühjahr 1933, als die Temperaturen stiegen und der Boden weicher wurde, grub ein Ukrainer sein eigenes Grab. Er wusste, dass er sehr wahrscheinlich sterben würde. Zu diesem Zeitpunkt waren schon mehrere Millionen Bewohner der ukrainischen Sowjetrepublik Stalins Hungerpolitik zum Opfer gefallen. Doch das wahre Motiv, warum er sein Grab schaufelte, war das Verlangen nach Würde. Wer Anfang 1933 in der Ukraine verhungerte, dessen Leichnam wurde auf einem Feld oder an einer Straße gefunden. Dann warf man ihn in einen der Karren, die fast jede Woche kamen, um Leichen aufzusammeln. Er kam mit vielen anderen in ein Massengrab an einem Ort, den die eigene Familie – falls sie überlebte – niemals finden würde. Also grub der Mann sein eigenes Grab, das dann eines Tages tatsächlich gefunden wurde.
Im April 1940 schrieb ein polnischer Offizier Tagebuch, wie viele andere polnische Offiziere auch. Die meisten von ihnen waren Reserveoffiziere, und polnische Reserveoffiziere waren Akademiker. Wer studiert hatte, wurde zur Reserve eingezogen. Und weil es ein Zeitalter des Schreibens war, führten gebildete Leute ein Tagebuch wie dieser Offizier. Der vorletzte Eintrag lautete: »Sie wollten meinen Ehering, den ich …« Hier brach der Satz ab. Der Offizier war an einem Ort namens Katyn und vermutete wahrscheinlich, dass man ihn bald hinrichten würde. Er wusste auch, dass die sowjetischen NKWD-Beamten, die ihn bewachten, seine Wertsachen fordern würden, bevor sie ihn umbrachten. Darum endet die Eintragung mit Punkten, weil er seinen Ehering so verstecken wollte, dass sie ihn nicht finden würden, aber vermutlich fanden sie ihn doch. Sein Tagebuch wurde wenige Jahre später mit ihm exhumiert, darum besitzen wir es.
Im September 1942 war die Stadt Kowel ein Teil des besetzten Ostpolen, heute gehört sie zur Westukraine. Die letzten verbliebenen Juden waren in der Synagoge eingesperrt. Der Krieg und der Holocaust waren schon so weit fortgeschritten, dass sie genau wussten, was ihnen bevorstand. Sie wussten, dass man sie herausholen und erschießen würde. Der Holocaust begann mit Erschießungen, und die Hälfte der Opfer starb auf diese Weise. Die eingeschlossenen Juden von Kowel ritzten mit Scherben, Steinen oder Ähnlichem Botschaften in die Wände der Synagoge. Eine junge Frau, die mit zweien von ihren Schwestern dort war, schrieb auf diese Weise an ihre Mutter: »Es tut uns so leid, dass du nicht bei uns bist.« Das mag uns unter diesen Umständen seltsam erscheinen, aber es sagt etwas Fundamentales über den Holocaust aus. Die Menschen wollten bei ihren Familien sein, darum verließen so wenige das Ghetto. Das ist einer der Gründe, warum es so wenig Widerstand gab. Die Botschaft endet mit dem Satz: »Wir küssen Dich viele Male.« Als die Rote Armee 1944 die Deutschen aus Kowel vertrieb, fand ein sowjetischer Offizier diese Worte und schrieb sie auf. Dann wurde die Synagoge von den Sowjets mit Getreide gefüllt und als Silo benutzt.
1. Die »Bloodlands«
Solche Ereignisse, die für mein Buch »Bloodlands« zentral sind, sind schwer zu verstehen, denn es handelt sich nur um drei von 14 Millionen Menschen, die zwischen 1933 und 1945 vorsätzlich getötet wurden, als Hitler und Stalin die Länder zwischen Berlin und Moskau beherrschten. Es sind drei von 14 Millionen Geschichten.
14 Millionen ist schließlich eine sehr große Zahl. Und sie ist noch bemerkenswerter, wenn man diese »Bloodlands« mit allen Orten vergleicht, die Hitler und Stalin beherrschten. Ich meine mit den »Bloodlands« also das Gebiet, in dem die 14 Millionen ermordet wurden. Es umfasst das heutige Polen, die Ukraine, Weißrussland, die baltischen Staaten und Westrussland. Das ist ein umfangreiches Gebiet, aber im Vergleich mit dem gesamten Territorium, das Deutsche und Sowjets 1940 oder 1941 oder 1942 beherrschten, ist es eher klein. Trotzdem fand die Mehrheit der deutschen und sowjetischen Morde hier statt.
Betrachten wir die ganze Ausdehnung der Sowjetunion und des Dritten Reichs auf dem Gipfel seiner Macht. Wir sehen ein Gebiet von Frankreich bis Sibirien, und auf diesem Gebiet werden etwa 17 Millionen Menschen ermordet. Von diesen 17 Millionen sterben aber 14 Millionen in den »Bloodlands«. Was bedeutet das? Selbst wenn uns die Opfer nicht interessieren, was sie aber sollten, und wir nur die Regime verstehen wollen, müssen wir diesen Raum verstehen.
Erstens ist 14 Millionen eine schier unfassbare Zahl. Zweitens fand hier der gesamte Holocaust statt − die meisten Juden lebten vor ihrer Ermordung hier, weil dieses Gebiet damals die Weltheimat der Juden war. Drittens waren die »Bloodlands« der Raum, wo deutsche und sowjetische Macht sich überschnitten, wo Deutsche ebenso wie Sowjets präsent waren. Wenn man an das von Deutschland besetzte Europa denkt, gab es viele Orte und Länder, in denen das NS-Regime herrschte und die Sowjets nicht, Deutschland, Frankreich, die Niederlande und so weiter. Andererseits kamen 90 Prozent des sowjetischen Territoriums nie unter deutsche Herrschaft. Orte, die nur von deutscher oder sowjetischer Macht berührt wurden, waren sehr gefährlich, aber nicht annähernd so gefährlich für Juden und alle anderen wie die Orte, an denen beide Staaten präsent waren.
Wir stehen also vor drei Fragen, die wir miteinander verbinden müssen: Warum geschah der Holocaust? Warum wurden so viele nichtjüdische Menschen an Orten getötet, wo der Holocaust stattfand, während Hitler und Stalin an der Macht waren? Und warum fanden diese Morde in einem Gebiet statt, das von deutscher wie von sowjetischer Macht berührt wurde? Von diesen Fragen geht mein Buch aus.
2. Probleme der Nationalgeschichte und des Links-rechts-Schemas
Alles bisher Gesagte bezieht sich auf Chronologie, Geografie und Arithmetik. Doch warum haben diese Aspekte in der Geschichtsschreibung bisher eine so untergeordnete Rolle gespielt? Mir erscheint es als wichtige Frage, warum auf dem Gebiet, wo fünfeinhalb Millionen Juden im Holocaust ermordet wurden, in denselben Jahren der NS-Herrschaft auch acht Millionen Nichtjuden ermordet wurden − selbst dann, wenn man sich nur für den Holocaust interessiert und nicht für die anderen Opfer. Es hat immer sehr viel Mühe gekostet, diese Opfer zu übersehen: die fünf Millionen Opfer deutscher Hungerpolitik und sogenannter Vergeltungsmaßnahmen und die vier Millionen Opfer sowjetischer Hungerpolitik und Terrormaßnahmen. Dies muss im Namen der Vernunft und der historischen Erklärung geändert werden und nicht zuletzt im Namen des Respekts für alle Betroffenen.
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Polizist und werden zu einem Tatort gerufen. Sie kommen zu einem Mietshaus. Fünf Menschen, die offensichtlich alle zu einer Familie gehören, sind ermordet worden. Fünf andere Menschen gehören nicht zu dieser Familie, wurden aber anscheinend von derselben Person ermordet. Und dann sind da noch vier Menschen, die nicht zu dieser Familie gehören und offenbar von jemand anderem ermordet wurden, aber im selben Gebäude zur selben Zeit. Wenn Sie Ihren Bericht schreiben, werden Sie vermutlich alle Morde erwähnen. Sie werden vielleicht denken, das ist sehr verwirrend, aber es muss eine Verbindung zwischen all den Morden geben – und von dieser Annahme gehe ich aus, den Arbeiten so mancher deutscher Historiker folgend.
Natürlich gibt es gute Gründe, warum wir dem Tatort bisher nicht in gebührender Weise Aufmerksamkeit geschenkt haben. Das größte Problem scheint mir zu sein, dass wir Geschichte national verstehen. Wir verstehen Geschichte als Geschichte der Juden oder der Polen, der Ukrainer oder der Russen oder der Deutschen. Wir benutzen die Sprache unserer Gruppe, als enthielte sie alle Lehren über unsere Taten und unser Schicksal. Das Leben ist natürlich völlig anders, aber die Geschichtsschreibung ist normalerweise so. Und alle Nationalgeschichten haben eigene Darstellungsweisen von Schurken und Helden, so dass sie sich nicht einfach integrieren lassen. Man kann nicht einfach ein Buch zur polnischen Geschichte mit einem zur jüdischen, einem zur deutschen und einem zur ukrainischen Geschichte kombinieren, um eine synthetische Geschichte zu bekommen, weil jede Nationalgeschichte nach ihrer eigenen Logik funktioniert. Nationen sind nur in der Produktion ihres Selbstbilds wahrhaft souverän, und das erschwert es uns natürlich, die Welt zu verstehen. Da die Welt immer noch durch Nationalstaaten, nationale Erziehungssysteme et cetera strukturiert ist, dominiert eine nationale Form des Verstehens dieser Ereignisse auf scheinbar natürliche und direkte, aber wenig konstruktive Art. Daneben kann Nationalgeschichte wichtige Fragen stellen, zum Beispiel, warum waren wir die Opfer oder warum waren wir die Täter oder warum standen wir dabei und taten nichts? Alles sehr gute und relevante Fragen, moralisch gewichtige Fragen, auf die wir Antworten suchen müssen, wenn wir uns mit bestimmten Nationen identifizieren. Die Nationalgeschichte stellt diese Fragen, kann sie aber nicht beantworten, weil einige von den Gründen, warum wir Opfer, Täter oder Zuschauer waren, mit Kräften zu tun haben, die nationale Grenzen überschreiten.
Der andere Grund, warum es so schwierig ist, diese Art von Geschichte zu betreiben, ist die Bipolarität der Politik. Ungefähr seit der Französischen Revolution haben wir Politik mit den Begriffen links und rechts beschrieben, was durch die Erfahrung von Faschismus und Antifaschismus zementiert wurde. Wir neigen dazu, die Sowjetunion als links und das Dritte Reich als rechts zu verstehen, und weil wir sie als links oder rechts ansehen, verstehen wir sie vor allem oder sogar allein aus ihren Ideen. Und da sich ihre Ideen natürlich sehr unterscheiden, ist es einfach für uns, sie einzuordnen, getrennt zu betrachten und zu glauben, sie hätten nicht viel Kontakt miteinander. Betrachtet man aber die »Bloodlands« und das Leben und den Tod ihrer Bewohner im am härtesten getroffenen Teil Europas, dann ist es unmöglich, die UdSSR und das Deutsche Reich als Gegensätze zu betrachten, weil diese beiden Regime trotz ihrer unterschiedlichen Ideen und Systeme ein gemeinsames Territorium besaßen. Wir Historiker schreiben im Allgemeinen so über das Dritte Reich und die Sowjetunion, als hätten sie sich auf unterschiedlichen Planeten befunden und nicht, als seien sie mächtige Systeme gewesen, die in einem bestimmten Teil der Welt am mächtigsten oder zumindest am mörderischsten waren. Wir tun das, weil es bequem ist. Es ist bequem, die Kategorien links und rechts beizubehalten, so wie es bequem ist, die Kategorien unterschiedlicher Nationen beizubehalten, aber Geschichte ist zu allererst unbequem.
3. Methoden, den Problemen zu entgehen
Wie schreibt man eine Geschichte, die diese schrecklichen Ereignisse erklären kann? Eine Methode: Ich habe versucht, nationales Sonderbewusstsein zu vermeiden. Dieses Buch handelt zwar ausführlich von Juden, Polen, Ukrainern und so weiter, aber es geht nicht von der jüdischen, polnischen oder ukrainischen Geschichte aus. Diese Feststellung mag simpel erscheinen, ist es aber nicht. Wenn man von der Beobachtung ausgeht, dass 14 Millionen Menschen ermordet wurden, hat man einen ganz anderen Ausgangspunkt, als wenn man etwa von der jüdischen oder polnischen oder ukrainischen Geschichte ausgeht.
Ich gehe also von allen Menschen aus, die das Gebiet bewohnten. Es ist natürlich wichtig, ob sie Juden waren, Polen, Litauer oder Russen. Es ist wichtig, wer jemand ist, obwohl noch wichtiger ist, wie einen die Mächte sehen, die größer sind als man selbst. Ich beginne mit der Beobachtung, dass es eine Katastrophe gab, deren schlimmster und deutlichster Teil der Holocaust war, und versuche dann, die einzelnen Teile auf der Grundlage der Erfahrung der anderen zu erklären.
In dem Buch verzichte ich nicht nur auf methodologischen Nationalismus, sondern auch auf dialektische Konstruktionen. Es gibt mindestens drei dialektische Übungen, die unser Verständnis dieser Ereignisse sehr erschweren. Nennen wir die erste die Dialektik der Sowjetapologie. Sie geht so:
»Ja, gewiss, die sowjetischen Behörden ermordeten in den 1930er-Jahren Millionen von Zivilisten. Aber die Rote Armee gewann den Zweiten Weltkrieg.« Zwischen diesen beiden Vorgängen besteht in Wirklichkeit kein logischer Zusammenhang. Das tiefere Problem ist aber: Wir können Ereignisse von 1933 nicht erklären, indem wir uns auf Ereignisse von 1945 beziehen. Wir können nicht erklären, warum Sie (zum Beispiel) diesen Artikel lesen, indem wir uns auf Ereignisse von 2024 beziehen.
Nennen wir die zweite Übung die Dialektik der NS-Apologie. Das ist die Nolte-Version, die ebenso wenig plausibel ist. Die beiden Systeme standen nicht in einer Art schicksalhafter hegelianischer Beziehung zueinander. Sie waren unterschiedliche politische Ordnungen, deren sehr unterschiedliche Führungspersonen sehr unterschiedliche Ideen hatten. Manchmal konkurrierten sie, manchmal kooperierten sie, und manchmal interagierten sie. Wann und wie sie interagieren, ist eine empirische Frage und wird nicht durch Intuitionen gelöst, die aus dialektischem Denken entstehen und bei nahezu völligem Unwissen über die Geschichte Osteuropas und der Sowjetunion, wie bei Nolte.
Die dritte Spielart ist die Dialektik des heutigen westlichen Liberalismus. Dies ist der Gedanke, dass Sowjets und Nazis, weil sie so unterschiedlich waren, irgendwie in der Mitte Europas zusammenstießen und einander aufhoben. Die Sowjets kamen irgendwie ins Spiel und machten alles rückgängig, was die Nazis getan hatten. So formuliert, wirkt es natürlich nicht plausibel, aber so denken Menschen im Allgemeinen über diese Ereignisse. Sie denken: eins minus eins ist null. Die richtige Aufgabe ist aber eins plus eins, und das ist zwei. Historisch gesehen betrachten wir Gebiete, in denen deutsche Macht wie Sowjetmacht präsent sind, das bedeutet, man hat erst die eine und dann die andere, und an einigen Orten sogar erst die eine, dann die andere und dann wieder die erste. Es ist schlimm, besetzt zu sein. Noch schlimmer ist eine doppelte Besetzung. Am schlimmsten ist eine dreifache Besetzung.
Eine dritte Prämisse neben dem Verzicht auf Nationalismus und Dialektik ist, dass ich von den Morden ausgehe. Das ist ein wenig anders als in dem dominanten Diskurs. Das beherrschende Bild des Holocaust und auch des sowjetischen Terrors ist das Lager, das Konzentrationslager. Wenn Sie zum Beispiel den Film Der Untergang gesehen haben, werden Sie sich vielleicht erinnern, dass am Schluss eine Tafel erscheint, auf der steht, dass sechs Millionen Juden in deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden. Das stimmt nicht. Die große Mehrzahl der Holocaustopfer kam nie bis in ein Konzentrationslager (wie der Öffentlichkeit noch immer nicht bewusst ist, trotz so vieler hervorragender Studien gerade in Deutschland). Juden wurden ja in Mordeinrichtungen und in Vergasungseinrichtungen getötet. Aber das waren keine Lager. Ein Lager ist ein Ort, wo man in Baracken schläft. Treblinka war kein Lager. Sobibor war kein Lager. Belzec war kein Lager. Chelmno war kein Lager. Der Teil von Auschwitz, in dem Menschen ermordet wurden, war auch kein Lager, und die meisten Auschwitzopfer sahen nie ein Lager, weil sie aus den Zügen direkt in die Gaskammern getrieben wurden. Und ein großer Teil der Juden wurde sogar außerhalb dieser Todesstätten ermordet. Wir erinnern uns an Lager, weil es dort Überlebende gab. Es waren schreckliche Orte, an denen viele Menschen starben, aber die meisten Menschen in Lagern überlebten, darum besitzen wir ein Zeugnis. Es ist ein grauenhaftes Zeugnis, das ich keineswegs in seiner Bedeutung verkleinern will, aber es ist ein unzureichendes Zeugnis. Es verweist nur auf die noch schrecklicheren Orte, an denen Menschen in Mordeinrichtungen durch Gas oder neben Massengräbern durch Kugeln oder – am häufigsten – durch Verhungernlassen ermordet wurden.
4. Der Raum als methodisches Prinzip
Mein Buch beginnt also mit einem Raum, teils aus Gründen der Moral und teils aus methodischen Gründen. Wenn 14 Millionen Menschen zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Gebiet ermordet wurden, das gar nicht so weit von einem anderen Gebiet entfernt ist, müssen wir versuchen, das zu verstehen. Dieser transnationale Raum erlaubt mir aber auch, nationales Sonderbewusstsein und konventionelle Dialektik beiseitezulassen. Die räumliche Perspektive bedeutet auch, dass ich die Regime betrachte. Im Allgemeinen werden Geschichten der Nazi-Morde von Berlin aus und Geschichten des sowjetischen Terrors von Moskau aus geschrieben. Es gibt Vergleiche, aber sie haben kein vermittelndes Drittes, das die Dinge zusammenbringt. Das kann jedoch gelingen, indem man seine Aufmerksamkeit auf das Territorium richtet, in dem sie beide präsent waren und ihre Mordeinrichtungen präsent waren. Indem man die Befehlskette von dort zurück nach Berlin und Moskau verfolgt und nicht nur in Berlin und Moskau bleibt. Das bedeutet, man muss nicht nur die Quellen der Regime auf Deutsch und Russisch lesen, sondern die Quellen der Opfer und der Zeitgenossen der Opfer auf Jiddisch, Polnisch, Ukrainisch und in den meisten Sprachen der »Bloodlands«.
Ich habe also Ort und Raum als methodisches Prinzip betont, nicht weil ich Ideen für unwichtig halte, sondern umgekehrt: weil ich meine, wir müssen Ideen ernstnehmen, und das heißt, wir müssen ihre Macht historisch verstehen. Ideen sind die Standarderklärung für Massenmord, die Nazis mordeten wegen nationalsozialistischer Ideen, die Stalinisten mordeten wegen stalinistischer Ideen. Ich habe das bewusst etwas vereinfacht formuliert, weil ich betonen möchte, dass Ideen nicht allein morden. Wenn das so wäre, wäre die Weltgeschichte noch viel mörderischer, als sie bereits ist. Wenn der Antisemitismus direkt zum Mord an den Juden führt, hätte es in Osteuropa keine Geschichte der Juden vor dem Holocaust gegeben. Erst wenn sich Ideen in Institutionen verkörpern, werden sie wirkungsmächtig. Im Fall des Holocaust war das ein antisemitischer Staat, NS-Deutschland, der Krieg gegen Nachbarländer führte, in denen Juden lebten. Das erste, was wir also tun müssen, und hier haben die Historiker, die das Dritte Reich und die Sowjetunion studiert haben, hervorragende Arbeit geleistet, ist also, das Verbinden der Ideologie mit den Institutionen herauszuarbeiten.
Zweitens müssen wir, um Ideologie mit Handlungen zu verbinden, begreifen, welches Zeitverständnis diese NS- oder Sowjetinstitutionen hatten. Ich habe es bereits erwähnt und betone es erneut, dass diese Ideologien verschieden waren. Ein Aspekt, in dem sie sich unterschieden, war ihr Verständnis von Vergangenheit und Zukunft. Für die Sowjets lag die Revolution in der Vergangenheit. Die Revolution, auf die es ankam, war die von 1917. Stalin sicherte aus seiner Sicht die Industrialisierung der UdSSR, die Kontrolle und Kollektivierung des Bodens und die autoritäre Behauptung des Sozialismus in einem Land. Darum fanden fast alle sowjetischen Morde in Friedenszeiten statt und fast alle auf sowjetischem Territorium. Für die Nazis bedeutete Revolution etwas Anderes, sie lag in der Zukunft. Revolution war für sie etwas, das nur im Krieg stattfinden könnte. Hitler, Himmler, Heydrich, Göring und die übrige NS-Elite wussten, dass der einzige Weg, die deutsche Gesellschaft in ihrem Sinne umzuwälzen und in Osteuropa ein rassisches Kolonialreich zu errichten, ein Krieg war. Während in den 1930er-Jahren die Sowjets also schon Institutionen besaßen, die unter anderem auch zum Massenmord fähig waren, freuten sich die Nazis auf den Krieg, der es ihnen erlauben würde, Mordinstitutionen zu schaffen und Mordkampagnen durchzuführen. Aus diesem Grund lag die Gesamtzahl der Naziopfer in Deutschland von 1933 bis 1939 bei einigen Tausend, die der ermordeten Juden bei einigen Hundert. Sobald Deutschland aber Krieg führte, kletterte die Zahl rasch auf Zehntausende, dann Hunderttausende, dann Millionen. Die deutschen Morde geschahen also fast ausschließlich im Krieg und außerhalb Deutschlands.
Um die Perspektive meines Buches zu verstehen, müssen wir uns klarmachen, dass »außerhalb Deutschlands« weitgehend dasselbe bedeutet wie »innerhalb der Sowjetunion«.
Drittens müssen wir erkennen, dass beide Ideologien eine ökonomische Dimension besitzen − auch hier sind übrigens deutsche Historiker vorangegangen. Ich meine, dass beide Ideologien, wenn man hinter ihre unmittelbare Ausdrucksform schaut, den Rassenkrieg oder den Klassenkrieg, auch Transformationsprojekte waren. Der Nationalsozialismus propagierte einen Rassenkrieg zur Vernichtung der Juden, aber dieser Krieg war gleichzeitig ein Projekt zur Kolonisierung eines großen Teils von Osteuropa. Er sollte zur industriellen Moderne in Deutschland ein ländliches Gegengewicht schaffen, in dem die Deutschen alle anderen Menschen entfernen und sich reinigen konnten. Ähnlich die Sowjets. Man sieht ihre Ideologie als eine des Klassenkampfes, und das ist natürlich richtig, aber der Klassenkampf hatte eine bestimmte Form, ein bestimmtes erwünschtes Ziel, und dieses Ziel war eine industrialisierte Gesellschaft, in der die Landwirtschaft kontrolliert und zur Modernisierung genutzt werden sollte. Das war fast das Gegenteil der NS-Ideologie. Die NS-Ideologie versprach, ein modernes Land durch ein agrarisches Utopia zu ergänzen. Die Sowjetideologie stellte dagegen in Aussicht, ein zurückgebliebenes Land zu modernisieren. Wir halten diese beiden Visionen gern getrennt, aber auch sie überschneiden sich in einem Gebiet, und dieses Gebiet ist vor allem die Ukraine.
Wir müssen verstehen, dass unsere Einordnung von Ideen eine Sache ist, und die Art, wie Systeme von den Menschen erlebt wurden, eine andere. Wir müssen die Unterschiede zwischen den Ideen erkennen, aber das ändert nichts daran, dass zum Beispiel Ukrainer sich daran erinnern, dass beide Regimes ihren Hungertod wünschten.
Ideologie kann ein bestimmtes Territorium in den Fokus der Weltgeschichte rücken. Nazis und Sowjets besaßen globale Visionen über Veränderung, über das Bild der Zukunft. Die Nazis stellten sich einen echten Weltkrieg vor, den sie gegen Briten und Amerikaner gewinnen würden. Sie stellten sich eine Welt vor, in der alle Juden vernichtet wären, aber in der Zwischenzeit – und das ist historisch immer die wichtigste Zeit, denn wir befinden uns stets darin – mussten die Nazis Osteuropa kontrollieren. Sie mussten ein Imperium schaffen, das eine rassische Erlösung ermöglichte, aber auch die Autarkie gegenüber Briten und Amerikanern. Auch die Sowjets hatten eine globale Vision. Sie glaubten, ihre Revolution sei etwas zu früh gekommen, aber später werde es weitere Revolutionen geben, zuletzt eine Weltrevolution. In der Zwischenzeit, auch hier die einzige Zeit, auf die es ankommt, waren die Kollektivierung der Landwirtschaft und die Industrialisierung wichtig, und auch diese Vision hatte einen bestimmten geografischen Fokus, in erster Linie die Ukraine.
Nachdem wir all das verstanden haben, ist die Katastrophe weniger überraschend. Wenn wir wissen, dass es zwei sehr unterschiedliche, aber fantastisch ehrgeizige neokoloniale Projekte gab, die denselben Teil Europas im Blick hatten, überrascht es nicht, dass so viele Menschen hier und nicht woanders sterben. Da beide Ideologien auf fruchtbaren Boden fixiert waren, überrascht es nicht, dass die wichtigste Methode des Massenmords in den 1930er- und 1940er-Jahren der Hungertod war. Es überrascht auch nicht, dass beide Regime in einem Punkt einig waren: die Zerschlagung des unabhängigen Polen. Aus der Sicht Moskaus wie aus der Sicht Berlins war der polnische Staat ein Hindernis. Er stand im Weg. Er hinderte sie an der Verwirklichung ihrer Ziele. In diesem Punkt waren Hitler und Stalin einer Meinung, und deshalb wurden sie 1939 militärische Verbündete. Worüber sie sich aber nicht einigen konnten, war die Ukraine. Aus der Sicht Deutschlands war die Ukraine der Brotkorb, der als Ergänzung zu seiner Industrie dienen sollte. Aus sowjetischer Sicht war die Ukraine der Brotkorb, der zum Aufbau der Industrie notwendig war. Die Ziele waren unterschiedlich, ebenso die Ideologien und die Zukunftsvision, aber das Land, um das gerungen wurde, war dasselbe, und nur einer konnte es beherrschen. Als sie dann gegeneinander kämpften, mussten sie um die Ukraine kämpfen, und das taten sie ab 1941.
5. »Bloodlands« und der Holocaust
Was bedeutet all das für die Juden? Damit es zum Holocaust kommen konnte, musste es eine Kombination aus zwei Elementen geben. Erstens war da die Judenfeindschaft der Nazis, die antijüdischen Maßnahmen, die damit begründet wurden, dass an allem deutschen Übel die Juden Schuld seien. In Verbindung damit gab es eine intellektuelle, politische und militärische Energie, die sich auf die osteuropäische Heimat der Juden richtete. Beides war notwendig. Die antisemitischen Ideen der Nazis allein hätten keinen Holocaust erzeugen können, weil 1939 nur 0,25 Prozent der deutschen Bevölkerung jüdisch war. Oder anders betrachtet: Als der Holocaust schließlich stattfand, waren 97 Prozent seiner Opfer Menschen, die kein Deutsch sprachen und außerhalb Mittel- und Westeuropas lebten, aus dem einfachen Grund, weil die Juden zu diesem Zeitpunkt ein weitgehend osteuropäisches Volk waren. Es braucht also beides, die besondere deutsche Judenfeindschaft und eine Erklärung, warum es in der Weltheimat der Juden einen solchen Konflikt gab.
Ich habe gerade versucht, eine Argumentation zu entwickeln, die so nicht im Buch ausgeführt wird, aber dessen Aufbau erklärt. Das Buch untersucht nacheinander die verschiedenen Mordmaßnahmen. Es beginnt mit der Hungersnot in der ukrainischen Sowjetrepublik in 1933. Dann betrachtet es die beiden Hauptformen des Großen Terrors in der Sowjetunion, den Massenmord an politisch verdächtigen Bauern (sogenannten Kulaken) und den Massenmord an politisch verdächtigen ethnischen Minderheiten. Ein entscheidendes Kapitel ist das vierte Kapitel über den Hitler-Stalin-Pakt 1939. Es ist ein wichtiges Kapitel, weil es als entscheidend erachtet, dass die Sowjetmacht nach Westen vorrückt, indem sie sich Ostpolen und das Baltikum einverleibt. Die Folge ist, dass die deutsche Macht jetzt massiv mörderisch wird, was vorher nicht im gleichen Maße der Fall war. Mit der Invasion Polens wurden die Einsatzgruppen aktiv.
Darüber hinaus begann mit dem Hitler-Stalin-Pakt de facto der Zweite Weltkrieg. Dieser Krieg hätte auch auf andere Art beginnen können, aber ich halte die Tatsache, dass er mit dem Hitler-Stalin-Pakt begann, für sehr aufschlussreich und wichtig. Der Pakt war etwas, woran Polen, Litauer, Letten und Esten die Erinnerung wachhalten wollten, weil er ihre Staaten zerstörte. Und ihre Staaten wurden von Deutschen und Sowjets gemeinsam zerstört. Für die Juden hatten der Pakt und die Zerstörung dieser Staaten die gravierendsten Folgen: Wenn man im Zweiten Weltkrieg als Jude an einem Ort in Europa lebte, in dem der Staat zerstört war, in dem staatliche Institutionen abgeschafft oder verdrängt waren, lag die Überlebenschance bei 1 zu 20. Wenn man als Jude in dieser Zeit an einem Ort in Europa lebte, in dem es einen Staat gab, selbst wenn dieser Staat mit Deutschland verbündet war wie Rumänien, Italien, Ungarn oder Bulgarien, und selbst wenn es Nazideutschland selbst war, lag die Überlebenschance bei etwa eins zu zwei. Angesichts der zentralen Rolle des Staates für das politische Denken im Allgemeinen und das jüdische politische Denken im Besonderen überrascht es, wie wenig Aufmerksamkeit wir der Zerstörung der Staaten 1939 zuwenden. Wir sahen bisher in Osteuropa nur ethnische Gruppen, aber kaum Institutionen. Unsere Sicht auf die Massenmorde war gewissermaßen nazifiziert.
Im fünften Kapitel versuche ich, den Ablauf des Holocaust zu erklären. Die Nazis hegten von Anfang an die Vorstellung, dass die Juden aus Europa verschwinden müssten. In der Praxis sollten die Juden aus dem ganzen deutschen Machtbereich entfernt werden, aber wie sollte man das anstellen? Zuerst drehten sich die Pläne des Regimes um Deportation. Deutschland eroberte Polen und deportierte die Juden aus einem Teil Polens in einen anderen. Das war wenig befriedigend. Dann überlegten die Nazistrategen, sie nach Madagaskar abzuschieben, dann in die Sowjetunion − Eichmann fragte sogar in Moskau an, ob die UdSSR zwei Millionen Juden aufnehmen würde. Dann hieß das Projekt: Wenn wir die Sowjetunion angreifen, werden wir die Juden nach Osten treiben.
Die deutsche Invasion der Sowjetunion im Juni 1941 war mit fürchterlich destruktiven Ideen verbunden, und als die Nazis die Grenzen ihrer Möglichkeiten erkannten, beschleunigten sie die sogenannte Endlösung. Zu Beginn des Angriffs glaubten die Deutschen, sie könnten die Rote Armee und den Sowjetstaat binnen neun Wochen zerschlagen und 30 Millionen Menschen im ersten Winter nach dem Sieg verhungern lassen. Eine große Kolonisierungskampagne sollte einerseits viele weitere Millionen vertreiben und dem Hungertod überlassen und andererseits die sogenannte Judenfrage lösen. Aber die Rote Armee leistete Widerstand, der Sowjetstaat brach nicht zusammen, die Deutschen konnten nicht so viele Menschen verhungern lassen wie geplant, wenn auch in sehr großer Zahl, was man nicht vergessen sollte: eine Million in Leningrad, dazu 3,1 Millionen Kriegsgefangene. Die Juden, denen natürlich die Schuld an allen Rückschlägen gegeben wurde und die mit dem Sowjetstaat identifiziert wurden, ermordeten die Deutschen seit Beginn der Invasion in immer größerer Zahl. Damit wurde die Endlösung zu dem, was wir den Holocaust nennen. Von diesem Punkt an stellt der Hauptteil des Buches die Mechanik dieses Vorgangs dar, zunächst im Baltikum, dann in der Ukraine, dann in Belarus/Weißrussland, dann in Polen.
6. Der Vergleich
Lassen Sie mich mit einer kurzen Bemerkung schließen, was dieses Buch leisten will und was nicht. Es will nicht vergleichen. Ich muss das betonen, besonders in Deutschland, weil der deutsche Methodennationalismus sich meistens durch zwei Argumente schützt: Erstens behauptet er, jede übernationale Geschichtsschreibung Osteuropas sei ein Vergleich (stimmt nicht); zweitens meint er, Vergleichen bedeute Gleichsetzen (noch mal falsch), um sich dann selbst dafür zu loben, keine Vergleiche anzustellen. Das ist eine Art intellektueller Nationalsport, der nur innerhalb der engen Grenzen des deutschen Methodennationalismus einen Sinn ergibt, wenn überhaupt. Dies gilt nicht für die ernstzunehmenden deutschen Holocaustforscher, die meine Herangehensweise in der Regel als konventionell oder sogar zu konservativ beurteilen. Wohl aber für diejenigen, welche die historische Literatur zum Holocaust in Osteuropa nicht wirklich kennen, sagen wir die Bücher von Gerlach bis Dieckmann. Anders ausgedrückt: Die Kritik meines Buches durch manche deutsche Wissenschaftler erscheint mir zuweilen als ein Ersatz für die nicht erfolgte Diskussion über die deutsche Historiografie des Holocaust der letzten zwanzig Jahre.
Was gar nicht sinnvoll ist, wäre eine Neuauflage des Historikerstreits, zumal es sich damals um eine rein deutsche Diskussion handelte, in der Osteuropa und die Juden fast gänzlich ausgeblendet wurden und in der die zwei Pole nationalistisch angehaucht waren: Nolte mit seiner unhaltbaren Argumentation und seiner Intention, die deutsche Geschichte zu exkulpieren; Habermas mit seiner Prämisse, dass Geschichte die Schule der Nation sei. In Noltes Fußstapfen sind heute diejenigen getreten, die nur deutschsprachige Quellen benutzen, um osteuropäische Ereignisse zu erörtern. Habermas folgen diejenigen, die Geschichte zugunsten von »Erinnerung« in den Hintergrund drängen, weil sie lieber selbst entscheiden, welche Lektüre für andere – in der Regel Osteuropäer – gut oder schlecht ist, statt ernstzunehmende intellektuelle Diskussionen zu führen.
Der Historikerstreit kann kein Gerüst für eine transnationale Geschichte des Holocaust sein, denn man würde die Diskussion verdeutschen, noch bevor sie überhaupt geführt werden kann. Wie die meisten Rezensenten richtig erkannt haben, betreibe ich eher transnationale als vergleichende Geschichte. Wer vergleicht, geht von zwei Voraussetzungen aus: Dass wir alles über die beiden Systeme wissen, was wir brauchen, und dass wir sie analytisch trennen und einzeln untersuchen können. Ich glaube nicht, dass wir alles über das NS- oder das Sowjetregime wissen, weil gerade ihre Pläne für Osteuropa und die Art, wie sie dort aufeinander trafen, zentrale Aspekte zu ihrem Verständnis liefern. Das Buch hat also viel mehr mit Interaktion als mit Vergleich zu tun. Ein Vergleich setzt eine analytische Trennung voraus. Eine Interaktion ist ein empirisch beobachtbares Ereignis.
Dennoch will ich den Vergleich als analytische Methode nicht beiseite schieben, weil ich glaube, ohne Vergleiche sind wir nicht in der Lage, irgendetwas Bedeutungsvolles über den Holocaust oder ein anderes dieser Verbrechen zu sagen. Wenn man sagt, der Holocaust sei schlimmer als alles andere, hat man bereits einen Vergleich angestellt. Doch wenn man diesen Vergleich anstellt, sollte es ein sinnvoller Vergleich sein, das heißt, es müssen auch Ähnlichkeiten oder gar Gemeinsamkeiten trotz aller Unterschiede bestehen. Sehr oft ist das nicht der Fall.
Obwohl mein eigenes Projekt also nicht primär vergleichend ist, ist mir klar, dass einer Tabuisierung von Vergleichen jede ernsthafte historische Arbeit auf diesem Gebiet unmöglich machen würde. Denn um Vergleiche zu verbieten, muss man das Denken einschränken. Das ist unmöglich, zumal in den Quellen selbst verglichen wird. Jeder, der längere Zeit Zeugnisse von Holocaustüberlebenden gelesen hat, und ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, weiß, dass Juden in Osteuropa Vergleiche zogen, so wie alle anderen auch, aus dem einfachen Grund, weil sie die jeweils andere Besatzungsmacht erlebt oder zumindest geahnt hatten, dass sie wiederkommen werde. Man hatte Gründe, sich über die Herrschaft der Sowjets und der Nationalsozialisten Gedanken zu machen: Flieh in die eine Richtung. Flieh in die andere Richtung. Bau einen Bunker. Bau keinen Bunker. Stell dich mit den örtlichen Kommunisten gut. Versuch dich mit dem örtlichen Priester gutzustellen. Je nachdem. Die Quellen sind voller Vergleiche. Sie sind ein unvermeidlicher organischer Teil der Erfahrung und der Geschichte.
Ich verstehe, dass die Vorsicht gegenüber Vergleichen mit der Vorstellung zu tun hat, wenn mehr als eine Sache ins Bild komme, werde das im Bild verkleinert, was doch so wichtig sei. Mein Eindruck ist dagegen: Das Bild ist viel größer, als man dachte. Die Sorge um das, was möglicherweise durch Verkleinerung nicht in angemessener Größe erscheint, ist standortgebunden. Nicht wenige Menschen waren zum Beispiel besorgt, mein Buch verharmlose den Stalinismus, weil ich den Stalinismus zu rational erscheinen lasse und weil ich die Zahl der Opfer des Stalinismus niedriger ansetze. In Deutschland befürchtet man dagegen, der Holocaust werde relativiert. In der Epoche des Kalten Krieges bis zum Erscheinen meines Buches sagten Historiker einerseits, die Sowjets waren wohl auf eigene Weise schlimmer, weil sie mehr Menschen ermordeten, aber der Holocaust sei etwas Anderes und Besonderes, weil es der einzige Versuch war, ein gesamtes Volk zu vernichten. Dieses Credo stimmt nur zur Hälfte: Nicht die Sowjets ermordeten mehr Menschen, sondern die Deutschen − allein dem Holocaust fielen mehr Menschen zum Opfer als allen stalinistischen Mordmaßnahmen zusammen. Mit anderen Worten, der Holocaust war nicht nur qualitativ, sondern quantitativ schlimmer, wenn wir von schlimmer reden wollen. In diesem Sinne verteidigt mein Buch radikal die These von der Einzigartigkeit des Holocaust. Transnationale Geschichte liefert somit belastbarere Ergebnisse als Nationalgeschichte.
Die Methode des Buchs ermöglicht Vergleiche gerade deshalb, weil ihm keine vergleichende Methode zugrunde liegt. Vergleichen dürfen wir jedoch erst am Ende, nicht am Anfang. Mit dem Vergleich zu beginnen heißt, analytisch zu trennen, was empirisch nicht trennbar ist, zum Beispiel und vor allem die Erfahrungen der Bewohner der »Bloodlands«. Am Ende kehren wir natürlich zu den großen Kategorien und großen Zahlen zurück, aber hoffentlich nur nach einer Betrachtung, die diese Erfahrung historisch wiederhergestellt hat. Meine Fragen sind dabei: Erstens, warum wurden so viele Menschen ermordet; und zweitens, was bedeuten diese Massenmorde? Was wir von Hitler, Stalin und dieser Epoche erben, sind riesige, erdrückende, überwältigende Zahlen. Sie sind eine der vielen Arten, auf die Hitler und Stalin die Geschichte des 20. Jahrhunderts dominieren. Die Historiografie als eine Humanwissenschaft sollte anerkennen und ernstnehmen, dass diese Zahlen nicht bloß quantitative, sondern qualitative Bedeutung haben. Dass die großen Zahlen sich aus kleinen Zahlen zusammensetzen. Alle großen Zahlen bestehen aus einzelnen Einheiten – solche »Einheiten« sind nicht abstrakt sondern unverwechselbare Personen.
Es gelang den politischen Systemen der Sowjetunion und NS-Deutschlands, Menschen zu Zahlen zu machen, und es gelang uns bisher weniger gut, sie wieder zu Menschen zu machen. Für mich ist das die Aufgabe der Geschichtsschreibung. Sie sollte versuchen, aus den Zahlen wieder Menschen zu machen. In diesem Sinne möchte ich Ihnen die Namen der Menschen nennen, die ich zu Beginn erwähnte, denn natürlich trugen alle 14 Millionen Menschen, die ermordet wurden, einen Namen. Der Ukrainer, der sein eigenes Grab schaufelte, hieß Petro Veldii. Der Pole, der ein Tagebuch führte, hieß Adam Solski. Und die junge jüdische Frau, die ein paar Stunden vor ihrer Erschießung eine Botschaft an ihre Mutter in die Wand der Synagoge ritzte, hieß Dobcia Kagan.
Nachbemerkung
Wer an anderen Repliken auf die umfangreiche Kritik – etwa zu den Themen Kollaboration, Ausmaß der Morde, Kausalität und Erinnerung – interessiert ist, sei verwiesen auf Snyders Texte: »Collaboration in the Bloodlands«, in: Journal of Genocide Research 13 (2011) 3, 313–352; »Global History and the Holocaust«, in: H-Diplo, 13 (2011) 2; »The Causes of the Holocaust«, in: Contemporary European History 21 (2012) 2, 149–168; »The Problem of Commemorative Causality in the Holocaust«, in: Modernism/Modernity (2013)
Ich kann mich den Glückwünschen an die Adresse der Jury zur Wahl des diesjährigen Preisträgers nur anschließen. Nicht nur deshalb, weil sein großes Werk Bloodlands perfekt zu dem großen europäischen Gedenkjahr passt, vor dem wir stehen – 2014, hundert Jahre Beginn des Ersten Weltkrieges, fünfundsiebzig Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges und fünfundzwanzig Jahre nach der großen Zäsur der demokratischen Revolution in Osteuropa –, sondern weil Timothy Snyder auch in enger Verbindung zu früheren Trägern des Hannah-Ahrend-Preises steht, insbesondere zu Tony Judt, dem Preisträger von 2007. Er hat posthum einen Band mit Gesprächen veröffentlicht, die er mit Judt über sein Leben und zur Geschichte des 20. Jahrhunderts führte – Nachdenken über das 20. Jahrhundert –, den ich sehr zur Lektüre empfehlen möchte. Die Wahl von Timothy Snyder erinnert auch an andere Preisträger, zum Beispiel François Furet und seine Geschichte des Kommunismus, aber auch an Jelena Bonner. Es gibt eine gewisse Linie in den Entscheidungen der Jury des Hannah-Ahrendt-Preises, die sich in dem diesjährigen Preisträger fortsetzt.
Was ich an Ihrem Buch, neben vielem anderen, wozu heute noch Berufenere sprechen werden, besonders erhellend fand, war der Bogen, den Sie zum Jahr 1914 geschlagen haben. Der Erste Weltkrieg hat die Büchse der Pandora geöffnet, aus dem die Schrecken emporstiegen, die dann dieses europäische 20. Jahrhundert, genauer die erste Hälfte des Jahrhunderts, gekennzeichnet haben: Nationalismus, Völkerkrieg, Klassenkrieg, Entfesselung schrankenloser Gewalt, Deportation, Völkermord – ich erinnere an den Mord an den Armeniern am Ende des Ersten Weltkrieges, der für Hitler ein erster Großversuch ethnischer Säuberung und genozidaler Politik war, den er sehr wohl beobachtet hat; auch ein Test darauf, was die internationale Öffentlichkeit, die Völkergemeinschaft hinzunehmen bereit war. Aushungerung als Waffe, auch das ist bereits im Ersten Weltkrieg und in den folgenden Jahren erprobt worden. In Russland sind schon 1920/ 1921, bei der ersten Welle der Konfiskation von Getreide und des Angriffs auf die privaten Bauern, mehrere Millionen Menschen verhungert – ein Vorläufer der zweiten großen Welle 1932/1933, die vor allem in der Ukraine stattfand.
Man muss darüber nachdenken, weshalb diese exzessive Gewalterfahrung, die mit dem Ersten Weltkrieg begonnen hat – dazu gehört auch der monströse Stellungskrieg, mit dem Millionen von Soldaten für minimale Geländegewinne abgeschlachtet wurden –, wieso diese exzessive Gewalterfahrung nicht zu einer Pazifizierung der europäischen Politik führte, sondern im Gegenteil zur zunehmenden Radikalisierung. Sie setzte schon vor dem Ausbruch der großen Weltwirtschaftskrise 1929 ein, und zwar beileibe nicht nur in der Sowjetunion und in Deutschland, den beiden revisionistischen Mächten im Zwischenkriegseuropa, die auf Umsturz der politischterritorialen Ordnung aus waren, die nach dem Ersten Weltkrieg entstand. Dabei ging es ihnen nicht nur um eine Revision der Grenzen, sondern um die Umwälzung der gesamten gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Insofern war auch der Nationalsozialismus eine revolutionäre Macht. Er war auf Umsturz aus, und zwar nicht nur auf staatlichen Umsturz, sondern auf den Umsturz aller Werte. Timothy Snyder arbeitet sehr gut heraus, dass Gewalt in der Sowjetunion, vor allem beim Stalinismus, als Mittel der inneren Kolonisierung der Gesellschaft eingesetzt wurde, während exzessive Gewalt für den Nationalsozialismus Teil der Lösung der sozialen Frage in Deutschland durch Errichtung eines germanischen Imperiums im Osten war. Das schloss Kolonisierung, Deportation, Assimilation einer kleinen Minderheit und Versklavung und Vernichtung der Mehrheit der Bevölkerung dieses Raums ein. Dieses exterministische Programm richtete sich nicht nur gegen die Juden, sondern auch gegen die slawischen Völker.
Von den ehemaligen »Bloodlands« Mittelosteuropas haben bisher Polen und die baltischen Staaten ihren Weg in die europäische Demokratie gefunden, mehr oder weniger gut, aber ich glaube doch irreversibel. Die Ukraine und Weißrussland bleiben bis heute in einer prekären Zwischensituation zwischen Autoritarismus und Demokratie, zwischen einem freiheitlichen Europa und einem Sonderweg, der sich von der westlichen Moderne abgrenzt. Das gilt auch für Russland selbst. Es ist nicht entschieden, welchen Weg diese Länder gehen werden – das liegt auch an uns, an der Politik der Europäischen Union. Wir werden diese Entscheidung nicht stellvertretend für sie treffen können, aber es ist auch an uns, alles zu tun, um den Weg in ein demokratisches Europa für diese Länder offen zu halten. Die Mission von 1989/90, der Prozess der europäischen Integration, ist noch nicht abgeschlossen. Wir sollten alles tun, um ihn zu befördern. Er ist erst vollendet, wenn ganz Europa einig und frei ist.
Ich wage die These, dass in diese politische und kulturelle Ambivalenz der Ukraine, Weißrusslands und Russlands die ungeheure Traumatisierung hineinspielt, die Timothy Snyder beschreibt. Die äußerste Gewalterfahrung dieser Zeit wirkt fort, und zwar nicht nur im kollektiven Unterbewusstsein dieser Gesellschaften, sondern auch in ihren gesellschaftlichen Strukturen. Der Terror des Nationalsozialismus wie des Stalinismus richtete sich ja nicht nur gegen Individuen. Zerschlagen wurden die gesellschaftlichen Strukturen in diesen Ländern, und zwar in einer ungeheuren Gründlichkeit, von der sie sich bis heute nicht erholt haben. Es dauert lange, um so etwas wie eine bürgerliche Gesellschaft wieder aufzubauen. Sehr lange!
Vor dem Hintergrund der europäischen Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts grenzt das, was in den Jahren seit 1989 passiert ist – die friedliche Revolution und die Überwindung der staatssozialistischen Regime, die demokratische Transformation einer ganzen Reihe von Ländern und die Osterweiterung der EU – fast an ein Wunder. Die Aufarbeitung der traumatischen Gewaltgeschichte, die über Mittelosteuropa liegt, ist ein wichtiger Beitrag zur europäischen Einigung. Und die Verleihung des HannahArendt-Preises an Tymothy Snyder ist eine gute Gelegenheit, an den Auftrag der europäischen Einigung zu erinnern. Man kann die Europäische Union nicht nur aus der Geschichte begründen, als ein Projekt gegen Gewaltherrschaft, Nationalismus und Völkermord. Aber das war und ist ein wesentlicher Impuls, sich weiter für dieses demokratische und vereinigte Europa einzusetzen.
Beitrag auf dem Bremer Kolloquium
Ich möchte an einem zentralen Gedanken anknüpfen, den Timothy Snyder hier entwickelt hat: nämlich dass sich am »Auschwitz«-Topos eine Art Grundaufstellung der historischen Erinnerung kristallisiert habe, die sich in »Zivilisierer« und »Nationalisierer« teilen lasse. Da wäre einesteils die in den Nationalsozialismus abkippende, sich selbst zerstörende oder verstümmelnde deutsche Zivilisation, deren Massenverbrechen von Dan Diner als ein regelrechter »Zivilisationsbruch« bezeichnet worden sind. Da ist andererseits dieser mittelosteuropäische Raum, der aus deutscher Perspektive in der Zwischenkriegszeit als ein bloßes »Zwischeneuropa«, ein von den westlichen Siegermächten in Versailles installierter »Cordon Sanitaire« mehr oder weniger willkürlich zugeschnittener Einzelstaaten wahrgenommen worden ist, die zu einer eigenständigen, höheren Kultur und Staatlichkeit nicht fähig waren und auch deshalb zum Kerngebiet der »Bloodlands« wurden. Und jenseits dessen lag eine Sowjetunion, die – so Snyders These – in der Erinnerungsaufstellung eher auf die Seite der »Zivilisierer« gerechnet wird, während die Länder des heutigen Mittelosteuropa auf der Seite der »Nationalisierer« stehen.
Dabei ist weder der eine noch der andere Begriff pejorativ beziehungsweise affirmativ zu verstehen; allerdings geht Snyders Argumentation, wenn ich recht verstehe, dahin, die angeblich borniertere Perspektive der »Nationalisierer« gegenüber der angeblich universelleren der »Zivilisierer« zu rehabilitieren. Ob man diese Begriffe passend findet, kann dabei erst einmal dahingestellt bleiben; es ist klar, was im Großen und Ganzen gemeint ist. Ich möchte diese Einteilung im Sinne unseres Themas einer »geteilten Erinnerung« im Prinzip aufnehmen, das Bild aber durch einige zentrale Befunde meines Buchs Der Russlandkomplex etwas weiter nuancieren und ihm eine historisch-genetische Dimension geben, die über das Chronotop von 1933 bis 1945, in dem Snyder die »Bloodlands« angesiedelt hat, in beide Richtungen hinausreicht.
Zunächst ist festzuhalten, dass die UdSSR besonders für die Deutschen, aber auch für große Teile der westlichen und vermutlich auch der mitteleuropäischen Öffentlichkeiten, über weite Strecken, wenn nicht bis zu ihrem Ende, im Kern noch immer mit »Russland« identifiziert wurde – um das es heute auch wieder geht. Die ganzen 1920er-Jahre hindurch sprach man in Deutschland so gut wie nie von der Sowjetunion, sondern von »Sowjetrussland« oder vom »Neuen Russland«. Was aus diesem Moskauer Großstaat neuen Typs einmal werden würde, als was er sich am Ende entpuppen würde, erschien noch ganz unklar. Klar war nur, dass die »Union Sozialistischer Sowjetrepubliken« eine Verwandlungsform des alten Russischen Reiches war, zu dem die Deutschen über zwei Jahrhunderte hinweg eine besondere, vielfältig changierende Beziehung unterhalten haben, die in einem binären Freund/Feind-Schema nicht aufgeht.
Das Changierende dieser Beziehungen und Wahrnehmungen ergab sich – um nur ein paar Stichworte zu nennen – zum Beispiel daraus, dass man es an der Basis mit einem riesigen Bauernland zu tun hatte, wobei es keine Rolle spielte, ob diese Bauern Russen, Ukrainer oder was immer waren. Wenn vom »russischen Menschen« die Rede war, dann war ein einfacher, bäuerlicher Mensch gemeint, den man fast im selben Atemzug negativ (als »primitiv«, »schmutzig« etc.) oder positiv (als »unverbildet«, »seelenvoll« etc.) beschreiben konnte – und oft lag nur eine Nuance dazwischen. Weit oberhalb dieser stationären bäuerlichen Basis erstreckte sich eine Zivilisationsschicht, die fast völlig europäisiert und zu großen Teilen eben deutsch geprägt war. Das galt nicht nur für die vielfältigen, beinahe exklusiven verwandtschaftlichen Beziehungen, die es seit petrinischer Zeit zwischen einigen deutschen Fürstentümern und dem russischen Hof gegeben hatte; das betraf auch das bedeutende, zeitweise fast dominante deutsche Element im zaristischen Verwaltungsapparat, besonders im Militär oder bei der Polizei; es betraf ein weiträumig agierendes, oft prosperierendes russlanddeutsches Unternehmertum, das sich im Baltikum oder an der Wolga auf große, aktive städtische oder agrarische deutsche Siedlungskerne stützen konnte; und das betraf die vielen deutschen Wissenschaftler und Schulmeister, Ingenieure oder Agronomen an den Akademien, Schulen und Hochschulen oder in den Großunternehmen und Planungsbehörden des Zarenreichs. Diese Aufzählung ließe sich noch fortsetzen.
Dazu kam Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, was Thomas Mann damals als »das Wunder der russischen Literatur« rühmte. Russland entpuppte sich als eine »Kulturnation« allerersten Ranges, teils betont konservativen Zuschnitts, teils existenzialistisch revolutionär gestimmt, und formal als Avantgarde auf so ziemlich allen Gebieten der Literatur, der modernen Kunst, der Musik, des Theaters und so fort.
Andererseits war dieses Russische Reich am Beginn des 20. Jahrhunderts ein Land, das wegen der notorischen Unruhe in seinen modernen, städtischen Milieus, von der Intelligenz bis zu den Arbeitern, aber zunehmend auch unter seinen Bauern angesichts des überkommenen, starren zaristischen Machtsystems zu einer Revolution verurteilt schien. Diese Revolution figurierte, zumal nach den Erfahrungen des Ausbruchs von 1905, in den strategischen Erörterungen der deutschen Reichsleitung vor und im Ersten Welt krieg als eine Tatsache, mit der man mehr oder weniger rechnen konnte, wenn es sich darum handelte, dieses Vielvölkerreich durch seine kriegerische Überbeanspruchung in einen Zustand der »Dekomposition« zu treiben und es so aus der Front der Feinde herauszubrechen oder einer deutschen »Durchdringung« zu öffnen. Die Frage war nur, welche Akteure in einer solchen Revolutionierung und Zerlegung Russlands zum Zuge kommen würden. In diesen Zusammenhang gehörte die kaltblütige Förderung der Bolschewiki und vieler anderer russischer, ukrainischer oder georgischer Revolutionäre durch das kaiserliche Deutschland.
Am Ausgang des chaotischen Revolutionsjahrs 1917, nach der Machteroberung der Bolschewiki, zeigte sich das alte »Russland plötzlich verwandelt«, wie man mit einem Buchtitel Kischs sagen könnte, und die deutschen Dekompositions-Pläne schienen aufgegangen – und das selbst über die eigene Niederlage und die Fieberschübe einer Bolschewismusfurcht 1918/19 hinaus. Im russischen Bürgerkrieg und in der Abwehr westlicher Interventionen und Teilungspläne erstand der Moskauer Staat in neuer Form wieder auf, als eine um »Sowjetrussland« gruppierte neue Union. Im Zeichen einer gemeinsamen Frontstellung gegen das »Versailler Weltsystem« ergab sich in den 1920er-Jahren so ein vielschichtiges und doppelbödiges Spiel deutschrussischer Verbindungen. Der Rapallo-Vertrag von 1922 hatte unter seiner harmlosen Oberfläche eine deutlich strategisch-revisionistische Komponente, die sich etwa in der geheimen, sehr weitgehenden Militärzusammenarbeit ausdrückte. Zugleich gab es eine dicht befahrene Kulturschiene MoskauBerlin. Es gab große ökonomische Kooperations- und Erschließungsprojekte. Und es gab im Weimarer Deutschland eine regelrechte literarische Obsession mit dem alten und dem neuen Russland. Das wieder aufgerichtete Sowjetrussland war für das amputierte, in seinen Weltmachtambitionen zurückgestutzte Deutsche Reich noch immer und jetzt sogar noch mehr das Inbild eines großen, vielgestaltigen Territorialreichs, das potentiell (in welcher Weise auch immer) für die im Westen blockierte und gedemütigte Weimarer Republik einen Ausweg oder jedenfalls einen fast natürlichen Betätigungsraum zu bieten schien.
Die Hitlerschen Ostraumpläne waren eine direkte Umkehrung der vielfältigen »Ostorientierungen« dieser Zeit, wie sie gerade auch in deutschnationalen oder nationalrevolutionären Milieus grassierten; wobei mit dem »Osten« immer Russland gemeint war. In Mein Kampf gab Hitler daher explizit als die neue Losung aus: Statt »Ostorientierung« – »Ostpolitik«. Der junge Goebbels war wie vor den Kopf geschlagen, als Hitler aus dem Gefängnis kam und bei der Führertagung Anfang 1926 seine neue Doktrin verkündete: Mit Sowjetrussland könne man sich nicht verbünden, man müsse seinen Zerfall beschleunigen und sich im Zuge dessen »Lebensraum im Osten« sichern.
Zu dem zu arrondierenden und kolonial zu durchdringenden Ostraum rechnete Hitler an erster Stelle sicherlich (in den Spuren der ludendorffschen Ostpolitik) eine vom Moskauer »jüdisch-bolschewistischen« Zentrum sich lösende Ukraine; aber natürlich ging es immer auch um das Baltikum, um Polen, die Tschechoslowakei oder Rumänien. »Lebensraum im Osten« – von dem schon das erste, von Rosenberg verfasste NSDAP-Programm 1921 gesprochen hatte – hieß zunächst nur, dass Deutschland sich eine Einflussund Erweiterungszone im Osten schaffen müsse, bestehend aus Ländern, Gebieten oder Staaten, die in welcher Form immer dem Reich politisch und wirtschaftlich anzugliedern waren. Das konnten Verbündete, Klienten oder Vasallen sein. Es bedeutete nicht notwendig territoriale Expansion und Annexion, und erst recht bedeutete es nicht eine militärische Zerschlagung der gesamten Sowjetunion; das wäre 1925/26 auch eine reichlich vermessene Idee gewesen. Klar war nur, und damit bewegten die Nazis sich in einem relativ breiten Strom der Weimarer Politik und Publizistik, dass die Zukunft Deutschlands im weiten Osten der »jungen Völker« lag, und nicht im alten Westen, der nicht nur den Nazis dekadent, »verniggert« und »verjudet« erschien.
Eine Politik des »Lebensraums im Osten« konnte man hypothetisch auch in einer losen Allianz oder Koordinierung mit Sowjetrussland verfolgen, als dem anderen großen Gegner der Versailler Weltordnung. So dachte ja ein großer Teil der Reichswehrführer, wenn sie in ihren Kamingesprächen mit der Führung der Roten Armee eine Zerschlagung Polens ventilierten; so dachte ein Gutteil der nationalistischen Intelligenz, etwa im fluktuierenden Feld der Gruppen und Organe der »Konservativen Revolution«; und so dachte eben auch ein Gutteil der Nationalsozialisten selbst, wie der linke NS-Flügel um die Strasser-Brüder oder eben den jungen Goebbels, der, als er von Hitlers neuer Doktrin hörte, fassungslos in sein Tagebuch schrieb: Wir – gegen Russland?!
Aber selbst in Alfred Rosenbergs Mythus des 20. Jahrhunderts, der 1930 herauskam, ist ein rotes »Moskowien« perspektivisch noch immer Teil des geopolitischen Spiels, und keineswegs notwendig ein Feind Deutschlands – sofern es eben gelänge, den expansiven Bolschewismus von Westen nach Osten, nach Asien umzulenken, wohin er eigentlich gehörte und wo er sogar große Aufgaben hätte; während Mittelosteuropa vom Baltikum (Rosenbergs Heimat) abwärts bis zur Ukraine in der einen oder anderen Form als Betätigungsfeld und Lebensraum eines nationalsozialistischen Deutschlands designiert war. So lautete in etwa die strategische Generallinie anno 1930, im Moment des Aufstiegs der Hitler-Bewegung.
Tatsächlich war von einer Zerschlagung der Sowjetunion in Hitlers Propaganda vor der Machteroberung kaum die Rede, so auch nicht in seiner Programmrede vor deutschen Schwerindustriellen im Düsseldorfer RheinRuhr-Klub 1932, für die die stalinschen Fünfjahrpläne ja eher ein Rettungsanker in der Weltwirtschaftskrise waren. Von der in Mein Kampf zentral stehenden Hypothese, dass das »große Reich im Osten« wegen seiner jüdischen Beherrscher dem Zerfall geweiht sei, war jetzt keine Rede mehr. Eher firmierte die rapide sich industrialisierende Sowjetunion Josef Stalins als ein stählerner Moloch, der Deutschland und Europa bedrohen könne, vor allem von innen her, nämlich über die Kommunistischen Parteien. Vom »jüdischen Bolschewismus« war mit keinem Wort die Rede; und überhaupt wurde dieser Topos angesichts der Agitation der Stalinisten gegen »Judas Trotzki« und die Trotzkisten nur noch viel seltener und verhaltener gebraucht. Die zentrale These der NS-Propaganda lautete stattdessen: die Versailler Mächte und der Weltkapitalismus wollen uns finanziell aussaugen, wehrlos halten und kulturell überfremden, und das bolschewistische Moskau will uns mittels der von dort gesteuerten Kommunisten (auch wenn die seit 1930 ihrerseits äußerst nationalistisch auftraten) scheinbar stützen, in Wirklichkeit aber unterminieren.
Die Machteroberung Hitlers bedeutete anfangs noch keinen Bruch mit der Sowjetunion; man brauchte sie noch als Gegengewicht. Erst ab 1934/35 schwenkte die deutsche Politik abrupt auf eine Linie und Rhetorik um, worin das nationalsozialistische Deutsche Reich (mit durchsichtigen taktischen Absichten) sich gegenüber den Westmächten, aber auch den autoritären Regimes in Mittelosteuropa, als ein Bollwerk gegen den Bolschewismus präsentierte – das deshalb in einem Akt der Notwehr legitimiert sei, die Fesseln von Versailles abzustreifen. Als das 1935 im Wesentlichen gelungen war und als mit dem Anschluss Österreichs und dem Münchener Abkommen 1938 sogar die kühnsten großdeutschen Territorialziele erreicht waren, da begann die NS-Führung unter der Hand wieder die ältere, an sich ja bewährte Option einer Politik mit Sowjetrussland auszuloten. Die »AntiKomintern«, ohnehin kaum mehr als eine Abteilung im Propagandaministerium, wurde schon im Winter 1938/39 in aller Stille beerdigt.
Die Sowjetunion ihrerseits hatte ungeachtet aller Antifa-Rhetoriken und Volksfront-Strategien nie aufgehört, um die Wiederherstellung der früheren, stillen Bündnisbeziehung mit Deutschland zu werben. So gab es zwischen 1935 und 1938 eine Reihe von Sondierungen und diskreten Angeboten. Die Inhaftierung und Ermordung des Gros der deutschen Emigranten im Großen Terror tat ein Übriges, um den Weg frei zu machen. Gleich nach München ließ Stalin die Antifa-Propaganda jedenfalls deutlich zurückfahren, während er gleichzeitig sehr aufmerksam das Ansteigen der Spannungen zwischen Hitler-Deutschland und den Westmächten nach der Pogromnacht des 9. November 1938 registrierte. Schon im Februar 1939 schob er dem Rüstungskommissar Kaganowitsch bei der Sitzung des Politbüros einen Zettel über den Tisch: Was könnten die Deutschen uns liefern? Der Pakt vom August 1939 bahnte sich über diskrete Wirtschaftsverhandlungen an; und dabei ging es von vornherein um kriegswichtige Güter, die man keinem potentiellen Gegner liefert.
Anfang September – nach dem deutschen Überfall auf Polen – bemerkte Stalin in einer seiner Instruktionsstunden gegenüber Dimitrov als dem nominellen Führer der Komintern: Hitler leistet uns gute Dienste bei der Zerschlagung des Weltkapitals; und dabei werden wir ihn vorerst unterstützen. Das ging über rein taktische Erwägungen weit hinaus. Die Sowjetunion selbst profitierte von dem Teilungspakt ja auf riesigem Terrain und führte ihre eigenen, parallelen Kriege und blutigen Säuberungen im Westen wie im Fernen Osten. Allerdings war Hitler dann etwas zu erfolgreich, als er Frankreich und halb Europa im Handstreich überrannte. Dennoch gab es von sowjetischer Seite jedenfalls keine Absage, als Ende 1940 die Japaner zu einem Viererpakt gegen die Westmächte einluden. Es war vielmehr Hitler, der das gar nicht in Erwägung zog und seine strategischen Linien schon neu zog. Stalin dagegen konnte sich einfach nicht vorstellen, dass der Mann so dumm sein könnte, sich – während er den Krieg gegen das britische Empire nicht zur Entscheidung bringen konnte – schon gegen ihn, gegen die Sowjetunion zu wenden. Selbst als die Spatzen es von den Dächern pfiffen, dass die deutsche Armee in Polen aufmarschierte, und als seine Marschälle Stalin sagten: Wir müssen etwas tun, drohte er ihnen: Wenn ihr einen Finger rührt, werdet ihr einen Kopf kürzer gemacht.
Daher rührt diese ganze jüngere Präventivkriegsdebatte. Dabei würde ich fast sagen: Hätten sie es doch bloß getan! Hätten sie doch präventiv zugeschlagen und diesen Aufmarsch zerschlagen! Aber das durften sie nicht. Stalin stand bis zuletzt im Bann der fixen Idee, die Briten wollten ihn zum Krieg mit Deutschland treiben, während sie selbst die Sowjetunion einkreisten. So schmierte und nährte die Sowjetunion die deutsche Kriegsmaschine bis zur allerletzten Minute weiterhin mit lebenswichtigen Gütern: mit Getreide, mit Öl und mit Nickel. Deutschland war vor der Eroberung von Narvik von allen Nickelvorkommen abgeschnitten; und Nickel braucht man, um Geschosse zu bauen. Die Sowjetunion kaufte sogar auf dem Weltmarkt Kautschuk für die motorisierte deutsche Kriegsmaschine ein, die im Juni 1941 dann über sie herfiel. Diese Politik Stalins war eine Mischung aus Appeasement und vermeintlich schlauer Berechnung, genährt von der Hoffnung, die deutsche Kriegsmaschine werde sich erst einmal in das britische Imperium verbeißen und beim Versuch, die britische Insel selbst einzunehmen, erschöpfen. Das alles sind Seiten einer Gesamtkonstellation, die nicht in jeder Hinsicht ausgeleuchtet und ausinterpretiert ist.
Das gilt für die Politik der deutschen Seite aber genauso. Es war schon erstaunlich, wie es nach dem Abschluss des Paktes im August 1939 plötzlich nicht nur keine ideologischen Differenzen von Nationalsozialismus und Bolschewismus mehr gab, sondern mit welcher Intensität die alte kulturelle Verbundenheit zwischen Deutschland und Russland auch in der NS-Presse beschworen wurde. Schauen Sie sich die Literatur an, die 1939/40 in Deutschland über Russland erschien. Da ging es um die »deutschen Zaren« (Peter und Katharina), um die vielseitige, sowohl künstlerische als auch bodenständige russische Kultur, um die alte Verbindung von Prussia et Russia, um den Geist von Tauroggen und so weiter. Bis im Juni 1941 Goebbels dann in sein Tagebuch schrieb: Jetzt müssen wir die antibolschewistische Walze wieder auflegen. Die jungen Männer, die in einem abrupten Renversement der Allianzen jetzt in die Tiefen des russischen Raumes bis nach Moskau marschieren sollten, mussten dafür schließlich scharfgemacht werden.
Mich interessieren vor allem diese, oft ganz raschen und scheinbar paradoxen Wechsel und Dynamiken der politisch-militärischen Entwicklungen, denen die ideologischen und mentalen Prozesse zwangsläufig folgen (mussten). Auch ein Heinrich Böll zum Beispiel musste sich als junger Wehrmachtssoldat gegen alle seine literarischen Vorprägungen und menschlichen Regungen undurchlässig und unempfindlich machen, um diesen Ostkrieg psychisch durchzustehen. Oder nehmen Sie die fehlinterpretierten Bilder der Wehrmachtsausstellung, die ganz unmittelbar zu diesen psychopolitischen Konditionierungen hinführen: Wie konnte man die jungen Soldaten, die man in die Schlachten warf, am Besten scharfmachen? Indem man sie zum Beispiel an den verstümmelten Leichen der Exekutierten des NKWD vorbeiführte und ihnen erklärte: Seht ihr! So haust die jüdisch-bolschewistische Bestie, wenn sie entfesselt ist, und ab jetzt gibt es kein Pardon mehr.
Ich habe mich immer gefragt, ob diese Wehrmachtsoldaten noch mit ihrem Dostojewski oder Tolstoi im Gepäck marschierten, der in Deutschland so intensiv gelesen worden war wie nirgends sonst auf der Welt? Ich denke hier zum Beispiel an meinen Onkel, der ein glühender Nationalsozialist war und als Arzt in Stalingrad verwundet wurde, wundersamer Weise überlebt hat (auch mit Hilfe russischer Ärzte), 1953 als Spätheimkehrer aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft kam – und bei dem nach dem Krieg dann die ganze alte und neue russische Literatur im Regal stand, während die Leute ihn als Landarzt »den Russendoktor« nannten. Krieg und Gefangenschaft sind eben auch eine Art, sich kennenzulernen. Für ihn war das alles ein Überlebensepos, und seine Schlussfolgerung daraus war, dass die Bolschewisten gefährlich waren und abgewehrt werden mussten; aber mit den »einfachen Russen« und auch manchen Gebildeten, russischen Ärzten zum Beispiel, konnte man sehr gut zurechtkommen, im Gegenteil, die hatten sogar viele positive Eigenschaften bewahrt, die uns westlich-überzivilisierten Menschen abgingen. So konnten sich manche seiner frühen nationalsozialistischen Prägungen in eine ganz andere, tendenziell gegenläufige Richtung drehen.
Ich möchte noch einmal einen Gedanken entwickeln, der mir schon bei der Lektüre der Bloodlands und noch einmal bei dem, was Timothy Snyder hier vorgetragen hat, gekommen ist: Wie und warum hat sich in den 1960/70erJahren »Auschwitz« als zentrale Metapher für den Holocaust, und in mancher Hinsicht sogar für die nationalsozialistische Vernichtungspolitik insgesamt, so durchgängig eingebürgert? Snyder hat plausibel dargelegt, wie die Auschwitz-Erzählung zu einer jüdischen und zugleich einer europäischen Rettungsgeschichte geworden ist. Und in diese Geschichte gehört dann eben auch die Rote Armee, die Auschwitz befreit hat, und also zur Rettung der Zivilisation beigetragen hat.
Meines Erachtens hat auf deutscher Seite für die psychische Ausblendung oder die notorische Ahnungslosigkeit, die viele der deutschen Massenverbrechen im Osten bis heute umgibt, so die mörderische Besatzungspolitik in Polen oder das erste Kapitel des Holocaust, Babij Jar und die Massenerschießungen überall auf sowjetischem Territorium, eine große Rolle gespielt, dass gerade diese Dinge den deutschen Soldaten (Unsere Väter, unsere Mütter) am wenigsten entgangen sein konnten. Auch meine Mutter hat in dem unter Bomben liegenden Ruhrgebiet durch ihr ukrainisches Hausmädchen – die gab es ja in vielen deutschen Haushalten – vieles von dem mitbekommen, was sich dort abspielte, wenn das Mädchen ihr etwa erzählte: Bei uns zu Hause in Charkow wird mit den Juden und Bolschewisten aufgeräumt. Das hatte sie offenbar aus Briefen erfahren, die sie von zu Hause erhielt. Die sowjetische Kollektivierung hatte sie als katastrophische Zeit erlebt; und auch darüber hat sie meiner Mutter erzählt. Für sie dürfte dieser wohlgepflegte deutsche Haushalt, in dem sie Hausmädchen war (unklar, wie freiwillig oder erzwungen), auch eine Rettungsinsel gewesen sein. Sie konnte Pakete nach Hause schicken, und vermutlich glaubte sie, auf Einverständnis zu treffen, wenn sie über all das berichtete. Meine Mutter sagte mir, dass sie das alles gar nicht habe hören und ertragen können, während ihr jüngerer Bruder vor Leningrad lag (oder schon gefallen war), und der ältere in Stalingrad eingeschlossen, dann verschollen war. Musste sich das, was da im Osten passierte, nicht irgendwann rächen? Und war gerade das nicht ein Argument, immer weiter machen zu müssen?
Die explizite oder implizite »Bindung im Verbrechen«, wie ich diesen Konnex einmal bezeichnet habe, war vermutlich eins der Geheimnisse des fatalistischen oder auch fanatischen Durchhaltens der Deutschen; aber gleich nach der Kapitulation dann auch ihrer vielfachen chamäleonhaften Anpassung und Häutung. Alliierte Reporter, die ihren Truppen 1945 auf dem Fuß folgten, aber auch Emigranten wie Hannah Arendt bei ihrem Deutschlandbesuch im Jahr 1950, stellten frappiert fest, dass es anscheinend nirgends Nazis gab oder je gegeben hatte. Keiner wollte es gewesen sein; alle wuschen die Hände in Unschuld; das alles war über sie gekommen. »Wie hat man uns betrogen«, schrieb auch mein Onkel aus dem russischen Gefangenenlager in einem seiner ersten Lebenszeichen nach dem Krieg.
Worauf ich hinauswill: Mir scheint, dass alle diese psychologischen Konstellationen und Erfahrungsschichten sich später um das »Auschwitz«-Narrativ herum aggregieren konnten. Indem die deutsche Verantwortung für diesen ungeheuren Eroberungs- und Versklavungskrieg und für die unzähligen deutschen Kriegs- und Massenverbrechen im Osten sich im »Holocaust« zusammenfassten, und dieser sich wiederum metaphorisch in »Auschwitz« lokalisierte, gerann alles zu einem stereotypen Bild und zu einer festen Formel, wurde alles Geschehene, so absurd man das finden mag, viel kommensurabler, und ließ diese ganze heillose Vergangenheit sich sehr viel besser »bewältigen« (wie dieser sprechende deutsche Ausdruck besagt), psychisch, intellektuell und praktisch.
Dass es die sowjetische Armee war, die Auschwitz befreit hat, ließ sich in dieses Bild gut integrieren. Im Kern waren das eben immer noch die Russen, so wie es auch ein »Russlandfeldzug« gewesen war, der 1945 zu seinem Ende kam und aus deutscher Perspektive das eigentliche, große Epos dieses Weltkriegs gebildet hat – im Unterschied zum alliierten Bombenkrieg, der viel niederträchtiger war, weil er doch nur die Zivilbevölkerung traf, während der Krieg im Osten eben ein richtiger Krieg war. Selbst das abschließende Wort Hitlers, wonach »dem stärkeren Ostvolk jetzt die Zukunft gehört«, da die Deutschen sich als unfähig erwiesen hatten, ein Herrenvolk zu sein – diese (nicht nur) von Albert Speer überlieferte letzte Message bringt das zum Ausdruck. Und selbst wenn sie nicht stimmt, ist sie so – als eine Art heidnisches Gottesurteil der Geschichte – weithin aufgenommen und gespeichert worden, oder sie entsprach sogar einem instinktiven Gefühl vieler, fast aller.
Dieses »stärkere Ostvolk«, die »Soffjets« (wie Adenauer sie nannte), musste man sich – ich rede von der alten Bundesrepublik – zwar mit Hilfe der Amerikaner unbedingt vom Halse halten; aber letzten Endes würde man mit ihnen doch zu irgendeinem großen Ausgleich kommen müssen, wie nicht nur Willy Brandt oder Egon Bahr, sondern auch Franz-Josef Strauß oder Helmut Kohl immer gedacht haben. Und so war dann die deutsche »Gorbymanie« vierzig Jahre nach dem Weltkrieg noch einmal ein sympathisches, aber auch hoch illusionäres Revival einer alt überkommenen deutschen Russomanie (nicht Russophilie wohlgemerkt) – an deren frühere Intensitäten und Ambivalenzen, am stärksten wohl in der Periode von 1900–1930, die Deutschen sich nach Stalingrad und nach Auschwitz, nach Berlin 1945 und 1961, und heute in der Ära Putins, nur noch ganz von Ferne erinnern. Auch das ist freilich ein Stück deutscher Geschichtsvergessenheit inmitten des Dauerbeschusses der »History«-Channels.
Wir sprechen hier über historische Narrative als symbolische Räume und Orientierungen. Wie Karol Sauerland richtig gesagt hat, war »Auschwitz« natürlich auch ein zentrales polnisches Narrativ. Damit wären wir also bei dem, was Timothy Snyder über die Erinnerungen und Geschichtspolitiken der »Nationalisierer« gesagt hat.
Was das angeht, konnten die polnischen Kommunisten vor 1989, scheint mir, eine gar nicht so unplausible Mitte zwischen beiden Diskursen, dem sowjetisch internationalen und dem polnisch nationalen, finden. So entwickelte der offizielle Museumsführer von 1970, den ich besitze, eine durchaus geschlossene Erzählung über Auschwitz als einen Ort polnischer Selbstbehauptung und als Inbegriff des Vernichtungswillens des deutschen Imperialismus, der weiter drohte. Das Gespenst eines deutschen Revanchismus wurde schließlich als Bindemittel des polnischen Nachkriegsstaats wie seines unverbrüchlichen Bündnisses mit der Sowjetunion und den anderen Völkern Osteuropas dringend benötigt. Gerade Auschwitz eignete sich dafür, eben weil von seinem Lagerkomplex so viel übrig war, als der prädestinierte Gedenkort eines gemeinsamen Martyriums aller vom Nationalsozialismus angegriffenen und unterworfenen Völker des östlichen wie des westlichen Europa und damit eines Schicksals, das die Polen nur als erste getroffen hatte. Auch das war eine machtvolle, in sich geschlossene Erzählung, in der sich der Holocaust durchaus unterbringen ließ, nämlich als ein Teil des nationalsozialistischen Massenmords an polnischen oder sowjetischen »Staatsbürgern«. Warum die jüdischen Leiden in einem solchen Meer allgemeiner Leiden hervorheben? Das hatte seine eigenen Schlüssigkeiten.
Dem steht die Geschichte eines deutschen und eines jüdischen Auschwitz-Tourismus gegenüber, der auf vollkommen konträre, aus polnischer Sicht aber auch komplementäre Weise den einen als Pilgerfahrt, den anderen als »Sühnezeichen« diente. Vor allem in der Zeit des Kriegsrechts der 1980er-Jahre war es ein wiederkehrendes Thema in Gesprächen mit polnischen Bekannten, und ein Punkt tiefer Erbitterung: nämlich dass die Deutschen wie auch die Juden exklusiv in »ihr Auschwitz« wie an einen mythischen, exterritorialen Ort reisten, unter bereitwilliger Ausblendung all dessen, was um sie herum gerade passierte; und ohne auch nur annähernd zu verstehen, in welchem Verhältnis das vor allem von Polen bevölkerte »Stammlager«, in dem sich auch das Museum befindet, und das davon getrennte, tatsächlich fast exterritoriale Vernichtungslager Birkenau, also »ihr Auschwitz«, eigentlich zusammengehörten.
In dieses Bild passt auch der Verlauf des deutschen Historikerstreits in den späten 1980er-Jahren, zu dessen Hauptergebnissen es gehörte, dass Jürgen Habermas’ Satz sich mehr oder weniger autoritativ etablierte: nämlich dass der deutsche Nachkriegsstaat im Tiefsten auf Auschwitz gegründet sei. Joschka Fischer hat als Vizekanzler und grüner Außenminister später ex officio diese Formel mehrfach wiederholt und zur ethisch-politischen Grundlage einer deutschen Politik der Menschenrechte und Demokratie erklärt, und vor allem auch einer »besonderen Verpflichtung« der Bundesrepublik gegenüber Israel. Abgesehen davon, dass selbst für Israel nur sehr eingeschränkt zutrifft, dass es »auf Auschwitz gegründet« wäre – für die Bundesrepublik Deutschland ist das eine vollkommen abstrakte, kaum in politische Termini übersetzbare, zugleich aber auch äußerst anmaßende Selbstdeklaration.
Ich würde stattdessen sagen: Es war zunächst einmal die Totalität der Niederlage 1945, die das sichere Fundament geliefert hat, auf dem jeder deutsche Nachkriegsstaat sich neu zu begründen hatte. Deutschland hatte sich die ganze Welt zum Feind gemacht und die totalste aller Niederlagen erlitten – und danach war dann endlich Ruhe im Karton. Noch einmal vom Dolchstoß zu orakeln wie 1918 oder auf irgendeinen neuen Griff nach Weltmacht zu sinnen, war ein für allemal gegenstandslos geworden. Das zweite factum brutum war ab 1948 dann die neue Weltteilung und die Rolle der beiden Deutschländer als Frontstaaten im Kalten Krieg, was ihnen einerseits wenig eigene Spielräume ließ, andererseits ihr Gewicht innerhalb der beiden, um sie herum konstruierten Bündnissysteme aber umso mehr erhöhte. In diesem Weltzustand haben sich zumindest die Westdeutschen materiell wie mental ganz komfortabel eingerichtet. Und zu diesem psychischen Komfort gehörte, etwas zynisch gesagt, auch, sich von der historischen Konkursmasse des verflossenen Reiches klar abzunabeln und das Universum der deutschen Kriegs- und Verbrechensgeschichte des Weltkriegszeitalters in den »Auschwitz«-Topos zurückzufalten.
Für die Bürger der Sowjetunion bedeutete der Vaterländische Krieg mit seinen unfassbaren Menschenopfern und dann der siegreiche Ausgang dieses Kriegs eine machtvolle Überformung aller vorangegangenen Leidenserfahrungen. Für viele war dieser historische Sieg ein Medium oder Agentium nachträglicher Sinnstiftung oder moralischer Kompensation, sogar für viele der überlebenden Opfer des Stalinismus oder ihre Angehörigen. Das wird im russischen Herzland sicherlich anders verteilt gewesen sein als zum Beispiel in der Ukraine oder unter den Nationalitäten, die vor oder im Krieg als potentielle Agenturen des Feindes mit Terror überzogen oder deportiert worden waren. Auch zwischen Russen und Nichtrussen gibt es vermutlich eine »geteilte Erinnerung«.
Aber das zentrale psychologische Faktum bleibt: dass angesichts des Versklavungs- und Vernichtungskriegs Hitlers für einen großen Teil der Sowjetbürger die Crash-Industrialisierung der 1930er-Jahre in ihrer Verbindung mit der Kollektivierung und der Hungerkatastrophe, und selbst mit den Menschenopfern des »großen Terrors«, sich auf irgendeine Weise im Nachhinein als Akte einer vorausschauenden Politik Stalins darstellten. So falsch und so vollkommen unlogisch das auch war und ist – so »psycho-logisch« nachvollziehbar ist es eben auch. Liest man etwa Swetlana Alexijewitschs Secondhand-Zeit mit diesem ungeheuren Wirrwarr von Stimmen, die sich in ihre tief vergrabenen Erinnerungen und zugleich in die widersprüchlichsten Behauptungen und Erklärungen verwickeln – dann gibt es darin nichts Beherrschenderes als die Erfahrung dieses lange vergangenen, existenziellen Krieges. Und selbst Menschen, die im Großen Terror grundlos verhaftet, gefoltert und aus der Bahn geworfen worden sind, oder die Kinder von Ermordeten können dann zum Beispiel plötzlich sagen: Eigentlich bräuchten wir wieder einen Stalin; Russland zerfällt, und diese geopolitische Katastrophe macht alles zunichte, wofür wir gekämpft und gelitten haben ... Gerade bei diesen Stimmen kann man am klarsten sehen, wie der Vaterländische Krieg als eine nachträgliche Sinnstiftung und als ein Rettungs- und sogar Versöhnungsnarrativ fungiert – Versöhnung auch mit den eigenen zerstörten Biographien und Lebenserwartungen.
Eine letzte Bemerkung noch zu den generationellen Aspekten der Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte in der Bundesrepublik, in der der 68er-Diskurs sich ja in vielem durchgesetzt hat und mehr oder weniger hegemonial geworden ist. Der »Historikerstreit« gehört in gewisser Weise auch dazu; und seither die rituelle Rede vom »Zivilisationsbruch«, der sich in Auschwitz manifestiert habe. Was natürlich in keiner Weise falsch ist, nur in vieler Hinsicht verkürzt.
Ich komme noch einmal auf meinen früheren Punkt zurück: Der vom nationalsozialistischen Deutschland 1939 entfesselte Aggressionskrieg, Eroberungs- und Versklavungskrieg als solcher ist schon ein ungeheures Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewesen, das in Nürnberg durchaus zu Recht der erste und wichtigste Anklagepunkt gewesen ist. Damit mussten wir als die erste deutsche Nachkriegsgeneration zurechtkommen, und im Schatten und im Bann dieser Geschehnisse sind wir aufgewachsen. Die große Historikerdebatte der frühen 1960er-Jahre handelte im Übrigen ja, wie man sich erinnert, von der deutschen Schuld am Ersten Weltkrieg. Also das auch noch!
Das war aber genau zu derselben Zeit, in der die Bilder aus den Vernichtungslagern erst wirklich ins allgemeine Bewusstsein traten, nicht zuletzt durch den Jerusalemer Eichmann-Prozess 1961 und den Auschwitz-Prozess in Frankfurt 1963. Wir als Nachgeborene mussten uns das alles ja irgendwie psychisch kommensurabel machen. Und dabei ist unsere Generation ziemlich verschlungene Wege gegangen.
Das entsprechende Kapitel meines Buchs Das rote Jahrzehnt hatte ich überschrieben: »Felix Culpa«. Leider hat das niemand aufgenommen, obwohl dieser Titel immerhin auf eine Bemerkung von Hannah Arendt zurückging, die sehr spitz und präzise war; nämlich in einem Brief à propos von Hans Magnus Enzensbergers »Betrachtungen vor einem Glaskasten«, einem Essay über den Eichmann-Prozess. Darin sagte Enzensberger: Die Eichmänner von heute sind die Strategen der atomaren Vernichtung in Washington, aber wir merken das nicht, sondern schauen auf diesen Jerusalemer Glaskasten ... Daraufhin schrieb Hannah Arendt an einen Zeitschriftenredakteur: »Oh felix culpa! Wie kommt der junge Herr Enzensberger sich großartig vor, wenn er die hypothetischen atomaren Vernichtungsszenarien beschwört – und sie dem tatsächlich stattgefundenen Judenmord von damals gegenüberstellt!« Wohlgemerkt, diese Zeilen sandte sie nicht an Enzensberger selbst, sondern sagte ihm sozusagen in indirekter Ansprache, stellvertretend für die deutsche Nachkriegsgeneration: Ich werfe Ihnen ja nicht vor, dass Sie die deutschen Verbrechen relativieren und verkleinern möchten, nein, Sie erkennen sie durchaus an. Aber müssen Sie sich dafür auch noch eine Feder an den Hut stecken?
Unter dieser Perspektive einer »Felix culpa« habe ich also mein Kapitel über die Bewältigung der deutschen Geschichte in meiner Generation, auch an meinem eigenen Fall, zu dechiffrieren versucht. »Auschwitz« diente darin vor allem als universelles Argument einer moralisch-politischen Delegitimierung der Eltern-, aber auch der gesamten älteren Generation, gleich welche Rolle sie im Dritten Reich tatsächlich gespielt hatten. Genährt war das natürlich auch aus eigenen, robusten generationellen Ambitionen, mit durchaus elitären Zügen. Man selbst war als »Nachgeborener« (im Sinne Brechts) diesmal jedenfalls ganz und gar auf der richtigen Seite und insoweit moralisch saniert, eine Art »reborn German«, wie man maliziös sagen könnte. Daraus folgte dann eine enorme moralisch-politische Selbsterhöhung und Selbstermächtigung, die man in ihren Extremen bis hin zum mind-set der RAF und der anderen terroristischen Gruppen durchbuchstabieren kann: Wenn »sie« (die Herrschenden) so etwas »wie Auschwitz« veranstalten konnten – was sollte uns dann nicht erlaubt sein?!
In abgemilderter Form einer recht komfortablen moralischen Selbsterhöhung zieht sich dieses Syndrom einer »Felix Culpa« bis heute durch, wie ich behaupten möchte, und hat sich von den »68ern« auf das Gros der bundesdeutschen Gesellschaft übertragen, spätestens mit der präsidialen Ansprache Richard von Weizsäckers 1990, nicht zufällig im Moment der deutschen Vereinigung. Dabei geht es mir gewiss nicht darum, dieses Syndrom einer »Felix Culpa« zu denunzieren – allerdings immer noch darum, es genauer zu beschreiben.
Was soll man, um ein allerjüngstes Beispiel zu zitieren, von dem mit riesigem Aufwand und prominenter wissenschaftlicher Begleitung produzierten, mit großer publizistischer Begleitmusik präsentierten Fernseh-Dreiteiler Unsere Väter, unsere Mütter halten – einer didaktisch und exemplarisch verstandenen Geschichte, in der nahezu nichts stimmt und deren atemverschlagende Ignoranz dann doch einigermaßen verstörend ist? Noch verstörender ist allerdings, dass das offenbar kaum jemandem aufgefallen ist, sondern dass diese Produktion von vielen prominenten Feuilletonstimmen aufs Lebhafteste akklamiert wurde.
Dabei, was soll man eigentlich verlogener an dieser Story finden: diese reihum verliebte deutsch-jüdische Swingjugendgruppe in Berlin Anno 1941; die junge Sängerin, die sich für ihren jüdischen Freund (na gut, ein bisschen auch für ihre eigene Karriere) einer SS-Charge hingibt; den steifen, eifrigpflichtbewussten Jungoffizier, der am Ende aller Schlachten seinen Vorgesetzten erschießt, desertiert und als Waldrusse an einem See sitzend von Feldgendarmen aufgegriffen und exekutiert wird; während sein sensibler, den Krieg hassender jüngerer Bruder sich in eine berserkerhafte Tötungsmaschine verwandelt, aber dafür wenigstens seinen jüdischen Freund rettet, indem er ebenfalls einen SS-Offizier erschießt, der diesen jüdischen Freund gerade festgenommen hat; kurz nachdem dieser seinen polnischen Mitpartisanen entronnen ist, die ihn ihrerseits beinahe umgelegt und jedenfalls verstoßen haben, weil er aus einem überfallenen Zug jüdische Häftlinge, die in voller Sträflingsmontur nach Auschwitz verschickt werden sollten, befreit hat, während die Polen sie nur zu gerne ihrem Schicksal überlassen hätten. Ach ja, und dann ist da noch die fünfte aus dem Bunde der verliebten Swingjugendgruppe, die im deutschen Feldlazarett in Russland eine als Krankenschwester getarnte jüdisch-sowjetische Ärztin erst freundlich anspricht, dann jedoch denunziert; nur um im Frühjahr 1945 eben von dieser, nunmehr als illustre Sowjetkommissarin auftretenden Jüdin vor der obligaten Vergewaltigung durch die betrunkenen Rotarmisten mit der Pistole gerettet zu werden. Und so treffen die drei Überlebenden (zwei Frauen und der Jude) sich dann wieder in ihrem alten Café an der Ecke, genau wie sie es sich 1941 geschworen hatten, und das Leben geht weiter.
Kein Klischee ist ausgelassen, kaum irgendein Detail stimmt oder ist auch nur plausibel; und das nach jahrzehntelangen Debatten und Forschungen, tausenden von Büchern und Artikeln, Schullektionen und Aufklärungsfilmen, präsidialen Ansprachen und einer scheinbar schonungslosen Bereitschaft zur Aufklärung und Selbstkritik! Das ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, in welchem Grade die erinnernde »Bewältigung« all dessen, was Timothy Snyder als eine Geschichte der »Bloodlands« beschrieben hat, nur partiell von vorhandenem Wissen bestimmt, in vielem dagegen noch immer von mächtigen Impulsen einer versöhnenden Selbstidentifikation diktiert wird, die am Ende – willentlich oder unwillentlich – auf eine paradoxe moralische Selbsterhöhung hinausläuft.
Anmerkungen aus polnischer Sicht
Das, was ich sage, ist nicht als nationale Sicht gemeint, sondern als ein Beispiel, das die beiden Staaten betrifft, die Polen überfallen haben, also Deutschland und die Sowjetunion. Als ich mein Buch Polen und Juden verfasste, habe ich ganz bewusst mit dem September 1939 begonnen. Ich wollte die Diskussion über den polnischen Antisemitismus vor Kriegsbeginn nicht berühren, denn mit dem 1. September 1939 wurde eine völlig neue Situation geschaffen. Innerhalb kurzer Zeit wurde Polen von den beiden großen Nachbarn als Staat völlig zerstört. Als die Rote Armee am 17. September in Ostpolen einmarschierte, floh die gesamte polnische Regierung nach Rumänien, wo sie erst einmal interniert wurde, sie konnte sich dann aber nach Frankreich begeben. Später gründete sie in London eine Exilregierung. Die Bevölkerung in Polen war plötzlich herrenlos, nachdem der polnische Staat mit Mühe zwischen 1918 und 1939 wiedererrichtet worden war. Innerhalb von zwanzig Jahren waren die drei Teile zu einem vereint worden.
Ich habe in den Neunzigerjahren in einer Monatsschrift einmal darauf verwiesen, dass die Deutschen sich in einer viel günstigeren Lage befinden als einst die Polen. Sie mussten nur zwei Teile zusammenfügen, nicht drei. Polen unterstand bekanntlich innerhalb von hundert Jahren drei verschiedenen Administrationen, drei unterschiedlichen Gesetzgebungen: der preußischen, der österreichischen und der russischen. Das alles musste durch Neues ersetzt werden. Im Grunde genommen war der Aufbau Polens, der Zweiten Republik, in nur zwei Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte, wobei man nicht vergessen darf, dass es sich um einen Vielvölkerstaat handelte. Zu den vielen Völkern gehörten auch die Juden mit einer eigenen Sprache, dem Jiddischen, das, hätte es nicht den Holocaust gegeben, sich in eine Kultursprache verwandelt hätte. In den Zwanziger- und Dreißigerjahren gab es nicht nur zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften, die in Jiddisch erschienen, sondern man begann auch wissenschaftliche Werke in dieser Sprache zu veröffentlichen. Ohne den Holocaust gäbe es heute in Polen eine große eigenständige jiddische Kultur mit etwa zwei Millionen jiddisch sprechenden Menschen.
In der Zweiten Republik wäre es nie zu einem Jedwabne gekommen, als die polnischen Bewohner dieses Ortes ihre jüdischen Nachbarn erschlugen. Es geschah fast drei Wochen nach dem Einmarsch der Deutschen, Anfang Juli 1941. Jedwabne war 1939 sowjetisch besetzt worden – die Sowjets verwandelten das eroberte Ostpolen mit Windeseile in ein Gebiet der Kolchosen und Staatsbetriebe. Zu gleicher Zeit hatten die Deutschen in Windeseile die Juden von den Nicht-Juden im besetzten Gebiet getrennt. Bereits am 1. Dezember 1939 mussten alle Juden im Generalgouvernement den Davidstern tragen. Im Reich erfolgte die Kennzeichnung im September 1941, nachdem am 8. März 1941 das »P« für Pole eingeführt worden war. In den besetzten Ländern Westeuropas trat die Bestimmung für Juden, einen Davidstern zu tragen, erst ab April beziehungsweise Mai 1942 in Kraft. Am 1. Dezember 1939 waren dagegen kaum zwei Monate Besatzung vergangen. Auch Jüngere wissen, was Besatzung heißt, sie haben es am Beispiel vom Irak erfahren können.
Diese Wucht, mit der ein Staat zerstört wurde, ist fast unfassbar.
Im Herbst 1940 wurde das Warschauer Ghetto eingerichtet. 130 000 Warschauer wechselten – jüdische wie auch polnische Warschauer – die Wohnungen. Es gibt hierzu eindrucksvolle filmische Aufnahmen in Wochenschauen: Da ziehen die Pferdewagen mit den Möbeln hin und her. In der gleichen Zeit deportieren die Sowjets Hunderttausende von Menschen von Ostpolen nach Sibirien und Kasachstan. Man könnte in einem Film zeigen, wie von zwei Besatzungsmächten eine ganze Region, die Zivilisation zerstört wird – unter Zivilisation verstehe ich hier, dass die Menschen nach bestimmten hergebrachten Regeln, ohne große Administration zu benötigen, zusammenleben können. Und plötzlich fällt dies alles zusammen. Mir sagt die These von Timothy Snyder sehr zu. Wenn ich mein Buch Polen und Juden neu auflegen sollte, würde ich noch viel stärker auf den Zerstörungsdrang der Besatzungsmächte verweisen.
Noch eine Bemerkung zu Auschwitz: in den 1960er-Jahren war ich als Student in den Sommerferien Chef eines Studentenhotels in Krakau, als solcher führte ich regelmäßig – vor allem als Übersetzer aus dem Polnischen ins Deutsche – Gruppen nach Auschwitz. Auschwitz galt damals als internationales Lager, in dem die Kommunisten im Widerstand führend waren. Vom Holocaust vernahm man da nichts, nach Birkenau fuhr man nicht, als sei es ein unbekannter Ort. Dorthin zu kommen, war fast unmöglich. Es ging schließlich so weit, dass in der DDR-Literatur – Thomas Taterka hat es sehr schön dargestellt –, Auschwitz zum Gründungsmythos der Bundesrepublik stilisiert wurde, weil dort die IG Farben tätig war, während Buchenwald zum Gründungsmythos der DDR emporgehoben wurde, denn dort habe der kommunistische Widerstand besonders erfolgreich gewirkt. Auschwitz und Buchenwald werden in der innerdeutschen Nachkriegsgeschichte gegeneinander ausgespielt. Aber das nur am Rande.
Der Holocaust wurde im Grunde genommen als unbekannt hingestellt, obwohl jeder Pole davon Kenntnis hatte, schließlich befanden sich die Todeslager auf polnischem Boden und hier lebten auch die meisten Juden mit einer eigenen Kultur. Wie war dieses Verschweigen möglich? Dadurch, dass in der offiziellen Erinnerung Opfer keine Rolle spielten. Nur der Widerstand war zu zeigen. Es ist daher ein großer Erfolg, dass es der Geschichtsschreibung im Rahmen der neuen Erinnerungskultur gelungen ist, die Opfer in den Mittelpunkt zu rücken. Im sowjetischem Erinnerungsmodell – wir lebten ja unter dem sowjetischem Modell – ging es nur um Sieg und erfolgreichen Widerstand, während die Juden als Herde angesehen wurden, die sich bereitwillig töten ließen.
Lanzmann spielte für die Aufklärung des Holocausts eine positive Rolle, wenngleich nicht der ganze Film in den Achtzigerjahren gezeigt wurde. Das Jaruzelski-Regime war daran nicht interessiert. Hier wäre auch auf Spielmann zu verweisen, der damals noch lebte, man konnte ihn als Zeugen in die Höhe heben. Erst als die Tagebücher von Hosenfeld erschienen, erkannte man, dass sich nicht alles über einen Kamm scheren lässt. Diese Tagebücher stellen eine wichtige Ergänzung zum »Pianisten« dar, denn die Spielmann-Memoiren, die gleich nach dem Krieg erschienen, waren frisiert worden. So wurde aus dem Deutschen, womit Hosenfeld gemeint ist, ein Österreicher – doch das ist eine andere Geschichte.
Die Polizei unter dem deutschen Besatzungsregime wurde blaue Polizei genannt. Es gab während der deutschen Okkupation sogar mehr Polizisten als in der Zweiten Republik. Sie waren im Prinzip für zivile Aufgaben vorgesehen. Aber sie wurden auch mit in den Holocaust einbezogen. Sie mussten zwar nicht schießen, doch hatten sie die Fluchtwege zu schließen und ähnliches mehr. Es kann zugleich nicht verschwiegen werden, dass auch in der Sowjetunion die jüdischen Gemeinschaften zerstört wurden. Jede authentische Tätigkeit von Juden wurde verboten. Es durfte weder orthodoxe Juden noch Zionisten geben. Alles wurde gleichgeschaltet, also im Grunde genommen verboten. Die Synagogen wurden im sowjetisch besetzten Polen geschlossen. Es gab dort kein jüdisches Leben mehr. Auch das gehört zu den eingangs angeführten Zerstörungsmaßnahmen. Das nur zur Ergänzung.
Hier sei an Tadeusz Borowskis Erzählung Bei uns in Auschwitz erinnert, die gleich nach dem Krieg erschien. Dort lässt der Autor einen Häftling sagen »Na Gott sei Dank werden jetzt nur noch die Juden vergast.« Es ist nicht die Meinung Borowskis, er wollte nur zeigen, dass es auch in Auschwitz Antisemitismus oder einfach Mitleidlosigkeit gab. Borowski selber war durch und durch ein Moralist; er ging so weit zu sagen, dass jeder der überlebt hat, irgendetwas im Lager verbrochen haben muss. Es ging im Übrigen soweit, dass in der polnischen Sprache sofort der Begriff »Arier« übernommen wurde, schon 1939. Ein Zeugnis davon gab Jerzy Andrzejewski in der Erzählung Karwoche. In den Übersetzungen dieser Erzählung wird das polnische Wort »arijski«, das heißt arisch, einfach weggelassen, wie ich in einer Analyse zweier Übertragungen der Karwoche ins Deutsche feststellen konnte ...
Auschwitz ist für Polen ein besonderes Symbol, denn das Lager wurde ja ursprünglich für Polen erbaut. Die ersten Insassen waren Polen. Bartoszewski war einer von ihnen. Und es schien ein Leichtes zu sein, die polnischen Juden einfach als Polen einzuordnen. Man tat lange Zeit so, als seien die polnischen Juden als Polen ermordet worden. Jetzt funktioniert das nicht mehr, denn die nationale Narration ist durch eine internationale mit Schwerpunkt auf den Holocaust verdrängt worden.
Ihr Buch, Herr Snyder, ist hochinteressant. Sie haben beispielsweise nur so nebenbei bemerkt, dass Hitler das britische Imperium, das heißt erst einmal Großbritannien selber, nicht erobern konnte, dass er das britische Imperium im Grunde genommen nicht wirklich verletzen konnte. Ich will damit auch sagen, dass Sie in Ihrem Buch internationale Konstellationen einzig am Rande berühren, Bemerkungen dieser Art sind aber für Ihre gesamte Erzählung sehr wichtig. Da steht bei Ihnen so ein Satz: Deutschland hatte nicht einmal genügend Schiffe, um genügend Waffen auf die britische Insel zu transportieren. Damals war es bekanntlich nicht möglich, an Stelle von Schiffen Flugzeuge einzusetzen. Man konnte mit ihnen noch nicht Panzer transportieren. Sie betonten, dass für Hitler der Osten das Wichtigste war, vor allem die Ukraine mit seinem Getreidevorrat und den Ölfeldern. Und Sie bringen auch die japanische Schiene mit hinein. Was wäre gewesen, fragen Sie, wenn sich Japan mehr für Sibirien als nur für die südlichen asiatischen Gebiete interessiert hätte. So etwas können Sie nur in Nebensätzen sagen, denn sonst müssten Sie ja mehrere Bände schreiben. Mit diesen zusätzlichen Bemerkungen bringen Sie Ihr Buch insofern etwas ins Wanken, als für Sie der Wille Hitlers von entscheidender Bedeutung bleibt. Sie haben aber gleichzeitig, was wir jetzt hier am Podium auch gemacht haben, auf die Mikroebene geschaut. Trotzdem meine ich, dass Ihre zusätzlichen Bemerkungen wichtige Elemente zu Ihrem Buch bilden.
Noch etwas zur Rolle Polens. Es gibt eine heftige Diskussion darüber, ob Polen gut daran getan hat, sich 1939 Hitlers Forderungen nach der Schaffung eines Korridors zu verweigern. Diese Fragen werden als rechte gebrandmarkt, und ein gewisser Piotr Żychowicz hat ein dickes Buch dazu geschrieben. Der Vorteil dieses Buches ist nach meiner Meinung, dass der Autor sehr viele Dokumente an den Tag gebracht hat, die Historikern zwar bekannt waren, aber selten zitiert werden. Sie zeigen, wie hilflos die polnische Politik angesichts der Forderungen nach dem Korridor war. Und es gibt fromme Wünsche, man hätte doch auf diese Forderung eingehen und anschließend mit Hitler gen Moskau marschieren sollen. Die meisten können sich natürlich Polen als deutschen Vasallenstaat nicht recht vorstellen, aber es sei hier nur angemerkt, dass es gerade dazu eine heftige Diskussion zu solchen Themen in Polen gibt.
Die zweite Frage betrifft die angebliche Befreiung Polens durch die Rote Armee. Es gibt das sehr schöne Tagebuch von Andrzej Bobkowski, das vor einiger Zeit von Martin Pollack unter dem Titel Wehmut? Wonach zum Teufel? ins Deutsche übersetzt worden ist. Bobkowski beschreibt die Besatzungszeit in Paris, er macht sich immer wieder über die Franzosen lustig, wie sie Widerstand leisten. Aber ich möchte vor allem auf die Stelle verweisen, an der Bobkowski sagt: ja, ich verfolge das Kriegsgeschehen, und die Sowjets haben immer größere Erfolge zu verzeichnen, bei Kiew, bei Kursk ... und ich weiß nicht, soll ich mich freuen oder traurig sein, denn jetzt rückt die sowjetische Besatzung Polens näher. Tatsächlich kam es so … Als die ersten ehemals polnischen Städte, Vilnius und Lemberg, mit Hilfe der AK, der polnischen Heimatarmee, befreit wurden, machten sich die Sowjets drei Tage später daran, die AK-Führung zu verhaften und sie gen Osten zu deportieren. Die Sowjets waren nicht bereit, mit einem selbständigen polnischen Staat zusammenzuarbeiten. Der Warschauer Aufstand von 1944 ist in diesem Zusammenhang zu sehen, denn diesmal wollte die AK die Stadt selber mit alliierter Hilfe befreien. Die Aufstandsführung dachte, dass die Sowjets den britischen und amerikanischen Flugzeugen erlauben werden, im Osten, der Ukraine, zwischenzulanden, um dort auftanken zu können, aber Stalin ließ das nicht zu. Die alliierten Flugzeuge mussten von Italien über Österreich und Krakau nach Warschau fliegen und dort nach Abwurf von Hilfsgütern wieder abdrehen.
Der Fall Jedwabne: natürlich spielt die sowjetische Besatzung eine große Rolle. Und ich habe das sehr genau verfolgt und in meinem Buch Polen und Juden beschrieben, wie die Polen mit Neid und Wut beobachteten, dass Juden Funktionen ausübten, die sie vorher nie hatten ausüben können. Zum ersten Mal waren Juden in großer Zahl zu Beamten ernannt worden. Natürlich waren sie nur kleine Beamte im sowjetischen Polen, aber immerhin hatten sie etwas zu sagen und das im Namen eines Besatzers. Das weckte Hassgefühle. Aber ich glaube wichtiger war, was Timothy Snyder angeführt hat: dass es keine Führung, keine polnischen Autoritäten mehr gab. Auch die katholische Kirche – sie existierte im sowjetisch besetzten Teil nicht – hatte an Autorität verloren. Übrigens wurde die Kirche auch im deutschen Besatzungsteil verfolgt. In Dachau sieht man viele polnische Namen von Priestern, die dort ihr Leben verloren haben. Auch die Kirche war mithin kein Ordnungsfaktor mehr. Das wird ständig unterschätzt. Schließlich spielte die katholische Kirche in der polnischen Geschichte als Ordnungsfaktor eine ganz wichtige Rolle, bis heute. Man kann sich darüber ärgern, aber sie ist es nun einmal, was von der einfachen Bevölkerung akzeptiert wird.
Wenn man von »Memorial« spricht, würde ich »Karta« noch hinzufügen. Karta ist die polnische Entsprechung des Memorial. Karta lässt alle Opfergruppen zu Worte kommen, auch die deutschen Vertriebenen. Karta und Memorial beziehen den ganzen Raum ein, in dem es so viele Opfer gibt. Zur Erinnerung gehören sowohl die Leiderfahrungen einfacher Menschen im Krieg wie auch die nach dem Krieg. In Deutschland macht man sich nur selten klar, wie viel sich im sogenannten Osten überlagert, nämlich der Hitlerfaschismus und die Sowjetherrschaft, und das von Anfang an. Es gilt die europäische Erinnerung um dieses Wissen zu erweitern. Es ist unter anderem wegen der Zunahme des Euroskeptizismus notwendig. Dieser ist im Osten besonders groß, weil sich diese Gebiete in Europa nicht entsprechend repräsentiert fühlen. Es geht hier nicht nur um Nationalgeschichte, sondern auch um die Geschichte dieses Raums, in dem es zum Beispiel am Ende des Zweiten Weltkriegs auch Kämpfe zwischen Ukrainern und Polen in Wolhynien gab. Man könnte noch viele andere Auseinandersetzungen in dieser Zeit anführen, die als nationale Auseinandersetzungen interpretiert werden, aber im Rahmen der beiden Totalitarismen gesehen werden müssen. In Wirklichkeit ist dieser Raum durch die Politik der Sowjetunion und Deutschlands durcheinander gebracht worden. Man versucht seit den Neunzigerjahren irgendwie zu sich zu kommen. Die Vertreter der polnischen Emigrationszeitschrift Kultura in Paris drangen schon in den 1950er-Jahren darauf, eine polnisch-ukrainische Versöhnungsdebatte zu führen, Polen und die Ukraine müssten zueinander kommen, betonten sie. Beide Länder würden zu Europa gehören. In unserer heutigen Diskussion komme ich zu dem Schluss, dass wir hier etwas für die Aufarbeitung der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen getan haben. Wir müssen einfach eine neue Erinnerung schaffen ...
So sollte man auch nicht sagen, dass der Zweite Weltkrieg die deutsche Tat ist. Der Zweite Weltkrieg ist eine deutsch-sowjetische Tat. Die polnische Armee hatte sich im September 1939 in den Osten zurückgezogen, und wollte von dort aus noch einmal versuchen, ihre Kräfte gegen die Wehrmacht zu konzentrieren. Die polnische Armee hätte natürlich den Krieg verloren, aber etwas später und in dieser Zeit wäre die öffentliche Meinung in Frankreich und England mobilisiert worden. In demokratischen Staaten braucht es seine Zeit, bis die Mehrzahl der Menschen bereit ist, Krieg zu führen. Wahrscheinlich hätte Hitler ohne die Hilfe der Sowjetunion seine Kriegsziele in dem Umfange nicht erreicht. Der ganze Zweite Weltkrieg wäre anders verlaufen. Ohne Sowjetunion kein Zweiter Weltkrieg ...
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz