
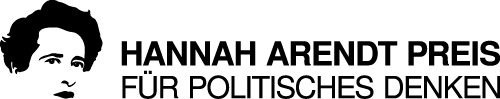

Jerome Kohn (1931-2024) war ein renommierter Hannah Arendt-Forscher und emeritierter Professor an der New School for Social Research in New York. Als langjähriger Vertrauter und Nachlassverwalter Hannah Arendts trug er maßgeblich zur Herausgabe und Interpretation ihres Werks bei und galt als einer der führenden Arendt-Experten weltweit.
Roger Berkowitz ist Rechts- und Politikwissenschaftler sowie Gründer und akademischer Direktor des Hannah Arendt Center for Politics and Humanities am Bard College in New York. Er ist Autor mehrerer Bücher über Hannah Arendt und ihre politische Philosophie und organisiert regelmäßig internationale Konferenzen zu aktuellen politischen Fragen im Geiste Arendts.
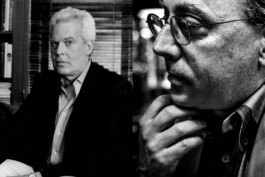
© Privat/Doug Menuez
Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Berkowitz. Im Namen des Vereins „Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken“ sowie im Namen von dessen Vorstand begrüße ich Sie herzlich zur nunmehr 24. Preisverleihung hier in den ehrwürdigen Räumen des Bremer Rathauses. Zu Beginn möchte ich Ágnes Heller gedenken. Sie war 1995 unsere erste Preisträgerin und verstarb in diesem Sommer im Alter von 90 Jahren ... Nun zurück zur diesjährigen Preisverleihung: Einen ganz besonderen Dank möchte ich der internationalen Jury aussprechen, die sich für die Findung der Preisträger viel Zeit genommen, intensiv diskutiert und sorgfältig abgewogen hat. Und natürlich danke ich den Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes für die wunderbare Zusammenarbeit, die – und deshalb hebe ich ihn namentlich hervor – vor allem durch Peter Rüdels geduldige Koordinierung und gründliche Organisation möglich war. Der Preis – inzwischen seit über zwei Dekaden an Menschen verliehen, die kritisch reflektierend, mutig, entschlossen und ganz im Sinne Hannah Arendts das „Wagnis Öffentlichkeit“ angenommen haben – wird auch in diesem Jahr wieder vom Senat der Freien Hansestadt Bremen und der Heinrich Böll Stiftung vergeben. Den beiden Preisstiftern gilt daher unser nachdrücklicher Dank, sowohl für die finanzielle Unterstützung als auch für das Zeichen, das sie mit der langjährigen Förderung eines primär politischen Preises setzen. Besonderer Dank gilt Silke Krebs, Staatsrätin der Freien Hansestadt Bremen, sowie Ellen Ueberschär, Vorstand der Heinrich Böll Stiftung, dass sie für die Preisgeber zu uns sprechen werden. Fraglos leben wir in unruhigen, wenn nicht gar beunruhigenden Zeiten, die uns vor große Herausforderungen stellen – Herausforderungen des politischen Handelns, aber auch und zuvorderst des politischen Denkens. Die diesjährigen Preisträger Jerome Kohn und Roger Berkowitz haben es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur den politischen Denkraum Hannah Arendts auszuleuchten und zu analysieren, sondern ihn auch für die Volatilität der gegenwärtigen politischen Welt nutzbar zu machen.
In einer Zeit, in der unsere Demokratien weltumspannend in Gefahr sind, drängen sich uns Fragen auf. Wie verändern sich die Demokratien angesichts von Fluchtbewegungen, Klimakatastrophe, sozialer Ungerechtigkeit und der sich rasant entwickelnden, sämtliche Lebensbereiche umpflügenden Digitalisierung? Wie kann der durch Manipulation hervorgerufenen Aushöhlung der politischen Welt begegnet werden? Vermag der politische Liberalismus neue Prinzipien des Zusammenlebens zu generieren und einem widererstarkten Nationalismus die Stirn zu bieten? Was von all diesen Bedenken ist Schwarzmalerei, was unleugbare Realität? Und wie können komplexe Fragen erhellend, aber nicht vereinfachend, in einer verdichteten, welthaltigen, aber nicht sich an der Oberfläche verlierenden Sprache beantwortet werden – einer Sprache, die uns in die politische Welt hineinzieht und nicht aus ihr herauskatapultiert? Jerome Kohn, langjähriger Freund und Mitarbeiter Hannah Arendts an der New School in New York hat ihr entschieden unabhängiges, menschenzugewandtes Querdenken von Anbeginn begleitet. Dass er ihr Werk, insbesondere ihre unveröffentlichten Schriften, einer weltweiten Leserschaft zugänglich gemacht hat, gehört ebenso zu seinen Verdiensten wie sein unermüdliches Engagement, Arendts Grundüberzeugungen in die Welt zu tragen und die Bedeutung ihres Politikbegriffs für die Demokratie herauszustellen. Roger Berkowitz, Rechts- und Politikwissenschaftler, ist akademischer Direktor des Hannah Arendt Center am Bard College in New York. Mit der Gründung dieses Zentrums entstand ein Ort, an dem Studierende Hannah Arendts Denken entdecken können und der es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Politikerinnen und Politikern aus aller Welt ermöglicht, über den Kurs der globalen Politik von heute zu debattieren. Es ist Roger Berkowitz‘ Verdienst, dass das Hannah Arendt Center zu einem Ort der politischen Begegnung und fruchtbarer Auseinandersetzungen geworden ist. Mit seinen öffentlichen Interventionen hält er die Frage aktuell, was es bedeutet in einer von Täuschungen bedrohten Welt zu leben, sie zu verstehen und sie dergestalt als eine gemeinsame und sinnvolle Welt anzunehmen. Beide – Jerome Kohn und Roger Berkowitz – halten das Arendtsche Denken lebendig und ermutigen ihre Mitmenschen, Position zu beziehen und Verantwortung in der Gegenwart für die Zukunft zu übernehmen. Dieses herausragende Engagement der beiden amerikanischen Wissenschaftler hat die internationale Jury des „HannahArendt-Preises für politisches Denken“ gesehen und gewürdigt. Die Jurybegründung vortragen respektive die Laudatio halten wird in diesem Jahr Antonia Grunenberg. Als Professorin für Politische Wissenschaft und langjährige Leiterin des Hannah Arendt-Zentrums an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg war sie an der Etablierung des Preises maßgeblich beteiligt – und ist auch nach ihrer Emeritierung Hannah Arendt verbunden, wie zahlreiche Fachaufsätze und Publikationen unter Beweis stellen. Diese Verbundenheit zu dem aus der Marginalität kommenden und die Epizentren der politischen Welt erfassenden Denken Hannah Arendts, eint die Laudatorin mit den beiden diesjährigen Preisträgern. Antonia Grunenberg wird uns deren
wissenschaftliche Leistungen in Erinnerung rufen und uns das dem Arendtschen Denken verpflichtete Wirken in der Gegenwart erläutern und es würdigen. Im Anschluss haben die Preisträger das Wort. An dieser Stelle möchte ich Jerome Kohn entschuldigen, der leider nicht persönlich anreisen konnte, uns aber eine Videobotschaft zukommen ließ, die wir in Teilen heute und in Gänze in einer eigenen Diskussionsveranstaltung im kom - menden Jahr sehen werden. Es folgen der Vortrag von Roger Berkowitz und schließlich die Übergabe des Preises. Danach lassen wir traditionell den Abend im Nachbarsaal ausklingen, wo Sie bei einem Glas Sekt das Gehörte in Gesprächen weiterspinnen und vertiefen können. Eine inhaltliche Intensivierung findet beim morgigen Colloquium im Institut Français statt, wo Roger Berkowitz, Ulrike Liebert und Antonia Grunenberg das Thema „Politischer Liberalismus in unruhigen Zeiten. Das Ende des Liberalismus – ein neuer Anfang?“ diskutieren werden. Beginn ist 11:00 Uhr und Sie sind zum Mitdenken und Mitdiskutieren herzlich eingeladen. Damit übergebe ich das Wort zunächst an Staatsrätin Silke Krebs. Anschließend sprechen, wie bereits angekündigt, Ellen Ueberscher für die Heinrich Böll Stiftung, Antonia Grunenberg für die Jury und es folgen Videosequenzen der Rede Jerome Kohns und schließlich der Vortrag von Roger Berkowitz.
Vielen Dank
Sehr geehrte Damen und Herren
es ist zugleich Fluch und Segen, dass ich für meinen erkrankten Staatsratskollegen (der herzlich grüßen lässt) Jan Fries einspringe.
Ein Segen, weil ich im Umgang mit Hannah Arendt geschulten Menschen sehr geübt bin, schließlich habe ich viele Jahr in der Nähe von Winfried Kretschmann, einem ausgewiesenen Hannah Arendt Verehrer verbracht. Der hatte sogar nach nicht mal einem halbem Jahr Amtszeit als Ministerpräsident selbst bei Bildzeitung einen solchen Eindruck hinterlassen, dass sie schrieb: Hannah Arendt sei nun die meistzitiere Frau Baden-Württembergs.
Ein Fluch – oder zumindest mit Hindernissen versehen ist der Termin für mich, da ich mich immer blind auf die Expertise Kretschmanns verlassen hatte und selber keine Anstrengungen übernommen, mit passenden Gedanken und Zitaten Hannah Arendts aufzuwarten, sie waren ja immer schon da. Aber nun!
Sehr geehrter Jerome Kohn, sehr geehrter Roger Berkowitz, im Namen des Senats der Freien Hansestadt Bremen und persönlich danke ich von ganzem Herzen für Ihr jeweiliges Engagement, Hannah Arendts Impulse weiterhin in die Gesellschaft zu tragen und sie in ihr zu verankern. Das ist so wichtig!
Denn es mangelt bei all den aufgeregten Debatten an Debatten – wenn auch nicht unbedingt aufgeregten – über die unsere Art, als Gesellschaft zu handeln, wie wir als Gesellschaft agieren wollen. Und das nicht im Format Gegenspieler, also Bürger versus Politik, ‚wir da unten‘ versus ‚die da oben‘. Sondern mit dem Blick Aredts, der allen eine aktive Rolle und Verantwortung zuspricht.
Derzeit wird die Verantwortung allzu oft von den einen zu den anderen weitergereicht. Politik fixiert sich dabei sehr auf den vermeintlichen Bürgerwillen, den sie Umfragen entnimmt, BürgerInnen ziehen sich allzu oft mit einem ‚Die machen eh was sie wollen‘ zurück.
Dabei ist es so entscheidend wahrzunehmen, dass und wie beide Seiten gar keine sind, sondern miteinander innigst verwoben. Die beiden heutigen Preisträger tragen mit ihrem Wirken dazu bei. Herr Kohn, Sie haben Arendts Werk für die Öffentlichkeit um zuvor Unveröffentlichtes bereichert und für alle zugängig gemacht.
Mit dem Hannah Arendt Center am Bard College haben Sie, Roger Berkowitz, einen so wertvollen Ort des fruchtbaren Streits über Verstehen und Handeln geschaffen.
Dafür gebührt Ihnen beiden großer Dank! Nun will auch ich – endlich – zu Hannah-Arendt-Zitaten greifen.
Das eine ist top aktuell:
„Weisheit ist eine Tugend des Alters, und sie kommt wohl nur zu denen, die in ihrer Jugend weder weise waren noch besonnen“
Welch ein passender Kommentar zu Friday-for-Future, er sei so manchem Kritiker auf die Fahnen geschrieben.
Und dann noch eines von Kretschmanns Lieblingszitaten. Er meint, Hannah Arendt habe immer gesagt, „Wo, wenn nicht in der Politik, dürfen wir Wunder erwarten?“
Was lässt sich besser dem Untergangspessimismus, auch in der Klimadebatte, entgegensetzen.
Meine Herren Preisträger, tragen Sie bitte weiter die Ideen Arendts in die Gesellschaft, wir bemühen uns weiter, gute Politik zu machen und wer weiß, vielleicht sind dann Wunder möglich.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Berkowitz, liebe Frau Berkowitz, lieber Henning Scherf, liebe Mitglieder der Jury, liebe Laudatorin, verehrte Gäste,
mein Name ist Dr. Ellen Ueberschär, ich bin Vorstand der Heinrich Böll Stiftung und gratuliere den diesjährigen Preisträgern des Hannah-Arendt-Preises, Roger Berkowitz und Jerome Kohn.
Wie Sie alle wissen, ist diesen Sommer die von uns so verehrte Agnes Heller im Alter von 90 Jahren verstorben. Sie war nicht nur große Intellektuelle und große Europäerin, sie war auch die erste Preisträgerin des Hannah-Arendt-Preises im Jahr 1995. Mit der diesjährigen Verleihung an Roger Berkowitz und Jerome Kohn schlagen wir einen Bogen, der sich über den Atlantik quasi von New York nach Bremen spannt.
Agnes Hellers Werk lässt sich „als eine Antwort auf das Denken Hannah Arendts lesen“. Persönlich ist sie Hannah Arendt jedoch nie begegnet. Jerome Kohn dagegen war Arendts langjähriger Freund und Mitarbeiter an der New School in New York. Er hat ihre Kunst zu Denken und zu Arbeiten hautnah, „live“, erlebt. Und hat sich später ihrem Werk voll und ganz verschrieben. Er publizierte unter anderem vier Bände von Arendts zuvor unveröffentlichten Schriften: „Essays In Understanding“, „Responsibility and Judgment“, „The Promise Of Politics“, „The Jewish Writings“ und zuletzt „Thinking Without Bannisters“ – eine Zusammenstellung an Essays, Reden, Interviews und Vorträgen, die die ganze Fülle ihrer anregenden Gedanken vor uns ausbreitet. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass uns die Texte Arendts ohne das Wirken von Jerome Kohn heute nicht in derselben Weise zugänglich wären.
Einen entscheidenden Beitrag zur Verbreitung des arendtschen Denkens hat auch Roger Berkowitz geleistet. Er hat sich zwar ebenso mit griechischer und deutscher Philosophie, Rechtsgeschichte und Verfassungstheorie beschäftigt, immer wieder ist er jedoch zurückgekehrt zu Hannah Arendt
Als Gründer und akademischer Direktor des Hannah Arendt Center am Bard College in New York hat er einen Ort geschaffen, an dem insbesondere Studentinnen, Wissenschaftlerinnen und Interessierte das Werk Arendts studieren und diskutieren können. Gerade die lebendige Auseinandersetzung mit Werk und Person Hannah Arendts ist auf solche Gelegenheit des pluralen Austauschs angewiesen, die gewissermaßen von einem dritten Ort aus, der Reflexion des öffentlichen, politischen Denkens dienen. Wir sind uns der Paradoxie bewusst, dass auch dieser dritte Ort zugleich selbst ein öffentlicher politischer Raum ist, und als solcher Gegenstand öffentlicher politischer Auseinandersetzungen werden kann.
Die Stifter dieses Preises wollen mit der Auszeichnung nicht allein akademische Leistungen, sondern ein Wirken in der Öffentlichkeit ehren. Zum Selbstverständnis heißt es, ich zitiere: „Geehrt werden Personen, die das Wagnis Öffentlichkeit angenommen haben und das Neuartige in einer scheinbar sich linear fortschreibenden Welt denkend und handelnd erkennen und mitteilen.“ Wie kaum eine andere Denkerin hat Hannah Arendt darüber nachgedacht, wie der öffentliche politische Raum entsteht. Und auf der Suche nach den Ursachen der totalitären Herrschaft im 20. Jahrhundert, hat sie erforscht, wie moderne Gesellschaften diesen Raum zerstören und dadurch totalitäre Herrschaft erst ermöglichen.
Öffentlichkeit als Voraussetzung für Demokratie. Die Leistung, die Jerome Kohn und Roger Berkowitz vollbracht haben, besteht darin, das Werk Hannah Arendts, insbesondere ihre unveröffentlichten Schriften, einer weltweiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen: in unzähligen Publikationen, Interviews, in Artikeln und Vorträgen – auf beiden Seiten des Atlantiks. Das ist ein Geschenk für alle, die sich mit dem Denken und Handeln im Geiste Hannah Arendts auseinandersetzen und es mit Leben füllen. Jetzt und in der Zukunft.
Ganz im Sinne Arendts geht es heute und morgen um „die Veränderungen der Demokratien im Zeitalter der Globalisierung“. Das berühmte Shakespeare-Zitat – „die Welt ist aus den Fugen“ – ist nicht zuletzt vom amtierenden Bundespräsidenten als aktuelle Zustands- Beschreibung der politischen Landschaft gewählt worden.
Im 30. Jahr der Erinnerung an den Fall des Eisernen Vorhangs wird uns bewusst, dass wir keineswegs nach dem Ende der Geschichte leben, sondern allenfalls am Beginn der Herausprägung einer neuen Weltordnung, um deren Charakter wir ein Ringen erleben und selbst darin handeln müssen. In jedem Fall wird China eine größere Rolle in dieser neuen Ordnung spielen, die Digitalisierung und die Klimakrise. Ob die Demokratie in ihrer liberalen Ausprägung, wie sie ganz wesentlich von Hannah Arendt gedacht worden ist, ob die multilateralen Ordnungssysteme auch in Zukunft funktionsfähig sein werden, ob wir mit Hilfe neuer Technologien die Klimakatastrophe abwenden können, steht im Moment auf dem Spiel. Aber das Denken Hannah Arendts ist ein Denken der Hoffnung auf Veränderung, ein Vertrauen auf die Möglichkeit des politischen Handelns. Das sollten wir uns zu Herzen nehmen!
Einzustimmen in ein konservativ bis reaktionär motiviertes, wenig humanitäres Krisengerede von Seiten illiberaler, ethnopluraler und menschenrechtsverletzender Seite ist der falsche Weg. Er führt geradewegs in die Aporien einer unausweichlichen Machtergreifung durch selbsternannte, anti-elitäre Führer und in das geschlossene, pöbelnde Denken einer verunsicherten Pseudopolitik, wie wir sie seit 2 Jahren im Bundestag beobachten können. Dem müssen wir – das sind wir Hannah Arendt schuldig – etwas entgegensetzen: die Öffentlichkeit, die Redlichkeit und die Glaubwürdigkeit politischen Denkens.
Demokratinnen und Demokraten aller Couleur müssen für die Veränderbarkeit der Verhältnisse zum Besseren einstehen, wenn gilt, was Hannah Arendt so wunderbar gesagt hat: „Der Sinn von Politik ist Freiheit.“
Die Auseinandersetzung mit den zerstörerischen, totalitären, in ihrer Form gleichwohl neuartig erscheinenden Tendenzen des 21. Jahrhunderts baut notwendigerweise auf Arendts theoretischem wie praktischem Engagement gegen den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts auf. Den Zugang dazu haben uns auch Jerome Kohn und Roger Berkowitz eröffnet – dafür sind wir Ihnen dankbar.
Und erlauben Sie mir abschließend noch eine Bemerkung: Gerade in diesen stürmischen Zeiten ist die Verleihung eines Preises, der Hannah Arendt gedenkt, an zwei amerikanische Intellektuelle besonders wichtig: Um immer wieder an die starken Bande zwischen Europa und den Vereinigten Staaten zu erinnern. Und um deutlich zu machen, dass wir diese Bande nicht leichtfertig aufgeben dürfen – Hannah Arendt, Agnes Heller, Roger Berkowitz und Jerome Kohn sind der beste Beweis.
Herzlichen Glückwunsch!
Meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Staatsrätin Krebs, liebe Ellen Ueberschär von der Heinrich Böll-Stiftung, liebe Freundinnen und Freunde des Hannah-Arendt-Preises, lieber abwesender Jerome Kohn, lieber anwesender Roger Berkowitz.
Es ist mir eine Ehre, Sie beide, Jerome Kohn und Roger Berkowitz hier und heute zu würdigen.
Die Jury ist mit dieser Preisvergabe zu den Ursprüngen des HannahArendt-Preises zurückgekehrt. Sie hat gefragt: wer beschäftigt sich mit dem Werk Arendts in einer Weise, die sowohl die Geschichtlichkeit, das Zeitbedingte als auch die Aktualität, das über die Zeit Hinausreichende dieses ungewöhnlichen politischen Denkens herausarbeitet. Wer erhebt mit Arendt seine/ihre Stimme gegen die bleierne Trägheit des demokratischen Diskurses in den Vereinigten Staaten?
In ihren öffentlichen Interventionen und in ihren Arbeiten greifen beide Preisträger die unterschiedlichen Facetten der Denkerin und politischen Analytikerin Hannah Arendt in je eigener Weise auf. Sie fragen öffentlich: wie kann sich die amerikanische Demokratie gegen die zerstörerischen Tendenzen im eigenen Haus wehren?
Jerome Kohn war in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts Assistent Hannah Arendts an der New School for Social Research, jener Hochschule, die so vielen 1933 aus Deutschland vertriebenen Hochschullehrern Zuflucht gewährte. Er betreut seit Jahren den Nachlass von Hannah Arendt und ihrem Mann Heinrich Blücher.
Es war Jerome Kohn, der seit den neunziger Jahren maßgeblich dafür sorgte, Arendts Denken über die Vereinigten Staaten hinaus bekannt zu machen, indem er ihre unveröffentlichten Texte einer weltweiten Öffentlichkeit zugänglich machte. Lassen Sie mich nur ein paar Aspekte benennen, die Kohn als besonders typisch für die Eigenart von Arendts Denken heraushebt:
– Arendt betrachtete das Denken nicht als professionelle Aufgabe von Intellektuellen, sondern als eine Angelegenheit all derer, die an der Öffentlichkeit interessiert sind. Denken ist auch nicht nur Angelegenheit einer Disziplin, etwa der Philosophie, sondern es entsteht im Aufeinandertreffen verschiedener Perspektiven aus der Geschichtswissenschaft, der Philosophie, Soziologie und Literatur, der politischen Ereignisse und der Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger
– Arendt wertschätzte Literatur und Dichtung als originäre Weisen des Denkens, eine Sichtweise, die ihre Kollegen aus den Humanwissenschaften mitunter mit völligem Unverständnis quittierten.
– Last but not least, Arendt argumentierte nicht als Moralphilosophin, die Anleitungen für das Gutsein und Gutes-tun der Bürgerinnen und Bürger verfasst hätte, sondern sie wies nachdrücklich auf die Möglichkeit politischen, immer risikoreichen Handelns im Sinne des Gemeinwesens der Bürgerinnen und Bürger (nicht des Staates und nicht der Nation) hin.
In Kohns Kommentaren zu Arendts Essays wird deutlich, dass ihr Denken eben mehr ist als eine Theorie wie andere. Streitbares, unseren Denkgewohnheiten entgegenstehendes Denken wäre eher kennzeichnend. Um dieser Denkweise gegenüber offen zu sein, bedarf es einer erheblichen Erweiterung des eigenen Denkhorizonts, was anstrengend ist, da es oft den eigenen Überzeugungen entgegenläuft. Doch dem gilt es sich auszusetzen, so argumentiert Kohn, wenn wir, die heutigen Generationen die Impulse Arendts weitertreiben wollen in die Gegenwart.
Durch Kohns öffentliches Reden wie durch seine Texte zieht sich die Frage: Wie kann Arendts Weise, die Welt zu betrachten, uns beim Verstehen der gegenwärtigen politischen Gemengelage helfen? Und wie müssen wir weiterdenken? Zusammen mit Elisabeth Young Bruehl (sie wäre heute die dritte im Bunde der Preisträger, wenn sie nicht schon von dieser Welt verschwunden wäre), brachte er seit den neunziger Jahren Fragen wie diese auf unzähligen Konferenzen zur Debatte. Die Tatsache, dass die nachwachsenden Generation ihnen zuhörte und immer wieder kam, dass das Interesse an der Deutsch-Amerikanerin Arendt nicht nachließ, hat gewiss viel mit der offenen Art zu tun, mit der Kohn den Denkansatz Arendts in der Öffentlichkeit präsentierte – aber ebenso gewiss auch viel mit dem Niedergang der demokratischen Debattenkultur in den Vereinigten Staaten, die eine gewisse Leere und Orientierungslosigkeit im öffentlichen Raum bis heute hinterlässt.
Lassen Sie mich meine kurze Würdigung mit einem deutlichen Verweis darauf schließen, wie Kohn das Denken Arendts auf die Gegenwart bezieht. In einem Brief aus jüngster Zeit heißt es:
„In Hongkong ereignet sich Politik direkt vor unseren Augen. Das Volk hat die Macht aufgenommen, die auf der Straße lag und organisiert die Macht in lokalen Räten. So etwas hätte Hannah Arendt ein „politisches Wunder“ genannt. Wäre sie überrascht gewesen? Natürlich, und sie hätte gejubelt. Aber viele hierzulande nehmen das Wunder kaum wahr, allenfalls wie einen Bauer im Schachspiel der Macht zwischen Washington und Beijing. – Doch für jeden der sehen kann, ist unübersehbar: Die Flamme der Freiheit hat sich einmal wieder gezeigt, diesmal in Hongkong.“
Den Preis gleichzeitig an Roger Berkowitz zu vergeben, ist geradezu zwingend, wenn man bedenkt, dass Berkowitz, aus der nächsten Generation nach Kohn stammend, in seiner Arbeit von den Fragen ausgeht, die Kohn und Elisabeth Young-Bruehl Jahrzehnte vorher in die Debatte gebracht hatten.
Roger Berkowitz ist von Haus aus Politikwissenschaftler und Rechtsgelehrter, gegenwärtig Professor für Politik, Menschenrechte und Philosophie am Bard College im Staat New York. Bard College ist im übrigen der Ort, an dem die Eheleute Hannah Arendt und Heinrich Blücher begraben liegen; dort steht auch Arendts Hausbibliothek der Öffentlichkeit zur Verfügung. 2006 gründete Berkowitz mit nachdrücklicher Unterstützung von Jerome Kohn dort das Hannah Arendt Zentrum für Politik und Humanwissenschaften, dessen Akademischer Direktor er seither ist. Wie der Name schon sagt, ist das Hannah Arendt Center ein Ort für streitbares politisches Denken und nicht nur ein Ort der akademischen Diskurse. Und dies zeichnet sowohl das Wirken des Zentrums wie auch seines Direktors Berkowitz aus: Arendt wird dort aus verschiedenen Perspektiven in ihre Zeit und in die Gegenwart gestellt. Das Zentrum veranstaltet Konferenzen zur aktuellen Politik, auf denen stets die Frage mitläuft: wie kann man politische Ereignisse verstehen, wo kann die Kritik ansetzen, welche Handlungsoptionen gibt es? Über die Jahre ist das Arendt-Zentrum ein Ort offener politischer Debattenkultur geworden. Dort kommen mitunter auch Leute zu Wort, die am Rande der demokratischen Kultur stehen. Dafür ist Berkowitz heftig kritisiert worden – und antwortet seinen Kritikerinnen und Kritikern mit dem Verweis darauf, dass Pluralität manchmal schwer auszuhalten ist, aber dass man sie in allen ihren Facetten praktizieren sollte, will man die Welt und die Menschen verstehen. Verkürzt könnte man auch sagen: man muss den Gegner kennen, den man politisch bekämpfen will. Oder um es distinguierter mit dem amerikanischen Obersten Richter Oliver Wendell Holmes im Jahre 1919 zu sagen:
„... wir benötigen den Gedankenreichtum der ganzen Gesellschaft, um uns mit den Ideen zu versorgen, die wir brauchen. Denken ist eine gemeinschaftliche Angelegenheit. Ich anerkenne deinen Gedanken, weil er Teil meines Gedankens ist – auch wenn mein Gedanke sich in Widerspruch zu deinem befindet.“
Berkowitz hat viel beachtete Bücher und Aufsätze über politische und philosophische Themen, über Arendts Denken und die gegenwärtige Politik publiziert, sie hier zu nennen, würde zu weit führen; eine Laudatio ist keine akademische Würdigung.
Doch lassen Sie mich ein Wort zur Art der Debatte kommentieren, die das Hannah Arendt-Zentrum immer wieder entzündet. Neben den Konferenzen betreibt das Center einen im Netz wöchentlich erscheinenden Newsletter. Unter dem Titel Amor Mundi erscheint er als eine Art Rundbrief an die Mitglieder, Unterstützer und Leser der Veranstaltungen und Publikationen des Hannah Arendt Zentrums. Er enthält Kommentare und Gastkommentare zur amerikanischen Politik, Rezensionen von politischen Artikeln und Zeitschriften, Polemiken, Hinweise zum Verstehen der Texte Hannah Arendts – alles in allem ist dies eine der wichtigen Stimmen in der gegenwärtig etwas ärmlichen liberalen Diskurskultur. Sein jüngster Kommentar widmet sich – wieder einmal – dem Phänomen der Fake News und warum sich Politik und Wahrheit nicht vertragen.
Beiden Preisträgern geht es um die Regeneration jener pluralen Öffentlichkeit, aus der allein auch individuelles Verstehen, gemeinsamer politischer Protest und Handeln entstehen können. Und mit dieser Leistung stehen beide Preisträger in einer Reihe mit den Preisträgern und Preisträgerinnen der Jahre 1995 bis 2018.
Zu jedem guten Vortrag gehört ein guter Witz, sagen unsere angelsächsischen Nachbarn. Und so lassen Sie mich schließen mit einem, den ich auf einer von Roger Berkowitz organisierten Tagung am Hannah Arendt Center des Bard College von Jerome Kohn gehört habe.
„Es war zu Zeiten der Finanzkrise: Hannah Arendt und Karl Marx be- gegnen sich im Himmel und schauen beide auf die Erde runter. Da fasst Arendt Marx am Ärmel und sagt: ‚Guck mal Marx, das haben sie alles allein zustande gebracht, keine Revolution nötig.‘“
Ich danke Ihnen.
Über politische Freundschaft
Zunächst möchte ich mich bei Professor Dr. Antonia Grunenberg und allen Mitgliedern der internationalen Jury sowie beim Senat der Freien Hansestadt Bremen und der Heinrich Böll Stiftung für diese hohe Auszeichnung bedanken. Keine Ehre könnte für mich jemals bedeutungsvoller sein. Ich begrüße herzlich alte und liebe Freunde und Freundinnen, auch diejenigen, die ich noch nicht getroffen habe und die ich als zukünftige Freunde anspreche. Mein einziges Bedauern, und es ist ein schweres, besteht darin, dass ich nicht persönlich mit Euch und Ihnen zusammen sein kann
Hannah Arendt sagte einmal – unvorhersehbar, wie immer –, dass einen Preis zu erhalten bedeute, eine Lektion in Demut zu erhalten. Denn, so sagte sie, es kommt nicht auf die eigene Meinung über die eigenen Verdienste an, sondern auf die verschiedenen Meinungen, die darüber bestehen. Wenn man diese auf eine Seite einer Waage stellt, überwiegt diese Vielfalt deutlich jede einzelne Meinung auf der anderen Seite. Somit, fährt Arendt fort, verpflichtet die Annahme eines Preises die Person, die ihn empfängt, auf die Pluralität der Menschen, die ihn verleiht. Natürlich in Dankbarkeit; aber es gibt noch eine andere Weise, diese Verpflichtung zu betrachten. Arendt legte auch darauf ihren Finger, indem sie zwei Zeilen aus Shakespeares Hamlet zitierte. Als Hamlet, Prinz von Dänemark davon erfährt, dass sein Vater vom König ermordet wurde, ruft er aus:
“The time is out of joint – O cursèd spite, That ever I was born to set it right! –” (Hamlet, I.v. 188-89). Und dann fügt Arendt sofort hinzu: „Im Bereich der Politik ist die Zeit immer aus den Fugen geraten.“
Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, war ich ein Junge, der nicht zuhause, sondern im Internat lebte. Ich war zu jung, um die qualvollen Details des Krieges zu verstehen, aber ich schloss mich der allgegenwärtigen Euphorie an, die durch das siegreiche Amerika fegte, ungeachtet des anhaltenden Leids so vieler entwurzelter Menschen in Europa und den meisten Teilen der Welt. Ein paar Jahre später hätte ich wahrscheinlich diese Euphorie als Folge der Niederlage des „Faschismus“ rationalisiert, allerdings auch nur mit einem vagen Verständnis dessen, was das bedeutet. Erst später, als ich bei Hannah Arendt in einem Seminar mit dem Titel „Politische Erfahrungen im 20. Jahrhundert“ studierte, wurde mir klar, dass die Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg historisch beispiellos, ja sogar unvorstellbar war. Arendts Worte beeindruckten ihre Schüler mit dem paradoxen Gedanken, dass eine so ungeheure Zerstörung ihr eigenes Ziel erreicht hatte. Das heißt, sie drängte uns zu der Erkenntnis, dass der Abschluss des Krieges in Japan der ultimative Vollzug massiver, weltvernichtender Gewalt und Stärke war. Hätte der Kriegspräsident der Vereinigten Staaten, Franklin D. Roosevelt, noch gelebt, so glaubte Arendt, hätte er nicht zugelassen, dass ohne jede Vorwarnung die ersten – und bisher einzigen – Atombomben an aufeinanderfolgenden Tagen zwei japanische Städte auslöschten. Unsere thermonuklearen Waffen des 21. Jahrhunderts sind hundert bis tausend Mal zerstörerischer als Atombomben der damaligen Zeit.
Heute, etwa fünfzig Jahre nach Arendts Seminar, ist das Paradoxon der Zerstörung als eigenes Endziel in den weltweiten öffentlichen Debatten und in den Stimmen, die sie durchdringen, präsent– und das ist kein Widerspruch, kein Endpunkt. Dies Paradoxon zeigt sich deutlich in den massenhaften Migrationsbewegungen und ist ein wichtiger Teil der schlechten Nachrichten, die Flüchtlinge immer zu ertragen haben. Es ist unverkennbar in den extremen klimatischen Veränderungen, die das Aussterben einer außerordentlich großen Anzahl von Lebewesen bewirkt haben, worüber wir es als Gemeinschaft von Lebewesen – mit bemerkenswerten Ausnahmen – eher bevorzugen hinwegzusehen als es zu verhindern. Andererseits ist Arendts Paradoxon nirgends auffälliger als im erstaunlichen Wachstum menschlicher Lebewesen, in dem anbrandenden Anstieg der menschlichen Bevölkerung in fast jedem bewohnbaren Winkel der Erde. Das Paradoxon ist das, was jeder Zerstörung als Selbst-Zerstörung zugrunde liegt und gleichzeitig jeder psychologischen Motivation von Selbstmord entgegensteht, einschließlich Dr. Freuds „Todestrieben“.
Die ökologische Forschung ist reich an Ideen, wie man die dynamische Interaktion von Organismen mit ihrer Umwelt kontrollieren kann, hat aber noch keine politisch mandatierte Verfahrensvereinbarung erreicht; und das kann man auch nicht erwarten, solange globale ökonomische Überlegungen in der öffentlichen Meinung im Vordergrund stehen. Es liegt in der Natur von Volkswirtschaften, dass sie nicht nur in Dollar oder Euro wachsen – für Arendt die am wenigsten greifbaren Anzeichen dafür, dass eine wachsende Zahl von Objekten das Begehren einer wachsenden Zahl von Subjekten befriedigen soll. Man kann sagen, dass dieser Komplex eines unnatürlichen Wachstums (wie Arendt mit Blick darauf ironisierte, dass für Aristoteles Wachstum zum Kern von Natur (physis) gehört) dazu fähig ist, sich in einen ideologischen Eindringling in den öffentlichen Raum zu verwandeln, wo er als spalterischer Versuch erscheint, die öffentliche Meinung auf die eine oder andere Seite zu ziehen. Die allgemein akzeptierte liberale Mentalität, die in der französischen und deutschen Aufklärung geboren wurde, aber fast sofort ihre Grundlage, nämlich die Gemeinsamkeit des Menschseins, verleugnete, erscheint nun in der Welt als Spaltung in radikal linke und radikal rechte Ideologien. Ihre Marionetten und Puppenspieler bringen ihre so genannten „Ideen“ – für Arendt: „Illusionen“ – gegen die ihrer ehemaligen Freunde in Anschlag, auch wenn beide Fraktionen die „Freiheit“ als das Ziel beschwören, das sie im Blick haben.
Wie erfrischend ist es, heute mit Arendt zu denken! Sie verschmähte nicht nur jeden Ismus, jede Ideologie, sondern auch jeden Versuch, die öffentliche Meinung zu gewinnen. Im Gegenteil, Ideologien und öffentliche Meinung waren für sie Zeichen von Entpolitisierung, das Aufgeben von politischem Handeln. Aber trotz der Rolle, die Ideologien bei der Bildung der öffentlichen Meinung einnehmen, bestand Arendt darauf, dass sie keineswegs die Hauptmissetäter seien. 1963 schrieb sie an einen Freund: „Selbst im Buch über den Totalitarismus (erschienen 1951), im Kapitel über Ideologie und Terror erwähne ich den merkwürdigen Verlust ideologischer Inhalte“. Für sie war vielmehr die Massen-„Bewegung selbst“, das allerwichtigste. Zehn Jahre zuvor hatte Arendt einem amerikanischen Freund geschrieben: „Die totale Herrschaft als solche ist völlig unabhängig vom tatsächlichen Inhalt einer bestimmten Ideologie.“ Lassen Sie mich die Frage auf den Kopf stellen: Gibt es etwas, das seinem Wesen nach politisch ist, etwas, was nicht aufgegeben werden kann, wenn es einen politischen Raum geben soll? Es geht hier nicht um die Funktion der Politik – nicht, wie wir in Amerika sagen, um die Funktionsweise des Systems –, sondern um die Möglichkeit, das Sprechen und Handeln einer Vielheit von Menschen so zu gestalten, dass Sprechen und Handeln sich zu Bedingungen für politisches Leben und politische Tätigkeit verwandeln.
Hier ist ein Verstehen gefordert, das nicht Wissensstand ist. Arendt besteht darauf, dass Descartes' korrekte Formulierung nicht das berühmte cogito ergo sum („Ich denke, also bin ich“) war, sondern dubito ergo sum („ich zweifle, also bin ich“). Es ist der Zweifel, nicht der Gedanke, der das Selbst oder das Ich als Schiedsrichter über Wissens und als Richter der Wahrheit einsetzt. Aber ist es nicht ein einheitliches Selbst, das da denkt, es ist vielmehr ein „Zwei-in-Eins“, wie Arendt es nennt, ein geteiltes, also ein plurales Selbst, das sowohl spricht als auch antwortet? Dieses „Zwei-in-Einem“ ist kein Konzept, sondern recht eigentlich die Erfahrung des Denkens als Dialog, dialegesthai, was auf Griechisch bedeutet, eine Angelegenheit aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu besprechen.
Die Pluralität tritt hier in den Bereich des einsamen Denkens ein, unter einer Bedingung: der Bedingung der Freundschaft. Und genau hier kommt vor allem Aristoteles in den Sinn, wenn auch nicht die historische Gestalt, die in Büchern anzutreffen ist, die über dies und das – praktisch über alles – über die Welt, in der er lebte, nachdachte. Heute nennen wir diese Welt Antike. Obwohl Aristoteles nicht an uns, noch an unsere Welt dachte, öffnet sein Denken uns doch unsere geistigen Augen für die Räume, in denen Wesen auftauchen, die sowohl miteinander in Beziehungen stehen als auch voneinander unterschieden sind – und zwar ebenso in unserer eigenen Welt, wie sie es in seiner taten. In diesem Sinne ist Aristoteles' Denken heute so lebendig wie vor mehr als zwei Jahrtausenden. Mein Hauptanliegen ist es, zu sagen, dass das politische Verhältnis, das er zwischen Freundschaft und Gerechtigkeit sah, aktueller ist denn je. Wir beklagen uns, dass Politiker kein Gewissen haben, keine innere Stimme, die ihnen sagt, was sie nicht tun sollen, aber für Hannah Arendt ist das Gewissen das Nebenprodukt der Freundschaft zwischen dem Zwei-in-Einem: Du würdest das nicht tun, wenn Du mein Freund bist. In dem Bewusstsein, dass jedes Übersetzen von Aristoteles eine Interpretation ist, will ich das mit einer kurzen, aber aussagekräftigen Passage über politische Freundschaft (philia politikē) aus dem Buch VIII seiner Nikomachischen Ethik versuchen zu erläutern:
„Freundschaft scheint die politischen Gemeinschaften zusammenzuhalten, und die Gesetzgeber scheinen mehr Wert darauf zu legen als auf Gerechtigkeit. Denn die Förderung des Einvernehmens, das Teil der Freundschaft ist, ist ihr Hauptziel, während Feindschaft das ist, was sie am meisten vermeiden wollen. Wenn Männer (men) Freunde sind, brauchen sie keine Gesetze, aber wenn es Gesetze gibt, brauchen Männer immer noch Freundschaft. In der Tat enthalten die wahrsten Formen der Gerechtigkeit die Qualität der Freundschaft und konstituieren ihren Charakter.“ (Nic. Eth. viii, 1155a26-32; vgl. ebd. 1160a30- 1163b25).
Wenn politische Freunde dann und wann kommunizieren, ist es nicht diese Kommunikation, sondern die Enthüllung, die das Wesentliche ihrer Rede ausmacht. Dies ist selten, aber nirgendwo deutlicher als in Arendts Bericht über die Erfahrung des französischen Dichters René Char in seiner Kampfzeit im französischen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs. Während er in Verstecken hauste, entdeckte er „eine Zitadelle der Freundschaft“, in der er und seine MaquisardGenossen in Bildern sprechen konnten, die allein für sie verständlich waren. Diese Bilder entstanden aus dem, was Char ihre gemeinsame „Empfindung eines Wunders“ nennt. „In unserer Dunkelheit“, schreibt er, „gibt es keinen einzigen Ort für Schönheit: der ganze Ort ist Schönheit.“ Wohlgemerkt, sie lebten in den Tiefen und der Dunkelheit von Höhlen. In diesem Dunkeln entdeckten sie einen „verborgenen Schatz“.
Char vergleicht die Enthüllung dieses Schatzes, ihre Freiheit, frei zu sein, mit dem „Rätsel einer Flamme“, die seit Jahrhunderten ungesehen brennt. Es ist diese Flamme, die uns heute den Weg erhellt, auch ohne den Freiheitsschatz der Maquisards. Die Worte des Dichters Char sind dicht, sie sind nicht transparent. Sie bezeichnen nicht, sie sind nicht Zeichen, die auf eine Idee, ein Konzept oder ein Ereignis hinweisen, was vor, hinter, über oder über ihnen liegt, weder räumlich noch zeitlich. Darauf spielt der große dänische witzige Kopf, Søren Kierkegaard, in einem seiner schönsten Gleichnisse an: „Als ein dänischer Herr in Kopenhagen die Straße hinunterging, sah er das Schild im Schaufenster: „Wanderhosen werden hier gebügelt“. Als er den Zustand seiner zerzausten Hose bemerkte, ging er in den Laden, ließ seine Hose fallen und legte sie auf die Theke. Der schockierte Ladenbesitzer fragte, was er da mache. Der dänische Gentleman sagte, er wolle sich die Hose bügeln lassen. Darauf antwortete der Ladenbesitzer: „Mein Herr, wir bügeln keine Hosen, wir machen Schilder“ (Entweder /Oder).“ Das Erscheinen, auch wenn es noch so flüchtig ist, von Objekten, Ideen, Personen und Ereignissen in der dichten Sprache der Poesie ist ihre unmittelbare Existenz. Sie können als Symbole betrachtet werden, aber nur im Sinne von Kant, also nicht als Repräsentationen, sondern als „ein Modus der Erkenntnis“ (Intuition). Kants Symbole symbolisieren nichts anderes als das, was sie selbst verwirklichen, präsent machen oder zur Geltung bringen. So schreibt er: „Das Schöne ist das Symbol des Sittlichen“ (Kritik der Urteilskraft, § 59). Ebenso werden Platons Ideen von den Augen des Geistes nicht in einem riesigen und ansonsten leeren Himmel gesehen, sondern von den menschlichen Ohren in seinen Dialogen gehört, wo er sie eingeschrieben hat. Verbale Formen dichten Denkens sind selten, außer in der großen Poesie, wo sie seit Homer der vorgesehene Modus für die enthüllende, nicht der kommunizierenden Sprache sind. Kurz gesagt, dichte Worte drücken nicht aus, pressen nicht aus, was in inkonsistenten und unbeständigen Herzen verborgen liegt, sondern beeindrucken unseren Geist und unsere Rede mit der vielgestaltigen Welt, die zwischen uns liegt, der Welt von gemeinsamem Interesse für uns. So werden wir nicht aus der Welt heraus gezogen sondern in die Welt hinein, welche die Freunde unterscheidet und sie zugleich miteinander verbindet. Denn im Gegensatz zu familialen Verbindungen sind die Beziehungen hier zwischen und von gemeinsamen Interesse für die unterschiedenen Einheiten, was jede Art von Identitätspolitik zu einem inneren Widerspruch macht.
Die Bedeutung dessen, wo wir uns befinden, wenn wir politisch denken, wird hörbar in den folgenden dichten Worten Lessings, der von Hannah Arendt so bewundert wurde. Er schrieb über den Genius der Poesie (und nun am Ende auf Deutsch): „Sein glücklicher Geschmack ist die Geschmack der Welt.“ Lassen Sie mich dasselbe noch einmal aus anderer Perspektive betrachten: Kanzlerin Merkel hat auf ähnliche Weise gesprochen, als sie vor ein paar Monaten sagte, die Vereinigten Staaten könnten nicht mehr zu den Freunden Europas gezählt werden. Ich glaube, ihre Aussage macht uns darauf aufmerksam, wie Shakespeare es vielleicht formuliert hätte, dass „etwas faul ist“ in unserer technologie-fixierten, dürre gewordenen, gefährdeten Welt. Ich versichere Ihnen an diesem Tage, dass der Gestank, der aus dieser Fäulnis steigt, für den „Geschmack der Welt“ verderblich ist, das heißt für jene „Welt“ aus politischen Freunden, die es immer noch gibt, selbst in Amerika. Die Worte der Kanzlerin bestätigen: auch unsere Zeit ist „aus den Fugen“. Und ihre Worte sind ein bleibendes Sinnbild für die Verantwortung der politischen Freunde, jenseits aller Grenzen und Ozeane, in Shakespeares Worten, „to set it right.“
Ich danke Ihnen allen, in Freundschaft.
Dankesrede
Es ist eine wahre Ehre für mich, heute Abend hier im Bremen Rathaus zu sein. Mein aufrichtiger Dank gilt dem Senat der Hansestadt Bremen und der Heinrich Böll Stiftung
Ich möchte auch sagen, wie sehr es mir eine Ehre ist, zusammen mit meinem Freund Jerry Kohn diese Auszeichnung zu erhalten.
In der folgenden Rede werden Intellektuelle und Experten kritisiert. Dies ist unglücklich in einer Zeit, in der so viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beschlossen haben, professionelle Anti-Intellektuelle zu werden. Ich bin nicht hier, um mich mit Anti-Intellektuellen zu verbünden. Und ich möchte daran erinnern, dass Hannah Arendt Benjamin Constant zitierte, bevor sie Karl Marx kritisierte: „Gewiss will ich die Gesellschaft von Kritikern eines großen Mannes vermeiden. Wenn ich zufällig in einem einzigen Punkt mit ihnen übereinstimme, wird mein Misstrauen gegenüber mir selbst wachsen; ich empfinde, dass ich diese falschen Freunde ablehnen und so weit, wie ich das kann, von mir fernhalten muss.“
Hannah Arendt äußerte tiefen Verdacht gegen Intellektuelle und Philosophen. In ihrem Buch über Rahel Varnhagen argumentierte Arendt, dass Varnhagens großer Fehler darin bestand, zu viel zu denken, aus der Realität in die Selbstbeobachtung zu entfliehen. Angesichts der harten Realität einer Welt, in der sie gewöhnlich, jüdisch und damit kaum ein Mensch war, hatte Rahel ein Mittel, dem zu entfliehen: Beim Denken konnte sie sich von einer unbedeutenden Jüdin in jemanden verwandeln, die ein Schicksal von besonderer Bedeutung auslebt. Das Denken war eine Rebellion gegen die Grausamkeiten der weltlichen Realität
Arendt nennt Denken einen Wahn, eine „Manie“, insofern als sie jemanden aus der realen Welt des gesunden Menschenverstands vertreiben kann. Wenn sie über diejenigen, die sich den Nazis in Deutschland widersetzten, argumentiert sie, dass Bildung und intellektuelle Leistung nicht mit Widerstand in Beziehung stehen. Intellektuelle, so befürchtete sie, würden ihre Denkfähigkeit eher dafür nutzen, Komplizenschaft oder Schweigen zu rationalisieren.
Es ist erstaunlich zu sehen, dass Arendt, die einmal gesagt hat, dass das Denken vielleicht die einzige Aktivität sei, die uns gegen böses Handeln immunisiert, auf Denken auch als Manie Bezug nimmt. Allerdings hatte Arendt immer gesagt, dass Denken gefährlich ist: Besonders gefährlich ist „das stetig wachsende Ansehen wissenschaftlich orientierter Braintrusts in den Regierungen“. Diese intellektuellen Akteure sind immer „versucht, ihre Realität – die ja von Anfang an menschengemacht ist und somit auch hätte anders sein können – an ihre Theorie anzupassen, wodurch sie mental der sie beunruhigenden Zufälligkeit entkommen konnten.“ Die großen Gefahren, die Intellektuelle für die Welt darstellen, bestehen daher, dass sie einzigartig in der Kunst ausgebildet sind, die Fakten zu leugnen, die unsere gemeinsame Welt ausmachen.
Am direktesten hatte sich Arendt mit der Gefahr, die von Intellektuellen ausgeht, in ihren Essays über den Vietnamkrieg befasst. Als sie 1971 die Pentagon-Papiere las, sah Arendt, dass „das grundlegende Problem, das durch die Papiere aufgeworfen wurde, Täuschung war“. Alle möglichen Lügen machten den amerikanischen Krieg in Vietnam möglich, einschließlich trügerischer Zahlen getöteter Menschen, verfälschter Schadensberichte und falscher Fortschrittsberichte. Und doch ignoriert die Empörung über die Lügen, Arendt zufolge, eine weitere grundlegende Tatsache, nämlich, dass „Wahrhaftigkeit nie zu den politischen Tugenden gezählt wurde“. Um die Welt zu verändern, muss sich die Politikerin die Welt anders vorstellen als sie ist; sie muss in „der bewussten Leugnung der faktischen Wahrheit – der Fähigkeit zu lügen“ – geschult werden.
Arendt identifiziert zwei Arten von Lügen. Die erste ist die bewusste Fälschung in Gestalt der „massenhaften Manipulation von Fakten und Meinungen“. Ein Jahrhundert moderner Propaganda hat gezeigt, wie leicht wir Fakten löschen oder ändern können.
Die zweite gefährliche Art der Lüge kommt von den Intellektuellen im „Regierungsapparat“. Diese intellektuellen Bürokraten fühlen sich in Konzepten und Theorien zu Hause. Sie sind ungewöhnlich fähig darin, selbst an ihre hypothetischen Schöpfungen über und gegen die reale und tatsächliche Welt zu glauben. Das Problem der in Konzepten denkenden Intellektuellen ist, dass sie eine unheimliche Fähigkeit besitzen, Fakten zu leugnen.
Ich erwähne Arendts Überlegungen über die absichtliche Lüge und die Fantasien der Intellektuellen in der Regierung in einem Moment, in dem beides in Verfahrungen zur Amtsenthebung des Präsidenten in den Vereinigten Staaten zu betrachten ist. Bei den Anhörungen geht es um Lügen und Korruption. Der Präsident autorisierte einen nicht amtsgemäßen Kommunikationskanal, militärische Hilfe für den ukrainischen Präsidenten Zelensky davon abhängig zu machen, dass gegen den politischen Rivalen des Präsidenten ermittelt wird. Erst nachdem ein Whistleblower auf ein vermutliches Fehlverhalten hingewiesen hatte, gab der Präsident die vom Kongress genehmigte Militärhilfe frei.
Bei den Anhörungen geht es auch um Täuschung in Form der Massenlüge. Fiona Hill, die führende Expertin des Weißen Hauses für Russland, die bei den Anhörungen aussagte, warnte den Kongress davor, die „fiktive Erzählung“ zu wiederholen, die Ukraine habe bei den Präsidentschaftswahlen 2016 eingegriffen, denn dies würde Wladimir Putin in die Hände spielen.
Die Ernsthaftigkeit der Beamten kontrastiert mit der Täuschung des Präsidenten. Zehn der zwölf Zeugen stammten aus der professionellen außenpolitischen Bürokratie. Sie bezeugten ihr starkes und oft tief empfundenes Engagement für die Ideologie professioneller Unpartei lichkeit. Dr. Fiona Hill betonte, dass sie „heute als Zeugin für Tatsachen auftauche“. Sie spricht von ihrem Stolz, „eine unparteiische Außenpolitikerin“ zu sein. Und sie fügte hinzu: „Ich habe kein Interesse daran, das Ergebnis Ihrer Untersuchung in eine bestimmte Richtung zu lenken, außer in Richtung der Wahrheit.“
William B. Taylor Jr., der führende amerikanische Diplomat in der Ukraine, sprach von demselben vernünftigen Ziel: „Ich bin nicht hier, um die eine oder andere Seite zu wählen oder für ein bestimmtes Ergebnis einzutreten. Mein einziger Zweck ist es, Fakten zu liefern.“ Gefragt, ob die Tätigkeiten des Präsidenten eine Anklage rechtfertigen, sagte er, dass ein Urteil darüber allein dem Kongress zustehe und über seine eigene Rolle als Tatsachenzeuge hinausreiche.
Für viele, die das Amtsenthebungsverfahren unterstützen, waren die Beamten, die aussagten, unbesungene Helden. Michelle Cottle in der NY Times schrieb: „Mr. Trump scheint etwas erreicht zu haben, das niemand für möglich gehalten hat: Er hat Beamte sexy gemacht.“
Ich weinte, als Oberstleutnant Alexander Vindman, der führende ukrainische Experte für den Nationalen Sicherheitsrat, seinem Vater dafür dankte, dass er alles riskiert hatte, um seine Familie in ein Land zu bringen, in dem Vindman frei und sicher gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten aussagen konnte, ohne Gefahr zu laufen, inhaftiert zu werden oder Schlimmeres zu gegenwärtigen. Vindman sagte: „Dad, meine heutige Sitzung hier, im US-Kapitol, ist der Beweis dafür, dass du vor vierzig Jahren die richtige Entscheidung getroffen hast, die Sowjetunion zu verlassen und hierher in die Vereinigten Staaten von Amerika zu kommen. Mach dir keine Sorgen. Mir wird es gut gehen, wenn ich die Wahrheit sage.“
Die Vorstellung, dass die Ernsthaftigkeit der öffentlich Beamteten der lügenden Täuschung des Präsidenten entgegensteht, ist beruhigend.
Aber bei aller inspirierenden Rede von heldenhafter Überparteilichkeit veranschaulichen Hill, Vindman und Taylor auch das, was Arendt provokativ die „Kunst des Lügens“ von „professionellen“ Problemlösern nennt . Denn neben der Aussage über die Tatsachen dessen, was der Präsident getan hat, haben alle drei auch ausführlich über die Notwendigkeit militärischer Hilfe für die Ukraine Zeugnis abgelegt. Die Hilfe, so sagten sie, sei unerlässlich, um die Demokratie zu unterstützen und der russischen Aggression entgegenzuwirken. Sie sprachen mit der moralischen und intellektuellen Autorität von Experten und Technokraten. Aber ihre Schlussfolgerungen sind, wie Arendt in einem anderen Kontext feststellt, eben keine Fakten, sondern Hypothesen.
Es ist natürlich möglich, dass Militärhilfe der Demokratie in der Ukraine hilft, aber sie könnte auch zur Militarisierung der Ukraine, zu Tausenden von unnötigen Todesfällen, zu einem langwierigen Krieg und zur Untergrabung der Demokratie führen. Es kann kaum eine Tatsache genannt werden, dass militärische Hilfe entweder der Ukraine oder den Vereinigten Staaten Vorteile bringt.
Vietnam zeigte, dass die Vereinigten Staaten einen jahrzehntelangen Krieg mit Befriedungs- und Umsiedlungsprogrammen, Entlaubung, Napalm und Antipersonenkugeln führen konnten, alles im Namen der Sicherung von Demokratie in Vietnam und der Welt und gleichzeitig, um kommunistische Aggressionen zu verhindern. Eine Lektion, die Arendt lernte, war die Erkenntnis, wie einfach es für Problemlöser und Technokraten ist, geopolitische Theorien zu beschwören, die militärische Intervention rechtfertigen. Allzu leicht, so Arendt, kann man von einer Hypothese, wie der sog. Dominotheorie, zu der als Tatsache ausgegebenen Auffassung kommen, dass wir einen Krieg führen müssten, um Vietnam zu retten.
Arendt kommt mit Blick auf die „Intellektuellen“, die den Krieg rechtfertigten, zu der Schlussfolgerung: „Sie brauchten keine Fakten, keine Informationen; sie hatten eine ‚Theorie‘, und alle Daten, die nicht passten, wurden verleugnet oder ignoriert ... Defaktualisierung und Problemlösung wurden begrüßt, weil die Missachtung der Realität den politischen Konzepten und Zielen selbst innewohnte“.
Ich wende mich hier Arendt zu, um zu zeigen, dass es eine Tendenz unter Intellektuellen in der Regierung gibt - Arendt nennt sie „Problemlöser“ –, „zu glauben, dass wir Ereignisse verstünden und Kontrolle über sie hätten, die wir aber nicht haben.“ Für Arendt führt dieses Vertrauen zu einer falschen Gewissheit; es ist eine Art Lüge.
Wir müssen Arendts Warnung vor der Gefahr, die Intellektuelle für die demokratische Regierung darstellen, ernst nehmen. Nach mehr als fünf Jahrzehnten zunehmend technokratischer Herrschaft durch Eliten erleben wir eine Rebellion der Öffentlichkeit gegen das Regieren durch Eliten. Die Vorurteile der elitär-liberaldemokratischen Politik – Demokratie heißt Elite, Liberalismus und Individualismus – werden gestört. Das technokratische Vorurteil der Elitepolitik ist nicht mehr sinnhaft und umsetzbar.
Arendt hilft uns, den Kontext für die Anhörungen zum Amtsenthebungsverfahren zu verstehen: den Verdacht, das Misstrauen, das viele gegen elitäre Herrschaft durch einen professionellen öffentlichen Dienst und studierte Eliten hegen. Eliten waren niemals freundlich zu Demokratien. Im Gegenteil, die zivilisatorischen Forderungen von Intellektuellen sind den demokratischen Traditionen im Allgemeinen entgegengesetzt.
Wie Alexis de Tocqueville bemerkte, fällt es einer zivilisierten Gesellschaft schwer, die Versuche zur Freiheit selbstregierter Stadtgemeinden zu tolerieren. Tocqueville sah den Geist der Vereinigten Staaten in Townships, die von Bauern, Lehrern und Ladenbesitzern regiert werden. Solche Gemeindeselbstregierung beinhaltet „gröbere Elemente“, die sich der gebildeten Meinung der Experten und Elitepolitiker widersetzen. Deshalb wird die Gemeindefreiheit in der Regel einer aufgeklärten Regierung geopfert.
Arendt sorgt sich um die Verwandlung der Intellektuellen von einer „marginalen sozialen Gruppe“ zu einer „neuen Elite, deren Arbeit, die die Bedingungen des menschlichen Lebens in einigen Jahrzehnten fast bis zur Unkenntlichkeit verändert hat, für das Funktionieren der Gesellschaft unerlässlich geworden ist. Intellektuelle sind ‚die wirklich neue und potenziell revolutionäre Klasse in der Gesellschaft‘.“ Es gibt, so Arendt weiter, allen Grund zu befürchten, dass die Macht der Intellektuellen in unserer Gesellschaft „sehr groß, vielleicht zu groß für das Wohl der Menschheit ist.“
Die Herrschaft der Intellektuellen entspricht der Zentralisierung der Macht und dem Aufstieg eines Verwaltungsstaates. Intellektuelle gewinnen an Macht, wenn die Länder stärker zentralisiert und verwaltungsbedürftig werden. In großen Ländern erleben wir eine Desintegration der öffentlichen Dienste - Schulen, Polizei, Müllabfuhr, sauberes Wasser und Luft gelten als „die automatischen Ergebnisse der Bedürfnisse von Massengesellschaften, die unkontrollierbar geworden sind“. All dies führt zu einem „wachsenden, weltweiten Groll gegen die ‚Größe‘ als solche“, ebenso wie gegen den Intellektuelle und Technokraten, die immer wieder versprechen, diese Größe der zentralisierten Regierungen zu zähmen und zu verwalten.
Die Herrschaft der Intellektuellen „führt dazu, dass alle authentischen Machtquellen im Land versiegen oder versickern“. Wenn den Menschen gesagt wird, dass die Gesellschaft zu komplex sei, um von irgendeinem außer von Experten regiert zu werden, werden sie entmachtet. Das Ergebnis sind Feindseligkeiten und Ressentiments gegen Intellektuelle, die durchaus „alle mörderischen Eigenschaften eines rassischen Antagonismus beherbergen“ können.
Angesichts einer solchen Gefahr durch eine zahlenmäßig überlegene Klasse von Nicht-Intellektuellen geht Arendt davon aus, dass die „Gefahr von Demagogen, von Volksführern, so groß werden wird, dass sich die Meritokratie zu Tyrannei und Despotie gezwungen sieht.“ Es besteht, so sieht sie es, die Gefahr eines gesellschaftlichen Krieges zwischen Experten und der einfachen Leute. Und sie fügt prophetisch hinzu, dass Ressentiments gegen Intellektuelle und Technokraten die Ursache für zunehmende Gewalt und erneuerten ethnischen Nationalismus sind.
Arendts Antwort auf den Verlust der Eliten-Autorität ist nicht, dieselbe Autorität der Elite wiederherzustellen. Die Gefahr von Eliten in der Regierung besteht darin, dass sie vorgeben, Wissen und Wahrheit zu haben, die sie nicht besitzen. Wir müssen uns mit der Tatsache versöhnen, dass es bei der Politik nicht um Wahrheit geht und dass technokratische Eliten keinen politischen Vorteil gegenüber Nicht-Eliten haben. Arendt lässt uns der Tatsache ins Auge sehen, dass Pluralität bedeutet, dass alle Meinungen in der Politik gleich sind.
Für Arendt geht es in der Politik nicht um Wahrheit. Deshalb drängt sie warnend darauf, dass die Ansprüche des Experten von jener der Politik getrennt werden sollten. Ein Klimawissenschaftler kann die Fakten und Theorien über unseren wärmer werdenden Planeten verstehen. Aber für Arendt hat ein Wissenschaftler keinen besseren Anspruch auf ein Urteil darüber, wie man auf den Klimawandel reagiert, als ein Baseballspieler oder ein Hausmeister. Die Wissenschaftler sind insofern wichtig, als er die Fakten feststellen, dass sich der Planet erwärmt. Aber in Fragen demokratischer Politik sollten Experten kein besonderes Ansehen genießen.
Ich möchte mit dem Gedanken abschließen, dass die Geisteswissenschaften eine Antwort auf die Gefahr und den Verlust der politischen Autorität der Elite sind. In den Geisteswissenschaften geht es darum, Geschichten, die wir für schön und gerecht und gut halten, zusammenzuflicken und aus diesen Geschichten eine gemeinsame Welt zu machen. Es spielt an sich keine Rolle, ob die Welt, von der wir erzählen, wahr ist, was auch immer die Wahrheit bedeuten würde. Die Geschichten, die wir erzählen, machen unsere Welt bedeutungsvoll, machen sie zu einer Welt, die wir mit unseren Freunden, Landsleuten und der ganzen Menschheit teilen. Die Geisteswissenschaften sind die gemeinsame Geschichte unseres menschlichen Aufenthalts auf dieser Welt.
Die Geisteswissenschaften als Praxis halten eine Tradition zusammen. Indem wir alte Texte, die Teil einer gebrochenen Tradition sind, auf neue Weise interpretieren und über sie miteinander sprechen, finden wir neue Bedeutungen und neue Geschichten, die unsere gemeinsame Welt bewahren und neu gestalten.
Die Geisteswissenschaften sind wichtig, lehrt Arendt, denn durch die Geisteswissenschaften bestätigen und sagen wir, was wir gemeinsam haben und was ist.
Zu sagen, „was ist“, heißt nicht, zu sagen „was wahr ist“. Die Geisteswissenschaften streben keine Objektivität an. Aber wenn die Geisteswissenschaften sagen, was ist, um dem, was wir alle teilen, Lebendigkeit zu verleihen, bestätigen sie unsere gemeinsame menschliche Welt. Sie tragen dazu bei, das zu schaffen und zu sichern, was Arendt, den überragenden Himmel und den Boden nennt, auf dem wir stehen. Im Gegensatz zu Experten, die darauf bestehen, den besten Weg in die Zukunft zu kennen, versucht der Geisteswissenschaftler, immer wieder die Brillanz dessen wiederherzustellen, war und was es. Auf diese Weise sind die Geisteswissenschaften unsere größte Waffe im Kampf gegen Defaktualisierung und Täuschung, die unsere Welt zu ruinieren droht.
Wenn Hannah Arendt heute etwas in unserer Welt bedeutet, so ist es, dass das, was die Politik heute so dringend braucht, nicht nur der Experte, sondern auch der Geisteswissenschaftler ist.
Jerome Kohn (1931-2024) war ein renommierter Hannah Arendt-Forscher und emeritierter Professor an der New School for Social Research in New York. Als langjähriger Vertrauter und Nachlassverwalter Hannah Arendts trug er maßgeblich zur Herausgabe und Interpretation ihres Werks bei und galt als einer der führenden Arendt-Experten weltweit.
Roger Berkowitz ist Rechts- und Politikwissenschaftler sowie Gründer und akademischer Direktor des Hannah Arendt Center for Politics and Humanities am Bard College in New York. Er ist Autor mehrerer Bücher über Hannah Arendt und ihre politische Philosophie und organisiert regelmäßig internationale Konferenzen zu aktuellen politischen Fragen im Geiste Arendts.
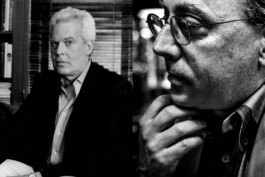
© Privat/Doug Menuez
Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Berkowitz. Im Namen des Vereins „Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken“ sowie im Namen von dessen Vorstand begrüße ich Sie herzlich zur nunmehr 24. Preisverleihung hier in den ehrwürdigen Räumen des Bremer Rathauses. Zu Beginn möchte ich Ágnes Heller gedenken. Sie war 1995 unsere erste Preisträgerin und verstarb in diesem Sommer im Alter von 90 Jahren ... Nun zurück zur diesjährigen Preisverleihung: Einen ganz besonderen Dank möchte ich der internationalen Jury aussprechen, die sich für die Findung der Preisträger viel Zeit genommen, intensiv diskutiert und sorgfältig abgewogen hat. Und natürlich danke ich den Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes für die wunderbare Zusammenarbeit, die – und deshalb hebe ich ihn namentlich hervor – vor allem durch Peter Rüdels geduldige Koordinierung und gründliche Organisation möglich war. Der Preis – inzwischen seit über zwei Dekaden an Menschen verliehen, die kritisch reflektierend, mutig, entschlossen und ganz im Sinne Hannah Arendts das „Wagnis Öffentlichkeit“ angenommen haben – wird auch in diesem Jahr wieder vom Senat der Freien Hansestadt Bremen und der Heinrich Böll Stiftung vergeben. Den beiden Preisstiftern gilt daher unser nachdrücklicher Dank, sowohl für die finanzielle Unterstützung als auch für das Zeichen, das sie mit der langjährigen Förderung eines primär politischen Preises setzen. Besonderer Dank gilt Silke Krebs, Staatsrätin der Freien Hansestadt Bremen, sowie Ellen Ueberschär, Vorstand der Heinrich Böll Stiftung, dass sie für die Preisgeber zu uns sprechen werden. Fraglos leben wir in unruhigen, wenn nicht gar beunruhigenden Zeiten, die uns vor große Herausforderungen stellen – Herausforderungen des politischen Handelns, aber auch und zuvorderst des politischen Denkens. Die diesjährigen Preisträger Jerome Kohn und Roger Berkowitz haben es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur den politischen Denkraum Hannah Arendts auszuleuchten und zu analysieren, sondern ihn auch für die Volatilität der gegenwärtigen politischen Welt nutzbar zu machen.
In einer Zeit, in der unsere Demokratien weltumspannend in Gefahr sind, drängen sich uns Fragen auf. Wie verändern sich die Demokratien angesichts von Fluchtbewegungen, Klimakatastrophe, sozialer Ungerechtigkeit und der sich rasant entwickelnden, sämtliche Lebensbereiche umpflügenden Digitalisierung? Wie kann der durch Manipulation hervorgerufenen Aushöhlung der politischen Welt begegnet werden? Vermag der politische Liberalismus neue Prinzipien des Zusammenlebens zu generieren und einem widererstarkten Nationalismus die Stirn zu bieten? Was von all diesen Bedenken ist Schwarzmalerei, was unleugbare Realität? Und wie können komplexe Fragen erhellend, aber nicht vereinfachend, in einer verdichteten, welthaltigen, aber nicht sich an der Oberfläche verlierenden Sprache beantwortet werden – einer Sprache, die uns in die politische Welt hineinzieht und nicht aus ihr herauskatapultiert? Jerome Kohn, langjähriger Freund und Mitarbeiter Hannah Arendts an der New School in New York hat ihr entschieden unabhängiges, menschenzugewandtes Querdenken von Anbeginn begleitet. Dass er ihr Werk, insbesondere ihre unveröffentlichten Schriften, einer weltweiten Leserschaft zugänglich gemacht hat, gehört ebenso zu seinen Verdiensten wie sein unermüdliches Engagement, Arendts Grundüberzeugungen in die Welt zu tragen und die Bedeutung ihres Politikbegriffs für die Demokratie herauszustellen. Roger Berkowitz, Rechts- und Politikwissenschaftler, ist akademischer Direktor des Hannah Arendt Center am Bard College in New York. Mit der Gründung dieses Zentrums entstand ein Ort, an dem Studierende Hannah Arendts Denken entdecken können und der es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Politikerinnen und Politikern aus aller Welt ermöglicht, über den Kurs der globalen Politik von heute zu debattieren. Es ist Roger Berkowitz‘ Verdienst, dass das Hannah Arendt Center zu einem Ort der politischen Begegnung und fruchtbarer Auseinandersetzungen geworden ist. Mit seinen öffentlichen Interventionen hält er die Frage aktuell, was es bedeutet in einer von Täuschungen bedrohten Welt zu leben, sie zu verstehen und sie dergestalt als eine gemeinsame und sinnvolle Welt anzunehmen. Beide – Jerome Kohn und Roger Berkowitz – halten das Arendtsche Denken lebendig und ermutigen ihre Mitmenschen, Position zu beziehen und Verantwortung in der Gegenwart für die Zukunft zu übernehmen. Dieses herausragende Engagement der beiden amerikanischen Wissenschaftler hat die internationale Jury des „HannahArendt-Preises für politisches Denken“ gesehen und gewürdigt. Die Jurybegründung vortragen respektive die Laudatio halten wird in diesem Jahr Antonia Grunenberg. Als Professorin für Politische Wissenschaft und langjährige Leiterin des Hannah Arendt-Zentrums an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg war sie an der Etablierung des Preises maßgeblich beteiligt – und ist auch nach ihrer Emeritierung Hannah Arendt verbunden, wie zahlreiche Fachaufsätze und Publikationen unter Beweis stellen. Diese Verbundenheit zu dem aus der Marginalität kommenden und die Epizentren der politischen Welt erfassenden Denken Hannah Arendts, eint die Laudatorin mit den beiden diesjährigen Preisträgern. Antonia Grunenberg wird uns deren
wissenschaftliche Leistungen in Erinnerung rufen und uns das dem Arendtschen Denken verpflichtete Wirken in der Gegenwart erläutern und es würdigen. Im Anschluss haben die Preisträger das Wort. An dieser Stelle möchte ich Jerome Kohn entschuldigen, der leider nicht persönlich anreisen konnte, uns aber eine Videobotschaft zukommen ließ, die wir in Teilen heute und in Gänze in einer eigenen Diskussionsveranstaltung im kom - menden Jahr sehen werden. Es folgen der Vortrag von Roger Berkowitz und schließlich die Übergabe des Preises. Danach lassen wir traditionell den Abend im Nachbarsaal ausklingen, wo Sie bei einem Glas Sekt das Gehörte in Gesprächen weiterspinnen und vertiefen können. Eine inhaltliche Intensivierung findet beim morgigen Colloquium im Institut Français statt, wo Roger Berkowitz, Ulrike Liebert und Antonia Grunenberg das Thema „Politischer Liberalismus in unruhigen Zeiten. Das Ende des Liberalismus – ein neuer Anfang?“ diskutieren werden. Beginn ist 11:00 Uhr und Sie sind zum Mitdenken und Mitdiskutieren herzlich eingeladen. Damit übergebe ich das Wort zunächst an Staatsrätin Silke Krebs. Anschließend sprechen, wie bereits angekündigt, Ellen Ueberscher für die Heinrich Böll Stiftung, Antonia Grunenberg für die Jury und es folgen Videosequenzen der Rede Jerome Kohns und schließlich der Vortrag von Roger Berkowitz.
Vielen Dank
Sehr geehrte Damen und Herren
es ist zugleich Fluch und Segen, dass ich für meinen erkrankten Staatsratskollegen (der herzlich grüßen lässt) Jan Fries einspringe.
Ein Segen, weil ich im Umgang mit Hannah Arendt geschulten Menschen sehr geübt bin, schließlich habe ich viele Jahr in der Nähe von Winfried Kretschmann, einem ausgewiesenen Hannah Arendt Verehrer verbracht. Der hatte sogar nach nicht mal einem halbem Jahr Amtszeit als Ministerpräsident selbst bei Bildzeitung einen solchen Eindruck hinterlassen, dass sie schrieb: Hannah Arendt sei nun die meistzitiere Frau Baden-Württembergs.
Ein Fluch – oder zumindest mit Hindernissen versehen ist der Termin für mich, da ich mich immer blind auf die Expertise Kretschmanns verlassen hatte und selber keine Anstrengungen übernommen, mit passenden Gedanken und Zitaten Hannah Arendts aufzuwarten, sie waren ja immer schon da. Aber nun!
Sehr geehrter Jerome Kohn, sehr geehrter Roger Berkowitz, im Namen des Senats der Freien Hansestadt Bremen und persönlich danke ich von ganzem Herzen für Ihr jeweiliges Engagement, Hannah Arendts Impulse weiterhin in die Gesellschaft zu tragen und sie in ihr zu verankern. Das ist so wichtig!
Denn es mangelt bei all den aufgeregten Debatten an Debatten – wenn auch nicht unbedingt aufgeregten – über die unsere Art, als Gesellschaft zu handeln, wie wir als Gesellschaft agieren wollen. Und das nicht im Format Gegenspieler, also Bürger versus Politik, ‚wir da unten‘ versus ‚die da oben‘. Sondern mit dem Blick Aredts, der allen eine aktive Rolle und Verantwortung zuspricht.
Derzeit wird die Verantwortung allzu oft von den einen zu den anderen weitergereicht. Politik fixiert sich dabei sehr auf den vermeintlichen Bürgerwillen, den sie Umfragen entnimmt, BürgerInnen ziehen sich allzu oft mit einem ‚Die machen eh was sie wollen‘ zurück.
Dabei ist es so entscheidend wahrzunehmen, dass und wie beide Seiten gar keine sind, sondern miteinander innigst verwoben. Die beiden heutigen Preisträger tragen mit ihrem Wirken dazu bei. Herr Kohn, Sie haben Arendts Werk für die Öffentlichkeit um zuvor Unveröffentlichtes bereichert und für alle zugängig gemacht.
Mit dem Hannah Arendt Center am Bard College haben Sie, Roger Berkowitz, einen so wertvollen Ort des fruchtbaren Streits über Verstehen und Handeln geschaffen.
Dafür gebührt Ihnen beiden großer Dank! Nun will auch ich – endlich – zu Hannah-Arendt-Zitaten greifen.
Das eine ist top aktuell:
„Weisheit ist eine Tugend des Alters, und sie kommt wohl nur zu denen, die in ihrer Jugend weder weise waren noch besonnen“
Welch ein passender Kommentar zu Friday-for-Future, er sei so manchem Kritiker auf die Fahnen geschrieben.
Und dann noch eines von Kretschmanns Lieblingszitaten. Er meint, Hannah Arendt habe immer gesagt, „Wo, wenn nicht in der Politik, dürfen wir Wunder erwarten?“
Was lässt sich besser dem Untergangspessimismus, auch in der Klimadebatte, entgegensetzen.
Meine Herren Preisträger, tragen Sie bitte weiter die Ideen Arendts in die Gesellschaft, wir bemühen uns weiter, gute Politik zu machen und wer weiß, vielleicht sind dann Wunder möglich.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Berkowitz, liebe Frau Berkowitz, lieber Henning Scherf, liebe Mitglieder der Jury, liebe Laudatorin, verehrte Gäste,
mein Name ist Dr. Ellen Ueberschär, ich bin Vorstand der Heinrich Böll Stiftung und gratuliere den diesjährigen Preisträgern des Hannah-Arendt-Preises, Roger Berkowitz und Jerome Kohn.
Wie Sie alle wissen, ist diesen Sommer die von uns so verehrte Agnes Heller im Alter von 90 Jahren verstorben. Sie war nicht nur große Intellektuelle und große Europäerin, sie war auch die erste Preisträgerin des Hannah-Arendt-Preises im Jahr 1995. Mit der diesjährigen Verleihung an Roger Berkowitz und Jerome Kohn schlagen wir einen Bogen, der sich über den Atlantik quasi von New York nach Bremen spannt.
Agnes Hellers Werk lässt sich „als eine Antwort auf das Denken Hannah Arendts lesen“. Persönlich ist sie Hannah Arendt jedoch nie begegnet. Jerome Kohn dagegen war Arendts langjähriger Freund und Mitarbeiter an der New School in New York. Er hat ihre Kunst zu Denken und zu Arbeiten hautnah, „live“, erlebt. Und hat sich später ihrem Werk voll und ganz verschrieben. Er publizierte unter anderem vier Bände von Arendts zuvor unveröffentlichten Schriften: „Essays In Understanding“, „Responsibility and Judgment“, „The Promise Of Politics“, „The Jewish Writings“ und zuletzt „Thinking Without Bannisters“ – eine Zusammenstellung an Essays, Reden, Interviews und Vorträgen, die die ganze Fülle ihrer anregenden Gedanken vor uns ausbreitet. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass uns die Texte Arendts ohne das Wirken von Jerome Kohn heute nicht in derselben Weise zugänglich wären.
Einen entscheidenden Beitrag zur Verbreitung des arendtschen Denkens hat auch Roger Berkowitz geleistet. Er hat sich zwar ebenso mit griechischer und deutscher Philosophie, Rechtsgeschichte und Verfassungstheorie beschäftigt, immer wieder ist er jedoch zurückgekehrt zu Hannah Arendt
Als Gründer und akademischer Direktor des Hannah Arendt Center am Bard College in New York hat er einen Ort geschaffen, an dem insbesondere Studentinnen, Wissenschaftlerinnen und Interessierte das Werk Arendts studieren und diskutieren können. Gerade die lebendige Auseinandersetzung mit Werk und Person Hannah Arendts ist auf solche Gelegenheit des pluralen Austauschs angewiesen, die gewissermaßen von einem dritten Ort aus, der Reflexion des öffentlichen, politischen Denkens dienen. Wir sind uns der Paradoxie bewusst, dass auch dieser dritte Ort zugleich selbst ein öffentlicher politischer Raum ist, und als solcher Gegenstand öffentlicher politischer Auseinandersetzungen werden kann.
Die Stifter dieses Preises wollen mit der Auszeichnung nicht allein akademische Leistungen, sondern ein Wirken in der Öffentlichkeit ehren. Zum Selbstverständnis heißt es, ich zitiere: „Geehrt werden Personen, die das Wagnis Öffentlichkeit angenommen haben und das Neuartige in einer scheinbar sich linear fortschreibenden Welt denkend und handelnd erkennen und mitteilen.“ Wie kaum eine andere Denkerin hat Hannah Arendt darüber nachgedacht, wie der öffentliche politische Raum entsteht. Und auf der Suche nach den Ursachen der totalitären Herrschaft im 20. Jahrhundert, hat sie erforscht, wie moderne Gesellschaften diesen Raum zerstören und dadurch totalitäre Herrschaft erst ermöglichen.
Öffentlichkeit als Voraussetzung für Demokratie. Die Leistung, die Jerome Kohn und Roger Berkowitz vollbracht haben, besteht darin, das Werk Hannah Arendts, insbesondere ihre unveröffentlichten Schriften, einer weltweiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen: in unzähligen Publikationen, Interviews, in Artikeln und Vorträgen – auf beiden Seiten des Atlantiks. Das ist ein Geschenk für alle, die sich mit dem Denken und Handeln im Geiste Hannah Arendts auseinandersetzen und es mit Leben füllen. Jetzt und in der Zukunft.
Ganz im Sinne Arendts geht es heute und morgen um „die Veränderungen der Demokratien im Zeitalter der Globalisierung“. Das berühmte Shakespeare-Zitat – „die Welt ist aus den Fugen“ – ist nicht zuletzt vom amtierenden Bundespräsidenten als aktuelle Zustands- Beschreibung der politischen Landschaft gewählt worden.
Im 30. Jahr der Erinnerung an den Fall des Eisernen Vorhangs wird uns bewusst, dass wir keineswegs nach dem Ende der Geschichte leben, sondern allenfalls am Beginn der Herausprägung einer neuen Weltordnung, um deren Charakter wir ein Ringen erleben und selbst darin handeln müssen. In jedem Fall wird China eine größere Rolle in dieser neuen Ordnung spielen, die Digitalisierung und die Klimakrise. Ob die Demokratie in ihrer liberalen Ausprägung, wie sie ganz wesentlich von Hannah Arendt gedacht worden ist, ob die multilateralen Ordnungssysteme auch in Zukunft funktionsfähig sein werden, ob wir mit Hilfe neuer Technologien die Klimakatastrophe abwenden können, steht im Moment auf dem Spiel. Aber das Denken Hannah Arendts ist ein Denken der Hoffnung auf Veränderung, ein Vertrauen auf die Möglichkeit des politischen Handelns. Das sollten wir uns zu Herzen nehmen!
Einzustimmen in ein konservativ bis reaktionär motiviertes, wenig humanitäres Krisengerede von Seiten illiberaler, ethnopluraler und menschenrechtsverletzender Seite ist der falsche Weg. Er führt geradewegs in die Aporien einer unausweichlichen Machtergreifung durch selbsternannte, anti-elitäre Führer und in das geschlossene, pöbelnde Denken einer verunsicherten Pseudopolitik, wie wir sie seit 2 Jahren im Bundestag beobachten können. Dem müssen wir – das sind wir Hannah Arendt schuldig – etwas entgegensetzen: die Öffentlichkeit, die Redlichkeit und die Glaubwürdigkeit politischen Denkens.
Demokratinnen und Demokraten aller Couleur müssen für die Veränderbarkeit der Verhältnisse zum Besseren einstehen, wenn gilt, was Hannah Arendt so wunderbar gesagt hat: „Der Sinn von Politik ist Freiheit.“
Die Auseinandersetzung mit den zerstörerischen, totalitären, in ihrer Form gleichwohl neuartig erscheinenden Tendenzen des 21. Jahrhunderts baut notwendigerweise auf Arendts theoretischem wie praktischem Engagement gegen den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts auf. Den Zugang dazu haben uns auch Jerome Kohn und Roger Berkowitz eröffnet – dafür sind wir Ihnen dankbar.
Und erlauben Sie mir abschließend noch eine Bemerkung: Gerade in diesen stürmischen Zeiten ist die Verleihung eines Preises, der Hannah Arendt gedenkt, an zwei amerikanische Intellektuelle besonders wichtig: Um immer wieder an die starken Bande zwischen Europa und den Vereinigten Staaten zu erinnern. Und um deutlich zu machen, dass wir diese Bande nicht leichtfertig aufgeben dürfen – Hannah Arendt, Agnes Heller, Roger Berkowitz und Jerome Kohn sind der beste Beweis.
Herzlichen Glückwunsch!
Meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Staatsrätin Krebs, liebe Ellen Ueberschär von der Heinrich Böll-Stiftung, liebe Freundinnen und Freunde des Hannah-Arendt-Preises, lieber abwesender Jerome Kohn, lieber anwesender Roger Berkowitz.
Es ist mir eine Ehre, Sie beide, Jerome Kohn und Roger Berkowitz hier und heute zu würdigen.
Die Jury ist mit dieser Preisvergabe zu den Ursprüngen des HannahArendt-Preises zurückgekehrt. Sie hat gefragt: wer beschäftigt sich mit dem Werk Arendts in einer Weise, die sowohl die Geschichtlichkeit, das Zeitbedingte als auch die Aktualität, das über die Zeit Hinausreichende dieses ungewöhnlichen politischen Denkens herausarbeitet. Wer erhebt mit Arendt seine/ihre Stimme gegen die bleierne Trägheit des demokratischen Diskurses in den Vereinigten Staaten?
In ihren öffentlichen Interventionen und in ihren Arbeiten greifen beide Preisträger die unterschiedlichen Facetten der Denkerin und politischen Analytikerin Hannah Arendt in je eigener Weise auf. Sie fragen öffentlich: wie kann sich die amerikanische Demokratie gegen die zerstörerischen Tendenzen im eigenen Haus wehren?
Jerome Kohn war in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts Assistent Hannah Arendts an der New School for Social Research, jener Hochschule, die so vielen 1933 aus Deutschland vertriebenen Hochschullehrern Zuflucht gewährte. Er betreut seit Jahren den Nachlass von Hannah Arendt und ihrem Mann Heinrich Blücher.
Es war Jerome Kohn, der seit den neunziger Jahren maßgeblich dafür sorgte, Arendts Denken über die Vereinigten Staaten hinaus bekannt zu machen, indem er ihre unveröffentlichten Texte einer weltweiten Öffentlichkeit zugänglich machte. Lassen Sie mich nur ein paar Aspekte benennen, die Kohn als besonders typisch für die Eigenart von Arendts Denken heraushebt:
– Arendt betrachtete das Denken nicht als professionelle Aufgabe von Intellektuellen, sondern als eine Angelegenheit all derer, die an der Öffentlichkeit interessiert sind. Denken ist auch nicht nur Angelegenheit einer Disziplin, etwa der Philosophie, sondern es entsteht im Aufeinandertreffen verschiedener Perspektiven aus der Geschichtswissenschaft, der Philosophie, Soziologie und Literatur, der politischen Ereignisse und der Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger
– Arendt wertschätzte Literatur und Dichtung als originäre Weisen des Denkens, eine Sichtweise, die ihre Kollegen aus den Humanwissenschaften mitunter mit völligem Unverständnis quittierten.
– Last but not least, Arendt argumentierte nicht als Moralphilosophin, die Anleitungen für das Gutsein und Gutes-tun der Bürgerinnen und Bürger verfasst hätte, sondern sie wies nachdrücklich auf die Möglichkeit politischen, immer risikoreichen Handelns im Sinne des Gemeinwesens der Bürgerinnen und Bürger (nicht des Staates und nicht der Nation) hin.
In Kohns Kommentaren zu Arendts Essays wird deutlich, dass ihr Denken eben mehr ist als eine Theorie wie andere. Streitbares, unseren Denkgewohnheiten entgegenstehendes Denken wäre eher kennzeichnend. Um dieser Denkweise gegenüber offen zu sein, bedarf es einer erheblichen Erweiterung des eigenen Denkhorizonts, was anstrengend ist, da es oft den eigenen Überzeugungen entgegenläuft. Doch dem gilt es sich auszusetzen, so argumentiert Kohn, wenn wir, die heutigen Generationen die Impulse Arendts weitertreiben wollen in die Gegenwart.
Durch Kohns öffentliches Reden wie durch seine Texte zieht sich die Frage: Wie kann Arendts Weise, die Welt zu betrachten, uns beim Verstehen der gegenwärtigen politischen Gemengelage helfen? Und wie müssen wir weiterdenken? Zusammen mit Elisabeth Young Bruehl (sie wäre heute die dritte im Bunde der Preisträger, wenn sie nicht schon von dieser Welt verschwunden wäre), brachte er seit den neunziger Jahren Fragen wie diese auf unzähligen Konferenzen zur Debatte. Die Tatsache, dass die nachwachsenden Generation ihnen zuhörte und immer wieder kam, dass das Interesse an der Deutsch-Amerikanerin Arendt nicht nachließ, hat gewiss viel mit der offenen Art zu tun, mit der Kohn den Denkansatz Arendts in der Öffentlichkeit präsentierte – aber ebenso gewiss auch viel mit dem Niedergang der demokratischen Debattenkultur in den Vereinigten Staaten, die eine gewisse Leere und Orientierungslosigkeit im öffentlichen Raum bis heute hinterlässt.
Lassen Sie mich meine kurze Würdigung mit einem deutlichen Verweis darauf schließen, wie Kohn das Denken Arendts auf die Gegenwart bezieht. In einem Brief aus jüngster Zeit heißt es:
„In Hongkong ereignet sich Politik direkt vor unseren Augen. Das Volk hat die Macht aufgenommen, die auf der Straße lag und organisiert die Macht in lokalen Räten. So etwas hätte Hannah Arendt ein „politisches Wunder“ genannt. Wäre sie überrascht gewesen? Natürlich, und sie hätte gejubelt. Aber viele hierzulande nehmen das Wunder kaum wahr, allenfalls wie einen Bauer im Schachspiel der Macht zwischen Washington und Beijing. – Doch für jeden der sehen kann, ist unübersehbar: Die Flamme der Freiheit hat sich einmal wieder gezeigt, diesmal in Hongkong.“
Den Preis gleichzeitig an Roger Berkowitz zu vergeben, ist geradezu zwingend, wenn man bedenkt, dass Berkowitz, aus der nächsten Generation nach Kohn stammend, in seiner Arbeit von den Fragen ausgeht, die Kohn und Elisabeth Young-Bruehl Jahrzehnte vorher in die Debatte gebracht hatten.
Roger Berkowitz ist von Haus aus Politikwissenschaftler und Rechtsgelehrter, gegenwärtig Professor für Politik, Menschenrechte und Philosophie am Bard College im Staat New York. Bard College ist im übrigen der Ort, an dem die Eheleute Hannah Arendt und Heinrich Blücher begraben liegen; dort steht auch Arendts Hausbibliothek der Öffentlichkeit zur Verfügung. 2006 gründete Berkowitz mit nachdrücklicher Unterstützung von Jerome Kohn dort das Hannah Arendt Zentrum für Politik und Humanwissenschaften, dessen Akademischer Direktor er seither ist. Wie der Name schon sagt, ist das Hannah Arendt Center ein Ort für streitbares politisches Denken und nicht nur ein Ort der akademischen Diskurse. Und dies zeichnet sowohl das Wirken des Zentrums wie auch seines Direktors Berkowitz aus: Arendt wird dort aus verschiedenen Perspektiven in ihre Zeit und in die Gegenwart gestellt. Das Zentrum veranstaltet Konferenzen zur aktuellen Politik, auf denen stets die Frage mitläuft: wie kann man politische Ereignisse verstehen, wo kann die Kritik ansetzen, welche Handlungsoptionen gibt es? Über die Jahre ist das Arendt-Zentrum ein Ort offener politischer Debattenkultur geworden. Dort kommen mitunter auch Leute zu Wort, die am Rande der demokratischen Kultur stehen. Dafür ist Berkowitz heftig kritisiert worden – und antwortet seinen Kritikerinnen und Kritikern mit dem Verweis darauf, dass Pluralität manchmal schwer auszuhalten ist, aber dass man sie in allen ihren Facetten praktizieren sollte, will man die Welt und die Menschen verstehen. Verkürzt könnte man auch sagen: man muss den Gegner kennen, den man politisch bekämpfen will. Oder um es distinguierter mit dem amerikanischen Obersten Richter Oliver Wendell Holmes im Jahre 1919 zu sagen:
„... wir benötigen den Gedankenreichtum der ganzen Gesellschaft, um uns mit den Ideen zu versorgen, die wir brauchen. Denken ist eine gemeinschaftliche Angelegenheit. Ich anerkenne deinen Gedanken, weil er Teil meines Gedankens ist – auch wenn mein Gedanke sich in Widerspruch zu deinem befindet.“
Berkowitz hat viel beachtete Bücher und Aufsätze über politische und philosophische Themen, über Arendts Denken und die gegenwärtige Politik publiziert, sie hier zu nennen, würde zu weit führen; eine Laudatio ist keine akademische Würdigung.
Doch lassen Sie mich ein Wort zur Art der Debatte kommentieren, die das Hannah Arendt-Zentrum immer wieder entzündet. Neben den Konferenzen betreibt das Center einen im Netz wöchentlich erscheinenden Newsletter. Unter dem Titel Amor Mundi erscheint er als eine Art Rundbrief an die Mitglieder, Unterstützer und Leser der Veranstaltungen und Publikationen des Hannah Arendt Zentrums. Er enthält Kommentare und Gastkommentare zur amerikanischen Politik, Rezensionen von politischen Artikeln und Zeitschriften, Polemiken, Hinweise zum Verstehen der Texte Hannah Arendts – alles in allem ist dies eine der wichtigen Stimmen in der gegenwärtig etwas ärmlichen liberalen Diskurskultur. Sein jüngster Kommentar widmet sich – wieder einmal – dem Phänomen der Fake News und warum sich Politik und Wahrheit nicht vertragen.
Beiden Preisträgern geht es um die Regeneration jener pluralen Öffentlichkeit, aus der allein auch individuelles Verstehen, gemeinsamer politischer Protest und Handeln entstehen können. Und mit dieser Leistung stehen beide Preisträger in einer Reihe mit den Preisträgern und Preisträgerinnen der Jahre 1995 bis 2018.
Zu jedem guten Vortrag gehört ein guter Witz, sagen unsere angelsächsischen Nachbarn. Und so lassen Sie mich schließen mit einem, den ich auf einer von Roger Berkowitz organisierten Tagung am Hannah Arendt Center des Bard College von Jerome Kohn gehört habe.
„Es war zu Zeiten der Finanzkrise: Hannah Arendt und Karl Marx be- gegnen sich im Himmel und schauen beide auf die Erde runter. Da fasst Arendt Marx am Ärmel und sagt: ‚Guck mal Marx, das haben sie alles allein zustande gebracht, keine Revolution nötig.‘“
Ich danke Ihnen.
Über politische Freundschaft
Zunächst möchte ich mich bei Professor Dr. Antonia Grunenberg und allen Mitgliedern der internationalen Jury sowie beim Senat der Freien Hansestadt Bremen und der Heinrich Böll Stiftung für diese hohe Auszeichnung bedanken. Keine Ehre könnte für mich jemals bedeutungsvoller sein. Ich begrüße herzlich alte und liebe Freunde und Freundinnen, auch diejenigen, die ich noch nicht getroffen habe und die ich als zukünftige Freunde anspreche. Mein einziges Bedauern, und es ist ein schweres, besteht darin, dass ich nicht persönlich mit Euch und Ihnen zusammen sein kann
Hannah Arendt sagte einmal – unvorhersehbar, wie immer –, dass einen Preis zu erhalten bedeute, eine Lektion in Demut zu erhalten. Denn, so sagte sie, es kommt nicht auf die eigene Meinung über die eigenen Verdienste an, sondern auf die verschiedenen Meinungen, die darüber bestehen. Wenn man diese auf eine Seite einer Waage stellt, überwiegt diese Vielfalt deutlich jede einzelne Meinung auf der anderen Seite. Somit, fährt Arendt fort, verpflichtet die Annahme eines Preises die Person, die ihn empfängt, auf die Pluralität der Menschen, die ihn verleiht. Natürlich in Dankbarkeit; aber es gibt noch eine andere Weise, diese Verpflichtung zu betrachten. Arendt legte auch darauf ihren Finger, indem sie zwei Zeilen aus Shakespeares Hamlet zitierte. Als Hamlet, Prinz von Dänemark davon erfährt, dass sein Vater vom König ermordet wurde, ruft er aus:
“The time is out of joint – O cursèd spite, That ever I was born to set it right! –” (Hamlet, I.v. 188-89). Und dann fügt Arendt sofort hinzu: „Im Bereich der Politik ist die Zeit immer aus den Fugen geraten.“
Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, war ich ein Junge, der nicht zuhause, sondern im Internat lebte. Ich war zu jung, um die qualvollen Details des Krieges zu verstehen, aber ich schloss mich der allgegenwärtigen Euphorie an, die durch das siegreiche Amerika fegte, ungeachtet des anhaltenden Leids so vieler entwurzelter Menschen in Europa und den meisten Teilen der Welt. Ein paar Jahre später hätte ich wahrscheinlich diese Euphorie als Folge der Niederlage des „Faschismus“ rationalisiert, allerdings auch nur mit einem vagen Verständnis dessen, was das bedeutet. Erst später, als ich bei Hannah Arendt in einem Seminar mit dem Titel „Politische Erfahrungen im 20. Jahrhundert“ studierte, wurde mir klar, dass die Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg historisch beispiellos, ja sogar unvorstellbar war. Arendts Worte beeindruckten ihre Schüler mit dem paradoxen Gedanken, dass eine so ungeheure Zerstörung ihr eigenes Ziel erreicht hatte. Das heißt, sie drängte uns zu der Erkenntnis, dass der Abschluss des Krieges in Japan der ultimative Vollzug massiver, weltvernichtender Gewalt und Stärke war. Hätte der Kriegspräsident der Vereinigten Staaten, Franklin D. Roosevelt, noch gelebt, so glaubte Arendt, hätte er nicht zugelassen, dass ohne jede Vorwarnung die ersten – und bisher einzigen – Atombomben an aufeinanderfolgenden Tagen zwei japanische Städte auslöschten. Unsere thermonuklearen Waffen des 21. Jahrhunderts sind hundert bis tausend Mal zerstörerischer als Atombomben der damaligen Zeit.
Heute, etwa fünfzig Jahre nach Arendts Seminar, ist das Paradoxon der Zerstörung als eigenes Endziel in den weltweiten öffentlichen Debatten und in den Stimmen, die sie durchdringen, präsent– und das ist kein Widerspruch, kein Endpunkt. Dies Paradoxon zeigt sich deutlich in den massenhaften Migrationsbewegungen und ist ein wichtiger Teil der schlechten Nachrichten, die Flüchtlinge immer zu ertragen haben. Es ist unverkennbar in den extremen klimatischen Veränderungen, die das Aussterben einer außerordentlich großen Anzahl von Lebewesen bewirkt haben, worüber wir es als Gemeinschaft von Lebewesen – mit bemerkenswerten Ausnahmen – eher bevorzugen hinwegzusehen als es zu verhindern. Andererseits ist Arendts Paradoxon nirgends auffälliger als im erstaunlichen Wachstum menschlicher Lebewesen, in dem anbrandenden Anstieg der menschlichen Bevölkerung in fast jedem bewohnbaren Winkel der Erde. Das Paradoxon ist das, was jeder Zerstörung als Selbst-Zerstörung zugrunde liegt und gleichzeitig jeder psychologischen Motivation von Selbstmord entgegensteht, einschließlich Dr. Freuds „Todestrieben“.
Die ökologische Forschung ist reich an Ideen, wie man die dynamische Interaktion von Organismen mit ihrer Umwelt kontrollieren kann, hat aber noch keine politisch mandatierte Verfahrensvereinbarung erreicht; und das kann man auch nicht erwarten, solange globale ökonomische Überlegungen in der öffentlichen Meinung im Vordergrund stehen. Es liegt in der Natur von Volkswirtschaften, dass sie nicht nur in Dollar oder Euro wachsen – für Arendt die am wenigsten greifbaren Anzeichen dafür, dass eine wachsende Zahl von Objekten das Begehren einer wachsenden Zahl von Subjekten befriedigen soll. Man kann sagen, dass dieser Komplex eines unnatürlichen Wachstums (wie Arendt mit Blick darauf ironisierte, dass für Aristoteles Wachstum zum Kern von Natur (physis) gehört) dazu fähig ist, sich in einen ideologischen Eindringling in den öffentlichen Raum zu verwandeln, wo er als spalterischer Versuch erscheint, die öffentliche Meinung auf die eine oder andere Seite zu ziehen. Die allgemein akzeptierte liberale Mentalität, die in der französischen und deutschen Aufklärung geboren wurde, aber fast sofort ihre Grundlage, nämlich die Gemeinsamkeit des Menschseins, verleugnete, erscheint nun in der Welt als Spaltung in radikal linke und radikal rechte Ideologien. Ihre Marionetten und Puppenspieler bringen ihre so genannten „Ideen“ – für Arendt: „Illusionen“ – gegen die ihrer ehemaligen Freunde in Anschlag, auch wenn beide Fraktionen die „Freiheit“ als das Ziel beschwören, das sie im Blick haben.
Wie erfrischend ist es, heute mit Arendt zu denken! Sie verschmähte nicht nur jeden Ismus, jede Ideologie, sondern auch jeden Versuch, die öffentliche Meinung zu gewinnen. Im Gegenteil, Ideologien und öffentliche Meinung waren für sie Zeichen von Entpolitisierung, das Aufgeben von politischem Handeln. Aber trotz der Rolle, die Ideologien bei der Bildung der öffentlichen Meinung einnehmen, bestand Arendt darauf, dass sie keineswegs die Hauptmissetäter seien. 1963 schrieb sie an einen Freund: „Selbst im Buch über den Totalitarismus (erschienen 1951), im Kapitel über Ideologie und Terror erwähne ich den merkwürdigen Verlust ideologischer Inhalte“. Für sie war vielmehr die Massen-„Bewegung selbst“, das allerwichtigste. Zehn Jahre zuvor hatte Arendt einem amerikanischen Freund geschrieben: „Die totale Herrschaft als solche ist völlig unabhängig vom tatsächlichen Inhalt einer bestimmten Ideologie.“ Lassen Sie mich die Frage auf den Kopf stellen: Gibt es etwas, das seinem Wesen nach politisch ist, etwas, was nicht aufgegeben werden kann, wenn es einen politischen Raum geben soll? Es geht hier nicht um die Funktion der Politik – nicht, wie wir in Amerika sagen, um die Funktionsweise des Systems –, sondern um die Möglichkeit, das Sprechen und Handeln einer Vielheit von Menschen so zu gestalten, dass Sprechen und Handeln sich zu Bedingungen für politisches Leben und politische Tätigkeit verwandeln.
Hier ist ein Verstehen gefordert, das nicht Wissensstand ist. Arendt besteht darauf, dass Descartes' korrekte Formulierung nicht das berühmte cogito ergo sum („Ich denke, also bin ich“) war, sondern dubito ergo sum („ich zweifle, also bin ich“). Es ist der Zweifel, nicht der Gedanke, der das Selbst oder das Ich als Schiedsrichter über Wissens und als Richter der Wahrheit einsetzt. Aber ist es nicht ein einheitliches Selbst, das da denkt, es ist vielmehr ein „Zwei-in-Eins“, wie Arendt es nennt, ein geteiltes, also ein plurales Selbst, das sowohl spricht als auch antwortet? Dieses „Zwei-in-Einem“ ist kein Konzept, sondern recht eigentlich die Erfahrung des Denkens als Dialog, dialegesthai, was auf Griechisch bedeutet, eine Angelegenheit aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu besprechen.
Die Pluralität tritt hier in den Bereich des einsamen Denkens ein, unter einer Bedingung: der Bedingung der Freundschaft. Und genau hier kommt vor allem Aristoteles in den Sinn, wenn auch nicht die historische Gestalt, die in Büchern anzutreffen ist, die über dies und das – praktisch über alles – über die Welt, in der er lebte, nachdachte. Heute nennen wir diese Welt Antike. Obwohl Aristoteles nicht an uns, noch an unsere Welt dachte, öffnet sein Denken uns doch unsere geistigen Augen für die Räume, in denen Wesen auftauchen, die sowohl miteinander in Beziehungen stehen als auch voneinander unterschieden sind – und zwar ebenso in unserer eigenen Welt, wie sie es in seiner taten. In diesem Sinne ist Aristoteles' Denken heute so lebendig wie vor mehr als zwei Jahrtausenden. Mein Hauptanliegen ist es, zu sagen, dass das politische Verhältnis, das er zwischen Freundschaft und Gerechtigkeit sah, aktueller ist denn je. Wir beklagen uns, dass Politiker kein Gewissen haben, keine innere Stimme, die ihnen sagt, was sie nicht tun sollen, aber für Hannah Arendt ist das Gewissen das Nebenprodukt der Freundschaft zwischen dem Zwei-in-Einem: Du würdest das nicht tun, wenn Du mein Freund bist. In dem Bewusstsein, dass jedes Übersetzen von Aristoteles eine Interpretation ist, will ich das mit einer kurzen, aber aussagekräftigen Passage über politische Freundschaft (philia politikē) aus dem Buch VIII seiner Nikomachischen Ethik versuchen zu erläutern:
„Freundschaft scheint die politischen Gemeinschaften zusammenzuhalten, und die Gesetzgeber scheinen mehr Wert darauf zu legen als auf Gerechtigkeit. Denn die Förderung des Einvernehmens, das Teil der Freundschaft ist, ist ihr Hauptziel, während Feindschaft das ist, was sie am meisten vermeiden wollen. Wenn Männer (men) Freunde sind, brauchen sie keine Gesetze, aber wenn es Gesetze gibt, brauchen Männer immer noch Freundschaft. In der Tat enthalten die wahrsten Formen der Gerechtigkeit die Qualität der Freundschaft und konstituieren ihren Charakter.“ (Nic. Eth. viii, 1155a26-32; vgl. ebd. 1160a30- 1163b25).
Wenn politische Freunde dann und wann kommunizieren, ist es nicht diese Kommunikation, sondern die Enthüllung, die das Wesentliche ihrer Rede ausmacht. Dies ist selten, aber nirgendwo deutlicher als in Arendts Bericht über die Erfahrung des französischen Dichters René Char in seiner Kampfzeit im französischen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs. Während er in Verstecken hauste, entdeckte er „eine Zitadelle der Freundschaft“, in der er und seine MaquisardGenossen in Bildern sprechen konnten, die allein für sie verständlich waren. Diese Bilder entstanden aus dem, was Char ihre gemeinsame „Empfindung eines Wunders“ nennt. „In unserer Dunkelheit“, schreibt er, „gibt es keinen einzigen Ort für Schönheit: der ganze Ort ist Schönheit.“ Wohlgemerkt, sie lebten in den Tiefen und der Dunkelheit von Höhlen. In diesem Dunkeln entdeckten sie einen „verborgenen Schatz“.
Char vergleicht die Enthüllung dieses Schatzes, ihre Freiheit, frei zu sein, mit dem „Rätsel einer Flamme“, die seit Jahrhunderten ungesehen brennt. Es ist diese Flamme, die uns heute den Weg erhellt, auch ohne den Freiheitsschatz der Maquisards. Die Worte des Dichters Char sind dicht, sie sind nicht transparent. Sie bezeichnen nicht, sie sind nicht Zeichen, die auf eine Idee, ein Konzept oder ein Ereignis hinweisen, was vor, hinter, über oder über ihnen liegt, weder räumlich noch zeitlich. Darauf spielt der große dänische witzige Kopf, Søren Kierkegaard, in einem seiner schönsten Gleichnisse an: „Als ein dänischer Herr in Kopenhagen die Straße hinunterging, sah er das Schild im Schaufenster: „Wanderhosen werden hier gebügelt“. Als er den Zustand seiner zerzausten Hose bemerkte, ging er in den Laden, ließ seine Hose fallen und legte sie auf die Theke. Der schockierte Ladenbesitzer fragte, was er da mache. Der dänische Gentleman sagte, er wolle sich die Hose bügeln lassen. Darauf antwortete der Ladenbesitzer: „Mein Herr, wir bügeln keine Hosen, wir machen Schilder“ (Entweder /Oder).“ Das Erscheinen, auch wenn es noch so flüchtig ist, von Objekten, Ideen, Personen und Ereignissen in der dichten Sprache der Poesie ist ihre unmittelbare Existenz. Sie können als Symbole betrachtet werden, aber nur im Sinne von Kant, also nicht als Repräsentationen, sondern als „ein Modus der Erkenntnis“ (Intuition). Kants Symbole symbolisieren nichts anderes als das, was sie selbst verwirklichen, präsent machen oder zur Geltung bringen. So schreibt er: „Das Schöne ist das Symbol des Sittlichen“ (Kritik der Urteilskraft, § 59). Ebenso werden Platons Ideen von den Augen des Geistes nicht in einem riesigen und ansonsten leeren Himmel gesehen, sondern von den menschlichen Ohren in seinen Dialogen gehört, wo er sie eingeschrieben hat. Verbale Formen dichten Denkens sind selten, außer in der großen Poesie, wo sie seit Homer der vorgesehene Modus für die enthüllende, nicht der kommunizierenden Sprache sind. Kurz gesagt, dichte Worte drücken nicht aus, pressen nicht aus, was in inkonsistenten und unbeständigen Herzen verborgen liegt, sondern beeindrucken unseren Geist und unsere Rede mit der vielgestaltigen Welt, die zwischen uns liegt, der Welt von gemeinsamem Interesse für uns. So werden wir nicht aus der Welt heraus gezogen sondern in die Welt hinein, welche die Freunde unterscheidet und sie zugleich miteinander verbindet. Denn im Gegensatz zu familialen Verbindungen sind die Beziehungen hier zwischen und von gemeinsamen Interesse für die unterschiedenen Einheiten, was jede Art von Identitätspolitik zu einem inneren Widerspruch macht.
Die Bedeutung dessen, wo wir uns befinden, wenn wir politisch denken, wird hörbar in den folgenden dichten Worten Lessings, der von Hannah Arendt so bewundert wurde. Er schrieb über den Genius der Poesie (und nun am Ende auf Deutsch): „Sein glücklicher Geschmack ist die Geschmack der Welt.“ Lassen Sie mich dasselbe noch einmal aus anderer Perspektive betrachten: Kanzlerin Merkel hat auf ähnliche Weise gesprochen, als sie vor ein paar Monaten sagte, die Vereinigten Staaten könnten nicht mehr zu den Freunden Europas gezählt werden. Ich glaube, ihre Aussage macht uns darauf aufmerksam, wie Shakespeare es vielleicht formuliert hätte, dass „etwas faul ist“ in unserer technologie-fixierten, dürre gewordenen, gefährdeten Welt. Ich versichere Ihnen an diesem Tage, dass der Gestank, der aus dieser Fäulnis steigt, für den „Geschmack der Welt“ verderblich ist, das heißt für jene „Welt“ aus politischen Freunden, die es immer noch gibt, selbst in Amerika. Die Worte der Kanzlerin bestätigen: auch unsere Zeit ist „aus den Fugen“. Und ihre Worte sind ein bleibendes Sinnbild für die Verantwortung der politischen Freunde, jenseits aller Grenzen und Ozeane, in Shakespeares Worten, „to set it right.“
Ich danke Ihnen allen, in Freundschaft.
Dankesrede
Es ist eine wahre Ehre für mich, heute Abend hier im Bremen Rathaus zu sein. Mein aufrichtiger Dank gilt dem Senat der Hansestadt Bremen und der Heinrich Böll Stiftung
Ich möchte auch sagen, wie sehr es mir eine Ehre ist, zusammen mit meinem Freund Jerry Kohn diese Auszeichnung zu erhalten.
In der folgenden Rede werden Intellektuelle und Experten kritisiert. Dies ist unglücklich in einer Zeit, in der so viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beschlossen haben, professionelle Anti-Intellektuelle zu werden. Ich bin nicht hier, um mich mit Anti-Intellektuellen zu verbünden. Und ich möchte daran erinnern, dass Hannah Arendt Benjamin Constant zitierte, bevor sie Karl Marx kritisierte: „Gewiss will ich die Gesellschaft von Kritikern eines großen Mannes vermeiden. Wenn ich zufällig in einem einzigen Punkt mit ihnen übereinstimme, wird mein Misstrauen gegenüber mir selbst wachsen; ich empfinde, dass ich diese falschen Freunde ablehnen und so weit, wie ich das kann, von mir fernhalten muss.“
Hannah Arendt äußerte tiefen Verdacht gegen Intellektuelle und Philosophen. In ihrem Buch über Rahel Varnhagen argumentierte Arendt, dass Varnhagens großer Fehler darin bestand, zu viel zu denken, aus der Realität in die Selbstbeobachtung zu entfliehen. Angesichts der harten Realität einer Welt, in der sie gewöhnlich, jüdisch und damit kaum ein Mensch war, hatte Rahel ein Mittel, dem zu entfliehen: Beim Denken konnte sie sich von einer unbedeutenden Jüdin in jemanden verwandeln, die ein Schicksal von besonderer Bedeutung auslebt. Das Denken war eine Rebellion gegen die Grausamkeiten der weltlichen Realität
Arendt nennt Denken einen Wahn, eine „Manie“, insofern als sie jemanden aus der realen Welt des gesunden Menschenverstands vertreiben kann. Wenn sie über diejenigen, die sich den Nazis in Deutschland widersetzten, argumentiert sie, dass Bildung und intellektuelle Leistung nicht mit Widerstand in Beziehung stehen. Intellektuelle, so befürchtete sie, würden ihre Denkfähigkeit eher dafür nutzen, Komplizenschaft oder Schweigen zu rationalisieren.
Es ist erstaunlich zu sehen, dass Arendt, die einmal gesagt hat, dass das Denken vielleicht die einzige Aktivität sei, die uns gegen böses Handeln immunisiert, auf Denken auch als Manie Bezug nimmt. Allerdings hatte Arendt immer gesagt, dass Denken gefährlich ist: Besonders gefährlich ist „das stetig wachsende Ansehen wissenschaftlich orientierter Braintrusts in den Regierungen“. Diese intellektuellen Akteure sind immer „versucht, ihre Realität – die ja von Anfang an menschengemacht ist und somit auch hätte anders sein können – an ihre Theorie anzupassen, wodurch sie mental der sie beunruhigenden Zufälligkeit entkommen konnten.“ Die großen Gefahren, die Intellektuelle für die Welt darstellen, bestehen daher, dass sie einzigartig in der Kunst ausgebildet sind, die Fakten zu leugnen, die unsere gemeinsame Welt ausmachen.
Am direktesten hatte sich Arendt mit der Gefahr, die von Intellektuellen ausgeht, in ihren Essays über den Vietnamkrieg befasst. Als sie 1971 die Pentagon-Papiere las, sah Arendt, dass „das grundlegende Problem, das durch die Papiere aufgeworfen wurde, Täuschung war“. Alle möglichen Lügen machten den amerikanischen Krieg in Vietnam möglich, einschließlich trügerischer Zahlen getöteter Menschen, verfälschter Schadensberichte und falscher Fortschrittsberichte. Und doch ignoriert die Empörung über die Lügen, Arendt zufolge, eine weitere grundlegende Tatsache, nämlich, dass „Wahrhaftigkeit nie zu den politischen Tugenden gezählt wurde“. Um die Welt zu verändern, muss sich die Politikerin die Welt anders vorstellen als sie ist; sie muss in „der bewussten Leugnung der faktischen Wahrheit – der Fähigkeit zu lügen“ – geschult werden.
Arendt identifiziert zwei Arten von Lügen. Die erste ist die bewusste Fälschung in Gestalt der „massenhaften Manipulation von Fakten und Meinungen“. Ein Jahrhundert moderner Propaganda hat gezeigt, wie leicht wir Fakten löschen oder ändern können.
Die zweite gefährliche Art der Lüge kommt von den Intellektuellen im „Regierungsapparat“. Diese intellektuellen Bürokraten fühlen sich in Konzepten und Theorien zu Hause. Sie sind ungewöhnlich fähig darin, selbst an ihre hypothetischen Schöpfungen über und gegen die reale und tatsächliche Welt zu glauben. Das Problem der in Konzepten denkenden Intellektuellen ist, dass sie eine unheimliche Fähigkeit besitzen, Fakten zu leugnen.
Ich erwähne Arendts Überlegungen über die absichtliche Lüge und die Fantasien der Intellektuellen in der Regierung in einem Moment, in dem beides in Verfahrungen zur Amtsenthebung des Präsidenten in den Vereinigten Staaten zu betrachten ist. Bei den Anhörungen geht es um Lügen und Korruption. Der Präsident autorisierte einen nicht amtsgemäßen Kommunikationskanal, militärische Hilfe für den ukrainischen Präsidenten Zelensky davon abhängig zu machen, dass gegen den politischen Rivalen des Präsidenten ermittelt wird. Erst nachdem ein Whistleblower auf ein vermutliches Fehlverhalten hingewiesen hatte, gab der Präsident die vom Kongress genehmigte Militärhilfe frei.
Bei den Anhörungen geht es auch um Täuschung in Form der Massenlüge. Fiona Hill, die führende Expertin des Weißen Hauses für Russland, die bei den Anhörungen aussagte, warnte den Kongress davor, die „fiktive Erzählung“ zu wiederholen, die Ukraine habe bei den Präsidentschaftswahlen 2016 eingegriffen, denn dies würde Wladimir Putin in die Hände spielen.
Die Ernsthaftigkeit der Beamten kontrastiert mit der Täuschung des Präsidenten. Zehn der zwölf Zeugen stammten aus der professionellen außenpolitischen Bürokratie. Sie bezeugten ihr starkes und oft tief empfundenes Engagement für die Ideologie professioneller Unpartei lichkeit. Dr. Fiona Hill betonte, dass sie „heute als Zeugin für Tatsachen auftauche“. Sie spricht von ihrem Stolz, „eine unparteiische Außenpolitikerin“ zu sein. Und sie fügte hinzu: „Ich habe kein Interesse daran, das Ergebnis Ihrer Untersuchung in eine bestimmte Richtung zu lenken, außer in Richtung der Wahrheit.“
William B. Taylor Jr., der führende amerikanische Diplomat in der Ukraine, sprach von demselben vernünftigen Ziel: „Ich bin nicht hier, um die eine oder andere Seite zu wählen oder für ein bestimmtes Ergebnis einzutreten. Mein einziger Zweck ist es, Fakten zu liefern.“ Gefragt, ob die Tätigkeiten des Präsidenten eine Anklage rechtfertigen, sagte er, dass ein Urteil darüber allein dem Kongress zustehe und über seine eigene Rolle als Tatsachenzeuge hinausreiche.
Für viele, die das Amtsenthebungsverfahren unterstützen, waren die Beamten, die aussagten, unbesungene Helden. Michelle Cottle in der NY Times schrieb: „Mr. Trump scheint etwas erreicht zu haben, das niemand für möglich gehalten hat: Er hat Beamte sexy gemacht.“
Ich weinte, als Oberstleutnant Alexander Vindman, der führende ukrainische Experte für den Nationalen Sicherheitsrat, seinem Vater dafür dankte, dass er alles riskiert hatte, um seine Familie in ein Land zu bringen, in dem Vindman frei und sicher gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten aussagen konnte, ohne Gefahr zu laufen, inhaftiert zu werden oder Schlimmeres zu gegenwärtigen. Vindman sagte: „Dad, meine heutige Sitzung hier, im US-Kapitol, ist der Beweis dafür, dass du vor vierzig Jahren die richtige Entscheidung getroffen hast, die Sowjetunion zu verlassen und hierher in die Vereinigten Staaten von Amerika zu kommen. Mach dir keine Sorgen. Mir wird es gut gehen, wenn ich die Wahrheit sage.“
Die Vorstellung, dass die Ernsthaftigkeit der öffentlich Beamteten der lügenden Täuschung des Präsidenten entgegensteht, ist beruhigend.
Aber bei aller inspirierenden Rede von heldenhafter Überparteilichkeit veranschaulichen Hill, Vindman und Taylor auch das, was Arendt provokativ die „Kunst des Lügens“ von „professionellen“ Problemlösern nennt . Denn neben der Aussage über die Tatsachen dessen, was der Präsident getan hat, haben alle drei auch ausführlich über die Notwendigkeit militärischer Hilfe für die Ukraine Zeugnis abgelegt. Die Hilfe, so sagten sie, sei unerlässlich, um die Demokratie zu unterstützen und der russischen Aggression entgegenzuwirken. Sie sprachen mit der moralischen und intellektuellen Autorität von Experten und Technokraten. Aber ihre Schlussfolgerungen sind, wie Arendt in einem anderen Kontext feststellt, eben keine Fakten, sondern Hypothesen.
Es ist natürlich möglich, dass Militärhilfe der Demokratie in der Ukraine hilft, aber sie könnte auch zur Militarisierung der Ukraine, zu Tausenden von unnötigen Todesfällen, zu einem langwierigen Krieg und zur Untergrabung der Demokratie führen. Es kann kaum eine Tatsache genannt werden, dass militärische Hilfe entweder der Ukraine oder den Vereinigten Staaten Vorteile bringt.
Vietnam zeigte, dass die Vereinigten Staaten einen jahrzehntelangen Krieg mit Befriedungs- und Umsiedlungsprogrammen, Entlaubung, Napalm und Antipersonenkugeln führen konnten, alles im Namen der Sicherung von Demokratie in Vietnam und der Welt und gleichzeitig, um kommunistische Aggressionen zu verhindern. Eine Lektion, die Arendt lernte, war die Erkenntnis, wie einfach es für Problemlöser und Technokraten ist, geopolitische Theorien zu beschwören, die militärische Intervention rechtfertigen. Allzu leicht, so Arendt, kann man von einer Hypothese, wie der sog. Dominotheorie, zu der als Tatsache ausgegebenen Auffassung kommen, dass wir einen Krieg führen müssten, um Vietnam zu retten.
Arendt kommt mit Blick auf die „Intellektuellen“, die den Krieg rechtfertigten, zu der Schlussfolgerung: „Sie brauchten keine Fakten, keine Informationen; sie hatten eine ‚Theorie‘, und alle Daten, die nicht passten, wurden verleugnet oder ignoriert ... Defaktualisierung und Problemlösung wurden begrüßt, weil die Missachtung der Realität den politischen Konzepten und Zielen selbst innewohnte“.
Ich wende mich hier Arendt zu, um zu zeigen, dass es eine Tendenz unter Intellektuellen in der Regierung gibt - Arendt nennt sie „Problemlöser“ –, „zu glauben, dass wir Ereignisse verstünden und Kontrolle über sie hätten, die wir aber nicht haben.“ Für Arendt führt dieses Vertrauen zu einer falschen Gewissheit; es ist eine Art Lüge.
Wir müssen Arendts Warnung vor der Gefahr, die Intellektuelle für die demokratische Regierung darstellen, ernst nehmen. Nach mehr als fünf Jahrzehnten zunehmend technokratischer Herrschaft durch Eliten erleben wir eine Rebellion der Öffentlichkeit gegen das Regieren durch Eliten. Die Vorurteile der elitär-liberaldemokratischen Politik – Demokratie heißt Elite, Liberalismus und Individualismus – werden gestört. Das technokratische Vorurteil der Elitepolitik ist nicht mehr sinnhaft und umsetzbar.
Arendt hilft uns, den Kontext für die Anhörungen zum Amtsenthebungsverfahren zu verstehen: den Verdacht, das Misstrauen, das viele gegen elitäre Herrschaft durch einen professionellen öffentlichen Dienst und studierte Eliten hegen. Eliten waren niemals freundlich zu Demokratien. Im Gegenteil, die zivilisatorischen Forderungen von Intellektuellen sind den demokratischen Traditionen im Allgemeinen entgegengesetzt.
Wie Alexis de Tocqueville bemerkte, fällt es einer zivilisierten Gesellschaft schwer, die Versuche zur Freiheit selbstregierter Stadtgemeinden zu tolerieren. Tocqueville sah den Geist der Vereinigten Staaten in Townships, die von Bauern, Lehrern und Ladenbesitzern regiert werden. Solche Gemeindeselbstregierung beinhaltet „gröbere Elemente“, die sich der gebildeten Meinung der Experten und Elitepolitiker widersetzen. Deshalb wird die Gemeindefreiheit in der Regel einer aufgeklärten Regierung geopfert.
Arendt sorgt sich um die Verwandlung der Intellektuellen von einer „marginalen sozialen Gruppe“ zu einer „neuen Elite, deren Arbeit, die die Bedingungen des menschlichen Lebens in einigen Jahrzehnten fast bis zur Unkenntlichkeit verändert hat, für das Funktionieren der Gesellschaft unerlässlich geworden ist. Intellektuelle sind ‚die wirklich neue und potenziell revolutionäre Klasse in der Gesellschaft‘.“ Es gibt, so Arendt weiter, allen Grund zu befürchten, dass die Macht der Intellektuellen in unserer Gesellschaft „sehr groß, vielleicht zu groß für das Wohl der Menschheit ist.“
Die Herrschaft der Intellektuellen entspricht der Zentralisierung der Macht und dem Aufstieg eines Verwaltungsstaates. Intellektuelle gewinnen an Macht, wenn die Länder stärker zentralisiert und verwaltungsbedürftig werden. In großen Ländern erleben wir eine Desintegration der öffentlichen Dienste - Schulen, Polizei, Müllabfuhr, sauberes Wasser und Luft gelten als „die automatischen Ergebnisse der Bedürfnisse von Massengesellschaften, die unkontrollierbar geworden sind“. All dies führt zu einem „wachsenden, weltweiten Groll gegen die ‚Größe‘ als solche“, ebenso wie gegen den Intellektuelle und Technokraten, die immer wieder versprechen, diese Größe der zentralisierten Regierungen zu zähmen und zu verwalten.
Die Herrschaft der Intellektuellen „führt dazu, dass alle authentischen Machtquellen im Land versiegen oder versickern“. Wenn den Menschen gesagt wird, dass die Gesellschaft zu komplex sei, um von irgendeinem außer von Experten regiert zu werden, werden sie entmachtet. Das Ergebnis sind Feindseligkeiten und Ressentiments gegen Intellektuelle, die durchaus „alle mörderischen Eigenschaften eines rassischen Antagonismus beherbergen“ können.
Angesichts einer solchen Gefahr durch eine zahlenmäßig überlegene Klasse von Nicht-Intellektuellen geht Arendt davon aus, dass die „Gefahr von Demagogen, von Volksführern, so groß werden wird, dass sich die Meritokratie zu Tyrannei und Despotie gezwungen sieht.“ Es besteht, so sieht sie es, die Gefahr eines gesellschaftlichen Krieges zwischen Experten und der einfachen Leute. Und sie fügt prophetisch hinzu, dass Ressentiments gegen Intellektuelle und Technokraten die Ursache für zunehmende Gewalt und erneuerten ethnischen Nationalismus sind.
Arendts Antwort auf den Verlust der Eliten-Autorität ist nicht, dieselbe Autorität der Elite wiederherzustellen. Die Gefahr von Eliten in der Regierung besteht darin, dass sie vorgeben, Wissen und Wahrheit zu haben, die sie nicht besitzen. Wir müssen uns mit der Tatsache versöhnen, dass es bei der Politik nicht um Wahrheit geht und dass technokratische Eliten keinen politischen Vorteil gegenüber Nicht-Eliten haben. Arendt lässt uns der Tatsache ins Auge sehen, dass Pluralität bedeutet, dass alle Meinungen in der Politik gleich sind.
Für Arendt geht es in der Politik nicht um Wahrheit. Deshalb drängt sie warnend darauf, dass die Ansprüche des Experten von jener der Politik getrennt werden sollten. Ein Klimawissenschaftler kann die Fakten und Theorien über unseren wärmer werdenden Planeten verstehen. Aber für Arendt hat ein Wissenschaftler keinen besseren Anspruch auf ein Urteil darüber, wie man auf den Klimawandel reagiert, als ein Baseballspieler oder ein Hausmeister. Die Wissenschaftler sind insofern wichtig, als er die Fakten feststellen, dass sich der Planet erwärmt. Aber in Fragen demokratischer Politik sollten Experten kein besonderes Ansehen genießen.
Ich möchte mit dem Gedanken abschließen, dass die Geisteswissenschaften eine Antwort auf die Gefahr und den Verlust der politischen Autorität der Elite sind. In den Geisteswissenschaften geht es darum, Geschichten, die wir für schön und gerecht und gut halten, zusammenzuflicken und aus diesen Geschichten eine gemeinsame Welt zu machen. Es spielt an sich keine Rolle, ob die Welt, von der wir erzählen, wahr ist, was auch immer die Wahrheit bedeuten würde. Die Geschichten, die wir erzählen, machen unsere Welt bedeutungsvoll, machen sie zu einer Welt, die wir mit unseren Freunden, Landsleuten und der ganzen Menschheit teilen. Die Geisteswissenschaften sind die gemeinsame Geschichte unseres menschlichen Aufenthalts auf dieser Welt.
Die Geisteswissenschaften als Praxis halten eine Tradition zusammen. Indem wir alte Texte, die Teil einer gebrochenen Tradition sind, auf neue Weise interpretieren und über sie miteinander sprechen, finden wir neue Bedeutungen und neue Geschichten, die unsere gemeinsame Welt bewahren und neu gestalten.
Die Geisteswissenschaften sind wichtig, lehrt Arendt, denn durch die Geisteswissenschaften bestätigen und sagen wir, was wir gemeinsam haben und was ist.
Zu sagen, „was ist“, heißt nicht, zu sagen „was wahr ist“. Die Geisteswissenschaften streben keine Objektivität an. Aber wenn die Geisteswissenschaften sagen, was ist, um dem, was wir alle teilen, Lebendigkeit zu verleihen, bestätigen sie unsere gemeinsame menschliche Welt. Sie tragen dazu bei, das zu schaffen und zu sichern, was Arendt, den überragenden Himmel und den Boden nennt, auf dem wir stehen. Im Gegensatz zu Experten, die darauf bestehen, den besten Weg in die Zukunft zu kennen, versucht der Geisteswissenschaftler, immer wieder die Brillanz dessen wiederherzustellen, war und was es. Auf diese Weise sind die Geisteswissenschaften unsere größte Waffe im Kampf gegen Defaktualisierung und Täuschung, die unsere Welt zu ruinieren droht.
Wenn Hannah Arendt heute etwas in unserer Welt bedeutet, so ist es, dass das, was die Politik heute so dringend braucht, nicht nur der Experte, sondern auch der Geisteswissenschaftler ist.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
© Hannah Arendt-Verein für politisches Denken e.V.
Impressum und Datenschutz